Komplexe Dynamische Evaluation (KDE): Ein Instrument zur Optimierung des universitären Fremdsprachenunterrichts
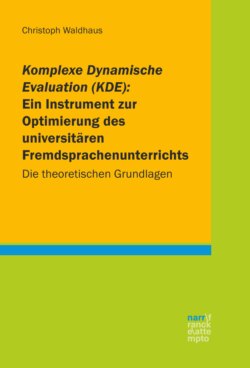
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Christoph Waldhaus. Komplexe Dynamische Evaluation (KDE): Ein Instrument zur Optimierung des universitären Fremdsprachenunterrichts
Inhalt
Geleitwort
Vorwort
Danksagung
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Evaluationsstandards
1.2.1 Inhalte der Evaluationsstandards
1.2.2 Evaluationsstandards im Detail
1.3 Optimierungspotential bei Evaluationsmodellen
1.4 Zielsetzung des vorliegenden Buches
1.5 Forschungsdesign
1.5.1 Ableitung der Forschungsfragen
1.5.2 Beantwortung der Forschungsfragen
1.5.3 Gliederung und Aufbau des Buches
2 Qualität, Evaluation, Hochschule
2.1 Dynamik von Qualität und Evaluation
2.1.1 Bildung als Ware und Lehre als Dienstleistung
2.1.2 Normen, Zertifizierungen, Ratings
2.1.3 QM-Begriffe im Hochschulkontext
2.1.4 Zwischenresümee
2.2 Qualitätsoptimierende Maßnahmen an Hochschulen
2.3 Zentrale Maßnahmen im Detail
2.3.1 Standards und Leitlinien (ESG)
2.3.1.1 ESG für interne Qualitätssicherung
2.3.1.1.1 Strategie für die Qualitätssicherung
2.3.1.1.2 Gestaltung und Genehmigung von Studiengängen
2.3.1.1.3 Studierendenzentriertes Lernen, Lehren und Prüfen
2.3.1.1.4 Zulassung, Studienverlauf, Anerkennung und Abschluss
2.3.1.1.5 Lehrende
2.3.1.1.6 Lernumgebung
2.3.1.1.7 Informationsmanagement
2.3.1.1.8 Fortlaufende Beobachtung und Überprüfung der Studiengänge
2.3.1.2 Fazit
2.3.2 Methoden aus dem Qualitätsmanagement
2.3.2.1 Benchmarking
2.3.2.2 Audit
2.3.2.3 Akkreditierung und Zertifizierung
2.3.2.4 Evaluation
2.4 Zusammenfassung
3 Evaluation und Fremdsprachenunterricht
3.1 Der Begriff »Evaluation«
3.1.1 Drei Referenzebenen von Evaluation
3.1.2 Unterschiedliche Kontexte von Evaluation
3.2 Abgrenzung zu anderen Begriffen
3.2.1 Evaluation vs. Evaluationsforschung, Programmevaluation und Evaluierung
3.2.2 Evaluation vs. Lehrveranstaltungsevaluation, Evaluation der Lehre, Lehrevaluation, Feedback und Rückmeldung
3.2.3 Evaluation vs. Qualitätsmanagement
3.2.3.1 Gemeinsamkeiten
3.2.3.2 Unterschiede
3.2.4 Evaluations- vs. Grundlagenforschung
3.2.5 Allgemeinsprachliche vs. wissenschaftliche Evaluation
3.2.5.1 Kennzeichen wissenschaftlicher Evaluation
3.2.5.2 Kriterien wissenschaftlicher Evaluation
3.3 Evaluationsmodelle
3.3.1 Allgemeine Evaluationsmodelle
3.3.2 Lehrveranstaltungsbezogene Modelle
3.3.2.1 Lernzielgesteuerte Evaluation
3.3.2.1.1 Ziele
3.3.2.1.2 Annahmen bzw. Voraussetzungen
3.3.2.1.3 Anwendung auf den Fremdsprachenunterricht
3.3.2.1.4 Methode
3.3.2.1.5 Umsetzung im Fremdsprachenunterricht
3.3.2.1.6 Fazit
3.3.2.2 Entscheidungsgesteuerte Evaluation
3.3.2.2.1 Ziele
3.3.2.2.2 Anwendung auf den Fremdsprachenunterricht
3.3.2.2.3 Methode
3.3.2.2.4 Unterschiedliche Entscheidungssituationen
3.3.2.2.5 Kontextevaluation
3.3.2.2.6 Inputevaluation
3.3.2.2.7 Prozessevaluation
3.3.2.2.8 Produktevaluation
3.3.2.2.9 Fazit
3.3.2.3 Nutzenorientierte Evaluation
3.3.2.3.1 Ziele
3.3.2.3.2 Überlegungen und Forderungen
3.3.2.3.3 Anwendung auf den Fremdsprachenunterricht
3.3.2.3.4 Weitere Überlegungen
3.3.2.3.5 Fazit
3.3.2.4 Kennerschaftsgesteuerte Evaluation
3.3.2.4.1 Selbstevaluation
3.3.2.4.2 Peer-Evaluation
3.3.2.4.3 Fazit
3.3.2.5 Beteiligteninteressengesteuerte Evaluation
3.3.2.5.1 Responsive Evaluation
3.3.2.5.2 Naturalistische Evaluation
3.3.2.5.3 Fallstudien
3.3.2.6 Qualitätsentwickelnde Evaluation
3.3.3 Evaluationsmodelle als Basis für die KDE
3.4 Anforderungen an ein umfassendes und wirkungsvolles Evaluationsmodell
3.5 Zusammenfassung
4 Qualität und QM im universitären Fremdsprachenunterricht
4.1 Der Begriff »Qualität«
4.1.1 Blicke auf Qualität
4.1.1.1 Qualität aus historisch-philosophischer Sicht
4.1.1.2 Qualität ist komplex und dynamisch
4.1.1.3 Qualität in der Allgemeinsprache
4.1.1.4 Qualität als Fachbegriff (Normbegriff) des QM
4.1.2 Unterschiedliche Qualitätsdimensionen
4.1.2.1 Qualität ersten Grades, Qualität zweiten Grades
4.1.2.1.1 Anwendung auf den Fremdsprachenunterricht
4.1.2.1.2 Fazit und Umsetzung durch die KDE
4.1.2.2 Planungs-, Prozess-, Produkt-, Ergebnisqualität
4.1.2.2.1 Anwendung auf den Fremdsprachenunterricht
4.1.2.2.2 Fazit und Umsetzung durch die KDE
4.1.2.3 Struktur-, Prozess-, Orientierungs-, Ergebnisqualität
4.1.2.3.1 Anwendung auf den Fremdsprachenunterricht
4.1.2.3.2 Fazit und Umsetzung durch die KDE
4.2 Qualität im Fremdsprachenunterricht
4.3 TQM im Fremdsprachenunterricht
4.3.1 Bedeutung von TQM. 4.3.1.1 »T« für »Total«
4.3.1.2 »Q« für »Qualität«
4.3.1.3 »M« für »Management«
4.3.2 Universität und TQM
4.3.3 Elemente des TQM
4.3.3.1 KundInnenorientierung
4.3.3.1.1 KundInnenorientierung im Unterricht
4.3.3.1.2 KundInnenzufriedenheit im Unterricht
4.3.3.1.3 Erfüllung interner KundInnenanforderungen
4.3.3.2 MitarbeiterInnenorientierung
4.3.3.2.1 MitarbeiterInnenorientierung im Unterricht
4.3.3.3 Prozessorientierung
4.3.3.3.1 Prozessorientierung im Unterricht
4.4 Qualitätsverbesserung
4.4.1 Verbesserung vs. Optimierung
4.4.2 Verbesserung im Unterricht
4.5 KAIZEN
4.5.1 Grundannahme und Zielsetzung. 4.5.1.1 Grundannahme
4.5.1.2 Zielsetzung
4.5.2 Axiome
4.5.2.1 Problemorientierung
4.5.2.2 KundInnenorientierung
4.5.2.3 Prozessorientierung
4.5.2.4 MitarbeiterInnenorientierung
4.5.3 KAIZEN und Verbesserung
4.5.3.1 Deming-Rad
4.5.3.2 KAIZEN und Verbesserungsvorschläge
4.5.3.3 KAIZEN und Standards
4.5.4 Prozessorientierung, Produktorientierung
4.5.5 KAIZEN in der Praxis
4.5.6 KAIZEN im Unterricht
4.5.7 Fazit
4.6 Zusammenfassung
5 Komplexe Dynamiken beim Lehren, Lernen und Evaluieren
5.1 Lernen und Lehren an Hochschulen
5.1.1 Didaktisches Dreieck und shift from teaching to learning
5.1.1.1 Aufgaben und Kompetenzen von Lehrenden
5.1.1.2 Lehrkompetenzoptimierung durch KDE
5.1.2 Faktoren im Fremdsprachenunterricht
5.1.3 Evaluation »neu«
5.2 CDST und Fremdsprachenunterricht
5.2.1 Grundbegriffe der CDST
5.2.1.1 Der Begriff »System«
5.2.1.2 Objektivität und Subjektivität von Systemen
5.2.1.3 Zusammenhänge und Abgrenzungen
5.2.2 Komplexe dynamische Systeme
5.2.2.1 Der Faktor »Zeit«
5.2.2.2 System und Umwelt
5.2.2.3 Offenheit der Systeme
5.2.2.4 Nichtlinearität
5.2.2.5 CDST – Wozu genau?
5.2.3 Funktionsweise von Systemen
5.2.3.1 Attraktor
5.2.3.2 Repellor
5.2.3.3 Kontrollparameter
5.2.3.4 Rückkopplung, Iteration, Feedback
5.2.3.4.1 Positive Rückkopplung
5.2.3.4.2 Negative Rückkopplung
5.2.3.4.3 Gemischtes Feedback
5.2.4 Anwendung der CDST im Unterricht
5.2.5 Evaluation im komplexen dynamischen Fremdsprachenunterricht
5.2.6 Erfassen der Dynamiken durch die KDE
5.3 Sprachentwicklung im komplexen dynamischen Unterricht
5.3.1 Wachstum und Ressourcen
5.3.1.1 Wachstum
5.3.1.2 Ressourcen
5.3.2 Haupteigenschaften von Ressourcen
5.3.2.1 Interne und externe Ressourcen
5.3.2.2 Limitierte Ressourcen
5.3.1.3 Ressourcen und Wachstum im Unterricht
5.4 Zusammenfassung
6 KDE im Fremdsprachenunterricht
6.1 Sammeln und Auswerten von Daten
6.1.1 Grundfragen beim Evaluieren
6.1.1.1 Grundfragen vor der Evaluation
6.1.1.1.1 Wer oder was soll evaluiert werden?
6.1.1.1.2 Wann soll evaluiert werden?
6.1.1.1.3 Wo ist die Evaluation angesiedelt?
6.1.1.1.4 Wozu soll evaluiert werden?
6.1.1.1.5 Für wen soll evaluiert werden?
6.1.1.1.6 Anhand welcher Kriterien soll evaluiert werden?
6.1.1.1.7 Von wem soll evaluiert werden?
6.1.1.1.8 Wie soll evaluiert werden?
6.1.1.1.9 Womit soll evaluiert werden?
6.1.1.2 Grundfragen nach der Evaluation
6.1.1.3 Grundintention der KDE
6.1.2 Didaktisch-methodische Grundfragen
6.1.2.1 Grundfragen aus Studierendensicht
6.1.2.2 Grundfragen aus Lehrendensicht
6.1.2.3 Beantwortung der Grundfragen
6.2 KDE im Detail
6.2.1 Form und Aufbau der KDE
6.2.2 Rahmen und Kontext der KDE
6.2.3 Funktionsweise der KDE
6.2.3.1 Vorevaluation
6.2.3.2 Begleitende Evaluation
6.2.3.3 Endevaluation
6.2.3.4 Selektive Evaluation
6.2.4 Aufbau der Fragebögen der KDE
6.3 Lehrerfolg und Lernerfolg im komplexen dynamischen FSU
6.3.1 Das Multifaktorielle Modell der LV-Qualität
6.3.2 Lehrende als komplexe dynamische Systeme
6.3.1.1 Einflussfaktoren von Lehrendenseite
6.3.1.1.1 Strukturiertheit/Klarheit
6.3.1.1.2 Breite/Auseinandersetzung
6.3.1.1.3 Verarbeitungstiefe
6.3.1.1.4 Lehrkompetenz
6.3.1.1.5 Engagement/Motivierung
6.3.1.1.6 Kooperativität/Klima
6.3.1.1.7 Interaktion (Förderung, Leitung)
6.3.1.1.8 Betreuung/Feedback
6.3.1.1.9 Wissenschaftliche Fachkompetenz
6.3.3 LernerInnen als komplexe dynamische Systeme
6.3.3.1 Einflussfaktoren von Studierendenseite
6.3.3.1.1 Vorwissen
6.3.3.1.2 Fähigkeiten
6.3.3.1.3 Vorinteresse
6.3.3.1.4 Fleiß/Arbeitshaltung/Arbeitsbelastung
6.3.3.1.5 Beteiligung
6.3.3.1.6 Referate
6.3.3.1.7 Störungen
6.3.3.1.8 Fehlzeiten
6.3.4 Rahmenbedingungen als komplexe dynamische Systeme
6.3.4.1 Einflussfaktoren durch Rahmenbedingungen
6.3.4.1.1 Thema
6.3.4.1.2 Überschneidungen
6.3.4.1.3 Anforderungen
6.3.4.1.4 Besuchszahl
6.3.4.1.5 Prüfung
6.3.4.1.6 Besuchsgrund
6.3.4.1.7 Veranstaltungstyp
6.3.5 Lehr- bzw. Lernerfolg als komplexes dynamisches System
6.3.5.1 Zielgröße Lehr-/Lernerfolg
6.3.5.1.1 Interessantheit der Veranstaltungsgestaltung
6.3.5.1.2 Allgemeine Veranstaltungsqualität
6.3.5.1.3 Lerngewinn (quantitativ/qualitativ)
6.3.5.1.4 Einstellungsänderungen
6.3.5.1.5 Kompetenzenerwerb
6.3.6 Fazit und Einbindung in die KDE
6.3.6.1 Dimensionen zur Itemsgenerierung
6.3.6.1.1 Strukturierung/Klarheit
6.3.6.1.2 Breite/Auseinandersetzung (Praxis)
6.3.6.1.3 Verarbeitungstiefe
6.3.6.1.4 Lehrkompetenz
6.3.6.1.5 Engagement/Motivierung
6.3.6.1.6 Kooperativität/Klima
6.3.6.1.7 Interaktion (Förderung/Leitung)
6.3.6.1.8 Betreuung/Feedback
6.3.6.1.9 Wissenschaftliche Fachkompetenz
6.3.6.1.10 Vorwissen
6.3.6.1.11 Fähigkeiten
6.3.6.1.12 Vorinteresse
6.3.6.1.13 Fleiß, Arbeitshaltung, Arbeitsbelastung
6.3.6.1.14 Beteiligung
6.3.6.1.15 Referate
6.3.6.1.16 Störungen
6.3.6.1.17 Fehlzeiten
6.3.6.1.18 Thema
6.3.6.1.19 Überschneidungen
6.3.6.1.20 Anforderungen
6.3.6.1.21 Besuchszahl
6.3.6.1.22 Prüfung
6.3.6.1.23 Besuchsgrund
6.3.6.1.24 Interessantheit
6.3.6.1.25 Allgemeine Veranstaltungsqualität
6.3.6.1.26 Lerngewinn
6.3.6.1.27 Einstellungsänderungen
6.3.6.1.28 Kompetenzenerwerb
6.4 Beantwortung der Forschungsfragen
7 Resümee und Ausblick
7.1 Resümee
7.2 Ausblick
8 Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Fußnoten. 1 Einleitung
1.2 Evaluationsstandards
1.3 Optimierungspotential bei Evaluationsmodellen
2 Qualität, Evaluation, Hochschule
2.1 Dynamik von Qualität und Evaluation
Bildung als »Ware« und Lehre als »Dienstleistung«
2.1.3 QM-Begriffe im Hochschulkontext
2.1.4 Zwischenresümee
2.2 Qualitätsoptimierende Maßnahmen an Hochschulen
2.3 Zentrale Maßnahmen im Detail
Fazit
2.3.2 Methoden aus dem Qualitätsmanagement
Benchmarking
Audit
Akkreditierung und Zertifizierung
3.1 Der Begriff »Evaluation«
3.1.1 Drei Referenzebenen von Evaluation
Unterschiede
Prozessevaluation
Überlegungen und Forderungen
Selbstevaluation
Responsive Evaluation
4.1 Der Begriff »Qualität«
Qualität als Fachbegriff (Normbegriff) des QM
Qualität ersten Grades, Qualität zweiten Grades
Struktur-, Prozess-, Orientierungs-, Ergebnisqualität
4.2 Qualität im Fremdsprachenunterricht
4.4.2 Verbesserung im Unterricht
Deming-Rad
Aufgaben und Kompetenzen von Lehrenden
5.1.2 Faktoren im Fremdsprachenunterricht
5.2 CDST und Fremdsprachenunterricht
Womit soll evaluiert werden?
6.2.4 Aufbau der Fragebögen der KDE
Kompetenzenerwerb
Отрывок из книги
Christoph Waldhaus
Komplexe Dynamische Evaluation (KDE): Ein Instrument zur Optimierung des universitären Fremdsprachenunterrichts
.....
Sämtliche dieser Forderungen decken sich auch mit Ansätzen aus dem Qualitätsmanagement, der Evaluationsforschung und der Fremdsprachendidaktik, wie in den folgenden Kapiteln noch ausgeführt wird.
In den vergangenen 15 Jahren wurden von der ENQA drei1 umfangreiche Erhebungen zum Thema qualitätssichernde Maßnahmen an europäischen Hochschulen durchgeführt. Die erste aus dem Jahr 2003 (siehe The Danish Evaluation Institute 2003) untersuchte die einzelnen Verfahren, die diesbezüglich an den Universitäten der 23 partizipierenden Länder zum Einsatz kamen und versuchte neben den Ebenen und dem Umfang auch Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede bei diesen Verfahren festzustellen. Die primären Ergebnisse dieser Befragung waren u.a., dass die unterschiedlichen Maßnahmen sowohl im Umfang als auch vom Typus seit den späten 1990er Jahren komplexer wurden, dass eine Zunahme von Qualitätssicherungsagenturen in Europa zu verzeichnen war und dass die Maßnahmen der einzelnen Länder im Wesentlichen auf den gleichen methodologischen Prinzipien aufbauen. Gleichzeitig wurde auch festgestellt, dass es mitunter nach wie vor erhebliche Unterschiede bei der Implementierung der einzelnen Methoden in den verschiedenen Ländern gab, wenngleich im Allgemeinen den Empfehlungen des Rates der Europäischen Union (Vier-Phasen-Modell) aus dem Jahr 1998 (siehe Amtsblatt L 270/59 vom 7.10.1998) Folge geleistet wird.
.....