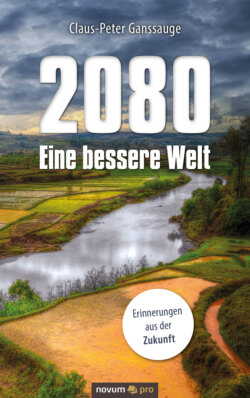Оглавление
Claus-Peter Ganssauge. 2080 - Eine bessere Welt
Impressum
Sinneswandel. Wir schreiben das Jahr 2080. Ich bin die älteste Enkelin des Buch-Autors von: „Zukunft? – Ja, wir schaffen das!“, der als Initiator des unterirdischen Fernverkehrs und Wiederentdecker der Hochgeschwindigkeits-Transrapid-Schwebebahn anstelle der umweltschädlichen Kurzstrecken-Flüge gilt. Sein wichtigstes Anliegen war, zunächst Mittel und Wege zu finden, wie man die aus dem Gleis geratene Umwelt wieder zur Normalität zurückführen könnte und was man in letzter Minute tun müsste, bevor es dafür zu spät ist. Er hatte dabei auch die Idee, die Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecken unter die Erde zu verlegen und diese Tunnelstrecken luftleer zu pumpen, wodurch ohne jeden Luftwiderstand Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 km/h erreicht werden können und dies auch noch völlig abgasfrei und ohne die Natur zu verschandeln. Nachdem diese Idee nach langen Debatten und großem finanziellen Aufwand endlich Gestalt angenommen hatte, war das der entscheidend wirksame Schlag gegen die luftverschmutzenden Kurzstrecken-Flüge, die ja heute weitgehend verboten sind, sofern sie noch mit Kerosin-Treibstoffen betrieben werden. Die Fluggesellschaften haben ihn dafür natürlich nicht sehr geschätzt. Er hatte in seinem Buch viele Anstöße gegeben, das vorhandene technische Wissen zu nutzen, um die Welt mit Hilfe der gewaltigen Sonnen-Energie vor der Vergiftung und Überhitzung zu bewahren und dabei auch noch öde Wüsten neu zu beleben. Leider ist mein Opa kurz nach dem Erscheinen seines Buches gestorben. Er durfte den Erfolg seines Werkes nicht mehr erleben. Ich will hier berichten, welche tiefgreifenden Veränderungen ich sowohl in der technischen Entwicklung, als auch im Denken und Handeln der Menschen erlebt habe und wie weit die Visionen meines Großvaters inzwischen zu Fakten geworden sind. Jetzt bin ich 80 Jahre alt und erfreue mich noch bester Gesundheit. Möglicherweise habe ich meine Gesundheit auch meinem verehrten Opa zu verdanken, der die Menschen „fünf Minuten vor Zwölf“ zusammen mit der Greta-Thunberg-Bewegung wachgerüttelt hat. Nur durch konkrete politische Maßnahmen, den sofortigen Einsatz modernster technischer Möglichkeiten und eine umweltschonende Lebensweise war die Erde noch vor der sicheren Unbewohnbarkeit zu retten. Die Durchsetzung der weltweit notwendigen, verbindlichen Gesetze und Verhaltensregeln hat allerdings Jahrzehnte gedauert – trotz deutlich spürbarer negativer Klima-Veränderungen. Die Häufung der Wetterkatastrophen und ihre Folgen waren zunächst nur allmählich spürbar, mit der Zeit wurden sie aber immer stärker für alle Erdteile zur Bedrohung. Die Einsicht, dass wir Menschen selbst durch das umweltschädliche Verhalten einer schnell anwachsenden Weltbevölkerung die Verursacher sind, erfolgte leider erst, als die Klimaveränderungen schon weit fortgeschritten waren. Dann endlich hatte die geschundene Natur auch dem letzten verbohrten Politiker klar gemacht: Wir haben die obere Grenze der Bevölkerungsdichte und auch das Ende der Resourcen-Verschwendung nicht nur erreicht, sondern bereits überschritten. Entweder verhalten wir uns ab sofort so, wie es die Natur unseres Planeten verkraften kann, oder wir gehen alle unter, nachdem wir die einst reichlich verfügbaren Rohstoffe verschwenderisch verbraucht haben und die landwirtschaftlichen Anbauflächen nicht mehr alle Menschen ausreichend ernähren können. Dann endlich einigte sich die politische Vertretung der Weltbevölkerung auf die erforderlichen Beschlüsse. Ohne die strikt einzuhaltenden Verhaltensregeln, die die UNO-Weltregierung den Menschen im Jahr 2028 verordnen musste, würde die Erde wahrscheinlich heute so aussehen, wie seinerzeit die Osterinsel, deren Lebensgrundlage die damaligen Bewohner durch ihre ungezügelte Vermehrung selbst vernichtet hatten. Ich habe in dem Buch meines Großvaters von diesem Drama gelesen, das aufgrund der heutigen Bevölkerungsdichte auf die ganze Erde übertragbar wäre. Zum besseren Verständnis all der notwendigen Einschränkungen und weltweiten Regulierungsmaßnahmen wiederhole ich hier die damaligen Beschlüsse, die ich mir aus der Zeitung ausgeschnitten hatte: Präambel: Es geht um die Bewohnbarkeit unseres Planeten Erde! Politik und Wissenschaft bekräftigen hiermit einmütig: Die Grenzen des Wachstums sind erreicht. Nur durch die strikte Einhaltung der folgenden Beschlüsse kann die Welt vor dem Untergang/der Unbewohnbarkeit gerettet werden. Mit dem Erlass zusätzlicher adäquater nationaler Gesetze wird dies auch gelingen. Wir erkennen, dass die beschlossenen Maßnahmen schmerzliche Einschnitte für die Automobilindustrie und ihre Zulieferer, die Luftfahrtindustrie nebst Zulieferern und die Luftfahrt selbst sowie für die Flughäfen bedeuten werden. In Abwägung aller hiermit verbundenen Probleme und in Abstimmung mit allen der UNO angehörenden Ländern mussten in Anbetracht des Ernstes der Lage die nachstehenden schweren Entscheidungen getroffen werden. Die gemeinsame Finanzierung der erforderlichen und weit gehenden Umstellungen und Investitionen erfolgt nach einem Quotensystem, das entsprechend der Wirtschaftskraft der einzelnen Länder ermittelt wurde
Die vorliegenden Maßnahmen wurden aus der Notwendigkeit heraus beschlossen, dass ein langfristiges Überleben der Menschheit nur noch möglich ist, wenn
Macht Euch die Erde untertan! Erste subterrestrische Reise. Dank des Erbes meines Opas konnte ich es mir leisten, schon in meinen Semesterferien mehr oder weniger ausgedehnte, aber immer besonders interessante Reisen zu unternehmen. Ich habe als junge Dozentin zum ersten Mal eine Fahrt mit dem superschnellen unterirdischen Transrapid von Hamburg nach Berlin unternommen. Das war im Jahr 2029. Meine Schwester Paula konnte mich begleiten, denn sie hatte gerade ihren ersten Urlaub von ihrem Forschungslabor bekommen, wo sie nach ihrem Chemie-Studium arbeitete. Das neue Verkehrssystem gänzlich unter der Erde war beeindruckend. Paula hatte anfangs noch ein bisschen Angst, wegen der hohen Geschwindigkeit, die unter der Erde im künstlich hergestellten luftleeren Raum erreicht wird. Auch ich hatte ein wenig Angst. Das gestehe ich heute, damals habe ich mir aber nichts anmerken lassen. Doch die nahtlos eingebauten Überwachungssensoren sorgen für absolute Sicherheit und bemerken rechtzeitig, wenn im Bereich der Strecke irgendeine Erdbewegung oder eine andere Störung stattfinden sollte. Selbst Erdbeben können heute bei den üblichen kleinen Vorbeben (aufgrund japanischer Erfahrungen) vorausberechnet werden. Der Zugbetrieb würde dann sofort angehalten. Bis heute ist jedenfalls noch kein ernsthafter Unfall passiert. Seit dieser ersten Fahrt bin ich ein Transrapid-Fan und habe schon viele tausend Kilometer unterirdisch zurückgelegt. Mein Smartphone-Tagebuch stand mir stets treu zur Seite, um über die wechselvolle Zeit meiner Unternehmungen berichten zu können. Die ersten unterirdischen Transrapid-Fahrten zwischen Flughafen Hamburg und Flughafen Berlin (BER) dauerten ca. 70 Minuten einschließlich der Wartezeiten an den beiden Hauptbahnhöfen. Heute schafft der Transrapid das in 40 Minuten, wobei der Zug die Strecke zwischen den beiden Hauptbahnhöfen in jeweils 20 Minuten bewältigt. Die erste Fahrt vom Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel bis zum Hauptbahnhof dauerte damals allein schon ca. 25 Minuten einschließlich Haltezeit. Aber am Anfang der Transrapid-Entwicklung betrug die Höchstgeschwindigkeit der Züge noch 600 km/h, während heute auf den längsten Strecken schon 1.000 km/h erreicht werden. Meine Schwester und ich fuhren zunächst mit dem ICE von Aachen nach Hamburg Hbf. und wollten von dort aus über die erste fertiggestellte unterirdische Strecke nach Berlin Hbf. „schweben“. Ein Hotelzimmer hatten wir in der Nähe gebucht. In Hamburg angekommen, hatten wir noch zehn Minuten Zeit, bis der Transrapid, der von Kopenhagen kam, ab Hamburg weiterschweben sollte. Wir mussten uns vom ICE-Bahnsteig entweder per Fahrstuhl oder über eine lange Rolltreppe in die unterste Bahnhofsebene begeben. Unten angekommen, durften wir aber noch nicht auf den Bahnsteig, sondern mussten in einem Wartesaal – wo man auch etwas essen und trinken konnte – auf die Ankunft des Zuges warten. Der kam auch auf die Minute pünktlich an – genau wie der Gegenzug aus Berlin. Erst nachdem alle Reisenden, die hier aussteigen wollten, den Zug verlassen hatten, wurde die Tür zum Bahnsteig geöffnet. Wir wussten durch die Anzeigetafel, wo der Waggon mit unseren numerierten Plätzen hielt. Einen Zug ohne Fenster hatten wir vorher noch nie gesehen. Es sah futuristisch und etwas unheimlich aus. Kaum hatten wir Platz genommen, ging es los. Zuerst mussten zwei Schleusen passiert werden, bis der Vacuum-Teil der Strecke begann. Von da an wurden wir sanft in unsere Sitze gepresst. Auf einem Anzeigenmonitor konnten wir unsere Beschleunigung ablesen: 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 550 – 600 – 630 km/h war zu lesen. Nach wenigen Minuten verminderten sich die Anzeigen, bis sie wieder bei 0 gelandet waren. Dies erfolgte etwa 30 Minuten, nachdem wir in Hamburg losgefahren waren. Wir konnten kaum glauben, dass wir unser Ziel schon erreicht hatten. Während der Fahrt konnte man auf dem Monitor zwischen den Geschwindigkeitsanzeigen Bilder der Städte und Landschaften sehen, die wir gerade unterirdisch passiert hatten. Gehört hat man auf der ganzen kurzen Fahrt nur leise Musik, die kaum wahrnehmbar von einem leisen Summen untermalt war. Dies war auch das einzige Fahrgeräusch. Also das war schon ein tolles Erlebnis – nur leider viel zu kurz. Übrigens: Wir haben auf der Fahrt und auf den beiden Transrapid-Halte-Ebenen keinen einzigen Bahnangestellten zu Gesicht bekommen. Unsere Fahrkarten mussten wir vor dem Einsteigen zwecks Kontrolle der Gültigkeit unter einen Bildschirm halten. Hätten wir keine gültige Fahrkarte gehabt, hätte uns eine Stimme aufgefordert, uns den Wegweisern nach ins Stationsbüro zu begeben. Bei Nichtbefolgung wäre unser Konto, das auf jeder Fahrkarte als Pflichtangabe vermerkt ist, mit etwa 500 Euro belastet worden. Aber das nur nebenbei. Paula und ich fuhren über Rolltreppen nach oben und mussten uns erst einmal in dem riesigen Berliner Hauptbahnhof zurechtfinden. Doch unser Smartphone, Abteilung Navi, wies uns den kürzesten Weg zu unserem Hotel. Seit meinem ersten Besuch in Berlin 2014, damals mit meinen Eltern, hatte sich schon wieder so vieles verändert. Vor dem Bahnhof standen jede Menge Taxis, die wenigsten mit Fahrern, die meisten vollautomatisch. Die sogenannten Robotaxis sind eine feine Sache. Die älteren Menschen kommen mit der Bedienung allerdings nicht so richtig klar. Die nehmen eben lieber ein Taxi mit Fahrer. Wir machten noch einen Stadtbummel und erreichten bequem zu Fuß unser Hotel. Wir wollten am Abend ein Konzert in der Philharmonie besuchen, auf das wir uns schon lange gefreut hatten. Die Karten mussten wir schon Monate vorher bestellen. Die Taxi-Fahrt dorthin war schon etwas abenteuerlich. Per Handy riefen wir die Nummer für automatische Taxen an. Fünf Minuten später meldete das Handy, dass der Wagen vor der Tür steht. Wir begaben uns zum Hotel-Ausgang und stiegen ein, nachdem sich die Wagentüren automatisch geöffnet hatten. In das aufblinkende Zahlungsgerät im Wagen schob ich meine Scheckkarte ein und gab durch das Mikrofon das Fahrziel an. Die Fahrzeugtüren schlossen sich automatisch, sobald wir Platz genommen hatten – sicher in der Absicht, dass wir nicht vor dem Bezahl-Vorgang im Freien stehen mussten. Die Berliner hatten gerade ein neues Zahlungs-Verfahren eingeführt (wahrscheinlich aufgrund schlechter Erfahrungen), damit das Taxi-Unternehmen sicher an sein Geld kommt. Bevor der Wagen losfuhr, zeigte das Gerät, in dem meine Karte steckte, den ungefähren Fahrpreis an. Auf dem Display erschien: „Zu unserer und Ihrer Sicherheit buchen wir … Euro plus zehn Prozent von Ihrem Konto ab.“ Nachdem die Bank automatisch bestätigt hatte, dass das Konto ausreichend gedeckt war, ging es los. Eine Stimme bat höflich: „Bitte anschnallen!“ Und schon reihte sich der Wagen elegant in den fließenden Verkehr ein. Wie sich dieser Wagen mit ziemlich hoher Geschwindigkeit durch den dichten Verkehr hindurchwurschtelte, war schon beeindruckend. Am Ziel angekommen, rief die bekannte Stimme wieder: „Bitte entnehmen Sie Ihre Karte. Der Fahrpreis beträgt … Euro.“ Und tatsächlich sah ich auf meinem Smartphone, dass nur der tatsächliche Fahrpreis abgebucht war. Das war alles. Den Preis habe ich inzwischen vergessen. Es war aber nicht teuer. Wohin der Wagen, nachdem wir ausgestiegen waren, anschließend fuhr, weiß ich nicht. Ich fragte mich: Was wäre passiert, wenn meine Bank die Zahlung verweigert hätte? Ganz einfach. Die Türen hätten sich wieder geöffnet, die Stimme hätte verkündert: „Bitte steigen Sie wieder aus. Es gibt ein Problem mit Ihrer Bank. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.“ Wenn wir nach zwei Minuten nicht ausgestiegen wären, hätte der Wagen die Polizei um Hilfe gerufen. Das wäre dann sehr teuer geworden, denn schließlich ist es die Aufgabe der Taxis, Personen zu befördern und nicht, nutzlos herumzustehen. Es war schon etwas gespenstisch zu erleben, wie alles ohne einen Menschen zu Gesicht zu bekommen bestens funktionierte. Eine Weile später nahmen wir auf unseren numerierten Sitzen in der Philharmonie Platz. Die schon etwas ergraute, weltberühmte Geigen-Virtuosin Anne Sophie Mutter, für die ich schon lange geschwärmt hatte, gab in Begleitung der Berliner Philharmoniker ein Konzert mit Werken von Beethoven, Mozart und Dvorák. Es war überwältingend, was diese Frau auf ihrer Geige an zauberhaften Tönen hervorbringen konnte. Ich bin sicher, wenn die drei Komponisten noch erlebt hätten, wie diese Künstlerin ihre Werke interpretiert – sie wären ihr begeistert um den Hals gefallen. Nach langanhaltendem Beifall gab sie als Zugabe noch ein für sie persönlich komponiertes Solostück von John Williams zum Besten – wohl als Beweis, dass sie die Interpretation moderner Musik ebenfalls perfekt beherrscht. Beglückt nach diesem ereignisreichen Tag sanken wir – etwas erschöpft – in unsere weichen Hotelbetten. Den nächsten Vormittag nutzten wir für einen ausgedehnten Stadtbummel. Im Gegensatz zu unserer Heimatstadt Aachen fiel uns der starke Verkehr an Luft-Taxi-Drohnen auf, die in allen Richtungen – fast lautlos – durch die Luft wirbelten. Das sah schon etwas beängstigend aus. Aber das 5G-netzgesteuerte Navigationssystem funktioniert bestens, reibungslos und schnell. Ich habe bisher nur von zwei Unfällen gehört. Die sind in Köln in der Nähe des Flughafens passiert. Die Ursache war kaum zu glauben: Alle Drohnen-Parkplätze waren besetzt. Die Drohnen fielen nach langer und vergeblicher Parkplatz-Suche schließlich vom Himmel, weil ihnen der Treibstoff ausgegangen war. Wir hatten vorher noch nie ein Lufttaxi benutzt. Bei unserem Stadtbummel hatten wir eine Werbung für „Berlin von oben“ bemerkt, die uns neugierig gemacht hat. Per Drohnen-Lufttaxi wurden Rundflüge angeboten für eine oder zwei Stunden Flugdauer. Der Preis war nicht gerade niedrig, aber das wollten wir als Abschluss unserer Kurzreise am nächsten Vormittag noch ausprobieren. Ich bestellte per Smarty/Handy für zehn Uhr unter der angegebenen Nummer ein Lufttaxi zum Hotel für einen einstündigen Rundflug. Ziemlich pünktlich landete die Drohne für maximal sechs Personen auf dem Dach unseres Hotels. Die finanzielle Abwicklung lief genau so ab wie bei unserer gestrigen Taxifahrt. Und gleich danach waren wir bei schönstem Wetter in der Luft über Berlin. Während des vollautomatischen Fluges erklärte uns eine angenehme Frauenstimme, was wir unter uns aus etwa 200 bis 400 Metern Höhe zu sehen bekamen. Die Details habe ich inzwischen vergessen, aber Regierungsviertel, Wannsee und Müggelsee, Spree und Havel waren natürlich dabei. Um den Funkturm sind wir in Augenhöhe herumgeflogen, auch um den Fernsehturm und dabei konnten wir den Besuchern der Kuppel zuwinken. Nach genau einer Stunde landeten wir wieder auf dem Dach unseres Hotels. An der raffinierten Technik der Lufttaxis fiel mir noch auf, dass man als Fahrgast absolut nicht auf den automatischen Ablauf des integrierten Software-Programms angewiesen ist. Durch ein Drücken auf einen gut gekennzeichneten Knopf hätte ich Kontakt mit der Zentrale aufnehmen können, z. B. um die Fahrt abzubrechen, oder.wenn ich das Schaukeln in der Luft nicht vertragen hätte. Das war schon 2029 eine perfekte Konstruktion. Wir beendeten unsere Berlinreise natürlich wieder per Transrapid auf der Strecke Berlin-Hamburg. Am späten Abend waren wir wieder zu Hause. Die Fahrt von Hamburg nach Köln dauerte auf unserer Reise an reiner Fahrzeit am längsten, obwohl die ICEs schon wieder mit 250 km/h dahinbrausten, aber wie früher leider schon immer, musste man in Köln umsteigen, um nach Aachen zu kommen. Aber der schnelle französische Thalys schaffte das auf der Strecke von Köln nach Paris bis Aachen auch schon in 25 Minuten. Aus heutiger Sicht wäre unsere Reise natürlich anders verlaufen, denn die Transrapid-Strecke Berlin-Köln-Aachen-Brüssel ist ja längst fertiggestellt. Für die 540 Kilometer lange Strecke zwischen Berlin Hbf. und Aachen braucht man mit dem Transrapid heute einschließlich der kurzen Aufenthalte in Magdeburg, Hannover, Dortmund, Düsseldorf und Köln ca. eine Stunde und 40 Minuten. Pro Station beträgt der Aufenthalt ca. fünf bis zehn Minuten. Als reine Fahrzeit verbleiben somit 50 Minuten. Das entspricht einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 648 km/h. Erste Afrika-Reise. Außer für die Berlin-Reise hatte ich während meines Studiums und in den nachfolgenden Jahren für längere Reisen keine Zeit. Nach meiner Hochzeit habe ich mich erst einmal um meinen Mann und die Kinder gekümmert. Außer zwei Babypausen musste ich meinen Beruf nicht einschränken oder gar aufgeben. Meine Arbeit hat mir immer Freude gemacht. Ich war auch bei den allermeisten Schülern, den Mädchen wie den Jungen, recht beliebt, denn ich habe viele Beweise von Zuneigung bekommen, sogar von einigen ehemaligen Schülern. Seit meinem 67. Lebensjahr bin ich pensioniert, obwohl ich gerne noch länger gearbeitet hätte. Nachdem mein Mann mir erklärt hatte, dass er sein Leben ganz seinem Beruf als Wissenschaftler widmen wollte und private Fernreisen nicht zu seinem Lebensplan gehörten, haben wir uns darauf geeinigt, dass ich allein oder mit meinen Schwestern Auslandsreisen unternehmen werde. Wir leben nun mal in einer Zeit des Wandels, der die ganze Welt verändert, und das bewusst zu erleben, möchte ich in meinem Leben nicht verpassen. In unserer Ehe bleibt jedenfalls alles so harmonisch wie immer. Ich wollte auch meinen Schülern und Schülerinnen – möglichst spielerisch – eine Wissensgrundlage vermitteln, die eine weitere Fortbildung ermöglicht und auch das Interesse wecken, die Ereignisse in der Welt besser verstehen zu lernen. Mir ist das – wie schon gesagt – auch recht gut gelungen. Ab meinem 45. Lebensjahr habe ich dann begonnen, längere Reisen zu unternehmen, soweit das die Großen Ferien ermöglichten. Meine erste Afrika-Reise habe ich aber erst 2056 erlebt. Finanziell hatte ich kein Problem, denn das Vermögen meines Opas, das aus seinen Buchverkäufen stammte, ist über meine Eltern an mich und meine beiden Schwestern übergegangen. Mein Opa hatte ja in seinem Buch „Zukunft?“ darüber berichtet, dass von der RWTH (Rheinisch-Westfälische Techische Hochschule) Aachen, Außenstelle Jülich, ein leistungsstarkes Sonnenkraftwerk entwickelt wurde, das durch die Bündelung der Sonnenstrahlen Dampf, Wasserstoff und elektrischen Strom erzeugen kann. Nachdem sich immer mehr wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen-Fahrzeuge in der Welt durchgesetzt hatten, war das eine verlockende Möglichkeit, Wasserstoff in Nordafrika herzustellen und die Welt damit zu beliefern. Aber zur Dampferzeugung gehört Wasser, viel Wasser. Nachdem in Europa die ersten Versuche erfolgreich abgeschlossen waren, wurden in einem vergrößerten Maßstab einige Kraftwerke dieser Art mit deutschem Kapital in Marokko gebaut. Aber woher sollte man nahe der Sahara das Wasser nehmen? Aus dem Mittelmeer oder aus dem Atlantik natürlich. Man musste dann nur eine Vorrichtung erfinden, um das als Nebenprodukt verbleibende Salz weiterzuverarbeiten. Der nächste Schritt war dann, mit dem reichlich erzeugten Strom einige Meerwasser-Entsalzungsanlagen zu bauen, mit dem die Städte mit Brauch- wie auch mit Trinkwasser versorgt werden konnten. Darüber hinaus wurde ein gigantisches Programm zur Bewässerung der Sahara entwickelt, mit dem zunächst einmal der nördliche und westliche Rand der Wüste mit Wasser versorgt werden konnte, womit dann Anpflanzungen möglich wurden. Mit ein wenig Kunstdünger und dem nun reichlich zur Verfügung stehenden Wasser konnten Wälder und Äcker angelegt werden, wo vorher nur Sand und Stein war. Die Chinesen haben mit sicherem Spürsinn sofort gewaltige Geschäfte mit den nordafrikanischen Ländern gewittert. Unter Umgehung deutscher Patente haben sie noch weit größere Sonnenkraftwerke errichtet und Ländereien in großem Stil aufgekauft, um Saatzuchtbetriebe und Baumschulen anzulegen, die die Pflanzen zur land- und forstwirtschaftlichen Nutzung der einstigen Wüstengebiete liefern würden. Und so geschah es dann auch. Ich habe in der Presse in all den Jahren verfolgt, wie sich zunächst Marokko allmählich wirtschaftlich entwickelt hat. Mit einiger Verzögerung setzte dann auch eine rasante wirtschaftliche Entwicklung in Algerien, Tunesien und etwas später in Libyen und Ägypten ein. Ströme von Flüchtlingen aus den unerträglich heißen Gebieten der Sahelzone siedelten sich in den aufblühenden Ländern an, fanden leicht eine gut bezahlte Arbeit und mussten nicht mehr die lebensgefährliche Reise in viel zu kleinen, nicht mehr seetüchtigen Booten übers Mittelmeer antreten, um in Europa einer ungewissen Zukunft entgegenzusehen. Nach den ersten erfolgreichen Versuchen, mit den riesigen neuen Sonnenkraftwerken die Energie für die Meerwasser-Entsalzung zu erzeugen, wurden weitere Kraftwerke installiert, die zunächst den erzeugten Wasserstoff für die Nachfrage der Autoindustrie nach Brennstoffzellen liefern sollten. Doch gleichzeitig mit dem Aufbau der ersten Solarkraftwerke in Kombination mit der Meerwasser-Entsalzung entstand das gewaltige Projekt der Sahara-Rekultivierung. Marokko zeigte sich als erstes afrikanisches Land sofort bereit für die zahlreichen gleichzeitig anfallenden Investitionen: eigenes Kapital einzusetzen, Kredite aufzunehmen, ausländische Investoren, private wie staatliche, zuzulassen und Fremdarbeitern Arbeitsgenehmigungen zu erteilen. Nun musste auch noch das Problem eines kostengünstigen Transportweges zwischen Afrika und Europa gelöst werden. Etwa gleichzeitig mit dem ersten Solar-Großkraftwerk in Marokko wurde mit dem Bau der ersten unterirdischen Transrapid-Hochgeschwindigkeitsstrecke begonnen, die von Agadir als vorläufigem Endpunkt durch die Straße von Gibraltar unter dem Grund des Mittelmeeres und unter Gibraltar bis nach Cadiz in Südspanien geführt werden sollte. Wegen der großen Mengen an Transportmaterial, mit denen ja richtigerweise gerechnet wurde, mussten die Röhren für die Bahnstrecken parallel für beide Richtungen gleichzeitig gebaut werden. Für später wurde eine weitere unterirdische Transrapidstrecke geplant, die ausschließlich dem Material- und Warentransport dienen sollte. In der Röhre Richtung Afrika verliefen neben der Bahnstrecke selbst auch die Starkstromleitungen aus dem südspanischen Kernfusions-Atomkraftwerk, das zunächst den benötigten Strom lieferte, der für den Aufbau der unterirdischen Transportstrecke und auch für den Bau der ersten Solarkraftwerke benötigt wurde. Gleichzeitig wurden große Windkraftanlagen errichtet, die den benötigten Strom auch nachts liefern konnten. Die vordringlichste Aufgabe war es aber, die Meerwasser-Entsalzugsanlagen zu errichten, die ja das benötigte Wasser für die Wasserstoff-Erzeugung und für die Bewässerung der Wüste liefern sollten. So entstanden Meerwasser-Entsalzungsanlagen und die dazu erforderlichen Energiequellen sowohl an der Mittelmeer- als auch an der Atlantikküste. Zum Zeitpunkt meiner Reise war inzwischen auch die Personenverkehrsstrecke Madrid-Gibraltar-Tetouan-Rabat-Agadir fertiggestellt, sodass ich meine Reise von Aachen aus mit dem Transrapid und zweimaligem Umsteigen direkt bis Agadir einplanen konnte. Ein Flugzeug zu bemühen, erübrigte sich somit. Ich fand es hochinteressant, selbst einmal an Ort und Stelle zu erleben, wie mit Hilfe modernster Technik eine trostlose Wüste in Wald- und Ackerland umgewandelt werden kann. Um nicht ganz unwissend vor der modernen Technik dazustehen, habe ich mich erst einmal informiert, wie so eine Meerwasser-Entsalzung funktioniert: Mehrstufige Entspannungsverdampfung. Hierbei handelt es sich um ein thermisches Verfahren mit der Abkürzung „MSF“ (englisch: Multi Stage Flash Evaporation). Es ist das am häufigsten eingesetzte Verfahren zur Meerwasserentsalzung. Bei diesem Verfahren wird das zugeführte Meerwasser auf eine Temperatur von 115 Grad Celsius erwärmt. Das aufgeheizte Salzwasser verdampft in nachgeschalteten Entspannungsstufen unter Vakuum, der Wasserdampf schlägt sich als Kondensat innerhalb dieser Stufen an mit Meerwasser-Kühlflüssigkeit gefüllten Rohrleitungen nieder und wird als salzfreies Wasser in Kunststoffrohren abgezogen. Das durch den Verdampfungsprozess immer stärker mit Salz angereicherte Meerwasser wird auch Brine (Salzlake) genannt und in einem nachgeschalteten Wärmeüberträger auf die Kondensationstemperatur des Dampfes (ca. 40° Celsius) abgekühlt. Es dient dann anschließend in den Rohrleitungen als Kühlflüssigkeit. Die Rohrleitungen selbst werden kontinuierlich mit Schwammgummikugeln von auskristallisierendem Salz gereinigt. Zuletzt wird dem Brine frisches Salzwasser zugeführt und das Gemisch erneut, vorwiegend durch Sonnenenergie, aufgeheizt. Der gesamte Vorgang stellt also einen geschlossenen Kreislauf dar. Der Überschuss des sich im Kreislauf konzentrierenden Salzes wird wieder ins Meer zurückgeführt oder zu Speisesalz weiterverarbeitet. (Wikipedia) Die von Siemens in der Nähe von Agadir gebaute Entsalzungsanlage ist die weltweit größte dieser Art und entsalzt täglich 2,135 Millionen Kubikmeter Meerwasser. Üblicherweise werden mit dem Verfahren täglich bis zu 500.000 Kubikmeter Trinkwasser aus dem Meerwasser gewonnen. Da einige Pflanzen in den Bewässerungszonen auch leichtes Salzwasser vertragen, werden zu der Süßwassermenge zeitweise wieder – je nach Bedarf – zehn Prozent Meerwasser zugesetzt, um damit Energie zu sparen und den Pflanzen mit dem geringen Salzwasserbedarf die optimale Wachstumshilfe zu gewährleisten. Auch für die Weiterverarbeitung zu Trinkwasser müssen dem Kondenswasser noch mineralische Zusätze beigefügt werden. Nachdem alle theroetischen und praktischen Vorbereitungen abgeschlossen waren, konnte die Reise beginnen. Es war Sonntag, der 6. August 2056. Die Fahrt Aachen-Agadir kostete damals hin und zurück 820,00 Euro. Für Nachtfahrten zwischen null und sechs Uhr gab es zehn Prozent Rabatt. Man konnte damals wie heute auch die Fahrt beliebig unterbrechen. Kaufen konnte man damals – und selbstverständlich auch heute – die Fahrkarten nebst Platzreservierung per Smartphone. Der Zahlungsverkehr ist ja heute viel flexibler als zur Zeit meiner Eltern und Großeltern. Aber das begann erst mit der Einführung der superschnellen, intelligenten Quantencomputer, die in Blitzesschnelle jeden Vorgang kontrollieren und danach entsprechend handeln können. Ich wählte also den Nachtzug. Er hielt zum ersten Mal nach wenigen Minuten Fahrzeit in Lüttich. Dort wurde der Zug in Sekundenschnelle neu zusammengestellt. Die Brüsseler, die in Richtung Paris fahren, werden angehängt, und die Waggons Richtung Brüssel werden mit denen aus Richtung Paris zusammengekoppelt. Und schon ging es weiter. Die nächsten Haltestellen waren Luxemburg, Reims und Paris. Spontan hatte ich mich entschlossen, in Paris meine Reise zu unterbrechen, um mir die Stadt anzusehen, die ich zuletzt vor 20 Jahren einmal besucht hatte. Ich bestellte noch während der Fahrt über mein Smartphone ein Hotelzimmer in der Nähe des Haltepunktes Gare du Nord. Mein Reisegepäck hatte ich vorher schon nach Agadir geschickt und hatte daher nur einen Rucksack mit dem Nötigsten dabei. Da es nachts gegen zwei Uhr war, bestellte ich mir per Smartphone eine Robot-Taxe für die kurze Fahrt zum Hotel. Ich dachte darüber nach, wie einfach heute unser Leben ist, alles per Handy innerhalb von Minuten erledigen zu können. Noch meine Großeltern hätten jetzt vor dem Bahnhof gestanden, um zu Fuß die in Bahnhofsnähe liegenden Hotels abzuklappern, ob vielleicht noch ein Zimmer frei ist. Aber nachts um zwei Uhr hätten sie das ohnehin nicht getan. Mit dem Taxi landete ich nach fünf Minuten Fahrt im Hotel, checkte ein, und zehn Minuten später lag ich im Bett. Am nächsten Morgen bemerkte ich mit Befriedigung, dass das französische Frühstück inzwischen internationalen Standard erreicht hat. Ich begann meine Stadtbesichtigung mit einem kleinen Spaziergang durch die Innenstadt. Im Gegensatz zu meiner früheren Reise stellte ich fest, dass die Luft jetzt viel sauberer war als vor 20 Jahren. Der Verkehr floss reibungslos dahin, und alle Wagen, die mit ihren Auspuffgasen die Luft verpestet hatten, waren aus dem Verkehr verschwunden. Der alte Eiffelturm war vor ein paar Jahren wegen Baufälligkeit abgerissen worden. Dafür war an der gleichen Stelle ein prächtiger Fernsehturm mit mehreren Aussichtsplattformen gebaut worden, der fast doppelt so hoch ist, wie es der Eiffelturm war. Ich ließ es mir nicht entgehen, diesen tollen Turm in mehreren Etappen zu besichtigen. Abends besuchte ich eine Revue im uralten Moulin Rouge. Was die dort zeigen, ist zwar alles perfekt, aber ich habe im Fernsehen schon bessere Aufführungen gesehen. Überdies war das Molin Rouge sehr teuer. Mein Handgepäck, Rucksack und Handtasche, hatte ich in einem Schließfach am Bahnhof hinterlegt. Ich holte es rechtzeitig wieder ab und bestieg den Transrapid-Zug zur Weiterfahrt kurz nach Mitternacht. Die nächste Strecke verlief über Orleans und Tours nach Bordeaux. In dieser Zeit konnte ich auf meinem Sitz, den man auf Liegestellung einstellen konnte, etwas schlafen. Die etwa 580 Kilometer schaffte der Zug trotz drei Haltepunkten in ca. einer Stunde. Obwohl der Zug hier noch einmal neu zusammengestellt wurde, konnte ich in meinem Abteil bleiben. Für die nächsten ca. 780 Kilometer bis Madrid brauchte der Zug über Saragossa weitere eineinhalb Stunden. Pünktlich um drei Uhr morgens habe ich den Zug in Madrid Hauptbahnhof verlassen. Auch hier wollte ich noch einen weiteren Tag dranhängen, um mir einen Überblick über diese Stadt zu verschaffen. Ich kannte von Madrid nur den weltberühmten Prado mit seinen unvorstellbar wertvollen Gemälden. Die wollte ich mir anschauen. Auf die gleiche Art wie in Paris bestellte ich mir wieder ein Hotelzimmer, denn ich wollte nach der anstrengenden Stadtbesichtigung und den beiden Nachtfahrten mal richtig ausschlafen. Nach einem sehr reichlichen Frühstücksbuffet nahm ich mir wieder eine Robotaxe und gab ein: zwei Stunden Stadtrundfahrt, Endstation Prado: Palacio Real, Bernabeu-Stadion, Plaza de Cibeles, Plaza Mayor und Retiro-Park waren die Haltepunkte. Eine angenehme Frauenstimme gab zu den einzelnen Haltestellen einige knappe Erklärungen auf Deutsch. Die gewünschte Sprache konnte man vorher natürlich auswählen. Am Abend besuchte ich noch eine Flamenco-Show, denn sowas gehört ja bei einem Spanien-Besuch dazu. Ich hatte von meinem fünften Lebensjahr an bis Ende meines Studiums selbst Ballett-Unterricht und bin nach wie vor sehr an Tanz-Darbietungen interessiert. Es war wirklich sehenswert, was da geboten wurde. Und dazu eine hinreißende Musik! Zehn Minuten nach Mitternacht ging mein Transrapid weiter bis zur Endstation Agadir über Toledo, Sevilla, Cadiz, Gibraltar Rabat und Casablanca bis Agadir, etwa 1600 Kilometer. Gegen vier Uhr morgens war ich endlich angekommen. Mein Hotel war ja vorbestellt. Eine Robotaxe gab es nicht, und so musste ich zu Fuß zum nahe gelegenen Hotel. Mein Smartphone-Navi zeigte mir den Weg. Ich hatte mich telefonisch von zu Hause aus bei dem deutschen Geschäftsführer der staatlich geförderten Biologischen Station mit dem Namen „Garten Eden“ in der Nähe von Agadir für ein Interview angemeldet, weil ich nach meiner Rückkehr nach Deutschland einen ausführlichen Artikel über die biologische Entwicklung der West-Sahara schreiben wollte. Ich rief Herrn Hermann Böhmer vom Hotel aus an und verabredete mit ihm einen Besuch am nächsten Tag. Mein Hotel besorgte mir einen Geländewagen, der mir für die gesamte Dauer meiner Reise zur Verfügung stand
Der Garten Eden. Mein unentbehrliches Smartphone-Navi führte mich zum Verwaltungsgebäude, das etwa eine Stunde Autofahrt südlich von meinem Hotel entfernt lag. Schon während der Fahrt dorthin hat es mir den Atem verschlagen. Wo einst trostlose Wüste war, wuchsen jetzt Bäume der verschiedensten Arten. Ich fuhr an zahlreichen Gemüsefeldern entlang, die alle mit dichten Baumreihen umgeben waren. Sie sollten ein wenig Schatten spenden, Wasser speichern und die Pflanzen vor den zum Teil heftigen Winden schützen. Nach einer Fahrt über die etwas holprige Piste parkte ich vor einem schlichten Verwaltungsgebäude im typisch marokkanischen Baustil. Im angenehm klimatisierten Büro empfing mich Herr Böhmer sehr herzlich. Er sagte mir, dass er sich schon lange einen interessierten Besuch aus Deutschland gewünscht hätte. Nach einigen privaten Worten begann ich mein Interview. Da dieser Besuch schon 24 Jahre zurückliegt, muss ich jetzt meine damaligen Aufzeichnungen und den später erschienenen Zeitungsartikel zur Hand nehmen. Herr Böhmer berichtete: „Die Forschungs- und Entwicklungsstation wurde schon lange vor Fertigstellung der Transrapid-Strecke von und nach Spanien gegründet. Das war im Jahr 2026. Die marokkanischen Behörden gaben organisatorische und teilweise auch finanzielle Unterstützung, aber im Wesentlichen wurden hier Gelder aus Deutschland investiert. Südöstlich der Stadt Guelmim wurde ein etwa 50 Quadratkilometer großes Wüstengebiet erworben, das allerdings fast nichts gekostet hat. Im gleichen Jahr wurde hier, süddlich von Agadir, die erste Meerwasser-Entsalzungsanlage in Verbindung mit einem Solarkraftwerk für uns selbst und für Algerien fertiggestellt, mit dessen zuständigem Ministerium wir einen Vertrag zur Lieferung von Strom und Wasser abgeschlossen haben. Die Algerier bauten dort, wo ihre erste Rekultivierung der Sahara stattfinden sollte, ebenfalls ein modernes Solarkraftwerk, um die Anlage mit Strom und Energie zu versorgen. Um das Solarkraftwerk herum, das sich in der Nähe zur Grenze Marokkos mitten in der Wüste, in der Nähe der Stadt Tindouf befindet, wurde eine neue Stadt gegründet, die sie Al-Jadi(d)maya (Neuwasser) nannten. Wasser konnten wir allerdings erst ab 2028 liefern, nachdem die erste Meerwasser-Entsalzungsanlage fertiggestellt und lieferfähig war. Wasser ist in diesem Klima lebenswichtig. Daher drängten wir unsere Regierung, so viele moderne Sonnenkraftwerke wie möglich aus Jülich herbeizuschaffen, mit deren Energie Meerwasser-Entsalzungsanlagen betrieben werden können. Da wir aber auch nachts abgasfreien Strom benötigen, wurden entlang der Atlantikküste bis jetzt um die 200 Windkrafträder errichtet, die in Deutschland vorproduziert und hier zusammengebaut wurden. So nutzen wir den vom Atlantik wehenden starken Wind optimal. Bis zur Fertigstellung der ersten kombinierten Anlagen mussten wir einen Tiefbrunnen nutzen, der uns leicht brackiges Wasser lieferte, das als Trinkwasser nicht geeignet war. Unsere Idee war, eine für das hiesige Klima und die sandigen Bodenverhältnisse geeignete Baumzüchtung herauszufinden, die auch mit möglichst wenig Wasser auskommt, aber viel Wasser im Boden binden kann. Das brackige Wasser brachte uns auf die Idee, eine Reissorte zu züchten, die auch in Brackwasser gedeihen kann. Dafür engagierten wir einen chinesischen Wissenschaftler, der sich schon mit neuen Reiszüchtungen befasst hatte. Nach fünfjähriger Forschung gelang es tatsächlich, eine ernteergiebige Reissorte zu kreieren, die viel Wasser benötigt, das aber mit zehn Prozent Meerwasser versetzt wird. Und Sie werden staunen: der Reis schmeckt tatsächlich genau so wie ein speisefertig gewürzter Reis erster Qualität. Als Milchreis ist er allerdings nicht geeignet. Wir beliefern Algerien nun schon seit 2026, seit der ersten Versuchsanlage, mit Süßwasser für Jadimaya. Unsere erste Anpflanzung mit jungen Bäumen, die wir hier aus importierten Samen gezogen hatten, endete leider in einem Desaster. Wir hatten gerade herausgefunden, wie viel Wasser wir für eine ausreichende Bewässerung benötigen und welche Menge Kunstdünger welcher Art wir als Starthilfe für die jungen Pflanzen zuführen müssen, als ein gewaltiger Sandsturm ausbrach, der den größten Teil unserer Anpflanzungen vernichtete. Die Bäumchen waren zum größten Teil verschüttet und zum anderen Teil umgeknickt. Dadurch wurde uns unmissverständlich klargemacht, dass sich die Wüste nicht ohne Widerstand kultivieren lässt. Schützender Wald muss her, bevor man an andere Bepflanzungen denken kann – dies war unsere grundlegende Erkenntnis aus unserer ersten Panne. Und bevor man die jungen Bäume ins Freiland pflanzen kann, müssen sie erst einmal geschützt in Treibhäusern bis zu einer widerstandsfähigen Größe herangezogen werden. Was war zu tun? Wir mussten die riesigen Sanddünen aus der Umgebung unserer Anlage erst einmal mit Hilfe schwerster Geräte einebnen und die neu gewonnene ebene Fläche zwecks Verfestigung des gefährlich lockeren Bodens mit Dünengras bepflanzen. Dafür musste aber die ganze Umgebung bis zehn Kilometer um die Anlage herum leicht feucht gehalten werden, damit kein Sand mehr aufgewirbelt werden kann. Bei der Bepflanzung mit dem Dünengras halfen uns die hiesigen Schulkinder, und in den Schulferien kamen Kinder und Jugendliche aus dem ganzen Land als Pflanzer und zum Bewässern. Die ganze Bevölkerung hier war bereit, den Kindern Unterkunft zu gewähren. Einen wichtigen Punkt mussten wir dabei auch noch bedenken. Eine jahrtausendelang sich selbst überlassene Wüste entwickelt ihre eigene Tierwelt, soweit überhaupt noch Tiere existieren können. Es gibt hier sehr giftige Schlangen, Skorpione und sehr lästige Sandfliegen. Wir mussten daher die Kinder mit entsprechender Schutzkleidung ausrüsten. Falls aber ein Kind mal von einer Sandviper gebissen wurde, musste das passende Serum zur Entgiftung in kürzester Zeit bereitstehen und angewendet werden können. Das alles musste vorher organisiert werden. Nachdem das geschafft war, legten wir als erstes mehrere Reisfelder an, um Saatgut für unsere neue Salzreis-Züchtung zu produzieren. Für die Ernte holten wir uns 1.000 Erntehelfer aus dem überfüllten Flüchtlingslager in Libyen. Für die mussten wir aber zunächst menschenwürdige Unterkünfte bauen. Wir brauchten für den Windschutz unserer Reisfelder sturmfeste Zäune, wie sie auch für den Schallschutz beim Autobahnbau in Deutschland eingesetzt werden, jedenfalls so lange, bis unsere Waldbäume groß genug gewachsen sein würden, um sie als Windschutz gebrauchen zu können. Aber die mussten wir ja erst mal wieder neu anpflanzen. Inzwischen haben wir auch mehrere hundert Treibhäuser gebaut, in denen wir Baumschößlinge heranzüchten, bevor wir sie in die freie Natur entlassen können. Man kann sich vorstellen, dass dies alles Unsummen an Investitionen gekostet hat. Inzwischen ist aber auch die Bill- Gates-Stiftung, die vom Gründer und Hauptaktionär der Firma Microsoft (WINDOWS) ins Leben gerufen wurde, mit einigen Millionen Dollar bei uns eingestiegen. Einige weitere Milliardäre sind seinem guten Beispiel gefolgt. Heute verdienen wir mit unserem Reisexport so viel, dass sich unsere laufenden Kosten tragen. Nun zu unseren Wald-Anpflanzungen. Wir haben dafür einen Professor aus Israel gewinnen können, der seine große Erfahrung mit der Neu-Anpflanzung von Wäldern auf heißen und verkarsteten Böden eingebracht hat. Mit Erfolg. Zunächst wird eine Kiefernsorte angepflanzt, die auf magersten Böden schnell wächst und mit wenig Wasser auskommt. Dazwischen werden Libanon-Zedern im Abstand von 15 Metern eingesetzt, und alle 25 Meter wird eine afrikanische Akazie gepflanzt. Wir haben auch Versuche gemacht, amerikanische Mammutbäume (Sequoia sempervirens und Sequoiadendron giganteum) anzupflanzen, wobei uns ein amerikanischer Förster aus Oregon mit einschlägiger Erfahrung zur Seite stand. Diese Bäume werden bis zu 3.000 Jahre alt und erreichen Wachstumsgrößen bis über 100 Meter Höhe. Die Sorte sempervivens kann noch älter werden und einen Stamm-Umfang von 30 Metern erreichen. Aber diese urtümliche Pflanze aus der Zeit der Dinosaurier ist die größte Pflanze der Erde. Ein ausgewachsener Mammutbaum kann ein geschätztes Gewicht von 2.400 Tonnen erreichen, was einem Gewicht von vier Airbussen Typ B680 entspricht. Diese Ungetüme haben aber eine Eigenart. Sie brauchen zur Vermehrung Waldbrände. Ihre Samenkapseln springen erst bei Temperaturen auf, die bei Waldbränden entstehen. Sie sind zu der Zeit, als bei uns die Braunkohle entstand, auch in Europa anzutreffen gewesen. Aber mit dem Einsetzen der Eiszeit sind sie ausgestorben, denn da wurde es ihnen offenbar zu kalt. Um nun die jungen Setzlinge aufziehen zu können, brauchten wir eine Holzasche-Schicht als Bodendecker, die wir erst aus Gegenden, wo kürzlich Waldbrände aufgetreten sind, importieren mussten. Heute, 30 Jahre nach den ersten Versuchen, befinden sich bereits 15 Meter hohe Mammutwälder in der Umgebug unseres ersten Wasser-Abnehmers aus Jadimaya. Der Bedarf an Süßwasser ist in unserem Klima enorm. In Marokko gibt es jetzt bereits 15 große Solarkraftwerk-Anlagen, die alle alten fossilen Kraftwerke ersetzen. Ein Teil des tagsüber dort erzeugten Wasserstoffes wird dazu verwendet, um in der Nacht, wenn die Solaranlagen pausieren, zusammen mit den Windkrafträdern mehrere Dampfkraftwerke anzutreiben, die den Strombedarf für die Nacht liefern, natürlich auch für die Meerwasser-Entsalzung. Somit wird die Wasserversorgung rund um die Uhr gesichert. Natürlich ist auch unser Wasserbedarf für die Anpflanzungen und die nachfolgende Bewässerung nicht gleichbleibend, während die Wasser-Anlieferung stets auf dem höchstmöglichen Stand gehalten wird. Daher ist es erforderlich, einen Puffer einzuschalten. Dieser besteht aus einem See oder einem großen Teich, der bei allen neuen Wüsten-Siedlungen gleichzeitig mit angelegt wird. Diese Art Seen unterliegen in unserem heißen Klima starker Verdunstung. Obwohl der Salzgehalt der entsalzten Wasserströme niedrig ist, werden wir fortlaufend Wasser aus diesen Reservoirs in die neu zu erschließenden Oasen wieder abführen, um eine konstante Wasser-Qualität zu erhalten. Auf diese Weise dringen wir immer tiefer in die Wüstengebiete hinein, um dort, wo immer nur Trockenheit und Öde vorherrschte, nun Wälder wachsen zu lassen. Der dritte Schritt ist dann, natürlich auch Wiesen, Felder und Plantagen anzulegen, wo sich Menschen niederlassen sollen, die sonst als Klima-Flüchtlinge anderen Völkern zur Last gefallen wären. Ganz nebenbei produzieren unsere jungen Wälder auch große Mengen an Sauerstoff, der zur Reinigung der Erdatmosphäre beiträgt. Mit der Erweiterung unserer Aufgaben als verantwortliches Institut für das gewaltige Sahara-Rekultivierungs-Projekt steigt natürlich auch unser Bedarf an Wasser und Energie. Es ist doch nach all den Jahren der klimatischen Katastrophen ein gutes Gefühl, jetzt und in Zukunft unendlich viel Strom erzeugen und Wasser verbrauchen zu können, ohne die Umwelt zu verschmutzen. Je weiter wir mit unseren Bewässerungsprogrammen in die Wüste vordringen, desto teurer wird allerdings das Vorhaben. Das entsalzte Wasser kommt nämlich nicht von allein in die entlegenen Gebiete, sondern muss über Hunderte von Kilometern durch Leitungen herangeschafft werden. Und nicht nur das Wasser muss weite Wege zurücklegen. Wir brauchen auch an Ort und Stelle neue Solarkraftwerke, und wir brauchen Menschen, deren Ansiedlungen dort auch attraktiv gestaltet werden müssen. Aber je mehr wir Wasserstoff als Treibstoff für die Auto- und Luftfahrt-Industrie verkaufen, desto leistungsfähiger wird unser Finanzhaushalt. Und seit einigen Jahren sind wir ja auch bedeutender Exporteur für die Versorgung der Welt mit Reis. Was haben die Menschen hier in unseren Breiten über die erbarmungslos brennende Sonnenhitze gejammert! Heute sorgt genau die gleiche Sonne dank technischer Nachhilfe für den wirtschaftlichen Wohlstand Nordafrikas. Ja, die Sonne. Es ist zwar tatsächlich noch die gleiche Sonne wie vor 28 Jahren, und sie wird es hoffentlich noch die nächsten 500 Millionen Jahre bleiben, aber dennoch hat sich bei uns klimatisch in den letzten paar Jahren etwas verändert. Wir haben in fast drei Jahrzehnten Milliarden Hektoliter Wasser in den Sand der Sahara gepumpt, haben gepflanzt, wo vorher nichts wuchs. Die Pflanzen haben das Wasser aufgenommen und zum Teil wieder in den Boden entlassen. Aber die intensive Sonneneinstrahlung hier hat gewaltige Mengen Wasser durch Verdunstung in die Atmosphäre entlassen. Daraus haben sich allmählich wieder Wolken gebildet. Es ist zwar noch nicht statistisch einwandfrei bewiesen, aber wir, die wir durch unseren Beruf mit der Natur eng verbunden sind, haben bemerkt, dass es in den vergangenen drei Jahren hier doppelt so viel geregnet hat wie in den zehn Jahren davor. Dadurch ist die Stromerzeugung durch unsere Solarkraftwerke etwas rückläufig, doch wir konnten mit dem zur Verfügung stehenden Wasser weitere Gebiete rekultivieren. Inzwischen haben wir sogar Probleme, ausreichend Arbeitskräfte für die neuen Anbaugebiete zu bekommen, denn die Flüchlingslager hier in Tunesien, Algerien und Libyen sind wie leergefegt. Man kann sagen: Solarkraftwerke zu bauen und sie mit Meerwasser-Entsalzung zu koppeln, war eine epochale Idee. Die Sahara zu kultivieren und auch andere Wüsten, die nicht allzuweit von einem Meer entfernt liegen, ist ein Schritt vorwärts in der Menschheitsgeschichte. Bis die ganze Sahara wieder fruchtbares Land sein wird, dauert es möglicherweise noch Jahrhunderte. Ich bin aber sicher, dass die Bewässerung der Wüsten dieser Erde mit Milliarden von Hektolitern sauberem Wasser auch hier einen Klimawandel bewirken wird, und zwar im positiven Sinne. Die Entwicklung von Land- und Forstwirtschaft in ganz Nordafrika zieht noch weitere wirtschaftliche Entwicklungen nach sich, was schon jetzt deutlich zu spüren ist. Die Bodenerschließung und die wachsende Landwirtschaft benötigen Maschinen und Geräte, die am besten dort produziert werden, wo sie eingesetzt werden sollen. Es werden sich hier immer mehr Menschen ansiedeln, die an der Wohlstandsentwicklung teilnehmen wollen. Sie haben also Bedürfnisse, und sie haben Einkommen. Das erzeugt Nachfrage. Es werden sich also in den nächsten Jahren verschiedene Industrien hier und in anderen Ortschaften ansiedeln für Möbel, technische Geräte, Elektronik, Küchenmaschinen, Fahrzeuge aller Art, Textilien usw., um nur einige Beispiele zu nennen. Und neben der wirtschaftlichen Entwicklung wird es auch eine kulturelle geben, nicht zu vergessen, dass sich Infrastruktur und Verkehr rasant weiterentwickeln werden. Die Anfänge von allem sind schon jetzt deutlich sichtbar. Aber zurück zu unserem Entwicklungsprogramm. Nachdem das Wald- und das Reisproblem gelöst waren, konzentrierten wir uns auf den Obst-Anbau in den neu erschlossenen Wüstengebieten. Wir haben bei uns jahrelange Versuche gemacht, geeignete Sorten Orangen, Mandarinen, Granatäpfel, Pampelmusen, Pfirsiche, Nektarinen und Aprikosen zu entwickeln, die in der prallen Sonne und den mageren Böden rentable Ernten abliefern. Das ist uns auch gelungen, doch wir arbeiten auch auf diesem Gebiet noch weiter an Verbesserungen. Olivenbäume, Feigen und Dattelpalmen gehören zu unseren Standard-Anpflanzungen. Allein in Marokko ist der Export an Obst der verschiedensten Sorten jährlich um mehr als 100 Prozent in den letzten zehn Jahren angestiegen. An den Südhängen des Atlasgebirges haben angeworbene Winzer aus Frankreich und Deutschland, aber auch aus Südafrika bereits seit mehr als zehn Jahren ausgedehnte Weinbaubetriebe angelegt. Sie mussten in den ersten fünf Jahren finanziell kräftig unterstützt werden, denn trotz des Einsatzes modernster Maschinen war es eine Knochenarbeit, erst einmal die terrassenförmigen Anlagen herzustellen, dann die Rebstöcke zu pflanzen und großzuziehen. Das bringt in den ersten fünf Jahren keinerlei Geld ein, im Gegenteil. Es wurden staatlicherseits Investitionskosten übernommen, gleichzeitig aber hohe Kredite vergeben. Gleichzeitig gehen die Anlagen in das Eigentum der Winzer über, die später die Kredite mit den zu erwartenden Gewinnen ablösen können. Die ersten Pioniere können bereits auf sehr positive Bilanzen schauen, da ihre Qualitätsweine sich bei den Weinkennern der Welt steigender Beliebtheit erfreuen. Unsere weiteren Anbaupläne sind: Gemüse, Getreide, Gewürze und Blumenzucht, letztere in Gewächshäusern. Das vorletzte Feld unserer Entwicklungsarbeit war und ist auch noch die Erprobung, welche Gemüsearten unter den hiesigen Klima- und Bodenverhältnissen am besten gedeihen. Außerdem sollen solche Gemüse nicht nur der Ernährung der hier in wachsender Zahl lebenden Menschen dienen, sondern auch für den Export geeignet sein. Wir haben in den letzten zehn Jahren Versuchsfelder angelegt für Zuccini, Stangenbohnen, einige Kartoffelsorten, Rote Bete, Zuckerrüben, Brokoli, Spargel, Erdnüsse, Kapern, Mandeln, Soja, Zwiebeln, Knoblauch, Kümmel, Mangold, Pflücksalate und Raps. Was wir bisher noch nicht in Angriff genommen haben, sind die verschiedenen Getreidesorten. Früher war Nordafrika die Kornkammer des Römischen Reiches. Das hatte ja die Begehrlichkeit der Römer auf das Punische Reich (Karthargo, heute Tunis) geweckt, dessen Untergang durch ihren Wohlstand besiegelt war. Unter Hannibal haben sich die Karthager, wie sie auch genannt wurden, kräftig gewehrt – doch letztlich half es ihnen nicht, gegen die Übermacht der Römer anzukommen. („Cetero censeo Karthaginem esse delendam …“, meinte der römische Konsul Cicero.) Aber das ist schon lange her. Wir haben uns diese Aufgabe bis zuletzt aufgehoben, weil wir zunächst Prioritäten setzen mussten. Es hätte auch keinen Zweck gehabt, Getreide anzubauen, ohne um die Felder einen schützenden Wald zu besitzen. Ein einziger Sahara-Sandsturm hätte die Arbeit eines ganzen Jahres vernichten können, wie wir das ja schon erlebt haben. Wir werden uns aber in den kommenden Jahren darauf konzentrieren, Nordafrika wieder zur Kornkammer Europas zu entwickeln. Ich komme jetzt langsam zum Schluss Ihrer Frage, was wir hier in Nordafrika geschaffen haben und noch weiter planen. Sie haben gehört, es gab viel zu tun. Vieles ist geschafft, worauf wir stolz sein können. Nein, Stolz ist keine gute Sache, wir können aber mit dem Geleisteten bisher recht zufrieden sein. Ein letztes Forschungsgebiet möchte ich noch erwähnen: Das sind Heilkräuter, Pilze und Wurzeln, die nur in tropischen Feucht- oder Trockengebieten wachsen können, wie zum Beispiel Ginseng-Wurzeln. Die sind vor allem für die Gesunderhaltug von Körper und Geist wichtig, besonders für ältere Menschen. Seit Tausenden von Jahren hat Ginseng seinen festen Platz in der Kräutermedizin, und auch heute können hochwertige Ginseng-Wurzeln noch Hunderte von Euro pro Kilo einbringen. Geduldige Erzeuger können mit der Anbaumethode des simulierten Wildwuchses oder einer mit der Natur identischen Methode beachtliche Mengen ernten und gutes Geld damit verdienen. Es dauert sieben Jahre, bevor der Ginseng geerntet werden kann, aber die Ernte wird sehr hochwertig sein. Unser Experte für Ginseng kommt aus Namibia. Wir sind natürlich bestrebt, möglichst hochwertige Produkte für den Export zu erzeugen, um die enormen Kosten der Anfangs-Investitionen langsam wieder hereinzubringen. Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass in unserem südlichen Nachbarland Spanisch-Westafrika seit etwa zehn Jahren mit dem Geld der Europäischen Union ein Wüstengebiet erschlossen wird, das bisher noch kaum erforscht war. Ich empfehle Ihnen, dort einmal hinzufahren, wenn es Ihre Zeit erlaubt. Geleitet wird die Station von meinem Kollegen Dr. Mathias Maurer, der seit den allerersten primitiven Anfängen dabei ist und inzwischen Erstaunliches erreicht hat. Sie können mit Ihrem Wagen gern und nach Belieben in den nächsten Tagen durch unsere Anlagen fahren und sich alles an Ort und Stelle anschauen. Falls Sie einen unserer Spezialisten für das eine oder andere Forschungsgebiet sprechen möchten, sagen Sie mir bitte Bescheid. Sie können mich fast immer telefonisch erreichen. Sie können auch – falls Sie Badesachen dabei haben – in unserem See baden. Das Wasser ist sauber und hat fast Trinkwasserqualität. Für den menschlichen Trinkwasserbedarf haben wir aber eine eigene Aufbereitungsanlage, für die unser Windrad und unsere separate Solaranlage den Strom liefern.“ Das war also mein Besuch bei dem netten Herrn Böhmer, nach dessen Vortrag mir der Kopf schwirrte. Mein Smarty hat alles aufgenommen. Die nächsten dreiTage wollte ich erst einmal die hiesige Anlage erkunden, mit den hier arbeitenden Menschen sprechen (die ja inzwischen alle – jedenfalls die Jüngeren – Englisch können) und Fotos machen. Die folgenden acht Tage wollte ich dann in Algerien deren erste Sahara-Rekultivierungsanlage anschauen und – falls noch Zeit übrig blieb – nach Spanisch-Westsahara rüberfliegen. Ich hatte ja ein Jahr zuvor meinen Flugschein für wasserstoffbetriebene Kleinflugzeuge gemacht. Da wollte ich in Übung bleiben und mir eine Maschine ausleihen. Herr Böhmer hatte mir seine Privatmaschine dafür angeboten. Aber zunächst blieb ich im Garten Eden. Ich habe teils per Wagen und teils zu Fuß die riesige Anlage durchstreift, die etwa fünf Kilometer breit war und rund zehn Kilometer tief in die Wüste hinein angelegt war. Auffallend war, dass nirgendwo ein Zaun angebracht war. Einer der Arbeiter erklärte mir, dass man beabsichtigte, die wenigen Säugetiere, die sich noch in der Wüste aufhielten, an die neue Umgebung zu gewöhnen: „Allerdings haben sich bereits einige Antilopen an unsere jungen Akazien- und Zypressen-Setzlinge herangemacht und die junge Rinde abgefressen. Dadurch sind Hunderte von jungen Bäumchen wieder eingegangen. Inzwischen versehen wir alle Setzlinge mit Maschendraht. Man musste eben erst mal gewisse Erfahrungen machen. Sollten sich hier auch wieder Elefanten zeigen, die ja ständig auf der Suche nach Wasser und Grünzeug sind, dann haben wir ein ernstes Problem.“ Da der Garten Eden eine Forschungs- und Aufzuchtstation ist, sieht man hier hauptsächlich nur junge Pflanzen. Sobald sie transportfähig sind, werden sie in die neuen Erschließungsgebiete verschickt und dort eingepflanzt. In der ganzen Anlage sieht man Bewässerungsfontänen, die die Felder und Schonungen immer genau mit der richtigen Menge Wasser versorgen. Interessant fand ich die Anlage der Edelholz-Anpflanzungen. Hier werden Versuche mit Teakholz, Mahagoni, Palisander, Ebenholz, Schwarznuss und Padouk unternommen. Das ist allerdings schon die zweite Generation der Wüstenbepflanzung. Als Erstbepflanzung in der Wüste mit dem noch mageren Boden eignen sie sich nicht. Erst wenn ein wirklich tropisches Klima mit hoher natürlicher Feuchtigkeit und eine bestimmte Bodenqualität erreicht sind, kann es gelingen, Edelholz-Plantagen mit Erfolg zu betreiben. Doch bis zur ersten Ernte wird man sich wohl noch 80 Jahre gedulden müssen. Am dritten Tag im Garten Eden konzentrierte ich mich auf die Edelobst-Züchtungen. Jetzt, im August, war gerade Erntezeit. Da man ja möglichst ertragreiche Sorten als Züchtungserfolg erhalten wollte, musste man natürlich alle Bäume erst einmal wachsen lassen, bis sie Früchte tragen konnten. Herrliche Pfirsiche, Nektarinen, auch Orangen und Zitronen, Pampelmusen und Mandarinen wurden gerade geerntet. Ich durfte so viel zum Eigenverbrauch pflücken, wie ich nur wollte. Ich habe so viel von diesem köstlichen Obst gegessen, wie ich nur konnte. Auf die Mahlzeiten im Hotel konnte ich gut verzichten. Am Abend nahm ich im Eden-See ein angenehmes Bad. Die Wassertemperatur dürfte so um die 27 Grad gewesen sein. Das Badezeug hatte ich zu Hause vergessen einzupacken, aber ich konnte mir in der Stadt Agadir einen schicken Bikini kaufen. Einige Flamingos leisteten mir beim Schwimmen Gesellschaft. Übrigens war ich ziemlich schockiert, wie hässlich Agadir ist. Es liegt direkt an der Atlantikküste und besitzt einen Industriehafen, wo die in der Nähe geförderten Metalle Kobalt, Mangan und Zink verschifft werden. Agadir wurde 1960 von einem starken Erdbeben fast völlig zerstört und anschließend hastig wieder aufgebaut. Hinter der Innenstadt erhebt sich ein Hügel, an dem in Richtung Meer mit riesigen arabischen Buchstaben eine Schrift angebracht ist. Ich habe mir sagen lassen, dass dies „Gott, Vaterland, König“ bedeutet. Durch den Aufbau der Forschungs- und Entwicklungsstation „Garten Eden“ sind auch viele Europäer nach Agadir gekommen. Eine koreanische Reisegesellschaft hat südlich von Agadir vor einigen Jahren eine Reihe von Hotels und Ferienhäusern errichtet, die inzwischen reichlich besucht werden. Der einstmals breite, durch den Meerwasser-Anstieg jetzt nur noch schmale Strand bietet den Urlaubern bestmögliche Erholung. Mir wäre ein reiner Strandurlaub allerdings viel zu langweilig. Inzwischen gibt es von dort aus aber verschiedene Ausflugsmöglichkeiten, unter anderem Bootfahrten zu den Kanarischen Inseln, die ja nicht weit entfernt sind. Bei klarem Wetter kann man die Spitze des 3.715 Meter hohen Teide von Teneriffa sehen. Am nächsten Morgen ging es los nach Algerien. Ich war etwas aufgeregt, allein nach Algerien zu fliegen, obwohl die Siedlung Jadimaya nicht allzu weit entfernt liegt. Ich war erstaunt, wie viel Komfort und Automatik die Maschine von Herrn Böhmer besaß. Ich gab die Koordinaten des dortigen Landeplatzes ein (mein Smartphone verriet mir diese), drückte auf „Start“, und schon erhob sich die Maschine senkrecht in die Luft, ohne eine Startbahn zu benötigen. Die Maschine war ja so ein Mittelding zwischen Hubschrauber und Drohne. Ich wurde von der Automatik aufgefordert, die gewünschte Flughöhe anzugeben. Da ich möglichst viel von der Landschaft unter mit sehen wollte, gab ich „Mindestflughöhe“ ein. Die pendelte sich bei etwa 400 Metern ein. Nach einer halben Stunde Flugzeit setzte die Maschine auf dem gewünschten Landeplatz auf. Ich fragte mich: Wozu hast du eigentlich eine Flugprüfung abgelegt? Es geht doch heute alles automatisch! Aber es hätte ja sein können, dass die Automatik irgendwann einmal versagt. Da hätte ich den Vogel selbst sicher zur Landung bringen müssen. In der Nähe des Landeplatzes gab es eine Art Information, bei der ich mich vorher schon für den nächsten Tag zu einer dreitägigen Rundreise angemeldet hatte. Auch in dem daneben liegenden Gästehaus hatte ich mich schon angemeldet und ein Zimmer gebucht. Aber am ersten Tag wollte ich mich erst einmal zu Fuß in dem jungen Ort umsehen. Meinen Rucksack mit den Übernachtungssachen habe ich im Flugzeug zurückgelassen. Wie sich später herausstellte, war es ein Fehler, mich nicht gleich im Hotel anzumelden. Algerien. Als erstes fiel mir der große See auf, an dessen Ufer eine Reihe hübscher Einfamilienhäuser stand. Es gab auch ein kleines Rathaus, eine Moschee und ein Bürgerhaus. Unübersehbar war auch ein Industrieviertel, in dem die drei großen Solarkraftwerke des Ortes fleißig Strom erzeugten. In der Nacht sorgte ein wasserstoffbetriebenes Kraftwerk für die ununterbrochene Versorgung mit Strom und für die richtige Dosierung der Wasserzufuhr an die Pflanzungen. Windkrafträder habe ich nur ganz wenige gesehen. (Anmerkung: Aus der Erfahrung der späteren Ereignisse hoffe ich, dass dieser Mangel keine zu schwerwiegenden Folgen gehabt hat.) Hier war ja auch die vorläufige Endstation der Transrapid-Transportstrecke, die den erzeugten Wasserstoff und die Agrarerzeugnisse nach Europa beförderte. Es gab Verladerampen für Be- und Entladung der Transportwagen, und es gab Zuganschlüsse zu den benachbarten Rekultivierungsstationen, die noch nicht unterirdisch an das Transrapidnetz für den Personenverkehr angeschlossen waren. Die inzwischen auf 40.000 Einwohner angewachsene Kleinstadt verfügte auch über mehrere Supermärkte, angeführt von der amerikanischen Firma Walmart, die mit einem großen Kaufhaus vertreten war – und es wohl auch heute noch ist. Sobald ich die Ortsgrenze erreicht hatte, begann der Wald, der mir schon von weitem aufgefallen war und der rings um den ganzen Ort wuchs. Die Bäume bestanden aus einer aus Israel stammenden Schwarzkiefernart, die Pionier der ersten Bepflanzungen überhaupt war. Dazwischen ragten schon jetzt eine Anzahl Mammutbäume heraus, die jetzt, nach etwa 25 Jahren bereits eine Höhe von ca. 15 Metern erreicht hatten. In gebührendem Abstand standen schlanke Zypressen und Zedern, die auch schon fast zwölf Meter erreicht hatten. Es gab auch Laubbäume, wie Akazien und Korkeichen. Der Boden war bedeckt mit Moosen und Farnen, die immer noch, nach 30 Jahren, durch ein raffiniert ausgeklügeltes System von Schläuchen bewässert wurden. Dies war und ist das Geheimnis, warum – trotz des mageren Sandbodens – alles so gut wächst. Aber schon Herr Böhmer hatte mir erklärt, dass der Sand der Wüste, hier in der westlichen Sahara, sehr mineralreich sei. Mit der Bepflanzung bei der ersten Bodenbearbeitung musste man nur noch ein wenig Kunstdünger zugeben, dann waren die meisten Pflanzen zufrieden. Aber nach der jahrtausendelangen Trockenzeit war der Durst natürlich groß. Eine ausreichende Wasserversorgung ist hier lebenswichtig, auch wenn die Bäume schon erwachsen sind. Nach einem kurzen Fußmarsch erreichte ich das erste Reisfeld, das völlig von Wasser bedeckt war. Leider gab es auch schon Schwärme von Mücken, die sich förmlich auf mich stürzten und jede Menge Blut trinken wollten. Offenbar schmeckte ihnen das entsalzte Wasser hier zu fade. Da ich nicht als Mücken-Tankstelle dienen wollte, zog ich mich sehr schnell wieder zurück in den Wald, in dem es angenehm kühl war – jedenfalls für die klimatischen Verhältnisse hier. Auf dem Weg durch den Wald kam ich an eine Weggabelung, der ich jetzt in eine andere Richtung folgte. Ich hörte von weitem die Töne eines fröhlichen afrikanischen Gesanges. Als ich aus dem Wald auf eine sehr große Lichtung kam, gelangte ich in das Obstanbaugebiet von Neuwasser. Ich benutze jetzt einfach mal die deutsche Übersetzung des Ortsnamens Al-Jadi(d)maya, denn der Name sagt ja genau aus, was der Zweck des gewaltigen Unternehmens der Sahara-Rekultivierung ist. Eine Gruppe von Arbeitern und Arbeiterinnen war gerade bei der Apfelsinenernte. Dabei sah ich zum ersten Mal die neuartigen Ernte-Automaten. Eine kleine Maschine wird an den Baum herangefahren. Zwei gepolsterte Arme umschlingen den Baum und fangen zunächst ganz zart an, den Baum zu schütteln. Nur die reifen Früchte fallen herab, während die Früchte, die noch nicht so weit sind, die nächsten Tage oder Wochen Zeit haben, bis zur optimalen Reife am Baum zu bleiben. Die heruntergefallenen Orangen werden in einem zuvor aufgespannten Netz aufgefangen und durch die Arbeiter mit der Hilfe eines in der Größe passenden Saugrohres auf ein Transportband befördert, das die Ernte weiter auf einen Elektro-Lkw lädt. Sobald der Wagen vollgeladen ist, fährt er automatisch zur Transrapid-Ladestation, wo eine Packerei die Früchte in Transportkisten packt und diese nach einem vorliegenden Plan an verschiedene Großmarkthallen in Europa adressiert. Die Verbraucher halten spätestens drei bis vier Tage nach der Ernte die frischen Früchte in den Händen und zwar bis hin zum Nordkap. Sogar Moskau wird auf diese Weise mit frischem Obst versorgt. Man hat mir erzählt, dass einige Kisten Obst sogar bis nach Sibirien gelangen, allerdings dauert der Transport dann etwas länger. Genial. Ich schaute mir das muntere Erntetreiben eine ganze Weile an und war erstaunt, dass während der ganzen Prozedur keine menschliche Hand die Früchte berührt hat – es sein denn, die eine oder andere Frucht war mal auf den Erdboden gefallen. Ich habe eine junge Frau aus der Gruppe der Pflücker angesprochen – sie war sehr dunkelhäutig – und sie gefragt, ob ich etwas helfen könnte. Ja, das könnte ich mit dem Aufsammeln heruntergefallener Früchte. So habe ich mich noch etwa eine Stunde nützlich gemacht. Dann war Mittagspause, und ich hatte einen Riesenhunger. Ich wanderte also zurück zu meinem Hotel, dem einzigen im Ort, meldete mich an und stellte fest, dass heute Ruhetag war. Eine etwas mürrische Frau erklärte mir, dass alle Zimmer belegt seien, denn schließlich sei ja jetzt Erntezeit und das letzte freie Zimmer habe sie vor einer halben Stunde an eine Dame vergeben, die morgen früh die botanische Rundreise mitmachen wollte. „Aber genau das will ich auch, und genau deshalb habe ich mich doch in Ihrem Haus angemeldet!?“ „Davon ist mir nichts bekannt. Wie war der Name?“ Aber auch der war ihr unbekannt „… Und wo bekomme ich etwas zu essen?“ Im Industriegebiet gäbe es ein Restaurant, und dort könnte ich etwas essen. Leicht verärgert zog ich wieder ab. Wenn ich hier nicht übernachten konnte, musste ich hier auch nicht essen. Ich lief zu meinem Luft-Heli, setzte mich hinein und gab die Koordinaten meines Hotels in Agadir ein. Flughöhe 1000 Meter. Nach etwas über 30 Minuten landete ich wohlbehalten und vollautomatisch auf dem Dach meines Hotels in Agadir. Was ich dort zu Mittag gegessen habe, weiß ich aber nicht mehr. Am Nachmittag und Abend habe ich an meinen Aufzeichnungen gearbeitet und mich auf die folgenden drei Tage der Rundreise vorbereitet. Ich hatte mir eine Landkarte besorgt, um zu sehen, wo die Reise morgen entlangführte. Das rekultivierte Algerische Gebiet war inzwischen, das heißt innerhalb von 30 Jahren seit den allerersten Anfängen, so groß angewachsen wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Es gab inzwischen zehn gewaltige Meerwasser-Entsalzungsanlagen am Mittelmeer, die alle mit Solarkraftwerken deutscher und chinesischer Bauart betrieben wurden. Es gab nun auch 25 größere Seen als Zwischenspeicher für die Bewässerung des Landes. Der entfernteste lag etwa 800 Kilometer von der Küste entfernt. Am meisten gespannt war ich auf den 15 Jahre alten künstlichen Urwald, der aber eigentlich gar kein Urwald in diesem Sinne war, sondern eine wissenschaftlich geplante Ansiedlung von wertvollsten Tropenbäumen, die kostbarste Hölzer für die Möbel-Industrie liefern sollten. Wenn die Bäume 30 Jahre alt wären, könnte man die Anpflanzungen ausdünnen und erste Ernten einfahren. Man hatte begonnen, alle fünf Jahre eine neue Anpflanzung dieser Art anzulegen, um eines Tages immer wieder, Jahr für Jahr, abholzen zu können, ohne an Waldbestand insgesamt zu verlieren. Nach jeder Abholzung, die wegen der unterschiedlichen Baumarten mit ganz verschiedenem Ernte-Alter mehrere Jahre andauern kann, würde wieder neuer Tropenwald an der gleichen Stelle angepflanzt – so stand es in dem Orientierungsblatt für unsere Rundreise zu lesen. Auch das finde ich genial. Am nächsten Morgen flog ich wieder los und nahm noch eine Dame aus dem Hotel mit, die auch an der Rundfahrt teilnehmen wollte. Ich war ganz froh darüber, denn sie hat sich an den nicht ganz billigen Flugkosten beteiligt
Der Flug zu unserem Treffpunkt verlief ohne Pobleme. Ein merkwürdig aussehender Kleinbus mit einem Bug wie von einem Motorboot, der offenbar eine Kombination aus Brennstoffzellen- und Elektrofahrzeug war, stand schon zur Abfahrt bereit. Punkt zwölf Uhr ging es los. Der Reiseleiter begrüßte uns und hielt zunächst einen kleinen Vortrag. Er sagte uns, dass Algerien das größte Land Afrikas sei. (Ich habe später in meinem schlauen Smartphone nachgesehen: Algerien ist siebenmal größer als Deutschland.) Da trotz der rasanten technischen und wirtschaftlichen Entwicklung Algeriens noch längst nicht alle Ansiedlungen per Auto erreichbar seien, habe seine Reisegesellschaft ein Spezialfahrzeug der Firma Tesla zur Verfügung gestellt, mit dem man jeden Punkt des Landes erreichen könne. Und das könne man wörtlich nehmen, denn dieses Fahrzeug kann fahren, fliegen und schwimmen „Da die Ausdehnung des Landes sowohl in der Länge als auch in der Breite annähernd 2.000 Kilometer beträgt, ist eine Rundreise in drei Tagen anders nicht möglich. Seit 30 Jahren werden in Algerien nun die Wüstengebiete rekultiviert. Wir haben davon noch nicht einmal ein Zehntel geschafft. Es wird noch mindestens weitere 100 Jahre dauern, bis wir das ganze Programm abgewickelt haben werden. Aber eines kann man schon heute feststellen: Das ehemals extreme Klima mit Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht von bis zu 40 Grad hat sich in den bereits rekultivierten Gebieten schon erheblich gemildert. Auch die einst seltenen Regenfälle haben zugenommen und die Heftigkeit des Sturzregens hat abgenommen. Die Grundlage und Voraussetzung für das Aufblühen unseres Landes ist Wasser. Aber Süßwasser gibt es normalerweise nicht in der Wüste. Wir müssen es herbeischaffen, und wie das geschieht, werde ich Ihnen als Erstes zeigen. Die Technik der Meerwasserentsalzung hatten wir Ihnen ja bereits in dem Rundreise-Prospekt erläutert, das Ihnen mit Ihrer Teilnahmekarte zugeschickt worden ist. Wir zeigen Ihnen, wie wir Wasser in die Wüste tranportieren. Die Sahara wird in unserem Land im Norden abgegrenzt durch das Atlas-Gebirge, genauer gesagt durch den Tell-Atlas. Diese Berge sind für die Wüstenbewässerung zwar ein Hindernis, haben aber auch Vorteile. Durch den Einsatz der mordernen Sonnenkraftwerke verfügen wir über beliebig große Mengen von Energie. Mit der Kraft gewaltiger Pumpen befördern wir das entsalzte Meerwasser hinauf ins Gebirge. Auf der Südseite des Atlas-Gebirges entsteht dann zur Wüste hin ein Gefälle, das mit Hilfe der irdischen Schwerkraft das Wasser in die Ebenen der Sahara ohne Unterstützung weiterer Pumpen befördert. Teilweise benutzen wir die im Gebirge entspringenden Wadis anstelle von künstlichen Wasserleitungen. Wadis sind Wasserläufe, die nur zeitweise Wasser führen und später in der Wüste versickern. Dort, wo die Wadis früher endeten, legen wir jetzt Seen an, die mit dem entsalzten Meerwasser befüllt werden. Für die verschiedenen Bepflanzungen benötigen wir auch unterschiedliche Wasserqualitäten. All das Wasser, das wir in die Trockenzonen des Landes leiten, wird an Ort und Stelle erst einmal in künstlich angelegten Seen oder größeren Teichen gespeichert, denn der Wasserbedarf der Anpflanzungen ist ja unterschiedlich, während die Wasseranlieferung kontinuierlich erfolgt. Die Bewässerungs-Automatik mixt dann je nach Bepflanzung Süßwasser mit Salzwasser oder mit erforderlichen Mineralstoffen. Für den menschlichen Bedarf an Trinkwasser werden dem sterilen, entsalzten Süßwasser ebenfalls noch einige Mineralien beigemischt. Soweit die Einführung und jetzt fliegen wir los.“ Wir stiegen ein, nahmen Platz, wobei jeder versuchte einen Fensterplatz zu ergattern. Doch das war gar nicht nötig, denn der Boden bestand aus einer großen Plexiglasplatte, die einen freien Blick nach unten erlaubte. Beim Einsteigen konnten wir noch beobachten, wie das flexible Dach in den Fahrzeugrumpf eingezogen wurde und wie sich gleichzeitig vier dreiflügelige Rotorblätter entfalteten. Drinnen konnten wir erleben, wie unser Reiseführer die Koordinaten der nächsten Landeposition eingab, die Flughöhe bestimmte und auf den Starterknopf drückte. Sanft wurden wir in die bequemen Sessel gedrückt, bis die gewünschte Flughöhe erreicht war. Unter uns sahen wir ringförmige Waldstücke, bestehend aus Kiefern, Zypressen und Atlaszedern. Dazwischen konnte man Reisfelder, Spargelfelder, Gemüse- und Obstplantagen sehen. Die Fontänen der Bewässerungen waren von hier oben aus gut zu beobachen. Vereinzelt sahen wir auch Ortschaften, die offenbar alle jünger als 30 Jahre waren und die durch schmale Straßen miteinander verbunden waren. Nach etwa 40 Minuten Flugzeit landeten wir sanft auf der Südseite des Tell-Atlas neben einem gewaltigen Solarkraftwerk. Menschen waren nur ganz wenige zu sehen, denn inzwischen gibt es ja für fast alles, wozu früher Handarbeit nötig war, intelligente Roboter, vorausgesetzt, dass genügend Strom verfügbar ist. Und daran mangelt es hier in diesem sonnenreichen Lande nicht. Neben dem Kraftwerk schloss sich ein in einer tiefen Mulde gelegener See an, in dem das vom Meer hochgepumpte Wasser gestaut war. Von dieser Wasserversorgungsstation wird das Wasser in offene Täler geleitet, in denen je nach Jahreszeit mehr oder weniger Gebirgswasser fließt. So verwandeln sich Rinnsale in ansehnliche Flüsse. An den Gebirgsabhängen waren, so weit das Auge reichte, Rebstöcke zu erblicken, die je nach Lage und Sorte grüne oder blaue Trauben trugen und teilweise auch schon gepflückt waren. In dem kleinen Verwaltungsgebäude wurden wir auch gleich zu einer Weinprobe eingeladen, die die Stimmung unserer kleinen Gesellschaft hörbar anhob. Es gab drei Sorten: einen Aperitifwein mit köstlich-frischem, vollmundigem Aroma, einen Tischwein mit einer etwas säuerlichen Note und einen Abendwein, der es in sich hatte. Er schmeckte würzig und süß mit gleichzeitig leicht säuerlichem, aber dezentem Aroma. Köstlich! Der Leiter der Kraftstation, der sich offenbar über unseren Besuch freute, erklärte uns die Funktionsweise des Solarkraftwerkes. Mehrere gebündelte Hohlspiegel fangen die Sonnenstrahlen ein und konzentrieren sie auf die Metallflächen großer rotierender Wasserkessel, so dass auf dem Auftreffpunkt Temperaturen von ca. 1.200 Grad entstehen, die das unter hohem Druck stehende entsalzte Wasser sofort zur Dampferzeugung bringen. Dieser Dampf erfüllt zwei Funktionen: Zum einen wird in einem Spezialverfahren Wasserstoff erzeugt, zum anderen treibt er stromerzeugende Turbinen an. Der Wasserstoff übernimmt nachts – wenn keine Sonne scheint – den Antrieb der Turbinen, sodass kontinuierlich Strom zur Verfügung steht. Der Strom wird unter anderem zur computergestützten Steuerung der Bewässerungsanlagen benötigt. Das Innere des Kraftwerkes durften wir wegen der dort herrschenden feuchten Hitze nicht betreten. Wir machten einen kurzen Spaziergang durch die Anlage, die hin und wieder von uralten Olivenbäumen beschattet wurde. Unterhalb der Station begann einer der erwähnten Wasserläufe, eine tiefe Schlucht, deren Wasser ursprünglich allein von den Niederschlägen des Gebirges stammte, aber nun mit der fünffachen Menge entsalzten Meerwassers ergänzt wurde. Mit einem rauschenden Wasserfall beginnt dieser neue Fluss, der früher nach kurzer Strecke in der Wüste versickert war, jetzt aber in einem künstlichen See etwa 300 Kilometer entfernt mündet. Auf der ganzen Strecke wird diesem Fluss Wasser für die neuen Wälder und Felder entnommen, bis zum Schluss nur noch ein überschaubares Rinnsal übrig bleibt, nachdem etwa 600 Quadratkilometer Felder und Wälder versorgt wurden. Der See, in den der Flusslauf endlich mündet und der noch einen zweiten Zulauf hat, versorgt dann weitere 600 Quadratkilometer Pflanzungen mit Wasser. Unsere nächste Station war also dieser See, genannt Al-behirasahara, den wir nach 45 Minuten Flugzeit erreichten. Der See war so groß, dass wir das jenseitige Ufer nur noch schwach erkennen konnten. An den Ufern waren vereinzelt prächtige Villen zu sehen. Auch einzelne Segelboote kreuzten durch das leicht wellige Wasser. Hier war der Ort, wo das Gebirgswasser noch bis vor 30 Jahren versickert war. Der Grundwasserspiegel war allerdings ergiebig genug, sodass sich hier schon seit Jahrhunderten eine Oase befand. Wir hatten inzwischen alle tüchtig Hunger. Ein kleines Hotel am See, in dem wir auch übernachteten, servierte uns ein köstliches Schawarma (gegilltes Lamm mit Huhn und Salat), und dazu gab es wahlweise Bier, Wein oder Fruchtsaft. Am Abend wurde uns ein Film über die Renaturierung der Sahara in den vergangenen 30 Jahren vorgeführt. Man kann nur staunen, wie dieses einst so lange rückständige Land zu neuer Blüte erwacht ist und heute schon zu einem wichtigen Exporteur für Südfrüchte, Gemüse, Reis und Wasserstoff-Treibstoff im Welthandel aufgestiegen ist. Und, noch einige Jahre weiter, dann wird Algerien wohl auch der wichtigste Lieferant für Edelhölzer sein. Nach dem Essen unternahm ich noch einen Spaziergang am Seeufer entlang. Die Orts-Verwaltung hatte – sehr vernüftig – dafür gesorgt, dass die Privatgrundstücke nicht direkt bis ans Seeufer heranreichen dürfen. Der Grund: Der Wasserspiegel des Sees verändert sich je nach Entnahmemenge sehr erheblich. Zum anderen sollte der Öffentlichkeit und den Gästen nicht der Zugang zum See versperrt werden. Einige Strecken am Ufer dienten als öffentliche Parkanlage. Die Bäume darin waren zwar noch alle sehr jung, aber man konnte schon ahnen, was für exotische Prachtexemplare der Natur hier in Kürze ihre ganze Schönheit entfalten würden. Am nächsen Morgen ging der Flug zum Chott Melghir, ganz im Nordosten Algeriens, das inzwischen zum größten Reisanbaugebiet der Welt entwickelt wurde. Es handelt sich dabei um einen ehemaligen Salzsee, der etwa 40 Meter unter dem Meeresspiegel liegt. Je nach Jahreszeit trocknete der See fast ganz aus. Nach ausgiebigen Regenfällen (die hin und wieder vorkamen) konnte dieses geheimnisvolle Gewässer eine Ausdehnung bis 6.700 Quadratkilometern und 200 Kilometer Länge einnehmen. Das Klima ist mörderisch heiß, doch dank modernster Technik wurde hier aus einem Höllenloch ein Zentrum der Landwirtschaft geschaffen. In der Zeit, in der der See fast ausgetrocknet war, wurde mit Riesenbaggern die am Seeboden gebildete Salzschicht abgetragen und ins Mitelmeer versenkt. Übrig blieb eine salzhaltige Schlammschicht. Auch an der nordöstlichen Mittelmeerküste des Landes wurden Solarkraftwerke, Solarfelder, Windkraftanlagen und weitere Meerwasser-Entsalzungsanlagen gebaut, deren Wasserströme ebenfalls ins Tellatlasgebirge hochgepumpt und dort auf die zahlreichen Quellen der Wadis verteilt wurden. Diese Flüsse sind aber genau diejenigen, die in der Regenzeit das Chott mit Wasser versorgen. Auf diese Weise spart man kilometerlange Rohrleitungen, die sonst zur Wüstenbewässerung benötigt würden. Jetzt kann man also den Wasserspiegel des Sees künstlich und nach Bedarf steuern. Quer durch den See hat man zwei Dämme gebaut, die den See in drei Teile abteilen, wobei das östliche und das westliche Seegebiet so flach gehalten wird, dass ein großflächiges Reisanbaugebiet entsteht. Die in Marokko gezüchtete Reissorte für salzhaltigen Boden gedeiht hier prächtig. Der in der Mitte verbliebene See gibt gerade so viel Wasser an die Reisfelder ab, wie benötigt wird. Der Wasser-Überschuss wird in die umliegenden Wüstengebiete weitergeleitet. Anbau und Reisernte erfolgen weitgehend automatisch. Von Menschenkraft wäre das wegen der riesigen Ausdehnung des Anbaugebietes auch gar nicht zu bewältigen. Unser Reiseleiter lud uns zu einer Seerundfahrt ein. Das allein war schon ein Erlebnis. Wir flogen bis zur Seemitte. Dort setzte unser Flieger auf dem Wasser auf, zog die Rotoren ein, und schon waren wir alle Schiffspassagiere. Auf der etwa zweistündigen Rundfahrt konnten wir viele Tierarten beobachten, Flamingos, Enten, Schwäne, Haubentaucher, sogar Seeotter gab es. Durch den Glasboden des „Schiffes“ konnten wir zahlreiche Fische beobachten. Das Erstaunlichste war: Es schwammen sogar einige Störe im See. Wir erfuhren, dass diese wertvollen Tiere extra gezüchtet würden, um eines Tages auch große Mengen Kaviar exportieren zu können. Man kann immer wieder staunen, was dieses Land in den vergangenen Jahren geleistet hat. Da trotz weitgehender Automatisierung auf den verschiedensten Gebieten für die land- und forstwirtschaftliche Entwicklung viele zusätzliche Menschen als Arbeitskräfte benötigt werden, ist Algerien heute ein beliebtes Einwanderungsland. Menschen kommen aus Gebieten Afrikas ins Land, die früher aus ihren Heimatländern hätten fliehen müssen, um nicht zu verhungern oder in Bürgerkriegen umzukommen. Was für eine Wende der Lebensbedingungen, die letztlich auf die Erfindung der Solarkraftwerke zurückzuführen ist! Wir übernachteten in einem einfachen Hotel in der ehemaligen „Wüstenstadt“ Biskra, die sich in den letzten Jahren mit Bäumen und Blumenbeeten schön herausgeputzt hat. Der dritte und letzte Tag unserer Rundreise sollte der Höhepunkt werden: drei Rundfahrten oder Wanderungen durch neu entstandene Wälder, einen Tropen-, einen Mammutbaum- und einen Mischwald mit anschließender Savanne, die der Viehweide dient. Wir mussten jetzt wieder ganz nach Südwesten fliegen, eine Strecke von etwa 1.200 Kilometern. Dabei überquerten wir weite Strecken, die noch unbearbeitete Wüste waren. Aber eines war jetzt schon deutlich zu erkennen: Wir sahen unter uns streckenweise rot blühende Hügel oder bunt blühende Ebenen, wo vor zehn Jahren noch unberührte Wüste lag. Unser Führer erklärte uns lachend: „Ja, wir haben schon ohne jede Bearbeitung erreicht, dass jetzt in einigen Teilen der Sahara zwei- bis dreimal pro Jahr Regen fällt. Hier, diese bunten Felder sind das Ergebnis. Es bilden sich Bachläufe, die zwar immer wieder austrocknen, aber der vom Regen angefeuchtete Sand lässt viele Sorten an Blumen und Sträuchern wachsen. Die Hitze der nachfolgenden Trockenzeit bereitet diesem bunten Spuk allerdings bald wieder ein Ende. Doch die Blumen, die hier wachsen, haben sich so angepasst, dass sie in der kurzen Zeit ihrer Blüte schon Samen bilden können. Jetzt blühen sie zwei- bis dreimal pro Jahr, während sie früher manchmal bis zu zehn Jahren warten mussten, bis der nächste Regen fiel.“ Nach etwa zweieinhalb Stunden Flugzeit waren wir am Ziel. Wir landeten in einer kleinen Ortschaft in der Nähe der Stadt Abadla, die auch wieder einen neuen Namen bekommen hatte, den ich aber vergessen habe. In der Ortschaft gab es eine Försterei, eine Baumschule, Unterkünfte für die Waldarbeiter und natürlich auch wieder Gewächshäuser. Die Forstbediensteten (keine Beamten) und die Gärtner bewohnten eine aus etwa 100 Häusern bestehende Reihenhaussiedlung. Unser Reiseführer machte uns mit dem leitenden Oberförster bekannt, der für die folgenden Stunden die Führung unserer Gruppe durch die Wälder und die Savanne übernahm. Die Wasserversorgung hier war eine technische Meisterleistung. Aus mehreren Mittelmeer-Entsalzungsanlagen wurde bis hierhin über Hunderte von Kilometern, zum Teil mitten durch Gebirgslandschaften, eine gigantische unterirdische Wasserleitung verlegt, die auch das auf der Strecke liegende Chott Chergui mit Frischwasser versorgte, in dessen Umgebung ebenfalls eine neue Kulturlandschaft entstand. Unser „Flugboot“ setzte sich nun als Geländewagen in Bewegung. Nach kurzer Fahrt erreichten wir den tropischen Urwald. Eine Bewässerungsanlage schoss Wasserfontänen hoch in die Luft, sodass der Wald permanent beregnet wurde und die Luft einen hohen Feuchtigsgrad annahm. Die Bäume waren noch nicht allzu hoch gewachsen, denn sie waren ja alle nicht älter als 25 Jahre, doch der Boden hatte durch herabfallendes Laub in Kombination mit der Bodenfeuchtigkeit eine dünne Humusschicht gebildet, die sich wie ein Brei ausgebreitet hatte. Da das Blätterdach noch nicht allzu dicht war, gab es einen Bodenbewuchs aus Moosen, Pilzen und Farnen. Auch einige Orchideen hatten sich hierher verirrt. Das Gelände war sehr wellig, und der Weg, den wir befuhren, war holperig. Gut, dass unser Wagen einen Vier-Rad-Antrieb besaß. Man konnte sich gut vorstellen, dass hier früher hohe Sanddünen existiert haben mussten. Herr Hammamed, so hieß der Oberförster, erklärt uns die verschiedenen Baumarten, die einmal zu Edelhölzern heranwachsen sollten. Diese Bäume hier waren bereits die zweite Bepflanzung, da der Boden zunächst durch schnellwachsende, humusbildende Sträucher vorbereitet werden musste. Aussteigen wollten wir hier nicht. Dafür war es zu feucht. Plötzlich lichtete sich der Wald, und wir kamen an einer Anpflanzung vorbei, in der verschiedene Leute arbeiteten. Ein Lieferwagen hatte junge Pflanzen aus der Baumschule geladen, die hier eingepflanzt werden sollten. Das ging ruckzuck. Ein Maschinenbohrer bohrte ein armdickes Loch in den Boden, ein zweiter Arbeiter schüttete schätzungsweise ein Kilo Langzeitdünger hinein, setzte die junge Pflanze ins Loch, schüttete aus einem dicken Rohr, das mit einem tankwagenähnlichen Fahrzeug verbunden war, dickflüssige Erde darauf und stampfte alles fest. Sobald eine Pflanzreihe fertig war, wurde alles unter Wasser gesetzt, damit sich die Wurzeln der jungen Bäume ordentlich vollsaugen konnten. Herr Hammamed erklärte uns, dass alle fünf Jahre eine neue Edelholzpflanzung angelegt werde, damit die Ernte nach 50 bis 65 Jahren kontinuierlich erfolgen kann, ohne dass Lieferengpässe entstehen. Die ganze Schonung war vorher mit einem Drahtzaun umgeben worden, damit die aus der Wüste vordringenden Gazellen, Giraffen und Elefanten nicht wieder die jungen Bäume abfressen. Unter den Tieren musste es sich schon herumgesprochen haben, dass es im nördlichen Algerien Grasland, Bäume und sogar herrliche Obstbäume gibt. So sind aus dem mittleren Afrika über Hunderte von Kilometern durch wasserlose Wüste einige Tierherden zugewandert. Wie das funktioniert hat, konnte mir niemand erklären. Das galt auch für viele Vogelarten, die sich hier neu angesiedelt hatten. Die Fahrt ging weiter nach Süden, und was wir jetzt sahen, hat mir den Atem verschlagen: Ein Wald mit Mammutbäumen breitete sich über mehrere Kilometer vor uns aus. Die Bäume waren dafür vorgesehen, für die nächsten 3.000 Jahre hier zu stehen und für ein gemäßigtes Klima zu sorgen. Allzu hoch waren auch diese Bäume noch nicht gewachsen, denn sie waren auch nur 25 Jahre alt, einige noch jünger. Sie waren bewusst in Abständen von mindestens 15 Metern voneinander gesetzt worden, denn sie breiten sich stark aus und dürfen einander nicht behindern. Zwischen den Bäumen waren Rhododendren und Azaleensträucher angepflanzt worden. Im Frühjahr muss das einen herrlichen Anblick geben, wenn die Sträucher in verschiedenen Farben blühen. Hier stiegen wir noch einmal aus, um die wunderbare würzige Luft zu genießen. Am Boden wuchsen auch verschiedene Gräser. Der sandige Untergrund war nirgendwo mehr zu entdecken. Die letzte Etappe war noch weiter südlich und führte uns in eine Graslandschaft, auf der nur vereinzelt Zedern, Zypressen und Kiefern, auch einige Pinien wuchsen. Wie wir vom Oberförster erklärt bekamen, sollte hier in einigen Jahren eine Viehzuchtstation entstehen, die dann endlich auch für Algerien Frischmilch liefern sollte, was bislang dort noch eine Rarität war. Ein kleiner künstlicher See besorgte die knappe Bewässerung, die verhinderte, dass sich hier größere Waldflächen bildeten, denn dieses Gebiet hier sollte Weidefläche bleiben. Wir sahen in der Ferne große Gnu-Antilopen und auch einige Giraffen. Aber dies waren nicht die einzigen Tiere, die sich hier angesiedelt hatten. Erdmännchen und Ameisenbären, aber auch Schlangen und Skorpione, die schon immer hier gelebt haben, hatten sich an die veränderten Lebensbedingungen angepasst. Herr Hammamed erklätte uns, dass man noch auf der Suche nach einer geeigneten Rinderart sei, die die hohen Temperaturen, die hier auch in Zukunft noch herrschen werden, gut vertragen können. Aber wie bekommt man die Frischmilch in die über 1.000 Kilometer entfernten Großstädte, wo sie so dringend gebraucht wird? „Ganz einfach“, meinte Herr Hammamed, „mit Hilfe eines hier geplanten Solarkraftwerkes kühlen wir die Milch auf plus zwei Grad Celsius herunter und befüllen täglich ein bis zwei Spezialflugzeuge, die anstatt einer Passagierkabine einen großen Tankraum besitzen. Diese Maschinen werden außer Algier auch noch mehrere Großstädte in unserem Land, in Marokko und Tunesien mit Milch versorgen. Das ist zwar noch keine ganz ideale Lösung des Problems, aber es sichert erst einmal die Versorgung. Sicherlich gibt es eines Tages noch eine bessere Lösung. Vielleicht kann man mit Unterstützung von Sonnenenergie und entsalztem Meerwasser an den Hängen des Atlasgebirges Almwiesen erschaffen, die diese Aufgaben in der Nähe der Großstädte übernehmen können.“ Gegen Nachmittag war unsere vierstündige Rundreise beendet. Wir bedankten uns bei Herrn Hammamed, bestiegen unser tolles Universalflugzeug der Firma Tesla, USA, und flogen zurück nach Al-Jadimaya. Dort bestieg ich mit meiner Reisebegleitung aus Agadir, einer Französin, mit der ich mich inzwischen angefreundet hatte, mein von Herrn Böhmer ausgeliehenes Flugzeug. Ich gab die Koordinaten vom Garten Eden ein, und alles andere erledigte die perfekte Automatik. Wir landeten kurz vor Dunkelheit auf dem dortigen Landeplatz. Ich tankte die Maschine noch voll, denn das war so mit Herrn Böhmer vereinbart. Wir trafen Herrn Böhmer noch in seinem Büro an, wo ich ihm die Papiere und den Zündschlüssel mit bestem Dank übergeben konnte. Sehr freundschaftlich nahmen wir von einander Abschied, denn ich fand es sehr nett von ihm, mir sein Privatflugzeug gleich für mehrere Tage anzuvertrauen. Ich bot ihm an, dass ich mich gern für seine Gastfreundschaft revanchieren würde. Wenn er mal besuchsweise oder für immer nach Deutschland kommen sollte, müsste er auch Aachen besuchen, damit ich ihm die alte Kaiserstadt zeigen könnte. Bis heute ist er aber leider nicht erschienen. Mein Leihwagen stand unversehrt noch auf dem Firmen-Parkplatz. Yvonne und ich fuhren damit nach Agadir zurück, wo wir spät in der Nacht in unserem Hotel eintrafen. Meine neue Freundin Yvonne wollte eigentlich noch ein paar Tage in Agadir bleiben. Ich konnte sie aber überreden, mit mir per Transrapid nach Tanger zu reisen, dort umzusteigen und die neue Transrapidstrecke über Algier nach Tunis kennenzulernen. Sie war einverstanden, und ich war froh, nun eine Reisebegleitung zu haben. Zu zweit macht das Reisen doch viel mehr Spaß. Der Fahrpreis war gar nicht hoch. Überhaupt, alle Preise für Verpflegung und Unterkunft waren hier viel günstiger als bei uns zu Hause. Am nächsten Morgen fuhren wir los und schon drei Stunden später stiegen wir in Tunis aus, denn dies war die vorläufige Endstation der Transrapid-Verbindung. Aber eigentlich wollten wir noch nach Libyen weiterreisen. Die Aufforstungsarbeiten in Tunesien wollten wir nicht auch noch besichtigen, denn die unterschieden sich kaum von denen in Algerien. Libyen. Von Tunis aus war die neue Strecke nach Tripolis seit zwei Jahren im Bau, doch war sie noch nicht betriebsbereit. Ich hatte mich über die aktuellen Zustände in Libyen schlau gemacht. Nach einem zwei Jahrzehnte dauernden Bürgerkrieg hatten sich die streitenden Parteien endlich vor etwa 25 Jahren geeinigt und die Vernunft siegen lassen. Die positive Entwicklung des Nachbarlandes Algerien war von den Libyern ja nicht unbemerkt geblieben. Die sozialen Unterschiede zwischen den beiden Ländern waren aber bis vor Kurzem noch extrem. Nun wollte man nach dem Beispiel von Algerien ebenfalls die von der Uno zur Verfügung gestellten Mittel zur Renaturierung der libyschen Sahara in Anspruch nehmen. Außerdem standen hohe Fördermittel dafür auch aus den USA, Deutschland, China und der Türkei bereit. Allmählich leerten sich die Flüchtlingslager. Aus allen Ländern Afrikas und auch aus dem Nahen Osten strömten Tausende von Menschen ins Land, um sich an den Aufforstungsarbeiten zu beteiligen und dort gutes Geld zu verdienen, glücklich, nicht mehr aus purer Not übers Meer flüchten zu müssen. Als allererste Investition und als Grundlage für alle weiteren Maßnahmen mussten mehrere Solarkraftwerke installiert werden, was damals gar nicht so einfach war, denn die Jülicher Produktionsanlage hatte Lieferengpässe, weil viel mehr dieser großartigen Energiespender aus aller Welt bestellt wurden als ausgeliefert werden konnten. Aber nachdem in Küstennähe drei dieser Kraftwerke, verstärkt durch Hochleistungs-Solaranlagen modernsten Bautyps und Windkraftanlagen, den Betrieb aufnehmen konnten, wurden ebenfalls drei Meerwasser-Entsalzungsanlagen fertiggestellt und in Betrieb genommen. Nun war der Anfang gemacht
Peking–Moskau. Nach meiner ersten Reise durch Nordafrika hat mich die Faszination der Wüsten-Rekultivierungen nicht mehr losgelassen. In den folgenden Jahren besuchte ich in den großen Ferien Spanisch-Marokko, Mali, Mauretanien, Tschad und Niger. Seit 2067 bin ich pensioniert und genieße meine Freiheit. Ich muss aber gestehen, dass mir manchmal meine Schüler, Jungen wie Mädchen, schon ein bisschen fehlen, denn ich bin immer gern Lehrerin gewesen, obwohl mir in den letzten Jahren meiner Berufstätigkeit der tägliche Kinderlärm schon etwas auf die Nerven ging. Aber jetzt war ich nicht mehr auf die großen Ferien als Reisezeit angewiesen. Jetzt konnte ich mir die beste Reisezeit für die Länder aussuchen, die ich bereisen wollte. Als ich 2028 in der Presse las, dass eine Transrapidstrecke von Peking nach Moskau geplant war, habe ich einen Weltatlas zur Hand genommen und mir angeschaut, was für eine gewaltige Entfernung das ist, nämlich 5.800 Kilometer. Und von Moskau nach Berlin sind es noch einmal 1.600 Kilometer. 1.900 weitere Kilometer würde man bis Madrid benötigen. Also 9.300 Kilometer, das ist fast ein Viertel des Erd-Umfangs, könnte man jetzt unterirdisch reisen. Das ist schon unglaublich, dass dies gelungen ist. Aber das ist ja noch nicht alles, denn man kann heute ja schon unterirdisch bis Tunis weiterreisen, und das sind weitere 2.050 Kilometer. Die ganze Strecke ist allerdings nicht machbar, ohne umsteigen zu müssen. Aber immerhin. Es ist schon ein harter Schlag gegen die klimaschädliche Luftfahrt und deren Industrie, der mit solch einer gewaltigen Hochgeschwindigkeitsstrecke gelungen ist. Allerdings – die Entwicklung ist auch auf der Ebene der Luftfahrt nicht stehengeblieben. Ich hatte ja schon erwähnt, dass es seit etwa 20 Jahren, also seit 2060 neue Flugzeugtypen gibt, die die Nachfolge der einst so berühmten französisch-britischen Concorde angetreten haben. Diese Maschinen haben sich nun ihrerseits zu einer ernsthaften Konkurrenz zum Transrapid-Fernverkehr entwickelt, weil sie wesentlich schneller fliegen, als die Transrapids schweben können, nämlich mit vierfacher Schallgeschwindigkeit und dies in 30 Kilometern Flughöhe, mit umweltverträglichem Wasserstoff-Antrieb. Der Nachteil: Diese Flüge sind sündhaft teuer und lohnen den Einsatz nur für extrem weite Flugstrecken. Ich habe den Bau der superweiten Transrapidstrecke jahrelang in der Presse mit Interesse verfolgt. Mehr als zehn Jahre hat die Fertigstellung der Trasse Moskau – Peking gedauert. Viele Rückschläge hat es gegeben. Eine wichtige Frage war immer wieder zu klären: Was passiert, wenn auf einem Streckenabschnitt eine Störung auftritt, auf der über Hunderte von Kilometern keine größere Ansiedlung anzutreffen ist, die in der Lage wäre, Hilfe in medizinischer wie auch technischer Hinsicht zu leisten? Es gab da nichts anderes, als alle 100 Kilometer Bahnstrecke eine Hilfsstation anzusiedeln, wo ein Werkstattwagen, eine Sanitätsstation und ein Technikerteam stationiert wurden. Das hat die Strecke leider verteuert, doch war das aus Sicherheitsgründen nicht zu vermeiden. Ansonsten hat man bei der Streckenführung einige Stationen der Transsibirischen Eisenbahn integriert, wo großstädtische Einrichtungen, wie Hauptbahnhöfe, Werkstätten und Krankenhäuser bereits seit längerer Zeit vorhanden sind. Ich lebe ja eigentlich recht bescheiden. Meine Schwestern halten mir des Öfteren unter die Nase: „Ja – man gönnt sich ja sonst nichts!“ Dank des Erbes meines Opas konnte ich mir aber längere und ausgedehnte Reisen, auch extrem teure, hin und wieder leisten. Und Reisen mit den modernsten Verkehrsmitteln, aber auch um andere Länder und Kulturen kennenzulernen, das war schon immer meine Antriebsfeder. Dies war der Grund, warum in mir der Wunsch allmählich reifte, auch mal China etwas näher kennenzulernen. Dieses Land hat sich in den vergangenen 80 Jahren ganz gewaltig entwickelt. Anfang des Jahrhunderts haben die Chinesen ihre besten Köpfe unter ärmlichsten Verhältnissen auf die europäischen Universitäten geschickt, um so viel Wissen wie irgend möglich zu ergattern. Sie haben anfangs auch jede Menge Patente anderer Länder umgangen, studiert – und weiterentwickelt. Heute ist China selbst ein Land mit führender Technik, von der inzwischen andere Länder lernen wollen. Peking. Wir schreiben das Jahr 2068. Ich wollte einmal nach China reisen, weil mich die technische Entwicklung neben der uralten Kultur des Landes reizte, zum anderen, weil es
Der dritte Grund war ja der wichtigste: Mein ältester Sohn, 42 Jahre alt, war gerade Gastdozent an der Pekinger Uni. Ich freute mich auf unser Wiedersehen und auch darauf, seine zukünftige Frau, eine intelektuelle Chinesin aus sehr gutem und wohlhabendem Haus, kennenzulernen. Es war im September, als ich mit etwas Herzklopfen die vorbestellten Flugtickets für die Reise nach Peking kaufte. Der Fahrplan gab mir Auskunft: Abflug 10.10 Uhr ab Berlin, die Ankuft in Peking – nach Peking-Zeit – 19.40 Uhr, doch das wäre nach Berliner Zeit erst 12.40 Uhr! Also 7.400 Kilometer in zweieinhalb Stunden! Das ist atemberaubend und entspricht einer durchschnittlichen Fluggeschwindigkeit von 2.960 km/h einschließlich Start und Landung. Am Montag, den 10. September begann meine Reise. Punkt acht Uhr bestieg ich in Aachen den subterrestrischen Transrapid Richtung Berlin und war 9.40 Uhr in Berlin-Flughafen. Mein Gepäck hatte ich schon eine Woche zuvor per Luftpost an mein Hotel in Peking geschickt, sodass ich nur einen handlichen Rucksack und eine Handtasche als Reisegepäck bei mir hatte. Ich brauchte also keine Wartezeit zum Einchecken einzuplanen und musste mich in Berlin nur aus dem Kellergeschoss des Flughafens nach oben ins Parterre begeben, um mir meine Bordkarte am Schalter der China-Airlines abzuholen. Ein schnelles Rollband brachte mich nach wenigen Minuten zum richtigen Flugsteig, wo eine futuristische Maschine die Fahrgäste erwartete. Ich konnte beim Einsteigen erkennen, dass das Flugzeug eine extrem spitze Nase und weit nach hinten gebogene Flügel hatte, die (laut Beschreibung der Maschine in einem Prospekt) während des Fluges noch weiter nach hinten und noch näher an den Rumpf herangezogen werden konnten. Etwa 10.10 Uhr wurden die Triebwerke angelassen, die Maschine rollte auf die Startbahn, und Sekunden später erhob sie sich in die Lüfte. Ich muss noch erwähnen, dass die damaligen, „Hypermach“ genannten Flugzeuge keine Fenster hatten. Das Risiko, dass eine Undichtigkeit oder gar ein Zerbrechen der Scheiben bei den enormen Druckverhältnissen eines Überschallfluges passieren könnte, war wohl zu hoch. Die Geschwindigkeit in „Mach“ und die Flughöhe wurden über den Sitzen angezeigt. Würde man im Flugzeug einen Knall hören, wenn die Schallgrenze überschritten wird? Ich war gespannt. Aber das einzige, was zu spüren war, war ein kleiner Ruck, und das singende Geräusch der Triebwerke war nach meiner Wahrnehmung danach etwas leiser geworden. Ob man auf der Erde einen Knall gehört hat? Ich weiß das nicht. Möglicherweise waren wir ja auch schon über unbewohntem Gebiet. Ich hatte nach etwas über zwei Stunden Flugzeit meinen Kaffee noch nicht ganz ausgetrunken, als es hieß: „Fasten seatbelts, please – bitte anschnallen, die Maschine setzt zur Landung an!“ Wenige Minuten später setzte die Maschine weich auf der Pekinger Landebahn auf. Eine Zollabfertigung gab es nicht mehr. Das gehört der Vergangenheit an. Ich musste nur meinen Personalausweis vorzeigen und wurde registriert. Mein Sohn empfing mich am Ausgang. Als wir ins Freie traten, traute ich meinen Augen nicht. Blauer Himmel über Pekings Hauptflughafen, und die Luft war frisch und glasklar. Man muss allerdings sagen, dass der neue Flughafen von Peking sehr weit außerhalb der Stadtmitte liegt. Mein Sohn hatte eine kleine Wohnung in der Nähe der Universität, die ihm die Pekinger Uni zur Verfügung gestellt hatte. Da Peking selbst neun Millionen Einwohner hat und im nahen Umfeld weitere zehn Millionen Menschen wohnen, dauerte die Fahrt mit seinem automatischen Brennstoffzellen-Auto chinesischer Produktion fast eine Stunde bis zu seiner Wohnung. Ich wunderte mich, wie wenig Autos unterwegs waren. Es war ja noch hell, und viele Betriebe schlossen ja auch erst 19 Uhr. Andererseits sahen wir unterwegs Unmengen von Motorrollern und Pedelegs. Auf der Fahrt zur Wohnung fiel mir noch etwas auf: Es schwirrten zahlreiche Kleinflugzeuge, die wie größere Drohnen aussahen, in der Luft herum, und sie erzeugten ein deutlich hörbares, summendes Geräusch. Wie war das zu erklären? Jan – so heißt mein ältester Sohn – klärte mich auf. Die Chinesen sind ja inzwischen ein wohlhabendes Volk und spielen in der Weltregierung eine wichtige Rolle. Aber die Gesetze, nach denen sich das Volk zu richten hat, sind beinhart. Als der Smog über der Stadt nicht mehr zu ertragen war und die Zahl der Lungenerkrankungen zusammen mit der Corona-Krise von 2020/2021 in eine Höhe geschossen war, die alle Krankenhäuser der Stadt überforderte, wurde endlich angeordnet, dass innerhalb der nächsten fünf Jahre kein Fahrzeug mit Verbrennngsmotor eine öffentliche Straße befahren darf. Und tatsächlich, ab dem 1. Januar 2026 war kein Auto, auch kein Hybrid-Fahrzeug, mehr auf chinesischen Straßen zu sehen: Die Chinesen hatten eine erschwingliche Methode entwickelt, die meisten Autotypen auf Elektro- oder Wasserstoff-Antrieb umzurüsten. Die Pekinger gingen dann noch einen Schritt weiter. Parallel zur Luftreinigung wurde die Beseitigung des unerträglichen Verkehrschaos angeordnet. Kein Auto, welcher Art auch immer, darf über Nacht auf den Straßen abgestellt werden. Man darf nur dann einen Wagen benutzen, wenn dafür eine Garage oder ein zugelassener Abstellplatz auf einem Hof oder einem Parkhaus nachgewiesen werden kann. Diese Berechtigung wird in die Fahrzeugpapiere eingetragen und muss alle zwei Jahre zusammen mit dem TÜV erneuert werden. Zuwiderhandlungen werden mit hohen Geldstrafen geahndet. Jede Wohnung hat zumindest zwei Abstellplätze für Motorroller, Streetscooter oder Fahrräder nachzuweisen. Für die Neu-Einrichtung solcher Plätze ist bei alten Häusern die Stadtverwaltung behilflich, indem der Platz dafür der Straßenbreite entnommen wird, falls dies notwendig ist. Für diese Aktion hatte jeder Hausbesitzer fünf Jahre Zeit. Die meisten Häuser Pekings gehören jedoch der Stadt selbst. Sehr viele Straßenzüge der Innenstadt wurden verschlankt, um vor den Häusern entsprechend dem Bedarf Parkplätze zu schaffen. Manche Straße wurde somit zur Einbahnstraße. Doch bald stellte man fest, dass alle diese Maßnahmen nicht ausreichten, um die Unmengen von Fahrzeugen unterzubringen, die die chinesische Autoindustrie auch an die eigene Bevölkerung verkauft hatte. Rigoros wurden alte Häuser abgerissen und dafür Parkhäuser gebaut – überall dort, wo entsprechender Bedarf bestand. Darüber hinaus war auch wachsender Bedarf an Abstellplätzen für private (wasserstoffbetriebene) Kleinflugzeuge entstanden. Auch hierfür wurden zahlreiche alte Häuser abgerissen und dafür passende Hangars gebaut, deren Mieteinnahmen die Stadtsäckel reichlich füllten. Die neueste Entwicklung chinesischer Kreativität sind die kombinierten „Airmobiles“, die fahren und fliegen können, ähnlich, wie das Wunderwerk von Kombi-Auto, das wir schon in Algerien erlebt hatten, nur viel kleiner und für Normalverdiener gerade noch erschwinglich. Soweit die Regelungen, den ausufernden Verkehr und auch den ruhenden Verkehr in den Griff zu bekommen. Und die dringend notwendige Luftreinigung bekamen die Pekinger auch bald durch weitere Maßnahmen unter Kontrolle. Mit dieser Aktion wurden alle Kohle- und Ölheizungen verboten. Erlaubt waren nur noch Elektro-, Solar-, Wärmeaustausch-, Erdwärme- und Erdgasheizungen. Das Verbot von Öl und Kohle galt auch innerhalb einer fünfjährigen Frist für alle Kraftwerke. Um den Energiebedarf zu decken, wurden zwar im Süden Chinas Dutzende von Solarkraftwerken, wie ich sie ja schon in Afrika gesehen hatte, neu gebaut. Doch hier im Norden Chinas war das weniger sinnvoll. Wegen der geographischen Lage Pekings ist der Wirkungsgrad der Solaranlagen ja bei weitem nicht so hoch wie in Afrika. Hier sind dafür zwei hochmoderne Fusionskraftwerke entstanden. Dazu kamen noch Hunderte von Windrädern und staatlich geförderte Solaranlagen auf Hausdächern. Das waren riesige Investitionen. Aber das Ergebnis war: blauer Himmel über Peking. Die millionenfach benutzten Atemmasken konnten erst einmal entsorgt werden. Die Innenstadt von Peking besteht heute zumeist aus Wolkenkratzern, in denen unglaublich viele Menschen pro Haus – meist in winzigen Wohnungen – leben. Auf den meisten Dächern befinden sich parkhausähnliche Hallen mit einer bis drei Etagen, die an zwei Seiten einen offenen Vorbau haben. Ich habe mir das in den nächsten Tagen mal aus der Nähe angeschaut. Eine dieser Plattformen besitzt Positionslichter und dient als Landeplatz, die andere als Startfeld. Blinken die Positionslichter grün, heißt das: Dieser Parkplatz hat noch freie Plätze. Blinkt es rot, bedeudet es: alles besetzt! Peking liegt nicht direkt am Meer. Tiajin ist die nächste am Meer gelegene Stadt und etwa 150 Kilometer von Pekings Zentrum, der „Verbotenen Stadt“,*) entfernt *) die Residenz der chinesischen Kaiser. Da sich viele Chinesen inzwischen ein Privatflugzeug von der Art leisten können, wie Yvonne und ich es schon geflogen hatten, kann man sich gut vorstellen, welches Gedränge im Sommer dort am Strand herrschen muss, da die Entfernung per Flugzeug nur einen Katzensprung bedeutet. Aber jetzt waren wir erst einmal in Jans Wohnung angekommen. Seine Freundin Xiujun begrüßte mich herzlich und meinen Sohn liebevoll auf Englisch. Sie sagte mir, dass ihr Name für unsere Zunge wohl etwas schwer auszusprechen sei. Ich sollte daher „Juni“ zu ihr sagen, was ich lachend zur Kenntnis nahm. Übrigens, Juni war sichtlich schwanger. Wir saßen bis ein Uhr nachts zusammen und hatten viel zu erzählen. Ich merkte, dass die beiden langsam müde wurden und bestellte ein Taxi zu meinem Hotel, das nicht allzu weit entfernt war. Aber eigentlich war ich noch gar nicht müde, denn nach meiner Uhr, die ich noch nicht nach Peking-Zeit umgestellt hatte, war es ja erst 18 Uhr! Ich fragte den Taxifahrer auf Englisch, ob er mich noch etwa eine Stunde durch die Innenstadt fahren könnte, was er bejahte, denn er konnte Englisch, obwohl er ziemlich schwer verständlich war mit seinem chinesischen Akzent. Wir vereinbarten einen Festpreis, der erstaunlich niedrig war. Er ließ mich auf seinem Smartphone etwas unterschreiben, woraus ich den Fahrpreis in Dollar und in Yuan, der chinesischen Währung (Renminbi = „Volksgeld“), ersehen konnte. Ich sah nun zum ersten Mal eine Super-Hauptstadt eines Super-Landes bei Nacht – und stellte fest, dass eigentlich nichts los war. Es war hier jetzt früher Freitagmorgen, und die ersten Arbeiter machten sich per Fahrrad oder E-Motorroller auf den Weg zu ihrer Arbeitsstelle. Fast genau so viele Frauen wie Männer waren unterwegs, allerdings etwas später, denn viele Frauen mussten ja noch ihre Kinder in den Kinder-Tagesstätten abgeben. Wir kamen auch an einigen Nachtbars mit reichlich schlüpfriger Reklame vorbei. Aber anscheinend war dort nicht viel los. Der Taxifahrer meinte, ich sollte mal sehen, was in der Nacht zum Sonntag los sei! Aber das interessierte mich eigentlich gar nicht. Mit der Umrundung der „Verbotenen Stadt“ beendeten wir die Besichtigungstour, und das Taxi brachte mich zu meinem Hotel. Die Chinesen sind ja ein uraltes Volk und pflegen ihre Traditionen. Ihr „Großer Führer“ Mao Tse Tung wollte im vergangenen Jahrhundert mit allem brechen, was irgendwie anders aussah als kommunistisch. Er führte auf dieser Basis mit brutaler Gewalt eine sogenannte Kulturrevolution ein, mit der er aber nach einigen Jahren jämmerlich scheiterte. Es hat lange gedauert, bis sich die Chinesen davon erholt hatten. Doch nachdem dies endlich geschehen war, ging der Aufschwung ihrer Wirtschaft in rasantem Tempo voran. Dennoch wird Mao heute noch von den Chinesen verehrt, denn er hat ihnen ihr verlorengegangenes Selbstbewußtsein wiedergegeben und die bis heute gültige und schließlich doch noch erfolgreiche Staatsform geschaffen. Jan hat mir einiges erzählt, wie die Regierung dieses aufstrebenden Landes funktioniert. Es gibt nach wie vor nur eine einzige zugelassene Partei, nämlich die Kommunistische. Einen Alleinherrscher mit unbegrenzter Amtszeit, wie zu Maos Zeiten, gibt es aber nicht mehr. Man kann jederzeit der Partei beitreten und an Ortsversammlungen teilnehmen. Als Parteimitglied ist man berechtigt, alle fünf Jahre den Ortsvorstand zu wählen, der aus seinen Reihen den Bürgermeister kürt. Die Ortsverwaltung besteht aus Fachleuten, die nicht unbedingt der Partei angehören müssen. Auch alle fünf Jahre werden aus den Reihen des Ortsvorstandes, dem auch Verwaltungsangestellte angehören dürfen, die Wahlberechtigten für den Provinz-Vorstand gewählt. Je nach Ortsgröße dürfen das zwei bis zehn Personen beiderlei Geschlechtes sein. Ein Provinz-Vorstand besteht aus zweiPersonen je 500.000 Einwohner. China hat 22 Provinzen (ohne Taiwan). Hinzu kommen noch fünf autonome Regionen (z B. Tibet), vier regierungsunmittelbare Städte (z. B. Peking) sowie zwei Sonderverwaltungszonen (u. a. Hongkong), also sind das insgesamt 33 Verwaltungen für ca. 1,6 Milliarden Menschen. Das ergibt etwa 194 Abgeordnete je Provinz. Diese sind alle gleichzeitig Angehörige des Nationalen Volkskongresses, der normalerweise einmal pro Jahr tagt. Da die Tagungsmitglieder des Nationalen Volkskongresses auf 3.000 Mitglieder begrenzt sind, darf abwechselnd nur jedes zweite Mitglied delegiert werden. Aus diesen Abgeordeten wird der siebenköpfige sogenannte „Ständige Ausschuss“ gewählt, der nun wieder den Ministerpräsidenten und den Staatspräsidenten aus den Reihen der Abgeordneten des Volkskongresses wählt und die Fachminister ernennt, soweit sich diese für ein Ministeramt beworben hatten. Der Ständige Ausschuss wählt auch die zwei chinesischen Mitglieder der Weltregierung. Nun habe ich ein wenig davon verstanden, wie dieses Land organisiert ist. Ich finde, obwohl es nur eine Partei gibt und Opposition nicht zugelassen ist, ist eine Art Demokratie wohl erkennbar, eben eine „Volksdemokratie“ Nun musste ich nur noch ein paar Worte Chinesisch lernen: die Zahlen eins bis zehn, guten Tag, auf Wiedersehen, Danke, Bitte, usw. Dies der Höflichkeit halber, denn alle jüngeren Chinesen verstehen inzwischen auch Englisch. Ich gestehe hier ganz offen, dass ich alle diese meist einsilbigen Wörter wieder vergessen habe. Nachdem ich noch einige Anmerkungen in mein Smarty gesprochen hatte, sank ich müde in mein Hotelbett. Am nächsten Morgen wollte ich erst einmal gründlich ausschlafen, doch daraus wurde nichts. Ich hatte nämlich noch vor dem Einschlafen einen Tagesausflug gebucht, der bereits um sieben Uhr morgens mit der Abholung vom Hotel begann. Ich musste also vor sechs Uhr aufstehen, denn ich wollte keinesfalls das Frühstück verpassen. Mein Opa hatte mir mal erzählt, dass sein damaliger Freund, der in der Zigarettenindustrie tätig war, als einer der ersten Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg die Erlaubnis bekam, nach China einreisen zu dürfen. Der hatte damals in einem sehr schlichten Hotel als Frühstück rohe Seegurke mit Reis vorgesetzt bekommen, wovon er keinen Bíssen herunterbekommen hatte. Ich war gespannt, was mir nun bevorstehen würde. Aber siehe da – es gab ein ansehnliches Frühstücksbuffet mit Räucherlachs, Eiern, Wurst und Käse, dazu Butter und Joghurt. Auch Brötchen, Weißbrot, Toast und Schwarzbrot lag appetitlich in Körben bereit. Daneben gab es aber auch noch typisch chinesische Lebensmittel. Ich stopfte mir den Magen voll, denn es sollte bis zum Abend ausreichend sein, wo ich wieder bei Jan und Juni zum Essen eingeladen war. Auf meinem Ausflugsprogramm standen heute die „Verbotene Stadt“ und die Chinesische Mauer. Das kostete (umgerechnet) 35 Euro. Der Bus fuhr zunächst eine Stunde zu einem Abschnitt der Chinesischen Mauer, deren Bau vor 2.600 Jahren begonnen wurde und die sich sage und schreibe insgesamt über 21.000 Kilometer erstreckte, doch sind bei weitem nicht mehr alle Teile erhalten. Diese Mauer ist das größte Bauwerk der Welt. Sie diente in der Anfangszeit dem Schutz vor kriegerischen nord-chinesischen Stämmen und später zum Schutz vor dem Anstürmen der Mongolen. Sie wurde auch im Laufe der langen Geschichte mehrfach versetzt. Bestückt war die Mauer mit etwa 25.000 Wachttürmen, die so angeordnet waren, dass Nachrichten in Geheimsprache in Windeseile von Turm zu Turm weitergegeben werden konnten. Ich spazierte – sehr beeindruckt von den Erklärungen des elektronischen „Guides“ in englischer Sprache – etwa eine Stunde auf der Mauerkrone entlang, genoss die frische Luft und klare Sicht, bis uns der Bus wieder zurück in die Stadt brachte. Wir stiegen aus vor dem Tor „Zum himmlischen Frieden“, das der beeindruckende Eingang zur Anlage des Kaiserpalastes ist. Die Gesamtanlage des 1406 bis 1420 gebauten Kaiserpalastes ist der größte Palast der Welt und war bis 1912 Herrschersitz der chinesischen Kaiser. Dem „gemeinen Volk“ war der Zutritt verboten. Daher der Name. Der Platz vor dem Eingang zur Verbotenen Stadt hat riesige Ausmaße. Er trägt den gleichen Namen wie das Eingangstor und erlangte 1989 eine traurige Berühmtheit durch das Tian’anmen-Massaker, als das chinesische Volk gegen die Tyrannei der damaligen kommunistischen Regierung einen Aufstand riskierte, bei der es – nach meiner Information – etwa 7.000 Verletzte gab. Die Zahl der Toten wurde geheimgehalten. Heute ist die „Verbotene Stadt“ ein Museum, das viele Asservate aus der Zeit der veschiedenen chinesischen Dynastien zeigt. Aber – ehrlich gesagt – das interessierte mich nicht so sehr. Am Wochenende luden mich Jan und Juni zu Ausflügen in die Umgebung ein, wobei wir Glück mit dem Wetter hatten. Für Montag bis Donnerstag war ein „Abstecher“ nach Hongkong geplant. Abstecher ist dabei stark untertrieben, denn immerhin sind es 1970 Kilometer von Peking nach Hongkong. Aber China ist ein riesiges Land, und da muss man sich auf Superlative in verschiedener Hinsicht einstellen. Ich freute mich zu hören, dass mein Sohn und Juni mich begleiten wollten. In Wirklichkeit war es genau umgekehrt. Beide hatten diese vier Tage beruflich mit einer Gastvorlesung in Hongkong verbunden, die sie schon vor längerer Zeit eingefädelt hatten. Die Zeit meines China-Aufenthaltes hatten sie dann mit mir und mit diesem Auftrag gekoppelt, damit wir gemeinsam reisen konnten und damit für beide die nicht ganz billige Fahrt nebst Hotel nichts kostet. Ich hatte noch nicht erwähnt, dass auch Juni Dozentin ist und zwar für das Fach Biologie mit Schwerpunkt Renaturierung von Wüsten und salzhaltigen Böden. Hongkong. Es gibt zwar schon eine Transrapid-Strecke zwischen Peking und Hongkong, doch die war gerade außer Betrieb, weil ein Teilstück Peking-Qingdao-Shanghai repariert werden musste. Also mussten wir fliegen. Das konnten wir aber auch mit gutem Gewissen, denn die Fluglinie China-Airline hatte seit einiger Zeit wasserstoffbetriebene Flugzeuge eingesetzt, die die Strecke in etwas über zwei Stunden bewältigten. Als Gepäck hatten wir nur unser Handgepäck, sodass wir keine Abfertigung am Eincheck-Schalter benötigten. Mein Sohn hatte die Hin- und Rückflüge schon bezahlt und die Bordkarten hinterlegen lassen. Wir waren froh, Juni dabei zu haben, denn das Chinesisch meines Sohnes war noch lange nicht perfekt, und Juni konnte uns durch alle etwaigen Verständigungsschwierigkeiten durchschleusen. Leider begann die Flugreise bereits um sieben Uhr morgens. Ich musste also vor 5.30 Uhr aufstehen und dem Hotel Bescheid sagen, dass ich bereits 5.45 Uhr frühstücken müsste. Das hat alles gut geklappt. Pünktlich holte mich unser Lufttaxi, in dem schon Jan und Juni saßen, 6.10 Uhr auf dem Dach meines Hotels ab und setzte uns 6.40 präzise vor dem Haupteingang des Pekinger Zentralflughafens ab. Fünf Minuten vor Abflug nahmen wir unsere Plätze im Flugzeug ein. Ich hatte einen Fensterplatz und konnte kurz einen Blick über Peking werfen, bevor die Maschine die Reisehöhe von 16.000 Meter (ca. 53.000 Fuß) erreichte. Aus dieser Höhe sind ohne Fernglas keine Einzelheiten mehr zu erkennen. Über Hongkong lag eine dichte Wolkendecke. Als die Maschine diese durchbrach, waren wir schon über der Hongkonger Landebahn. Es war 9.10 Uhr, als wir in der Ankunftshalle ankamen. Eine Zeitumstellung war trotz der großen Entfernung nicht erforderlich. Jan und Juni begaben sich direkt zur Uni, wo sie den ganzen Tag zu tun hatten. Wir wollten uns erst am Abend im gemeinsamen Hotel wiedertreffen. Vor dem Flughafeneingang standen Busse für verschiedene Arten der Stadtbesichtigungen. Ich wählte mir eine Tour aus, die ca. acht Stunden dauerte und auch eine Hafenrundfahrt mit einschloss. Die Handelsbeziehungen zwischen Hongkong und Europa, besonders mit England, begannen schon im 17. Jahrhundert. 1711 wurde eine britische Handelsniederlassung gegründet. Da die Briten aus China über den Hongkonger Hafen mehr Waren ausführen als Produkte ins Land einführen konnten, kamen sie auf die „tolle“ Idee, Opium an die Chinesen zu verkaufen. Das war ein Riesengeschäft, das jedoch Millionen von Chinesen süchtig machte. Als die chinesische Regierung den Opium-Handel schließlich verbot, kam es zum Opiumkrieg, den die Briten (leider) gewannen. Nun setzten sich die Briten 1841 genau hier fest und gründeten 1842 ihre Hongkonger Kronkolonie, die sich bis 1997 behaupten konnte. Das Ende war zum Glück friedlich. Man schloss einen Vertrag ab, mit dem den Hongkongern eine Anzahl von Sonderrechten gegenüber den Bewohnern des chinesischen Festlands eingeräumt wurde. Hongkong ist während der Zeit der britischen Herrschaft, die von einem Gouverneur geleitet wurde, rasant angewachsen. Heute leben hier etwa zehn Millionen Menschen. Das Hongkonger Territorium umfasste früher neben einer Festlands-Halbinsel mehr als 200 Inseln. Große Teile des Arreals sind bergig und können nicht bebaut werden. So entstand ein Eldorado für die Hochhauserbauer der ganzen Welt. Aber die höchsten Wolkenkratzer reichen nicht aus, um die vielen Menschen und die zahlreichen internationalen Büros unterzubringen. So entstand vor und besonders nach der chinsesischen Übernahme ein umfangreiches Programm zur Landgewinnung. Das einfache Konzept war und ist noch heute: Berge abtragen, Wasser zuschütten. Zum Glück ist die Bucht von Hongkong, die auch die Mündung des Perlflusses bildet, der viel Sand und Steine ins Meer befördert, nicht sehr tief. Somit sind die vielen Inseln nach und nach verschwunden und wurden mit dem Festland verbunden. Wir stiegen auf der ehemaligen Insel Lantau, die seit einigen Jahren Festland ist, aus und bestiegen eine Seilbahn, die uns auf den höchsten Punkt, den Lantau Peak beförderte. Von dort aus hatten wir einen wundervollen Rundblick nach allen Richtungen. Der morgendliche Nebel hatte sich inzwischen verzogen, sodass wir auch den höchsten Berg des Territoriums klar sehen konnten: den Tai Mo Shan, der über 950 Meter hoch ist und von einem Nationalpark umgeben wird. Ich fragte unseren Reiseführer, ob es schon Probleme mit den aufgeschütteten Ländereien wegen des Meerwasseranstieges gegeben hätte, was er verneinte, denn hier wäre der Meeresspiegel erst etwas über einen Meter angestiegen, und das hätten die neuen Territorien gut verkraftet. Ich fragte auch nach, ob es hier Sonnenkraftwerke und Meerwasser-Entsalzung gäbe. Ja, die gäbe es, aber sie spielten hier keine große Rolle, weil der Perlfluss genüged Süßwasser führe. Hongkong hat aber einen gewaltigen Energiebedarf. Die meisten Autos sind batteriebetrieben. Das liegt daran, dass Hongkong ein Werk für Elektroautos besitzt. Um den enormen Strombedarf decken zu können, verfügt Hongkong schon seit dem vorigen, dem 20. Jahrhundert, über einige der ältesten Atomkraftwerke. Der inzwischen angefallene Atommüll machte der Stadt erhebliche Sorgen. Wohin damit? Die Lösung war, aber auch in letzter Minute, gefunden worden. Seit einigen Jahren sind die neuen, umweltfreundlichen Fusionsreaktoren im Einsatz, die je Reaktor die vierfache Strommenge eines Reaktors für Kernspaltung liefern können. Zum Glück ist diese Technik ja dank der chinesischen Entwicklung in der Lage, die ausgebrannten Brennstäbe der alten Kraftwerke peu à peu mitzuverarbeiten und in pure Energie umzuwandeln. Ich habe mich informiert, wie so ein Fusionsreaktor-Prinzip arbeitet. Kernfusionen finden im Inneren der Sonne statt. Dort herrschen Millionen Grad Hitze und ein unvorstellbar hoher Druck, der durch die Gravitation der gewaltigen Sonnenmasse entsteht. Durch diese Verhältnisse werden die Wasserstoff-Atome ineinander gequetscht, sodass unter Abgabe großer Energiemengen Helium entsteht. Die Verhältnisse, die im Inneren der Sonne herrschen, kann man hier auf Erden natürlich nicht nachvollziehen. Man kann aber den enormen Druck durch höhere Temperaturen und andere Materialien als Sauerstoff (z. B. Deuterium und Tritium) ersetzen. Natürlich hält auch kein irdisches Material die erforderlichen Temperaturen aus. Der Verschmelzungsvorgang muss also schwebend in einem sehr starken Magnetfeld erfolgen. Man kann sich vorstellen, dass die schwierige Entwicklung eines funktionierenden Fusionsreaktors Jahrzehnte dauert. Die Chinesen haben diesen Reaktortyp – mit allen Risiken – als erste in der Praxis eingesetzt. Hongkong besitzt zwei dieser Reaktoren. Ich wollte versuchen, an einem der nächsten beiden Tage einen der beiden Energiespender besuchen zu dürfen. Unser Bus fuhr an einem dieser Kraftwerke vorbei. Dies war ein grauer Rundbau, von dem eine Reihe von Hochspannungsleitungen ausgingen. Die Umgebung war streng abgesperrt. Mehr war von außen nicht zu sehen. Keine Kühltürme, kein Rauch, kein Schornstein, kein Dampf – nichts weiter. Das war also eine der Energie-Lösungen für die Zukunft! Allerdings werden hier bedeutende Mengen an Kühlwasser benötigt. Man braucht also Wasser. Das erhitzte Wasser wird im Winter für den Betrieb der Fernheizungen verwendet. Im Sommer wird damit Wasserdampf für die Wasserstoff-Produktion erzeugt. Nur wenig warmes Wasser gerät in die Flussmündung. Gegen 19 Uhr war ich wieder im Hotel, müde und hungrig nach den Fahrten mit Bus, Seilbahn und Schiff. Jan und Juni waren auch schon vor Ort. Juni kannte in der Innenstadt ein kleines Restaurant mit europäischer Küche, das von einem Vier-Sterne-Koch geleitet wurde. Dort ließen wir es uns schmecken. Zu erzählen gab es auch eine Menge. Gegen zehn Uhr lag ich erschöpft im Bett und schlief sofort ein. Am nächsten Morgen hatte Juni frei. Jan musste noch einmal in die Uni. Wir zwei Frauen wollten einen ausgiebigen Stadtbummel machen und „shoppen“ gehen. Juni kannte sich in Hongkong ganz gut aus, denn sie hatte zwei Semester hier studiert. Ich war beeindruckt und auch ein wenig erschreckt über diese Masse an riesigen Wolkenkratzern, die fast alle höher aufragten als die von Manhattan/New York. Das höchste Gebäude ist ein Wohnturm von 700 Metern Höhe. Ich möchte niemals in einem solchen Monster wohnen müssen! Abends besuchten wir gemeinsam einen 3D-Film über das Leben in der chinesischen Mondstation und die beeindruckenden Vorbereitungen auf die bevorstehende Marslandung. Hier in Hongkong ist die Zukunft schon weiter fortgeschritten als bei uns in Deutschland. Am Donnerstag stand der Besuch des Fusionsreaktors auf dem Programm. Jan hatte durch seine Verbindung zur Hongkonger Uni erreicht, dass wir drei dem Kraftwerk einen Besuch abstatten durften. Aber ehrlich gesagt war ich froh, als wir wieder draußen waren, denn man konnte nur geschlossene Maschinen und Apparaturen, Mess-Stationen, Bildschirme, Kabelbündel und schweigsame Menschen hier erleben. Dazu war ein ständiger, hoher singender Ton zu hören, der mir spürbar auf die Nerven ging. Am Nachmittag bestiegen wir wieder das Flugzeug nach Peking und waren am frühen Abend wieder in Jans und Junis Wohnung angekommen. Leider mussten beide am nächsten Morgen wieder arbeiten. Der Kampf gegen den Wüsten-Vormarsch. Peking hatte seit Jahrzehnten große Trinkwasser-Probleme. Allein Peking verbraucht heute jährlich ca. 40 Milliarden Kubikmeter Wasser, Tendenz steigend. Der Bedarf wurde bis Anfang unseres Jahrhunderts aus dem Grundwasser gedeckt, bis der Grundwasserspiegel so weit abgesunken war, dass man ein völliges Versiegen befürchten musste, was für 18 bis 20 Millionen Menschen katastrophale Folgen hätte. Schon zu Zeiten Maos wurde notgedrungen damit begonnen, eine Wasser-Fernleitung aus dem Süden 1.430 Kilometer bis nach Peking und zur benachbarten Industriestadt Tianjin zu bauen. Als das Wasser nach langer Bauzeit endlich an den Zielorten ankam, stellte man fest, dass es stark verschmutzt und als Trinkwasser unbrauchbar war. Lediglich der Industrie war damit einstweilen geholfen
Das Niger-Tschad-Projekt. Schon seit dem ersten Einsatz der Solarkraftwerke im Zusammenspiel mit Meerwasser-Entsalzung zum Zwecke der Sahara-Rekultivierung habe ich mich für den Fortgang dieser Aktionen besonders interessiert und alles gelesen, was ich an Informationen ergattern konnte. Ich habe vor meiner Pensionierung (2067) in den großen Ferien noch einige weitere nordwest-afrikanische Länder besucht und mich über den Fortgang der Rekultivierungen informiert. Die meisten der nordafrikanischen Länder vereint ein gemeinsames Riesenprojekt (genannt „SNT Sahel-Niger-Tschad“), das sowohl von afrikanischen Dachverbänden als auch von der Weltregierung selbst mit hoher Priorität gefördert wird. Ich konzentriere meinen Bericht auf das Gesamtkonzept, ohne auf alle meine Afrikareisen einzugehen. Ich konnte schon damals einige der Projekte beobachten, um zu ahnen, welch gewaltige Ausmaße dieses Programm eines Tages haben wird. Dass die zunächst utopisch erscheinenden Pläne nun zum größten Teil Wirklichkeit geworden sind, war für die ärmsten Länder dieser Region eine rettende Notwendigkeit. Aber nicht nur für diese:
Ich konnte mich in Marokko, Algerien, Libyen und anderen Ländern bereits von der segensreichen Wirkung der getroffenen Maßnahmen überzeugen. Alle diese Länder, deren Staatsgebiet ganz oder teilweise in der Sahara oder in der Sahelzone liegt, waren vom Klimawandel besonders stark bedroht. Ihnen musste zuallererst geholfen werden. Die seit dem Jahr 2002 bestehende Afrikanische Union (AU) hat 2025 die Interessengemeinschaft „Sahel-Niger-Tschad“ (SNT) gegründet mit der Zielrichtung, ausgetrocknete Wüstengebiete und Trockensavannen wieder fruchtbar und bewohnbar zu machen. Das Projekt SNT ist eine Weiterentwicklung eines Vorgängerprojektes, das sich „Grüne Mauer“ genannt hat und das zum Ziel hatte, die weitere Ausdehnung der Sahara zu bremsen. Die SNT arbeitet mit der Welt-Forstbehörde eng zusammen und erhält von dort auch finanzielle Unterstützung. Dabei geht es in erster Linie um die Erschließung gewaltiger Mengen Wasser für die Bewässerung der ausgedörrten Erde in der Größenordung einer mehrfachen Landfläche von Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen. Als Wasserlieferant wurde der ca. 4.200 Kilometer lange Fluss Niger ausgewählt, der die Länder Guinea, Mali, Niger und Nigeria durchfließt und auch die Grenze zu Benin bildet. Obwohl der Fluss Niger in mancher Regenzeit auch Überschwemmungen verursacht, reicht sein Wasser – über ein Jahr betrachtet – bei weitem nicht aus, um die Wüste ausreichend zu bewässern und die Sahelzone in blühende Landschaften zu verwandeln. Hier muss also massiv nachgeholfen werden. Die SNT besteht zum einen aus Wasser-Lieferanten und zum anderen aus Wasser-Empfängerländern. Insgesamt gehören der SNT die Länder Marokko-Westsahara, Mauretanien, Burkina Faso, Senegal, Guinea-Bissau, Elfenbeinküste, Sierra Leone, Liberia, Ghana, Togo, Kamerun und Tschad an. Wasserlieferanten sind die Länder Marokko-Westsahara, Sierra Leone, Guinea und auch Kamerun. Auch Mauritanien entsalzt Meerwasser, jedoch nur für den Eigenverbrauch
In diesen vier Ländern wurden mehrere gewaltige wind- und sonnenbetriebene Meerwasser-Entsalzungsanlagen installiert, die den Flusslauf des Niger als natürliche Wasserleitung nutzen, um das benötigte Wasser bis in die Wüstengebiete zu transportieren. Überall dort, wo der Niger in die Nähe von Dürregebieten gelangt, entstanden und entstehen weitere Zapfstellen zwecks Weiterbeförderung des Wassers in die Trockenzonen. Dafür sind dann noch starke Pumpanlagen und Hunderte Kilometer unterirdische Wassertunnel erforderlich. Dies ist ein Jahrhundert-Projekt, an dem noch mehrere Generationen fleißiger Menschen zu arbeiten haben. Wüsten-Rekultivierungen mit den dafür erforderlichen Kraftanlagen sind nicht nur ein Segen für die betroffenen Länder, sondern langfristig auch ein gutes Geschäft. In diese Länder haben sich europäische, amerikanische, saudische, türkische und chinesische Investoren schon mit Beginn der Sahara-Rekultivierung, das lukrative Geschäft witternd, finanziell förmlich hineingestürzt. Die Grundstückspreise schossen von quasi Null auf europäische Standards in die Höhe. Wind-, Solar- und Atomkraftwerke entstanden in höchstmöglichem Tempo. Im Gebiet Marokko-Westsahara, das jetzt zu den Wasserlieferanten zählt, gab es vorher absolut nichts an Industrie. Siedlungen für die Arbeitskräfte mussten erst einmal geplant und errichtet werden. Die Firma Siemens und einige andere Hersteller von Meerwasser-Entsalzungsanlagen wussten kaum, wo sie zuerst mit dem Bauen anfangen sollten. Die Aktienkurse der beteiligten Firmen schossen in die Höhe. Es gab aber auch eine Unmenge an Anfangsproblemen zu lösen. Hier, im SNT-Projekt, mussten die sogenannten Wasserspender zuerst einmal selbst mit ausreichend Süßwasser aus dem Atlantik versorgt werden. Erst dann – etwa ab 2030 – konnte man mit dem Wasserexport in die benachbarten Länder beginnen. Heute, 55 Jahre nach den Anfängen, sind die einst notleidenden und hilfsbedürftigen Länder, in denen Hunger, Durst und politisches Chaos sowie teilweise auch Bürgerkriege geherrscht haben, wohlhabende Lebensmittel-Exporteure. Statt Flüchtlingsströme zu erzeugen und ihre jungen Menschen auf dem Mittelmeer in Lebensgefahr zu bringen, suchen sie heute händeringend nach Arbeitskräften, um ihre Ernten einzubringen, zu verarbeiten und zu verschiffen. Seit ein paar Jahren wird an weiteren unterirdischen Transportstrecken gebaut, um die Transportschiffe zu entlasten. An den Küsten Mauretaniens, Guineas, Sierra Leones und der Elfenbeinküste entstanden zusätzlich neue Containerhäfen, um die wachsenden Mengen von Exportgütern zu verschiffen, die ihren Ländern satte Einnahmen verschaffen. Um die Wüsten-Kultivierungen von Mali, Niger, Benin und Burkina Faso dauerhaft zu sichern, entstand ein in seiner Größe weltweit einmaliges Projekt: Der Niger wurde zwischen den Städten Timbuktu (Mali) und Niamey (Niger) mit vier hintereinanderliegenden gigantischen Talsperren aufgestaut. Es ist das größte Talsperren-Projekt der Welt. Dafür wurden Ausschreibungen für alle wirtschaftlich starken Länder der Welt ausgelegt. Gewonnen haben die Aufträge China und die USA, die Erfahrungen mit den bisher größten Talsperrenbauten hatten. Auch Ägypten ist mit daran beteiligt. Angefangen wurde das Projekt 2030, fertiggestellt 2060. Bis die insgesamt mehrere Hundert Kilometer langen Seen gefüllt sind, dauert es noch weitere 20 bis 30 Jahre. Doch diese Wasserreservoire sind die wichtigste Quelle für die erfolgreiche Landwirtschaft der einst notleidenden Länder. Reis, Mais, Weizen, Soja, Obst und Gemüse sind die Haupt-Export-Erzeugnisse. Nebenbei werden aber auch Blumen, Fische, Bau- und Edelhölzer exportiert. Seit neuestem ist Mauretanien auch an die marokkanische Transrapid-Transportstrecke nach Europa angeschlossen. Seitdem wird auch dort Wasserstoff aus Meerwasser mit Sonnen- und Windenergie produziert, was sich als lohnendes Geschäft erwiesen hat. Seit etwa 25 Jahren ist nun auch eines der schwierigsten Sanierungsprobleme gelöst. Es geht um den in der Mitte Afrikas gelegenen Tschadsee, der einst einer der größten Seen Afrikas war und fast ganz auszutrocknen drohte. Das bedeutete für die Anliegerstaaten Niger, Tschad und Nigeria ein menschliches und wirtschaftliches Desaster, jedenfalls in den Provinzen, die vom Wasser des Tschadsees abhängig waren. Lange hat man nach Lösungen gesucht, wie man die völlige Austrocknung des Sees verhindern könnte. Der im Nachbarland Zentralafrikanische Republik fließende wasserreiche Fluss Bamingui sollte frisches Wasser liefern, indem ein Tunnel zu einem derjenigen Flüsse abgezweigt würde, die den Tschadsee hin und wieder überhaupt noch erreichen können, bevor ihr Wasser verdunstet ist. Aber dieser Plan ist wohl von vornherein an finanziellen Schwierigkeiten gescheitert. Doch dann entstand im Anschluss an das kühne Niger-Projekt ein ähnliches Projekt, das Aussicht auf Erfolg versprach, nämlich: ein vorhandenes Flussbett als Naturwasserleitung für entsalztes Meerwasser über Hunderte von Kilometern zu benutzen. Im mittleren Kamerun, in der Nähe des Ortes Ngaoudéré (ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht), entspringt in den Ausläufern des benachbarten Gebirges ein Fluss namens Vina. Zunächst ist das Flüsschen noch recht klein, doch wächst es durch zufließende Nebenflüsse allmählich und mündet in den Fluss Logone. Dieser mündet dann kurz vor dem Tschadsee in den zweiten Seezufluss, namens Chari, der im gleichen Gebirge entspringt, jedoch im Staatsgebiet der Zentralafrikanischen Republik (wo er Ouham genannt wird) Kameruns Staatsgebiet reicht selbst zwar bis zum Tschadsee, aber die Entfernung vom Meer bis dahin ist gewaltig, sodass man die in den Tschadsee mündenden Flüsse als billige Ersatz-Wasserleitungen bevorzugen wollte. Der Nachteil ist, dass alle an den Flüssen liegenden Dörfer unkontrolliert Wasser entnehmen können. Da aber jeder Anlieger zukünftig ausreichend Wasser zur Verfügung haben soll, ist das auch okay. Also muss entsprechend viel Wasser herangeschafft werden. An der Küste Kameruns entstanden vier Hochleistungs-Meerwasser-Entsalzungen, deren Süßwasser in zwei Wasserleitungen nach Nordosten gepumpt wird. Die eine ergießt sich in die Vina, die andere in den Fluss Ouham (Zentralafrikanische Republik), der später Chari heißt. Beide Flusssysteme versorgen nun den Tschadsee mit frischem, entsalztem Meerwasser
Ein Vulkan-Ausbruch. Als ich zwölf Jahre alt war, unternahmen meine Eltern mit mir und meinen Schwestern eine Reise durch Nordamerika. Mein Vater muss wohl gerade eine bedeutende Tantiemen-Zahlung von seiner Firma erhalten haben, denn die Reise für uns fünf Personen muss eine Stange Geld gekostet haben. Ich habe die meisten Eindrücke von dieser 14-tägigen Rundreise schon wieder vergessen, aber ich habe kürzlich noch einmal meine alten Fotos durchgesehen. Ich hatte mir zu meinem zwölften Geburtstag einen Fotoapparat gewünscht und auch bekommen, und mit dem habe ich unterwegs fleißig geknipst. Eines der schönsten Bilder gelang mir vom Mount Rainier im nordwestlichen Bundesland Washington. Es ist der schönste Berg – außer dem Matterhorn –, den ich bisher gesehen habe. Ich zeige dieses Bild hier. Warum? Das erkläre ich später noch. Doch die Schönheit dieses Berges ist genauso groß wie seine Gefährlichkeit. Er ist ein Vulkan, der genau auf der Kante zweier Erdplatten liegt: der pazifischen und der amerikanischen. Dass dieser Berg einmal eine Gefahr für die ganze Erde sein würde, konnte damals natürlich niemand ahnen. Laut einer amerikanischen Berichterstattung erfolgte der letzte Ausbruch dieses Vulkans im Jahre 1843. Das Ereignis muss aber nicht sehr schlimm gewesen sein, denn in Europa hat niemand davon Kenntnis genommen. Im Jahre 1980, im Monat Mai, ist aber etwas passiert, das die Aufmerksamkeit sehr wohl auf diese Gegend gelenkt hat: Da explodierte der in der Nachbarschaft gelegene Vulkan St. Helens. Dieser Ausbruch kam allerdings nicht ganz überraschend, denn er hatte sich durch Erdbeben in der Umgebung des Vulkans angekündigt. Es gab also Vorwarnungen. Dennoch gab es Tote, als es dann geschah
Die letzte Reise. Vorbereitungen. Wir schreiben das Jahr 2073. Es hatte Monate gedauert, bis man den Himmel wieder mit klarem Sonnenschein erleben konnte. Etwa ein Jahr nach der Katastrophe des Mount Rainier wollte ich noch einmal in eines der Länder reisen, in denen umfangreiche Wüstenrekultivierungen stattgefunden hatten. Saudi-Arabien stand schon lange auf meinem Reiseplan, und für längere, anstrengende Reisen wurde es für mich Zeit. Ich bin ja jetzt 73 Jahre alt. Meine beiden Schwestern sind nun auch pensioniert. Beide sind auch schon lange verheiratet und haben erwachsene Kinder. Jana, meine nächstjüngere Schwester, die es beruflich zur Professorin für Germanistik und Journalismus gebracht hatte, hat zwei Kinder und vier Enkel: Ihr Mann, auch Professor, ist gerade emeritiert. Paula, die Jüngste von uns dreien, hat auch zwei Kinder und drei Enkel. Mein jüngster Sohn ist schon lange verheiratet und hat eine Tochter. Von meinem Ältesten habe ich inzwischen auch einen Enkel, der halb deutsch und halb chinesisch ist. Er hat sich schon als Dreijähriger als großes Musik-Talent erwiesen. Seit zwei Jahren spielt er – nun fünfjährig – hervorragend Geige. Sein großes Vorbild ist die weltberühmte Geigerin Anne-Sophie Mutter, die 2062 mit 99 Jahren verstarb. Mein Sohn besitzt fast alle Aufnahmen ihrer Konzerte. Schon mein Opa war ein großer Bewunderer ihrer Kunst. Also, ich erwähne meine Familienverhältnisse, weil ich mir vorgenommen hatte, meine letzte große Reise mit meinen beiden Schwestern zusammen zu unternehmen. Und dafür mussten die ja erst einmal beruflich frei und auch in ihren Haushalten abkömmlich sein. Ich hatte mich schon lange vorher über die Verhältnisse im Vorderen Orient, also vorwiegend über Saudi-Arabien und Israel, das seit nunmehr 28 Jahren Al Genezareth heißt, informiert. Vor allem wollte ich wissen, wie weit die Wüsten-Rekultivierungen in Nahost vorangekommen waren und wie groß die Schäden sind, die die lange Verdunkelung der Sonne angerichtet hat. Dann interessierte mich auch, wie die Saudis heute ihre Frauen behandeln. Früher wurden sie ja ähnlich wie Sklaven gehalten und durften ohne Erlaubnis fast nichts anderes tun, als Kinder zu gebären und mussten klaglos all das ertragen, was dem vorausging. Schon vor vielen Jahren hatte mich eine Zeitungsnotiz erfreut, die berichtete, dass der damalige Kronprinz Mohammed bin Salman vom Obersten Gericht in Den Haag zu zwölf Jahren Gefängnis wegen Anstiftung zum Mord an dem regime-kritischen Journalisten Jamal Khashoggi verurteilt worden war. Zusätzlich wurde er zu 100 Millionen Dollar Geldstrafe verurteilt, von denen zehn Millionen an die Familie Khashoggi zu zahlen waren. Mohammed bin Salman war sehr bald mit der Tötung des saudischen Journalisten in Verbindung gebracht worden, der am 2. Oktober 2018 bei einem Besuch des saudischen Konsulats in Istanbul verschwand. Nachdem klar bewiesen war, dass der Regimekritiker Khashoggi tatsächlich ermordet und möglicherweise vorher noch gefoltert worden war, setzten umfangreiche Ermittlungen ein, wer den Auftrag zu dieser Tötung gegeben hatte. Es dauerte auch nicht sehr lange, bis die Beweise vorlagen, wer der Auftraggeber war. Vom Gericht erging die Weisung, den Kronprinz an die Strafvollzugsbehörde in Den Haag auszuliefern. Es war abzusehen, dass dieser Weisung nicht Folge geleistet würde. Der Kronprinz wurde aber auf Weisung des Gerichts von da an beobachtet. Das Besondere an diesem Urteil war, dass die Geldstrafe mit dem gerichtlich festgelegten Tag des Haftantritts fällig wurde. Mit jedem Tag Zahlungsverzögerung erhöhte sich die Geldstrafe um eine Million Dollar und die Haftzeit um einen Tag. Der Betrag sollte in eine Stiftung fließen mit dem Zweck, die Aktion „Clean Fridays“ zu unterstützen, um allen bedürftigen Jugendlichen nach Abgabe des eingesammelten Mülls eine warme Mahlzeit zu ermöglichen oder ein Care-Paket mit Lebensmitteln auszuhändigen. Alle Milliardäre dieser Welt waren aufgerufen, sich finanziell an dieser Stiftung zu beteiligen. Jahre später – um 2024 herum – hielt sich der Prinz, inzwischen König geworden, besuchsweise im Norden seines Landes auf. Das blieb nicht unbemerkt. Von Israel aus startete ein Super-Hubschrauber, der mit einer magnetischen Greifvorrichtung ausgestattet war. Er wurde von der Beobachtungsdrohne über den Luxuswagen des verurteilten Prinzen dirigiert. Der Hubschrauber flog so niedrig wie möglich über den Wagen des Prinzen, fuhr den magnetischen Greifarm aus, packte das ganze Auto und flog mit ihm in Richtung Israel davon. Dort wurde er aus dem Wagen herausgeholt und per Flugzeug nach Den Haag gebracht. Beharrlichkeit hat auch hier wieder einmal zum Ziel geführt. Ja, der Arm des Gesetzes ist lang, und manchmal ist er sogar magnetisch! Nun sitzt er, ein verurteilter Mörder, schon lange wieder auf dem Thron Saudi-Arabiens und ist inzwischen 88 Jahre alt. Dass ich von dieser Verurteilung wusste und mich auch noch darüber gefreut hatte, durfte ich in Saudi-Arabien aber keinesfalls erwähnen. Ich würde wohl heute diesen Bericht nicht schreiben können. Drei einzelne Frauen in Saudi-Arabien, die allein durchs Land reisen und dazu noch allein in Hotels übernachten, sind auch heute noch in diesem moralisch rückständigen Land eine bedenkliche und problematische Sache. Um allen Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, konnten wir Hans-Jürgen, Janas Ehemann, kurzfristig dazu bewegen, uns zu begleiten. Er war ja frisch gebackener Pensionär. Außerdem war er ein Biologe, der sich auch in der tropischen Pflanzenwelt gut auskannte. Nun war dank unserer männlichen Begleitung das Hotel-Übernachtungsproblem geklärt. Gegen einen Ehemann mit drei Frauen hatte im muslimischen Arabien niemand etwas einzuwenden. Für die Einreise mussten wir ein Visum beantragen. Um ein solches zu bekommen, mussten wir eine Einladung eines Bürgers des Landes oder von einer Universität vorweisen. Hans-Jürgen kannte aus seiner Studienzeit einen Saudi, der es auch zum Professor gebracht hatte und in Riad lehrte. Hin und wieder hatte Hans-Jürgen auch wissenschaftliche Kontakte mit ihm gehabt. So nahm er per E-Mail mit ihm Verbindung auf und erklärte ihm, dass wir vier als Journalisten per Privatflugzeug ins Land einreisen und über die saudischen Erfolge der Wüsten-Kultivierung berichten wollten. Außerdem wollten wir von den Saudis lernen, wie sie mit den biologischen Schäden der monatelangen Sonnenverdunkelung klar gekommen seien. Zwei Tage später hatten wir die Einladung und die Genehmigung, in alle Rekultivierungsgebiete des Landes zu reisen. Bedingung: Wir durften nicht von Al Genezareth kommend direkt nach Saudi-Arabien einreisen, sondern mussten über Jordanien und den Irak bis zum saudischen Ort Arar fliegen und uns dort beim Zoll und der Einreise-Behörde melden. Bei Nicht-Beachtung würden wir zur Landung gezwungen. Freundlicherweise schickte er Hans-Jürgen eine E-Mail-Anlage mit, auf der die wesentlichen Orte angegeben waren, wo Wüsten-Rekultivierungen bisher stattgefunden hatten und die für Besichtigungen freigegeben waren. Außerdem waren bei den einzelnen Gebieten die Anpflanzungs-Schwerpunkte angegeben. Das fanden wir sehr nützlich. Hans-Jürgen schickte ihm ein herzliches Dankeschön zurück. Vom saudischen Konsulat bekamen wir einige Verhaltensrichtlinien, die wir zu beachten hätten, um nicht mit der dortigen Sittenpolizei Probleme zu bekommen. Die Frauen müssen sich so kleiden, dass keine Körperformen erkennbar sind. Die Haare müssen bedeckt sein. Man soll sich beim Begrüßen nicht die Hand geben, vor allem den Frauen nicht. In den letzten 20 Jahren haben sich die strengen Keuschheitsregelungen bezüglich der Moral der Frauen etwas gelockert. Aber Vorsicht war immer noch geboten. Saudi-Arabien ist ein riesiges Land mit einer maximalen Länge von ca. 2.200 Kilometern und einer maxinalen Breite von ca. 1.400 Kilometern. Das Land liegt im Zentrum eines Trockengürtels, in dem ein extrem trockenes und heißes Klima vorherrscht. Daher nahmen auch Wüsten und Wüstensteppen fast 99 Prozent der gesamten Staatsfläche ein. Im Norden liegt die Wüste Nefud, im Südosten befindet sich die größte geschlossene Sandwüste der Welt (500.000 Quadratkilometer) die Rub al-Chali, unter der alllerdings gewaltige Ölvorkommen „schlummern“, die das Land ungeheuer reich gemacht haben. (Natürlich schlummern sie nicht mehr, sondern wurden fast 100 Jahre lang kräftig angezapft, nun allerdings nur noch sehr eingeschränkt!) Auf der Hinreise wollten wir zuvor dem modernen Staat Al Genezareth einen Besuch abstatten. Jana kennt eine Professorin der Universität Tel Aviv, die einige Jahre in Deutschland studiert hat und auch sehr gut deutsch sprechen kann. Frau Prof. Sarah Weinheimer – so heißt sie – freute sich auf unseren Besuch und wollte sich zwei Tage freinehmen, um uns im Lande zu den Gegenden zu führen, die uns interessierten. Seit dem Jahre 2045 gibt es weder den Staat Israel noch den Gazastreifen und auch nicht Palästina. Als im Jahre 2044 auch die 60. Gesprächsrunde der sogenannten Friedensverhandlungen gescheitert war und so, wie seit Jahrzehnten, weiterhin Raketen zwischen dem Gazastreifen und Israel hin und her flogen, griff jetzt endlich die Weltregierung ein. Es war nun klar, dass die Friedensgespräche niemals zu einer Einigung führen konnten, denn beide Seiten forderten Jerusalem unverzichtbar als ihre Hauptstadt, weil dort ihre wichtigsten Heiligtümer liegen (Klagemauer und Felsendom), auf die keine Seite verzichten wollte. Und Jerusalem zu teilen, wäre auch keine Lösung, weil damit immer neue Streitpunkte entstehen würden. Das früher geteilte Berlin war ein wirksames Negativ-Beispiel hierfür. Die Weltregierung ordnete an: Schluss jetzt mit den scheinheiligen Verhandlungen und mit dem fortwährenden Blutvergießen. Israel, Gazastreifen und Palästina werden zum Staate Al Genezareth zwangsvereinigt. Innerhalb einer Frist von einem halben Jahr musste eine von allen Parteien gebildete Kommission eine Verfassung ausarbeiten und verabschieden, die eine demokratische Regierungsfähigkeit für alle Zukunft sicherstellen konnte. So lange, bis dies sichergestellt war, wurde das gesamte Land von der Weltpolizei besetzt und überwacht. Der Frieden wurde jetzt erzwungen! Und tatsächlich. Seit Jahren funktioniert das. Der Welt-Währungsfond stellt hierfür erhebliche Geldmittel zur Verfügung. Im Lande, genauer gesagt, an den Küsten von Gaza und Paläs-tina wurden riesige Solarkraftwerk und Windkraftanlagen installiert, und auch ein Fusionskraftwerk wurde gebaut. Letzteres liefert unter anderem die Energie, um auch gewaltige Meerwasser-Entsalzungsanlagen zu betreiben. Das gewonnene Süßwasser wird in den Jordan und den See Genezareth gepumpt. Von dort erreicht es das Tote Meer, das nun auch mit Frischwasser versorgt und vor dem Austrocknen bewahrt wird. Mit diesen Maßnahmen sind neue Obstplantagen, Wälder, Parks, Seen und Felder entstanden, die viele Arbeitskräfte benötigen. Somit ist Schluss mit der Massen-Arbeitslosigkeit in Nahost, und für die meisten Menschen in Gaza und Palästina haben sich die kümmerlichen Lebensbedingungen der Vergangenheit radikal verbessert. Die Menschen sind wieder zufrieden. Viele junge Leute erleben zum ersten Mal in ihrem Leben Jahre ohne Hunger und Angst. Das war und ist die Grundvoraussetzung, dass dort endlich Frieden eingekehrt ist. Ich habe mir die alten Zeitungsberichte über dieses historische Ereignis aufgehoben. Beeindruckt hatte mich auch die Anordnung der Weltregierung, dass in die neue Verfassung folgende Bestimmung aufgenommen werden musste: „Jeder Bürger hat das Recht, seine Religion frei auszuüben, soweit die Rechte und Freiheiten anderer Mitbürger nicht beeinträchtigt werden. Für ein dauerhaftes, friedliches Zusammenwachsen aller Landesteile sind religiöse Provokationen durch Kleidung, sichtbare Kennzeichen und Haartracht in der Öffentlichkeit zu unterlassen (Kippa, Kopftuch, Ringellocken, steifer Hut, Kaftan und Ähnliches).“ Nach den langen Vorbereitungen und nachdem wir unsere Reise mehrmals aus familiären Gründen verschieben mussten, ging es dann endlich am 1. Oktober 2073 los. Al Genezareth. Wir hatten uns lange überlegt, wie wir am besten unsere Reiseziele erreichen können. Um meinen Flugschein nicht zu verlieren, muss ich ja jedes Jahr einige Flugstunden am Steuer eines kleineren Flugzeuges für maximal sechs Personen nachweisen. Ich setzte mich mit meinem Flugzeug-Verleiher in Verbindung und verhandelte über den Preis für eine 14-tägige Vermietung. Dabei stellte sich heraus, dass die Kosten nur geringfügig höher lagen als die insgesamt anfallenden Fahrpreise für Transrapid oder Linienflug für vier Personen. Die Transportkosten innerhalb der beiden Länder, die wir ja gründlich besichtigen wollten, kämen noch dazu, natürlich auch die Treibstoffkosten für unsere Flüge. Ich fragte bei den Konsulaten Genezareths und Saudi Arabiens für eine Einreise-Erlaubnis per Privatflugzeug nach, die mir nach einigen Testfragen auch erteilt wurde. Unsere Maschine war eine Cessna 840 Vollautomatik für sechs Personen. Sie erwartete uns ab sechs Uhr morgens vollgetankt auf dem Flugplatz Aachen-Merzbrück. Die vor uns liegende Strecke betrug ca. 3.300 Kilometer. Die Reichweite des Flugzeugs mit Langstrecken-Ausrüstung wird mit 2.200 Kilometer angegeben. Wir mussten aus Sicherheitsgründen zwei Zwischenstops einlegen. Höchstgeschwindigkeit bei 6.000 Meter Höhe ca. 500 km/h, je nach Windrichtung und -stärke. Pünktlich 6.30 Uhr waren alle eingestiegen, und das Gepäck war verstaut. Als ersten Zwischenstopp hatte ich Bukarest (1.650 Kilometer) angepeilt und Beirut als Nummer zwei (3.030 Kilometer). Von dort nach Tel Aviv/Jerusalem (3.300 Kilometer) war es dann nur noch ein Katzensprung. Ich gab die drei Koordinaten, die Flughöhe mit 6.000 Meter ein und kündigte unsere Landung in Bukarest Flughafen für ca. 10.30 Uhr an. Der Wetterbericht war okay. Unseren Wasserstoff-Verbrauch schätzte ich auf 135 Liter für die erste Strecke. Ich drückte auf den Startknopf, schaltete die Automatik ein, und schon hob unsere Maschine ab. Auf dem Flug hatten wir klare Sicht. Es wehte aber ein starker Wind von Nordwest, der unseren Flug Richtung Südost stark beschleunigte und Treibstoff sparte. Wir konnten beim Überfliegen der Alpen sogar Österreichs höchsten Berg, den Großglockner, gut erkennen. Kurz nach zehn Uhr landeten wir sicher in Bukarest. Während des Auftankens stiegen wir aus und nahmen im Flughafen-Restaurant ein rumänisches Frühstück ein. Für den Überflug über die Türkei brauchten wir eine Genehmigung mit Angabe des Datums und der Flugzeug-Bezeichnung, die ich schon ein paar Tage vorher eingeholt hatte. Dem Bukarester Flugplatz-Tower musste ich unser Flugziel noch angeben. Unsere Flughöhe wurde uns wegen des dichten Flugverkehrs vorgeschrieben: 5.500 Meter. Bei aller modernen Technik wird im Luftverkehr die Höhe immer noch in „Fuß“ gemessen. 5.500 Meter entsprechen demnach 18.045 Fuß. Gegen 11.30 Uhr ging es weiter in Richtung Beirut, wo ich unsere Ankunft für 15 Uhr angemeldet hatte. Wieder waren wir etwas schneller unterwegs, als ich berechnet hatte. Jedenfalls landeten wir in Beirut schon vor 15 Uhr. Mit Frau Prof. Weinheimer hatte Jana für diesen Nachmittag ein Zusammentreffen auf dem Flughafen von Tel Aviv vereinbart. Nun musste ich ihr nur noch unsere Ankunftszeit nennen, die ich ihr über mein Smarty für 17 Uhr ankündigte. Wir landeten auch pünktlich gegen 16.45 in Tel Aviv Airport Ben-Gurion. Nun musste ich noch mit der Flughafenleitung klären, wo wir unsere Maschine für zwei Tage parken könnten. Sarah Weinheimer empfing Jana mit großer Herzlichkeit und uns alle vier hieß sie in Al Genezareth willkommen. Bei einer Tasse Kaffee machten wir uns erst einmal etwas näher bekannt. Nach dem langen Flug hatten wir jetzt ordentlichen Hunger. Ich fand es sehr nett, dass Frau Weinheimer uns das Du anbot. Wir luden Sarah zum Essen ein und baten sie, uns zu einem guten Restaurant in der Stadt zu führen, ihr geräumiges Auto hatte Platz für uns fünf. Von Deutschland aus hatten wir zwei Zimmer im Hotel Shalom gebucht, wo uns Sarah nach dem Essen hinfuhr. In der Hotelbar saßen wir noch eine gemütliche Stunde zusammen und besprachen unsere Besuchspläne für die nächsten zwei Tage. Am nächsten Morgen wollte sie uns pünktlich neun Uhr abholen. Nach dem langen Flug, auf dem ich ja die Verantwortung trug und alle Instrumente und Anzeigetafeln im Auge behalten musste, war ich etwas erschöpft
Deshalb zog ich mich bald in unser Zimmer zurück, das ich mit Paula teilte. Ich konnte aber lange nicht einschlafen, denn Sarah hatte uns eine Menge über ihr Land erzählt, was mich total überraschte, weil ich das aus unseren Zeitungen oder den TV-Nachrichten nicht erfahren hatte. Zunächst Israel und später auch das vereinigte Al Genezareth platzte schon vor der Vereinigung aus allen Nähten, weil jahrzehntelang Jahr für Jahr Juden aus aller Welt einwanderten. Es hatte daher in seine neue Verfassung einen Einwanderungsstopp mit aufgenommen. Es darf die zuletzt festgestellte Gesamteinwohnerzahl nicht mehr überschritten werden. Es dürfen also nur so viele Menschen einwandern, wie Abgänge ermittelt werden. Die Zwei-Kinder-Regelung wird darüber hinaus auch hier streng eingehalten. Neben der Erschließung des einst völlig verkarsteten und vertrockneten Landes, in dem es auch keine bekannten Bodenschätze gab, wurde zunächst die Landwirtschaft in genial-wissenschaftlicher Weise aufgebaut. Energiequellen gab es auch keine. Seit Anfang 2000 war es klar, dass auch die Wasservorräte des Landes nicht ausreichen würden, um die Landwirtschaft am Leben zu erhalten und die wachsende Industrie zu versorgen. So wurden bis 2020 bereits umfangreiche Meerwasser-Entsalzungsanlagen errichtet:
Bald stellte sich heraus, dass das Betreiben der energie-aufwendigen Entsalzungsanlagen mit den importierten fossilen Energien (Kohle, Öl, Erdgas) auf Dauer nicht zu finanzieren war. So begann man selbst, intensiv nach Erdöl und Erdgas zu suchen. Unter dem Mittelmeer entdeckten die Israelis dann ergiebige Erdgasfelder, mit denen sie zehn Jahre später ihren gesamten Energiehaushalt decken konnten. Die Entwicklung der Jülicher Solarkraftwerke war natürlich zusätzlich hoch willkommen, denn Erdgasvorkommen werden eines Tages erschöpft sein, während die Sonne – wenn auch manchmal mit Unterbrechung – ewig scheinen wird. Somit wurden in den Folgejahren zehn weitere sonnenbetriebene Kraftwerke in Kombination mit Entsalzungsanlagen und zusätzlich auch Windenergieanlagen gebaut, mit denen der Jordan, der See Genezareth (international „Lake Tiberias“ genannt) und das Tote Meer wiederbelebt werden konnten. Auch Jordanien wird durch den Jordan mit Süßwasser versorgt. Im Süden, in Elat, wurden mehrere Entsalzungsanlagen am Roten Meer errichtet, wodurch weite Gebiete der Negevwüste erschlossen werden konnten. Diese Gegend wollten wir uns am zweiten Tag anschauen. Sonnenenergie wird in Israel schon seit 130 Jahren genutzt und entwickelt. Der Bedarf an Warmwasser in den Haushalten wird in Israel ausschließlich durch Sonnenkollektoren gedeckt. Seit ein paar Jahren ist auch eine israelische Fusionsanlage fertiggestellt, die als eine Weiterentwicklung der chinesischen Anlage gilt. Ihr Leistungsvermögen ist geheim, soll aber ein Mehrfaches der chinesischen Anlagen betragen. Das Land ist im Wesentlichen von Feinden umgeben. Der ehemals ärgste Feind, der im Gaza-Streifen saß, ist inzwischen zwangsvereinigt und zufriedengestellt. Nur Jordanien hatte sich eigentlich immer neutral verhalten. Seitdem Jordanien weitgehend von den israelischen Wasserlieferungen abhängig ist, entstand sogar eine gewisse Freundschaft. Kurz nach der Gründung des Staates Israel wollte Ägypten nach eigener Aussage zusammen mit Syrien die „Juden ins Meer treiben“. Sie begannen einen erbitterten Krieg – und waren innerhalb von sechs Tagen besiegt. Israel gewann hierdurch große Gebiete neues Land, das es auch für die Einwanderungsströme bitter nötig brauchte. Ägypten bekam später eine etwas gemäßigtere Regierung und schloss Frieden. Israel gab die eroberte Sinai-Halbinsel an Ägypten zurück. Syrien verlor die Golan-Höhen, von denen aus man ganz Israel beschießen könnte. Dieses strategisch so wichtige Gebiet werden die Israelis mit Sicherheit niemals wieder zurückgeben. (Ich nenne sie immer noch so, weil das leichter auszusprechen ist als „die Genezarether“.) Bleiben noch Libanon und Saudi-Arabien. Diese beiden Länder sind keine Freunde Israels. Sie haben im eigenen Land aber so viele Probleme, dass sie sich in die Auseinandersetzungen mit den Juden zunächst nicht einlassen wollten. Aufgrund dieser politischen Lage entstand in Israel auch eine starke Rüstungsindustrie, deren Produkte in alle Welt verkauft werden. (Ich glaube: auch an ihre ehemaligen Feinde.) Das alles ging mir durch den Kopf. Ich kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus, schlief aber dann doch noch ein, nachdem ich bemerkt hatte, dass inzwischen auch Paula im Bett lag. Am nächsten Morgen waren wir pünktlich zum Frühstück versammelt. Punkt neun Uhr erschien Sarah. Wir stiegen in ihr Auto. Die Fahrt ging an der Küste entlang Richtung Norden zu den Jaffa-Orangen-Plantagen, die schon zu Zeiten der Kreuzritter dort angebaut wurden. Sarah berichtete, dass vor 90 Jahren der Anbau zum Erliegen kam, weil nicht mehr genügend Wasser zur Verfügung stand. Doch zehn Jahre später förderte die erste Meerwasser-Entsalzungsanlage wieder genügend Süßwasser, und der Export dieser berühmten Sorte lief wieder an. Jetzt, im Oktober, war ja gerade Erntezeit. Wir stiegen in einer der größten Farmen aus. Sarah kannte die Leiterin, die sie schon über unseren Besuch informiert hatte. Jetzt hörten wir zum ersten Mal aus berufenem Mund, welche Folgen der Vulkanausbruch in den Rekultivierungs-Gebieten verursacht hatte „Der vergangene Winter war ungewöhnlich kalt, weil die Sonnenwärme die Erde nicht mehr erreichen konnte. Die Hälfte der Obstbäume hatte Frostschäden, weitere 20 Prozent waren nicht mehr zu retten und mussten abgeholzt werden. Die überlebenden Bäume mussten zurückgeschnitten werden, weil einzelne Äste, die eigentlich Früchte tragen sollten, abgestorben waren. Zur Zeit der Frühjahrsblüte war der Himmel immer noch zu dunkel. Entsprechend mager fiel die Frühjahrsblüte aus. Das Wachstum der Früchte setzte viel zu spät ein. Die diesjährige Ernte fällt daher sehr mager aus. Die Früchte haben bei weitem nicht ihre gewohnte Qualität erreicht, obwohl ja jetzt wieder die Sonne scheint. Wie sind die Zukunftsaussichten? Wir haben aus unseren Gewächshäusern junge Nachzüchtungen eingepflanzt. Bis der alte Baumbestand wieder erreicht ist, werden aber noch einige Jahre vergehen.“ Das waren ernüchternde Nachrichten. Wir gingen gemeinsam einige Reihen der Plantage entlang und waren schon einigermaßen erschrocken über die viel zu kleinen Früchte, die noch an den Bäumen hingen. Nach diesem ersten Eindruck wurde uns klar: Wenn das überall auf der Welt so aussieht, werden wir wohl in den folgenden Monaten – oder Jahren? – erhebliche Ernährungsprobleme auf der Welt erleben. Wir verabschiedeten uns mit Dank und fuhren weiter in Richtung Haifa. Ich wollte nun noch gerne die vor 100 bis 120 Jahren neu angepflanzten Wälder sehen, die die erste Rekultivierungsmaßnahme des jungen Staates Israel gewesen waren. Opa hatte Mitte der siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts als Tourist fünf Bäume gespendet, was fast alle Touristen in diesen Jahren getan hatten, um dem jungen Staat mit auf die Beine zu helfen. Wir fuhren also östlich um Haifa herum und erreichten die Waldzone, die sich entlang der Hügel bis Jerusalem erstreckt. Die Bäume waren jetzt über 100 Jahre alt: Kiefern, Zedern und Zypressen, hin und wieder unterbrochen von Korkeichen. Die Bäume sahen zum Teil übel aus. Die Nadeln waren teilweise von den Zweigen gefallen, aber zum Glück nicht alle. Hans-Jürgen, unser Biologe, untersuchte eine Reihe von Nadelhölzern und auch die Korkeichen und beruhigte uns. Die Bäume seien nicht tot. Da sie schon 100 Jahre alt waren, seien sie kräftig genug, um sich wieder zu erholen. Das hat uns alle sehr erleichtert. Allerdings empfahl Hans-Jürgen, den gesamten Waldbestand wieder gründlich zu bewässern. Der Boden sei zu trocken. Und wie soll das gehen? Durch Löschflugzeuge und das Anzapfen der Süßwasserleitung, die zum See Tiberias führt. Sarah meinte, dass sie das bei der Forstbehörde anregen würde. (Wie wir später erfuhren, war das bereits in Vorbereitung.) Ich gestehe, wir hatten die Israelis mal wieder unterschätzt! Wir machten einen längeren Spaziergang durch den Mischwald und konnten tatsächlich feststellen, dass einige Bäume schon wieder ausgetrieben hatten und jetzt, im Oktober, frisches Grün zeigten. Hoffentlich würden sie so den nächsten Winter überstehen! Mount Rainier hatte auch hier einiges durcheinander gebracht! Die nächste Station unserer Rundfahrt war der aus der Bibel bekannte See Genezareth, der jetzt in der Landessprache „Kineret“ heißt. Die Straße dorthin führt über lange Strecken abwärts, bis wir in der Stadt Tiberias am See eine Tiefe von 218 Meter unter dem Meesspiegel erreicht hatten. Eigentlich muss man ja noch drei Meter dazurechnen, weil der Meeresspiegel nach der letzten amtlichen Messung drei Meter gestiegen ist. Nachdem dem See große Mengen Süßwasser aus den Entsalzungsanlagen zugeführt werden, ist die Gefahr der Austrocknung gebannt. Durch die großflächige Rekultivierung des ehemals ausgedörrten Landes wurden dem See von Beginn des Staates Israel an enorme Mengen Wasser für die Anpflanzungen entnommen. Die durch die lange Sonnenverdunkelung angerichteten Schäden waren auch hier unverkennbar. Die Obsternte fiel auch hier kümmerlich aus. Infolge der fehlenden Sonneneinstrahlung waren ja die Solarkraftwerke, die die Entsalzung betreiben sollten, weitgehend ausgefallen, obwohl zur Rettung der geschädigten Pflanzen besonders viel Wasser benötigt wurde. Wenn die Temperaturen nicht gleichzeitig auch noch gesunken wären, wäre der Wasserbedarf allerdings noch größer ausgefallen. Der Wasserspiegel war also in diesem Jahr mangels Zulauf stark gefallen, doch würde er sich nun wieder erholen. Wir machten abschließend noch einen Rundgang durch den Ort, in dem Johannes der Täufer gewirkt hatte, der dort auch hingerichtet worden ist. Auch Jesus soll in Tiberias gepredigt haben. Nachdem wir jeder einen köstlichen Eisbecher verzehrt hatten, traten wir die Rückreise nach Tel Aviv an. Sarah hatte uns zu sich nach Hause eingeladen und setzte uns ein leckeres kaltes Abendessen vor, das sie schon am frühen Morgen vorbereitet hatte. Es war alles koscher, also nach jüdischen Glaubensregeln hergestellt. Der leckere Käse z. B. durfte nur mit mikrobiologischem Lab erzeugt sein. Dazu gab es Salate, frisches Brot, verschiedene Früchte, die aus Treibhäusern stammten und noch die alte Jaffa-Qualität besaßen. Nach dem Essen saßen wir noch ein Stündchen zusammen und besprachen die Tour des nächsten Tages. Reiseziel war die Negev-Wüste, die seit 30 Jahren Stück für Stück rekultiviert wird. Wie die Israelis das machen, darauf waren wir besonders gespannt. Wegen der Entfernung wählten wir als Transportmittel unser Flugzeug. Wir verabredeten uns also für neun Uhr auf dem Ben-Gurion Flughafen. Um an unsere abgestellte Maschine zu gelangen, mussten wir uns ausweisen und körperlich durchsuchen lassen. Die Israelis sind da immer noch sehr genau, denn es hatte in der Vergangenheit schon viele Attentatsversuche gegeben, die aber dank der strengen Sicherheitskontrollen alle abgefangen wurden. Auftanken, einige Snacks für unterwegs einkaufen, Wetterbericht checken, Anweisungen empfangen für die Landung in Elat, schließlich einsteigen und das Anrollen zum Startplatz: Alles war nach einer halben Stunde erledigt. Gegen 9.30 Uhr drückte ich nach Eingabe der Koordinaten und der Flughöhe auf den Startknopf, und unsere Maschine erhob sich Richtung Südsüdost. Unterwegs informierte uns Sarah noch über einige Besonderheiten der Negev-Wüste. Zunächst einmal: Weite Gebiete der Wüste sind seit etwa 100 Jahren militärisches Sperrgebiet. Mittendrin befindet sich ein Atomkraftwerk. Wahrscheinlich sind dort auch israelische Atombombenversuche vorgenommen worden. Schon seit der Gründung des Staates Israel wird an der Verwirklichung des Traums gearbeitet, die Wüste in fruchtbares Land zu verwandeln. Der bekannteste Vertreter dieser Idee war David Ben-Gurion (erster Ministerpräsident Israels), der selbst in den Kibbuz „Sede Boker“ einzog, um an der Besiedlung der Wüste mitzuwirken. Dies erklärt, warum das Nationale Israelische Solarforschungsinstitut und das Israelische Wüstenforschungszentrum sich in Sede Boker befinden. Innovative landwirtschaftliche Methoden, wie die auf antiken Vorbildern aufbauende Sturzwasserlandwirtschaft, wurden in der Negev entwickelt und angewendet. Diese Bewässerungstechnik beruht darauf, dass es in der Wüste bekanntlich nur selten regnet. Wenn aber, dann oft sintflutartig mit einer Heftigkeit, dass von den Fluten alles, was man an Gemüse und Getreide angebaut hatte, weggeschwemmt wird. In einer ausgeklügelten Anordnung werden nun um die landwirtschaftlichen Gebiete Mauern errichtet, die die Wasserfluten aufhalten und in große Auffangbecken lenken, die dann während der Trockenzeiten den Wasserbedarf sichern. Ein aufstrebender Wirtschaftszweig der Negev ist erstaunlicherweise die Fischzucht. So wird fossiles Brackwasser in künstliche Teiche gepumpt. Die Ausbeuten sind wegen des heißen Klimas äußerst ertragreich, und der Wirtschaftszweig hat sich als sehr profitabel erwiesen. Das leicht salzhaltige fossile Brackwasser hat sich auch für die Bewässerung von speziell für diese Bedingungen gezüchteten Früchten und Gemüsesorten als geeignet erwiesen. Viele in Europa bekannte israelische Landwirtschaftserzeugnisse stammen aus der Wüste, auch deshalb, weil das ganzjährig abgemilderte Klima Energiekosten spart und so einen Exportvorsprung ermöglicht. Die marrokkanische Züchtung einer für Brackwasser geeigneten Reissorte passte genau in das israelische Konzept. In Elat liefern bereits seit zehn Jahren ein Fusionskraftwerk und ein konventionelles Atomkraftwerk sowie große Solarkraftwerke unglaubliche Mengen an Energie für die Betreibung von drei gewaltigen Meerwasser-Entsalzungsanlagen. Damit steht auch genügend Süßwasser zur Verfügung. Die Brackwasser-Förderung aus dem Untergrund ist inzwischen weitgehend erschöpft. Dem entsalzten Meerwasser wird jetzt die jeweils richtige Menge Meerwasser wieder hinzugefügt. Soweit die Vor-Information. Nach einer halben Stunde Flugzeit für die 285 Kilometer lange Strecke, auf der wir wieder starken Rückenwind hatten, kamen Elat und das Rote Meer in Sicht. Fünf Minuten später landeten wir auf dem dortigen Flugpatz, der hauptsächlich dem Touristen-Flugverkehr dient. Sobald die neue Transrapid-Strecke zwischen Haifa, Tel Aviv, Jerusalem und Elat fertig ist, wird sich der Flugverkehr wohl nur noch, oder im Wesentlichen, auf private Flugzeuge beschränken. Sarah hatte unterwegs bereits einen Mietwagen bestellt, der uns vor einem Nebengebäude des Flughafens in Empfang nahm. Unsere Strecke führte uns nun nach Norden. Von Wüste war eigentlich nichts mehr zu bemerken. Dort, wo der ehemalige Wüstenboden nur steinig war, waren Seen und Teiche angelegt worden. Unterschiedlich alte Nadelwälder begleiteten unsere Straße etwa eine Stunde lang. Dazwischen sahen wir Obstplantagen und neu entstandene Siedlungen, die typisch israelischen Kibbuzim. Diese werden fast ausschließlich von Einwanderern bewohnt. Dort gilt der reine Sozialismus: Allen gehört alles gemeinsam. Es gibt eine Leiterin oder einen Leiter der Gemeinschaft, der die Weisungen für die zu leistende Arbeit erteilt. Arbeitspläne, Anbaupläne, Arbeitszeiten etc. werden gemeinsam festgelegt. Die ganze israelische Landwirtschaft ist auf diese Weise überaus erfolgreich entstanden. Wir sahen sowohl in den Wäldern als auch auf den Feldern erhebliche Schäden, die die lange Dunkelheitsphase angerichtet hatte. Hans-Jürgen, unser Biologe, der sich alles ganz genau anschaute, bestätigte aber, dass es keine Total-Ausfälle gab. In ein bis zwei Jahren könne man mit den früheren Ernteerträgen rechnen. Sarah erzählte uns auf der Fahrt noch einiges über die israelische Rekultivierungstechnik, die ja weitgehend Vorlage für die Sahara-Anpflanzungen war. In den Orten Be’erSheva (Beersheba) und dem südöstlich davon gelegenen Dimona gibt es seit 60 Jahren ausgedehnte Baumschulen und Saatzuchtbetriebe, die den Bedarf für die Neu-Anpflanzungen decken. Ursprünglich kam das Wasser hierfür aus Oasen-Quellen oder aus erbohrtem Untergrund. Doch diese Vorräte aus der Eiszeit gehen allmählich zur Neige. Heute werden beide Orte mit entsalztem Wasser aus dem Mittelmeer und dem Roten Meer versorgt. Mit dem Auto kamen wir natürlich nicht so weit nach Norden. Das hätte man in einer Tagestour nicht schaffen können, denn wir hätten auf dem Weg dorthin das weiträumig abgesperrte Militärgebiet umfahren müssen. Auf dem Rückflug wollten wir aber mal einen Blick von oben hineinwerfen. Beersheba ist übrigens eine uralte Stadt, die in der Bibel mehrfach erwähnt wird. Auch der alte Abraham soll hier eine Zeit lang gelebt haben. Da dies ein Ort gewesen sein muss, wo „Milch und Honig fließt“, müssen demnach vor Jahrtausenden die klimatischen Verhältnisse wesentlich günstiger gewesen sein, als sie es heute sind. Nach etwa 60 Kilometern Fahrt machten wir im Kibbuz „Nehud-Semadar“ eine Rastpause. Hier werden verschiedene Weinsorten allerhöchster Bio-Qualität angebaut. Darüber hinaus gibt es Dattelpalmen- und Olivenplantagen, Pfirsich-, Aprikosen-, Mandarinen-, Apfelsinen-, Granatäpfel-, Birnen-, Melonen- und Kiwi-Felder. Alle Arten hatten Schäden, und die Ernte fiel in diesem Jahr kümmerlich aus. Der Kibbuz war zwar in einer Oase entstanden, ist aber an die Wasserleitung aus Elat angeschlossen. Hier ist aus der Wüste ein Paradies entstanden. Rings um den Ort wachsen auch seit 80 Jahren Pinien, Zedern, Tamarisken und Zypressen, die die Luft in ein angenehmes Klima verwandeln. Früher muss hier eine fast unerträgliche Hitze geherrscht haben. Am Nachmittag erreichten wir den Nationalpark Awda im riesigen Erosionskrater der Negev namens „Machtesch Ramon“. Hier endet eine der drei Hauptwasserleitungen aus Elat. Der Ramon-Krater ist ein uralter erloschener Vulkan, dessen Wände seit Jahrmillionen verfallen. Der Krater bildet eine riesige Senke, in der es auch Wasser gab. Er war früher von den Nabatäern besiedelt und lag an der prähistorischen Weihrauchstraße. Heute ist der Krater bereits ein riesiger See, der die Pflanzkulturen mit Wasser versorgt und auch das heiße Klima etwas mildert. Wir staunten auch hier über die reichhaltigen Anpflanzungen. Es gab auch ausgedehnte Wiesenflächen für Ziegen und Schafe, aus deren Milch ein hochwertiger Käse hergestellt wird. Wir konnten uns kaum sattsehen, auch wenn das Wachstum wegen der langen Dunkelheit in diesem Jahr nur spärlich war. Aber nun wurde es höchste Zeit, wieder zurückzufahren und den Rückflug anzutreten. Wir erwischten gerade noch die letzte halbe Stunde, bevor es Nacht wurde, was ja in diesen Breiten ziemlich schnell geht. Wir überflogen Beersheba und konnten gerade noch erkennen, welche gewaltigen Ausmaße die dortigen Baumschulen hatten. Aber wir durften nun keine Zeit mehr verlieren, um noch mit dem letzten Tageslicht in Tel Aviv zu landen. Wir besuchten noch am Abend ein kleines, aber gemütliches koscheres Restaurant, wo wir Abschied von Sarah nahmen, zu der sich inzwischen eine herzliche Freundschaft entwickelt hatte. Am nächsten Morgen flogen wir in den Gazastreifen, um noch drei Tage Erholung am Mittelmeer zu genießen. Das früher so radikale Land, von dem aus regelmäßig Raketen auf Israel abgeschossen wurden, hat sich in den letzten 30 Jahren zu einem attraktiven Ferienland entwickelt. Der angestiegene Meeresspiegel wurde genutzt, den Strand ins Land hinein zu verschieben und neue, preiswerte Strand-Hotels zu errichten. Ein sichtbarer Wohlstand ist nun endlich auch dort eingekehrt. Dies war der abschließende Eindruck unseres Israel-Besuches. Saudi Arabien. Unsere Reise nach Saudi-Arabien sollte drei Tage mit Besichtigungen der rekultivierten Gebiete ausgefüllt werden. Die Anreise durfte ja nicht von Al Genezareth aus erfolgen. Wir mussten also den Umweg über Jordanien und den Irak nehmen, um in dem Grenzort Arar zu landen. Hans-Jürgen hatte den Inhalt aus der E-Mail seines saudischen Kommilitonen uns drei Schwestern auf unsere Smarties überspielt, sodass wir alle wussten, wohin wir fliegen und was wir ungefähr zu sehen bekommen würden. Früh um sieben Uhr bestiegen wir in Gaza unsere Maschine. Es dauerte etwas, bis ich die Koordinaten des kleinen Grenzortes Arar herausgefunden hatte. Wir durften mit der kleinen Privatmaschine hier nicht höher als 3.000 Meter fliegen. Der Wetterbericht war auch akzeptabel. Wir würden nur mit starkem Seitenwind aus Nordost zu rechnen haben. Der Autopilot des Flugzeuges wird sich darauf von allein einstellen und trotzdem die direkte und kürzeste Fluglinie einhalten. Die Entfernung wurde mit 530 Kilometer angegeben. Um 7.20 Uhr hoben wir ab. Unter uns sahen wir ein dicht besiedeltes Land vorbeigleiten, Orte mit Industrie und dann wieder weite Flächen mit Wäldern und Obstplantagen. Getreide- und Reisfelder konnten wir nur sehr wenige erkennen
Nach etwa eineinhalb Stunden landeten wir auf einem von oben erkennbaren Parkplatz für Kleinflugzeuge. Beim Zoll mussten wir unsere Pässe und die Besuchserlaubnis vorzeigen. Das Tragen christlicher Symbole wurde ausdrücklich verboten, aber die hatten wir ohnehin nicht bei uns. Auch unsere europäische Kleidung wurde kritisch überprüft. Wir mussten auch angeben, wo wir uns wie lange aufhalten wollten. Wir nannten zuerst Riad, die Hauptstadt. Dann aus der uns vorliegenden Vorschlagsliste die Orte: Almayah-jadid, Almayah-nazifa, Madina-godida, Mustaqbal und Bidun-milahh. Alle diese Neu-Siedlungen liegen im Gebiet Ash Sharqiyah, was soviel heißt wie „Östliche Region“. In Wahrheit ist es aber der riesige südöstliche Teil des Landes. Zuvor wollten wir aber vorher noch der Küstenstadt Ras-al-Khafji einen Besuch abstatten, weil dort die größten Meerwasser-Entsalzungsanlagen der Welt stehen, die vor allem die Hauptstadt Riad mit Süßwasser versorgen. Früher hieß es: „Die Saudis schwimmen im Geld, ersticken im Oel und verdursten im Sand.“ Aber heute scheint das Verdursten nicht mehr so aktuell zu sein. Es stellte sich heraus, dass der Zollbeamte die Namen der Neu-Ansiedlungen gar nicht kannte und auch nicht in seinem Nachschlagewerk fand. Das machte ihn misstrauisch. Er hielt uns nun für Spione, zumal es im südöstlichen Gebiet geheime Militär-Stützpunkte gab und wohl auch heute noch gibt. Hans-Jürgen kam die rettende Idee, und er sagte ihm, er möge doch bitte die Uni Riad anrufen und Prof. Yussuf Almani verlangen. Hans-Jürgen hatte auch gleich die Durchwahl-Nummer bereit. Herr Almani wusste ja von unserer Reise, denn er war von Hans-Jürgen informiert worden. Er erwartete uns gegen Abend. Wir hatten Glück, Herr Almani war am Apparat und konnte die Sache aufklären. Die ganze Einreisezeremonie hatte uns viel zu lange aufgehalten. Doch gegen zehn Uhr konnten wir nach Riad weiterfliegen, nachdem wir die Maschine so voll wie irgend möglich getankt hatten. Zum Glück gab es auf dem kleinen Flugplatz eine Wasserstoff-Tankstelle. Die Entfernung betrug ca. 1.200 Kilometer bis Riad. Jetzt konnten wir auch wieder in größerer Höhe fliegen, denn der Flugverkehr auf dieser Strecke war nicht sehr stark. Wir stiegen auf 5.500 Meter bei klarer Sicht und nutzten den Schiebewind, der uns nach knapp drei Stunden Flugzeit auf dem Riad Airport King Khalid International sicher landen ließ. Bis die Maschine in dem uns zugewiesenen Hangar untergebracht und unsere Registrierung erledigt war, verging nochmals etwas Zeit. Unterwegs hatte Jana auf ihrem Smartphone für uns ein Hotel herausgesucht und dort zwei Doppelzimmer für zwei Nächte gebucht. Auch Paula war nicht untätig geblieben und hatte ein Innenstadt-Restaurant gefunden und dort einen Tisch für uns vier zum Mittagessen reservieren lassen. Als wir dort eintrafen, war es schon 16 Uhr, denn die Saudis waren mit ihrer Zeit eine Stunde vor den Israelis voraus. Wir bekamen trotzdem noch ein leckeres Mittagessen. Nach dem Essen machten wir einen ausgiebigen Spaziergang durch die Innenstadt. Wir sahen unterwegs viele modern gekleidete Frauen, die lediglich ein Kopftuch als muslimisches Kennzeichen tragen mussten. Seit 50 Jahren ist den Frauen auch das Chauffieren eines Autos erlaubt. Ob sie auch einen Flugschein erwerben dürfen, weiß ich nicht, doch glaube ich das schon. Jedenfalls dürfen sie seit einiger Zeit ein eigenes Bankkonto besitzen, ein Grundstück erwerben, und beruflich Geld verdienen dürfen sie auch. Da hat sich schon einiges zum Positiven gewandelt, wenn auch reichlich spät. Ich hatte früher gelesen, dass die Saudis große Probleme in der Wasserversorgung ihrer stark anwachsenden Städte haben. Tagelang waren die Wasserleitungen zeitweise trocken geblieben. Doch das ist inzwischen anders geworden. Wir sahen in der Stadt einige Springbrunnen und auch ein paar gepflegte Parkanlagen mit Blumenbeeten. In einem dieser Parks machten wir eine kleine Rast und kamen mit einer perfekt englisch sprechenden jungen Frau ins Gespräch, die auf einer Nebenbank eine Portion Eis verzehrte. Sie erklärte uns, dass Riad schon seit 50 Jahren mit Wasser von der Küste versorgt werde. Die Einwohnerzahl von Riad wachse aber so schnell an, dass die Wasserversorgung nicht nachkomme, sodass es immer mal wieder akute Wassernot gebe. Inzwischen sei aber eine mehrere 100.000 Kubikmeter Wasser fassende unterirdische Zisterne fertiggestellt, die die Wasserversorgung und die Anpflanzung kühlender Parks, Blumenbeete und deren laufende Bewässerung sicherstelle. Seit den fünfziger Jahren seien rings um Riad mehrere Millionen Bäume angepflanzt worden, die das fast unerträglich heiße Klima verbessert haben. Temperaturen bis zu 50 Grad Celsius waren im Juli und August keine Seltenheit. Das komme jetzt hier nicht mehr vor. Auf meine Frage, wie die umgebenden Wälder die Dunkelperiode der letzten Monate überstanden hätten, meinte sie: „Wir können froh sein, dass unsere Planer bei der Anlage der Meerwasser-Entsalzungen nicht ausschließlich auf Sonnenenergie gesetzt haben, sondern gleich ein großes Atomkraftwerk mit angelegt hatten, das die Energie für den steigenden Bedarf bei Tag und Nacht zuverlässig liefert. Die Wälder und auch alle neu entstandenen Reis- und Getreidefelder konnten deshalb während dieser Zeit verstärkt mit Wasser versorgt werden, obwohl es in diesen Monaten erheblich kälter als sonst gewesen ist. Die Schäden haben sich somit in Grenzen gehalten.“ Das war ein sehr nettes und auch aufschlussreiches Gespräch. Hans-Jürgen rief von unserer Bank aus nochmal seinen Exkollegen Yussuf Almani an und vereinbarte mit ihm ein Treffen zum Abendessen in einem besonders schicken Restaurant, zu dem wir ihn einladen wollten. Die Einladung lehnte er ab und lud uns seinerseits zu einem „Begrüßungsmahl“ ein, denn das wäre doch hier Gebot der Gastfreundschaft. Er freute sich, seinen Exkumpel nach so langer Zeit wiederzusehen und auch uns, seine Angehörigen, kennenzulernen. Das Treffen fand abends um 22 Uhr statt. So spät am Abend noch etwas zu unternehmen, ist hier üblich, weil im Sommer während der Mittagshitze das Leben ruht und die Stadt wie ausgestorben erscheint. Wir ließen uns – reichlich erhitzt, obwohl es ja schon Oktober war – ins Hotel fahren, meldeten uns an und zogen uns zum Duschen und Ausruhen auf unsere Zimmer zurück. Unser Reisegepäck hatten wir im Flugzeug gelassen und nur unser Übernachtungszeug im Rucksack. Das war unangenehm, denn wir hätten uns alle für den Abend passend umziehen müssen. Im Restaurant trafen wir Prof. Almani schon an. Ich musste mich zusammenreißen, um ihm bei der Begrüßung nicht die Hand hinzustrecken. Dennoch war die Begrüßung sehr herzlich. Die beiden Herren unterhielten sich bei unserem kleinen Imbiss sehr angeregt, vor allem über die Regierungspläne für die weitere Energie-, Wasser- und Lebensmittelversorgung in der Zukunft des Landes. Auch das Thema Bevölkerungszuwachs spielte eine Rolle. Saudi Arabien tat sich jahrelang schwer, die Zwei-Kinder-Beschränkung einzuhalten. Die Begründung vieler junger Leute hier war: Wir haben doch genug Land, und das Energie- und Wasserproblem ist doch dank der neuen Kraftwerke gelöst. Aber die Begründung der Regierungsstellen, dass man bald keine Rohstoffe mehr habe, um allen einen Fernsehapparat, einen PC oder gar ein Auto anbieten zu können, wenn man so weitermacht wie bisher, setzte sich dann doch durch. Die Zwangsimpfung nach dem zweiten Kind, die weitere Schwangerschaften verhütet, wird jetzt ohne größere Widerstände eingehalten. Prof. Almani erzählte uns Interessantes über die Wüsten-Rekultivierung der vergangenen Jahrzehnte und die Wirtschafts- Pläne für die kommenden Jahre „Erst seit 1938 wird im Lande Öl gefördert, und zwar wurde man zuerst fündig in der Siedlung Dammam am Persischen Golf. Erst allmählich wurde klar, dass fast der ganze Südosten unseres Wüstenlandes auf riesigen Ölfeldern ruht. Die amerikanische Firma Standard Oil war der Hauptinvestor, der dem Land (und vor allem sich selbst) satte Gewinne bescherte. Heute sind wir Saudis aber nicht mehr so dumm, uns von amerikanischen Konzernen übers Ohr hauen zu lassen. Wir wissen, was unser Öl wert ist und haben unsere eigene Förder- und Exportgesellschaft namens Aramco aufgebaut, die inzwischen die größte Ölfirma der Welt ist. Mit dem Welt-Verbot der Verbrennungsmotoren für den Straßenverkehr ging die Nachfrage nach Öl aber deutlich zurück. Bis in die dreißiger Jahre dieses Jahrhunderts war Saudi Arabien reiner Rohstoff-Exporteur. Etwa ab 2035 begann Aramco hier mit der Herstellung von Treibstoffen für die immer weiter wachsende Flugindustrie, speziell also mit der Kerosin-Produktion. Es wurden mehrere große Ölraffinerien errichtet. Dafür mussten wir die Fachleute erst ins Land holen, die wir mit Spitzengehältern entlohnen mussten, damit sie überhaupt kamen, um in unserem heißen Klima eine Zeit lang zu leben. Damit wurde die Grundlage für den Aufbau einer Industrie in unserem Land gelegt. Es gab aber noch viele Probleme zu lösen. Die Herstellung von Kerosin aus Erdöl erfordert viele chemische Prozesse. Nur ein kleiner Anteil des Erdöls kann für die Kerosin-Herstellung genutzt werden. Es fällt dabei eine große Anzahl von Nebenprodukten an, für die wir hier gar keine Verwendung haben. Damit sich die Kerosin-Produktion überhaupt lohnt, mussten Abnehmer für die Nebenprodukte, z. B. Kunststoffe, noch gefunden werden. Dafür mussten wir Kaufleute, speziell Marketing-Experten anheuern, die sich auf diesen Gebieten auskennen. Es bedurfte also ungeheurer Anstrengungen, um erst einmal eine arabische Industrie aufzubauen. Heute verstehen wir uns vorwiegend als Öllieferant im komplexen Sinne. Das heißt: Wir produzieren nun auch mit einem hohen Marktanteil Speiseöle, die wir in alle Welt exportieren. Wir bauen also nicht nur ölhaltigen Pflanzen an, wie Datteln, Kokos, Erdnüsse, tropischen Raps und Oliven, sondern verarbeiten die Öle zu Speiseölen und -fetten. Dieser Industriezweig wurde, wie Sie ja wissen, erst durch umfangreiche Meerwasser-Entsalzung in Verbindung mit Atomkraft, Windenergie und mit Hilfe deutscher und chinesischer Solarkraftwerke ermöglicht. Wie Sie auf Ihrem Rundflug durch unser Land erleben werden, haben wir zwei weitere Schwerpunkte, sowohl für den Eigenbedarf als auch für den Export geschaffen: Wir bauen mit Hilfe der jetzt zur Verfügung stehenden Bewässerungsmethoden Baumwolle im großen Stil an. Wir haben bereits erreicht, dass der Anteil von Kunststoffen in der Textilindustrie wieder rückläufig ist und dass stattdessen wieder mehr Baumwolle verwendet wird. Die Nachfrage nach Wolle ist in unserem Land und in unseren Nachbarländern wegen des heißen Klimas nur gering, daher haben wir darauf verzichtet, ausgedehnte Weiden für Schafherden einzurichten. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Produktion und unseres Exportes ist Mais, Soja, Weizen und Hafer. Hierfür mussten für das Klima geeignete Sorten gezüchtet werden. Ich selbst bin daran maßgeblich beteiligt, dass wir in dieser Hinsicht über unseren religiösen Schatten gesprungen sind, indem wir israelische Wissenschaftler engagiert und für sie Forschungs-Institute eingerichtet haben. Darüber hinaus bauen wir auch salzverträglichen Reis in großem Umfang an. Reis zu verzehren, war in unserem Land früher kaum üblich. Das hat sich in den vergangenen 20 Jahren aber stark verändert. Um unser extremes Klima zu mildern, aber auch um unsere landwirtschaftlichen Flächen vor Sandstürmen zu schützen, haben wir in den letzten 40 Jahren zwischen unseren Pflanzungen ausgedehnte Waldgebiete angelegt. Es wurden mit Unterstützung der Meerwasser-Entsalzung inzwischen schätzungsweise 500 Millionen Bäume angepflanzt. Wir haben in unserem Land nicht nur Sandwüsten, sondern auch Felsen und weite Gebiete nur mit Geröll, die sich jeder Bepflanzung widersetzt haben. Für diese Zonen haben wir Millionen Tonnen von Schlamm und Humuserde importiert, die wir mit Sand vermischt haben, um wenigstens ein bescheidenes Pflanzenwachstum zu ermöglichen. Die Israelis haben da schon Erstaunliches geleistet. Wir werden in einigen Jahrzehnten also auch Holz, sogar Bambus und Edelhölzer exportieren können.“ Nach diesem langen Vortrag, der uns sehr beeindruckte, ergaben sich noch viele weitere Fragen, die Prof. Ismali geduldig beantwortete. Die Zeit verging wie im Fluge. Wir bedankten uns und verabschiedeten uns sehr herzlich. Leider stand er uns für unsere Rundreise nicht zur Verfügung, da er in den nächsten Tagen wichtige Termine hatte. Ein Taxi fuhr die Familie – außer mir – ins Hotel. Ich musste ja dringend noch zum Flugzeug, um unser Gepäck zu holen. Alle waren froh, morgen früh wieder frische Sachen anziehen zu können. Nach einem anstrengenden Tag wie diesem sank jeder von uns reichlich müde ins Bett. Wasser zum Duschen gab es reichlich. Beim Frühstück am nächsten Morgen besprachen wir die nächsten Ziele. Mein schlaues Smarty hatte die Koordinaten für die jungen Wüstenorte, die wir besuchen wollten, herausgefunden. Wir konnten also alle Orte direkt ansteuern. Unser erstes Ziel war der Seehafen Al Dammam, die Stadt, von der der Wohlstand des Landes zuerst ausgegangen war. Wir fanden heraus, dass es inzwischen auch eine Transrapid-Verbindung zwischen Riad und Al Dammam gab. Wir ließen also unser Flugzeug im Riader Hangar stehen und fuhren unterirdisch nach Dammam. Aus dem kleinen Ort, der erst 1923 durch die Ansiedlung einer Volksgruppe aus dem benachbarten Bahrein zu einer Stadt wurde, ist nun ein Welthafen entstanden, in dem 900.000 Meschen wohnen und der ein Haupt-Umschlagsplatz für Güter aus aller Welt zur Versorgung der neun Millionen Menschen in und um Riad geworden ist. Bei unserem Rundgang durch die Stadt entdeckten wir ein Atomkraftwerk, zwei große Meerwasser-Entsalzungsanlagen, vier Solarkraftwerke, mindestens 30 Windräder und einen gewaltigen Container-Verladeplatz. Erst am Ende unseres Rundganges sahen wir, dass auch eine Stadtrundfahrt per Bus oder ein Rundflug per Kleinflugzeug, so ähnlich wie in Berlin, angeboten wurde. Am Hafen sahen wir auch Restaurants und Imbiss-Buden. Ja, wir hatten inzwischen Hunger bekommen, hatten aber keine Zeit, uns in ein Restaurant zu setzen. So nahmen wir nur einen kleinen Snack und danach ein Eis, und dann begann auch schon unsere Rundfahrt. An allen öffentlichen und privaten Gebäuden konnte man erkennen, dass dieses Land tatsächlich im Geld schwimmt. Alles war vom Feinsten und mit dem Teuersten ausgestattet. Allein der Bahnhof, wo wir heute Morgen ausgestiegen waren, ist ein Prachtstück der Architektur. Es gibt zwar immer noch eine ICE-Verbindung zwischen Dahrahn und Riad, aber die spielt kaum noch eine Rolle, nachdem die Trasrapid-Verbindung fertiggestellt ist. Erstaunt hat uns, dass wir auf unserer Rundfahrt kaum Container-Transporter angetroffen haben. Wo waren die Massen von Containern geblieben, die wir im Hafengebiet gesehen hatten? Des Rätsels Lösung erfuhren wir auf der Rundfahrt: Mit den modernsten Vortriebsmaschinen aus Deutschland war auch eine Zwei-Tunnel-Transrapid-Lastenstrecke zwischen Dahrahn und Riad gebaut worden, in der die Originalcontainer mit Importgütern ununterbrochen nach Riad transportiert werden, was für die 450 Kilometer Strecke etwa 40 Minuten benötigt. Umgekehrt werden so von Riad nach Dammam Exportgüter befördert, die direkt im Hafen landen und computergesteuert, zeitgenau in die Transportschiffe verladen werden. Da haben wir wieder einmal gestaunt. Was für ein Land der Gegensätze! Auf der einen Seite herrschte hier modernste Technik vor, kombiniert mit unvorstellbarem Luxus, auf der anderen Seite galt noch das mittelalterliche Rechtssystem der Scharia. Vollgestopft mit neuen Eindrücken landeten wir mit dem Abend-Transrapid wieder in Riad. Hungrig genossen wir in unserem Hotel ein typisch saudisches Dinner. Da ich noch meine Aufzeichnungen – nicht zu Papier bringen, sondern in mein Smarty – eingeben wollte, zog ich mich gleich nach dem Essen in unser Zimmer zurück. Ich dachte auch noch daran, was denn wäre, wenn ich mein Smarty aus irgendeinem Grunde verlieren würde oder wenn es mir geklaut würde? Das würde einer totalen Katastrophe für mich gleichkommen – wenn es nicht dafür eine Lösung gäbe. Mit einem Knopfdruck auf meinem Smarty werden alle meine Daten, die täglich dazukommen, bei Google gespeichert. Es kann niemals vorkommen, dass alles weg ist, vorausgesetzt, ich vergesse nicht, täglich den Speicherknopf zu drücken. Google weiß genau, wo ich mich gerade aufhalte. Mein Smarty ist auch gegen Verlust versichert. Bei Verlust des Smartys kann ich eine bestimmte Telefonnummer anrufen, gebe dort meine Geheimzahl an, werde eine Frage gefragt, die – vorher vereinbart – nur ich beantworten kann und erhalte am nächsten Tag schon an die von mir gewünschte Adresse ein neues, aufgeladenes Smarty. Mein altes Smarty wird sofort gesperrt. Ich muss nun eine neue Geheimzahl für die Benutzung des neuen Smartys eingeben. Das ist alles. Mein Bankkonto erfährt dabei allerdings zunächst einen schmerzlichen Verlust, der allerdings von meiner Versicherung ersetzt wird, falls mir das Smarty – durch Anzeige bei der örtlichen Polizei – nachweislich gestohlen wurde. Das gibt mir auf meinen Auslandsreisen ein absolut sicheres Gefühl. Die warme Dusche vor dem Schlafengehen war ein Genuss, denn die Klimaanlage unseres Zimmers war deutlich zu kalt eingestellt. Am nächsten Morgen ließen wir uns nach dem Auschecken aus unserem Hotel per Taxi zum Flughafen bringen. Ich zahlte die Parkgebühr, tankte voll und meldete mich ab zu den neuen Orten: Almayah-jadid (Neuwasser), Almayah-nazifa (sauberes Wasser), Madina-godida (Neustadt), Mustaqbal (Zukunft) und Bidun-malah (ohne Salz) in der „Eastern Region“ Der erste Ort mit dem für uns unaussprechlichen Namen war Neuwasser, der nur 450 Kilometer von Riad entfernt ist. Ich gab wie üblich die Koordinaten und die Flughöhe ein, drückte auf den Startknopf und vertraute uns dem Autopiloten an, der uns nach einer Stunde Flugzeit sicher in Almayah-jadid auf dem kleinen Landeplatz absetzte. In der Flugplatz-Information war ein Prospekt auf Englisch ausgelegt mit Informationen über den neuen Ort und über das landwirtschaftliche Anbaukonzept. Außerdem gab es einen Vorschlag einer Besichtigungs-Route, die für Besucher empfohlen wird. Auch hier gab es neu angelegte Wälder mit besonders genügsamen Ansprüchen an die Bodenqualität, die hier sehr dürftig war. Umsomehr brauchten die Pflanzen frisches Wasser. Das kam – entsalzt – aus einem künstlichen See, der von der Meerwasser-Entsalzung des Ortes Salwa am Persischen Golf reichlich versorgt wird. Eine Wasserleitung war nicht zu sehen, da das Wasser durch einen Tunnel hierher gepumpt wird. Ich muss nun gestehen, dass wir etwas enttäuscht waren, was wir hier zu sehen bekamen. Es waren endlose Felder mit Baumwolle, dazwischen wieder Wald, dann große Felder mit Soja und Reis. Auffallend waren ausgedehnte Bambus-Wälder, in denen man sogar vier Panda-Paare ausgewildert hatte, die leider unsichtbar blieben. Für die Aufzucht der jungen Bäume gab es endlose Reihen von Treibhäusern, wo die Pflanzen geschützt heranwachsen konnten, bis sie stark genug waren, ins Freie verpflanzt zu werden. Der Ortsbürgermeister hatte aber offenbar Freude daran, in einem der Gewächshäuser Orchideen zu züchten. Die durften wir uns anschauen und bewundern. Um Orchideen zu züchten, braucht man einschlägige Kenntnisse. Sonst wird da nichts draus. Automaten wurden reichlich eingesetzt, um die schwere Arbeit bei der Baumwoll- und Sojaernte zu erleichern. In Neuwasser lebten etwa 7.000 Menschen, meist Inder und Afrikaner, die hier recht gut verdienten und reichlich Arbeit hatten. Bis heute wird sich die Einwohnerzahl noch erheblich vergrößert haben. Das Erfreuliche war, dass die Dunkelheit nach dem Vulkanausbruch hier in Süd-Arabien nicht ganz so finster ausgefallen war. Es gab als Folge Ernte-Verzögerungen, aber nur geringe Ausfälle. Der See hier war der erste, der in der Eastern Region angelegt worden war. Das hatte sich offenbar auch in der Tierwelt herumgesprochen. Zahlreiche Wasservögel, wie Flamingos und Pelikane, hatten sich angesiedelt. Gnus, Antilopen, Schakale und leider auch einige Giftschlangen fanden reichlich Wasser. Leider gab es auch höchst giftige Skorpione, vor denen die Besucher gewarnt wurden. Wir hatten alle feste Schuhe dabei. Deshalb riskierten wir zum Tagesabschluss noch einen Spaziergang durch den jungen Wald, durch den es tatsächlich einen schmalen Pfad gab, der eigentlich für die Waldarbeiter angelegt worden war. Am Waldrand gab es einen Hochstand, von dem aus man die Tiere auf dem und um den See herum beobachten konnte. Hier gab es auch etwas Besonderes zu sehen, was mir bisher noch nicht begegnet war. Ein großes Waldgebiet war mit Eukalyptusbäumen bepflanzt worden. Und tatsächlich hatte man aus Australien Koala-Bären importiert, die sich offenbar recht gut an das Klima angepasst hatten, denn sie hatten sogar schon Nachwuchs gezeugt. Im Ort selbst gab es ein bescheidenes Hotel, in dem wir übernachten konnten und auch etwas zu essen bekamen. Nach dem Essen setzten wir uns zu einer Besprechung zusammen. Nach der ausführlichen Schilderung von Prof. Ismani wussten wir eigentlich schon, was wir hier zu sehen bekommen. Auf dem Flug hierher konnten wir beobachten, dass alles so ist, wie er es beschrieben hatte. Es gab in dem riesigen Land allerdings noch weite Gebiete mit nichts als Sand und Wüste, deren Einerlei nur durch zahlreiche Bohrtürme unterbrochen wurde. Wir beschlossen also, unseren Aufenthalt in Saudi-Arabien abzubrechen. Als Abschluss unserer Reise hatten wir noch einen zweitägigen Abstecher nach Dubai geplant. Paula hat dort eine Brieffreundin, mit der sie seit Jahren korrespondiert. Mit ihr wollte sie gern einmal zusammentreffen, und unsere Reise war hierzu eine gute Gelegenheit. Wir hatten dort schon von zu Hause aus ein Hotel gebucht. Wir riefen also per Smartphone dort an und bestellten für morgen einen Tag zusätzlichen Aufenthalt. Unsere Reiseziele, die wir nun auslassen würden, wollten wir am anderen Morgen beim Überfliegen von oben betrachten, um dann gleich weiter nach Dubai zu fliegen. Am nächsten Morgen gegen acht Uhr verließen wir unser kleines Hotel nach einem ausgiebigen Frühstück. Auf dem Weg zu unserem Flugzeug-Parkplatz sahen wir auf einem Hügel eine Ansammlung von Menschen, die um diese Zeit normalerweise auf dem Weg zu ihrer Abeitsstelle waren. Wir hörten aus der Ferne Schreie. Hans-Jürgen sprach einen Mann an und fragte, was dort los sei. Der Mann wollte erst nicht mit der Sprache heraus. Wir kamen aber auf unserem Weg noch näher an den Hügel heran. Da sahen wir es: Eine junge Frau war bis zum Oberkörper in den felsigen Grund eingegraben. In einem engen Halbkreis standen Menschen um sie herum und bewarfen sie mit Steinen, die etwa so groß wie Pflastersteine waren. Nun rückte der Mann, der offenbar ein Inder war, mit der Sprache heraus. „Stoning“, meinte er. Die Frau sei zum Tode durch Steinigung verurteilt worden. Sie sei beim Ehebruch mit einem anderen verheirateten Mann „in flagranti“ erwischt worden. Das Gesetz der Scharia kennt in diesem Fall keine Gnade. Sie wurde zum Tode durch Steinigen verurteilt mit der Maßgabe, dass der betrogene Ehemann den ersten und den letzten Stein werfen muss. Der Liebhaber der Frau, der selbst mit einer Auspeitschung davonkommt, musste selbst fünf Steine werfen. Der Mann erzählte noch weiter, dass der betrogene Ehemann die arme Frau fast täglich verprügelt hätte und sie wie eine Gefangene gehalten habe. Das waren hier aber keine mildernden Umstände. Wir beschleunigten unseren Schritt zum Parkplatz, denn dieses Drama wollten wir auf keinen Fall mit ansehen. Der Inder bemerkte noch, bevor er zum Hügel eilte, um ja nichts zu verpassen, dass das alles nicht so schlimm sei, denn, sobald die Verurteilte das Bewusstsein verloren hätte, käme der Scharfrichter und zertrümmere der Verurteilten den Schädel mit einem Felsbrocken, was zum augenblicklichen Tode führt. Uns zitterten noch die Knie, als wir bei unserer Maschine ankamen. Nur schnell weg von diesem schrecklichen Ort! Wir verstauten unser Gepäck. Treibstoff hatten wir genug. Ich gab noch die Koordinaten der anderen Orte mit den unaussprechlichen Namen ein, dazu auch die Koordinaten des Airport Dubai mit automatischer Landung. Als Flughöhe stellte ich 400 Meter und ab Bidun-malah 3.300 Meter mit Kurs auf Dubai ein. Wo einstmals öde Wüste, Felsen und Steine, Sand und einige vetrocknete Sträucher zu sehen waren, breiteten sich jetzt unter uns ausgedehnte Plantagen mit Palmen, Olivenbäumen, Raps-und Reisfeldern, aber auch Felder mit Erdnüssen aus. Ein großes Anbaugebiet hatte sich nicht nur der Speiseöl-Gewinnung gewidmet. Wir erkannten von oben auch mehrere große Mais- und Sojafelder. Dazwischen Nadelbäume, Ansiedlungen, Fabriken für die Weiterverarbeitung der Ernten und immer wieder Bohrtürme. Was hier an Öl gefördert wurde und z. T. auch noch wird, ist eine unvorstellbare Menge. Man hat inzwischen gemessen, dass das Land dadurch im Schnitt seit 1938, dem Beginn der Ölförderung, schon sechs Meter abgesunken ist, wogegen der Meeresspiegel hier um drei Meter gestiegen ist. Nun muss man langsam aufpassen, dass sich das Meer nicht allmählich über das Staatsgebiet ausbreitet. Dubai. Nach etwa einer Stunde Rundflug landeten wir nach weiteren zwei Stunden Flugzeit sicher in Dubai International Airport, nachdem ich vor dem Verlassen des Staatsgebietes von Saudi-Arabien unsere voraussichtliche Ankunft und die Bezeichnung unserer Maschine angemeldet hatte. Wir wurden nach dem Aufsetzen in einen Hangar weitergeleitet, wo wir einen Stellplatz zugewiesen bekamen. Für eine Landung auf dem Dach unseres Hotels war unser Flugzeug zu groß. Nach den vielen zurückgelegten Flugkilometern bestellte ich eine Wartung mit gleichzeitigem Auftanken für den Rückflug, auch mit zusätzlicher Füllung unseres Fernreisetanks, der die Reichweite des Flugzeugs um weitere 400 Kilometer verlängert, was allerdings nur geht, wenn nicht mehr als fünf Personen mitfliegen. Dies war eine Vorsichtsmaßnahme, da wir auf der Rückreise mit starkem Gegenwind rechnen mussten. Ehrlich gesagt, wir waren froh, das unheimliche Land Saudi-Arabien unbeschadet verlassen zu haben. Dies hier war nun die letzte Station unserer Informationsreise. Paula hatte sich bei ihrer Brieffreundin angemeldet, die ihr angeboten hatte, die drei Tage unseres Aufenthaltes bei ihr zu wohnen. Paula nahm das an, und so hatte ich jetzt eben das Hotelzimmer für mich allein – so hatte ich gedacht. Auf der ganzen Reise hatte ich fast täglich mit meinem Mann telephoniert. Als wir per Taxi unser Hotel erreicht hatten, traute ich meinen Augen nicht. In der Hotel-Lobby saß … mein lieber Ehemann und schloss mich freudestrahlend in die Arme. Er kannte Dubai noch nicht und wollte es gern mit uns zusammen kennenlernen. Deshalb habe er sich kurzentschlossen nach meinem Anruf ein Flugticket nach Dubai für den ersten Flug heute morgen gekauft. Ja, nun sei er eben da. Das hat mich gefreut. Sowas hatte er noch niemals vorher gemacht. Mein Mann hatte schon für uns fünf einen Tisch im Restaurant „At the Top Sky“ für 18 Uhr bestellt, was nun wirklich eine tolle, wenn auch kostspielige Idee war. Es befindet sich nämlich in 450 Meter Höhe, im 148. Stockwerk des höchsten Gebäudes der Welt, dem Burj Khalifa, der insgesamt 828 Meter hoch ist. Wir einigten uns darauf, Paulas Freundin Viktoria zu bitten, uns bei unserem Dinner zu begleiten. Paula rief sie an und sie sagte erfreut zu. Sie kannte zwar das Gebäude (das kennt ja jeder in Dubai), doch war sie noch nie drin gewesen, weil sie sich so etwas nicht leisten konnte. Bis dahin hatten wir noch etwas Zeit, uns ein wenig auszuruhen, uns frisch zu machen und uns in unsere besten Klamotten zu werfen. Gemeinsam ließen wir uns per Taxi zum Burj Khalifa fahren. Dort angekommen, nahmen wir den Express-Fahrstuhl, der uns in wenigen Sekunden nach oben „schoss“. Man merkt das Tempo nur dadurch, dass der Magen scheinbar in die Kniekehlen rutscht
Also, der Blick von dort oben war umwerfend. Wir hatten einen Zeitpunkt gewählt, an dem wir die Stadt und die Umgebung sowohl bei Tageslicht als auch bei der verschwenderischen Nachtbeleuchtung betrachten konnten. Das Fünf-Gänge-Menü war auch ausgezeichnet, und der Wein dazu schmeckte exzellent. Nach dem Essen nahmen wir unseren Espresso in einem Nebenraum ein. Dort gab es dann noch eine Überraschung, die als Highlight gedacht war: Der durch „Virtual Reality“ simulierte freie Fall vom Burj Khalifa! Das fand in Zeitlupe statt und war eigentlich nichts für schwache Nerven. Als junges Mädchen habe ich öfters den Ausdruck „Nine Eleven“ gehört. Ich fragte meine Mutter, was damit gemeint ist. Sie hat es mir erklärt. Nach der Erzählung meiner Mutter habe ich mir auf meinem PC-Monitor Videoaufnahmen dieses Jahrhundert-Verbrechens angesehen und war erschüttert. Ich habe das heimlich getan, denn meine Mutter hätte nicht erlaubt, dass ich mir so etwas Schreckliches anschaue. Diese Bilder, zusammen mit der Schilderung meiner Mutter, werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Ich war damals eineinhalb Jahre alt, als das passierte und habe von dem Ereignis selbt nichts mitbekommen. Es war der von Osama Bin Laden so teuflisch geplante Anschlag auf die Bürotürme des Welthandelszentrums in New York. Meine Großeltern wollten am folgenden Tag, dem 12. September 2001, ihre Goldene Hochzeit feiern. Alle waren schon am Vorabend in einem Hotel am Rhein versammelt, als diese Nachricht hereinplatzte. Beim Umkleiden für das Abendessen hatte mein Onkel Bernd den Fernseher eingeschaltet und sah die schlecklichen Bilder, wie nacheinander zwei gekidnappte Flugzeuge in die Türme hineingesteuert wurden und darin verschwanden. Die vollgetankten Maschinen verursachten in den Gebäuden schreckliche Zerstörungen und gleichzeitig eine höllische Hitze. Zahlreiche Menschen in den Stockwerken über und unter den Einschlaglöchern konnten die Hitze nicht mehr ertragen und sprangen aus den zersprungenen Fenstern in den sicheren Tod, noch bevor die beiden Türme nacheinander in sich zusammensanken. Die furchtbaren Bilder von damals kamen mir in Erinnerung, als ich diesen Videoclip hier sah. Dies und auch das, was wir heute Morgen erleben mussten, hat mir die Laune verdorben, und in der Nacht konnte ich nicht gut schlafen. Ich fasse mich hier kurz, denn das eigentliche Ziel unserer Reise war damit erledigt, nämlich zu erfahren, wie die Saudis mit ihrem vielen Geld und ihren riesigen Wüstenflächen in den vergangenen 40 bis 45 Jahren umgegangen waren und welche Auswirkungen die Jahrtausend-Eruption des Mount Rainier in den rekultivierten Zonen verursacht hatte. Die wahren Folgen der Katastrophe – so hatte ich den Eindruck – würden wohl erst im nächsen Jahr spürbar werden, wenn man weltweit feststellen würde, welche Ernte-Ausfälle die lange Dunkelheit ausgelöst hat und wenn die Lebensmittelvorräte aus den Ernten der Vorjahre erschöpft sein würden. Leider sollte ich in diesem Fall Recht behalten. Aber jetzt wollten wir erst einmal die letzten Tage unseres Urlaubs genießen und den unglaublichen Luxus dieses kleinen Emirates kennenlernen, das noch vor 120 Jahren ein ärmliches Wüsten-Nest war. Paula und Viktoria hatten sich für die nächsten zwei Tage abgemeldet. Sie wollten ihre Erkundungen auf eigene Faust unternehmen. Viktoria würde mit ihrem Insider-Wissen Paula so manchen Fleck zeigen können, wo wir als Normal-Touristen niemals hinkommen würden. Wir anderen machten aber erst einmal einen Plan, wie wir die Haupt-Attaktionen der Stadt am besten nacheinander „abarbeiten“ könnten. Alles, was wir hier sahen, hatte extreme Ausmaße. Wir fragten uns nur, wie ein so kleines Land wie das Emirat Dubai, das etwa 3,5 Millionen Einwohner hat, es schafft, jährlich etwa 15 Millionen Besucher anzuziehen, die Unsummen von Dollars oder Euro hier ausgeben. Eine solche Besucher-Attraktivität kommt natürlich nicht von allein. Da müssen zuerst erhebliche Vorleistungen erbracht werden, die das Land und vor allem diese gleichnamige Stadt so interessant für Besucher machen. Aber von nichts kann auch nichts kommen. Grundlage für den Reichtum dieses Landes ist das Öl hervorragender Qualität, das dort gefördert wird. Zweitens spielt die Lage des Landes am Persischen Golf eine Rolle, denn die Flugstrecke von Europa nach Fernost führt über Dubai, wobei früher auf dem Weg nach Singapur oder Australien und Neuseeland wegen der damals noch begrenzten Reichweite der Flugzeuge genau dort aufgetankt werden musste. Aber der entscheidende Punkt ist, dass die intelligenten Emire mit bewunderswertem Ideenreichtum ihr vieles Geld sofort phantasievoll und wirtschaftlich klug angelegt hatten. Ausgangspunkt war dabei wohl ein leistungsstarker Flughafen, der die Zwischenlandung gerade hier für viele Fluglinien so attraktiv gemacht hat. Die Regierung hat es verstanden, viele internationale Veranstaltungen politischer, aber vor allem sportlicher Art ins Land zu holen und damit vielen Menschen etwas Besonderes zu bieten. Und dies, im Gegensatz zu vielen Nachbarländern, ohne jede religiöse Bevormundung (obwohl auch Dubai ein muslimisches Land ist). Dabei war man bestrebt und auch sehr erfolgreich, Attraktionen zu präsentieren, die es in der Welt nirgends sonst gibt. Ja, und diese von menschlischem Geist erschaffenen Weltwunder wollten wir uns in den nächsten zwei Tagen anschauen, wobei wir mit dem Besuch des Burj Khalifa schon den Anfang gemacht hatten. Ich zähle hier einfach mal auf, was wir alles besichtigt haben, und dies bis zur Grenze der Erschöpfung:
In der anderen großen Einkaufsstraße, der „Mall of Emirates“ gibt es eine Sommer-Skipiste, auf der man sich in den Schnee stürzen kann, während draußen 40 Grad Wärme sind