Die Diktatur der Triebe
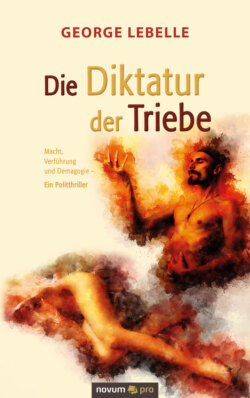
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
George Lebelle. Die Diktatur der Triebe
Impressum
Protagonisten. Ähnlichkeiten mit lebenden oder gestorbenen Personen sind rein zufällig oder satirisch zu verstehen
Reichskanzler Piepgen. Um halb sechs am Abend trafen am Kanzleramt in kurzen Abständen zahlreiche Dienstwagen des Bundes und der Länder ein. Die Wachleute am Portal hatten die Anweisung, nur die persönlich vom Kanzler eingeladenen Personen einfahren zu lassen. Daher mussten die als Adjutanten getarnten Leibwächter des Generalinspekteurs und der Inspekteure von Heer, Luftwaffe und Marine die Wagenkolonne verlassen und im Wartesaal Platz nehmen. Man nahm ihnen Telefone und Waffen ab und verpackte diese in nummerierten Tüten. Baudissin verfluchte seine Entscheidung, das Kanzleramt nicht umstellen zu lassen. Auf dem Weg zum Sitzungssaal tuschelte er mit dem Luftwaffenchef. „Hast du deine Dienstwaffe dabei?“ Brandt nickte und flüsterte. „Ich habe eine Staffel Kampfhubschrauber angefordert, falls wir nicht um punkt neun Uhr zurück vor dem Kanzleramt auftauchen.“ „Ja, mein Chauffeur telefoniert bereits mit den Kommandeuren der Einheiten rund um Berlin. Plan B wird eingeleitet.“ Sie mussten ihr Gespräch beenden, weil sie an der Tür zum Sitzungssaal von des Kanzlers Assistenten begrüßt wurden. „Guten Abend, meine Herren, der Herr Reichskanzler lässt seinen Gruß ausrichten. Er freut sich, sie alle hier zu sehen.“ Lafontaine machte eine Verbeugung in die Richtung eines jeden der vier Militärs. „Ich wünsche Ihnen einen interessanten Abend und darf Sie zu einem kleinen Imbiss und einem Glas Champagner hier gleich rechts einladen.“ Die vier Uniformierten nickten kurz und wandten sich dem Büffet zu. Im Saal befanden sich gut zwanzig Leute, meistens Männer in unauffälligen Anzügen mit blassblau oder blassrosa gestreiften Hemden und mit noch unauffälligeren Krawatten. Ebenso wenig bemerkenswert waren die Innenministerinnen von Niedersachsen und Brandenburg. Nur der Verteidigungsminister, der sich nun Kriegsminister nennen musste, überragte alle wegen seiner Körpergröße, aber auch wegen seines gegelten schwarzen und vollen Haarschopfes, seines dunkelblauen Maßanzuges, des knallroten Oberhemdes und der schwarzrotgoldenen Krawatte. Kriegsminister Karl-Georg von Brauchitsch war Anfang vierzig, wurde von der Massenpresse und den TV-Sendern als Star bejubelt und empfand sich selbst als „ausgesprochen schöner Mensch“ und dazu als „ungewöhnlich intelligent“ Dieser Mensch entdeckte seine obersten Militärs und ging mit federndem Schritt, den hatte er sich angewöhnt, um seiner dynamischen Persönlichkeit Ausdruck zu geben, auf die vier zu und begrüßte sie überschwänglich. „Wie schön, Sie zu sehen. Man sieht sich ja viel zu selten. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Leider lässt mir mein politisches Amt zu wenig Zeit, mich um die Truppe zu kümmern. Ich bin ja so dankbar, in Ihnen so fürsorgende Chefs der Streitkräfte an meiner Seite zu wissen, und möchte Ihnen bei dieser Gelegenheit ganz, ganz herzlich für die stets gute Zusammenarbeit danken.“ Luftwaffenchef Brandt schaute auf die schwarzglänzenden Lackschuhe seines Ministers. Bei jedem Satz wippten sie auf und nieder. Dieser Schwätzer, warum wird solch ein Quatschkopf ausgewählt, dachte er. Doch der Minister quasselte, was das Zeug hielt. Die vier wurden jedoch hellhörig, als er von den „neuen und anspruchsvollen Aufgaben für die Bundeswehr“ sprach. „Die Bundeswehr muss sich neuen Aufgaben stellen. Deutschland ist ja von Freunden umzingelt, hahaha. Da brauchen wir keine Panzertruppen in Armeestärke mehr. Die neuen Aufgaben entstehen da, wo unsere Rohstoffe herkommen, und diesen neuen Herausforderungen müssen wir uns stellen. Da brauchen wir Interventionstruppen, viel Marine, Marineinfanterie und Luftwaffe. Bisher hat Deutschland militärisch unter dem Mandat der UNO agiert, jedenfalls meistens, hahaha. Das soll sich nun ändern. Unter dem Schutz der Bundeswehr müssen wir selbst für eine sichere Rohstoffversorgung tätig werden. Sie verstehen, die Bundeswehr braucht eine globale Angriffskapazität.“ „Der ist gar nicht so blöde, wie ich immer angenommen hatte“, dachte Vizeadmiral Dr. Cem Döner, der Marineinspekteur. „Männer, deshalb werden wir eine vierte Teilstreitkraft aufbauen, nämlich eine Raketenstreitmacht, die mit Langstreckenraketen jeden Ort auf der Erde erreichen kann, natürlich mit Atomwaffen. Sie wissen ja, Herr Vizeadmiral, dass man von den neuen U-Booten sowohl Nuklearraketen als auch nuklear bestückte Marschflugkörper starten kann.“ Der hält mich für blöde, dachte der Vizeadmiral. In diesem Augenblick erklang der Gong. „Ich bitte unsere verehrten Gäste, an den Tischen hinter den Namensschildern Platz zu nehmen. Der Herr Reichskanzler wird in wenigen Augenblicken erscheinen.“ Die donnernde Stimme Lafontaines kam aus Lautsprechern. Nach wenigen Sekunden erschien ein mittelalterlich gekleideter Herold mit einer Fanfare in der Hand auf der Bühne „Der Piepgen ist ja völlig durchgeknallt“, murmelte Luftwaffengeneral Brandt. Das Gemurmel im Saal erstarb. Als es still geworden war, blies der Herold seine Fanfare, ein Dreiklang ertönte. Die Stimme aus dem Lautsprecher: „Der Herr Reichskanzler! Bitte erheben Sie sich.“ Vizeadmiral Dr. Döner erhob sich wie alle anderen, mit Ausnahme seiner drei Militärkollegen, die ihn giftig ansahen. Aber Döner blickte nach vorn, zum Reichskanzler. Vielleicht würde er doch noch Admiral und könnte endlich auf Augenhöhe mit seinen Admiralskollegen aus aller Welt parlieren. Zur gleichen Zeit befand sich Rechtsanwalt Müller-Lüdenscheid II in seiner Ferienvilla im Spreewald. Dorthin hatte er seine Freunde und Mitstreiter zu einem „intimen Diner“ eingeladen. Das großzügige Haus war umgeben von einigen Hektar Parkanlagen und Wald. Für Ortsunkundige war es schwer zu finden. Man musste von Petershagen zwei Kilometer auf einem Waldweg fahren. Er hatte alle für die Unterstützung der Kanzlerpläne wichtigen Persönlichkeiten zu einem Abendessen für Feinschmecker eingeladen, mit „anschließendem fröhlichem Umtrunk und erotischer Kurzweil“. Zwar war kaum eine Persönlichkeit als Feinschmecker bekannt. Doch verschmähte keiner der Eingeladenen die Aussicht auf einen heftigen Rausch und Sexspiele mit reizenden Damen. Mafioso Luigi Luciano war von ihm beauftragt worden, sechzehn die verschiedenen Geschmäcker ansprechende Damen zu beschaffen. Die mietbaren Damen trafen um halb sieben mit einem Bus ein. Sie begaben sich auf die Zimmer, um sich vorzubereiten. Luigi verkündete dem verblüfften Rechtsanwalt, er wolle sich in einer der Damen ordentlich austoben, bevor es an die Arbeit ginge, und verschwand nach oben in die erste Etage. Der Rechtsanwalt ging mit seinem Hausverwalter noch einmal die Gästeliste durch. „Also, der Luigi ist gerade gekommen. Die anderen kommen später um halb acht.“ Auf der Gästeliste waren die Namen illustrer Menschen zu lesen:
Aufbegehren der Gewerkschaften. Am Mittag waren die Vorsitzenden des Gewerkschaftsbundes und dreier Einzelgewerkschaften in einem unterirdischen, abhörsicheren Sitzungsraum des Berliner Gewerkschaftshauses zusammengekommen. Als Grund für die Eilkonferenz hatte Dr. Theo Sommer, der Vorsitzende des Gewerkschaftsbundes, die geheimen Pläne der Regierung angegeben. Über Kanäle, zu denen er nichts sagen dürfe, sei ihm das Putschprogramm des Kanzlers übermittelt worden. Dieses wurde gerade an die Anwesenden verteilt. Auf diesem Papier konnten sie lesen:
Kampfroboter. Karl-Friedrich und Inge Bornheim hatten im Offiziersheim der Kaserne Potsdam ein kleines Appartement bezogen. Als Folge der erotischen Entbehrungen in den letzten Wochen waren sie nach dem Abendessen im Kasino ins Bett gegangen. Drei Mal musste das Bett die wütenden Bewegungen der Liebenden ertragen, bis sie um elf Uhr das Licht löschten. Um halb vier summte das kaserneninterne Telefon und Kurt Eisner, der Heeresinspekteur, meldete sich. „Moin, lieber Bornheim. Soeben habe ich eine alarmierende Nachricht von einem zuverlässigen Offizier des militärischen Geheimdienstes erhalten.“ „Ja“, murmelte Bornheim schläfrig. „In Hamburg wurden etwa tausend Kampfroboter aus den USA ausgeladen und in vier großen Hallen gelagert. Wahrscheinlich werden sie dort programmiert und sind in ein bis zwei Tagen einsatzbereit.“ KFB war sofort hellwach. „Kann die Luftwaffe diese Hallen kurz vor Sonnenaufgang bombardieren?“ „Ja, natürlich. Aber diese Roboter sind sehr widerstandfähig. Und sie schießen zurück.“ „Dann setzen die eben Napalm oder so etwas ein, um die Elektronik abzufackeln.“ „Einverstanden.“ KFB wollte das Gespräch beenden, aber der General wollte noch etwas sagen. „Bornheim, es kommt noch schlimmer. In Bremerhaven sind Transportschiffe mit Panzern, Raketen, Flugzeugen und Lastwagen eingetroffen. Sie werden zurzeit entladen und in einen Marinestützpunkt östlich von Bremen überführt. Das wird zwar einige Tage dauern. Aber dann werden wir mit dieser Kampfkraft der Marine ein Problem haben. Wir wissen aber noch nicht, wie viele Panzer und Flugzeuge angelandet worden sind.“ „Ja, aber warum versenkt ihr nicht die Schiffe und bombardiert die Hallen?“ „Sie müssen das entscheiden, lieber Bornheim. Wir haben Sie als Oberbefehlshaber gewählt. Das war immer die Aufgabe der politischen Führung. Ihr Politiker wolltet doch, die Politik sollte den Vorrang haben, den Primat der Politik, sozusagen.“ „Ich habe verstanden. Also befehle ich: Zerstören Sie alle Roboter und lassen Sie ermitteln, ob in anderen Häfen Roboter entladen worden sind. Diese sind ebenfalls zu eliminieren. Zweitens: Die Transportschiffe in Bremerhaven müssen versenkt werden, egal, welche Flagge sie tragen. Alle Stützpunkte der Marine um Bremerhaven und Bremen sind überfallartig auszulöschen. Verstanden?“ „Sehr wohl, Oberbefehlshaber.“ Karl-Friedrich drückte die Ende-Taste. Inge kicherte. „Na, dem hast du es aber gezeigt.“ Nachdem ihr Mann wieder in das Doppelbett gestiegen war, schlief er sofort wieder ein. Inge hatte Angst. Wenn dieser gefährliche Putschversuch scheiterte, würden sie beide erschossen, im schlimmsten Fall zu Tode gefoltert werden. Die Bande, die Kanzler Piepgen um sich geschart hatte, wäre jeder sadistischen Prozedur fähig. Inge lag darüber noch lange wach. Als die Bomber der Luftwaffe im Morgengrauen Hamburg erreichten, waren die Roboter bereits ausgeladen und hatten sich in Marsch gesetzt. Plangemäß setzten sich in Hamburg, Travemünde und Rostock um zwei Uhr 1500 Roboter nach Süden in Bewegung nach Berlin. Die Straßen waren um diese Uhrzeit natürlich leer. Den wenigen Autofahrern fielen die zwei Meter hohen, gedrungenen, menschenähnlichen Maschinen nicht auf, weil sie matt-grau gestrichen waren und nur einzeln marschierten. Kurz vor drei Uhr brauste ein Lastwagen des Heeres auf der Autobahn von Lübeck nach Osten. Es war vollkommen dunkel. Die beiden Soldaten im Fahrerhaus hatten sich bis vor Kurzem unterhalten. Aber nun war der Beifahrer eingeschlafen. Sie hatten den Auftrag, Munitionskisten zum Heeresstandort bei Rostock zu bringen. Sie waren sich einig, dass ein derartiger Transport Blödsinn sei, denn da gebe es ja den Marinestützpunkt, und die hätten genug Munition. Die Autobahn war leer und der Fahrer kämpfte mit der Müdigkeit und der Langeweile. In gut dreihundert Metern Entfernung reflektierte etwas das Scheinwerferlicht. Und da bewegte sich etwas. Der Fahrer sah nun ein seltsames Objekt auf der Überholspur. Das Ding näherte sich auf dem linken Fahrstreifen. Instinktiv trat er auf die Bremse. Aber es war schon zu spät. Ein Blitzstrahl schoss aus dem Ding und zerstörte die Fahrerkabine. Der Fahrer war sofort tot. Der Armeelastwagen schleuderte und krachte in die rechte Leitplanke. Der Beifahrer verlor das Bewusstsein. Der Roboter registrierte den LKW als zerstört und marschierte weiter. Erst zwei Stunden später stoppte ein Auto an der Unfallstelle und meldete der Autobahnpolizei den Unfall. Da waren die Roboter schon 60 bis 80 km weiter nach Süden vorgedrungen. Wenige Minuten nach vier stiegen von den Stützpunkten der Luftwaffe in Norddeutschland zwanzig tief fliegende Jagdbomber auf, um die Luftabwehr der Marine auszuschalten. Wenig später verließen dreißig Kampfbomber ihre Hangars in Emden, Wilhelmshaven und Harburg, starteten und steuerten Bremerhaven an. Der Befehl des Luftwaffeninspekteurs lautete: Schiffe versenken, Schwertransporter und LKWs der Marine zerstören, Marinestützpunkte auslöschen. Der Aufgabe entsprechend waren die Kampfbomber mit schweren Bombenkalibern, Raketen und Torpedos beladen. Die Inspekteure des Heeres und der Luftwaffe hatten sich abgestimmt, dass zunächst die Luftwaffe „reinen Tisch“ machen solle und danach Bodentruppen die letzten Marinestützpunkte erobern sollten. Um die Roboter aufzuspüren, wurden ab vier Uhr, es war noch vollkommen dunkel, 55 Kampfhubschrauber aus Hamburg eingesetzt. Die Piloten fanden schnell heraus, dass die Roboter die Lagerhallen bereits verlassen hatten und nach Südosten marschierten. Die Roboter hatten gelernt, Hubschrauber anhand ihres Wärmebildes auf drei Kilometer Entfernung zu erkennen und sie durch Beschuss mit Kleinstraketen oder durch Ausschaltung der Bordelektronik durch harte Hochfrequenzimpulse zum Absturz zu bringen. Nachdem vier Hubschrauber auf diese Weise abgestürzt waren, hielten die Piloten ausreichenden Abstand und nutzten Geländesenken zur Deckung. Die Inspekteure Eisner und Brandt unterrichteten dem Oberbefehlshaber KFB ab sechs Uhr halbstündlich über die Lage. Als dieser nach der Meldung um halb sieben wieder einschlafen wollte, presste sich Inge an ihn und wichste seinen Schwanz steif. In diesem halbschlafenden Zustand konnte sie sich sehr lange auf ihm austoben, bevor er spritzte. So war es auch dieses Mal. Hoch befriedigt sank sie von ihm, als wieder das Telefon summte. Luftwaffenchef Brandt meldete, die Aktion „Schiffe versenken“ sei erfolgreich abgeschlossen. „Wahrscheinlich hat kein Panzer, kein Flugzeug oder ein anderes Waffensystem der Alliierten die Schiffe verlassen.“ „Das ist ja ganz ausgezeichnet, hervorragend!“ „Danke, Oberbefehlshaber. Aber es gibt ein großes Problem mit diesen verdammten Robotern. Die müssen schon um zwei Uhr losmarschiert sein. Außerdem haben unsere Agenten vom Militärgeheimdienst berichtet, dass sich nicht nur von Hamburg Roboter nach Süden bewegen, sondern auch von Travemünde und Rostock. Vielleicht sind es mehr als 2000, wir wissen es noch nicht. Deren Zahl erscheint niedrig, aber Sie müssen berücksichtigen, dass denen eine Kampfkraft von gut 20.000 Soldaten entspricht.“ „Ach, du großer Schreck! Kann man die nicht mit Raketen oder Napalmbomben ausschalten?“ „Im Prinzip ja. Aber die erkennen unsere Hubschrauber und Flugzeuge, bevor diese überhaupt etwas abfeuern können. Wenn wir realistisch bleiben, ist es möglich, dass die Hälfte dieser Dinger Berlin erreicht. Bis dahin werden wir die Wachmannschaften am Abschirmring um Berlin weder verstärkt noch mit roboterbekämpfenden Waffen ausgestattet haben.“ „Dann werden wir uns aus Berlin verabschieden müssen. Und Piepgen hat gesiegt.“ „Ja.“ Nach Beendigung des Gesprächs räusperte sich Inge. „Nimm es doch nicht so schwer, Liebling. Die Hauptsache ist doch, wir sind zusammen, wir lieben uns und wir werden noch etwas leben.“ Sie wusste, dass er noch „einen Schuss draufhatte“ Kanzler Piepgen erfuhr an diesem frühen Morgen sexuelle Freuden. Weil er im Morgengrauen immer einen Ständer hatte, sorgte Lafontaine zuverlässig dafür, dass ein Weib neben ihm lag und er sich an ihr befriedigen konnte. Lydia, eine schöne Hure aus Weißrussland, hatte ihn fünf Mal abspritzen lassen, eine Leistung, für die Piepgen sich selbst bewunderte und Lydia bewog, ihn anzuhimmeln. Um halb acht wurde Piepgen durch Lafontaines Telefonanruf geweckt. „Meister, es gibt eine gute und eine sehr schlechte Nachricht. Was wollen Sie zuerst hören?“ „Scheiße, schon keine ausreichende Nachtruhe. Was gibt es? Ach ja, zuerst die schlechte Nachricht.“ „Alle Schiffe der Allianz und alle Waffensysteme an Land sind zerstört worden. Vorher ist unsere Luftabwehr ausgeschaltet worden. Vorerst wird es keine Unterstützung durch die Alliierten mehr geben. Es sei denn, Sie rufen deren Truppen herbei.“ „Dann müsste ich ja die Macht mit denen teilen. Kommt nicht infrage. Was ist denn die gute Nachricht?“ „Die Roboter sind auf dem Vormarsch. Einer ist verbrannt worden. Aber die haben vier Hubschrauber des Heeres abgeschossen. Die Roboter marschieren nun nicht mehr auf Autobahnen und breiten Straßen, wo sie von Weitem erkennbare Ziele wären, sondern vornehmlich auf Feldwegen und Landstraßen, Bäume und Häuser als Deckung nutzend. Das sind wirklich tolle Maschinen.“ „Wann treffen die in Berlin ein und greifen die Militärringe an?“ „Das hängt davon ab, auf wie viel Widerstand sie stoßen. Ich schätze, etwa morgen früh.“ „Sehr gut. Und schicke mir heute Abend wieder Lydia.“ „Sehr wohl, mein Führer!“ Tatsächlich hatten die Kampfbomber in Bremerhaven und in der östlichen Umgebung von Bremen alles zerstört, was irgendwie nach wehrtechnischem Material aussah. Um fünf Uhr früh beschwerte sich der dortige US-Konsul beim Außenministerium in Berlin über die Bombardierung und Versenkung von Schiffen unter der Flagge der USA und drohte mit Vergeltung. Außenminister Steinmüller versuchte, den Konsul zu beruhigen. Es seien schon Maßnahmen gegen die „Aufständischen“ mit dem US-Botschafter besprochen und eingeleitet worden. Davon war lediglich wahr, dass sich der Außenminister beim US-Botschafter für die brüderliche Hilfe in Form der Kampfroboter bedankt hatte. Auch bei den Regierungen der sieben weiteren Mitgliedstaaten der „Allianz gegen linken Terrorismus“ hatten sich er und der „Herr Reichskanzler“ begeistert für die Waffenlieferung bedankt. Die Mitglieder dieser Allianz waren allesamt rechtsradikale bis faschistische Regierungen in Europa, Nord- und Südamerika. In Potsdam sahen sich KFB, seine Frau Inge und die Generäle Bilder des Militärgeheimdienstes aus Bremerhaven und dem Gebiet um Bremen an „Das sieht ja aus wie in einem Krieg.“ KFB zeigte sich entsetzt. Die gesamte Kaianlage für Überseeschiffe samt Kränen, Schienen, Containerlagern und Hafenbecken glich einem Haufen von Schutt und Schrott inmitten von Wasserlöchern. Die zerschossenen, zerfetzten und ausgebrannten Schiffe glichen Skeletten aus Stahl, aber nicht mehr Seefahrzeugen. Zum Teil ragten nur noch Masten oder Kommandobrücken aus dem Wasser, zum anderen Teil waren die Schiffskörper zerbrochen oder auf die Seite gekippt. Andere wiederum waren durch die explodierte oder in Brand gesetzte Munition zu skurrilen Figuren zerschmolzen. Die Schneise der Verwüstung zog sich bis auf die offene See hinaus. „Mein Gott, das müssen ja fast hundert Schiffe gewesen sein.“ Inge war erschüttert. „Was hätten diese Waffen in der Hand der Marine für uns bedeutet? Den sicheren Tod.“ Weitere Fotos zeigten auf den Straßen von Bremerhaven nach Süden zerstörte Kolonnen von LKWs und Schwertransportern mit Panzern, dem Erdboden gleichgemachte Lagerhallen und vernichtete Stützpunkte und Kasernen der Marine. In Zukunft müssen wir verhindern, dass Teile der Armee gegeneinander kämpfen können oder gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt werden, dachte Inge. Dazu müssten sich in einer derartigen Lage die Befehlsstränge gegenseitig blockieren. Das werde sie ihrem Karl-Friedrich, dem „Oberbefehlshaberchen“, in einer stillen Stunde beibringen. Fast einhundert Kilometer westlich von Berlin, nämlich in der Kleinstadt Braunlage, bekamen der Stadtrat, der Bürgermeister und die Einwohner nichts von den militärischen Wirren mit. Am späten Nachmittag hatte der Stadtrat mit einfacher Mehrheit beschlossen, dass sich Bürger und insbesondere die städtischen Angestellten und Beamten von nun an mit dem „Führergruß“ zu grüßen hätten, also mit der rechten Hand waagerecht zum Handkantenschlag nach rechts ausholend. „Im nächsten Monat wird das kontrolliert. Wer das nach zwei Monaten nicht kapiert hat oder sich gar widersetzt“, der Bürgermeister lachte laut, „na, der bekommt eine Ordnungsstrafe von einem Monatslohn. Diese Abweichler werden registriert. Und was wird den später erwarten?“ Alle Stadträte von CDP, LDP, PDS und NSU lachten, fast alle. Von den zwanzig Stadträten gehörte nur einer der Opposition an, nämlich Karl Löbel von der Linksfraktion. Aber der hielt aus gutem Grund den Mund. Den Abend zuvor hatten ihn Jungmitglieder der CDP zusammengeschlagen. Seine Nase war gebrochen und rot geschwollen, die Lippen blutverkrustet und sein Unterleib schmerzte wegen der Tritte mit den harten Stiefeln. Er konnte kaum reden und hielt die Schnauze. Als jedoch der Tagesordnungspunkt „Privatisierung der Polizei und der Steuerbehörden“ aufgerufen wurde, meldete er sich als Erster zu Wort. Zähneknirschend erteilte ihm der Vorsteher des Stadtrates das Wort. Der Bürgermeister bekam einen Wutanfall. „Nachdem mir eure Leute gestern die Fresse poliert haben, sozusagen als sachliche Auseinandersetzung mit politischen Argumenten, muss ich hier und jetzt nur noch die Ermordung durch eure wohlgeratene Jugend fürchten. So weit ist dieser Staat gekommen! Die Polizei soll durch die Mafia ersetzt werden. Vor zwei Wochen kamen vier gepflegte junge Männer in die örtlichen Polizeistationen und unterwarfen sie ihren Befehlen, mit einer Vollmacht des Bundeskanzlers Piepgen.“ Der Stadtverordnetenvorsteher brüllte: „Herr Abgeordneter, ich fordere Sie auf, den Amtstitel „Reichskanzler des Vierten Reiches“ zu verwenden. Andernfalls schließe ich Sie von der Sitzung aus.“ Der einzige Oppositionsabgeordnete fuhr fort. „Diese vier Männer gehören der russischen Mafia von Sergej Tscherwinski an. Das wollen Sie aber nicht wissen. Für Sie sind die Befehle aus Berlin das A und O. Viel schlimmer ist es, dass Sie auch nicht bemerkt haben wollen, dass sich vier weitere Kerle in das Finanzamt eingeschlichen haben, und zwar von derselben Mafiaorganisation. Diese Leute haben die Erlaubnis, Steuern einzunehmen und die Bürger auch mit Gewalt zu Steuerzahlungen zu zwingen. Das ist doch Mittelalter! Diese Bande kann auch völlig neue Steuern festlegen und einnehmen, zum Beispiel eine Fenster- oder eine Obstbaumsteuer. Das ist doch Anarchie! Wollen wir das in Braunlage?“ „Herr Abgeordneter Löbel! Wegen defätistischer und staatsfeindlicher Äußerungen sehe ich mich gezwungen, Ihnen das Wort zu entziehen und Sie von der Sitzung auszuschließen.“ Der Gemeindediener führte den Stadtrat Löbel aus dem Saal, ihn ruppig am Ärmel des Jacketts ziehend. Als die Saaltür hinter den beiden zuschlug, trat ein Abgeordneter der CDP neben den Bürgermeister und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Der Bürgermeister nickte. Am übernächsten Morgen trat Stadtrat Löbel aus dem Haus, machte ein paar Schritte durch den kleinen Vorgarten und atmete tief ein. Plötzlich nahm er ein leises Sirren in der Luft wahr. Er schaute hoch, sah aber nichts. Als er die Gartenpforte öffnen wollte, sank er zusammen und stürzte auf den gepflasterten Weg. Er schrie um Hilfe. Nach wenigen Sekunden erlosch seine Stimme. Der von den Nachbarn herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Geschickt ließ er das kleine, spitze Geschoss, das im Hals des Stadtrates steckte, unter seiner linken Hand und dann im Ärmel verschwinden. Die drei um ihn stehenden alten Leute bemerkten nichts von seinem Trick. Zwei Tage später erfuhr der Bürgermeister offiziell vom Tod des Stadtrates. Die zehn Mitarbeiter der Geheimen Staatspolizei in Braunlage hatten eine perfekte Arbeit geleistet. Der Notarzt musste schweigen. Er ließ eine Todesanzeige in der einzigen und ihm gehörenden Tageszeitung erscheinen, in der er „den schmerzlichen Verlust für das Gemeinwohl, die ganze Stadt und den Stadtrat betrauerte“ In der folgenden Sitzung des Stadtrates mussten sich die Abgeordneten zu einer stummen Trauerminute erheben. „Nachdem wir nun unter uns sind und daher offen reden können“, eröffnete der Bürgermeister die Sitzung, „wollen wir einmal prüfen, was uns die jüngste Steuerreform aus Berlin gebracht hat. Herr Kämmerer, Sie haben das Wort.“ Der neue Stadtkämmerer war erst seit zwei Wochen im Amt, trat aber auf, als wäre er Finanzminister. Er hatte sein Handwerk bei einem Finanzamt und danach bei der Gesellschaft Black&WhiteWater für Finanzinvestoren gelernt. So sah er auch aus: dunkelblauer Anzug, fein gestreiftes Hemd mit reinweißem Kragen, lila-grau-silbern gestreifte Krawatte und schwarze Lackschuhe, Alter 35, die Haare schwarz gefärbt und gegelt. Alle im Saal wussten, dass der neue Kämmerer auch der neue Chef des Finanzamtes war. Sie wussten jedoch nicht, dass der junge Mann von einer Gesellschaft zur Rekrutierung von Steuer- und Finanzspezialisten nach Braunlage beordert worden war. Diese Gesellschaft mit dem vielgepriesenen Namen „Treue, Ehre, Vaterland“ gehörte zu gleichen Teilen dem Rechtsanwalt Müller-Lüdenscheid II und dem Kanzlerassistenten Lafontaine. Die beiden hatten sich das ausgedacht, weil die Mafiaorganisationen nicht das erforderliche Fachpersonal für die Finanzämter stellen konnten. Ihr bisher erfolgreicher Plan war es, skrupellose Jungmanager aus den Beratungs- und Investmentfirmen abzuwerben, nicht nur durch hohe Gehälter, sondern vor allem mit der Aussicht auf üppige Gewinnbeteiligungen. Damit waren die Mafiosi überhaupt nicht einverstanden. Sie wollten fünfzig Prozent der Steuereinnahmen, wie vom Kanzler versprochen. Der Rechtsanwalt und Lafontaine mussten klein beigeben und vereinbarten, nach einem halben Jahr sollten die Gehälter und die Boni der Jungmanager halbiert werden. Wer das nicht akzeptierte, würde entlassen. Eine Chance auf die Rückkehr auf ihre alten Jobs hätte niemand. Denn ihre Positionen hätten bereits andere karrieresüchtige Leute eingenommen. „Das haben wir doch toll geregelt“, freute sich Lafontaine. „Hoffen wir bloß, dass die nicht nach der Halbierung des Gehaltes zur Opposition wechseln.“ „Ach, was, die sind unpolitisch, nur geldgierig. Und die lassen sich prima von den Familien einsetzen. Da fehlte es ja oft an versierten Geldwäschern, Investorenberatern und Lobbyisten. Außerdem wird es bald keine Opposition mehr geben.“ Der neue Kämmerer trat ans Rednerpult und ließ den großen Bildschirm aufleuchten, um seine Zahlen präsentieren zu können. „Insgesamt sind die Steuereinnahmen in den letzten zwei Monaten um 12 % gestiegen. Das mag an der guten Wirtschaftslage liegen und lässt sich wahrscheinlich nicht mit Maßnahmen der Regierung begründen.“ In den Seminaren der Gesellschaft „Treue, Ehre, Vaterland“ war er gedrillt worden, eine „volksnahe Sprache zu sprechen“, „Fremdwörter und Fachchinesisch zu vermeiden“ und „die Menschen nicht intellektuell zu überfordern“, gerade auch bei Gemeinderäten und anderen Parlamentariern. Anfangs hatte er verflucht, auf was er sich da eingelassen hatte. Sein elitäres Bewusstsein, der absolut perfekte Investmentexperte zu sein und die Kunden gekonnt zu seinem eigenen Vorteil beraten zu können, bekam zunächst einen Dämpfer, weil Stadträte auch unbequeme Fragen stellten, vor allem die von der Linksfraktion. Aber die gab es in Braunlage nicht mehr „Sehr geehrte Volksdeutsche“, sprach er die Stadtverordneten zu deren Erstaunen an. Das kam nicht so gut an, denn einige Stadträte murmelten oder posaunten ihre Meinung heraus. „Sehr geehrte Stadtverordnete“, korrigierte sich der Kämmerer, „wir schätzen, dass sich bis April nächsten Jahres die Steuereinnahmen verdoppelt haben werden. Von da ab werden 50 % der Steuern an unsere Gesellschaft überwiesen. Sie, liebe Stadträte, wissen wohl, auf welche Weise wir dieses Ziel zu erreichen gedenken. Als erste Maßnahme werden unsere Fachleute die Steuerpflichtigen an ihrem Arbeitsplatz und zu Hause aufsuchen. Wenn der Steuerpflichtige nicht 50 % mehr Steuern zahlt, rücken ihm zwei kräftige Mitarbeiter unserer Gesellschaft auf den Leib, enthalten sich aber jeglicher körperlicher Gewalt. Wenn das erfolglos bleibt, übernimmt die gemeinsame Jugendorganisation von CDP und NSU, die „Junge Morgenröte“, die weitere Behandlung. Sie können mir glauben, dann wird der Delinquent zahlen.“ Er machte eine Pause, um die Wirkung seiner Worte zu prüfen. Die Stadträte hörten ihm aufmerksam zu. Gut reden kann der, dachte so mancher. „Dabei interessiert uns nicht, wie viel der Bürger bereits zahlt. Jeder muss 50 % mehr zahlen. Natürlich werden wir die einflussreichen Bürger schonen. Wir können ja nicht die Kuh umbringen, die uns Milch gibt.“ Er lachte, die Stadträte feixten. Sie nahmen selbstverständlich an, sie gehörten zu den Einflussreichen „Aber“, den Arm hochhebend, dämpfte er die ausgelassene Stimmung, „aber wir müssen uns auch neue Einnahmequellen ausdenken, mit denen wir den Kampf gegen die Aufständischen und Landesverräter finanzieren können. Dabei geht es nicht um eine Apfelbaum- oder Fenstersteuer, wie der zu unserem grööößten Bedauern verstorbene Abgeordnete Karl Löbel unterstellt hat“, er grinste breit, und die Stadträte johlten, „sondern um politische Steuern für die Regierung. Dazu gehören Abgaben, die die finanziellen Möglichkeiten der Unterschicht noch weiter einschränken, also höhere Steuern auf Strom, Gas und Benzin, aber auch auf den Eisenbahn-, Bus- und Straßenbahnverkehr, vor allem aber die Erhöhung der Steuern auf Lebensmittel auf 40 %. Die müssen schon am 20. eines Monats nur noch Geld zur Ernährung übrig haben. Dann kommen auch keine Gedanken mehr nach Revolution auf. Für höhere Mieten hat ja der sogenannte Markt schon früher gesorgt, hahaha. Sie sehen, liebe Abgeordnete, alles ist im Fluss und auf dem besten Wege. Jetzt müssen wir beten, dass die Terroristen, bestehend aus Linken, Gewerkschaften, Heer und Luftwaffe, geschlagen werden. Wir Finanzexperten werden unseren Teil dazu beitragen, so wahr uns Gott und Allah helfe!“ Seine Rede wurde mit heftigem Trampeln und Faustschlägen auf die Tische bedacht. Eine Diskussion war nicht vorgesehen. Man beschloss, im Ratskeller ausgiebig zu Mittag zu essen und danach die Stadtratssitzung fortzusetzen. Das Menü bestand aus Zwiebelsuppe, Grünkohl mit Schweinebauch, Bratwurst, Blutwurst und Kassler und danach Pflaumen in Rotwein. „So ein Quatsch, einmal in der Woche ein Gemüsegericht ohne Fleisch vorschreiben zu wollen. Der Mensch ist, was er isst. Da wachsen dem die Tomaten auf dem Kopf und aus den Ohren sprießt der Schnittlauch. Hahaha!“ Der Abgeordnete haute sich auf die Schenkel. Das gemeinsame Mittagessen erwies sich nicht nur als sehr gemütlich, sondern auch als politisch und effizient. Denn es wurden sechzig halbe Liter Bier getrunken, begleitet von zwanzig großen Korn. Am Abend wusste der Stadtverordnetenvorsteher seiner Frau zu erzählen, man habe wichtige politische Entscheidungen getroffen: „Punkt 1, Punkt 2 und Punkt 3. Punkt 4 habe ich vergessen. Aber alle waren dafür.“ Torkelnd war er seinem Auto entstiegen. Er wusste, dass die Polizei andere Aufgaben hatte, als brave Bürger an ihrer „freien Fahrt für freie Bürger“ zu hindern. Um halb zehn lag er im Bett und schnarchte. Seine Frau, die sich eine Quizsendung im Fernsehen anschaute, war wieder einmal enttäuscht von ihrem Mann. Sie schaltete auf einen Pornosender um und griff sich zwischen die Schenkel. An dem Fenster, das bis zum Boden reichte, schob sie Vorhang und Gardine beiseite und zog Rock und Schlüpfer aus. Sie setzte sich mit weit gespreizten Schenkeln auf das Sofa. Sie wusste, dass man sie von der gegenüberliegenden Straßenseite gut erkennen konnte. Der Gedanke, jemand würde sie bei ihrem schamlosen Tun beobachten, machte sie hemmungslos lüstern. Als sie Schritte auf dem gegenüberliegenden Trottoir hörte, richtete sie den Lichtkegel der Stehlampe auf ihren nackten Unterleib. Nun waren zwei langsam gehende, eher schlendernde Männer zu sehen, die sich offensichtlich unterhielten. Der eine nahm das Licht im Wohnzimmer des Stadtverordneten wahr. Er stieß seinen Kumpel an. Sie sahen eine Frau, die mit der rechten Hand die Schamlippen auseinander spreizte und mit dem linken Zeigefinger immer wieder in ihr Loch stieß. Die Frau hoffte, die beiden würden bei ihr klingeln. Sie würde sie hereinlassen und so leer melken, dass sie zwei Wochen nicht ejakulieren könnten. Sie keuchte vor Lust. Aber die beiden Männer gingen weiter. Sie stellte sich vor, die beiden würden sie jeden Tag besuchen, wenn ihr Mann in der Sitzung des Stadtrats weilte. Aufgeheizt durch die zahlreichen Kopulationen in dem Film, war ihr Geschlecht angeschwollen und gerötet. Sie rieb und schlug heftig darauf und stöhnte. In dem Film sah sie, wie ein riesiges Glied zwischen nass glänzende Schamlippen fuhr. Sie kreischte und spritzte. Ihr Blick war glasig und sie atmete schwer. Plötzlich riss sie die Augen auf, weil sich auf der Straße etwas Seltsames bewegte. Sie stürzte zum Fenster und sah eine merkwürdige olivgraue Maschine mit menschenähnlichem Körper marschieren. Die Maschine drehte den Kopf in alle Richtungen, so als ob sie sich sichern wollte. Aufgeregt rannte sie in das Schlafzimmer und weckte ihren Mann, indem sie ihn anschrie, er müsse sehen, was da auf der Straße vor sich gehe. Grummelnd erhob er sich aus dem Bett, noch im Anzug und mit den Schuhen an den Füßen, und schritt rülpsend an das Fenster „Oje, wat is dat dann“, lallte er. Aus dem Schrank im Flur nahm er sein Jagdgewehr, obwohl ihn seine Frau anflehte, er solle wieder ins Bett gehen, er sei ja immer noch betrunken. Sie konnte „das besoffene Stück“ nicht daran hindern, auf die Straße zu treten und mit dem Gewehr auf die Maschine zu zielen. Der Roboter erfasste die Situation schneller, als der Betrunkene das Gewehr abfeuern konnte. Die Frau des Stadtverordneten sah, wie aus dem rechten Arm des Roboters ein weißer Blitz schoss und ihren Mann niederstreckte. Für den Roboter war das Zielobjekt Gewehr mit dem Sturz des Gewehrträgers eliminiert. Er marschierte weiter in Richtung Heidegrundkaserne, die seit Piepgens Amtsantritt Walhalla-Kaserne hieß. Die Frau des getöteten Stadtverordnetenvorstehers fühlte sie sich leer, nachdem sie die Leiche ihres Mannes, erledigt durch eine komische Maschine, in den Vorgarten gezogen hatte. Sie bestellte den Notarzt, der sich insgeheim wunderte, dass keine Giftpfeile den Stadtrat erledigt hatten, sondern massive Verbrennungen im Bereich des Herzens und der Lunge. Weder der Notarzt, noch die herbeigerufenen Polizisten sahen eine Notwendigkeit, die Todesursache näher zu analysieren. Sie hielten die Aussage der Witwe für „Geschwätz“ Mittlerweile war es kurz nach drei Uhr in der Nacht und der Roboter war nur noch zwei Kilometer von der Heidegrundkaserne des Heeres entfernt. Am Ortsausgang von Braunlage lud er an einer Tankstelle seine Batterien auf und füllte seine Benzintanks in den Beinen. Mit leicht schaukelndem Gang bewegte er sich auf der Zufahrtsstraße in Richtung des Haupttores. Die aus sechs Soldaten bestehende Nachtwache saß vor den Monitoren, deren Kameras die unmittelbare Umgebung des großen Kasernengeländes abtasteten. Der Zufahrtsstraße schenkten sie keine Beachtung. Wer würde sich so exponieren? „So ein Scheiß, dass wir jetzt zu sechst Nachtwache schieben müssen. Früher haben doch zwei Mann gereicht.“ „Der Major wird schon seine Gründe haben. Das hängt wohl mit den Kämpfen zwischen der Marine und dem Heer und der Luftwaffe zusammen. Vielleicht plant die Marine einen Angriff auf unsere Kaserne.“ „Was? So weit im Binnenland? Das wagen die nie.“ „Seht mal, was ist das denn da draußen?“ „Sieht aus wie ein Roboter.“ „Wie im Film.“ „Die Amis sollen so etwas haben.“ „Wir gehen mal raus und sehen nach, wie das Ding reagiert.“ „Seid vorsichtig, diese Dinger sollen sehr gefährlich sein.“ Die beiden anderen Soldaten lachten und packten ihre Schnellfeuergewehre. Als sie neben das Wachhäuschen traten, sahen die vier in der Pförtnerloge gebliebenen Soldaten, wie aus dem rechten und dem linken Arm des Roboters je ein Blitz aufleuchtete. Die beiden waffentragenden Soldaten waren sofort tot. Die vier in der Pförtnerloge warfen sich auf den Boden. Einer von ihnen konnte noch die Alarmtaste drücken und sein Kollege unter „besondere Vorkommnisse: Roboter greift an“ in das digitale Wachbuch eintippen. Sirenen heulten auf, plötzlich war das Kasernengelände taghell erleuchtet. Aus den Baracken stürzte die Kompanie der Alarmbereitschaft. Die gut fünfzig Soldaten in Kampfmontur waren mit Maschinenpistolen ausgerüstet. Der kommandierende Hauptmann ließ das Funktelefon in der Wache klingeln und erfuhr, dass ein Kampfroboter zwei Soldaten getötet habe und vermutlich in die Kaserne eindringen werde. Wahrscheinlich sei er mit Hochleistungslasern ausgerüstet. Der Hauptmann ließ die Soldaten Deckung nehmen, informierte sie über die Lage und versorgte sie mit Flammenwerfern und Panzerabwehrraketen. „Diese Sachen werden ihn wohl umbringen.“ Er hielt die Situation für so gefährlich, dass die 50 Mann von der Alarmbereitschaft mit dem Roboter nicht fertig werden würden, und löste Großalarm für alle anderen 400 Soldaten aus. Der befehlshabende Major teilte die Lagebeurteilung des Hauptmanns. Er ließ alle Scheinwerfer ausschalten, denn seine Männer wären bei dieser Helligkeit zu leicht zu erkennen. Man sagte, die Infrarotbilder des Roboters wären nicht so scharf und kontrastreich wie Aufnahmen mit sichtbarem Licht. Vermutlich traf das auf diese neue Robotergeneration zu. Zusätzlich zu den optischen hatten sie auch feinste akustische Sensoren und konnten außerdem Gerüche wahrnehmen, alles zusammen viel besser als ein Mensch. Leider waren die 18 Panzer an diesem Standort nicht einsatzbereit. Die müssten erst noch betankt und mit Munition versorgt werden. Inzwischen hatte der Roboter mit einer Ladung Plastiksprengstoff das Haupttor in Stücke gerissen. Da es sein Auftrag war, die Panzer, LKWs und Munitionslager am Standort Heidegrund zu zerstören, ignorierte er das Wachgebäude und die Wohnbaracken und schwenkte nach rechts zu den Lagerhallen. An den Hallenecken, auf den Hallendächern und hinter den im Gelände verstreuten Betonsperren warteten die Soldaten „auf den Feind“ Natürlich erkannte der Roboter die hin und her huschenden Soldaten, aber er hatte Prioritäten zu setzen. Er schoss zwei Nebelgranaten ab, um die Soldaten zu verwirren. Das Tor zu der riesigen Panzerhalle hatte er schnell zerstört. Der Major kauerte gegenüber der Panzerhalle auf dem Boden und bedeutete den fünf Mann mit den Panzerabwehrraketen, auf den Roboter zu feuern. Der Roboter liquidierte zuerst die vier Soldaten auf dem Dach, die auf ihn zielten. Er sah die Raketen auf sich zurasen, sprang seitwärts und erschoss den Major und die fünf Soldaten mit sechs simultanen Laserimpulsen. Wenn der Roboter hätte lächeln können, so hätte er jetzt gelächelt, denn die an ihm vorbeifliegenden Panzerabwehrraketen setzten drei Panzer in Brand. Innerhalb einer halben Minute verschoss er seine gesamte panzerbrechende Munition. Die Hallendecke wurde glühend heiß, die senkrechten tragenden Säulen zerbrachen und die Geschützrohre der Panzer wurden weich und schlaff. Dann stürzte die Hallendecke in ein Flammeninferno. Aufgabe 1 erledigt, registrierte sein Arbeitsspeicher. Einhundertfünfzig Meter vor sich erkannte er eine Phalanx von Flammenwerfern und Panzerabwehrkanonen und aktivierte sofort sein Sprunggelenk, das ihn auf das Dach der nächsten Halle katapultierte. Bevor die Soldaten überhaupt die Ortsveränderung des Roboters wahrgenommen hatten, wurden sie alle durch eine Phosphorbombe verbrannt. Der Hauptmann, der erkannt hatte, worauf es dem Roboter ankam, wollte ihm den Weg zum Munitionsbunker versperren. Soldaten versuchten, ihre Flammenwerfer einzusetzen. Aber der Roboter war schneller. Alle Soldaten des Kommandos wurden eliminiert. Der Roboter legte um das Munitionslager ein Kabel, erschoss zwischendurch einige auf ihn lauernde Soldaten und befestigte an geeigneten Stellen Brandbomben. Er zerschnitt den Kasernenzaun, zündete die Sprengsätze und kauerte sich tief in eine Bodensenke. Die Explosion war so gewaltig, dass im entfernten Braunlage um fünf Uhr ein heller Blitz zu sehen war. Einige Sekunden nach der Explosion zerstörte der Roboter sämtliche Armeelastwagen durch Brandsätze. Damit waren seine Aufgaben erledigt und er machte sich auf den Weg nach Berlin, genauso wie mehr als 1400 andere Kampfroboter. Dort hatten sie den militärischen Ring des Heeres um Berlin auszuschalten. Karl-Friedrich Bornheim, seine Frau Inge und die drei Generäle Baudissin, Brandt und Eisner sprachen über die Lage. Es war früh am Morgen, gerade einmal halb sieben. Die Bedienung räumte das Frühstücksgeschirr und die Reste der Mahlzeit vom Tisch und vom Büffet. Brandt: „Unsere Luftaufklärung meldet zwei Konvois mit 120 Transportschiffen im Nordatlantik, etwa vier Tage von Bremerhaven entfernt.“ Inge Bornheim: „Wahrscheinlich weitere Lieferungen von Panzern, Raketen, Flugzeugen und Munition.“ Brandt: „Ja, sehr wahrscheinlich. Aber dieses Mal sind sie in Begleitung von 50 Kriegsschiffen, darunter zwei Flugzeug- und ein Hubschrauberträger. Die werden wir kaum versenken können.“ Bornheim (KFB): „Die werden damit rechnen, in Bremerhaven wieder angegriffen zu werden. Kann man die nicht schon jetzt angreifen?“ Baudissin: „Mit U-Booten vielleicht, aber die hat nur die Marine. Mit Flugzeugen kaum. Die werden abgeschossen, sobald sie in Reichweite sind.“ Inge Bornheim: „Und wenn die Flugzeuge Raketen aus großer Entfernung abschießen, zumindest auf die Flugzeugträger und größeren Kampfschiffe.“ Brandt: „Ja, dazu brauchen wir mindestens hundert Jagdbomber mit je vier großkalibrigen Raketen. Die haben wir.“ Luftwaffeninspekteur Peter Brandt rannte aus dem Besprechungszimmer. Bis die Flugzeuge betankt und mit den Raketen bewaffnet wären, würde mindestens eine Viertelstunde vergehen. Mit dem altmodischen analogen Funknetz, das weder die Geheimdienste noch die Marine abhören konnten, hatte er in wenigen Minuten die Einsatzbefehle an alle Luftwaffenstützpunkte und an die Satellitenaufklärung verteilt. Fünf Minuten später blinkten in den Flugplatzkasernen die Alarmampeln. General Brandt kehrte in den Besprechungsraum zurück. „Ich hoffe, in zehn Minuten sind die Maschinen in der Luft. Zwei Flugzeuge mit je vier Raketen für jedes Schiff. Vierhundert Raketen für 170 Schiffe, das müsste klappen.“ „Das bedeutet, wir treten in einen Krieg mit den USA ein“, wandte Inge ein. „Sicher. Aber sehen Sie eine andere Lösung? Krieg bedeutet erst einmal Bürgerkrieg in Deutschland. Es ist die Frage, ob sich die USA darin verwickeln lassen wollen.“ „Wenn Piepgen denen was zu bieten hat, nach seinem Sieg im Bürgerkrieg, dann werden die sich einmischen. Militärstützpunkte, ungehemmte Industriespionage, Börsenmanipulationen, Aufkäufe von Unternehmen.“ „Damit beraubt er sich ja seiner Macht.“ „Das ist dem doch egal. Hauptsache, er bleibt Kanzler, kann Luxus fressen und saufen, und vor allem luxusficken.“ „Aber Inge, deine Ausdrucksweise!“ „Ist doch wahr.“ Sie schwieg kurz. „Es scheint ja, dass Großbritannien und Russland nach der Versenkung ihrer Schiffe keinen weiteren Nachschub mehr entsenden. Die haben wohl genug Schiffe verloren.“ „Zum Glück für uns. Wie viele Kampfroboter sind eigentlich auf dem Weg nach Berlin?“, wollte KFB wissen. „Die sehe ich als größte Gefahr für unseren Belagerungsring um Berlin.“ Brandt zog die Schultern hoch. „Die Luftaufklärung spricht von 44 durch unsere Hubschrauber zerstörten Robotern. Wir haben allerdings auch 25 Hubschrauber verloren. Diese Dinger sind wirklich höchst gefährlich. Tage später haben wir durch hoch fliegende Jagdflugzeuge weitere 60 Roboter zerstört, danach keinen mehr. Denn die haben sich auf nächtliche Aktionen und Märsche umgestellt. Ich wüsste gerne, wie diese Dinger programmiert sind. Wir müssten ein paar von denen unbeschädigt in unsere Gewalt bekommen, sozusagen gefangen nehmen.“ „Aber wie? Ich schlage vor, dass sich der Technische Geheimdienst MTSS sofort damit befasst“, meinte Baudissin. Alle nickten. „Die haben alle Mittel dazu, sollte man meinen, jedenfalls nach dem Geld zu urteilen, das die bisher gekostet haben.“ „Habt ihr euch überlegt, wie die USA reagieren werden, wenn wir deren kleine Kriegsflotte und die Transportschiffe angreifen und vielleicht versenken?“ Inge Bornheim wartete einen Augenblick. „Die haben in Deutschland noch 15.000 Soldaten stationiert. Und etliche Kernwaffen in Büchel in der Eifel. Und vor allen Dingen Standorte ihrer Geheimdienste an der Nordseeküste, im Frankfurter Raum und in Baden-Württemberg, mit tausenden Agenten und Militärpolizei. Was werden die also tun? Uns weiter machen lassen?“ Ihr Mann nickte. „Da stimme ich dir zu. Was können wir gegen die Reaktion der US-Regierung tun?“ Kurt Eisner, Inspekteur des Heeres, hatte bisher geschwiegen, auch weil er die geplanten Angriffe der Luftwaffe nicht akzeptierte „Die scheißen doch auf Verbündete. Wahrscheinlich setzen sie ihr Militär gegen uns ein, Heer, Luftwaffe und Polizei, notfalls auch mit Kernwaffen, falls sie zu schwach sind. Oder sie erpressen und drohen uns mit deren Einsatz. Deshalb schlage ich Aktionen in folgender Reihenfolge vor:
Oberbefehlshaber Bornheim und das Lager mit den Atomwaffen. Oberstleutnant Sanftleben hatte seinen Befehl persönlich vom Generalinspekteur entgegengenommen. „Geräuschlos, blitzschnell und möglichst ohne Waffeneinsatz.“ So sollte das letzte Nuklearwaffenlager der US-Streitkräfte in Deutschland eingenommen werden. Deshalb habe das Oberkommando beschlossen, keine schweren Waffen, wie Panzer oder Artillerie, einzusetzen, sondern sich ausschließlich auf Guerillataktik zu verlassen. Die Soldaten sollten daher als solche nicht erkennbar sein, sondern die Kleidung oder Overalls von Friedhofsgärtnern, Kanalarbeitern oder Automechanikern tragen. Dem Oberstleutnant war es als Panzeroffizier zutiefst fremd, nicht in großen Formationen mit fünfzig Panzern zum Kampf anzutreten. Aber er verstand das große Risiko eines solchen Einsatzes und ließ also zehn Gruppen zu je zwanzig Soldaten im Umkreis des Kernwaffenlagers Stellung beziehen. Das Kernwaffenlager Büchel befand sich sechs Kilometer nordwestlich der Stadt Cochem an der Mosel. Der Ort Büchel liegt an der Bundesstraße B259, die von Cochem nach Ulmen führt. Im Nordwesten von Büchel verläuft eine Stichstraße zum Fliegerhorst Büchel der deutschen Luftwaffe. Dort befindet sich auch das Lager für die Nuklearwaffen der US-Streitkräfte in Deutschland. Bis zur Autobahn A61 Koblenz-Ludwigshafen braucht man weniger als zehn Minuten. Am späten Nachmittag des Angriffstages inspizierte OTL Sanftleben noch einmal alle zehn Kampfgruppen, die auf Campingplätzen, auf städtischen Bauhöfen, in verlassenen Steinbrüchen oder im Wald stationiert waren. Die Leute sahen wirklich ziemlich unmilitärisch aus, jedenfalls für seine Vorstellung vom Militär, aber die Bewaffnung war „tipptopp“, wie er es in der Abschlussbesprechung zu bewerten pflegte „Männer, wir haben einen politischen Auftrag, nämlich die USA daran zu hindern, ihre Nuklearwaffen in Deutschland einzusetzen. Dazu müssen wir deren Lager Büchel umzingeln und jeden Versuch der Amerikaner, an ihre Kernwaffen zu kommen, vereiteln, sofort und dauerhaft. Dort befinden sich in elf unterirdischen Bunkern etwa zwanzig Bomben der Modelle 4 und 7 mit einer Sprengkraft von 50 bis 340 Kilotonnen, also 2,5 bis 17 Mal Hiroshima. Ihr wisst, der Fliegerhorst untersteht zwar unserer Luftwaffe. Wir können aber nicht mit der Hilfe unserer fast 500 Kameraden rechnen, weil sie vermutlich von US-Geheimdiensten überwacht werden. Außerdem haben wir den Auftrag, Zivilisten zu spielen. Und der deutsche Kommandant, ein Oberst Richthofen, soll ein mieses Verhältnis zum Inspekteur der Luftwaffe haben. Wir sind daher auf uns allein gestellt. Unser Angriff wird heute Nacht um zwei Uhr beginnen. Ruht euch also vorher aus. Es kann gefährlich werden. Die US-Wachmannschaft besteht zwar nur aus acht Leuten in der Nacht. Aber wir wissen nicht, wie sie bewaffnet sind und wie schnell Verstärkung, zum Beispiel vom Truppenübungsplatz Baumholder, eintreffen kann. Wenn wir das Lager umzingelt haben, kann uns kaum einer überwältigen. Gegen die Nachtdrohnen, die sie immer ab drei Uhr starten, hat jeder von euch zehn Kleinstraketen zur Verfügung. Die Amis haben nur noch einige Kampfhubschrauber in Deutschland, aber wir haben welche in Nannhausen bei Simmern. Da stehen zwölf Kampfhubschrauber bereit, die uns im Morgengrauen unterstützen können. Aber alles kommt jetzt auf uns an, die US-Wachmannschaft zu überraschen.“ Die Kampfgruppen im Umkreis von bis zu 30 km rückten um ein Uhr aus. Vom Moselort Treis bewegte sich ein kleiner Konvoi aus einem Feuerwehrwagen und einem roten Kleinbus nach Westen. Bei Sehl an der Mosel war die regionale Müllabfuhr stationiert. Dort bestiegen zwanzig Müllmänner zwei Lastwagen, jeder mit einem verborgenen Maschinengewehr. Außer Kleinwaffen und Handgranaten trugen die Lastwagen zwei Flugabwehrkanonen sowie tragbare Raketenwerfer gegen Panzer oder Hubschrauber. Eine andere Gruppe aus Ulmen an der A48 hatte die Aufgabe, von Nordwesten anzurücken. Am Abend vorher hatte sich eine Gruppe von 22 Wanderern vom Campingplatz Klotten nordwestlich von Cochem auf den Wanderweg zum Kloster Maria Martental gemacht, durch ein schönes Tal und dichte Wälder. Um halb zehn, es war noch nicht völlig dunkel, wertete US-Sergeant Trump noch einmal die Aufklärungsbilder der Drohnen, Satelliten und Überwachungskameras des Tages aus, bevor er das Kommando an den Chef des Nachtdienstes Dick Cheney übergab. Er schrieb in das Tagebuch „keine besonderen Vorkommnisse“. Wandergruppen waren in dieser Gegend täglich, oft sogar stündlich zu beobachten. Die Nachtdrohnen mit den Infrarotkameras starteten erst in der Nacht. Wegen des begrenzten Treibstoffvorrats konnten sie sich nur zwei Stunden in der Luft halten. Kaugummi kauend übernahm Dick Cheney das Kommando und bestätigte es mit seiner Chipkarte. „Nix besonderes heute. Hast du davon gehört, dass die Deutschen unsere Marine im Atlantik angegriffen haben? Es gibt Gerüchte über hohe Verluste.“ „Nee, das ist auch unmöglich. Wir haben die stärkste Armee der Welt. Die kann niemand besiegen, schon gar nicht die Weicheier von Deutschen.“ „Na ja, die haben sich im Weltkrieg zwei massiv gegen uns gewehrt.“ „Ach, die Schlappschwänze von heute machen wir doch in zwei Tagen fertig.“ „Also, dann haue ich ab“, verabschiedete sich Trump. Cheney sah seine Dienstvorschrift durch, ob eine Möglichkeit bestünde, die Drohnen früher als um drei Uhr starten zu können. Nein, las er, nur bei besonderen Vorkommnissen. Also keine Möglichkeit! Er und sein Stellvertreter spielten mit zwei anderen Soldaten Monopoly. Die anderen vier sollten Wache halten und würden dann um zwei Uhr abgelöst. So war es seit Jahrzehnten Brauch, aber niemandem in der Ebene der Offiziere bekannt. Um halb zwölf prüfte Sergeant Cheney die drei Tresore, in denen sich die Schlüssel für die elf unterirdischen Bunker befanden, auf ihren bestimmungsgemäßen Zustand und trug das Ergebnis in eine Checkliste ein. Für jeden Bunker brauchte man drei verschiedene Schlüssel, um ihn zu öffnen. Die Tresore selbst ließen sich nur mit einer Zahlen-Buchstaben-Kombination aufmachen, die stündlich vom Hauptquartier Europa in Heidelberg gesendet wurde und daher nur eine Stunde gültig war. Aber selbst wenn es jemand schaffte, sich der Atombomben in den Bunkern zu bemächtigen, konnte er nichts mit ihnen anfangen. Sie ließen sich nur mit einem Befehl des US-Präsidenten scharf machen. OTL Sanftleben hatte sich am Abend in die Bücheler Wohnung eines befreundeten Ehepaares aus Köln einquartiert, kleidete sich als Wanderer um und stieß um Mitternacht zu der Wandergruppe, die an der Brücke über den Bach wartete. Sanftleben hatte seine „Zivilsoldaten“ genauestens über die Sicherungsprozeduren der US-Wachen an Nuklearwaffenlagern instruiert. Es kam darauf an, die Wachen blitzartig zu überrumpeln und als Geiseln zu nehmen. Er wusste, die Wachen konnten sich wochenlang selbst versorgen. Das würde auch für „seine Jungs“ gelten. Von einem Spezialisten des Militärgeheimdienstes, der auch als US-Soldat gedient hatte, war Sanftleben mit den Codewörtern für den Zugang zu dem Bunker der Wachmannschaften versorgt worden. Vermutlich würde man daher keine Gewalt anwenden müssen. Um zwanzig vor zwei parkten am Kirchplatz von Büchel ein Feuerwehrlöschzug und ein roter Kleinbus. Am nördlichen Ortsausgang von Büchel, gegenüber der Zufahrtsstraße zum Fliegerhorst, befanden sich zwei Mülllastwagen mit je einem geschlossenen Container. Die Gruppe aus Ulmen war mit ihren Geländefahrzeugen die B259 bis zum Abzweig zum Kloster Martental gefahren, dorthin abgebogen und wartete nun im Wald hundert Meter vor dem Zaun des Fliegerhorstes. Die Wandergruppe von OTL Sanftleben erreichte um halb eins die Anhöhe, auf der sich der Flugplatz befand. Obwohl nur noch eine halbe Stunde zu marschieren war, trieb Sanftleben die Männer zur Eile an, denn er hatte Angst, sie könnten vorzeitig entdeckt werden. Einige Tage zuvor wurde Oberbefehlshaber Bornheim von Generalinspekteur Baudissin informiert, eine Einheit des Berliner Militärrings habe einen offenbar „blinden“ Roboter am Rand der Siedlung Schönwalde „aufgegriffen“. Der Roboter habe sich nicht gewehrt, weil seine optischen Systeme ausgefallen waren. Er, Baudissin, hatte die Kampfmaschine in das geheime Versuchslabor im Güterbahnhof Johannesstift im Forst Spandau bringen lassen, um den Roboter von Experten der Technischen Universität Berlin und des Armeegeheimdienstes untersuchen zu lassen „Und stellen Sie sich vor, die konnten tatsächlich in die Programmierungsebene eindringen, ohne dass der Roboter reagiert hätte. Es gelang ihnen, ihn umzuprogrammieren mit dem alleinigen Ziel, andere Roboter zu erkennen und zu vernichten. Dann haben sie ihm neue optische Sensoren eingebaut. aber auch einen Positionsmelder, um seinen Weg verfolgen zu können. Ich habe dann befohlen, ihn im Spandauer Wald auszusetzen. Bisher hat er sechs andere Roboter vernichtet.“ „Das entspricht sechzig kampfstarken Soldaten. Bitte erinnern Sie mich, dass wir diese Fachleute auszeichnen, befördern und belohnen. Aber dieser eine Roboter wird nur wenige andere Roboter ausschalten können. Wie kriegen wir diese Maschinenarmee im Großraum Berlin in den Griff? Es sind ja schon welche in Tegel, Reinickendorf, Pankow und Weißensee gesichtet worden.“ „Wir sind spät dran. Der erbeutete Roboter war fast vollständig von seinen optischen Sensoren abhängig, wie ein Mensch von seinen Augen. Wenn wir diese Sensoren gezielt zerstören, könnte es uns gelingen, weitere Roboter umzuprogrammieren. Deshalb habe ich dreißig starke Schweißlaser besorgen lassen, um die Roboteroptik zu zerstören. Die Schweißlasergeräte erkennen die nicht als Waffe oder Feind, sie reagieren daher nicht mit einem Angriff.“ „Mann, Ihre Leute sind wirklich gut!“ Baudissin lächelte stolz. „Die dreißig Laser stehen jetzt an vielen nördlichen Einfallstraßen zum Zentrum. Das Versuchslabor hat jetzt neun Zweigstellen im nördlichen Innenstadtbereich, besetzt mit Experten.“ „Sie sind ja wirklich ein perfekter Organisator.“ „Hm, hoffentlich geht es weiter aufwärts.“ Kanzler Piepgen erwachte am nächsten Morgen mit einem Ständer und ärgerte sich, dass ihm Lafontaine keine Bettgespielin besorgt hatte. Ich muss wohl besoffen gewesen sein, murmelte er und schlief wieder ein. Um halb neun wurde er von Lafontaine geweckt. „Mein Führer, ich habe schlechte Nachrichten.“ Piepgen brummte, er wolle noch schlafen, so müde wie er sei, und schlechte Nachrichten wolle er nicht hören, nur gute. Aber Lafontaine gab sich unerbittlich. „Mein geliebter Führer.“ „Lass den Quatsch.“ „Mein Führer, es gibt kaum noch Meldungen über Roboter im Berliner Stadtgebiet. Entweder sie operieren nur noch tief in der Nacht, sodass sie kaum Menschen begegnen. Oder es ist etwas mit ihnen passiert. Da es auch keine Meldungen über vernichtete Stützpunkte des Heeres gibt, vermute ich Letzteres. Vielleicht haben sie die Orientierung wegen schlechter Programmierung verloren. Oder ihre Sensoren funktionieren nicht mehr richtig. Vielleicht haben sie die Ziele vergessen. Für uns ist das sehr schlecht. Ich sehe kaum noch Hoffnung, dass die Roboter das Regierungsviertel erreichen.“ Der Kanzler stöhnte. „Besorg mir sofort eine Frau, sofort!“ „Sehr wohl, mein Kanzler!“ Er rannte fort zu des Kanzlers Harem, in dem sich in einem Schichtdienst rund um die Uhr immer drei Edelnutten bereithielten, eine sehr üppige Blondine, eine schwarzhaarige Grazile und eine etwas ältere rothaarige Lederdomina. „Elisabeth, du wirst jetzt verlangt.“ Aber auch Elisabeth konnte des Kanzlers düstere Stimmung nicht aufhellen. Wenn die Roboter nicht Berlins Mitte und das Kanzleramt freikämpfen konnten, was würde dann aus ihm? Ein Kanzler ohne Reich? Er drang zwar noch in Elisabeth ein, verlor aber dann die Lust und schickte sie fort. Lafontaine ließ ihn noch eine gute Stunde schlafen. Den Chef der Marine und Reichsmarschall, Dr. Cem Döner, vertröstete er auf die Mittagszeit. Der Herr Reichskanzler habe eine Nachtsitzung gehabt und müsse unbedingt ausschlafen. Die Minister und Beamten wussten, wie man diese Begründung zu bewerten hatte, und heuchelten Verständnis. Einem Beamten, der es vor Wochen gewagt hatte, einem Kollegen seine Meinung über des Kanzlers Hurerei und Sauferei zu sagen, war das schlecht bekommen. Drei Tage später fand man ihn erhängt im Volkspark Mariendorf, mit herausgeschnittener Zunge. Den Polizisten, die ihn fanden, war sofort klar, wem man diesen Mord zuschreiben musste. Das war die Botschaft der Russenmafia: „Wer redet, dem passiert dies.“ Deshalb machten die Polizeibeamten nur eine interne Notiz und ließen die Leiche schleunigst durch einen diskreten Bestatter wegbringen. Um halb zwölf schließlich nahm Piepgen eine frisch gekochte Hühnerbouillon mit zwei noch flüssigen Eigelb zu sich. Um halb eins empfing er den Marineadmiral und ließ ihn erklären, wieso die Roboter nicht weiter vorrückten. „Sie sehen doch die roten Punkte auf dem Monitor. Das sind die Orte, an denen Roboter gesichtet worden sind. Das verstehen Sie doch.“ Piepgen sah ihn lauernd an. Der Admiral nickte. Er wollte gerade etwas antworten, da trat Lafontaine ein, knallte die Hacken zusammen und machte den neuen Führergruß, nämlich die rechte Hand waagerecht hochreißend und nach rechts wie zum Handkantenschlag ausholend. „Lafontaine, zeigen Sie dem Admiral, dass es in Berlin-Mitte keine Roboter gibt.“ Lafontaine deutete auf die Karte mit dem Stadtzentrum ohne jeglichen roten Punkt „Nun, mein Lieber, wo bleibt Ihre Antwort?“ Piepgens Augen waren schmale Schlitze geworden. Seine Stimme wirkte gepresst, als ob er sich sehr zusammenreißen müsste. „Nun, muss ich Ihrem werten Gedächtnis nachhelfen?“ Dr. Döner begann zu schwitzen. „Lafontaine, hol die Cognacflasche. Wir müssen seine Zunge lockern.“ Er wandte sich wieder seinem erstarrten Opfer zu, wohl wissend, dass niemand in dieser Runde das Ausbleiben der Roboter erklären konnte. „Wenn der Cognac nichts nutzt, wird man Sie foltern, zunächst leicht, wie im Puff der Domina, hahaha, später immer härter, wie bei der Inquisition.“ Er feixte den Admiral an. Dessen Schweißperlen auf der Stirn wuchsen und wuchsen, er musste einen Cognac nach dem anderen austrinken. Nach einer halben Stunde war der Admiral besoffen, hackevoll, wie Piepgen zu sagen beliebte. Der Admiral war von seinem Sessel auf den Boden gerutscht und hatte sich die Admiralshosen vollgepinkelt. Piepgen maulte. „Aus dem kriegen wir nichts mehr heraus. Aber darauf kam es mir nicht an, sondern ich wollte ihn demütigen, dauerhaft. Schicken Sie ihn weg. Am besten, seine Ordonanz schleppt ihn weg.“ Lafontaine führte den Befehl aus, zweifelte aber an Piepgens Klugheit. Würde sich Piepgen in Döner einen neuen Feind heranziehen? War es weise, den einzigen Militärführer, der hinter ihm stand, derartig zu demoralisieren? Er seufzte, in solchen Fällen ließ sich der Führer auch von seinem Adjutanten nicht beeinflussen und erst recht nicht korrigieren. In den Versuchslaboren des Heeres im Norden Berlins arbeiteten die Experten der Technischen Universität und des Armeegeheimdienstes von Mitternacht bis Mitternacht, um die durch die starken Laser „erblindeten“ Kampfroboter umzuprogrammieren und somit in den Kampf mit den heranrückenden Roboterkollegen zu schicken. In dem kleinen Labor am Rangierbahnhof Wuhlheide lag auf einem langen Tisch ein gut zwei Meter langer Roboter mit zerstörten optischen Sensoren. Zwei Robotik-Studentinnen und zwei Fachleute des Armeegeheimdienstes hatten das vor einer Stunde von der Trabrennbahn Karlshorst eingelieferte Exemplar an ihre Computer angeschlossen und ließen ihre Diagnoseprogramme laufen. „Wie erwartet, keine Informationen aus dem optischen Bereich. Ich glaube, wir können ihn jetzt operieren.“ Bei diesem Wort riss der Roboter seinen Oberkörper hoch, verharrte eine Sekunde und hieb auf die Köpfe der aufgeschreckten Spezialisten ein. Eine Studentin und ein älterer Soldat waren sofort tot. Die beiden anderen konnten sich unter den Tisch retten. Der Soldat flüsterte der Studentin ins Ohr, sie müssten sofort fliehen. „Der kann noch hören und riechen, auch uns.“ Der schwere Tisch über ihnen knirschte und ächzte, wenn sich der Roboter bewegte. Die Studentin zeigte auf die offen stehende Tür zum Vorraum des Labors. Der Soldat nickte, denn sie würden keine Tür öffnen müssen und leise sein können. Sie wies mit dem Arm auf eine auf dem Boden liegende Stahlklammer, die wohl zum Fixieren des Roboters gedacht war. Wenn man das Ding auf die Wand gegenüber der Tür würfe, würde der Roboter aufspringen und sich dem Geschepper zuwenden. Der Soldat verstand den Plan, nickte und zeigte auf sich. Sie nickte. Eine Sekunde später hatte der Soldat die schwere Handschelle ergriffen und schleuderte sie gegen die Wand. Binnen einer Zehntelsekunde sprang der Roboter vom Tisch und stampfte gegen die Wand, wo die Handschelle noch auf dem Fliesenboden rasselte. Die beiden waren unter dem Tisch gestartet, benötigten vier Schritte bis zur Tür, liefen weiter bis zum Haustor und schlossen das Tor sehr leise. Draußen war es noch hell, bis zur Dämmerung hatten sie einen Vorteil gegenüber dem Roboter, denn der war ja blind, und sie nicht. Sie rannten über die Bahngleise in Richtung der westwärts gelegenen Schrebergärten. Gut einen halben Kilometer weiter befand sich das Bundesamt für Strahlenschutz. Dort gab es mehrere Mikrowellenkanonen, die ursprünglich zur Bekämpfung von gewalttätigen Demonstranten, später auch von gewaltbereiten, danach überhaupt von Demonstranten entwickelt worden waren. Vielleicht konnte man eine solche Kanone gegen ihren Verfolger einsetzen. Denn sie hörten ihn, wie er gegen die Eisenbahnschienen stieß, dann aber deren Abstand registrierte und entsprechend passende Schritte einstellte. Ab und zu schoss er auf sie mit Laserimpulsen, zu ihrem Glück weit von ihnen entfernt. Aber sie spürten, dass der verletzte Roboter näherrückte. Vielleicht hatte er eine Art Ehrgeiz entwickelt, um seine Blindheit zu rächen. „Komm“, zog sie den Soldaten am Ärmel. „Hier gibt es einen großen Garten mit einem gewaltigen Komposthaufen. Und der duftet ungeheuer. Daneben verstecken wir uns. Da kann er uns nicht hören und nicht riechen, obwohl er unser akustisches und Geruchsspektrum gespeichert haben wird.“ Der Soldat des Geheimdienstes deutete nach Osten in die Richtung der Gleisanlagen. Der graue Metallkopf bewegte sich genau auf sie zu. Jetzt war er nur noch hundert Meter entfernt. „Wieso weiß das Biest, wo wir uns versteckt haben? Vielleicht kann er doch noch etwas sehen.“ „Lass uns verschwinden. Hier im offenen Gelände haben wir wenig Chancen gegen ihn.“ Kaum waren sie zehn Meter gelaufen, wurden sie beschossen, wie es schien mit Schrotmunition. Schwer atmend, aber unverletzt erreichten sie die Köpenicker Allee, auf der noch erheblicher Verkehr herrschte. Es gelang ihnen, die Straße zu überqueren, bevor der Roboter erschien. Er blieb stehen, der Verkehrslärm und der Geruch der Abgase überdeckte vollständig die akustischen und olfaktorischen Daten seiner Zielobjekte. Sofort entstand ein Stau, dann Panik, als sich der Grund für den Stau herumsprach. Der Roboter rührte sich nicht mehr. Nach einer halben Stunde brachten sich in gut fünfzig Meter Entfernung zwei graue Einsatzwagen des Bundesamtes für Strahlenschutz in Stellung, einer im Norden, einer im Süden. Die Polizei sperrte einen Umkreis von zweihundert Metern um den Roboter ab, der friedlich neben einer Parkbucht stand. Die Heckklappen der Lieferwagen öffneten sich und zwei Mikrowellenkanonen schossen simultane Impulse auf den ganzen Roboter ab. Die Impulse waren auf eine Frequenz eingestellt, bei der sämtliche Kunststoffteile schmolzen und innerhalb von Sekunden in Brand gerieten. Kurz darauf war der Roboter hingerichtet und kippte um. Die Studentin und der Geheimdienstsoldat, die den Einsatz der Mikrowellenkanonen angefordert hatten, wurden gebeten, nach Hause zu gehen. Die Studentin war wegen der überstandenen Gefahr hitzig geworden und zog den gut zwanzig Jahre älteren Soldaten in ein unbesetztes Büro an der Köpenicker Allee und drückte ihn auf einen mit grünem Lederimitat gepolsterten Stuhl. Sie setzte sich mit gespreizten Beinen auf ihn, während sie ihn küsste und die Bluse aufriss, um ihre spitzen Brüste frei zu legen. Als sie spürte, wie es sich in seiner Hose regte, erhob sie sich, öffnete seinen Hosengürtel und zerrte Hose und Unterhose mit einem einzigen Ruck herunter. Weil es schnell gehen musste, der Saft ihres Geschlechtes benetzte schon die Innenseiten ihrer Oberschenkel, verzichtete sie darauf, ihren Schlüpfer auszuziehen. Sie packte ihn bei den Schultern, setzte sich langsam auf sein aufrechtes Glied und ließ es schließlich mit einem Ruck in die nasse Scheide fahren. Nun begann sie, auf ihm zu toben, jedoch nicht hinauf und herab, sondern vor und zurück, das Glied blieb in der Scheide. Sie bewegte sich mit wütender Lust, er hatte Angst, sein Ding würde abbrechen. Auch der Stuhl ächzte unter der Wucht ihrer Stöße. Als ihr Höhepunkt zu kommen schien, sie keuchte schon heftig, stand sie auf und ließ den steifen Bolzen aus der Scheide gleiten, aber nur, um ihn sogleich mit aller Macht wieder hineinzustoßen. Nach dem dritten Mal grunzte und röchelte sie und krallte die Fingernägel in seine Schulter „Ich danke dir, du hast mir das Leben gerettet“, hauchte sie ihm ins Ohr. Ihn überkam ein Lustschauer und er begann, sachte zu stoßen „Warte noch etwas, dann kann ich auch wieder“, bat sie. Sie ist wirklich sehr schön, dachte er, sagte es aber nicht. Schwarzes Haar, schwarze Augen, dichte Augenbrauen, und sie duftet so weiblich. „Ich heiße Sefrima, und du?“ Der Geheimdienstler nannte seinen Vornamen. „Aber der ist auch nur ein Deckname, mehr darf ich nicht sagen.“ Sie drückte ihm die steifen Warzen ihre spitzen Brüste ins Gesicht und richtete sich abrupt auf. „Ich möchte jetzt deinen Schwanz sehen.“ Sie stieg von ihm ab und sah eine nass glänzende Stange mit einem erstaunlich dicken Schaft. „Oh, die Eichel hat ja einen mächtigen Wulst. Was ist das für ein Prachtexemplar!“ Ihr Blick wurde starr „Komm“, sagte er. „Ja.“ Sehr langsam führte sie sich den glitschigen Ständer ein. Sie stöhnte, wie er die Scheide weitete, sie stöhnte heftig, als er sie ganz ausfüllte. Er umgriff ihre Arschbacken und hob sie hoch und ließ ihren Körper wieder fallen, immer schneller, bis es ihr erneut kam und er seinen Samen abspritzte. Draußen war es ganz dunkel geworden. Sie hörten, wie Putzkolonnen durch die Gänge polterten „Ich würde dich gerne wiedersehen, komm mich doch mal besuchen“, schlug sie vor. „Na ja, ich auch, aber das geht nicht, leider.“ „Du bist also verheiratet? Hast du Kinder?“ Er nickte. „Bist du glücklich in deiner Ehe?“ Er nickte wieder. Sie lachte. „Gut, schließlich habe ich dich verführt. Jedenfalls war es sehr schön für mich. Ich danke dir.“ Sie küsste ihn auf den Mund. „Leb wohl.“ Am nächsten Tag brachte er seiner Frau einen schönen Strauß Blumen mit. Nachdem er sie noch vor dem Abendessen heiß gestreichelt und dann aufgespießt hatte, musste er sich inquisitorischen Fragen unterwerfen. „Hast du etwas ausgefressen?“ „Gab es einen Seitensprung?“ „Ja, ich habe im sechzehnten Ehejahr erkannt, ich müsste dich mehr verwöhnen.“ „Ihr Geheimdienstleute seid manchmal skurril.“ Aber sie freute sich doch. Die Studentin hat er nie wieder gesehen. Die Nacht nach seiner depressiven Stimmung hatte Kanzler Piepgen ohne Albträume geschlafen. Pünktlich um neun wurde er geweckt, um sich für die „Große Lage“ vorbereiten zu können. Weil daran der Kriegs-, der Außen-, der Innen- und der Wirtschaftsminister und der Chef der Geheimdienste teilzunehmen hatten, musste Piepgen den weisen und entschlossenen Führer der Nation spielen. Als Neuerung hatte er eingeführt, dass auch führende Vertreter der Wirtschaft an der „Großen Lagebesprechung“ teilnehmen durften. Praktischerweise waren das die Bosse der drei großen Mafiaorganisationen. Kein Zweifel, den Führer der Nation spielen, das konnte Piepgen inzwischen sehr gut, urteilte auch Lafontaine. Ohne die üblichen, ausschweifenden Begrüßungsformeln eröffnete der Kanzler um elf Uhr die Große Lage und kam direkt zur Sache. „Also, die Lage ist beschissen.“ Einige seufzten oder machten „oje“ oder „oho“, obwohl sie sehr wohl um die allgemeine Lage wussten. „Die Roboter kommen nicht vorwärts ins Zentrum, der Marine gelingt gar nichts mehr und die Amis und die anderen Verbündeten tun nichts. Sie haben sogar ihren Nachschub eingestellt. Die Amis drohen mir mit Entmachtung.“ Kriegsminister war vor Kurzem der Verteidigungsexperte der CDP, Theo Weigel, geworden. Er mochte die Lageeinschätzung seines Chefs so nicht akzeptieren und erlaubte sich einen unangemessenen Ton. „Herr Kanzler!“ „Das heißt Herr Reichskanzler“, korrigierte ihn Lafontaine. „Also, daran soll es nicht scheitern, Herr Reichskanzler. Die Roboter rücken nicht weiter vor. Weiß man die Gründe dafür? Vielleicht gibt es Programmierfehler.“ „Das Warum interessiert mich einen Scheißdreck. Noch könnt ihr das Kanzleramt ungefährdet besuchen. Aber bald haben die Potsdamer Terroristen auch die unterirdischen Tunnel hierhin gefunden.“ Das ist mir doch egal, murmelte der Kriegsminister. Der neben ihm sitzende Boss der italienischen Mafia, Luigi Luciano, bekam das mit und erhob sich. „Nach meinen Erkenntnissen möchte ich empfehlen, den Herrn Kriegsminister über seine Ansichten zu befragen, möglichst sehr intensiv.“ Er setzte sich und grinste. „Denn der Herr Kriegsminister beliebte zu sagen: Das ist mir doch egal.“ Piepgen schlug mit der Faust auf den Tisch. „Du bist entlassen, sofort. Du wirst von mir zu einem Test deiner Gesinnung verurteilt. Wir müssen wissen, ob du loyal bist und der Bewegung treu ergeben sein wirst. Schön, einen neuen Kriegsminister werden wir schnell finden. Lafontaine, erledige das!“ Die Teilnehmer der Runde, die mit Leckereien und Champagner reichlich versorgt wurden, atmeten auf, als das schwarze Schaf von Lafontaine hinausgeführt wurde. „Was uns übrig bleibt, ist ein Bürgerkrieg, an dessen Ende wir siegen werden. Den könnten wir zum Beispiel anheizen zwischen Sachsen und Sorben oder zwischen Schleswigern und Dänisch Sprechenden. Aber das ist schwierig zu organisieren. Begeistert war ich damals von dem gegenseitigen Abschlachten im Kaukasus vor Jahrzehnten oder von dem Völkermord an den Armeniern und anderen Minderheiten um 1900. Die Aufstachelung der Menschen zu blutrünstigen Folterungen und Morden, das wurde auch schon viel früher von Politikern vorbildlich gemacht. Alle Staatsorgane waren dabei, Polizei, Militär und Geheimdienste. Spitzenleistungen führten zu mehr als einer Million Toten. Aber wir haben kaum genug Marinesoldaten. Sie sind Heer und Luftwaffe hoffnungslos unterlegen. Die Polizei steht nur in wenigen Städten auf unserer Seite.“ Er machte eine Pause. Die anderen blickten erwartungsvoll auf ihn. „Was wir aber haben, das sind die Mafiaorganisationen. Wie wäre es denn, wenn ihr die Oppositionspolitiker ausrottet. Ihr habt doch Profikiller genug.“ Die drei Mafiabosse sahen ihn verständnislos an. Der anerkanntermaßen brutalste von ihnen, Sergej Tscherwinski, stellte klar, an so etwas hätten sie kein Interesse. „Wir streben nach Geld und Macht. Und dabei ist uns jedes Mittel recht. Aber zu Massenmorden können wir unsere Leute nicht überreden. Durch hunderttausend Umgebrachte haben wir nicht einen Dollar mehr Gewinn. Hunderttausend Tote konsumieren weder Haschisch noch Heroin, sie saufen und rauchen nicht, nehmen keine Medikamente und lassen sich auch nicht mehr erpressen.“ „Nein, nein, das ist kein Geschäftsmodell für uns“, bekräftigte Luigi Luciano „Nein, so etwas geht gegen unsere Kriminellen-Ehre“, pflichtete Tscha Ni Tsing ihm bei. Der Kanzler schaute sie böse an. Lafontaine fürchtete, der Kanzler bekäme einen seiner berüchtigten Tobsuchtsanfälle, durch die er sich schon viele lebenslange Feinde gemacht hatte. Er setzte gerade zu einem Wortschwall der Beschwichtigung an, als der Kanzler seltsam ruhig antwortete: „Schade, vielleicht wäre auf diese Weise ein Bürgerkrieg oder Anarchie entstanden. Davon hätten wir dann profitiert. Denn bei Bürgerkriegen oder anarchischen Zuständen gewinnen immer die Falschen, nicht aber diejenigen, die für eine gerechte Sache kämpfen, für eine Idee, für eine Ideologie. Ich genieße die Macht über Menschen, sie erniedrigen oder foltern zu können. Das unterscheidet mich von den Spinnern, die eine Idee, eine Religion oder einen Wahn realisieren wollen. Insofern habe ich die gleichen Interessen wie die Familien.“ Die anderen nickten. Widerspruch hätte Piepgen ohnehin nicht geduldet „Also, die Große Lage beschließt:
Er reichte ein Blatt mit den Beschlüssen dieser Großen Lage herum, und alle unterzeichneten. Lafontaine war sehr zufrieden. In Potsdam besprachen der designierte Kanzler Bornheim, Generalinspekteur Baudissin, Luftwaffeninspekteur Brandt und Heeresinspekteur Eisner die Lage. Natürlich war in der vierten unterirdischen Etage auch Frau Dr. Inge Bornheim dabei, zum einen, um ihren Mann nicht dem ausschließlichen Einfluss dieser Militärs auszusetzen, und zum anderen durch ihren Intellekt und nicht zuletzt durch ihre erotische Ausstrahlung Entscheidungen zu beeinflussen. Vor einigen Tagen hatte sie sich zu letzterem Zweck einen Büstenhalter gekauft, der ihren gewiss nicht kleinen Busen besonders spitz und abstehend vom Körper formte. Darüber eine halbdurchsichtige Bluse oder eine schwarze, schwere Seidenbluse geworfen, das würde jeden Mann scharf machen. Die „Lage“ hatte um neun Uhr begonnen, aber Inge gesellte sich erst um zehn Uhr dazu. Die Männer sollen sich erst einmal auslabern, dachte sie, bevor ich Vernunft in den Kreis bringe. Kurz vor zehn war sie mit ihrer Toilette fertig. Sie hatte sich für die nicht durchsichtige, schwer fallende Bluse und einen körperengen, roten und wadenlangen Rock entschieden, völlig jenseits des derzeitigen Modetrends. Auch die schwarz glänzenden Stilettopumps waren zurzeit völlig „uncool“, sodass niemand derartige Artikel anbot. Schade, dachte sie, dass die Erotikkultur so den Bach runtergeht. Aber zumindest in den Kreisen älterer Herren würde ihr Auftritt noch gewürdigt werden. Denn diese Generation hasste Turnschuhe, Schlabberhosen, aufgeschlitzte Jeans und T-Shirts bei Frauen. Als sie in den Sitzungsraum trat, richteten sich natürlich alle Blicke auf sie. Den drei Militärs wurde es warm zwischen den Schenkeln, und auch ihr Mann registrierte mit Wohlgefallen ihre erregende Erscheinung. Die aufkeimenden lustvollen Phantasien der Männer wurden durch Inges sarkastische Bemerkung von einer auf die andere Sekunde gelöscht, man sei wohl noch nicht zu Beschlüssen gekommen, wie man dem System Piepgen eine Ende bereiten könnte. „Die Haushaltsmittel für Heer und Luftwaffe reichen nur noch bis Ende des Monats. Danach können die Gehälter der Soldaten nicht mehr bezahlt werden. Der Kanzler hat eine Haushaltssperre für euch Terroristen angeordnet.“ Inges Stimme war laut und schneidend geworden. Als sie in den Besprechungsraum getreten war, erinnerte sich KFB an den Abend vor einigen Jahren, an dem sie sich spät abends in der intim dunklen Bar des Dom-Hotels zum Tanz getroffen hatten. Inges weit schwingendes Sommerkleid bestand aus dünner, weiß glänzender Seide. Als er ihren Körper an sich drückte und seine linke Hand ihren Rücken berührte, fühlte er, dass sie keinen Büstenhalter trug. Die linke Hand tastete ihren Rücken hinab und erfühlte, dass sie auch keinen Schlüpfer trug. Inge hatte gelächelt. Sie nahm seine linke Hand und führte sie an ihre nackte Scham. Karl-Friedrich hatte sofort einen Ständer bekommen, der von ihrer Hand in eine angenehme Position gerückt und mehrere Male gepresst wurde. Sie hatten den Tanz abgebrochen, der Oberkellner musste ein Zimmer in dem Luxushotel für sie buchen. Es wurde eine wüste Nacht. Aus diesen Erinnerungen gerissen, musste er sich anhören, dass in zwei Monaten auch kein Geld mehr für Treibstoffe da sein werde. Karl-Friedrichs angeschwollenes Glied wurde wieder schlaff. „Piepgen lässt die Steuern inzwischen von der Mafia eintreiben. Da wird für den Bundeshaushalt nicht viel übrig bleiben Irgendwann sind also Heer und Luftwaffe handlungsunfähig. Könnte man dann nicht Freiwillige bewaffnen? Zuverlässige Leute aus den Gewerkschaften?“ Wenn auch die Männer bei ihrer stehend vorgetragenen Rede mehr auf ihren Busen und auch die von Frauen bewunderten Hüften starrten, als Inges Feststellungen geistig zu verarbeiten, gelang es ihnen doch, einigermaßen konzentriert auf ihre Analyse zu reagieren. „Das ist eine strategische und eine politische Frage“, sagte Baudissin. „Das muss die politische Führung anpacken.“ Die beiden anderen Militärführer nickten, schoben also die Verantwortung auf den „Kanzlerkandidaten“, wie sie KFB militärintern nannten, ab. Inge, die sich nach ihrem erotischen Auftritt wieder auf ihren Stuhl gesetzt hatte, erhob sich erneut. „Meine lieben Herren, in dem sich auflösenden Staat Deutschland ist niemand mehr da, der Macht legitim ausübt. Mein Mann ist kein Kanzler, noch nicht einmal Kanzlerkandidat. Denn er ist von niemandem aufgestellt worden. Ihr Militärs habt zwar noch eure Ränge, bekommt aber im nächsten Monat kein Gehalt mehr. Wenn euren Soldaten ebenfalls kein Gehalt mehr überwiesen wird, werden sie sich Söldnertruppen anschließen. Diese wird Piepgen ins Leben rufen, mit Hilfe der Mafiosi und deren Steuergelder.“ Sie genoss es, ihren Busen in das Gesichtsfeld von Männern zu rücken. Die Militärs seufzten. Es wurde beschlossen, Baudissin möge einen Plan ausarbeiten, um 50.000 Freiwillige in vier Wochen als Guerillakämpfer auszubilden. Zuverlässige Mitarbeiter des Heeres und der Luftwaffe sollten aus den eigenen Reihen Freiwillige gewinnen, aber auch Kontaktleute bei den Gewerkschaften und Sozialverbänden ansprechen. Man werde Aufrufe „Rettet die Demokratie“ durch Wurfaktionen in Briefkästen, durch Publikation in Zeitungen und digitalen Medien und durch Verteilen an Passanten vor Bahnhöfen, in Einkaufszentren und Fußgängerzonen in Umlauf bringen. Inge konnte sich eine kleine Stichelei nicht verkneifen. „Ihr Militärs müsst euren Aktionen doch immer Codenamen geben. Wie wäre es hier mit der Operation FrWzRDem, also „Freiwillige zur Rettung der Demokratie“? Sie lachte hell auf, ihr Busen bebte. Ihr Mann blickte gegen die Decke, als ob er sich bei dem Herrn da oben Beistand erflehte. Na warte, du Kerl. Dich werde ich heute Nacht rannehmen, dachte sie. Die Kampfgruppen von Oberstleutnant Sanftleben hatten um viertel vor zwei in der Nacht ihre Angriffspositionen um den Fliegerhorst Büchel eingenommen. Es war vereinbart worden, sich lautlos und getrennt zurückzuziehen, wenn der Angriff scheitern würde oder bis drei Uhr nicht erfolgreich beendet werden konnte. Denn um drei Uhr wurden immer die Kampfdrohnen zur Überwachung der näheren und weiteren Umgebung gestartet. Der Himmel war vollständig mit Wolken bedeckt. Kein Mond erhellte die Nacht. Es war nun zwei Uhr geworden. Kein US-Soldat hielt sich am oder in der Nähe des Bunkers für die Wachmannschaften auf. Vom deutschen Fliegerhorst in gut einem Kilometer Entfernung würde man den nächtlichen Angriff der Wandergruppe nicht sehen können, denn dazwischen lag eine Anhöhe mit alten Fichten. Die vier Jeeps der Gruppe aus Ulmen warteten vor dem Tor zum Fliegerhorst, gut im Wald versteckt. Diese Gruppe hatte den Auftrag, bei einem Scheitern der Wandergruppe einzugreifen und die Männer „herauszuhauen“ Die als Feuerwehr getarnte Gruppe am Kirchplatz von Büchel sollte Angriffe aus dem Moseltal abwehren. Die Gruppe mit den Mülllastwagen befand sich an der Zufahrtstraße zum Fliegerhorst und musste etwaige Panzer- oder Hubschrauberattacken der US-Streitkräfte stoppen. OTL Sanftleben bedeutete nun seinen Männern, den Zaun um das Gelände des Fliegerhorstes zu zerstören. Da sie nicht wussten, ob der Zaun unter Hochspannung stand oder ob bei einer Verletzung ein elektronisches Signal an eine Alarmzentrale gesendet würde, setzte man eine neue Technik ein, nämlich das Abschmelzen der Zaunpfosten mit einem Schweißbrenner. Nach drei Minuten war der Stacheldrahtzaun über eine Breite von drei Metern umgekippt. Es blieb ruhig, keine Sirene heulte, kein Warnlicht war zu sehen. Sie warteten noch eine Minute. Es blieb ruhig. Mit Spaten und Spitzhacken lösten sie dicke Erdklumpen aus dem Grasboden vor dem Zaun und schaufelten sie über den auf dem Boden liegenden Zaun. Auf diese Weise war der Stacheldraht bedeckt, und für die Männer und die Jeeps gab es keinen scharfen Stacheldraht mehr. Die Entfernung zu dem Bunker der US-Wachen betrug nur achtzig Meter. Bis zu dem Bunker war jedoch ein weiterer Zaun zu überwinden, gut drei Meter hoch und elektrisch geladen, was man an den Isolierkeramiken an den Zaunpfosten erkennen konnte. Aber auch an diesem Zaun bewährte sich die Methode mit dem Schweißbrenner. Nach wenigen Minuten entstand eine ausreichend breite Schneise. Wiederum wurde kein Alarm ausgelöst. In dem Bunker der Nuklearwachmannschaften hatten Sergeant Cheney und drei seiner Leute das Monopolyspiel um kurz vor zwei beendet. Sie wurden von vier anderen Soldaten abgelöst, die die Zeit bis dahin mit Fernsehen verbracht hatten. Um zwanzig nach zwei schlief die erste Schicht bereits, während die Ablösung die Pokerkarten und eine Flasche Whisky auspackte. Dies war ebenso verboten wie die Aufteilung der acht Soldaten in zwei Gruppen von vier Leuten. Aber in den mehr als siebzig Jahren seit dem Aufbau des Atomwaffenlagers Büchel hatte noch nie ein Offizier oder ein anderer Prüfer an einer Nachtschicht teilgenommen. Daher war die Praxis „höheren Orts“ unbekannt, jedoch sehr beliebt bei den Mannschaften. Von zwei Uhr bis zwei Uhr und neun Minuten erfassten die Wärmebildkameras sowohl die Männer von OTL Sanftleben als auch den Einsatz der Schweißbrenner. Aber in der Wand mit gut zwanzig Monitoren fiel das während der Zeremonie „Wir machen es uns jetzt gemütlich“ nicht auf. Um zwei Uhr zwanzig erreichte die Gruppe mit OTL Sanftleben den Eingang des Bunkers. Sanftleben tippte die drei Codewörter in die Tastatur des Türöffners ein. Langsam öffnete sich die erste Stahltür. Sie war gut acht Zentimeter dick. Neben der zweiten Tür befand sich eine weitere Tür. Sanftleben war etwas ratlos, tippte aber wiederum die Codewörter ein. Tatsächlich öffnete sich diese Tür aus fünfzig Zentimeter dickem Beton und danach eine vergleichsweise dünne Tür, die vollkommen gasdicht konstruiert war. Der OTL blickte in einen schwach beleuchteten Gang. Alle Männer trugen nun Gasmasken und hielten Gaspistolen in der Hand. Die Munition für diese Gaspistolen enthielt ein in weniger als einer Sekunde wirkendes Nervengas, das jede körperliche Bewegung für mindestens eine Stunde blockierte. Auf Zehenspitzen laufend und flüsternd, verteilten sich die zweiundzwanzig Männer vor den vier Türen auf dem Gang. Sanftleben hob den Arm, und alle Klinken wurden nach unten gedrückt. Alle Türen wurden gleichzeitig aufgerissen. Kleine Blendgranaten wurden abgeschossen und die Nervengaspistolen abgefeuert. Nach wenigen Sekunden war es sehr still. Alle US-Soldaten wurden gefesselt und geknebelt in den beiden Schlafräumen eingeschlossen. Sanftleben schickte ein verschlüsseltes Signal an die anderen Gruppen rund um Büchel und an Baudissin, die Operation Eifelfuchs sei erfolgreich abgeschlossen worden. Niemand hatte jedoch an die Bewegungssensoren gedacht, die die US-Soldaten am Handgelenk tragen mussten. Deren Signale wurden jede Stunde in das US Hauptquartier in Heidelberg gesendet. Dort fiel der Nachtwache um vier Uhr auf, dass keine Bewegungssignale mehr aus Büchel gesendet wurden. Der zuständige Unteroffizier meldete den Vorfall seinem Chef. Doch der versuchte abzuwiegeln. „Das kommt immer mal wieder vor. Da schlafen die Jungs ein, weil sie zu viel gesoffen haben. Ja, ich weiß, dass das verboten ist. Aber es kommt trotzdem vor.“ Da der Unteroffizier jedoch auf der schriftlichen Bestätigung seiner Meldung bestand, unterschrieb der Captain unwirsch „diesen Wisch“ Der Unteroffizier grinste und verschwand endlich. Der Captain widmete sich wieder dem Sexfilm auf seinem Minicomputer, den er bei dem Anklopfen des Soldaten schnell abgedeckt hatte. Erst um halb fünf meldete der Captain seinem Chef, einem Major Bush, dass möglicherweise in Büchel „etwas nicht stimme“. Dem Major musste er erst erklären, welche Einheit in „Bychel“ stationiert sei und welche Aufgabe sie habe. Um fünf Uhr schließlich, es dämmerte schon der Morgen, machte der Major eine folgenreiche Meldung an Colonel Claus Bernanke. OTL Sanftleben ließ die drei Türen wieder sichern und setzte eine Mannschaft von achtzehn Männern ein, die den Eingangsbereich rund um die Uhr zu überwachen hatten. Ein Soldat hatte sich um die Bedürfnisse der Gefangenen zu kümmern und ein weiterer sollte für die Ernährung aller sorgen. Sanftleben und Leutnant Schleipfer hatten die Kommunikation nach außen aufrechtzuerhalten. „Leute, wahrscheinlich werden wir hier für längere Zeit festsitzen. Es wird irgendwann sehr langweilig werden, weil nichts passiert. Die Gefangenen werden einen Aufstand versuchen und uns ermorden wollen. Unter uns wird öfter Streit ausbrechen, wie in einem langweiligen Ferienlager. Wir sind aber nicht in einem Ferienlager, sondern wir haben den Auftrag, die US-Kernwaffen zu bewachen, damit sie sie nicht einsetzen können. Wenn wir dadurch das Leben von Millionen bewahren können, werden wir Helden sein. Wenn man uns hier angreifen sollte, werde ich dafür mein Leben geben. Und das hoffe ich von euch ebenfalls.“ Im US-Hauptquartier für Mitteleuropa in Heidelberg nahm General Eisenhower den Anruf von Colonel Bernanke entgegen, in „Bychel“ wären wahrscheinlich Terroristen eingedrungen. Vermutlich wollten sie die Nuklearwaffen rauben. Der General äußerte sich ziemlich skeptisch. „Selbst wenn da jemand in den Mannschaftsbunker eingedrungen sein sollte, haben sie keinen Zugang zu den Bunkern mit den Sprengköpfen. Außerdem wird der Zugangscode stündlich geändert. Und scharf gemacht werden können die Bomben nur durch den Präsidenten und einen vom Generalstab.“ „Aber es wäre doch möglich, dass die Mannschaften gefoltert werden, schließlich machen wir das doch auch. Dann rücken die auch den Code für die Tresore heraus, in denen sich die Schlüssel für die Kernwaffenbunker befinden.“ „Ja, ja, okay. Aber die können die Waffen nicht scharf machen, verstanden?“ „Aber die Terroristen können die Sprengköpfe klauen, sie irgendwo vielleicht scharf machen oder aus dem Plutonium darin schmutzige, höchst toxische Bomben bauen.“ „Okay, Sie gehen mir auf den Sack. Ich erteile Ihnen hiermit den Befehl, den Standort „Bychel“ von den Terroristen zu säubern. Wie Sie das machen, ist mir egal. Sie sind ja schließlich Colonel genug, um den Angriff zu leiten. Kollateralschäden an der Zivilbevölkerung sind mir egal. Die deutsche Regierung wird schon nicht aufmucken. Haha, dieser Piepgen!“ Eine Minute später warf der Colonel die Militärmaschinerie an. Sanftleben beobachtete amüsiert am Bildschirm, wie die um drei Uhr automatisch gestartete Drohne die Umgebung abflog, das Moseltal um Cochem, von dort die Straße nach Kaisersesch, von dort die Autobahn bis Ulmen, dann die B 259 bis Büchel. Weder die als Feuerwehr getarnte Gruppe am Marktplatz von Büchel noch die Ulmener Gruppe oder die Müllwagengruppe am Abzweig zum Lager Büchel waren als Kampfeinheiten erkennbar. Sanftleben lächelte zufrieden. „High-tech, aber zu doof, sie auszuwerten.“ Er grinste Leutnant Schleipfer an. „Das habe ich doch immer gesagt. Die Amis sind uns haushoch überlegen.“ Der Leutnant erwiderte: „Da sollten Sie sich aber nicht so sicher sein. Vielleicht bewegt sich deren Militärapparat morgen oder übermorgen. Dann wird unser Bunker zittern und wir werden vor Angst in die Hosen scheißen. Und dann kommt das Giftgas. Die Filter der Belüftungssysteme absorbieren das einige Tage. Aber was ist danach? Die mit Giftgas gesättigten Filter brechen durch, und wir sind in ein paar Minuten tot. Dann haben wir nichts erreicht.“ Sanftleben seufzte. „Ja, Sie haben recht, aber bitte erzählen Sie das nicht den Mannschaften. Für die Kampfmoral wäre das verheerend.“ Schleipfer nickte. „Ich denke, dass die Amis so um fünf Uhr angreifen werden. Bis dahin sollten wir noch eine Mütze Schlaf nehmen.“ Um viertel vor sechs, es war schon fast hell, bemerkten die „Müllmänner“ am Abzweig zum Fliegerhorst sieben Hubschrauber am westlichen Himmel. Sie gaben ihre Beobachtung sofort an die Kameraden im Bunker und an den anderen Standorten weiter und machten ihre im nahen Wald versteckten Flugabwehrraketen feuerbereit und startklar. Ursprünglich wollte man Hubschrauber auf dem Luftwaffenstützpunkt Büchel landen lassen und sie dann unter Feuer nehmen. Aber das hätte zu viel Aufsehen erregt. Daher zog es Sanftleben vor, die Hubschrauber in möglichst großer Entfernung abzuschießen. Nach dem Überfliegen des Dorfes Alflen hätten die Maschinen nur noch offenes Land ohne Bebauung unter sich, und es würden keine Zivilisten durch die Abstürze Schaden nehmen. Von Alflen bis Büchel bräuchten die Hubschrauber etwa eine Minute, es musste also alles sehr schnell gehen. Oberleutnant Schmidt-Jorzig beobachtete das Dorf Alflen durch ein Fernglas und wartete, bis sich die Hubschrauber über dem Dorf befanden. Der Befehl vom OTL lautete: „Je Hubschrauber drei Raketen abfeuern, aber nacheinander im Abstand von einer Sekunde!“ Die Raketen würden zwar mit doppelter Schallgeschwindigkeit fliegen. Dennoch hätten die Hubschrauberpiloten zwei bis vier Sekunden Zeit, um ihnen auszuweichen, allerdings nur durch sehr gewagte Manöver. Die Feinderkennungssensoren der Raketen bestanden aus Infrarotmessfühlern für verschiedene Wellenlängenbereiche und folgten automatisch der Flugbahn. Allerdings konnten sie abrupten Richtungs- und Höhenänderungen nicht folgen. Die Scheinwerfer der Hubschrauber waren nun ausgeschaltet, doch Schmidt-Jorzig konnte sehr gut erkennen, wie der anführende Hubschrauber über dem Kirchturm von Alflen anflog. Er gab das Zeichen zum Abschuss, und einundzwanzig nur einen halben Meter lange Raketen rasten auf die Hubschrauber zu. Der leitende Officer im Cockpit der ersten Maschine sah ein Feuerwerk von grellen Blitzen im Wald vor Büchel. „Scheiße, wir werden angegriffen!“, schrie er in sein Helmmikrofon. „Ausweichmanöver und dann Gegenangriff.“ Er sah ein glänzendes Objekt mit einem Feuerschweif auf sich zu rasen und riss den Steuerknüppel an sich und damit den Hubschrauber steil hoch. Das Objekt schoss unter ihm vorbei und zerfetzte den hinter ihm fliegenden Hubschrauber. Jedoch nahm er nun eine zweite Rakete wahr, ließ den Hubschrauber nach links abschmieren und wurde schließlich von einer dritten Rakete erwischt. Oberleutnant Schmidt-Jorzig zählte die Explosionen in der Luft und am Boden. Es waren sieben, und das meldete er dem OTL. Im US-Hauptquartier in Heidelberg war man über den Verlust der sieben Hubschrauber sehr überrascht. Colonel Bernanke machte General Eisenhower Meldung. Also, er versuchte es. „Sie Idiot, warum haben Sie nicht zuerst durch den Geheimdienst zu eruieren versucht, was da los ist und wer da agiert? Wieso zuerst Hubschrauber? Wen oder was sollten die angreifen, wenn die Piloten nichts wussten?“ „Ich dachte, die könnten da landen …“ „Papperlapapp, ich dachte. Denken können Sie den Pferden überlassen, die haben größere Köpfe!“, brüllte der General. „Ich enthebe Sie Ihres Auftrags, ab sofort, basta!“ Dann rief er seinen alten Kumpel, General Hellobird an. „Hör mal, ich brauche deine Hilfe. Du hast doch so einen alten Haudegen, den Colonel Twintower. Der hat doch etliche Überfälle auf unbotmäßige Länder mitgemacht. Kannst du mir den mal ausleihen?“ Der Kumpel wollte wissen, wofür. „Unser Kernwaffenlager Bychel in der Eifel, Germany, ist offenbar in der Hand von Terroristen. Mein Colonel Bernanke sollte das Lager säubern. Aber er hat versagt. Jetzt brauche ich einen kampferprobten Draufgänger.“ „Ja, sicher. Ab wann brauchst du den? Ab sofort, in der nächsten Stunde?“ Wenig später sahen sich Colonel Twintower und sein Stab die Lagekarten Büchel auf dem riesigen Monitor an. „Da ist doch nur der deutsche Luftwaffenstützpunkt. Von denen kann man doch keinen Angriff erwarten. Nein, nicht von denen.“ „Aber die Raketen kamen eindeutig aus der Richtung von Bychel.“ „Ich würde da zwanzig Panzer einsetzen. Oder besser noch Giftgas. Lange werden die das ohne Frischluftzufuhr nicht aushalten.“ Colonel Twintower machte klar, man werde mit dem Hubschrauber eine Truppe von zehn Mann in der Nähe absetzen, am besten im Wald bei dem Kloster Maria Martental. „Diese Leute sollen nicht kämpfen, sondern die Lage erkunden und an uns melden. Natürlich nehmen die auch Granatwerfer mit. Um die Terroristen abzulenken, werden wir von zwei Seiten mit je fünfzig Soldaten angreifen, von Alflen, wo unsere Hubschrauber abgestürzt sind, und von Gevenich im Süden. Wer von euch kann so gut Deutsch, dass er am Morgen Einheimische in Alflen fragen kann, was gestern passiert ist?“ „Niemand kann Deutsch, okay. Scheiße, dass wir nur Amerikanisch können.“ Der Colonel entschied, sich höchstpersönlich mit den zehn Kundschaftern beim Kloster absetzen zu lassen. Wahrscheinlich hatten die Terroristen eine ähnliche Route gewählt, um an das Lager heranzukommen. Mittlerweile war es neun Uhr geworden. OTL Sanftleben befürchtete massive Luftangriffe auf die Kampfgruppen in der Umgebung. Daher befahl er der „Müllmannschaft“, sich östlich von Büchel im Wald zu verstecken. Die Ulmener Gruppe sollte im Nordosten vom Kloster Stellung beziehen. Die Feuerwehrgruppe musste den Marktplatz von Büchel verlassen und östlich der B 259, die von Cochem nach Büchel führte, im Wald eine Verteidigungslinie aufbauen. Von dort hatte man auch die Straße von Gevenich im Schussfeld. Kurz vor zehn landete ein Transporthubschrauber südlich des Dorfes Gevenich. Aus der Hecköffnung strömten fünfzig schwer-bewaffnete US-Soldaten und sammelten sich am Waldrand. Der Hubschrauber hob wieder ab und verschwand nach Süden. Das Manöver dauerte nicht einmal dreißig Sekunden, wurde jedoch von der Feuerwehrgruppe gesehen und gehört. Deren Gruppenführer beriet mit dem OTL, wie man einem Angriff begegnen sollte. „Nicht direkt angreifen, nur aus dem Hinterhalt. Die haben mehr Leute als wir. Man sollte auch vermeiden, dass die Verstärkung anfordern. Deshalb lieber anschleichen und so weiter.“ Keine fünf Minuten später landete auf der Wiese hinter dem Kloster Maria Martental ein Hubschrauber und spuckte elf Soldaten heraus. Colonel Twintower sprang als Erster aus der Maschine, warf sich auf den Boden und robbte in Richtung Wald. Als der Hubschrauber wieder fort war, lagen alle unter niedrigen und dicht stehenden Kiefern. Der Colonel wies nach Süden. Ihr Pech war es, dass sie eine große Wiese überqueren mussten. Plötzlich wurde von drei Seiten das Feuer auf sie eröffnet. Vier Scharfschützen der Ulmener Gruppe schossen auf sie. Den Überlebenden blieben nur Sekunden, um von der Uferböschung des Baches ins Wasser zu springen. Colonel Twintower schob sein Periskop über den Rand der Böschung, um nachzusehen, wo die Erschossenen und die Verwundeten lagen. Als das Objektiv über das Gras ragte, knallte es zweimal, und das teure Gerät war zersplittert. „Tja, jetzt sind wir nur noch zu viert. Wenn es Verletzte geben sollte, können wir ihnen nicht helfen. Die haben bestimmt die Wiese umzingelt. Also, robben wir weiter bis zum Wald.“ Jetzt war es viertel nach zehn. Vom Dorf Alflen waren es nur vier Kilometer bis nach Büchel, quer durch Felder und Wald. Colonel Sweeney trieb seine hoch gerüstete Fünfzig-Mann-Truppe zur Eile an. „Los Leute, wir müssen die Krauts fertig machen, noch heute. Wir sind schließlich die Weltmacht Nummer Eins.“ Seine Soldaten, überwiegend Schwarze, trieb das allerdings nicht zu besonderer Eile an. Schwieriges Gelände im Laufschritt zu bewältigen, schmeckte nicht jedem der überwiegend fetten Männer. Die einzige Frau lief vorbildlich an der Spitze mit. Allerdings ist die auch weiß, seufzte der Colonel. Er war auch weiß. Um elf Uhr erreichten sie die Kurve der B 259, an der die Straße zum Kloster Martental abzweigt. Nur wenige Autos waren auf der Bundesstraße zu sehen. Colonel Sweeney empfing gerade eine Nachricht von Colonel Twintower. „Sieben Tote, ach du Scheiße!“ Er erfuhr, dass die anderen bisher keine Feindberührung gehabt hatten. „Also, weiter nach Bychel. Irgendwann werden sich die Terroristen rühren müssen.“ Zwei Tage nach der Großen Lage mit den Mitgliedern der Regierung, den Geheimdienstchefs und den Mafiabossen rief der Kanzler um sieben Uhr in der Frühe seinen Adlatus Lafontaine herbei. Heftig atmend, stürzte Lafontaine in das persönliche Büro des Reichskanzlers. „Guten Morgen, mein Führer!“ Er knallte die Hacken zusammen und hob die Hand zum Führergruß durch Handkantenschlag nach rechts. „Lass den Quatsch und hör mir zu.“ „Jawoll, mein Führer!“ Piepgen blickte ihn grimmig an. „Mir ist eine Idee gekommen. Wir befehligen kein Heer und keine Luftwaffe mehr. Wie wäre es, wenn ich mir eine Privatarmee schaffe? Ich lasse mir von den Reichen in Deutschland und in Europa Geld spenden und stelle mir eine Söldnerarmee auf. Rechne doch mal aus, wie viele Privatsoldaten wir brauchen, um die Rathäuser, Flughäfen, Bahnhöfe und andere Einrichtungen zu besetzen, aber nur für ein paar Tage, und um Unruhe zu stiften. Diese Privatarmee soll Lastwagen, Hubschrauber und Polizeiwaffen bekommen, vielleicht auch Abwehrraketen gegen Panzer und Flugzeuge. Was würde das kosten und wie kriegen wir das Geld dafür zusammen?“ „Jawoll, mein Führer!“ „Wenn meine Privatarmee steht, wirst du sie führen. Aber mache dir ja keine Illusionen, du könntest mich aus dem Amt fegen. Da habe ich vorgesorgt.“ „Selbstverständlich bleibe ich meinem Führer bis zum Tode treu.“ Gerade wollte er hinausgehen, als Piepgen ihn zurückrief. „Wie würdest du denn die Privatarmee nennen? Mir ist da schon etwas eingefallen: Kanzlergarde, Schutzstaffel, Kanzlerleibstandarte oder Wachbataillon Kanzler.“ „Nein, nein. Das klingt alles nicht privat genug. Das darf mit Ihrer Person gar nicht in Verbindung gebracht werden, und es erinnert an längst vergangene Zeiten. Wir nennen sie einfach „Bürger für den Frieden“ oder abgekürzt „BüFri“. Tausend Dollar pro Tag auf die Kralle, Genfer Konvention, Menschenrechte und Kriegsrecht interessiert die einen Scheißdreck. Mein Führer, ich bewundere Sie, das ist eine glänzende Idee.“ Lafontaines Strategie war es, Piepgen ständig zu überhöhen und ihn schließlich als unfehlbar darzustellen. Irgendwann würde Piepgen dann abstürzen, weil er Fehler machte. Dann wäre seine, Lafontaines, Chance gekommen. Mit einer eigenen Söldnertruppe im Rücken würde er diese Chance mit Gewalt nutzen. Bis jetzt war für das Piepgen-Regime ziemlich viel schiefgelaufen. Die Aktion mit den Kampfrobotern gelang im Anfang sehr gut, war dann aber kümmerlich gestorben. Die Marine konnte nicht dazu beitragen, Berlin zu befreien. Den Mafialeuten war es nicht gelungen, die Gewerkschaften zu unterwandern. Mehr Steuern als früher konnten sie auch nicht eintreiben. Piepgen konnte sich darauf verlassen, Lafontaine würde in wenigen Tagen eine gründliche Recherche über die notwenige Größe und den Finanzierungsbedarf einer Privatarmee liefern. Vor Lafontaine hatte er keine Angst. Er würde in einigen Jahren als Politiker abtreten und Lafontaine das Ruder überlassen, um sich seinen vielen Frauen intensiver widmen zu können. Das mit Lafontaines Illusionen hatte er nur gesagt, um ihn anzuspornen und Lust auf Macht zu entwickeln. In der Tat brachte Lafontaine drei Tage später eine ausführliche Analyse über die Machbarkeit und die Kosten des Projekts „BüFri“ in Piepgens Privaträume. „Das muss unbedingt unter uns bleiben“, meinte er zu Piepgen. „Wenn irgendetwas herauskommt: Sie wissen nichts, und ich habe eigenmächtig gehandelt und muss die Konsequenzen tragen und so weiter, das Übliche.“ Piepgen musste über seinen Assistenten schmunzeln. Er erinnerte sich nicht, ob er in dessen Alter auch einen derartigen Elan entwickelt hatte. „Fasse dich kurz und lass mir das Papier hier. Ich werde mich heute Abend damit befassen. Aber zuerst ist Jelena an der Reihe. Also, was hast du herausgefunden?“ Lafontaine kannte Jelena gut, denn er hatte sie mit Piepgen verkuppelt. Dieser sehr weiblich entwickelten und körperlich starken Domina war Piepgen sofort verfallen. Jeden zweiten Tag kam sie in sein Schlafgemach, demütigte, misshandelte und prügelte ihn. Manchmal ließ sie ihn zwischen ihren mächtigen Brüsten nach Luft röcheln. Sie ließ ihn zwar in sich eindringen, er musste aber vorher ein dickes, jeden Reiz abstumpfendes Kondom überziehen, mit der Wirkung, dass er fast eine Stunde stieß und stieß, aber keinen Samenerguss erlebte, sie jedoch sechs oder sieben Höhepunkte. Nach dem Besuch Jelenas musste sich Piepgen immer gut zwei Stunden ausruhen, so fertig fühlte er sich. Lafontaine hatte den Auftrag ausgeführt und berichtete: „Für wenige gezielte Operationen in der Woche in Deutschland reichen 500 Kämpfer vollkommen aus. Vorausgesetzt, es sind Spitzenkräfte und ihnen stehen die besten Spezialwaffen zur Verfügung, auch Panzer- und Flugabwehrraketen. Panzer und anderes schwere Gerät brauchen wir nicht. Denn wir hätten Probleme, die sicher zu stationieren und ausreichend zu warten. Wir sollten die Söldner für jeden Einsatztag bezahlen, also nicht mit einem festen Monatsgehalt. Dann sind sie motiviert, möglichst viele Einsatztage zu haben. Im Jahr wären das 25 bis 100 Millionen US-Dollar an Personalkosten. Für die Waffen bräuchte man einmalig 10 bis 30 Millionen und für Munition, Raketen und Betriebskosten noch einmal jährlich 50 bis 80 Millionen US$. Das ist alles sehr überschaubar und könnte locker aus dem Verteidigungshaushalt finanziert werden. Also einmalige Kosten zum Aufbau der Armee BüFri maximal 30 Millionen und jährlich 180 Millionen US$. Für Milliardäre ist das ein Klacks. Ich werde, Ihr Einverständnis voraussetzend, morgen mit den Vertretern der dreihundert reichsten und mächtigsten Familien besprechen, wer wie viel gibt.“ „Einverstanden, ich werde dich heilig sprechen, wenn du das schaffst.“ „Mit Verlaub, mein Führer, zuerst selig. Wenn die Privatarmee steht, dann heilig.“ „Gut, gut, jetzt geh an die Arbeit!“, befahl der Kanzler, dessen Geschlecht sich in der Hose meldete. Jelena wartete bereits im Schlafzimmer hinter seinem Büro. Lafontaine verkniff sich eine Bemerkung und verschwand. Am nächsten Tag, es war gerade neun Uhr geworden, rief Lafontaine Kurt Schläcker und Fürst Dietrich zu Hohenlohe an, die als gewählte Sprecher der Milliardärsfamilien in Deutschland einen sehr großen Einfluss auf die Politik und in der Wirtschaft ausübten, diesen jedoch hinter Prominenten- und Adelsklatsch geschickt verbargen. Es gelang ihm, das Interesse der beiden an dem Projekt „Bürger für den Frieden“ zu wecken. Natürlich musste er ihnen den Hintergrund dieses Namens erläutern. „Ach, das kennen wir schon. Soziale Marktwirtschaft, Liberale Initiative oder Neue Soziale Marktwirtschaft, dahinter standen immer unsere Gelder.“ Schließlich konnte er einen Präsentationstermin mit den beiden und anderen Milliardären aushandeln. Man wollte die Sache am kommenden Wochenende – die Angelegenheit duldet keinen Aufschub – im Kanzlerbunker während eines intimen Abendessens besprechen und wohl auch beschließen. Kurt Schläcker, Fürst zu Hohenlohe und Lafontaine hatten vereinbart, die erlauchten Herrschaften sollten um sieben Uhr vom Kanzler empfangen werden. An dessen viertelstündiger Rede sollte sich ein opulentes Dinner anschließen. Der Reichskanzler umwarb in seiner Rede, die ihm Lafontaine pünktlich am Morgen überreicht hatte, seine schwerreichen Gäste, deren Vermögen sich trotz zweier Weltkriege, einer Rieseninflation und mehrerer Wirtschaftskrisen auf wundersame Weise vermehrte, während die sogenannten kleinen Leute einige Male von Null anfangen mussten, bat sie inbrünstig um Beistand, malte Schreckensszenarien wie „es droht ein Bürgerkrieg“, „ausländische Mächte im Osten lauern darauf, sich Deutschland einzuverleiben“ und drohte, bei einem Scheitern seiner Regierung mit einer linksextremen Räterepublik, die alle großen Vermögen enteignen und die Großunternehmen verstaatlichen werde „Das hat bei den Reichen und erst recht bei den kleinen Häuschenbesitzern immer schon gewirkt“, hatte ihm Lafontaine erläutert. Nachdem der Champagner gereicht worden war, wurden die Herrschaften einzeln beim Eintreten in den festlich erleuchteten und geschmückten Speisesaal durch einen mittelalterlich kostümierten Herold angekündigt:
Der Reichskanzler begrüßte jeden einzeln und wechselte mindestens ein paar Sätze mit den potenziellen Geldgebern, auch wenn er bei der einen oder anderen Person dachte, was das für komische Figuren seien. Also besülzte er die weiblichen Gäste mit „Gnädige Frau werden ja immer jünger“ und den Herren schmeichelte er durch wahre Lobeshymnen. Hinter ihm musste Jelena mit ihrem bodenlangen und hoch geschlossenen Kleid schreiten, um die männlichen Gäste in ihren strengen Bann zu ziehen. In seiner Rede an die Milliardäre kamen erwartungsgemäß alle Parolen jeder linksradikalen Propaganda vor:
Jeder dieser Kampfbegriffe löste bei den einfacheren Gemütern unter den Milliardären Gruseln und Angstschauer aus. Denn die allermeisten von ihnen waren Erben von Eltern oder Ehegatten. Oft stammte die Erbmasse von den Urgroßeltern oder aus noch früherer Zeit. Noch während Piepgens Rede ließ Lafontaine eine Liste mit allen Namen der Anwesenden umlaufen, mit einer Spalte für die Höhe der einmaligen Spende im nächsten Monat, einer Spalte für die jährliche Unterstützung der „Bürger für den Frieden“, einer Spalte für die Abbuchungserlaubnis und die Bankverbindung und einer für die Unterschrift. Anfangs gestaltete sich das aktive Spenden noch etwas zäh, aber bald konnten die Superreichen sehen, was der Nachbar zu spenden bereit gewesen war. Bevor der Reichskanzler das Dinner eröffnete, steckte ihm Lafontaine einen Zettel mit dem Spendenergebnis zu. „Meine sehr verehrten Damen, sehr geehrte Herren, bevor ich Ihnen einen guten Appetit wünsche, möchte ich Ihnen kundtun, dass Ihre Spendenbereitschaft meine Erwartungen bei Weitem übertrifft. Für den Aufbau der Söldnerarmee kamen einmalig 60 Millionen US-Dollar zusammen. Das reicht zur Beschaffung auch modernster Waffen und technischer Infrastruktur aus. Ich danke Ihnen von Herzen und denke, das ist einen Applaus wert.“ Der Applaus war allerdings nicht so gewaltig, wie er es erwartete. Baron Adolf von Finck beugte sich zu seinem Nachbarn, Fürst Claus Aribert zu Oettingen, und mäkelte: „Warum haben wir uns nicht längst eine Privatarmee der Reichen geleistet. Dann hätte man sich die lahme Bundeswehr sparen können. Die darf ja noch nicht einmal auf die Bevölkerung schießen.“ Sein Tischnachbar wiegte das Haupt. „Na, wenigstens haben die vor einiger Zeit die Wehrpflicht abgeschafft. Bei der Bundeswehr wurden ja die späteren Revolutionäre ausgebildet.“ „Noch mehr bin ich entzückt über Ihre Bereitschaft, die Kampfkraft unserer Privatarmee aufrechterhalten zu wollen und dafür einen jährlichen Beitrag von 300 Millionen Dollar zu leisten. Dafür erhalten Sie eine hochmotivierte und bestens ausgebildete Söldnertruppe, die für Ihre Interessen kämpfen wird. Ich erhebe mein Glas und trinke auf Sie, auf Deutschland und die Nation. Und darauf, dass wir das Vaterland von diesen Terroristen, Banditen und Faschisten befreien werden.“ Der Kanzler hielt einen Augenblick inne. „Und nun, liebe Freunde, möchte ich ein Vorhaben ankündigen, über das Sie begeistert sein werden.“ Er machte eine effektvolle Pause „Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor längerer Zeit haben wir vor allem mit der Parole „Genug Demokratie. Jetzt“ offene Türen in Ihren Kreisen eingerannt. Nun halten wir die Zeit für gekommen, das auch endlich in einer Reform des Wahlrechts umzusetzen. Die Stimme eines jeden Wählers zählt gleich. Was für ein Unsinn! Die Menschen sind nicht gleich, sondern verschieden, nämlich verschieden fleißig oder faul, verschieden intelligent oder dumm, die einen erfolgreich, die anderen Verlierer. Und da soll jede Stimme gleich zählen? Hat der Arbeitslose, der Rentner oder der Tagelöhner so viel Einfluss und Beziehungen wie ein Mensch mit Vermögen? Sollte er deshalb nicht auch weniger Rechte als ein Wohlhabender ausüben dürfen? Viele von uns stellen Tausende von Arbeitsplätzen zur Verfügung, damit die Beschäftigten ihre Familien ernähren können. Für diese Verantwortung und die damit gezeigte barmherzige Gesinnung verdienen die Milliardäre doch wahrlich mehr politische Anerkennung. Außerdem verfügen die Einkommensmillionäre nicht nur über wirtschaftliche Kompetenzen, sondern sind auch, was ihre Intelligenz angeht, anderen Bevölkerungsgruppen weit überlegen. Deshalb haben wir beschlossen, in Kürze das Wahlrecht wie folgt zu ändern:
Lafontaine wird Terrorist. Lafontaine hatte die Ortsgruppen der PR in Jena, Weimar und Gera inspiziert und instruiert. Nun wollte er die alten Kontakte zu den Mafiagruppen wiederbeleben. Sein bevorzugter Gesprächspartner war Luigi Luciano, mit dem er sich immer sehr gut verstanden hatte und den er für den Gerissensten aller Mafiabosse hielt. Insgeheim dachte er daran, wie er die schöne Irina wiedersehen könnte. Ihr hatte er es doch zu danken, dass aus einem verklemmten Bürokraten ein Lüstling und Genießer geworden war. Luciano gab zu bedenken, seine Organisation habe gar nicht so viele Mitglieder, um neben dem alltäglichen Geschäft terroristische Aktionen durchzuführen. Bei Aktivitäten von beiderseitigem Interesse sei man gern bereit zu helfen. Mist, dachte Lafontaine, deren Geschäftsinteresse geht vor. Noch bedauerlicher ist, dass ich so eine Schönheit und wilde Frau wie Irina nie wieder genießen werde. Wo soll ich die denn finden, hier in der Provinz? In Berlin kann ich mich nicht mehr blicken lassen. Ob ich überhaupt noch einmal eine so aufregende Frau wie Irina erleben werde? Aber er sollte sich täuschen. Bei dem zweiten Treffen der Weimarer Ortsgruppe, die aus drei Aktivisten, einem weißhaarigen Herrn um die siebzig, einer Frau mit Kopftuch und einem schwarzbärtigen, jungen Mann bestand, sah Lafontaine auch eine Neue. Sie war etwa Anfang dreißig und betörte ihn geradezu. Ihr langes schwarzes Haar, der rosabraune Teint, die grünen Augen, mohnblütenrote Lippen und Fingernägel fesselten seine Aufmerksamkeit. Er konnte sein glühendes Interesse kaum verbergen, obwohl man von ihrer Figur kaum etwas ahnen konnte, denn sie trug ein sehr weites rostbraunes Leinenkleid. Seine intensiven Blicke parierend sagte sie, bevor Lafontaine etwas fragen konnte: „Ich bin zum ersten Mal dabei. Mein Vater hat mich überzeugt.“ Sie wies auf den Weißhaarigen. „Ich denke, wir Religiösen werden unterdrückt. In jedem Dorf sind christliche Kirchen, aber in nur wenigen Orten ist eine Moschee. Okay, Hindu- oder Buddhatempel findet man noch weniger. Aber was mich am meisten aufregt, sind diese an jeglicher Religion desinteressierten Bürger. Die tun so, als ob es ein Leben ohne Religion gäbe. Auch ein Mongole, Kenianer, Kubaner oder US-Bürger hat irgendeine Religion. Deshalb fordere ich religiöse Unterweisungen in den Religionen der Welt vom Kindergarten bis zum Abitur.“ Oh je, ist das eine rassige Frau, dachte Lafontaine. Er betraute sie und ihren Vater mit der Vorbereitung einer Demonstration auf dem Weimarer Marktplatz. „Ich werde Handzettel drucken lassen, die ihr vorher verteilen könnt. Transparente stelle ich ebenfalls zur Verfügung. Wenn ihr den Termin festgelegt habt, kommt euch ein erfahrener Aktivist aus Weimar unterstützen. Mit dem meldet ihr die Demonstration an, sorgt für ausreichend Ordner, was eben die Behörde so fordert.“ Was die wohl für Brüste hat, rätselte er, unter dem weiten Kleid kann man nichts erkennen. Aber die ist sicher so religiös, dass sie einen nur ranlässt, wenn man mit ihr verheiratet ist und ein Kind machen will. Die Frage des Bärtigen störte seine Phantasien. „Ne Demonstration ist ja ganz nett. Aber können wir nicht was Härteres machen? Hier gibt es einen Buchverlag namens Aufklärung. Der spuckt linke, kommunistische und antireligiöse Bücher aus. Ein Buch heißt sogar: Religion ist Opium für das Volk. Diese Bande sollte man ausräuchern.“ „Dann tut das doch.“ Lafontaine gab ihm eine Broschüre „Bau und Verwendung von Brandsätzen“ „Da steht auch drin, wie man keine Spuren hinterlässt und wie man die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gewinnt und Sympathisanten anlockt.“ Man verabredete ein weiteres Treffen in drei Tagen, das zusammen mit zwei Mitgliedern der NKP im Hinterzimmer der Gaststätte „Zum Deutschen Kaiser“ stattfinden sollte. Während der Fahrt in sein Hotel sinnierte er, ob die Schöne auf seine werbenden Blicke regieren werde. An die unauffällige Frau mit dem Kopftuch verschwendete er keinen Gedanken. Er fuhr das Auto in die Tiefgarage des Hotels. An der Rezeption füllte er den Meldezettel aus und nahm den Zimmerschlüssel in Empfang. Gerade wollte er sich auf den Weg zum Aufzug machen, als eine Frau mit Kopftuch und bodenlangem grauen Mantel in sein Blickfeld trat. Es war die Kopftuchfrau aus der Ortsgruppe. Bevor er sich fragen konnte, warum diese Frau aus Weimar in einem Hotel übernachtete, brachte er die geistreiche Frage an sie heraus, ob sie auch hier übernachte. Sie nickte. Ihre Augenbrauen waren dicht und dunkel, die Wimpern sehr lang, die Nasenflügel geschwungen und die Lippen voll und glänzend. Als sie einen kleinen Schritt vortrat, lugte unter dem langen Mantel ein schwarzer Lackschuh mit einem atemberaubend hohen Absatz hervor. Er trat an sie heran. „Ach, haben Sie Lust, an der Bar noch einen kleinen Drink zu nehmen? So in einer halben Stunde?“ Sie sah ihn an und nickte dann. „Ja, sehr gern. Ich möchte mich nur noch etwas frisch machen. In einer halben Stunde an der Bar.“ Der Aufzug hielt in der zweiten Etage. „Bis gleich.“ Rätselhaft, diese traditionellen Frauen, wunderte er sich. Vielleicht kriege ich sie heute noch ins Bett. Wunder gibt es ja. Er ging unter die Dusche und schlüpfte in frische Unterwäsche aus einem roten, durchsichtigen Seidengewebe. An der Bar hockten einige Männer, die wie Geschäftsreisende aussahen, zwei Pärchen, von denen das eine heftig turtelte und das andere sich gegenseitig anschwieg. Es gab auch Sessel und Sofas mit runden Tischchen, an denen sich drei attraktive Damen aus dem horizontalen Gewerbe räkelten. Lafontaine setzte sich auf einen Barhocker, die Füße auf einer quer verlaufenden Stange abgestützt. Auch die drei Damen flüsterten und trugen zu dem allgemeinen Geraune bei, als Lafontaines Verabredung in die Bar trat. Zwar trug sie wieder einen bodenlangen Mantel mit langen Ärmeln. Aber nun bestand der Mantel nicht aus grauer, grober Wolle, sondern aus weinroter Seide, die vorteilhaft über ihren Körper fiel. Das Kopftuch fehlte, das schwarze Haar fiel offen über die Schultern. Während sie auf den Barhocker hüpfte, lächelte sie ihn an. Dabei wurden ihre Beine in den transparenten, roten Strümpfen und die roten Pumps sichtbar. Aha, so kann man sich täuschen, dachte er. „Möchten Sie ebenfalls Champagner? Ich habe noch nichts bestellt, bin aber ganz scharf auf Champagner, habe schon lange keinen getrunken. Sie müssen mal in die Champagne fahren. Da können Sie bei den Winzern Jahrgangschampagner trinken, nicht so ein Einheitsgebräu wie hier.“ „Einverstanden, trinken wir bloß einen Veuve Cliquot und träumen dabei von richtigen Champagnern.“ Sie lächelte ihn wieder an. „Ich heiße Laila, Laila Özgün. Meine Mutter war Türkin, mein Vater war Syrer. Heute sind sie Deutsche und essen gern Eisbein mit Sauerkraut. Und wie ist dein Vorname, Herr Lafontaine?“ „Em, äh, Balthasar“, stotterte Lafontaine, denn Laila hatte seine rechte Hand genommen und sie auf ihre linke Brust gedrückt. Sie tranken einander zu. Im Nu waren die Gläser leer, der Kellner füllte nach, wohl wissend, die beiden würden nicht mehr lange bleiben. Den Rest in der Flasche würde er selbst aussaufen. In Lafontaines Hose begann es zu wachsen. Sie nahm seinen Kopf, drückte ihren Mund an sein Ohr und flüsterte: „Was glaubst du, trage ich unter dem Mantel?“ Ihr Atem und die Lippen kitzelten in seinem Ohr, er bekam einen Ständer. Schnell tranken sie das zweite Glas aus, und der Kellner freute sich über die halbe Flasche, die für ihn übrig blieb. Schon im Aufzug küssten sie sich, die Körper eng aneinander gepresst. Kaum in seinem Zimmer angekommen, zog sie den roten Mantel über den Kopf. Darunter trug sie einen schwarzen Büstenhalter und einen schwarzen Schlüpfer sowie die roten Strümpfe und Schuhe. Sie zerrte ihn auf das breite Bett. Er hatte kaum Zeit, sich zu entkleiden, da lag sie schon auf ihm „Zieh mir das Höschen aus“, flüsterte sie und reckte das Gesäß. Mit der rechten Hand zog er die Rückseite des Spitzenhöschens herab, die linke ergriff wie zufällig die Schamlippen und drückte sie aneinander. Laila seufzte, und ihre Säfte tropften auf seine Hand. „Jetzt öffne den BH, schnell!“ Den Schlüpfer hatte er entfernt, seine Hände nestelten den Verschluss des Büstenhalters auf. Feste, runde Kugeln mit einer steifen, braunrosa Warze warteten auf seine Hände. „Ach, dein Schwanz ist so schön steif. Den stecke ich mir jetzt hinein. Und rühre dich nicht, überhaupt nicht stoßen. Umso mehr hast du davon.“ Sie führte das Glied ganz langsam ein und presste den Unterleib auf ihn. Er packte die Brüste und quetschte sie. Beide Lippenpaare waren eins geworden. Nach einer guten Viertelstunde vollkommener Unbeweglichkeit aber kaum zu steigernder Lustgefühle stützte sie sich mit den Händen auf seine Brust und begann, das Becken zu heben und zu senken. Sein Glied glitt ein wenig heraus und bis zum Schaft wieder hinein. Solch ein Zyklus dauerte gut zehn Sekunden, für Lafontaine unerträglich langsam. Aber sie gab ihm keine Möglichkeit, schneller zu stoßen. Schließlich keuchte und röchelte sie, löste ihre Umklammerung und ließ ihn rammeln. Sie fiepte und grunzte hemmungslos bis zum finalen Stoß mit anschließender Überschwemmung. Nach einer Weile Erholung sagte sie: „So, jetzt fühle ich mich befriedigt. Du hast mich gerade zur richtigen Zeit getroffen. Wahrscheinlich hatte ich heute meinen Eisprung.“ Er sah sie entsetzt an. „Nein, nein, natürlich nehme ich die Pille. Es gibt halt Zeiten, da bin ich furchtbar geil.“ Erleichtert sank er wieder auf das Kissen. Das hätte ihm noch gefehlt: Eine Muslima geschwängert, das hieße Zwangsheirat mit Vier-Kinder-Pflicht. „So, mein Lieber, jetzt gehe ich auf mein Zimmer, mein Abendgebet ausüben. Wir sehen uns ja in drei Tagen wieder. Bis dahin kannst du überlegen, ob du lieber die attraktive Schönheit ficken willst oder mich, das Kopftuchmädchen.“ Geschwind war sie angekleidet und gab ihm einen Kuss auf seinen erschlafften Schwanz. Bevor sie die Zimmertür hinter sich schloss, gelang es ihm, einige „Äh“ von sich zu geben. Lafontaine war mehr als verwirrt. Er hatte sie noch fragen wollen, warum sie einen traditionellen anatolischen Mantel trug, wenn sie eine doch so westliche Einstellung habe. Während er vor sich hin grübelte, was für eine schnippische Antwort er bekommen hätte, fiel ihm die schöne Tochter des Weißhaarigen ein. Es würde schwierig sein, sich unter den Augen Lailas an sie heranzumachen. Er durfte den Zusammenhalt der Gruppe nicht gefährden. Frustriert schlief er endlich ein, im Traum verfolgt von eifersüchtigen Frauen und mit dem Messer bedroht von deren Brüdern, Vätern und Müttern. Zwei Wochen waren seit Lafontaines Besuchen in Thüringen vergangen, als den amtierenden Kanzler Bornheim kurz vor der Mittagpause die Nachricht erreichte, in mehreren Städten Thüringens seien Bomben- und Brandanschläge auf Büros der PDS, von Rosa-Luxemburg-Clubs und von einigen Gewerkschaften verübt worden. Er druckte die Liste mit den Schäden aus und rief seine kleine Regierungsmannschaft zusammen. „Jetzt ist geschehen, was meine Frau schon länger vorhergesagt hat. Die Rechtsradikalen haben sich formiert und üben sich in Terrorismus. Unsere Geheimdienste haben das wieder einmal nicht erkannt. Hier, seht euch die Liste an, die ist empörend.“ „Ich glaube, das ist nur der Anfang“, meldete sich Inge zu Wort. „Irgendjemand finanziert den großen Zusammenschluss von Rechtsextremen, die Rechten und der religiösen Strömungen zu einer Partei. Die wird es bei der kommenden Wahl noch nicht geben. Doch deren Aktive wollen den Ausgang der Wahl beeinflussen. Und zwar durch Angstpropaganda vor Migranten, vor dem Verlust von Arbeitsplätzen, vor dem sozialen Absturz, vor der Kriminalität, vor einem Krieg in Europa oder vor Terroristen. Alle diese Ängste sind da, wir sollten sie nicht negieren, sondern Antworten auf die Ängste finden.“ „Das sehe ich auch so“, äußerte sich Innenminister Eisner. „Was aber machen wir nun? Die Bevölkerung erwartet von uns, dass wir handeln, dass wir etwas tun, und sei es noch so sinnlos.“ Inge atmete tief durch. „Dann ruft doch einfach den nationalen Notstand aus. Die Wahlen werden um ein halbes oder ganzes Jahr verschoben. Das wird jeder verstehen. In der Zwischenzeit durchsucht die Polizei mit den Staatsanwaltschaften immer wieder die Büros der PR, der NKP und ihrer Ableger, mit dem Ziel, die Bürger dafür zu sensibilisieren, dass diese Leute kriminell sind.“ Am Abend in der Tagesschau verkündete der amtierende Kanzler, dass die Notstandsgesetze in Kraft getreten seien. Man werde auf dieser Basis mit aller Härte gegen Terroristen jeglicher Richtung vorgehen. Schon nach den Attentaten in Thüringen wurden dort nächtliche Ausgangssperren von 20 Uhr bis 4 Uhr verhängt. Nun bestand Inge darauf, die vor langer Zeit von den rechten Parteien verabschiedeten Notstandsgesetze anzuwenden, und zwar auf den gegenwärtigen Rechtsterrorismus. „Ihr versteht doch, was es heißt, wenn der Notstand erklärt wird?“ Zwar nickten ihr Mann und die Minister, aber Inge fühlte, sie hatten es nicht verstanden und fuhr fort. „Der Notstand wird durch den Kanzler festgestellt. Polizei, Grenzschutz und Armee werden dem Kanzler direkt unterstellt. Versammlungen werden verboten, die Parlamente werden aufgelöst, Wahlen werden verschoben.“ Am späten Nachmittag hatten sie Details der notwendigen Maßnahmen ausformuliert. Die Mittagpause hatten sie ausfallen lassen, aber es gab Kaffee und Kuchen um drei Uhr. Ein Problem bestand darin, dass die alten Notstandsgesetze und die zugehörigen Verordnungen auf den Kalten Krieg der 1960er Jahre zugeschnitten waren und nicht so einfach auf den Terrorismus der Rechten und Religiösen angewendet werden konnten. „Ich bin zwar nur Juristin. Aber das müssen wir flexibel sehen.“ Sie wollte noch Weiteres ausführen, aber da klopfte es an der Tür des Kanzlerbüros. Der Sekretär trat ein und reichte dem Kanzler eine zweiseitige Nachricht. Er verbeugte sich und verschwand lautlos. „Verdammt!“, rief Bornheim. „Im Ruhrgebiet sind fast hundert Anschläge verübt worden, überwiegend auf Kultureinrichtungen, Verlage, Parteibüros und Gewerkschaftshäuser. Überall sind Flugblätter eines Kommandos Che Guevara hinterlassen worden, offensichtlich, um Linken die Attentate in die Schuhe zu schieben.“ Er reichte die erste Seite weiter. „Ach, du großer Schreck. Jetzt auch in Sachsen und Bayern Hunderte von Brandstiftungen, zwei Mordanschläge auf linke Politiker. Ob denen etwas passiert ist, steht hier nicht.“ Seite zwei wanderte durch die kleine Gruppe. „Dahinter steckt wohl die Partei der Religiösen des Pastor Schleich, die offensichtlich muslimische Fanatiker und andere Fundamentalisten für sich gewinnen konnte, aber wahrscheinlich auch die Nationalkapitalistische Partei, die im Geld schwimmt und mächtigen Zulauf aus nationalistischen Kreisen erlebt“, dozierte Inge. „Oder habt ihr eine andere Erklärung? Oder gar der Militärische Geheimdienst?“ Dessen Chef, Innenminister Eisner, duckte sich weg. Irgendwann werde ich der Ziege das heimzahlen. Verteidigungsminister Baudissin schlug vor, das Militär überall sichtbar werden zu lassen. „Das zeigt der Bevölkerung, der Staat ist präsent und greift ein, auch mit Waffengewalt. Es muss ja nicht vor jedem Verlag ein Panzer stehen. Ein Posten mit Maschinengewehr genügt auch. In den Stadtzentren stehen Soldaten mit Sturmgewehren“ – „aber nicht die von Heckler und Koch“ – „nein, das ist reine Symbolpolitik, dient aber der Beruhigung der Menschen und der Abschreckung.“ „Das klingt herrlich martialisch und mag zur Abschreckung beitragen. Aber wenn Irre die Taten planen und ausführen, bringt das nichts. Sie lassen sich gern erschießen oder sprengen sich selbst in die Luft. Wir müssen überlegen, wie man den religiösen Fanatismus austrocknet. Das geht weder durch Bestrafung noch durch militärische Präsenz, sondern nur durch demokratische Gehirnwäsche. Ich meine damit nicht, dass man die Medien aller Art zensieren sollte, vielleicht nur ein wenig, sondern wir müssen die Stammtische, Vereine und Nachbarschaften erobern. Ich weiß, das dauert Jahre. Aber nur so lässt sich der braun-religiöse Sumpf austrocknen. Wir haben es uns viel zu lange nicht vorstellen können, dass sich die Rechtsradikalen eines Tages mit den religiösen Fundamentalisten vereinigen könnten.“ Balthasar Lafontaine war sehr zufrieden mit sich. Die Attentate in Thüringen und Sachsen hatten wie geplant funktioniert. Die Mannschaft war jetzt motiviert, auch politische Morde zu begehen. Mindestens drei Mal täglich tauschte er sich mit Pfarrer Helmut Schleich aus, natürlich nur von öffentlichen Telefonen aus, damit man ihn nicht orten konnte, jedenfalls nur sehr langsam. Sie verständigten sich mit Hilfe belangloser Floskeln, mit denen ein Dritter nichts anfangen konnte. „Das war doch hervorragend, wie du die Würste in Thüringen und Sachsen verkaufst hast.“ „Danke Chef. Wie verläuft der Verkauf in Bayern und Baden-Württemberg?“ „Nun, mein Sohn, das ist ein schwieriges Kapitel. Katholische Kirche und Traditionen, die wirken wie eine Spaßbremse. Du verstehst?“ „Gewiss, gewiss. Morgen werde ich nach Köln und Düsseldorf reisen. Da fehlen uns noch Kampagnenmanager.“ „Sehr gut, dieses Gebiet haben wir noch nicht ausreichend beackert.“ Schleich wusste, dass sein Telefon rund um die Uhr abgehört wurde. Er hatte sich daran gewöhnt, derartig verschlüsselt zu sprechen. Das Komische war, seine jeweiligen Gesprächspartner verstanden ihn durchaus, ohne dass eine Wort-für-Wort-Entschlüsselung notwendig war. Nur die Geheimdienstbeamten konnten mit dem Gespräch nichts anfangen. Deshalb war die Regierung auch nicht gewarnt worden, als die Bomben- und Brandanschläge auf Süddeutschland ausgeweitet wurden. Im Terminal 2 des Münchener Flughafens starben mehr als zweihundert Reisende und Angestellte. Die große Halle des Münchener Hauptbahnhofes war ohne Dach, sämtliche Verkaufsbuchten waren ausgebrannt, und man zählte etwa siebzig Tote und Hunderte von Schwerverletzten. Nur einen Tag später wurden in den Toiletten zweier Großbuchhandlungen in Stuttgart verheerende Brandsätze gezündet. Die Feuerwehr vermutete, dass den Brandsätzen Magnesium- oder Aluminiumpulver beigemischt wurde. Es gab zwar keine Schwerverletzten, aber die Gebäude sind zum Abriss verurteilt. Aus Mannheim wurde berichtet, vier Vermummte seien in das Gebäude eines Verlages für sozialistische Literatur eingedrungen und hätten alle Mitarbeiter erschossen. Anschließend steckten sie das Haus in Brand. Auf einem verlassenen Campingplatz bei Würzburg berieten sich Schleich und Lafontaine über das weitere Vorgehen. „Mit den Anschlägen haben wir erst einmal unsere rechtsradikalen Anhänger, die Feinde von Demokratie und Aufklärung, die religiösen Fundamentalisten und die hasserfüllten gesellschaftlichen Randgruppen erfreut. Dass wir diese alle unter einen Hut bringen konnten, ist schon erstaunlich“, wunderte sich Pastor Schleich. „Was konntest du im Rheinland erreichen? Haben sich die radikalen islamischen Gruppen mit den Fundamentalkatholiken einigen können? Und die Rechtsextremen machen da mit?“ Lafontaine seufzte. „Leider nicht. Jede Gruppe wurstelt für sich. Zu einer Zusammenarbeit mit anderen müssten sie ja Kompromisse eingehen. Dazu sind sie nicht bereit. Der fundamentalistische Erzbischof der Katholiken redet seit Jahren nicht mit seinen evangelischen und muslimischen Kollegen. In Köln hat sich eine neofaschistische „Grupo Mussolini“ gebildet, aber die wird von den anderen Rechtsradikalen und Hooligans bekämpft. Warum, das habe ich nicht verstanden.“ „Seltsam“, murmelte der Pastor. „Die Bornheims stammen ja aus Köln. Könnte es sein, dass die dort einen Spaltpilz gesät haben? Wie kriegen wir das heraus? Sollen wir mal einen gemeinsamen Auftritt in der Szene wagen?“ „Nein, das ist viel zu gefährlich. Darauf wartet der Militärgeheimdienst nur. Ich denke, wir sollten in weiteren Städten Anschläge verüben lassen, vor allem aber prominente Anhänger der jetzigen Regierung ermorden. Also, ermorden lassen, durch unsere Kampfgruppen. An die Minister oder an den Kanzler kommen wir nicht ran.“ „Wer weiß. Ich könnte mir durchaus vorstellen, wie man den bei einer Wahlveranstaltung erschießen könnte.“ „Die Wahlen werden wohl abgesagt werden. Aber der Bornheim muss sich als Kanzler auch mal lebendig zeigen, nicht nur im Fernsehen. Und da müssen wir zustoßen.“ Es wurde langsam dämmrig. Sie verabschiedeten sich, um nicht im Dunkeln überrascht zu werden. „Wir werden diese Aktion Pizza Chef nennen. Übrigens starb jeder zehnte Regierungschef, König oder Diktator nicht eines natürlichen Todes, sondern wurde ermordet, von Verwandten, politischen Konkurrenten oder beauftragten Gangstern. Was wir tun werden, hat also eine historische Tradition.“ Mannomann, worauf habe ich mich da eingelassen, sinnierte Lafontaine. Wenn er erwischt würde, hätte er mit seiner sofortigen Erschießung zu rechnen. Aber jetzt war es zu spät, um auszusteigen. Nicht nur Schleich, sondern mindestens zwanzig Aktivisten kannten ihn, würden ihm die Verantwortung zuschieben und gegen ihn aussagen, wenn sie verhaftet würden. Er musste also weitermachen und auf Sieg setzen. Er zog sich in sein Zimmer in einem unauffälligen Hotel in Hanau zurück und skizzierte, wie man Bornheim „erledigen“ könnte. Am Tag des Attentats auf den Münchener Flughafen saßen die Mitglieder der Regierung beim Kaffee zusammen. Inge Bornheim war nicht dabei, sie sprach auf einer Veranstaltung ihrer neuen Partei „Freiheit, Solidarität, Zukunft“. Karl-Friedrich hatte also freie Hand, Sofortmaßnahmen zu beschließen. Schon zwei Stunden später befanden sich an allen wichtigen Einkaufszentren, Schulen, Bahnhöfen, Flughäfen und großen Unternehmen Soldaten mit Maschinengewehren. Gleichzeitig wurden die Notstandsgesetze in Kraft gesetzt. Alle Wahlen wurden um ein Jahr verschoben. Vor jedem Parteibüro, vor jeder Redaktion, jedem Gewerkschaftshaus, Verlagsgebäude und gefährdeten Verein sollten Doppelposten von Soldaten patrouillieren. Ein geheimer Befehl sprach von einem „Bürgerkrieg Regierung gegen Terroristen“ und „Wer zuerst schießt, der überlebt“ Nachdem am folgenden Tag trotz der einschneidenden Maßnahmen wieder mehr als hundert Sprengstoffanschläge in einigen Großstädten geschehen waren, entschied der Kanzler, man solle an alle Gefährdeten kugelsichere Westen, Stahlhelme, Waffen und Munition austeilen. Die Armee solle die Betroffenen im Selbstschutz und Gebrauch der Waffen ausbilden, und zwar binnen einer Woche. Bedenken des Verteidigungsministers, in so kurzer Zeit wäre keine Ausbildung möglich, wischte Bornheim vom Tisch. „Uns bleibt keine Zeit. Wir müssen schneller sein als die. Was wir hier machen, ist pure Notwehr. Die müssen ja Tausende von Aktivisten in ihren Reihen haben. Dagegen kommen wir mit regulären Mitteln nicht an, weder mit Polizei, noch mit Armee oder Geheimdienst. Wir müssen sie aus der Deckung locken. Ob wir dann den Bürgerkrieg gewinnen werden, weiß ich nicht.“ Seine Minister seufzten. „Ihr müsst euch doch klarmachen, dass seit mindestens zwanzig Jahren kein Dialog mehr zwischen Rechts und Links, Oben und Unten, Grün, Braun, Rot, Schwarz und Gelb stattgefunden hat. Eine Kultur des Dialogs gibt es nicht mehr. Man brüllt sich an, schreit Hassparolen und geifert mit giftiger Hetze gegen Andersdenkende. Das ist die Voraussetzung für einen Bürgerkrieg. Eigentlich wundert es mich, dass der Bürgerkrieg nicht schon vor zehn Jahren ausgebrochen ist. Damals konnte jeder Idiot seine Parolen im Internet verbreiten. Schnell wurde die Kultur der Blödiane der Maßstab, an dem sich weitere Dumpfbacken orientierten, mit dem Resultat, dass primitivste Empfindungen Normcharakter bekamen. Für mich ist jetzt der Zeitpunkt für einen Stopp, bis hierher, aber nicht weiter!, gekommen. Ab sofort müssen anonyme Meinungsbekundungen im Internet grundsätzlich und automatisch gelöscht werden. Wer seine Meinung sagt, soll auch mit seinem Namen dafür bürgen und dahinterstehen. Systeme und Plattformen, die anonyme Meinungsäußerungen ermöglichen, werden verboten. Morgen werde ich dazu eine Verordnung erlassen. Ich hoffe, ihr seid einverstanden.“ Alle nickten. „Zurück zu den Gefahren für unser Land: Wir haben noch einige kleine Gruppen marodierender Marinesoldaten, dann Mafiagruppen in den Großstädten und drittens mindestens hundert Zellen gewaltbereiter Religiöser oder Rechtsradikaler. Wir werden uns erst im Sessel zurücklehnen, wenn diese Gefahren nicht mehr bestehen.“ Auf Wunsch von Pfarrer Schleich waren in einem Dresdener Vorort verschiedene Gruppen in einer Arbeiterwohnung zusammengekommen. Etwa zwanzig Personen hatten auf den Klappstühlen Platz genommen. Der Inhaber der Wohnung fühlte sich sehr geehrt, als der Pfarrer ihm voll des Lobes dankte. „Uns ist es gelungen, nicht nur die Gruppe Mein neuer Kampf, die Gruppe Recht und Deutsche Freiheit, die Gruppe Religiöse Fundamentalisten und die Gruppe Nation und Volk zu diesem Treffen einzuladen, sondern auch erstmalig die Gruppen Religionskampf und Gottes Krieger. Darüber freuen wir uns sehr. Eine gemeinsame Plattform ist einfach unerlässlich, wenn man Erfolg haben will in der Politik. Ihr wisst selber, dass beeindruckende Mitgliederzahlen gar nichts aussagen. Wie viele davon sind überhaupt aktiv? Wie viele davon würden ihr Leben aufs Spiel setzen, um ihre Ziele zu erreichen? Deshalb wollen wir uns nur an unseren Taten messen, wie viele Politiker umgebracht, wie viele Theater gesprengt wurden. Das ist es, was zählt.“ Er machte eine Pause, jemand gab ihm einen Stapel Papier. „Aha. Die Liga für Zucht und Ordnung, die hier heute nicht vertreten ist, macht hier einige Vorschläge für Reformen. Ihr gestattet, dass ich das mal vorlese.“ Er trank einen Schluck Wasser „Also, die Liga für Zucht und Ordnung beschreibt in der Einleitung die jetzigen Zustände, die verkommene Moral und den schlappen Staat. Das sehen wir auch so, und deshalb lese ich euch die vier Seiten nicht vor. Interessant sind deren Vorschläge. Das Konzept ist, Wahlen langfristig abzuschaffen und durch das Führerprinzip zu ersetzen. Gerichte werden durch die Führer ernannt. Es werden nur nationale und religiöse Parteien zugelassen. Zunächst sollen Wahlen alle zehn Jahre und mit einer 10 %-Klausel stattfinden. Alle Medien unterstehen der Regierung. Bis hierhin seid ihr sicher einverstanden.“ Schleich kam nun auf die Vorschläge zum Strafrecht zu sprechen. „Ich lese weiter vor, was schwere Strafen verdient, wenn wir die Macht ergreifen. Und das wird bald sein, das wird keine vier Wochen mehr dauern. Das verspreche ich euch.“ Die Versammlungsteilnehmer johlten. Der Wohnungsmieter war ein wenig besorgt, die Nachbarn könnten Anstoß an dem Lärm nehmen „Also, Leute, was wird künftig schwer bestraft:
Leute, da finden wir immer etwas. Und wie soll das bestraft werden? Sicher, mit der Todesstrafe. Dafür sind wir schon lange. Aber hier gibt es eine Liste, wie das geschehen soll:
Unterhalb der Todesstrafe werden gefordert:
Die Rache des Pastor Schleich. Im von Potsdam weit entfernten Duisburg hatten Pfarrer Schleich und die Hubschrauberinsassen ihren Unterschlupf im Stadtwald verlassen und bezogen nun ihre Zimmer in einer kleinen Pension in Mülheim-Speldorf. Als sie am Abend nach den Nachrichten die Rede zur Nation sehen und hören mussten, platzte Schleich der Kragen. Mit hochrotem Gesicht bellte er los: „Diese Fotze, die klaut uns alle Begriffe und dreht deren Bedeutung um. Die macht uns lächerlich. Die werde ich persönlich umbringen.“ Er beruhigte sich nur langsam. „Wir müssen unverzüglich losschlagen, also die Kaserne in Potsdam stürmen und die Notstandsregierung liquidieren. Der Rest der Armee wird uns dann schon folgen. Offiziere kennen nur Gehorsam, und zwar dem jeweils Herrschenden. Selber zu denken, wurde denen ja abtrainiert.“ Er konnte zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, dass Polizei und Armee begonnen hatten, sämtliche Wohnungen in verdächtigen Vierteln nach Waffen, Sprengstoff, Propagandamaterial und Kämpfern zu durchsuchen. Um den Attacken und Überwachungsmaßnahmen der Geheimdienste wenigstens kurzfristig zu entgehen, hatte Schleich die Umbenennung der zahlreichen nationalistischen und radikalreligiösen Gruppen in „Heilsfront XYZ“ befohlen. Für XYZ konnte jede Gruppe eine eigene Parole einsetzen, jedoch keine Ortsnamen. Er beauftragte seine vier Begleiter, den Befehl zu Plan C zu verbreiten. Im Falle des Plans C sollten sogenannte Wutbürger von Berlin nach Potsdam marschieren und unterwegs alles niederwalzen, wenn sich Widerstand regte. Außerdem sollten sie die Kader in Berlin kontaktieren, die dort die Revolution auszulösen hatten. Die vier Begleiter nahmen sich am frühen Morgen einen Mietwagen, um nach Berlin zu fahren. Schleich, nach dem Polizei und Geheimdienste fahndeten, er selbst musste andere Wege wählen, um unerkannt nach Potsdam zu gelangen. Dafür eignete sich das System der Kuriere hervorragend. Auf diese, für ihn risikoarme Weise erreichte er am frühen Abend Potsdam und übernachtete bei der Familie eines seiner Kuriere. In dessen Gartenlaube trafen sich um neun Uhr die wichtigsten Anführer der religiösen, völkischen und nationalen Gruppen. Es flossen reichlich Bier und Schnaps, nachdem man beredet hatte, welche Gruppen wann was zu machen hatten. Am besten gefiel Schleich der Anführer der Gruppe „Ein Volk, ein Reich, ein Gott“ Dieser Kerl war an Unterarmen und am Hals mit grausamen Motiven tätowiert und trug ein Hemd mit der Aufschrift „Einer führt, die anderen folgen“ „Der Spruch gefällt mir, obwohl darüber noch stehen müsste „Heilsfront“, wie ich es kürzlich befohlen habe.“ „Zu Befehl, mein Führer. Das wird sofort morgen geändert.“ Er war aufgesprungen und hatte die Hacken zusammengeknallt. „Setz dich wieder, ist schon in Ordnung, wenn du das morgen in Ordnung bringst. Sieh dir das Hemd deines Kollegen Abdeslam an. Der hat das richtig bedruckt: Heilsfront Boko Haram.“ Schleich erhob sich. Sofort wurde es still „Jeder von uns schätzt und achtet diejenigen Kameraden, die keinen Alkohol anrühren wollen, die den Frauen nicht die Hand geben, Menschen anderer Meinung am liebsten umbringen möchten oder westlichen Politikern und Journalisten grundsätzlich nichts glauben. Ich sage euch, das bisschen, was uns trennt, eint uns umso mehr, weil wir ein gemeinsames Ziel haben. Wir haben uns zusammengerauft und schließlich vereint, weil wir dieses System hinwegfegen wollen. Wir werden die von den Konzernen bezahlten Politiker und Beamten verhaften und umerziehen. Wir werden die Konzerne zerschlagen in mittlere Betriebe. Die Banken werden verstaatlicht. An den Schulen werden wieder Sitte und Gehorsam, nationale und patriotische Gesinnung und gesundes Volksempfinden einziehen. Wer religiöse Empfindungen verletzt, gehört ins Gefängnis. Religion muss im Alltag wieder sichtbar sein. Geschichte muss als nationale Größe erfahrbar sein. Aber wir sind auch stolz auf unsere religiöse, ethnische und sprachliche Vielfalt. Unsere Heilsfront hat muslimische, katholische, evangelische und jüdische Fundamentalisten zusammengeführt, hat feurige Kurden, Türken, Russen, Syrer, Iraker und Serben unter ein Dach gebracht und Neofaschisten jeder Herkunft aufgenommen. Da muss ich mich mal selber loben.“ Die Kameraden ließen sich durch seine Rede anfeuern, sie sprangen auf, klatschten und johlten begeistert. Schleich wollte schon zur Ruhe aufrufen. Aber der Besitzer der Gartenlaube versicherte ihm, das Häuschen sei gut schallisoliert und man könne draußen nichts hören. „Liebe Kameraden, in drei Tagen wird ein Marsch von Tausenden von Berlin aus zu der Armeekaserne in Potsdam starten. Die Volksmassen werden friedlich losgehen. Aber vor der Kaserne angekommen, wo die sogenannte Regierung haust, wird die Demonstration gewalttätig werden. Die Militärpolizei wird sich gezwungen sehen zu schießen. Das werden unsere verdeckt unter den Demonstranten mitlaufenden Aktivisten zum Anlass nehmen, ihre Waffen einzusetzen. Unsere Leute verteilen dann Pistolen und Gewehre an die Demonstranten. Nun beginnt der Sturm auf die Tore. Zehn Minuten später haben wir diese Volksverräterin und ihre Minister gefangen genommen. Nach weiteren zehn Minuten verkünden wir, dass die Heilsfront die Macht in Deutschland übernommen hat.“ Jubel brauste auf. Aber Schleich dachte auch an das Danach. Würde es ihm gelingen, die so unterschiedlichen Bündnispartner zusammenzuhalten? Wenn nicht, drohte dann ein erneuter Bürgerkrieg? Er hatte sich entschieden, einen autoritären, einen Polizei- und Geheimdienststaat zu errichten, und später seine Mitstreiter und möglichen Konkurrenten nach und nach auszuschalten, durch tragische Unfälle, schwere Krankheiten oder Morde aus Eifersucht. „Liebe Kameraden, ich bin glücklich, dass ihr so begeistert über unsere bevorstehende Machtübernahme seid. Begeisterung ist sehr wichtig, aber Disziplin ebenso. Ungeordnete Horden ohne strikten Zeitplan können niemals eine große Kaserne stürmen, zumal dort noch die Regierung verschanzt ist. Ich mahne also Disziplin an. In ein paar Tagen werden wir die Regierung sein. Ich werde bei dem Überfall auf die Kaserne in vorderster Front dabei sein.“ Es wurde noch viel gesoffen, Parolen wurden gebrüllt, und Verbrüderungen fanden statt. Das kleine Gartenhaus war zwar schallisoliert, aber auch vom Militärgeheimdienst verwanzt. Deshalb war es nur für die Gäste im Gartenhaus verwunderlich, dass um etwa elf Uhr das Grundstück von Leuten des Geheimdienstes umzingelt war. Doch es dauerte bis um halb zwölf, einige Aktivisten der Heilsfront hatten sich auf den Nachhauseweg begeben, als Gartenhaus, Wohnhaus und Garten mit grellem Licht überflutet wurden. Eine Lautsprecherstimme forderte die Versammelten auf, mit erhobenen Händen herauszukommen, keinen Widerstand zu leisten und sich festnehmen zu lassen. „Ich gebe Ihnen zehn Sekunden Zeit. Wenn Sie diese Zeit verstreichen lassen, werden wir Gewalt anwenden.“ Unmittelbar nach diesem Aufruf öffnete sich die Tür des Gartenhauses. Eine qualmende Rauchbombe wurde herausgeworfen. Sogleich vernebelte der weißliche Rauch die Sicht. Der Einsatzleiter gab das Zeichen zum Angriff. Schüsse fielen, es gab einen Toten und drei Verletzte. Wenig später befanden sich Schleich und seine Kämpfer in einem Bus ohne Fenster. Man teilte ihnen über das Fahrtziel nichts mit. Sie konnten auch nichts von außen hören. Der Fahrer und sein Begleiter saßen in einer sprengstoffsicheren Kabine und somit unerreichbar für Angreifer von außen. Nach einer guten Stunde Fahrt erreichte der Bus das Tor eines stillgelegten, aber gut bewachten Kernkraftwerkes. Als sich das Tor hinter dem Bus geschlossen hatte, kehrten die vier Begleitfahrzeuge und die beiden Hubschrauber nach Potsdam zurück. Die Wachmannschaften des Kraftwerkes wurden noch am Abend durch eine Einheit des Militärgeheimdienstes ersetzt. Die Gefangenen mussten in einem unterirdischen Bunker auf Feldbetten übernachten. Dort würden sie am nächsten Morgen von Spezialisten verhört, hatte der Einsatzleiter entschieden. Noch während der Rückfahrt sendete er einen Bericht an die Vorsitzende der Notstandsregierung. Frau Doktor Bornheim dankte ihm herzlich. Es sei überlebenswichtig, die Pläne der Terroristen aufzudecken. Bornheim und die Geheimdienstleute konnten nicht wissen, dass Pfarrer Schleich noch im Gartenhaus einen verschlüsselten Notruf mit Hilfe eines Minisenders abgesandt hatte. Anschließend verschwand der Sender in seinem Magen. Für den Fall, dass er oder seine Gruppenführer verhaftet oder getötet würden, gab es einen Plan B. Um nicht zu abhängig von den Gruppenführern zu werden, hatte Schleich für jeden einen Stellvertreter ernannt, damit dieser im Notfall sofort zur Verfügung stand, aber auch um unbotmäßige Gruppenführer schnell absetzen zu können. Als er am nächsten Morgen auf dem Feldbett erwachte, schmerzten seine Glieder. Es war kühl gewesen, und man hatte ihnen keine Decken gegeben. Trotzdem lächelte er und stellte sich vor, wie in zwei Tagen die Demonstration vor der Kaserne in Potsdam als Staatsstreich endete. Pünktlich um acht Uhr begannen die Verhöre. Den Agenten war strikt verboten worden, die Gefangenen zu foltern. Sie bekamen jedoch nichts zu trinken, nichts zu essen, durften aber ihre Notdurft verrichten. Nach ein, zwei Tagen ununterbrochenen Verhörs würde ihre Widerstandskraft gebrochen sein und man würde „die Wahrheit“ von ihnen erzwingen. Doch auch nach zwei Verhörtagen und Schlafentzug waren die Ergebnisse mehr als dürftig. Dann bekamen sie etwas zu essen und zu trinken. Aber auch diese Gunst führte zu nichts. Schleich lächelte viel. Am Abend des dritten Tages nach der Verhaftung von Schleich und seinen Gruppenführern wies Inge Bornheim den Innenminister an, die Gefangenen dauerhaft einzubunkern und sie mit Lebensmitteln, Wasser und Decken zu versorgen, damit sie für dreißig Tage sich selbst versorgen könnten. Falls sie in dieser Zeit von den Gangstern der „Heilsfront“ gefangen genommen würde, hätte sie etwas Verhandlungsmasse in der Hand. Es wird sich zeigen, dass dies eine Fehleinschätzung war. Gegen Mittag teilte man ihr mit, dass sich mehrere Demonstrationszüge von Berlin nach Potsdam bewegten. Die Teilnehmerzahl würde insgesamt auf vierzig- bis sechszigtausend geschätzt. Bisher machte die Demonstration einen wohlorganisierten und disziplinierten Eindruck. Allerdings gäben die mitgeführten Plakate und Transparente zu erheblichen Bedenken Anlass: „Sturz des Regimes der Ungläubigen“ „Ein Volk, ein Reich, ein Gott“ „Nationale Ehre statt Landesverrat“ „An den Galgen mit den Lügnern“ „Religionspolizei statt Lügenpresse“ Sehr aufschlussreich schien es den Beobachtern, dass hinter dem Transparent „Ausländer raus“ überwiegend Zuwanderer aus anderen Kontinenten marschierten. Besonders schockiert war Inge über den hohen Anteil an jungen Menschen, die den fragwürdigen Parolen nachliefen „Die Bornheim aufs Schafott“ oder „Inge, dir geb ich die Klinge“, solche Sprüche empfand sie als harmlos und tat sie mit einem Schulterzucken ab. „Idioten wird es immer geben.“ Sie beauftragte Innenminister Kurt Eisner, Hubschrauber und Drohnen zur Überwachung der Demonstrationszüge einzusetzen. „Ist schon geschehen.“ „Prima.“ Der Verteidigungsminister musste hinter den Zäunen, Mauern und Toren der riesigen Kaserne Maschinengewehre hinter Sandsäcken aufstellen lassen. Auf den Dächern waren Scharfschützen postiert. Für die Soldaten war es Pflicht, Gasmasken mitzunehmen. Die Umgebung von Potsdam sollte durch Jagdbomber überwacht werden. An jeder Straßenkreuzung außerhalb von Potsdam sollten Soldaten im Schutz von Panzern den Verkehr lenken, um das Einsickern von bewaffneten Kämpfern zu verhindern. Sozialminister von Thane bekam den Auftrag, Agenten in die marschierenden Massen einzuschleusen. Sie sollten widersprüchliche und zersetzende Parolen durch Flüsterpropaganda verbreiten. „Ich verstehe. Früher haben wir das Scheißhausparolen genannt.“ Er machte sich mit seinen Mitarbeitern sofort an die Arbeit. Nach wenigen Augenblicken konnte Inge die Parolen bewundern. „Der Schleich ist in Wirklich kein christlicher Pfarrer, sondern jüdischer Rabbiner.“ „Die Heilsfront besteht fast nur aus Islamisten.“ „Die Gruppenführer sind fast alle Russen.“ „Bei dieser Demonstration sind fast keine Arier.“ „Nach der Demonstration werden alle Nicht-Christen erschossen.“ „In Wirklichkeit ist das eine Aktion der Katholischen Kirche.“ Inge zeigte sich einverstanden, doch sie verspürte eine gewisse Übelkeit. Schon früher hatte sie vergeblich gegen derartige Hetze gekämpft. Damals konnte jeder hasserfüllte Idiot oder halbe Analphabet seine Meinung im Internet verbreiten. War das Demokratie? Oder Mitbestimmung des Volkes? Mittlerweile hatten sich die Agenten des Sozialministers unter die Demonstranten gemischt und streuten fleißig ihre perfiden Parolen unter die Marschierenden. Sie kamen an der westlichen Stadtgrenze Berlins an. Es gab einen kurzen Halt, weil sich die Anführer der vielen religiösen, nationalen und rechtsextremen Gruppen nicht einigen konnten, wer den Oberbefehl übernehmen sollte. Das gelang umso schlechter, nachdem die Agenten des Sozialministeriums die Parole verkündet hatten, Schleich habe sich in ein sicheres Land abgesetzt. So kamen sie überein, jede halbe Stunde solle ein anderer den Marsch anführen. Zuerst käme Imre Orban an die Reihe, auf ihn solle Witold Kaczynski folgen. Danach werde man weitersehen. Aber es war klar, dass dann zwei Islamisten dran wären. Es fehlten eben die integrierende Kraft Schleichs und die Intelligenz von Lafontaine. In der Viertelstunde, die der Halt währte, gelang es den Agenten, die Stimmung mit weiteren ungeheuerlichen Parolen zu vergiften: „Die Armee hat den Einsatz von Giftgas im Plan.“ „Hinter der Heilsfront steckt in Wahrheit der Geheimdienst.“ „Warum wurde der Marsch eine Viertelstunde angehalten? Von wem?“ Als es unter der Führung Orbans endlich weiterging, zeigten sich schon erste Zersetzungserscheinungen. Während die Demonstranten bis zur Pause unabhängig von ihrer Gesinnung gemischt marschiert waren, suchten sie nun die heimelige Nähe ihrer Gruppen, deren Anführer diese Veränderung begrüßten, verlieh sie ihnen doch mehr Macht und Einfluss. Nach einer halben Stunde sollte es eigentlich zu dem vereinbarten Führungswechsel kommen. Doch eine Schar von wütenden Anhängern der „Frommen Sadisten“ hatte sich an die Spitze des Demonstrationszuges gesetzt und forderte unbedingten Gehorsam von allen anderen Gruppen. Die unvermeidliche Schlägerei konnte nur dadurch beendet werden, dass die von allen Gruppen gestellten Ordner mit ihren Gummiknüppeln auf die Köpfe der Rebellen einschlugen, bis sie schwiegen „Die setzen Gummiknüppel gegen uns ein“, raunte es bald in der Menge. „Wer sind die in Wirklichkeit?“ Einer der Agenten flüsterte einen Lagebericht in sein verstecktes Mikrofon. „Unsere Parolen wirken bereits. In einer guten Stunde sind wir vor der Kaserne. Bis dahin haben die sich zerstritten oder viele Demonstranten kehren nach Berlin zurück.“ Der Sozialminister meldete es umgehend an Inge. Sie stellte eine Verbindung zu den anderen Ministern her. „Auf jeden Fall haben wir noch eine Stunde Zeit. Die verbleibenden Demonstranten müssen eingekesselt werden. Sie sind in Internierungslager zu bringen und dort einzeln zu verhören, damit wir die Rädelsführer herausfischen können. Den Befehl zur Gewaltanwendung gebe allein ich, ist das klar? Bitte, bestätigen Sie mir das!“ Umgehend kamen die Bestätigungen. „Gut, jetzt begebe ich mich in die oberste Etage unseres Hochhauses, um mir einen Überblick zu verschaffen. Herr Baudissin wird mich begleiten.“ Die beiden wechselten in das Hochhaus und fuhren in die zehnte Etage. Von dem nach Nordosten ausgerichteten Eckzimmer ließen sich alle an der Kaserne vorbeiführenden Straßen beobachten. In mehreren Wohngebäuden um die Kaserne, weniger als hundert Meter entfernt, hatten sich insgesamt gut hundert Kämpfer der Heilsfront eingenistet, teils in kurzfristig gemieteten Wohnungen, teils in Kellerräumen, vor denen Schilder „Betreten verboten, Gefahr“ angebracht waren. Sie waren hervorragend bewaffnet: Schnellfeuergewehre, Panzerabwehrraketen, Boden-Luft-Raketen, Handgranaten, Plastiksprengstoff, Blendgranaten. Diese Kämpfer hatten ihre Erfahrungen gesammelt in den diversen Kriegen zwischen der Türkei und Griechenland, zwischen Serbien und Ungarn, zwischen Polen und Weißrussland und zwischen Belgien und den Niederlanden. Sie kannten weder Furcht noch Skrupel oder das Völkerrecht und die Genfer Konvention. Von der Existenz dieser Spezialeinheit wusste nur Schleich. Er hatte auch die Waffen besorgt und die Strategie erarbeitet. Sie waren ihm blind ergeben, auch ohne seine Präsenz. Sie hatten den Befehl, sich dann auf die Straße zu begeben und sich unter die Demonstranten zu mischen, wenn die Menge vor der Kaserne dicht genug und zusammengedrängt war, also ohne Gefahr, von oben entdeckt zu werden. Die Demonstranten sollten ihnen als Schutz dienen, wenn sie aus der Menge heraus die Kaserne beschossen. Einige von ihnen trugen Stirnkameras, um die Reaktionen des Gegners zu filmen und um später daraus Propagandamaterial zu gewinnen. Am frühen Nachmittag erreichten die ersten Marschkolonnen den Potsdamer Bahnhofsvorplatz, fast eine Stunde hinter dem Plan, weil es wieder Auseinandersetzungen zwischen den ideologischen Gruppen gegeben hatte. Nun führte die Heilsfront „Glaube und Nation“ die Massen an. Gegen den wütenden Protest der anderen Gruppen rief deren Anführer, ein gewisser Josef Dschugaschwili zum Gebet gegen die Ungläubigen auf. Er schloss mit den Worten: „Unsere Vorbilder sind und bleiben Jesus, Adolf Hitler und der Prophet Mohammed.“ Die meisten Demonstranten klatschten Beifall, die Proteste der anderen Gruppen waren verstummt. Nach weiteren zwanzig Minuten entdeckten Inge Bornheim und Baudissin die Spitze des Demonstrationszuges. „Da kommen sie. Das sind noch gut dreihundert Meter, also noch fünf bis sechs Minuten. Geben Sie Alarmstufe Gelb.“ Aber auch Schleichs Spezialkämpfer hatten das Herannahen der Marschkolonnen bemerkt. Sie studierten noch einmal die von Schleich verfassten Einsatzbefehle. Sie hatten ihre Waffen je nach Größe in Rucksäcken, Handkarren, Rollkoffern oder Fahrradanhängern verborgen. Jeder von ihnen war außerdem mit einer großkalibrigen Pistole im Achselhalfter und einem Kampfmesser unter dem Hemd bewaffnet. Unauffällig wie Touristen gekleidet mischten sie sich in Grüppchen von zwei oder drei Leuten unter die Demonstranten. Inge befand sich nun mit Verteidigungsminister Baudissin auf dem Flachdach des Hochhauses. Mit hochauflösenden Ferngläsern suchten sie nach Auffälligkeiten im Demonstrationszug. Da meldete sich von Thane auf dem Monitor: „Zwei meiner Agenten melden, aus einer Seitenstraße hätten sich kleine Trupps von Touristen mit auffälligem Gepäck in die Demonstration eingeschleust. Sie glauben, einige als Söldner in früheren Kriegsgebieten erkannt zu haben. Was sollen die tun?“ „Wenn das stimmt: nichts. Wenn Ihre Leute versuchen, an das Gepäck zu kommen, werden sie sofort umgebracht.“ Baudissin machte sich Sorgen. „Wir sollten Tiefflieger einsetzen, um Verwirrung und Panik zu verursachen. Dann werden sich die normalen Demonstranten von den gewaltbereiten trennen. Die Söldner werden wohl das Feuer eröffnen.“ „Das klingt plausibel“, erwiderte Inge. „Wir vermeiden massenhaftes Blutvergießen. Also los mit den Tieffliegern!“ Baudissin sandte einen Befehl an die in der Luft kreisenden Jagdbomber. „Außerdem soll sich der Ring von Panzern und Soldaten enger um die Demonstranten schließen. Die sechshundert Busse zum Abtransport der Demonstranten in die Internierungslager sollen den Panzern folgen, damit der Transport zügig abläuft.“ Keine Minute später brauste von Westen ein Kampfflugzeug in hundert Metern Höhe über die Kaserne und die Baumwipfel der Allee hinweg. Die Demonstranten mussten sich die Ohren zuhalten. Aber nach zehn Sekunden kam die zweite Maschine. Die Söldner führten zwölf Boden-Luft-Raketen mit sich. In zwei Sekunden waren diese aus den Fahrradanhängern ausgepackt und in weiteren vier Sekunden feuerbereit. Sie hatten das viele Male geübt. Auf dem Dach schrie Inge: „Da, die haben Raketen. Die nächste Maschine muss sofort hochziehen.“ Aber es war zu spät. Der Befehl Baudissins erreichte den Piloten erst, als die Rakete schon im Flug war. Die Maschine wurde zerfetzt, brennende Teile fielen auf die Allee mit den Demonstranten. Es gab viele Tote, auch der Pilot hatte keine Chance gehabt, den Notausstiegsknopf zu betätigen. Der Pilot der in zehn Sekunden folgenden Maschine sah den Flammenblitz, zog den Steuerknüppel an sich und drehte nach Norden ab. Die Vorsitzende der Notstandsregierung bestand weiterhin darauf, dass vorerst keine Waffen gegen die Demonstranten eingesetzt würden. „Wir machen uns unglaubwürdig, auf diese Weise die Demokratie zu verteidigen. Wir müssen einige Minuten abwarten, bis nur noch die Söldner und die Hundertfünfzigprozentigen übrig sind. Die haben wir schnell eingekesselt.“ Inge fühlte sich erleichtert. Durch ihre Ferngläser konnten sie sehen, wie sich die Demonstration auflöste. Drei Viertel der Menschen flohen nach Osten. Die kampferprobten Söldner hatten den Auftrag, die Kaserne anzugreifen, solange sie sich unter den Demonstranten verbergen konnten. Dieser Augenblick war schon fast vorbei. Ihre Panzerabwehrgranaten zerstörten zuerst die Tore und töteten die Wachsoldaten darin. Wenig später explodierten Granaten in allen erreichbaren Eingängen der Häuser und Baracken. Damit waren die Hausinsassen gefangen. Denn die Fenster im Erdgeschoss waren ausnahmslos vergittert. Auf dem Dach mussten sich Inge und Baudissin auf den Boden werfen, um dem Maschinengewehrfeuer zu entgehen. „Ich kann nicht sehen, ob unten noch harmlose Demonstranten sind. Aber Sie müssen jetzt die Kampfhubschrauber einsetzen und Alarmstuf Rot befehlen, Feuer frei.“ Einen halben Kilometer entfernt stiegen Tausende von Menschen in die Busse. Sie hatten die Explosionen gehört und waren froh, in Sicherheit zu sein. Der Ring der Panzer und der sie begleitenden Panzergrenadiere zog sich enger um die Lindenallee vor der Kaserne zu. Noch immer flohen Demonstranten aus dem Kampfgebiet. Inge lugte mit dem Fernglas über die Dachbrüstung. „Ich sehe nur noch wenige Menschen.“ Da pfiff ein Geschoss heran und zertrümmerte das Fernglas. Ohne dieses Gerät wäre sie sicher erschossen worden. Ihre Hände zitterten. Die Trümmer des Fernglases fielen zu Boden. „Um Himmels willen, sind Sie verletzt?“ Baudissin stürzte zu ihr. „Nein, nein, alles in Ordnung.“ Vor den Eingangstüren der Kasernengebäude sahen sich zu wenige Soldaten mit unzureichender Bewaffnung vielen hochgerüsteten Kämpfern gegenüber. Zum Glück für die Soldaten waren die Hubschrauber eingetroffen und schwebten über den Kämpfern. Inge und Baudissin verließen das Dach. Wegen der vielen Querschläger war es zu gefährlich geworden. Auf dem Weg nach unten im Treppenhaus war es seltsam still. Man hörte hier nichts von dem Maschinengewehrfeuer, von explodierenden Granaten und vom Geheul der Raketen. Im achten Stock angekommen, bedeutete Baudissin seiner Chefin, ihm zu folgen. Am Ende eines langen Ganges schloss er eine Tür mit dem Schild „Putzraum“ auf. „Hier ist das Waffenlager für die hohen Offiziere. Da wir nicht wissen, was uns blüht, sollten wir Waffen mitnehmen und uns so teuer wie möglich verkaufen.“ Inge widersprach. „Ich lehne es ab, Menschen zu töten. Auch Verbrecher und Putschisten sind Menschen.“ „Aber Sie haben kein Problem damit, Menschen töten zu lassen.“ Inge schwieg. „Hier, nehmen Sie wenigstens die Maschinenpistole. Damit haben Sie eine Chance, nicht viele Male gefoltert und vergewaltigt, sondern im Kampf erschossen zu werden. Haben Sie vergessen, wie brutal die Bürgerkriege in Osteuropa, im Nahen Osten und in Zentral- und Ostafrika verlaufen sind? Ich sterbe doch lieber durch eine schnelle Kugel, als durch wochenlanges Hungern, NägelAusreißen, Prügeln, Auspeitschen und Vergewaltigen. Steinigen und Kreuzigen habe ich noch vergessen.“ Inge sagte nichts, nahm aber die Maschinenpistole. Baudissin schnallte einen Gürtel mit zehn Handgranaten um. Im linken Armhalfter steckte eine 9 mm-Pistole. In der linken Hand trug er ein Schnellfeuergewehr. „Hier habe ich zwei kugelsichere Schutzwesten für den Brust- und Bauchbereich und zwei Stahlhelme. Ich bin schließlich Verteidigungsminister und bestehe darauf, dass Sie sich angemessen schützen.“ Sie musste lachen und fügte sich. Als er ihr die Schutzweste überstreifte, berührte er unabsichtlich ihren Busen. Er erschauerte, seine Hände zitterten. „Ach, Baudissinchen, Sie brauchen sich doch nicht zu genieren, wenn Sie meine Brüste berühren. Ich habe das sehr gern. Wenn wir diesen Scheiß hier überleben, dürfen Sie das oft machen, sogar täglich oder stündlich.“ Baudissin schluckte und seufzte. „Ja, wenn.“ Inge nahm seinen Kopf in die Hände und küsste ihn auf den Mund. Am Ende des Ganges befand sich ein Fenster, allerdings mit einer undurchsichtigen Glasscheibe. Aber sie konnten an dem ununterbrochenen Mündungsfeuer und den hellen Explosionen erkennen, dass die Kämpfe vor dem Hochhaus keineswegs abflauten. In diesem Moment erschütterte eine gewaltige Explosion die Umgebung, die Fensterscheibe zersplitterte, die beiden warfen sich auf den Boden, glühende Metallteile schossen an die Decke des Ganges. Draußen zerfetzten Hubschrauberrotoren die Außenwand „Los, weg. Der Hubschrauber wird gleich explodieren!“, brüllte Baudissin. Unversehrt erreichten sie das Treppenhaus. „Komm runter, zur nächsten Etage. Die Flammen werden nach oben steigen. Unten sind wir sicherer.“ Die Tür zur sechsten Etage war abgesperrt, weil dort die Zentrale des Militärischen Geheimdienstes logierte. Als Baudissin die große Flügeltür aufschloss, zitterte das Gebäude. Flammen loderten in den siebten und achten Stock und entzündeten alles Brennbare. Sie stolperten durch die Tür. Es gelang ihm, sie wieder abzuschließen. „Jetzt schnell weiter runter, in den Keller. Vielleicht bricht das Haus zusammen. In der dritten Kelleretage gibt es einen unterirdischen Gang zum Nachbargebäude. In dem die Verwaltung sitzt.“ Sie konnten nicht wissen, dass der abgeschossene Hubschrauber auf die Angreifer und die Soldaten vor dem Hochhaus gestürzt war. Wer nicht sofort getötet wurde, kam in den Flammen des entzündeten Treibstoffs oder durch die explodierende Munition um. Ohne in Gefahr durch die Söldner zu geraten, hätten die beiden durch das zerstörte Portal ins Freie treten können. Sie erreichten in dem dritten Kellergeschoss den Gang zum Nachbargebäude. Er war durch eine massive Tür versperrt. Baudissin schloss sie auf und hinter ihnen wieder ab. Er drückte auf den Lichtschalter „Der Gang sieht ziemlich lang aus“, sagte Inge und nahm seine Hand. Sie zitterte. Zum ersten Mal in ihrem Leben fürchtete sie sich vor dem Tod, vor dem Tod durch andere Menschen. Natürlich verspürte Baudissin ebenfalls Angst. Aber in ihm erwachte auch sein Beschützerinstinkt. „Ja, etwa dreihundert Meter ist das Verwaltungsgebäude entfernt. Am Ende des Ganges ist eine Stahltür, die jedem Sprengversuch widersteht. Die Verwaltungsbeamten sind ja so wichtig, wichtiger als wir Soldaten. Aber ich habe ja einen Generalschlüssel.“ Inge lachte. „Klar, du bist ja auch General.“ „In gewissen Abständen gibt es an der Decke Kameras, durch die wir entdeckt werden könnten. Die müssen wir unbrauchbar machen.“ Er zog eine Spraydose mit schwarzem Lack aus der Tasche und reichte Inge das Schnellfeuergewehr. Vorsichtig schritten sie voran. „Da oben, da ist eine Kamera. Die ist sogar drehbar.“ Er sprang hoch und sprühte kräftig, bis schwarze Farbe auf den Betonboden tropfte. „Die Wachleute entdecken uns nur, wenn sie gleichzeitig alle Monitore beobachten. Aber das ist unwahrscheinlich.“ Schließlich trafen sie an der Stahltür ein. „Entsichere das Gewehr“, befahl er ihr. „Und spring sofort hinter die Tür, wenn ich angeschossen werde.“ Er musste kräftig an dem Türgriff ziehen, denn die Tür war sehr schwer. Dahinter herrschte Dunkelheit, und es war still. Er flüsterte: „Hier unten in Etage Drei unter dem Erdgeschoss gibt es nur Lagerräume. Da wird kaum jemand sein. Hier können wir notfalls übernachten, wenn wir oben nicht weiterkommen.“ Er schaltete das Licht ein. Den Aufzug am Ende des Ganges benutzten sie nicht, sondern stiegen langsam die Treppe in Etage 2 hinauf, immer nach oben sichernd. Plötzlich hörten sie weit oben, vielleicht in der vierten Etage, einzelne Schüsse, dann lautes Gebrüll von Befehlen, auf die lange Salven aus automatischen Waffen folgten. Es war beinahe still, aber man konnte Schritte auf den Treppen vernehmen. Baudissin machte mit dem Daumen das Zeichen „wieder nach unten“ Hinter ihnen schloss er die Tür zum Treppenhaus ab. Schließlich fanden sie einen Kellerraum, der sich von innen verriegeln ließ. Sie durchsuchten die anderen Räume in der dritten Etage und versorgten sich mit Wasserflaschen und einigen Konserven, mit zwei Isoliermatten und Wolldecken sowie mit Kerzen und Streichhölzern, falls der Strom ausfiele. Auch ein Eimer für das gewisse Geschäft konnte gefunden werden. Inge musste lachen. „Es ist ja beinahe gemütlich hier.“ Er sah sie an. „Auch ein bisschen romantisch.“ In der folgenden Nacht kamen sie sich sehr nahe. Die kampferprobten Söldner von Pfarrer Schleich, diese hundert Mann von der Heilsfront, waren den Soldaten des Heeres waffentechnisch weit überlegen. Bisher hatten sie kaum Verluste erlitten, im Gegensatz zu den Soldaten. Allerdings fehlten ihren Kommandeuren die strategischen Ideen von Schleich und Lafontaine, über deren Schicksal niemand etwas wusste. Die Kämpfer durchstreiften in Grüppchen das Kasernengelände, erschossen überraschte Soldaten, sprengten Gebäude und raubten Waffen, Munition, Fahrzeuge und Verpflegung. Die Soldaten leisteten praktisch keinen Widerstand mehr. Nur die Kampfhubschrauber griffen immer wieder die vielen Söldnertrupps an. Nachdem aber drei weitere von ihnen durch Kleinraketen abgeschossen worden waren, wurde den anderen Maschinen der Rückzug auf eine weiter entfernte Waldwiese befohlen. So gab es kaum noch Hindernisse für die Söldner, sie konnten das gesamt Kasernengelände erobern. Solange die Kämpfer zerstören, morden und stehlen konnten, war es für ihre Anführer kein Problem, sie zu lenken und zu steuern. Als sie jedoch die Kaserne „soldatenfrei“ geschossen hatten, gab es strategische Konflikte zwischen Josef Dschugaschwili, Imre Orban und Witold Kaczynski. Der eine wollte Berlin erobern, der andere nur die Kaserne und der dritte die Weltherrschaft. Am späten Abend hatten die Söldner die gesamte Kaserne unter ihrer Kontrolle und plünderten, was transportierbar war. Natürlich konfiszierten sie auch die alkoholischen Bestände der Kantinen und Offizierskasinos. Da blieb es nicht aus, dass nach Mitternacht die Mehrheit der Kämpfer besoffen in der Eingangshalle des noch intakten Verwaltungsgebäudes lag. Der Rest der erprobten Trinker sank um drei Uhr morgens besinnungslos zu Boden. Inge Bornheim und Lothar Baudissin schliefen eng umschlungen bis zum Morgengrauen, das sie allerdings in dem Kellerraum nicht sehen konnten „Verdammt, es ist schon halb sechs.“ Baudissin rüttelte an Inges Schultern. „Wir müssen sofort aufstehen. Vielleicht können wir von hier abhauen.“ Inge maulte. „Immer muss ich so früh aufstehen.“ „Liebes Kanzlerinnenhäschen, das ist deine Pflicht. Wenn die Gangster noch pennen sollten, müssen wir von hier verschwinden.“ Wenig später pirschten die beiden hoch zum Erdgeschoss. Erschreckt von dem riesigen Haufen schlafender Männer entsicherten sie ihre Waffen. Inge flüsterte: „Ich weiß, du würdest sie alle erschießen. Aber wir brauchen sie als Zeugen. Gut achtzig Zeugen, die aussagen werden, von wem sie ihr Geld bekamen für ihre Mordtaten. So etwas ist selten gelungen. Deshalb verbiete ich dir zu schießen und rufe die Militärpolizei an.“ Baudissin fügte sich, blieb aber wachsam an der Treppe zum Untergeschoss 1 stehen, während Inge unten telefonierte. „Hier spricht die Kanzlerin. Bitte schicken Sie ausreichend Militärpolizei, um hundert besoffene Kämpfer zu verhaften und abzutransportieren, in eine sichere Kaserne, bitte sofort.“ Sie notierte den Namen des Offiziers und ließ ihn den Befehl wiederholen. Baudissin nahm gerade einen sich erhebenden, dann torkelnden jungen Kerl wahr, der auf einen Pflanzenkübel zu wankte, um seine Blase zu entleeren. Inge flüsterte: „Die kommen gleich. Schade, dass wir kein Gas zur Betäubung dabeihaben.“ Nach zehn Minuten, das Dämmerungsgrau war lichter geworden, beobachteten sie draußen umherhuschende Gestalten. „Komm, wir flüchten wieder in unser trautes Heim. Das hier kann gefährlich werden.“ Doch Inge sträubte sich. „Ich muss doch sehen, ob das hier klappt.“ Er nickte und führte sie zu einem entfernten Notausstieg im ersten Stock. Dort entsicherte er die Alarmanlage und öffnete das Fenster. Er stieg als Erster die eiserne Leiter hinunter. Kaum hatten seine Füße den Boden berührt, als zwei Stirnlampen aufleuchteten. „Halt, wer da! Hände hoch oder wir schießen.“ Baudissin erkannte, dass es zwei Militärpolizisten waren, und antwortete: „Verteidigungsminister Baudissin und die Kanzlerin.“ „Und ich bin der Kaiser von China und das ist meine Mutter.“ Inge war in den Lichtkegel getreten. Betreten stammelten die beiden eine Entschuldigung „Ist schon gut“, sagte Inge und erkundigte sich, wie die Militärpolizei die Terroristen gefangen nehmen wollte. „Das ist schon geschehen, mit Narkosegas. Die meisten haben nichts mitbekommen, so besoffen waren die. Jetzt werden sie in Truppentransporter gehievt, an Händen und Füßen gefesselt und mit zugeklebtem Mund. Sie werden nach Greifswald gebracht, in ein stillgelegtes, aber hochgesichertes Kernkraftwerk.“ „Dort werden sie verhört. Dort wird ihnen auch der Prozess gemacht werden“, versicherte die Kanzlerin. „Damit diese Bande gerecht verurteilt werden kann, werde ich das Strafrecht ändern.“ Sie ließ sich mit dem Kommandeur der Militärpolizei verbinden. „Sie garantieren mir, dass niemand von diesen Gangstern entkommt. Machen Sie von der Waffe Gebrauch, wenn es notwendig ist. Ihre Leute haben meine Rückendeckung.“ Baudissin wunderte sich, schwieg aber. Die beiden ließen sich von den Militärpolizisten zu den abfahrbereiten Bussen führen. Inge bedankte sich über die bordeigenen Sprechanlagen für die erfolgreiche Arbeit, ermahnte die Soldaten, keinen Gefangenen entkommen zu lassen und versprach einen baldigen Prozess mit harten Urteilen. Nachdem die Busse das zerstörte Kasernentor passiert hatten, ließ sie sich in ihre Zweizimmerwohnung in der Kaserne bringen. Sie stand genüsslich unter der Dusche und strich wollüstig über ihren nassen Körper. Noch bin ich eine schöne, sinnliche und begehrenswerte Frau, dachte sie. Wieso tue ich mir dies hier an, als Kanzlerin mit Morddrohungen, Bürgerkrieg und Aufruhr leben? Ich könnte doch auf eine griechische Insel ziehen, mir dort drei oder vier Jünglinge halten und mich von denen verwöhnen lassen. Da könnte ich länger schlafen und müsste mich nicht mit Themen wie „Brauchen wir ein Tempolimit in Wohngegenden?“ oder „Muss die Vollverschleierung verboten werden?“ herumärgern. Aber was mache ich, wenn ich mich nicht mehr für Männer interessiere? Wenn ich dann wieder in die Politik will, kennt mich keiner mehr und andere haben die Schalthebel der Macht in den Händen. Das Summen des Telefons riss sie aus ihren Gedanken. Es war Sozialminister von Thane. „Kanzlerin, Sie leben. Wir hatten schon das Schlimmste befürchtet. Wir wurden informiert, dass die Verbrecher verhaftet worden sind. Der Aufstand der Gruppe Schleich-Lafontaine ist gescheitert. Das müssen Sie unbedingt noch heute der Bevölkerung mitteilen. Sonst flammt die Lust zur Randale wieder auf.“ „Lieber von Thane, ich stehe gerade unter der Dusche, nackt natürlich, und bereite meine Rede für heute Mittag vor. Gern können Sie kommen und meinen nassen Körper abtrocknen.“ „Äh, ja, gern, äh, nein. Sie verstehen, äh, ich wollte Sie nur über die Lage informieren.“ „Ich verstehe. Noch bin ich nackt und würde mich gern Ihren abtrocknenden Händen unterwerfen.“ „Oh, ja, äh, nein, das darf ich doch nicht, nein. Entschuldigung.“ Er brach das Gespräch ab. Inge kicherte, während sie sich abtrocknete. Von Thane himmelte sie an, aber er traute sich nicht. Die Ansprache an die Nation sollte um 13 Uhr gesendet werden, und dann noch einmal um 20 Uhr. Sie wollte staatsmännisch, entschlossen und visionär wirken. Sie hasste Hosenanzüge, weil man ihre schönen, langen Beine sehen sollte. Den üppigen Busen würde sie unter einer schwarzen Bluse verbergen. Darüber umschloss den Oberkörper eine schwarze Kostümjacke in spanischem Stil. Ein kurzer schwarzer Etuirock gab den Blick auf die schwarz bestrumpften Beine und die glänzend schwarzen Lackpumps frei. Die Kameraleute hatten längst begriffen, wie sie wirken wollte. Die Männer begeistern, den Frauen ein Vorbild sein. Eine halbe Stunde vor Sendebeginn erschien die Kanzlerin im Fernsehstudio der Armee. Wie immer freundlich, gut gelaunt und zu Späßen aufgelegt. Während der Kameramann und die beiden Techniker die Beleuchtung und die Mikrofone ausrichteten, genoss sie die versteckt oder offen lüsternen Blicke der Männer. Früher, vor zehn Jahren, hätte sie die drei in der halben Stunde verführt und nach der Aufnahme noch einmal. Als Kanzlerin ging das natürlich nicht. Sie seufzte leise. Schließlich leuchtete die rote Anzeige „Aufnahme“ und der Studioleiter bedeutete ihr, sie möge anfangen „Liebe Landsleute, als Kanzlerin der Notstandsregierung teile ich Ihnen mit, dass der gestrige Putschversuch der sogenannten Heilsfront gescheitert ist. Mehr als hundert Kämpfer der Religiösen, Nationalisten und Völkischen wurden verhaftet. Auch deren Anführer Dschgaschwili, Orban und Kaczynski sitzen nun hinter Gittern. Schon vor ein paar Tagen haben wir die beiden Oberhäupter der Heilsfront gefasst. Sowohl Helmut Schleich als auch Balthasar Lafontaine befinden sich in unserer Gewalt. Diese Verbrecher werden zurzeit an verschiedenen Orten verhört, und in der nächsten Woche wird die Anklage durch den Generalstaatsanwalt vorbereitet. Dies wird der strengste Prozess, den die Republik gesehen hat. Niemand wird mit einer Bewährungsstrafe davonkommen. Die etwa fünfzigtausend friedlichen Demonstranten in Potsdam, die sich nicht an dem späteren Angriff auf die Kaserne und den Sitz der Notstandsregierung beteiligt haben, gehen straffrei aus. Denn sie haben nur ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrgenommen. Ich betone aber, dass künftige, womöglich nicht genehmigte Demonstrationen mit aller Härte bekämpft werden, wenn aus ihrer Mitte Gewalttaten begangen werden. Das nächtliche Ausgangsverbot von 22 bis 5 Uhr bleibt bestehen. Wer in dieser Zeit ohne Sondergenehmigung angetroffen wird, muss damit rechnen, erschossen zu werden. Nun, liebe Landsleute, müssen wir nach vorn blicken. Die materiellen Schäden, die die Extremisten angerichtet haben, lassen sich in absehbarer Zeit beheben. Doch um die seelischen Verwüstungen durch die Terroristen zu heilen, braucht es Zeit. Noch viel mehr Zeit ist nötig, um die Spaltung der Gesellschaft in zwei sich unversöhnlich gegenüberstehende Gruppen zu überwinden. Dazu werde ich in Kürze eine nationale Versöhnungskommission gründen, in der alle gesellschaftlichen Kräfte vertreten sein werden, vor allem aber unabhängige, ausgleichende und mitreißende Denker. Die Versöhnungskommission wird für eine gewisse Zeit das Parlament ersetzen, aber dann freie Wahlen vorbereiten. Liebe Bürgerinnen und Bürger, wir werden mit den alten Parteien nicht einfach weitermachen können. Weil ein Neuanfang geboten ist, bitte ich alle am Gemeinwohl Interessierten, sich zusammenzufinden und neue Parteien und Initiativen zu gründen. Um auch kleinen und kleinsten Parteien eine Chance zu geben, muss die Fünfprozenthürde aufgehoben werden. Insbesondere diejenigen Landsleute, die sich bisher nicht am politischen Leben beteiligt haben, fordere ich auf, sich in den Neuanfang einzubringen. Eure frische, lebendige Sicht auf die Gesellschaft ist gefragt und wird entscheidende Verbesserungen anstoßen. Deshalb sollte niemand zögern, mit seinem Wissen und seiner Erfahrung zur Gestaltung einer neuen Gesellschaft beizutragen.“ Zum Schluss dankte sie den Streitkräften und der Polizei für ihren „vorbildlichen Einsatz für die Erhaltung der Demokratie“. Das habe es in der Geschichte Deutschlands bisher noch nicht gegeben. Kaum hatte die Kanzlerin das Studio verlassen, überboten sich die drei Männer in ihren Lobpreisungen. „Mann, die strahlt vielleicht einen Sex aus!“ „Mit der würde ich mich gerne eine Woche einsperren lassen.“ „Mit ihrer Aura kriegt die jeden Kerl auf mehrere Entladungen hintereinander.“ Natürlich ahnte Frau Dr. Bornheim, was die Männer tuschelten. Es gab kaum einen Lebensbereich, in dem sie sich so perfekt auskannte: Männer. Am nächsten Tag wurde sie mit den Ergebnissen der Ermittlungen von Generalbundesanwalt Gerhart Baum konfrontiert. „Liebe Inge“, er kannte sie aus ihrer Zeit als Rechtsanwältin, und sie waren damals befreundet, als ihr Mann noch lebte, „diese Mappe enthält Beweise für schreckliche Verbrechen. So etwas habe ich der Heilsfront bisher nicht zugetraut. Mich haben diese Bilder schockiert. Ich könnte verstehen, wenn Du sie nicht sehen willst.“ „Gerhart, mittlerweile bin ich in Deutschland auf alles gefasst.“ Sie nahm die Mappe und schlug sie auf. Das erste Foto zeigte einen Kindergarten in einem Dorf. Auf dem zweiten waren erschossene Kinder in Blutlachen zu sehen, auf dem dritten die abgehackten Köpfe, Arme, Beine und Körper der vier Erzieherinnen, Letztere allesamt mit zerhackter Scham. Die letzte Serie zeichnete die Gräueltaten in einer Kaserne der Bundespolizei auf. Die Kommandeure wurden vor den Augen der Polizisten mit Beilen enthauptet. Grinsende Killer, saufende Söldner und sadistische Mörder, das war Inges Eindruck. „Die können wir doch nicht bloß lebenslang einsperren.“ „Das sagst du, die Todesstrafe willst du ja nicht.“ „Auf keinen Fall, da hat es schon so viele Fehlurteile und staatliche Morde gegeben.“ „Ja, ich weiß. Aber niemand auf der Welt wird verstehen, warum wir die nicht umlegen.“ „Bloß das nicht. Aber was spricht dagegen, wenn die Gefangenen einfach vergessen werden. Zuerst werden die meisten am Durst sterben, der Rest am Hunger. Alles in unterirdischen Geheimgefängnissen. Kaum jemand weiß das, niemand berichtet darüber. Aber ich fürchte, dass wir später ebenfalls angeklagt werden, und das zu Recht.“ „Ich schlage vor, das gesamte Material zu veröffentlichen, vollständig und immer wieder.“ „Richtig, diese Beweise müssen auch in der Versöhnungskommission besprochen werden. Jede Bürgerversammlung muss das diskutieren. Nur so lassen sich die Wutbürger, die Elitenhasser und die schlichten Gemüter beschwichtigen. Vielleicht.“ „Ja, vielleicht.“ Sie beauftragte den bekannten politischen Grafiker und Karikaturisten Frans Valenta, eine Serie von Plakaten zu entwerfen, die im ganzen Land aufgehängt werden sollten. Darauf waren die Parolen, Sprüche und Verbrechen der Heilsfront dargestellt. Alle Plakate wurden durch Kameras überwacht. Wer sich ihnen auf weniger als einen Zentimeter näherte, wurde durch einen automatischen Schuss aus einer Mikrowellenkanone für Stunden gelähmt. Bei einer solchen Nähe am Plakat durfte man einen Zerstörungswillen begründet annehmen. Auf diese Weise gelang es, im ganzen Land Tausende von Sympathisanten der „Heilsfront“ festzunehmen. In pausenlosen Verhören gaben sie die Namen weiterer Anhänger preis. Nach wenigen Wochen waren die als Internierungslager genutzten verlassenen Fabrikhallen gefüllt mit Anhängern der sogenannten Heilsfront. Der Generalbundesanwalt und seine Mitarbeiter waren auf ihre schnelle Arbeit an den Anklageschriften sehr stolz. „Zweitausend Seiten Beweise“, strahlte Gerhart Baum die Kanzlerin an. „Und das in vier Wochen.“ Inge juckte es in den Fingern, ihm den kahlen Schädel zu streicheln. „Sehr gut. Gibt es eigentlich am Obersten Gerichtshof einen oder mehrere Richter, die der Heilsfront nahestehen?“ Das stolze Lächeln wich von seinem Gesicht. „Hm. Ja, der Gert Wilders. Der ist damals von den Nationalreligiösen nominiert worden. Und auch die Tanja Gulburdin. Die hat als Anwältin Kämpfer der Al-Nusra-Front verteidigt.“ „Das war ihr gutes Recht. Aber wir sollten auf jeden Fall beide Kammern für die Verhandlungen zusammenlegen. Da spielen ein oder zwei abweichende Meinungen keine Rolle mehr.“ „Ja, das wird gehen. Aber ich habe noch eine andere Idee.“ „Ja, welche denn?“ „Was machen wir mit Lafontaine und Schleich. Die einfach so aburteilen und das war es, finde ich ein bisschen wenig. Und Rachegefühle dürften Sie ja hegen.“ „Och, eigentlich nicht. Ich bin froh, dass ich nicht von denen umgebracht worden bin.“ Inge sann nach. „Vielleicht sollte man die beiden öffentlich lächerlich machen, zum Beispiel in der Sendung Zeugen der Zeit. Wie sie da befragt werden sollen und wie die Sendung ablaufen soll, darum darf sich Frans Valenta kümmern. Der kann das.“ Tage später aktivierte ein bisher schlafendes Signal den Minicomputer von Richterin Tanja Gulburdin. Es war Sonntagmorgen. Die allein lebende Richterin saß beim Frühstück und die Sonne schien durch die schleierartigen Vorhänge. Auf dem Monitor erschien eine verschlüsselte Nachricht. Sie fuhr mit ihrem Siegelring, in dem ein Entschlüsselungsprogramm gespeichert war, über den Bildschirm, auf dem nun der Klartext erschien: „Tanja, es ist so weit, dass Plan B aktiviert werden muss. Dazu sollst du folgenden Code an Serafim schicken. Dein Helmut Schleich. Auf ewig.“ Sie sandte die Kombination aus Zahlen und Buchstaben an Serafim, der natürlich anders hieß. Serafim entschlüsselte Tanjas Nachricht: „Die Heilsfront stellt ein Ultimatum bis Montag, 12.00 Uhr. Bis dahin sind alle Verhafteten und Internierten frei zu lassen.“ Es wurden nun alle Gefängnisse, Bunker und Lager aufgezählt. „Sind bis 12 Uhr nicht alle freigelassen, werdet ihr unsere von Gott verliehene Macht spüren. Irgendwo in Deutschland, vielleicht in Berlin, in Hamburg, München oder Köln wird eine schmutzige Nuklearbombe explodieren.“ Es folgten Details über die Sprengkraft, übrigens zwanzig Kilotonnen (Hiroshima-Format), und die freigesetzten giftigen und hochradioaktiven Nuklide „Durch diese Bombe, die um 12.30 Uhr gezündet werden wird, sterben direkt und sofort zwanzigtausend, vielleicht auch hunderttausend Menschen. In den folgenden Wochen und Monaten werden weitere Millionen elend verrecken. Noch viele Jahre danach werden Hunderttausende an seltenen Krebsarten leiden. Das alles kann nur verhindert werden, wenn die selbst ernannte Notstandsregierung zurücktritt und vorher alle Gefangenen freilässt. Das ist unser letztes Wort. Mit Gott, für die Nation, der Sieg ist unser.“ Serafim zögerte keine Sekunde, diese Nachricht an die Presseagentur Nation-Glaube-Volk weiterzuleiten, verbunden mit einem Honorar in einer siebenstelligen Summe. Dort war man über diesen üppigen Auftrag begeistert und handelte sofort. Schon zwei Minuten später brachten alle Sender und Medien diese Nachricht. Helmut Schleich in seinem Bunkergefängnis schaute auf seine Uhr und lächelte. Er würde als der große Vereiniger von Religiösen, Völkischen und Faschisten in die Geschichte eingehen. In tiefer Zufriedenheit stach er sich das Besteckmesser ins Herz. Als die Wachsoldaten ihn fanden, war er schon lange tot. Nach zwei Monaten unter der Herrschaft der Domina Amanda wurde Lafontaine an eine Russin mittleren Alters verkauft. Diese hielt sich in ihrer riesigen Villa bei Moskau einen Harem von jungen bis reiferen Männern, die ihren wilden Gelüsten zur Verfügung stehen mussten. Sie konnte sich das leisten, denn ihr Gatte war mehrfacher Milliardär mit besten Verbindungen in den Kreml, aber leider impotent und deshalb sehr großzügig. Nach Lafontaines Übersiedelung nach Russland verlor auch der Armeegeheimdienst seine Spur. So geriet der Assistent und ehemals wichtigste Berater des Kanzlers Piepgen in Vergessenheit. Sofort nach der Sensationsmeldung rief Inge den Innen- und den Verteidigungsminister zu sich. „Was können wir jetzt tun? Wie kann die Bombe aufgespürt werden? Wie kann man sie entschärfen?“ „Die Armee hat einige Hubschrauber mit Gammastrahlenscannern. Wie viele davon einsatzbereit sind, weiß ich allerdings nicht.“ „Erkläre mal, was diese Geräte machen.“ „Praktisch alle schmutzigen Nuklearbomben enthalten Gammastrahler, deren Strahlung man auch aus größerer Entfernung messen kann. Mit den Gammascannern in Hubschraubern kann man in relativ kurzer Zeit ganze Städte überprüfen. So lässt sich die Quelle der Gammastrahlung orten. Zum Entschärfen muss aber unsere Spezialeinheit herbeigeflogen werden.“ Der Innenminister legte Wert auf die Feststellung, auch die Bundespolizei verfüge über ein „mobiles Einsatzkommando zur Abwehr von Nuklearterroristen“, genannt MEKANT. „Die haben ebenfalls Gammascanner, allerdings in Lieferwagen. Und es gibt auch Spezialisten zum Entschärfen von Nuklearsprengkörpern.“ „Gut, wir haben maximal vierundzwanzig Stunden Zeit. Ich wünsche, dass Armee und Bundespolizei eng zusammenarbeiten. Es zählt nur der Erfolg, nicht der Erfolgreiche. Sie müssen zuerst die Einheiten alarmieren und die Maschinen und Fahrzeuge einsatzbereit machen. Dafür muss eine halb Stunde genügen.“ Die beiden Minister nickten und bedienten ihre Telefone. „Allerdings können wir nicht ganz Deutschland absuchen. Ist es ausreichend, nur die von den Gangstern genannten Millionenstädte abzuscannen? Vielleicht geht das Ding in Essen, Stuttgart oder Leipzig hoch. Der Effekt wäre der gleiche.“ Innenminister Eisner schüttelte den Kopf. „Die Millionenstädte aufzuzählen, war doch nur ein Ablenkungsmanöver, um uns zu verwirren. Ich tippe auf Berlin, das ist für mich naheliegend. Denn dort hatte die Heilsfront ihre stärkste und radikalste Mitgliederbasis. In München, Hamburg und Köln lief doch nicht viel. Berlin als Hauptstadt zu strafen, hätte Symbolcharakter und eine weltweite Wirkung.“ Inge und Baudissin stimmten zu. „Vielleicht ist die Bombe sogar im Regierungsviertel platziert, um das verhasste System auszuschalten.“ „Gut, wir müssen spätestens in einer Stunde mit der Operation „Abtasten“ beginnen. Jetzt haben wir 11 Uhr 42. Um 14.00 Uhr möchte ich den ersten Bericht haben. Danke, meine Herren.“ Inge küsste die beiden auf die Wange und vergaß dabei nicht, ihren festen Busen an die Oberkörper der beiden zu drücken. Sogleich nachdem Eisner und Baudissin die Tür des Büros hinter sich zugezogen hatten, informierte sie den Außen- und den Sozialminister „Vielleicht können uns befreundete Nachbarländer mit Scannerhubschraubern aushelfen. Ich werde mich darum kümmern“, versprach der Außenminister. Nachdem Serafim das Ultimatum an die Presseagentur weitergeleitet hatte, erschien auf seinem Bildschirm eine weitere verschlüsselte Nachricht. Diese befahl ihm, die folgende Zahlen-Buchstaben-Kombination an eine Adresse „Selig-sind-die-Sterbenden-denn-ihrer-ist-das-Himmelreich“ zu schicken. Er führte den Befehl sofort aus. Daraufhin wurde der Countdown-Mechanismus in der schmutzigen Bombe ausgelöst. Der Nullpunkt war auf 12 Uhr 30 am nächsten Tag eingestellt. Die Bombe befand sich in einem Kellerabteil im Nachbarhaus, in dem sein Bruder Hakim wohnte. Die Bombe war von Schleichs Mitarbeitern dort versteckt worden, weil Hakim seinen Keller nie aufräumte und betrat. Aber das wusste Serafim nicht. Serafim würde nichts aussagen können, weil er verglüht worden wäre. Und wenn etwas schiefging, konnte er nicht verraten, wo das Ding versteckt war. Schleich hatte an alles gedacht. In Hakims Keller stand ein alter, verwitterter Schrank, in dem sich ein Pappkarton befand, unter dessen Styroporschicht ein Maschinchen von dreißig mal vierzig mal zwanzig Zentimetern vor sich hin tickte: „Minus 24 h 37 min 18 sec.“ In erstaunlichen fünf Minuten hatten Baudissin und Eisner die Einsatzbereitschaft der Sondereinheiten geprüft. Leider mit dem Ergebnis, dass nur fünf Hubschrauber flugfähig waren, die ein Gammascansystem an Bord hatten und von den Besatzungen der MEKANT-Lieferwagen nur sechzig Prozent dienstfähig waren „Verdammte Scheiße, schrien die beiden in ihre Telefone. „Ich verlange hundert Prozent in fünf Minuten. Oder ihr werdet alle entlassen.“ „Sofort müssen die Hubschrauber fit gemacht werden. Alle Luftwaffentechniker dafür einsetzen! In fünf Minuten. Dies ist ein Notstandsbefehl.“ Tatsächlich waren eine Viertelstunde später zwölf Hubschrauber über Berlin in der Luft. Die Speziallieferwagen der Bundespolizei verteilten sich in der ganzen Stadt, um auf die Signale der Hubschrauber zu warten. Die Bombenuhr mit dem roten Anzeigefeld war bei „Minus 23 h 01 min 12 sec“ angelangt. Serafim lag auf seiner Couch und genoss den friedlichen Sonntag. Schleich hatte ihm versprochen, ihn zum Gauleiter Berlin der Heilsfront zu machen. Dann hätte seine Geldnot eine Ende, denn Schleich bezahlte seine Gebietsfürsten sehr gut. Serafim wusste nicht, dass Schleich zu diesem Zeitpunkt bereits tot war. Aber auch die Regierung erfuhr erst am frühen Nachmittag, dass Schleich sich umgebracht hatte. Die Informationskette war eben nicht perfekt. Um 14.00 Uhr wurde Inge informiert, dass fünf deutsche, drei niederländische und zwei französische Hubschrauber mit Scannern in der Luft seien und bereits die nördlichen Stadtbezirke abgeflogen hätten, jedoch ohne ein Gammasignal empfangen zu haben „Hoffentlich haben wir mit unserer Berlin-Theorie recht“, murmelte Inge. Innenminister Eisner berichtete stolz, alle zehn MEKANT-Lieferwagen seien im Einsatz und gleichmäßig über Berlin verteilt. Die Digitaluhr der Bombe zeigte nun an: „Minus 21 h 47 min 08 sec“ Aber diese Anzeige sah niemand. Nach Inges Schätzung gab es eine Galgenfrist von 21 Stunden bis zur Zündung der Bombe. Solange nicht klar war, in welcher Stadt der Countdown lief, machten Vorbereitungen zur Evakuierung der Bevölkerung keinen Sinn. Allerdings alarmierte sie den Berliner Katastrophenschutz mit dem Hinweis, möglicherweise werde Montagmittag in Berlin eine große Bombe explodieren. Man solle ausreichendes Sanitätspersonal und Transportmöglichkeiten für Hunderte von Verletzten vorhalten. Um kurz nach vier kam die erlösende Nachricht von Baudissin. „Über der Reinickendorfer Straße haben die französischen Kollegen ein ziemlich starkes Gammasignal aufgefangen. Zwei unserer Hubschrauber helfen denen, das Signal genauer zu lokalisieren, damit die Detektorwagen der Bundespolizei das Signal hausgenau orten können. Neun der Lieferwagen sind bereits unterwegs zur Reinickendorfer Straße.“ Serafim war auf seinem Sofa eingeschlafen, wachte aber kurz vor vier Uhr auf, geweckt durch ein lautes Knattergeräusch. Schwerfällig erhob er sich und trottete zum Fenster. Er sah einen Hubschrauber über den gegenüber liegenden Häusern. Es kam ihm merkwürdig vor, dass der nicht weiterflog. Na ja, irgendein Unfall, brabbelte er und legte sich wieder auf das Sofa. Doch das Hubschraubergeräusch blieb. Unwillig stand er wieder auf und sah aus dem Fenster. Wie unverrückbar stand der Hubschrauber in der Luft. Serafim konnte nicht sehen, dass ein anderer Hubschrauber über seinem Mietshaus stand und ein dritter hundert Meter weiter. Er zuckte die Achseln. „Jetzt mach ich mir erst mal ’nen Kaffee.“ Als er den Kaffee ausgetrunken hatte, meldete sich Giovanna, seine Freundin, am Telefon. „Ne, du, ich komme lieber zu dir. Hier ist es so laut. Draußen knattert ein Hubschrauber. Weiß nicht, wat der hier tut.“ Er wusch sich, zog ein schwarzes Hemd und eine weiße Hose an und legte ein Goldkettchen um den Hals. Giovanna liebte es, wenn er sich als Macho gab. Eine Stunde später klingelte er an ihrer Wohnungstür. Die Bombenuhr hatte „Minus 19 h 13 min 32 sec“ erreicht. Giovanna öffnete die Tür. Auf seinen Wunsch trug sie ein züchtiges Kopftuch, das ihr schönes, langes Haar bedeckte, und sonst nichts. „Mann, oh Mann, bist du eine geile Alte.“ Er zog sie an sich und schob die Tür mit dem Fuß zu. Inge hatte sich in Eisners Büro einquartiert und hörte mit ihm den Funkverkehr ab. Der Kommandant der beiden deutschen Hubschrauber meldete: „Das Signal bleibt in Stärke und Richtung konstant. Es kommt aus der Reinickendorfer Straße 74 oder 76.“ „Gut, dann sollen jetzt die Kollegen in den Lieferwagen das Signal verfolgen. Sie können wegfliegen und den Rest Berlins abscannen.“ Die Anwohner in der Reinickendorfer Straße waren erleichtert, dass die sonntägliche Nachmittagsruhe nun nicht mehr gestört wurde. Die vier Lieferwagen mit den Firmenaufschriften „Wäscherei Kernseife“, „Heizung und Sanitär Volldampf“, „Schreinerei Sägen bringt Segen“ und „Pizzaschnelldienst Lento“ setzten sich in Bewegung. „Das Signal kommt eindeutig aus Haus 76, aus einer der untersten Etagen.“ „Schicken Sie Wagen 3 und 4 weg. Zwei Gammascanner genügen. Einsatzleitung, bitte melden.“ „Hier Einsatzleitung Özcalan. Die Reinickendorfer Straße ist von Haus 50 bis 100 abgesperrt. Auf den Dächern liegen zehn Scharfschützen, die die Straße und die Hinterhöfe im Visier haben. Einige Gruppen aus vier Spezialisten stehen bereit, um die Hauseingänge und die Kellertreppen zum Hof zu stürmen. Wir warten aber noch, bis die zwölf Schützenpanzer eingetroffen sind.“ „Wie lange wird das dauern?“ Nicht mehr als fünf Minuten.“ „Einverstanden. Entscheiden Sie das Weitere. Durchsuchen Sie alle Wohnungen und vor allem die Keller. Ist das Entschärfungskommando vor Ort?“ „Nein, die kommen aus Sicherheitsgründen in den Schützenpanzern.“ Inge schaltete sich ein. „Hier spricht die Kanzlerin. Ich erteile Ihnen den ausdrücklichen Befehl, keine Risiken einzugehen und verdächtige Personen zu erschießen.“ „Verstanden.“ „Wenn die Bombe gefunden wird und sie nicht entschärft werden kann, ist es möglich, sie wegzuschaffen an einen unbewohnten Ort oder in ein Bergwerk?“ Die Bombenzeit war auf „Minus 18 h 22 min 39 sec“ vorgerückt. „Ja, so eine Bombe ist heutzutage relativ klein und lässt sich von einer Person tragen. Wenn ein Hubschrauber bereitsteht, kann der in einer Stunde im Braunkohlengebiet oder an einem Salzbergwerk sein. Dann bleibt immer noch Zeit, das Ding zu beerdigen und Beton darauf zu gießen.“ „Danke, ich werde den Verteidigungsminister bitten, alles Notwendige vorzubereiten. Viel Glück für den Sturm auf das Haus.“ „Die Panzer sind soeben eingetroffen. Es sieht nicht so aus, als ob wir angegriffen werden könnten. Wir werden sofort losschlagen.“ Zehn Sekunden später wurden die Haustür und die Tür zum Hof aus den Angeln gesprengt. Die Scharfschützen auf den Dächern konnten unten jede Bewegung beobachten. Im ganzen Haus wurden gleichzeitig die Wohnungstüren aufgebrochen. Die Bewohner waren überrascht und empört. Man fand jedoch nichts Verdächtiges. Die Uhr auf der Bombe zeigte „Minus 17 h 40 min 07 sec“ an. Serafim und Giovanna schlummerten nach ihrem Liebesspiel. Sie ließ ihn immer in dem Glauben, sie bewundere ihn als Macho, ja, sie füge sich seinen Befehlen. Doch in Wirklichkeit lenkte sie ihn nach ihren Wünschen. Dass er irgendetwas mit der Heilsfront zu tun hatte, wusste sie nicht und ahnte auch nichts. Als die Leute der Spezialeinheit die Kellertür im Haus 76 aufstießen, wurde das Gammasignal sofort stärker. „Hier muss das Sauding sein. Bitte zuerst alle Kellerabteile nach Sprengfallen absuchen.“ Der Gammazähler führte sie zu einem Verschlag, in dem sich verstaubte Schänke, Koffer und Kisten befanden. Das Signal wurde sehr stark. „In dieser Kiste muss die Bombe sein.“ Er prüfte mit einem Sensor, ob elektronische Schaltungen an oder in der Kiste verborgen wären, die zu einer vorzeitigen Zündung führen könnten. Man fand aber nichts. Also öffnete ein Spezialist für Kernwaffen die Holzkiste. Sie sahen den Zeitzähler rote Ziffern anzeigen. „Minus 16 h 55 min 14 sec.“ „Aha, das sieht gut aus. Ich werde die Kanzlerin anrufen.“ Inge war erleichtert, dass noch mehr als sechzehn Stunden Zeit war. „Werden Sie das Ding entschärfen können?“ „Das können wir noch nicht sagen. Es sieht nach einer veralteten Technik aus, aber das könnte eine Finte sein, um uns hereinzulegen. In einer halben Stunde wissen wir mehr. Aber bitte schicken Sie uns einen Hubschrauber oder besser zwei, falls etwas schiefgehen sollte. Dann kann man das Ding notfalls in einem Bergwerk versenken und mit einem schnell härtenden Beton zuschütten.“ „Einverstanden. Ich werde alles veranlassen. Viel Glück.“ Die beiden Kerntechniker rätselten, wie das Zeitzählwerk mit dem Zündmechanismus verbunden sein könnte. Kabel hierfür konnte man keine sehen. Vielleicht steuerte ein Funksender des Zählwerks den Zünder. Nach zehn Minuten machte der Einsatzleiter dem Rätselraten ein Ende. „Männer, wir können keinerlei Risiko eingehen. Kann man das Ding in der Kiste transportieren?“ Die beiden prüften, ob es eine Verankerung gab oder einen Mechanismus, der das Abtransportieren bestrafen würde. „Ne, wir finden nix.“ „Dann lasst uns das Ding wegschaffen. Draußen steht schon der Hubschrauber.“ Vier Minuten später hob der Hubschrauber mit der Bombe, dem Einsatzleiter, den zwei Kerntechnikern und acht schwer bewaffneten Soldaten ab. Hinter ihnen flogen zwei Kampfhubschrauber und darüber eine Drohne, durch deren Kamera der Verteidigungsminister den Überblick über die Lage behielt. Baudissin hatte in der Zwischenzeit im Südwesten Berlins ein stillgelegtes Salzbergwerk erkunden lassen. Dessen Wasserpumpen waren noch in Betrieb, und es ließ sich auch noch gefahrlos betreten und befahren. Baudissins Stabsoffiziere hatten den Besitzer des Bergwerks „gebeten“, sofort dorthin zu fahren und das Bergwerk für das Militär zu öffnen. Des Weiteren „bat“ man ihn, alle Lastwagen für Transportbeton aus der Umgebung zu ordern, „und zwar randvoll“. Das müsse er in einer halben Stunde anlaufen lassen. Es werde sein Schaden nicht sein. Auch die Transportbetonfirmen würden sehr gut honoriert. Den Beamten des Stabes war klar, dass der Bergwerksbesitzer nur eine sehr begrenzte Anzahl von Betonfirmen mobilisieren konnte. Deshalb kontaktierten sie alle Lieferanten von Transportbeton im Umkreis von zweihundert Kilometern, also mit einer Fahrzeit von weniger als drei Stunden zu dem Bergwerk. Nuklearexperten hatten inzwischen geschätzt, dass man zwischen 2000 und 4000 Tonnen Beton benötigen würde, um die Wirkung einer kleineren Kernwaffe zu annullieren oder zu dämpfen. Inge wollte sich schon über „diese schwabbelige Angabe“ aufregen. Aber der Professor wandte ein, man wisse ja nichts über die Detonationsstärke der Bombe. Im Übrigen empfehle er, nach der Versenkung des Betons noch ein paar tausend Tonnen Sand und Kies über dem Schacht zu verteilen. Inge musste ihre Wut hinunterschlucken, schließlich war sie ja nur Juristin „Dass ich dieses NUR überhaupt denken kann“, murmelte sie. Bisher tat ihre Gilde immer so, als könnten sie alles, und Probleme wären ausschließlich juristischer Art. Der Kerntechniker im Hubschrauber schaute auf das Zeitzählwerk: „Minus 16 h 21 min 4 sec.“ „Wir haben jetzt das Berliner Stadtgebiet verlassen. In zwanzig Minuten werden wir das Ziel erreichen“, sagte der Bordcomputer „Hoffentlich kriegen die so viel Beton zusammen, in solch kurzer Zeit“, fürchtete der andere Techniker. „Und dann noch tausende Tonnen Sand und Kies.“ „Wer weiß, ob da überhaupt eine Bombe drin ist. Vielleicht nur eine Attrappe“, zweifelte der Pilot. „Aber woher kommt dann die Gammastrahlung aus der Kiste? Vielleicht eine Kobalt-60-Kapsel aus der Nuklearmedizin? Schön von Blei umschlossen mit einer winzigen Öffnung zur Bestrahlung? Nein, die Strahlung kommt aus allen Richtungen und ist nicht kobaltspezifisch.“ „Jedenfalls haben wir noch sechzehn Stunden, bis das Ding im Sarkophag liegt.“ Sie landeten, und das Triebwerk wurde ausgeschaltet. Der Kerntechniker mit seinem „Baby“ im Arm wurde vom Bergwerksbesitzer und vierzig Soldaten einer Sondereinheit empfangen. Mehr als dreißig Betonfahrzeuge mit rotierenden Trommeln warteten auf ihre Entladung. Die Soldaten hatten bereits eine Rutsche zum Schacht aufgebaut „Also fahren wir runter!“, rief der Einsatzleiter. Er, der Bergwerksbesitzer und die beiden Kerntechniker fuhren mit dem Aufzug in die siebte Sohle, etwa in 1200 Metern Tiefe. Dort stiegen sie aus und fuhren mit einer elektrischen Lokomotive gut dreihundert Meter horizontal weiter. Der Kerntechniker mit der Bombe im Arm rechnete im Kopf. „Wir brauchen mindestens 7000 Kubikmeter Beton, damit der Schacht zu ist.“ Der Einsatzleiter nickte und telefonierte nach oben. Dort gab man seine Information an die Kanzlerin weiter. Kurz bevor sie ausstiegen, um die Bombe in einer Höhle im Salzstock zu deponieren, stellte der Träger der Bombe fest, dass die Uhr bereits auf „Minus 12 h 7 min 32 sec“ vorgesprungen war. Wie konnte das sein? Es hätte höchstens 16 h 02 min angezeigt werden sollen. Der Einsatzleiter war entsetzt. „Vielleicht hat sich eine Art Zeitraffer eingeschaltet, um uns zu verwirren.“ „Tatsächlich, in einer realen Sekunde verstreichen bei dem Zähler vier bis fünf Sekunden. Dann haben wir vielleicht nur noch fünf Stunden Zeit. Ob das reicht, den Schacht zuzuschütten?“ Der Einsatzleiter rechnete. „Wenn man optimistisch denkt, schaffen wir es, in einer Minute zwei Fahrzeuge zu entleeren. Dann würden fünf Stunden gerade reichen. Vorausgesetzt, der Zeitzähler wird nicht weiter beschleunigt.“ „Vielleicht ist es besser, den ganzen horizontalen Stollen zum Einsturz zu bringen, durch ordentliche Sprengungen an den richtigen Stellen. Der flüssige Beton wird ohnehin kaum in den horizontalen Stollen fließen. Dann brauchen wir keine 7000 Kubikmeter Beton.“ Der Einsatzleiter stimmte zu. Er wies auf eine Kiste mit Dynamitstangen und Zündern in der Lokomotive hin. Sie arbeiteten sehr schnell, um zehn Sprengladungen an Decken und Wänden zu befestigen und zu verkabeln. „So, lasst uns abhauen.“ „Die Zähluhr steht jetzt auf 12 h 01 min 16 sec. Komisch, die hätte weit unter 12 h anzeigen sollen.“ „Scheißegal, wir rechnen jetzt mit fünf Stunden bis zur Detonation.“ Der Aufzug führte sie schnell nach oben oberhalb der Betonrutsche. Der Einsatzleiter löste die Sprengungen im Stollen aus. Eine Sekunde lang vibrierte der Korb des Fahrstuhls. Dann floss die erste Betonladung die Rutsche hinab. Die Mannschaften und die Fahrer waren informiert worden, warum sie mit höchster Geschwindigkeit arbeiten mussten. Die Polizei hatte alle Fahrtrouten abgesperrt, damit die Fahrer Höchstgeschwindigkeit fahren konnten. Schon bevor die Sprengladungen im Stollen gezündet wurden, hatten schwere Baufahrzeuge begonnen, auf der Fläche, unter der die Bombe explodieren würde, eine zehn Meter dicke Schicht aus Sand und Kies aufzuschütten. Der Kerntechniker und der Bergwerksbesitzer schätzten, dass eine Kies- und Sand-Platte von hundert Metern Durchmesser und zehn Metern Dicke die Bildung einer Spalte über dem voraussichtlichen Ort der Detonation verhindern würde. Dazu waren fünfzig schwere Baufahrzeuge und vier riesige Planierraupen im Einsatz. „Das klappt alles prima. Es sind bereits hundert Tonnen Beton in den Schacht gerutscht.“ Noch gerade in Sichtweite schüttete ein Vierzigtonner nach dem anderen Sand und Kies auf eine Fläche, dreihundert Meter vom Förderturm entfernt „Ich werde mich hüten, jetzt schon Hosiannameldungen nach Berlin zu senden. Wer weiß, was noch alles schiefgeht“, sagte Einsatzleiter Özcalan. „Die in Berlin stellen sich alles so einfach vor, am grünen Tisch ausgedacht. Dass man die Rutsche ständig von Betonablagerungen freikratzen muss, das können die sich nicht vorstellen.“ Er wies auf die vier Soldaten an der Rutsche, die mit Schiebern die Rutschfläche glatt hielten. Die Kanzlerin trank zwar Kaffee mit Verteidigungsminister Baudissin und Innenminister Eisner, war jedoch mit ihren Gedanken weit weg. „Ich bin beunruhigt, was sich im Salzbergwerk abspielen mag.“ Eisner nickte. „Eine organisatorische Meisterleistung, so viel Beton zu beschaffen und Sand und Kies herbeizufahren.“ „Wenn das alles klappt, haben Sie in Özcalan meinen Nachfolger. Jedenfalls sollte man ihn sofort zum General befördern.“ Nachdem die Militärs die Reinickendorfer Straße verlassen hatten, drangen Geheimdienstleute in Haus 74 und 76 ein, befragten die Bewohner und durchsuchten jedes Zimmer. Schließlich durchwühlten sie auch Serafims Wohnung und fanden auf dem Minicomputer verschlüsselte Dateien, aber auch die Adresse seiner Freundin Giovanna. Zehn Minuten später sprengte eine Spezialeinheit die Tür von Giovannas Wohnung. Sie und Serafim waren aufgeschreckt, hatten aber keine Chance gegen die Schwerbewaffneten. Sie wurden verhaftet und ins Polizeipräsidium an der Oranienburger Straße transportiert. Serafim weigerte sich, irgendetwas auszusagen, auch später in Gegenwart eines Anwalts. Doch nach etlichen Stunden gab er zu, einen Befehl, dessen Inhalt er nicht kannte, weitergeleitet zu haben. Von einer schmutzigen Bombe habe er nie etwas gehört. „Nun sagst du uns, wer dein Auftraggeber war.“ Vier große Männer beugten sich über ihn „Wer hat dich beauftragt!“, brüllte einer. „Wir werden dich als Verräter an der türkischen Nation bei den Grauen Wölfen denunzieren. Dann sehen wir, wie lange du noch lebst.“ „Oder wir führen deine Freundin dort als Hure ein.“ Serafim schwitzte. Diese Ermittler sind wirklich nicht gefühlvoll. „Kennst du den Code Selig-sind-die-Sterbenden-denn-ihrer-ist-das-Himmelreich?“ Serafims Widerstand brach zusammen. „Dein Prophet Schleich hat sich feige das Leben genommen. Und du hältst noch immer zu ihm. Hat er dir ein Pöstchen versprochen? Aber deine Träume sind ausgeträumt.“ Serafim begann zu weinen. Der Kommissar reichte ihm ein Papiertaschentuch. „Du hast uns bestätigt, was wir bereits wussten. Trotzdem danken wir dir für deine Kooperation. Ich vermute, der Staatsanwalt wird dich anklagen, wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung und wegen Beihilfe zu versuchten Morden. Du weißt also, was dich erwartet.“ Nach Serafims dreiwöchiger Untersuchungshaft begann ein Aufsehen erregender Prozess. Doch nach zwei Wochen erlahmte das Interesse der Medien. Das Urteil lautete auf „lebenslänglich, mit besonders schwerer Schuld“. Damit gäbe es für Serafim keine Chance, das Gefängnis nach fünfzehn Jahren zu verlassen. Im Gerichtssaal saß Giovanna und weinte. Sie weinte auch nach drei Tagen noch, nachdem ihr „rasende Reporter“ täglich mehrmals Interviews „gegen gutes Geld“ angeboten hatten. Sie müsse sich doch erinnern können, „wie Serafim im Bett gewesen war“ und ob er links gewesen wäre. Die Medienimperien, die fünf Familienclans gehörten, hielten das für Qualitätsjournalismus. In Inges Büro in der Potsdamer Kaserne saß sie immer noch mit Eisner und Baudissin zusammen und wartete auf die erfolgreiche „Beerdigung“ der schmutzigen Nuklearbombe. Einsatzleiter Özcalan hatte ihnen gemeldet, dass nach seiner Schätzung noch fast fünf Stunden bis zur Detonation der Bombe vergehen würden. Er schilderte das Problem mit der springenden Zähluhr. „Es kann auch zwölf Stunden dauern oder nur noch drei Stunden. Der Schacht ist bereits zu einem Drittel mit Beton gefüllt. Den Rest werden wir innerhalb der Frist schaffen. Danach wird auch der Schacht mit zehn Meter Sand und Kies abgedeckt. In der Umgebung des Förderturms ist das Aufhäufeln bereits im Gang.“ „Ich danke Ihnen und Ihren Leuten im Namen des Volkes. Bitte richten Sie das den Mannschaften aus. Bitte melden Sie sich, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind oder Sie den Ort aus Sicherheitsgründen verlassen haben.“ Ob sich das Lob der Kanzlerin messbar ausgewirkt hatte, ist heute nicht mehr zu ermitteln. Jedenfalls war der Schacht zum Zeitpunkt „minus 2 h“ mit Beton gefüllt. Die Senke, in der sich der Förderturm befand, wurde von den Planierraupen mit Kies zugeschüttet. Als nach Özcalans Zeitschätzung der Zeitpunkt „minus 1 h“ erreicht war, gab er den Befehl zum Abrücken. Es würde einige Zeit in Anspruch nehmen, die Baufahrzeuge und Planierraupen in sicheres Gebiet zu bringen. Die Soldaten und die Kerntechniker bestiegen die Militärlastwagen und wurden in ein nahe gelegenes, tiefes Tal gefahren. Özcalan teilte der Kanzlerin und seinem Chef die Lage mit. In dem Tal stellten die Nuklearfachleute einige Seismographen auf und baten um absolute Stille. Man wartete nun „Jetzt wäre minus fünf Minuten“, flüsterte Özcalan. Auf dem Seismographenschreiber konnte man jeden LKW auf der entfernten Bundestraße erkennen. Sonst tat sich nichts. „Jetzt haben wir plus eine halbe Stunde. Das muss ich Potsdam melden.“ Eine weitere halbe Stunde verging. Einer der Soldaten sagte: „Das war sicher nur eine Attrappe, um den Staat zu verarschen.“ „Bestimmt, was sollen wir hier rumsitzen, womöglich noch Stunden.“ Özcalan erhob sich und atmete tief ein. „Wollt ihr wohl die Klappe halten. Meine Schätzung, wann die Bombe explodieren würde, war nur ein Bauchgefühl. Die Uhr an der Bombe spielte ja verrückt. Das Ding hätte auch schon vor drei Stunden hochgehen können. Dann wären wir wahrscheinlich tot. Vielleicht müssen wir auch noch sechs Stunden warten, jedenfalls nach der Anzeige vor zehn Stunden.“ „Psst“, machte der Kerntechniker. „Da tut sich was.“ Er wies auf die Ausschläge des Seismographenzeigers. Jetzt schlug er sehr heftig nach oben aus „Sie ist explodiert“, stellte er fest „Sie ist explodiert“, wiederholte Özcalan, nur viel majestätischer. Er war erleichtert und befahl, vier Soldaten sollten in die Strahlenschutzanzüge steigen und mit Messgeräten das Gelände über dem Salzbergwerk überprüfen. Er selbst schlüpfte in einen leichten ABC-Anzug und fuhr die Soldaten aus dem Tal auf das Hochplateau, unter dem sich die Salzmine befand „Von hier oben sieht alles unverändert aus. Die Strahlenschutzleute messen jetzt die Gegend durch. Ich teile Ihnen dann die Messwerte mit“, telefonierte er seinem Chef Baudissin. Der war sehr zufrieden und lobte ihn für die „hervorragende Pflichterfüllung“ Da schaltete sich Inge ein. „Herr Oberstleutnant, ich habe noch eine Idee. Wenn Sie nichts oder nur eine sehr geringe Strahlenbelastung messen, heißt das noch nicht, dass in ein paar Stunden oder Tagen keine radioaktiven Gase aus dem Bergwerk in die Außenluft diffundieren könnten. Deshalb schlage vor, dass Sie und einige Ihrer Leute noch eine Woche in dem Gebiet bleiben und zwei Mal am Tag Messgänge durchführen, nicht wahr, Herr Verteidigungsminister?“ Dieser sagte laut: „Ja, ich bin einverstanden.“ Inge war sehr stolz, den Begriff „Diffundieren“ richtig angewandt zu haben. Und das als Juristin! Auch Baudissin war beeindruckt. Özcalan erzählte seinen Leuten von dem fachkundigen Befehl der Kanzlerin. „Die hat ja echt den Überblick.“ Die Soldaten und die Kerntechniker freuten sich, dass sie auf einem nicht weit entfernten Landgut mit dem Angebot „Ferien auf dem Bauernhof“, deftiger Kost und viel Bier hausen konnten. Nach drei Stunden kehrten die Messtechniker von ihrer Exkursion zurück. „Absolut nichts, alles unter der Nachweisgrenze.“ „Keinerlei Erhöhung der Strahlung.“ „Nichts, keine Alpha-, Beta- oder Gammastrahlung.“ „Noch nicht einmal direkt am Schacht.“ Özcalan hatte den Messtechnikern seinen Telefoncomputer hingehalten, damit die Kanzlerin und der Verteidigungsminister die Ergebnisse direkt hören konnten. „Das ist ja sehr erfreulich. Aber seien Sie vorsichtig. Eine Woche werden Sie wohl dort aushalten können.“ Özcalan lächelte, bedankte sich und schaltete das Gerät aus. Am Abend trat die Kanzlerin wieder in den Nachrichten aller Medien auf. „Liebe Landsleute, gestern und heute haben wir eine sehr große und schreckliche Gefahr erfolgreich bekämpfen können. Eine Bande von Kriminellen wollte uns mit der Drohung erpressen, eine schmutzige Atombombe in einer Großstadt explodieren zu lassen. Durch den Einsatz unserer Armee, der Bundespolizei, der Geheimdienste und befreundeter Militärorganisationen in den Nachbarländern ist es uns gelungen, die Bombe zu finden und unschädlich zu machen. Alle an der Vorbereitung und Durchführung dieses Anschlags beteiligten Verbrecher wurden verhaftet. Noch einmal ausdrücklich danke ich unserer Armee und den Geheimdiensten und nicht zuletzt den Regierungen Frankreichs und der Niederlande.“ Inge trug wieder das schwarze Kostüm mit einer schwarzen Bluse darunter. Den Fernsehleuten hatte sie die Hoffnung vermasselt, ihre schönen langen Beine ins Bild zu bringen, indem sie hinter einem massiven Schreibtisch Platz genommen hatte. Doch auch die schwarze Bluse bot den Zuschauern genügend Sex. Denn sie war aus schwerer Seide gefertigt. Außerdem trug sie um den Hals ein großes Bronzeamulett, das durch sein Gewicht den Busen wunderbar teilte und dadurch beide Brüste hervorhob „Bah, ist das ’ne geile Alte“, sagte der Beleuchter zum Aufnahmeleiter, der bloß nickte und seufzte „Ein Wahnsinnsparfüm umweht die“, meinte der Tontechniker. Inge, die ihren Fernsehauftritt genoss, bedankte sich bei den Fernsehleuten, wohl wissend, wieder einige Fans gewonnen zu haben. Auch nach Ablauf der Woche wurde um das Salzbergwerk keinerlei erhöhte Radioaktivität gemessen. Die Kanzlerin war erleichtert. Als sie mit ihrer provisorischen Regierung zusammensaß, entstand der Gedanke, auf dem Gelände des Salzbergwerks eine Art Arbeits- und Internierungslager für die Putschisten aus Heilsfront, Marineoffizieren und verschiedenen extremistischen Gruppen wie „Mein neuer Kampf“, „Recht und deutsche Freiheit“, „Religiöse Fundamentalisten“, „Nation und Volk“, „Religionskampf“, „Gottes Krieger“ und „Liga für Zucht und Ordnung“ einzurichten. „Da wir eine Art Notstandsregierung darstellen, müssen wir uns nicht unbedingt nach den bestehenden Gesetzen richten. Ich bin auch dafür, dass wir später eine neue Verfassung ausarbeiten, die die jetzige Realität widerspiegelt und nicht überkommene Familien-, Staats- und Demokratievorstellungen.“ „Ja, ähm, Internierungslager“, druckste Eisner herum. „Das Wort Lager verbinde ich, und sicher auch viele alte Menschen, mit den Konzentrationslagern der Nazis oder Arbeitslagern von Stalin.“ „Hm, ja, da haben Sie recht.“ Baudissin schlug vor, die zu Internierenden in ein normales Gefängnis zu überführen, nach einer rechtskräftigen Verurteilung natürlich. „Also nur: Gefängnis für Putschisten.“ „Ich muss sagen, das gefällt mir am besten. Die Bezeichnung überschlafen wir am besten. Aber die Einrichtung der Lagerbaracken kann nicht warten. So viele Gefängnisse haben wir gar nicht.“ „Gut, ich bin ja dafür zuständig. Für wie viele Gefangene sollen wir denn Baracken errichten?“ „Keine Ahnung, aber es sollen nur die Anführer interniert werden, nicht die einfachen Mitläufer. Wichtiger ist es, eine Art nationale Versöhnungskommission zu gründen. In der sollen alle gesellschaftlich wichtigen Kräfte vertreten sein. Prüfen Sie doch mal, wen wir dazu berufen sollen, lieber Eisner. Die Nationale Versöhnungskommission sollte höchstens zwanzig Mitglieder haben.“ „Hoffentlich ist das ausreichend, um alle wichtigen Strömungen zu repräsentieren“, nickte Eisner. „Dann gründen Sie eben zusätzliche Ausschüsse, in denen die fachliche Arbeit getan wird.“ Eisner nickte wiederum, beinahe ergeben. Innenminister Eisner bildete zehn Arbeitsgruppen, die in drei Wochen fünfzig Standorte für die Internierungslager ermittelten. Jedes Lager sollte nicht mehr als tausend Insassen vorsehen. Die Kanzlerin war zufrieden. Inge beschloss, die Gründung neuer Parteien selbst in die Hand zu nehmen. Sie sorgte dafür, dass in allen Medien Aufrufe veröffentlicht wurden, in denen Anforderungen an demokratische Parteien und ihre Gründer festgelegt wurden, nämlich:
Balthasar Lafontaine kehrt als Oskar Müntefering aus Moskau zurück. Vor zwei Monaten konnte sich Lafontaine mit der auch eigennützigen Hilfe eines Altpolitikers aus seinem Moskauer „Gefängnis“ befreien und zurück nach Deutschland reisen. Korrekterweise muss man sagen, dass seine Besitzerin froh war, ihn losgeworden zu sein. Denn mit seiner sexuellen Potenz war es nicht mehr weit her. Unauffällig gekleidet, mit einer neuen Frisur und vor allem mit einem neuen Pass, den ihm der Altpolitiker vom Geheimdienst besorgt hatte, konnte er im Eisenbahnzug an der polnisch-deutschen Grenze einreisen und in Berlin untertauchen. Unter seinem neuen Namen Oskar Müntefering mietete er in Berlin-Moabit eine kleine Dachgeschosswohnung mit schrägen Wänden, aber einem schönen Blick auf den Hinterhof. Um ein festes Einkommen zu erhalten, bewarb er sich bei der Stadtverwaltung. Aber die Begründung der Absage lautete „mangelnde Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung“. Es gelang ihm aber, die Stelle eines Disponenten eines Abfallentsorgungsunternehmens zu ergattern und bei dieser Tätigkeit durch Fälschung der Entsorgungsnachweise viele Unternehmen von hohen Abfallgebühren zu entlasten, natürlich nicht zum Schaden seines Arbeitgebers und seines eigenen Kontos. Schon nach wenigen Wochen in Berlin bekam er Zugang zu den Versammlungen der vielen neuen Parteien, deren Gründung die Kanzlerin gefördert hatte. Bei diesen Versammlungen warb er immer für eine stärkere religiöse Ausrichtung, gleich, ob es sich um eine sozialistische, neoliberale, nationalistische oder reaktionäre Gruppierung handelte „Die Religion ist der Ursprung jeder Gesellschaft“, verkündete er stets und bekam immer Beifall. Offensichtlich bestand ein religiöses Bedürfnis beim Volk. Das musste man nutzen und in die richtigen Bahnen lenken. Im Laufe der Monate gelang es ihm, sehr viele Spenden für eine vollkommen neue religiöse Partei zu sammeln. Diese Partei sollte Neoreligiöse Partei NRP heißen und alle Strömungen, Sekten, Konfessionen und Weltreligionen zu einer einzigen Religion, dem wahren und echten Bekenntnis, zusammenführen, zu einer Art Internationale des Glaubens. Schon viel früher hatte er sich mit den alten Religionen des Vorderen Orients, Indiens und Asiens beschäftigt. Später hatten ihn die zahlreichen Sekten der spätrömischen Zeit beeindruckt. Aber auch das Mittelalter und die Neuzeit boten interessante und scheinbar widersprüchliche Entwicklungen. Wenn er all diese Vielfalt in einer einzigen Religion vereinen könnte, wäre ihm die Begeisterung des Volkes sicher. Am besten gefiel ihm die Möglichkeit, alle geschlechtlichen Handlungen als heilig zu erklären. In jedem Dorf, in jedem Stadtviertel sollten auch Alte, Hässliche und Kranke an der „Heiligen Hochzeit“ teilnehmen, an deren Abschluss das gemeinsame Trinken der „Heiligen Säfte“ stehen sollte. Zu Gott findet man nur durch den Geschlechtsakt, das hatten die Priester zu verkünden. Diese sollten auch darüber wachen, dass kein Jüngling und kein junges Mädchen ohne eine „heilige Fickerin“ oder einen „heiligen Ficker“ in das Leben eingeführt würden. Für eine solche Religion würde man gewiss Millionen von Anhängern gewinnen. Dagegen sollten Varianten, die auf Körperhass und Frauenfeindlichkeit beruhten, verpönt werden. Wenn er, noch als Balthasar Lafontaine, auch lange gebraucht hatte, um seine eigene Geschlechtlichkeit zu genießen, so gruselte es ihn inzwischen, wie lange Geschlechtsteile, der Akt der Zeugung, die Menstruation und die Geburt als unrein angesehen wurden. Als vorbildlich erkannte er es, dass schon vor 2500 Jahren eine Vielzahl von „Heiligen Schriften“ kursierte. Denn jedermann konnte seine eigenen Schriften als heilig erklären. Wer danach lebe, habe ein seliges Leben, wer nicht, der blicke in einen fürchterlichen Tod. „Ich danke dir, Gott, dass du mich nicht als Ungläubigen, als Arbeiter oder als Frau geschaffen hast.“ Während dieses Gebetes lachte er oft, bis er Bauchweh bekam. Besonderen Spaß bereitete ihm die Lektüre über Kasteiungen. Weil der Körper des Menschen ein Kerker für die Seele sei, müssten Arme, Beine und Leib ständig gezüchtigt werden. Der Körper sei nur eine Dunggrube, ein Gefäß der Fäulnis. Man geißelte sich vier Mal in der Woche oder sogar täglich vor dem Schlafengehen und nach dem Erwachen mit Peitschenhieben und Stahlspitzen. Im Körper wohnten Unzucht, Unsittlichkeit und böse Begierden. Mit großer Erheiterung las er, dass man sich nicht nur für vergangene Sünden, sondern auch für zukünftige Sünden geißelte. So gab es einige Heilige, die sich in Dornen wälzten, sich von Passanten peitschen, beschimpfen und auf das Gesicht treten ließen. Andere aßen verschimmeltes Brot, tranken Waschwasser von Aussätzigen und füllten ihren Mund mit Durchfallscheiße. Ein besonders Heiliger kaute und fraß den Schmutz von den Lumpen der Armen. Besonders konsequent fand er die Schrift über die „Feuertäufer“. Diese sahen den Geschlechtsakt als Erbsünde an. Deshalb werde die Menschheit nur durch den Tod der Geschlechtsorgane erlöst und könne dann in das Paradies kommen. Der erste Grad der Reinheit werde bei Männern durch die Entfernung der Hoden, bei Frauen durch die Entfernung der Brustwarzen oder einer Brust erreicht. Doch der höchste Grad der Reinheit erfordert beim Mann die Entfernung des Gliedes, bei Frauen die Entfernung der Kleinen Schamlippen und des Kitzlers. Immerhin wurden Männer erst entmannt, nachdem sie mehrere Kinder gezeugt hatten. Die Lust zur Sünde solle man mit Wein und Schnaps bekämpfen. Dann erlischt die Gier nach dem Körper und der Satan der Fleischeslust entflieht der Seele. Haha, dachte Oskar Müntefering, das macht doch jeder Ehemann mit einer Frau weit jenseits der Wechseljahre. Einer alten Schrift entnahm er interessante Einzelheiten über die Sekte „Die heilige Domina“. Deren Sektenmitglieder beteten die Heilige Domina mit den Wunderbrüsten und der Riesenfotze an, aus der ständig der Heilige Geist strömte. Männer müssen innerhalb und außerhalb des Hauses verschleiert sein, der ganze Körper muss stets durch ein weites Gewand bedeckt sein. In Gegenwart einer Frau dürfen sie nur nach deren Aufforderung reden. Sie dürfen keine Schule besuchen, sie lernen nur die Heilige Schrift über die Heilige Domina auswendig. Das Haus dürfen sie nur in Begleitung einer Domina verlassen. Jede Domina darf sich vier Ehemänner halten, die für die Hausarbeit und die Erziehung der Kinder zuständig sind. Geschlechtsreife Mädchen haben die Befehlsgewalt über ihre Brüder. Ungehorsam der Ehemänner wird streng bestraft. Bei schweren Vergehen, bei Impotenz und bei mangelndem erotischem Eifer können die Ehemänner verstoßen werden. Eine andere Sekte behauptete, während des Geschlechtsverkehrs entweiche der Heilige Geist. Deshalb lege man so oft wie möglich Hand an sich, am Tag und in der Nacht und vermeide so den sündigen Geschlechtsverkehr. Müntefering war beeindruckt und stellte eine Verbots- und Gebotstafel auf
Müntefering stellte sich vor, wie viele Religionen, Konfessionen und Sekten durch eine solche Gesetzestafel entstünden, wie sie sich von diesen abspalteten und sie sich gegenseitig bekämpften. Ihm fiel ein, wie sehr sich die Frauen in der Vergangenheit emanzipiert hatten und im Gegenzug die Männer immer mehr Rechte verloren, bis sie sich selbst als Versager und „verlorenes Geschlecht“ empfanden. Der männliche Kampfeswille war erlahmt und trat nur noch bei Fußballspielen auf. Lüsternheit und Fleischeslust der Frauen machten die Männer zu willenlosen Lustobjekten. Diese Entwicklung galt es aufzuhalten und umzukehren. Zuerst musste der Geschlechtstrieb verdrängt werden durch nationale, ethnische und religiöse Wahnvorstellungen. Die Tabuisierung alles Geschlechtlichen erzeugt unkritische und willige Untertanen. Je mehr der Mensch den eigenen Körper versklavt, umso leichter lässt er sich selbst versklaven. Entbehrte Lust frustriert, und Frustrierte neigen zu Selbsthass. Das führt zu Hass auf andere Menschen, auf Andersartige, auf Fremde, auf andere Sekten, auf Abweichler von der reinen Lehre. Sex lähmt den Verteidigungswillen. Sex ist gefährlicher als ein äußerer Feind. Durch Gefühle gegenüber Frauen darf die Kampfmoral nicht geschwächt werden. Daher wird Soldaten vor einem Krieg sexuelle Abstinenz befohlen. Müntefering beschloss, ein Gesetzbuch über die Pflichten der Frau zu verfassen, mit einer Präambel, die die geschundene Männerseele erheben sollte: Das Weib verhalte sich zum Mann wie das Unvollkommene und Defekte zum Vollkommenen. Die rechte Ordnung findet sich nur da, wo der Mann befiehlt und die Frau gehorcht. Die Vorrangstellung des Mannes ist gottgewollt. Die Frauen haben sich zu verschleiern, weil sie nicht das Ebenbild Gottes sind. Die Arme müssen bedeckt sein, Kleider haben bis zum Boden zu reichen. Kleider müssen aus groben Stoffen sein und hochgeschlossen bis zur Halsgrube, nicht zu eng anliegend und nicht durchsichtig. Schmuck, Schminke, gefärbtes Haar, Fleisch und Wein sind ihnen verboten, ebenso das Singen oder Lachen. Sie dürfen nicht aktiv am Gottesdienst teilnehmen, und das Studium der Heiligen Schriften ist ihnen nicht erlaubt. Die größte Ehre eines Weibes ist es, einen Sohn zu gebären. Nachdem er diesen Text formuliert hatte, grinste er in sich hinein und stellte sich vor, wie sich aus der Neoreligiösen Partei NRP in Windeseile fünf, sechs oder mehr Parteien abspalteten. Dazu bräuchte er nichts beizutragen. Zwar stieß er bei den Versammlungen der anderen kleinen und größeren Parteien häufig auf den wütenden Widerstand empörter Frauen und militanter Emanzen. Doch es gelang ihm stets, deren Kritik an seinen neoreligiösen Leitlinien abzubügeln mit dem Vorschlag, eine „Domina-Partei“ zu gründen, in der jede Frau und auch jeder Mann die „Heilige Domina“ verehren und anbeten könne. Dieser Vorschlag wiederum erweckte den geifernden Protest der männlichen Fundamentalisten, was zu einer Spaltung der Versammlung in eine „Fundisekte“ und in eine „Realosekte“ und einige Wochen später auch noch in eine „Wahre Dominasekte“ und in eine „Tolerante Dominasekte“ führte. Vor dem Schlafengehen las Müntefering genüsslich die Protokolle der Versammlungen. Als Folge seines Geschicks, die verschiedenen ideologischen Strömungen zu artikulieren und zu lenken, eilte ihm bald der Ruf voraus, ein exzellenter Versammlungsleiter zu sein, der auch einmal mit der Faust auf den Tisch hauen konnte. Nachdem er genug über „des Volkes Wille“ bei den vielen Versammlungen erfahren hatte, gründete er seine eigene Partei, die „Nationalreligiöse Bewegung“ NRB, die alle religiösen und nationalistischen Strömungen vereinigen wollte. „Ich werde mich nicht scheuen, auch faschistische und islamistische Kämpfer aufzunehmen, jedoch keine Kommunisten, Sozialisten und anderes Pack.“ Seine Bewunderer wurden immer mehr. Nur eine Stunde nach dem Attentat auf die Kanzlerin verkündete Wolfgang Baudissin als Chef der Notstandsregierung den verschärften Ausnahmezustand:
Baudissin und Brandt werden befreit. Am gleichen Tag, allerdings am frühen Nachmittag, landete ein großer Kampfhubschrauber auf dem Dach des Gefängnisgebäudes, in dem Baudissin und Brandt gefangen gehalten wurden. Ihre Gefangenschaft wurde wieder einmal durch die Anwesenheit zweier attraktiver Huren versüßt. Diese Zusammenkünfte fanden immer in den besonders hergerichteten Räumen im obersten Stockwerk statt. Bevor sich je Fenster zwei Soldaten aus dem Hubschrauber vom Dach abseilten, um in die „Zimmer der Lust“ einzudringen, sollten zehn Elitesoldaten die Gefängnismauer an der Nordseite überklettern, um die Kommunikationseinrichtungen im Keller auszuschalten. Der Direktor sollte sich weder die Szenerie im „Puffzimmer“ ansehen, noch eine Nachricht an seine Sicherheitsleute und an Großmarschall Spahn senden können. Erst wenn diese Nachrichtenkanäle ausgeschaltet wären, sollte die Entführung von Baudissin und Brandt beginnen „Die beiden werden nicht begeistert sein, beim Ficken unterbrochen zu werden“, kicherte Witterschlick. Die Soldaten warfen Seile mit Enterhaken auf die Krone der Hofmauer, kletterten daran hoch und ließen sich auf der anderen Seite an den Seilen hinab. Witterschlick fühlte sich dazu nicht ausreichend trainiert und verbrannte mit einem Flammenwerfer die Tastatur am Eingangstor. Zu seiner Überraschung öffnete sich das Tor, und er konnte sehen, wie die Soldaten zum Eingang des Gebäudes rannten. Witterschlick war bis auf seine Mikrowellenkanone und den kleinen Flammenwerfer unbewaffnet. Neben dem Eingangstor befand sich der Kellereingang, dessen Zugangstür seltsamerweise nicht verschlossen war. In dem Lagerraum dahinter gab es leere Kartons, Holzpaletten und Gitterboxen. Er verfolgte den Lauf der Kabel an der Decke und traf auf eine Tür, die auf einen dunklen Gang führte. Oben an der Decke verliefen die dünneren Datenkabel nach rechts. Bald stand er vor einer Tür mit dem Schild „Eintritt verboten. IT-Zentrale“. Wie könnte er diese Tür öffnen? Die Mikrowellenkanone wirkte nur auf Menschen, Tiere und Pflanzen. Gegen das gepanzerte Schloss konnte der Flammenwerfer nichts ausrichten. Plötzlich vernahm er Schritte, die näher kamen. Er verbarg sich hinter einer Betonsäule und wollte gerade die Mikrowellenkanone betätigen, als er im letzten Moment sah, dass es einer der Soldaten war. Er winkte ihn zu sich und bat ihn, das Türschloss der IT-Zentrale zu zerschießen. Witterschlick freute sich, wie schnell die recht kompakten Teile des Schlosses auseinanderflogen. Sie zogen die schwere Tür auf und suchten nach dem Hauptschalter für die interne und externe Datenkommunikation. Dieser befand sich, gut gekennzeichnet, unter einer Plastikhaube, die sich mit dem Flammenwerfer leicht schmelzen ließ. Sekunden später saß der Gefängnisdirektor vor einem dunklen Bildschirm. Witterschlick gab den Angriffsbefehl. Die Hubschrauberbesatzung begann mit dem Abseilen zu den beiden „Puffzimmern“ Im Erdgeschoss wurden die wenigen Wärter und Aufseher überwältigt. Sie hatten gegen die schwer bewaffneten Soldaten keine Chance und wurden, ebenso wie der Direktor, in eine der vielen freien Zellen gesperrt. Dann stürmten Witterschlick und die Soldaten in die oberste Etage zu den Puffzimmern. Die vier Soldaten aus dem Hubschrauber hatten bereits die unvergitterten Fenster eingetreten. Baudissin vergnügte sich gerade mit einer bezaubernden Chinesin, während auf Brandt eine kaffeebraune Schönheit aus Südamerika ritt. Mit ausgesuchter Höflichkeit ersuchte Witterschlick die beiden Damen, „die beiden Herren in die Freiheit zu entlassen“, und bat den Piloten des Hubschraubers, im Hof zu landen, um die Befreiten und die Soldaten aufzunehmen. „Meine Damen, es steht Ihnen frei, hier auszuharren oder das Gefängnis zu verlassen. Leider muss ich Ihnen die Mobiltelefone abnehmen.“ In der nun gebotenen Eile rannten Witterschlick, Baudissin und Brandt und die vierzehn Soldaten im Treppenhaus nach unten. Der große Hubschrauber wartete bereits im Hof. Ohne angegriffen zu werden, gelang es allen, in den Hubschrauber zu steigen. Dieser hob sofort ab, um nach Osten zu fliegen. Denn die polnische Grenze war nur sechs Kilometer entfernt. Witterschlick hatte mit der Hilfe von Oberst Özcalan beim polnischen Oberbefehlshaber General Jaruzelski erreicht, dass die deutsche Maschine beim Örtchen Dobra landen durfte. Von dort aus würden sie in sichere Unterkünfte gebracht. Während des Anfluges auf Dobra entdeckten sie westlich des Ortes drei Panzer der polnischen Armee. Auf der Wiese bei den Panzern gab es ein kleines Zeltlager, getarnt als Pfadfinderlager, und drei kleine zivile Busse. Als der Hubschrauber gelandet war und sich die Rotoren nicht mehr drehten, trat ein polnischer Offizier auf die Aussteigenden zu. Witterschlick wusste sofort, wer dieser Offizier war. „Guten Tag, Herr Oberst Usłow. Wir danken Ihnen für den Empfang in Sicherheit. Ich nehme an, Sie kennen die Generäle Baudissin und Brandt.“ Die beiden waren hinzugetreten und schüttelten dem Oberst herzlich die Hand „Natürlich, wir kennen uns aus den Zeiten, als Deutschland noch in der NATO war“, sagte Baudissin auf Polnisch. Witterschlick überließ die drei ihrem vertrauten Gespräch und schloss sich der Gruppe der deutschen Soldaten an, um mit ihnen zu besprechen, wie sie in Deutschland untertauchen könnten. Fast einen Tag später gelang es einem Gefängniswärter, der früher ein versierter Einbrecher gewesen war, das Schloss der Zellentür zu knacken und sich und seine Kollegen zu befreien. Bis sie einen Notruf an das Ministerium absenden konnten, vergingen noch einmal zwei Stunden. Genau um viertel nach drei in der Nacht zuvor explodierten im Landratsamt Strausberg vier Sprengladungen und das im Treppenhaus verschüttete Benzin wurde gezündet. Da die Brandmelder und das sonstige Alarmsystem von Jadwiga lahmgelegt worden waren, konnte sich das Feuer ungehindert entwickeln und ausbreiten. Fünf Minuten später brannten die hölzernen Treppengeländer und Treppenstufen. An den vier Ecken des Gebäudes klafften riesige Löcher, die dem Feuersturm im Inneren genügend Luft zuführten. Zwar war das Gebäude nicht eingestürzt, wie es die Gruppe aus Kostrzyn erhofft hatte, doch die Schäden waren so gewaltig, dass nur ein Abriss übrig blieb. In der Umgebung hatte kaum jemand die Explosionen gehört. Nur ein alter Mann murmelte, wieso die auch nachts auf dem Schießplatz Wökendorf herumballern dürften, und schlief wieder ein. Erst als die Flammen meterhoch aus dem Dachstuhl schossen, wachte er wieder auf und sah das Unglück aus dem Fenster. Sofort rief er die Feuerwehr an. Als diese eintraf, fiel der Dachstuhl in sich zusammen. Um fünf Uhr meldete sich der Parteiführer der Heilsfront in Strausberg im Reichsinnenministerium. Er musste zwanzig Minuten warten, bis er zu dem Sekretär des Ministers durchgestellt wurde. „Ein Bombenanschlag, sagen Sie? Gibt es Hinweise auf die Täter?“ „Ja, wir haben eine Art Bekennerschreiben eines Kommandos Sarah Wagenknecht gefunden.“ „Also Linke! Das ist super, kommt wie gewünscht. Die werden wir jetzt liquidieren. Ich werde sofort den Reichsmarschall informieren. Danke für Ihre Mitteilung!“ Er wusste, der Reichsmarschall wünschte, nicht vor sechs Uhr geweckt zu werden, und wartete also so lange. „Verdammt noch mal, hätten Sie mich nicht früher informieren können!“ „Herr Reichsmarschall, Sie hatten doch befohlen, dass wir Sie nicht vor …“ „Papperlapapp, ihr müsst mehr mitdenken. Das gilt doch nicht in Ausnahmesituationen.“ „Aber …“ „Halten Sie jetzt die Klappe, sonst landen Sie bei der SS, haha.“ Nachdem Reichsmarschall Spahn erkannt hatte, dass man in Strausberg im Moment nichts mehr tun konnte, legte er sich wieder ins Bett und schlief noch zwei Stündchen. Dann informierte er Staatschef Müntefering. Doch der meinte, das sei nur ein lokales Ereignis, ohne Relevanz für das Reich. Doch am frühen Nachmittag wurden die beiden durch eine schreckliche Nachricht erschüttert. Der Gefängniswärter, der sich befreien konnte, musste bis in die Ortsmitte von Mewegen laufen, bis ihm endlich jemand erlaubte, sein Telefon zu benutzen. Zuvor hatte er von den Einwohnern nur gehört, man hasse den Staat. Deutschland müsse endlich negerfrei werden, und Schwule gehörten an den Galgen. Er rief das Ministerium an. „Alarm, unser Direktor ist gefangen genommen worden.“ „Aber wer spricht denn da? Und worum geht es überhaupt?“ Hastig stellte sich der Gefängniswärter vor und berichtete, was geschehen war. Der Regierungsrat, der den Anruf entgegengenommen hatte, informierte seinen Vorgesetzten, den Oberregierungsrat, und dieser den Abteilungsleiter, der seinerseits nur seinem Chef, dem Ministerialdirigenten berichten durfte. Und nur dessen Chef, der Ministerialdirektor, war berechtigt, den Reichsinnenminister oder seinen Stellvertreter zu informieren. Folgerichtig war es mittlerweile acht Uhr geworden, als Reichsmarschall Spahn endlich erfuhr, dass Baudissin und Brandt befreit worden waren. Als Müntefering das von Spahn hörte, rastete er aus. „Hast du geglaubt, deine Beamten im Innenministerium wären alle Koryphäen ihres Fachs? Und wusstest du nicht, dass man der trägen Beamtenmasse ständig in den Hintern treten muss, damit sich die Herrschaften bewegen? Und dass du ständig wachsam sein musst, damit du nicht in die Fallen stolperst, die die Beamten für dich aufstellen? Am liebsten würde ich dich sofort von deinem Posten absetzen. Aber das kann ich mit dir leider nicht machen. Am besten ist es, wenn wir die Befreiung vergessen. Ich gebe dir daher den Auftrag, das Personal dieses Gefängnisses zu verhaften, meinethalben wegen Beihilfe zum Terrorismus. Am besten bleiben die in Mewegen inhaftiert. Da kann nichts nach außen dringen. Den Gerichtsprozess verschieben wir auf die nächsten Monate. Lass dir was einfallen. Und jetzt hör mir gut zu: Du musst unbedingt herausfinden, wer hinter der Befreiungsaktion steckt. Auf den ersten Blick können nur das Heer oder die Luftwaffe dahinterstecken. Aber wurden sie aus dem Ausland unterstützt? Vielleicht aus den Niederlanden, oder aus Frankreich, oder aus Polen? Also gegen wen müssen wir den nächsten Krieg führen?“ Er lachte meckernd. „Solange es Einheiten bei Heer oder Luftwaffe gibt, die über Soldaten und Waffen verfügen, haben wir nicht die volle Macht im Staat. Und wenn diese Verräter auch noch Nachschub vom Ausland bekommen, können wir nur auf einen Bürgerkrieg hoffen. Und den solltest du schon einmal vorbereiten.“ „Sehr wohl, Chef. Erledigt sind bereits: Internierungslager für kritische Journalisten, Professoren, Politiker, Schriftsteller und andere Intellektuelle. Und wir haben die kämpferischen Mitglieder der staatstragenden Parteien. Die Russland, China oder den USA nahestehenden Gruppierungen werden geschont.“ „Das will ich wohl hoffen. Mit den Supermächten können wir uns nicht anlegen.“ Müntefering erzählte später, er habe Spahn an diesem Abend „huldvoll“ verabschiedet, trotz seines Versagens. Mit der tatkräftigen Hilfe von Oberst Usłowo gelang es Witterschlick, den vierzehn Soldaten, die an der Befreiung in Mewegen beteiligt waren und denen in Deutschland die Todesstrafe wegen Hochverrats drohte, eine neue Identität zu verschaffen. Der polnische Geheimdienst stattete sie mit neuen Personalausweisen, Kleidung und Geld aus, damit sie in Deutschland untertauchen konnten. Doch alle hatten sich entschlossen, sich als trojanische Pferde in die Heilsfront einschleusen zu lassen, vorzugsweise als Rechtsradikale oder katholische Fundamentalisten. Sie sollten dort Informationen sammeln und weiterleiten, damit später gerichtsfeste Beweise für Verbrechen vorlägen. „Außerdem sollen Sie die Stimmung anheizen, gegen Andersdenkende hetzen und zu Gewalttaten aufrufen, ohne sich selbst daran zu beteiligen.“ Oberst Usłowo grinste. „Sie verstehen, was ich meine.“ Wenige Tage nach dieser Einweisung reisten die vierzehn Soldaten nach Berlin, bezogen vierzehn Kleinwohnungen und trafen sich bald mit den Basisgruppen der Heilsfront. Dort baten sie um Aufnahme. Die Befragungsprozedur zur Aufnahme gestaltete sich überall als sehr anspruchsvoll. Immer wollten die Vorsitzenden wissen, ob sich der Antragsteller schon einmal an einer terroristischen Aktion beteiligt habe. Wenn man darauf mit Ja geantwortet hätte, wäre die Aufnahme abgelehnt worden. Denn die Direktive von „Oben“ war: Wir brauchen keine Terroristen, sondern Fachleute. Alle wurden sie aufgenommen. Baudissin und Brandt wurden nach Warszawa geflogen und trafen am Abend im polnischen Verteidigungsministerium ein. Dort wurden sie von Ministerpräsident Tusk, Verteidigungsminister Penderecki und Oberbefehlshabe Jaruzelski willkommen geheißen. Die beiden deutschen Generäle trugen noch ihre gestreifte Gefängniskleidung, wurden aber mit ausgesuchter Höflichkeit empfangen. Die beiden Ex-Generäle legten dar, auf welche Weise sie einen Putsch gegen „die herrschende Clique“ vorbereiten wollten. „Da wir nicht wissen, welche Einheiten des Heeres und der Luftwaffe uns noch folgen werden, schlage ich vor, Guerillatrupps aus zuverlässigen Leuten zu bilden. Die sollen dann aus dem Untergrund nachts blitzartig Polizeistationen und Marinestützpunkte angreifen, um das Regierungssystem zu destabilisieren. Wir dürfen natürlich nur diejenige Infrastruktur zerstören, die wir später nach unserer Machtübernahme nicht selbst brauchen. Es macht ja keinen Sinn, das Bauamt einer Stadt mitsamt seinen Mitarbeitern in die Luft zu jagen. Wir brauchen ja die Fachleute. Nur deren Chefs, die brauchen wir nicht, wenn es Parteimitglieder der Heilsfront sind. Die können ohnehin nichts, nur Parteipolitik.“ Jaruzelski nickte zustimmend. „Also, wir sollten zehn bis zwanzig Guerillaverbände aus deutschen Soldaten bilden. In Einheiten von zwanzig bis fünfzig Mann. Sie werden von der polnischen Armee ausgerüstet und gelenkt. Aber diese Lenkung darf niemals sichtbar sein. Sonst gerät Polen in Schwierigkeiten.“ Jaruzelski antwortete: „Gut, morgen gebe ich entsprechende Befehle aus. Aber jetzt werden wir Wodka trinken und singen.“ Ministerpräsident Tusk und Verteidigungsminister Penderecki verabschiedeten sich. Dringende Regierungsgeschäfte zwängen sie leider, sich zurückzuziehen. Als sie den Besprechungsraum verlassen hatten, grinste Jaruzelski und sagte in verschwörerischem Tonfall: „Von wegen Regierungsgeschäfte. Die fahren jetzt zu ihren Geliebten und vergnügen sich mit denen. Aber ich habe ja Verständnis. Sonst werden die zu seelischen Krüppeln.“ Nachdem er die erste Runde Wodka eingeschenkt hatte, erzählten Baudissin und Brandt in aller Ausführlichkeit von ihren erotischen Erlebnissen im Gefängnis von Mewegen. Nach dem vierten Glas Wodka insistierte Jaruzelski, man möge ihm noch detaillierter die Erlebnisse mit den attraktiven Huren schildern. Weil auch Baudissin und Brandt schon sehr angeheitert waren, beschrieben sie die körperlichen und sexualtechnischen Vorzüge der Damen und die vielfältigen Beischlafvarianten. „Und stell dir vor“, man war mittlerweile zum Du übergegangen, „die haben meistens auf uns geritten. Wir mussten selten selbst aktiv werden. Die hatten es drauf, uns immer steif zu halten.“ Mstislaw, so lautete des Generals Vorname, seufzte. „Da habt ihr eine sehr schöne Zeit im Gefängnis gehabt. Sicher, wenn es zum Prozess gekommen wäre, hätte man euch zum Tode verurteilt. Ist ja noch mal gut gegangen.“ Eigentlich wollte er die beiden, die nun genug getankt hatten, in die Gästezimmer begleiten lassen. Aber Brandt wollte unbedingt noch über die Blondine berichten. Baudissin schloss sich mit dem Wunsch an, über den „köstlichen Körper“ der Schwarzhaarigen erzählen zu dürfen. Danach, es war halb elf geworden, rief Jaruzelski eine Ordonanz herbei und ließ die beiden „Hackevollen“ in ihre Zimmer bringen. Jaruzelski zweifelte daran, dass die beiden am nächsten Morgen gesprächsfähig sein würden. Nach dem Anschiss durch den Staatschef erholte sich Reichsmarschall Spahn dadurch, dass er seine „ihm gehörende Ehefrau“ brutal vergewaltigte und sie anschließend mit einem Kabel verprügelte, weil sie ihm eine „zweite Nummer“ verweigerte. Danach setzte er sich in das pompöse Büro in seiner Villa, öffnete eine Flasche Sekt und brütete einen Plan aus, wie man die regimekritischen „Zecken“ ausrotten könnte. Schon vor längerer Zeit hatte er sich vom Innenminister Personenlisten aufstellen lassen, in denen alle kritischen Journalisten, Professoren, Schriftsteller und oppositionelle Politiker mit ihren Adressen aufgelistet waren „Künstler, Schauspieler, Kabarettisten, Quatsch. Die schaden uns nicht. Die kannst du dir sparen“, hatte Müntefering entschieden. Immerhin enthielt die Liste, die er nun durchging und einzelne Namen markierte, mehr als zehntausend „reichsfeindliche Subjekte“ Bei Nummer 512 hatte er den Sekt ausgetrunken und war eingeschlafen. Am nächsten Morgen weckte er seine Ehefrau und befahl ihr, geeignete Orte in Deutschland für Internierungslager auszusuchen. „Jedes Lager soll tausend Häftlinge aufnehmen, also brauchen wir mindestens zehn Lager. Sieh zu, dass du das bis heute Abend erledigt hast. Staatssekretär Mümmelmann wird dir dabei helfen.“ Seine Frau, deren verheulte Augen ihm nicht auffielen, nickte. In diesem Augenblick dachte sie auch an ein Internierungslager, allerdings für die Regierung. Sie stellte sich genussvoll vor, wir ihr Mann und Staatschef Müntefering dort durchgeprügelt würden. Nach drei Tagen hatte Spahn die Liste der zu Internierenden immer noch nicht durchgearbeitet. Schließlich hatte er keine Lust mehr und reichte die Liste an den Geheimdienst weiter. Der sollte sich darum kümmern. Inzwischen hatte seine Frau gute Arbeit geleistet und auch die Versorgung der Lager geplant. Am Abend wollte er sie wieder „nehmen“. Sie wehrte sich nicht, ließ es geschehen und wartete auf eine Gelegenheit, ihm ein Messer in den fetten Bauch zu stoßen. Zwei Tage später wogte eine Welle der Verhaftungen durch Deutschland. Die vom Geheimdienst gesteuerte Polizei „räumte in jedem Ort auf“. Dafür bildeten die gespeicherten Berichte über das Lesen reichsfeindlicher Literatur, Kontakte mit kritischen Bürgern, Verleumdungen aus der Nachbarschaft und Einstufungen der Behörden die Basis. Im Morgengrauen startete vor dem Leipziger Polizeipräsidium ein Kleinbus, um den Literaturnobelpreisträger Hartmann zu verhaften. Am frühen Morgen klingelte es an der Tür des Reihenhauses von Hartmann und es wurde an die Haustür gehämmert. Carl Amadeus Hartmann öffnete die Haustür und sah sich zehn maskierten Soldaten gegenüber. „Äh, was wollen Sie?“ Der Einsatzleiter drängte sich vor. „Wir verhaften Sie wegen der Unterstützung des Terrorismus.“ „Äh, ich verstehe nicht.“ Der Einsatzleiter hielt ihm den Haftbefehl vor das Gesicht. Fassungslos las Hartmann die Anschuldigungen
Das Ende des Vierten Reiches. Naturgemäß war die Stimmung beim Staats- und beim Regierungschef gereizt. „Wieso ist es dem Arschloch Baudissin gelungen, sich in der Uckermark einzunisten, wo wir doch dort unsere treuesten Anhänger haben?“ „Wahrscheinlich, weil die polnische Grenze nah ist. Dort haben wir keine Truppen, und der Marinestandort Rostock ist weit weg. Offenbar haben sich Heer und Luftwaffe dort etabliert. Da wird es nicht mehr lange dauern, bis sie Berlin angreifen.“ „Du bist ein pessimistisches Miesmacherschwein!“, schrie Staatschef Müntefering. „Du kannst ja nach Polen abhauen, oder nach Holland, wie damals der Kaiser.“ „Und du, du verpisst dich bald als Selbstmörder mit einer Kapsel Kaliumzyanid. Das hatten wir schon einmal bei einem Führer.“ „Halt die Schnauze, du Drecksau!“ Staatschef Müntefering schmiss einen schweren Bürolocher auf ihn. Dieser traf Spahns linke Schläfe, die sofort stark blutete. Wutentbrannt warf Spahn einen messerähnlichen Dolch, den man früher als Brieföffner benutzt hatte, auf Müntefering. Doch der Dolch, der die Brust treffen sollte, verirrte sich in das linke Auge. Müntefering brüllte auf und riss sich das Projektil aus dem Auge. Mit dem rechten Auge erfasste er gerade noch, wie Spahn mit der Faust auf ihn ausholte. Er rammte den Brieföffner in Spahns Bauch. Sofort zog er die Waffe heraus und stach in den Brustkorb. Spahn sackte sofort auf ihn, die Augen weit geöffnet. Müntefering war nun auf einem Auge blind, aber ansonsten körperlich unversehrt. Es machte nun keinen Sinn mehr, das Auge retten zu wollen. Jetzt würde der Endkampf kommen, bis zu seinem Endsieg. Auf jeden Fall würde er Zyanid-Kapseln besorgen lassen. Er wälzte seinen toten Reichsmarschall von sich, torkelte zum Telefon und rief seinen Leibarzt zu sich „Nein, da ist nichts mehr zu machen. Der Sehnerv ist zerstört.“ Der Arzt schüttelte bedauernd den Kopf. „Lassen Sie den da wegschaffen. Er hat mir das Auge ausgestochen. Und ich musste mich wehren.“ Der Arzt nickte. „Der Fall ist klar. Sie mussten sich wehren.“ „Quatschen Sie mir nicht alles nach. Besorgen Sie mir zehn Kapseln Kaliumzyanid, und zwar noch heute.“ Wieder nickte der Arzt, kommentierte aber den Wunsch des Staatschefs lieber nicht. Als er gegangen war, betrachtete sich Müntefering im Spiegel seines Privatbades. Der Arzt hatte ihm eine Beruhigungsspritze gegeben, die Blutung im Auge gestoppt und die Wunde sterilisiert. „Hach, die Augenklappe steht mir gut. Jetzt sehe ich aus wie ein Pirat. Ja, es ist schade um das Auge. Aber räumliches Sehen brauche ich nicht als Staatschef, ich habe ja einen Chauffeur und einen Piloten.“ Er rief seine Frau Anneliese an und schilderte ihr den Vorfall. Sie hörte sich seine Schilderung schweigend an „Und du darfst nicht erschrecken, wenn du mich mit der Augenklappe siehst“, bat er. Doch sie hatte das Gespräch beendet, bevor er fortfahren konnte. „Komisch, die Alte könnte doch um mich weinen.“ Er beschloss, nicht nach Hause zu fahren, sondern sich im Büro zu besaufen. Vielleicht hätte er eine Idee, wie ihm der Endsieg gelingen könnte. Vielleicht war es noch möglich, die Terroristen der Heilsfront „Glaube und Nation“ und die Religiösen „Mit Gott“ zu Anschlägen, Morden, Entführungen und Geiselnahmen zu bewegen. Allerdings war ihm bewusst, dass das Volk genug hatte vom ständigen Ausnahmezustand und von den vielen Toten. Weitere Tote würden wohl dazu führen, dass sich das Volk von ihm abwendete. Aber er ließ sich in seiner Endzeitstimmung nicht irritieren, hörte spätromantische Musik und schlürfte den russischen Wodka, bis er sich zum Schlafen auf die Pritsche im Büro fallen ließ. Heinz und Jadwiga Kowalski, Oberstleutnant Winjawski und Major Kopernikus saßen im Wohnzimmer ihres Quartiers in Kostrzyn an der Oder und tranken Kaffee. Im Fernsehen wurde über die Zustände in Deutschland berichtet, nicht ohne Schadenfreude über bürgerkriegsähnliche Zustände, Anschläge rivalisierender Terrorgruppen und über die zerfallende Infrastruktur. „Habt ihr mal daran gedacht, dass das alles wieder aufgebaut werden muss? Finanzämter, Stadtverwaltungen, Schulen? Und wer bezahlt das?“ Winjawski schaute die anderen eindringlich an. „Ja, das wird eine entbehrungsreiche Zeit werden.“„Das müssen die Reichen bezahlen, denn die haben ja den Müntefering bezahlt.“ „Vielleicht, aber wie verhindern wir es, dass die Reichen alle auswandern?“ Das Fernsehgerät war eingeschaltet. So bekamen sie mit, dass sich die deutsche Marine ergeben hatte. „Die Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde soll morgen in Rostock stattfinden.“ „Das ist das Ende des Regimes Müntefering“, kommentierte Kopernikus. „Morgen werden wir nach Berlin fahren und dort Anschläge auf Behörden verüben, aber immer eingedenk der Tatsache, dass alles, was zerstört wurde, wieder aufgebaut werden muss.“ „Gut, wir konzentrieren uns also auf diejenigen Behörden, die nur Bürokratie erzeugen. Schulämter brauchen wir nicht, das können die Schulen selber. Und wozu dient ein Sportamt?“ „Schon mit dieser Einschränkung werden wir in Berlin viel zu tun haben.“ Jadwigas Busen schwang, während sie das sagte. Die gierigen Blicke von Heinz, aber auch der anderen Männer ließen ihre Scham feucht werden. Sie stellte sich vor, wie sie von allen drei bestiegen wurde. Sie musste schlucken und atmete schwer. „Also, ich brauche jetzt ein Schläfchen. Heinz, kommst du!“ Als die beiden das Wohnzimmer verlassen hatten, grinsten sich die beiden Offiziere an. „Was muss das für eine heftige Liebe sein!“ „Ich glaube eher, es handelt sich bei beiden um einen exzessiven Geschlechtstrieb.“ „Für mich ist das das Gleiche.“ Eine Stunde später erhielt Winjawski einen Anruf von General Jaruzelski. Dieser teilte ihm mit, dass das deutsche Heer und die Luftwaffe die Kontrolle über Deutschland wiedergewonnen hätten. Noch Anschläge auf Behörden vornehmen zu wollen, gäbe keinen Sinn. Deshalb sollten sie den Stützpunkt Kostrzyn aufgeben und nach Warszawa zurückkehren. Die Guerillaaktion sei also zu beenden. „Ab wann gilt das, Herr General?“ „Ab sofort. Morgen berichten Sie mir in meinem Büro.“ General Jaruzelski hatte die Lage etwas zu positiv dargestellt. Denn Berlin war noch nicht von Heer und Luftwaffe eingenommen, wohl aber umzingelt. Außerdem gab es noch Widerstandsnester in kleinen Städten. Aber darum mussten sich die Deutschen selbst kümmern. Er wollte unbedingt außenpolitische Konflikte vermeiden. Gerade als sich Winjawski und Kopernikus erheben wollten, um ihre Sachen zu packen, wurde die Zimmertür geöffnet und ein strahlender Heinz Kowalski trat ein, hinter ihm Jadwiga mit lieblich geröteten Wangen. Sie trug ein glattes, eng sitzendes Seidenkleid, unter dem sich die gewaltigen Brüste überdeutlich abmalten. „Was planen wir eigentlich für heute Nacht?“ Die beiden wurden darüber informiert, dass sie alle sofort abreisen müssten. „Oh, wie schade“, bedauerte Jadwiga. „Ich hätte euch so gern an meinen Busen gedrückt.“ Sie zog Winjawski, der bereits aufgestanden war, zu sich, umfasste ihn und presste ihn an sich. „Und jetzt kommst du, Majörchen.“ Major Kopernikus war etwas kleiner als Jadwiga. Sie nahm seinen Kopf und drückte ihn zwischen ihre Brüste. Mit der linken Hand fasste sie ihm zwischen die Oberschenkel. Als sie ihm ihre feuchten Lippen auf die seinen drückte, war es um ihn geschehen. Mit einigen Oh- und Ah-Lauten entwand er sich ihr und stürzte aus dem Wohnzimmer „Was hat er denn nur?“, fragte Jadwiga scheinheilig „Ach, ich glaube, er musste nur schnell seine Unterhose wechseln“, grinste der Oberstleutnant. Auf dem Parkplatz vor der Pension verabschiedeten sie sich, dieses Mal aber nur mit Handschlag. Am Ortsausgang von Kostrzyn sagte Kopernikus, der am Steuer des Autos der beiden Offiziere saß, dass er „diese Frau gern bestiegen hätte“ „Eine solche Frau lässt sich nicht besteigen, sondern sie reitet auf einem, bis sie sich befriedigt hat. Sie führt dich, und du musst dich ihren Wünschen fügen.“ Jadwiga und Heinz vergnügten sich noch zwei Wochen in der Pension. Dann kehrten sie zu ihren Ehepartnern nach Poznan zurück. Was sie denen erzählten, wissen nur sie selbst. Die Guerillagruppen unter der Leitung von Herbert Witterschlick bereisten nun seit zwei Wochen die großen Städte im Norden, Westen und Süden Deutschlands. Sie nahmen sich aber nicht mehr öffentliche Einrichtungen vor, sondern die Büros der Heilsfront „Glaube und Nation“ und der Religiösenpartei „Mit Gott“. Obwohl dort die führenden Brandstifter, Hetzer und Lügner saßen, war es den Guerilleros strikt verboten, Menschen auch nur zu verletzen. „Wir zerstören nur deren Büros, das aber radikal.“ Oberstleutnant Sanftleben und Major Dombrowski wurden jeden Tag von Witterschlick informiert, was geschehen war und welchen Eindruck sie von der örtlichen Lage hatten. Die beiden Offiziere berichteten direkt an Baudissin und Brandt. So war sichergestellt, dass die Führung von Heer und Luftwaffe den richtigen Zeitpunkt für die Überfälle auswählen konnte. An einem Samstagabend, an dem nicht damit zu rechnen war, dass sich in dem Büro der Heilsfront in der Bahnhofstraße in Heilbronn noch jemand aufhielt, hielt ein Lieferwagen der Firma „Einstein – Heizung, Strom, Sanitär“ vor dem Büro an und fuhr mit den rechten Rädern auf den Bürgersteig. Der Fahrer blieb im Fahrzeug und beobachtete das Umfeld. Doch die Bahnhofstraße blieb menschenleer. Sein Kollege öffnete die Heckklappe und stellte einen Kanister auf den Gehweg. Er ging zu dem Fahrer. „Du, über dem Parteibüro sind Wohnungen. Da können wir das Benzin nicht einsetzen.“ „Dann nimmst du eben den Sprengstoff. Aber dann müssen wir sofort abhauen. Beeil dich.“ Der Kollege stellte den Benzinkanister wieder in den Laderaum und entnahm ihm ein kleines Paket Sprengstoff, das man sowohl elektrisch als auch mit einem Streichholz zünden konnte. Zunächst öffnete er mit einer Brechstange die Eingangstür. Er wusste, dass jetzt bei einem Sicherheitsdienst Alarm ausgelöst wurde. Aber wenn dessen Leute oder die Polizei einträfen, wären sie längst weg. Er legte das Sprengstoffpäckchen unter einen der Computer und entflammte die Zündschnur mit einem Feuerzeug. Er hatte sieben Sekunden zur Flucht und rannte zu dem Lieferwagen, riss die Beifahrertür auf und sagte „los!“ Sie waren schon um die nächste Ecke gebogen, hörten aber doch noch die Detonation. Nach zehn Minuten erreichten sie die Stadtgrenze. An dem Büro der Heilsfront trafen nacheinander Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und zwei Leute der Sicherheitsfirma ein. Schnell wurde festgestellt, dass niemand verletzt war, keine Einsturzgefahr des Gebäudes bestand und auch kein Brand zu löschen war. „Schwere Sachbeschädigung“, stellte der Polizeikommissar fest. „Zerstörte Büromöbel, zerfetzte Computer, nur noch Trümmer. Das werden uns die linken Zeck…, äh, ich habe nichts gesagt.“ Die Anwesenden lachten. Jeder wusste, dass der Polizeiapparat und die Sicherheitsdienste eine Hochburg der Antidemokraten waren. Der Kommissar meldete den Vorfall sogleich seinem Vorgesetzten. Doch erst drei Tage später kam der Befehl vom Innenminister, die Parteibüros der Heilsfront „Glaube und Nation“ und der Religiösen „Mit Gott“ verstärkt zu überwachen. „Wie intensiv? Mit wie vielen Leuten? Tag und Nacht? Woher sollen wir die Beamten dafür nehmen?“ Das waren die Fragen in den Dienststellen der Polizei, auf die jedoch niemand eine Antwort bekam. An den drei Tagen, an denen nichts geschah, führten Witterschlick und seine Guerillatrupps Brand- oder Sprengstoffanschläge auf die Parteibüros in München, Nürnberg, Würzburg und Frankfurt aus. Aber auch nachdem Wachen der Polizei oder des „Volkssturms“ vor den Parteibüros aufgestellt worden waren, konnten die Guerilleros zahlreiche Parteibüros in Köln, Dortmund, Hannover und Hamburg verwüsten. Denn die Aufmerksamkeit der Wachen ließ nach und deren Disziplin war recht mangelhaft. Staatschef Müntefering tobte vor Wut, als er von der Kapitulation von Dr. Döner und seiner Marine erfuhr. „Dieses Miststück von Verräter. Ich hätte diesen schwulen Versager schon damals erschießen lassen sollen.“ Seine Berater Merz und Hohmann nickten. „Chef, wir müssen mehr Gewalt anwenden, die Bevölkerung terrorisieren, um zu zeigen, wer hier das Sagen hat.“ „Gut, schreibt mir mal eure Vorstellungen auf. In einer Stunde kommen wir wieder zusammen.“ Wenn man mich verurteilen und hängen sollte, dann werden die beiden mit mir baumeln, dachte er. Es gab ja in einer Stunde schriftliche Beweise. Für eine dringliche Nachtsitzung ließ er die Anführer der Heilsfront, Josef Dschugaschwili, Imre Orban und Witold Kaczynski, und den Anführer der Religiösen, Nikolaj Raskolnikoff, herbeibitten. Ab zehn Uhr am Abend saßen der Staatschef, seine beiden Berater und die vier fanatischen Anführer zusammen und besprachen, wie man den Staat in eine Anarchie verwandeln könne. „Liebe Volksgenossen, unsere Bewegung hat etwa vier Millionen Mitglieder. Auch wenn zahlreiche Büros zerstört sind, gibt es noch Hunderttausende von Mitgliedern, die nach Rache dürsten. Ich schlage vor, in allen deutschen Städten Straßenkämpfe mit dem Militär zu beginnen.“ Müntefering nahm nicht wahr, dass einige der Anwesenden den Kopf schüttelten, und fuhr fort. „Die Stärke von Baudissins Truppen dürfte zurzeit die Hunderttausend nicht überschreiten. Wir sind daher in der Überzahl. Die Frage ist, ob wir genügend Waffen aus den Beständen der Marine in Deutschland verteilen können.“ Es regte sich Unmut unter den Anführern. „Bis die Waffen der Marine verteilt sind, sind zwei Wochen vorbei. Mit unserer jetzigen Bewaffnung haben unsere Leute keine Chance. Daher werden sich unsere Mitglieder weigern, gegen das Militär anzutreten.“ Müntefering grinste. „Dieses Argument habe ich erwartet. Dann beschränken wir uns eben auf die Verteidigung Berlins. Die Baudissin-Truppen konnten Berlin nicht einnehmen. In Berlin müssen wir Angst und Schrecken verbreiten. Dazu werden wir Wohnungen und Häuser mit slawischen Namen an den Türschildern und Klingeln aufsuchen und die Bewohner verhaften oder massakrieren.“ „Das ist doch Quatsch. Dann werden die Leute den Einmarsch des Heeres herbeisehnen.“ Müntefering schaute Kaczynski sehr böse an. „Hast du noch mehr zu meckern?“ „Sicher, wir sollten uns in den Untergrund zurückziehen und von da aus den Staat destabilisieren.“ „Mit mir könnt ihr das nicht machen. Das ist Verrat an unserer großen Sache!“ Müntefering zog seine Pistole und schoss Kaczynski in den Kopf. „Das war auch so ein Slawe, hinterhältig, falsch, lügnerisch. Das wussten wir eigentlich schon früher. Die Slawen waren der Untergang des Germanentums. Merz und Hohmann, räumen Sie mir das weg!“ Er schaute in die Runde, während Merz und Hohmann die Leiche aus dem Besprechungszimmer zogen. „Hat noch jemand was zu meckern? Ihr wisst sicher alle, wie Stalin mit Nörglern umging.“ Er schüttete sein Glas Schnaps hinunter „Aber wir können noch mehr tun, als Chaos zu stiften. Was haltet ihr von Parolen zum Thema Heim ins Reich?“ Alle nickten beflissen. „Das habe ich auch nicht anders erwartet. Also wir heizen die Stimmung an mit Transparenten und Lautsprecherparolen. Wir wollen Schlesien, Pommern und Ostpreußen wiederhaben. Deutsche Gebiete heim ins Reich. Krönen können wir das mit: Elsass und Lothringen werden wieder deutsch. Damit werden wir die Massen begeistern. Morgen früh werde ich die Chefredakteure der Massenpresse, der Privatsender und der Internetplattformen anrufen und sie bitten“, er lachte hämisch, „entsprechende Leitartikel zu publizieren.“ Er rief seinen Diener herbei und befahl ihm, ein paar Flaschen armenischen Weinbrand zu servieren. „Das ist ein alter Tropfen, gut vierzig Jahre alt. Der wird uns glücklich machen. Nach der dritten Flasche gehen wir schlafen. Morgen gibt es viel zu tun.“ Nach der ersten Flasche wurde die Stimmung heiter bis locker. Der Diener dachte, das kann eine lange Nacht werden. Nach der zweiten Flasche wurden völkische Lieder gegrölt. Um ein Uhr schickte Müntefering alle ins Bett. Zum Frühstück um neun Uhr trafen sie sich im Salon des Staatschefs. Alle hatten gut geschlafen und litten nicht unter Kopfschmerzen. „Also, jetzt muss es zack-zack gehen. Josef, du übernimmst Ostberlin, du, Imre, Westberlin und Nikolaj die Randbezirke. Heute Abend will ich Aufmärsche Heim-ins-Reich sehen. Solche Forderungen der Massen werden zumindest diplomatische Konflikte bewirken. Besser wären militärische Angriffe aus Frankreich und Polen. Das würde das deutsche Volk zusammenschweißen. Und Heer und Luftwaffe können sich da nicht neutral verhalten.“ „Sieg Heil, unser Führer!“, schrien die Anwesenden und gingen auseinander mit dem festen Glauben, in zwei Wochen hätten sie ganz Deutschland im Griff. Danach würde man massiv aufrüsten, um die vor langer Zeit verlorenen Gebiete „heim ins Reich“ zu holen. Mit dieser Perspektive gelang es den Anführern Dschugaschwili, Orban und Raskolnikoff ihre Gefolgschaft in Begeisterung zu versetzen, viele sogar in einen rauschartigen Zustand. Auf allen großen Plätzen hielten die Anführer aufpeitschende Reden. Sie brüllten Befehle wider jede Moral, Anstand und Rechtsempfinden, und die Massen folgten ihnen. „Der Feind wohnt neben dir, betreibt eine Bäckerei oder ist Apotheker und heißt Bielinsky und ist Slawe. Er ist also Pole, Tscheche oder Slowake. Die anderen Slawen nehmen wir uns auch noch vor. Wartet nur, wir kriegen euch!“ Die Menge brüllte „Ein Volk, ein Reich, eine Rasse“, „Nieder mit den Volksverrätern“ und „Tod den Lügenpolitikern“ Am Nachmittag waren die noch intakten Geschäfte, Büros und Betriebe mit slawischen Namen verwüstet, in Brand gesteckt, aber vor allem ausgeplündert worden. Selbst ernannte „Volksankläger“ und „Volksrichter“ errichteten Standgerichte, von denen Slawen zum Tod durch Erhängen oder Erschießen verurteilt wurden. Eine ältere Frau aus dem Orient kreischte während der Verkündung der Urteile so lange, bis sie ihren Willen bekam: die Steinigung. Dies war ein langwieriges Spektakel und kostete viel Zeit. Deshalb ließ Müntefering eingreifen und verbot die Steinigung. In einer Ansprache stellte er das Verbot der Steinigung als einen Akt der christlich-jüdischen-islamischen Nächstenliebe dar. Ansonsten war Müntefering mit dem Ausbruch von Wut und Hass sehr zufrieden. Die psychischen Schäden bei den Bürgern wird man nicht in einer Generation heilen können, dachte er. Das wird meine späte Rache sein. Spät am Abend teilte man ihm mit, dass Berlin nun „slawenfrei“ sei. Schön, dachte er, und was nun? Er hatte sein Ziel erreicht, die Massen waren euphorisiert und warteten auf eine kämpferische Rede von ihm. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als die „Volksgenossen“ auf einen Krieg vorzubereiten, um die „verlorenen Gebiete heimzuholen“. Das wird zuerst ein Krieg mit Polen. Dem Volk muss ich beibringen, „die Pollacken“ hätten uns Schlesien, Pommern und Ostpreußen geraubt. Dann sind sie vom Zorn erfüllt und kriegsbereit. Aber bald fiel ihm ein, dass ihm nur die Massen in Berlin folgten, kaum jedoch in den anderen Regionen Deutschlands. Er weinte bitterlich, denn er hatte schon eine halbe Flasche von dem armenischen Weinbrand getrunken. Er rief seine Frau Anneliese an, sie möge sich heute noch nach Dänemark absetzen, bevor es in Berlin losginge. „Aber warum?“, wollte sie wissen. „Du kannst doch leicht hunderttausend fanatische Kämpfer für dich rekrutieren. Warum willst du so schnell aufgeben?“ „Weil ich keine Chance mehr sehe!“, rief er und beendete das Gespräch. Er rief seine beiden Berater herbei und befahl ihnen, seine Rede an das Volk aufzuzeichnen. Eilig stellten die beiden zwei Mikrofone auf seinen Schreibtisch. Mit gelegentlich schwerer Zunge rief er „sein Volk“ zum erbitterten Widerstand gegen die „Aggression der Slawen“ auf. „Holt euch, was euch gehört! Stürmt die Kasernen der Armee und nehmt euch die Waffen, und dann auf nach Osten! Holt euch Pommern, holt euch Schlesien, holt euch Ostpreußen! Der Sieg wird euer sein.“ „Und das sollen wir senden?“ Merz war überraschend aufmüpfig. „Weißt du, was das ist?“ Müntefering hatte die Pistole auf den Schreibtisch gelegt. „Wenn ich nicht in einer Viertelstunde meine Rede in allen Medien hören kann. Seid ihr beide tote Kerls. Alles klar?“ „Jawoll, mein Führer!“ Sie entnahmen dem Aufnahmegerät das Speichermedium und rannten hinaus. Müntefering schmunzelte. Um viertel vor zwölf wurde Baudissin informiert, dass Staatschef Müntefering eine Rede über die Medien verbreiten ließ. Er rief Peter Brandt zu sich, um diese Rede anzuhören. Die Rede war nicht lang. Nach der Rede schauten sich die beiden an. „Der ist völlig durchgeknallt. Wenn der die Massen in Berlin aufpeitscht, werden dort heute Nacht mordlustige Banden wüten. Bis morgen früh wird es weitere Tausende von Toten geben.“ „Das können wir nicht zulassen. Noch heute Nacht werden wir Berlin einnehmen. Ich denke, in zwei Stunden kann es losgehen. Wir rücken mit den Panzern vor, hinter denen fahren schnelle Lastwagen mit Soldaten. Da wird sich keiner von den Heilsfrontleuten auf die Straße wagen. Notfalls müssen wir auf diese Fanatiker schießen. Deine Hubschrauber sollten alles von oben überwachen und, wenn notwendig, Hilfe leisten. Um vier Uhr werden wir Berlin im Griff haben, also bevor die Arbeiter zur Frühschicht aufbrechen. Es ist jetzt zehn Minuten nach zwölf. Die Militärmaschinerie ist zwar schwerfällig, aber sie wird jetzt anlaufen.“ Um ein Uhr grinste Müntefering, als er erfuhr, dass sich vor dem Brandenburger Tor Tausende versammelt hatten. Parolen aus Lautsprechern heizten die Stimmung an. „Wir kacken auf die Polacken“ und „Schmarotzer aus Polen, der Teufel soll euch holen“ Transparente bekräftigten den „Willen des Volkes, Pommern, Danzig, Ostpreußen und Schlesien heim ins Reich zu holen“ Die Menge wälzte sich über die Prachtstraße Unter den Linden in Richtung Alexanderplatz. Dass keins der Luxusgeschäfte geplündert wurde, dafür sorgten die Ordner der Heilsfront. Denn die Geschäfte gehörten nicht Polen, sondern internationalen Konzernen. Müntefering verfolgte den Marsch der Massen auch über die installierten Kameras mit Gesichtserkennungsprogrammen. Damit konnte jeder Bürger identifiziert werden. Seine Anführer Dschugaschwili, Orban und Raskolnikoff hatten ganze Arbeit geleistet. Sogleich verfiel sein Pessimismus, und Glücksgefühle ergriffen ihn. Baudissin und Brandt saßen noch lange zusammen und besprachen, wie das Militär in der Nacht vorgehen solle. „Ich denke, wir lassen die Panzer aus allen Richtungen in das Zentrum vorrücken. Wir verfügen über 80 Panzer, das muss ausreichen.“ „Einverstanden, du bist der Chef des Heeres. Ich werde mich gleich mit einer Hubschrauberstaffel in die Lüfte erheben und die Lage in Berlin erkunden. Ich hoffe, die Heilsfront hat keine Luftabwehrraketen.“ General Brandt informierte die Hubschraubereinheit und ließ sich zum Flugplatz Dedelow fahren. Während der Fahrt schüttete der Fahrer sein Herz aus. „Ich bin sehr erleichtert, dass die Armee endlich etwas gegen diese Mörderbanden tut. Mein Nachbar ist vor ein paar Tagen von diesem Pack zusammengeschlagen worden, bloß, weil er Tilkowski heisst. Was haben die Religiösen und die Chauvinisten denn auf einmal gegen Polen und andere Slawen?“ „Ja, manche Politiker brauchen ein schwarzes Schaf, einen Sündenbock, auf den sie die Massen hetzen können, um von den eigenen Mängeln abzulenken. Dadurch legitimisieren sie ihre Macht. Früher waren das die Juden, heute eben die Slawen. Aber damit wird jetzt Schluss sein, noch heute Nacht.“ „Schön wär’s ja“, sagte der Fahrer mit einer gewissen Skepsis in der Stimme. General Brandt nickte. „Wissen Sie, das Heer und die Luftwaffe sind in den letzten zehn Jahren systematisch von der Regierung Müntefering kaputtgespart worden. Überall fehlt es an Waffen, Munition. Fahrzeugen, Kampfpanzern und Flugzeugen. Der Haushalt des Kriegsministeriums bestand fast nur noch aus Marine. Deutschland muss auf allen Weltmeeren präsent sein, hieß die politische Parole. Flugzeugträger und Nuklearraketen auf U-Booten mussten her. Damals waren wir sozusagen von Freunden umzingelt. Da meinte man, keine Landstreitkräfte mehr. Man meinte, man solle abrüsten. Das war ja richtig. Aber wer hat damals daran gedacht, dass die Entwicklung neuer Waffensysteme zwanzig Jahre braucht? Die Politiker sicher nicht. Niemand hat sich überlegt, welche Sicherheitslage in zwanzig oder dreißig Jahren bestehen könnte.“ „Herr General, wir sind da.“ Der Luftwaffenchef bedankte sich und stieg aus. Fünf Kampfhubschrauber waren einsatzbereit. Immerhin, dachte Brandt. Er liesßKanister mit Nervengas an die Hubschrauber montieren. Denn er hatte sich mit Baudissin abgestimmt, dass der Einsatz von Schusswaffen oder gar Bomben unverhältnismäßig wäre und nur zu einer weiteren Eskalation führen würde. Es sollte gewartet werden, bis die Fanatiker den Alexanderplatz erreicht hatten, um dort das Nervengas einzusetzen. Dieses würde die Menge für Stunden lähmen und bewegungslos dahindämmern lassen. Sie würden dann mit Bussen und Lastwagen abtransportiert und in Lager in Brandenburg, Mecklenburg und Vorpommern gebracht. Später sollten sie alle vor Gericht gestellt werden. „Vor reguläre Gerichte“, verlangte Baudissin. „Und wenn das zehn Jahre dauert.“ Die Hubschrauber flogen los und erreichten bald das Brandenburger Tor und die Straße Unter den Linden. Brandt schätzte, dass die Demonstranten in fünf Minuten am Alexanderplatz ankommen würden. Er ließ die Hubschrauber so fliegen, dass sie die Menschen vor sich hertrieben. Man konnte zahlreiche Leute mit Waffen erkennen, Doch sie konnten die Hubschrauber nicht gefährden, weil die Entfernung zu groß war. Brandt konnte die Parolen, die aus den unter ihnen fahrenden Autos abgespielt wurden, nicht hören. Aber an den Reaktionen der Marschierenden war zu erkennen, dass zu Hass und Gewalt aufgefordert wurde. Inzwischen hatte Baudissiin zweihundert Busse von den Berliner Verkehrsbetrieben beschlagnehmen lassen. Diese waren um den Alexanderplatz verteilt. Als die letzten Marschierer den Alex erreichten, gab Brandt den Einsatzbefehl, etwa zehn Meter über die Köpfe, und das Nervengas ausströmen zu lassen. Er sah, wie die Leute, überwiegend Männer, zusammensackten „Schlaft schön“, murmelte Brandt und übermittelte die Nachricht an das Heer, sie könnten die Schläfer in einer halben Stunde einsammeln. Sie vergewisserten sich, dass auch in den Nebenstraßen die Kämpfer betäubt auf der Straße lagen, und kehrten zurück zum Flugplatz Dedelow bei Prenzlau. „Die werden nicht erfrieren, die Nacht ist ja noch warm. Außerdem werden sie in Kürze in die Busse verladen.“ Baudissin war es gelungen, auch Fahrer für die Busse zu rekrutieren, in manchen Fällen erst nach Androhung von Gewalt. Für die Bewachung der Gefangenen während der Fahrt zu den Internierungslagern waren für jeden Bus drei Soldaten abkommandiert, bewaffnet mit Maschinenpistolen und Mikrowellenkanonen. Das größte Problem bestand in der zügigen Beladung der Busse mit den Betäubten. Dazu ließ er die Besucher eines Rockkonzertes auf der Freilichtbühne im Volkspark Friedrichshain verhaften und zum Alex marschieren. Die überwiegend jungen Leute fügten sich murrend, aber dann doch willig. Denn man hatte ihnen beliebig viel Freibier auf der Freilichtbühne nach der Verladeaktion versprochen. Daher beteiligten sich sogar die Musiker, die Betäubten in die Busse zu verfrachten. Um halb vier waren alle Busse abgefahren. Todmüde ließ sich Baudissin auf seine Schlafpritsche fallen. Morgen werden wir wissen, ob auch Anführer von Heilsfront und Religiösen gefasst wurden. Schade, dass das die Inge nicht mehr erleben konnte. In tiefer Nacht wurde Müntefering von seinem Berater und jetzigem Adjutanten Friedhelm Merz telefonisch geweckt. Der Schlaftrunkene musste sich eine schlimme Nachricht anhören. „Was, der Marsch in den Osten ist gescheitert?“ Sofort wurde er hellwach und ließ sich Genaueres berichten. „Das ist wohl das Ende. Ich werde euch und meinen anderen treuen Anhängern eine Vollmacht geben, damit ihr euch aus dem Staatshaushalt bereichern könnt. Danach solltet ihr sofort auswandern. Kapiert? Die Vollmacht wird in meinem Vorzimmer liegen.“ Er beendete das Gespräch. Zwei Millionen für jeden sollten ausreichend sein, um in einem fernen Land ein neues Leben anzufangen, dachte er. Dann nahm er sich eine Flasche des armenischen Weinbrandes vor. Um sechs Uhr schrillte Baudissins Wecker. Obwohl er aus dem Tiefschlaf gerissen wurde, zeigte er Disziplin, machte eine schnelle Katzenwäsche und schlüpfte in seine Uniform. Er frühstückte mit Brandt und einigen hohen Offizieren in der Kantine. „Meine Dame, meine Herren, heute werden wir Berlin einnehmen, das Kanzleramt und die Ministerien besetzen und Münte verhaften. Dann werde ich mich an die Bürger wenden, um eine neue deutsche demokratische Republik auszurufen. Zwei oder drei Monate später müssen wir sehen, was machbar ist. Dann sollen die Bürger entscheiden, von wem sie regiert werden wollen. Bis dahin wird es eine Militärregierung geben unter meiner Leitung mit eurer Hilfe, aber vor allem mit der Unterstützung durch einen Runden Tisch der demokratischen Kräfte. Zu diesem Runden Tisch werde ich in meiner Ansprache sehr viel sagen. Ich hoffe, Sie sind mit meinen Vorstellungen einverstanden.“ Alle nickten, aber Frau Oberst Gisela Merkel von der Luftwaffe wollte die allgemeine Zustimmung präzisieren und nicht nur als bloße Jasagerin dastehen. Mit ihren fünfzig Jahren war sie eine äußerst attraktive Frau, die wusste, wie man mit Männern umgeht. „Lieber Herr General, aus unserem Kreis, aber auch außerhalb, sind doch nur Sie befähigt, die Staatsgeschäfte zu lenken.“ Sie wandte sich ihrem Chef Brandt zu. „Ich hoffe doch, dass Sie mir meine Bemerkung nicht übel nehmen. Denn nur Baudissin hat auch Erfahrung als Regierungschef. Wir können es uns nicht leisten, die Monate bis zur Wahl ohne ein Gesamtkonzept zur Gestaltung Deutschlands zu vertrödeln. Die Weichen für ein neues Deutschland müssen vor der Wahl gestellt sein. Wenn dann der Wähler etwas anderes will, dann haben wir eben verloren. Aber bis dahin müssen wir die Menschen überzeugen, dass eine religiöse, nationalistische oder kapitalistische Diktatur sehr schlecht für sie ist und die Diktatoren nur betrügen und das Volkseigentum klauen.“ „Ich danke Ihnen, Frau Merkel. Besser hätte ich das auch nicht formulieren können.“ Baudissin verabschiedete die Teilnehmer des Frühstücks mit den Worten: „Denken Sie daran: Wir tun das alles nicht für uns, sondern für unsere Vorstellung von einem würdevollen Leben.“ Er stand an der Tür der Kantine und blickte den Offizieren nach. Mannomann, was hat die für tolle Beine! Sie trägt schwarze Strümpfe mit Naht und hochhackige Schuhe. Ach ja, die Frauen. Er atmete tief. Nach dem Berufsverkehr rückten Panzer aus allen Himmelsrichtungen in das Zentrum Berlins vor. Am Himmel kreisten Hubschrauber und überwachten die Dächer und die Straßenschluchten. Aber es regte sich keinerlei Widerstand. Um halb elf erreichten die Panzer das Kanzleramt. Baudissin, Brandt und einige Offiziere des Generalstabs hörten den Funkverkehr des Heeres und der Luftwaffe ab. „Das ist ja erstaunlich. Kein Widerstand. Noch vor Wochen schien das Volk nur aus glühenden Chauvinisten und fanatischen Religiösen zu bestehen. Wo sind die alle?“ „Ich glaube, unsere Aktion gestern Nacht hat die Leute wohl beeindruckt. Die Gerüchte nach der Aktion zeigten ja, dass die Leute glauben, wir hätten tödliches Giftgas eingesetzt. Da traut sich niemand mehr auf die Straße.“ „Ich finde, wir haben das richtig gemacht. Der Pöbel muss eingeschüchtert werden. Seit Jahrzehnten gibt es zu viele Dumpfbacken, die ihre unqualifizierte Meinung bei jeder Gelegenheit herauskotzen.“ „Und es gibt zu viele Kriminelle, die sich auf Kosten anderer bereichern.“ „Leute, Leute“, mahnte Baudissin. „Wir sind zusammengekommen, um ein Konzept für das neue Deutschland zu finden. Da hilft es nichts, in der verpfuschten Vergangenheit zu wühlen. Was wir jetzt brauchen, ist eine zündende Idee zur Versöhnung der gespaltenen Gesellschaft.“ Ein Soldat trat ein und überreichte ihm eine Meldung. „Staatschef Müntefering wurde in seinem Büro tot aufgefunden, vermutlich Selbstmord durch eine Zyanid-Kapsel und einen Schuss aus seiner Pistole.“ Baudissin las die Meldung vor und lachte zynisch auf: „Das feige Schwein hatte die Hosen voll vor einem Gerichtsprozess. Den hätte ich gern erwürgt.“ Er setzte sich. „Entschuldigen Sie meinen Ausbruch der Gefühle. Auch ich habe mich nicht immer unter Kontrolle. Das wird nicht mehr geschehen. Ich denke, schon in einer halben Stunde sollten die Bürger und die Welt wissen, was hier geschehen ist und wer jetzt das Sagen hat. Gut, eine halbe Stunde ist nicht viel Zeit. Sie entschuldigen mich, ich muss sofort meine Rede schreiben.“ Als er den Raum verlassen hatte, hörten die Offiziere den militärischen Funkverkehr ab und beobachteten die Meldungen in den Medien. Über den toten Staatschef gab es keine weiteren Erkenntnisse. Die Beamten und Angestellten aus Münteferings Regierungsapparat waren verschwunden, die Führungsetagen der Ministerien verwaist und die Zentralen der Heilsfront und der Religiösen leer geräumt. „Wahrscheinlich wird in zehn Jahren behauptet, eine Allianz zwischen religiösen Fanatikern und faschistischen Nationalisten habe es nie gegeben.“ „Und wenn doch, dann nur zur Rettung des deutschen Volkes vor dem bösartigen Slawentum.“ „Angebliche Plünderungen von slawischen Geschäften sind eine Erfindung der Engländer. So etwas werden wir uns dann anhören müssen.“ „Und um das zu verhindern, werde ich eine Regierung Baudissin energisch unterstützen“, beendete Oberst Gisela Merkel die Debatte, die ihr zu pessimistisch zu werden drohte. „Gibt es in diesem Kreis jemanden. Der glaubt, er werde es besser machen, als Baudissin? Oder auch jemand aus den Unternehmen, Gewerkschaften oder wissenschaftlichen Instituten? Ich sehe da niemanden. Also: Baudissin ist der Beste. Jetzt können wir die politischen Leitlinien vorgeben, nach der Wahl können wir das nicht mehr. Wir sollten seine Rede in allen Medien verbreiten. Ich werde mich darum kümmern, dass alle Bürger diese Rede anhören.“ Die anderen nickten zustimmend. Oberst Merkel verließ den Besprechungsraum. Die verbliebenen Offiziere besprachen, wann die erste freie Wahl stattfinden könne. „Ich denke, man muss den Menschen genug Zeit lassen, damit sie sich in Parteien, Bürgerbewegungen oder Bündnissen organisieren können. Dafür wird ein halbes Jahr reichlich knapp bemessen sein.“ „Das sehe ich auch so. Außerdem brauchen wir als Militärregierung mindestens einen Monat, um eine funktionierende Verwaltung in Gemeinden und Städten aufzubauen. Dazu müssen wir demokratisch denkende und entscheidungsfreudige Menschen gewinnen.“ „Dafür wären die Runden Tische gerade richtig. Dort lernen sich die Leute kennen, und sie sehen schnell, wer ein Schwätzer, Karrierist oder Ideologe ist. Auf diese Weise kann auch verhindert werden, dass sich alte Kämpfer der Nationalisten oder der Religiösen in den Prozess der Demokratisierung einschleichen.“ „Gut, wenn man das alles bedenkt, ist es wohl sinnvoll, die Wahl erst in acht oder neun Monaten vorzusehen.“ Es war eine halbe Stunde vergangen. Oberst Merkel kehrte in den Besprechungsraum zurück. „Ich habe es geschafft. Um zwei Uhr werden alle Sender, Medienplattformen und Online-Zeitungen die Rede von Baudissin senden. Die laufenden Filmchen, Talkshows, Tiersendungen und so weiter werden unterbrochen. Eigenmächtig habe ich gesagt, die Ansprache des Chefs der Militärregierung werde zwanzig Minuten dauern.“ Die anderen Offiziere nickten anerkennend. Einer von ihnen dachte, das war doch damals eine gute Entscheidung, die Uniform für weibliche Offiziere von dem Modezaren Gucci entwerfen zu lassen. Figurbetonter ginge es kaum noch. Die Frau Oberst könnte sich für jedes Modejournal fotografieren lassen. Vermutlich auch nackt für eine Sexzeitschrift. Er konnte seine sinnlichen Gedanken leider nicht weiterspinnen, denn Baudissin betrat den Sitzungsraum. Erfreut nahm er zu Kenntnis, dass der Sendetermin geregelt war. „Gut, dann gehen wir schnell was essen. Dabei werde ich den Inhalt meiner Rede skizzieren.“ In der Kantine gab es nur ein begrenztes Angebot: Kaninchen in Weißweinsauce mit Brokkoli und Schupfnudeln und Ravioli, gefüllt mit Meeresfrüchten, dazu geschmortes Wurzelgemüse. Baudissin gelang es, abwechselnd zu kauen, herunterzuschlucken und zu reden. Am Ende der Mittagspause wurde sein Redekonzept nicht nur sehr wohlwollend, sondern eher begeistert akzeptiert. Oberst Gisela Merkel lächelte ihn an. Um vierzehn Uhr schaltete sich beim Privatdetektiv Witterschlick der Monitor für Kommunikation ein. Er hatte gerade mit seiner Geliebten Helga Schidlowski zu Mittag gespeist, ein einfaches Mahl, wie er es angekündigt hatte, bestehend aus einer Meeresfrüchtesuppe, gebratenem Seewolf mit geschmorten Steinpilzen und Reis und Himbeerpfannkuchen. Helga fühlte sich selig, zumal sie bei den gereichten Weinen tüchtig zugelangt hatten. Herbert betrachtete gierig seine Helga. Doch auf dem Monitor erschien die Meldung: „Jeder Bürger ist verpflichtet, die Ansprache des Chefs der Militärregierung, General Lothar Baudissin, anzuhören. Die Militärregierung.“ Nach einer Minute erschien Baudissin auf dem Bildschirm, in Uniform, grauhaarig und milde lächelnd. Herbert Witterschlick sprang auf: „Da haben sie es doch geschafft. Dieser Gangster Müntefering ist offenbar entmachtet worden. Dafür habe auch ich gearbeitet. Das weißt du ja. Aber jetzt hören wir erst einmal seine Rede an. Danach werde ich dich aufspießen.“ Helga griff sich zwischen die Schenkel. Doch er schüttelte den Kopf. „Zuerst müssen wir seine Rede anhören.“ „Liebe Bürger Deutschlands, liebe Bürger aus anderen Staaten. Deutschland hat die schwere Zeit einer brutalen Diktatur hinter sich. Die Menschen, die in dieser Zeit anständig geblieben sind, können aufatmen und sich frei fühlen. Doch diejenigen, die sich schuldig gemacht haben durch Diebstahl, Brutalität, Folter und Mord, die werden vor ordentliche Gerichte gestellt und mit aller Härte bestraft.“ Herbert quatschte dazwischen: „Oder befördert, wie nach der Nazizeit 1945.“ Helga legte den Zeigefinger auf den Mund „Zuerst wird die Militärregierung dafür sorgen, dass die Versorgung mit Strom, Trinkwasser und Lebensmitteln wieder funktioniert. Wir können eine neue Demokratie nur aufbauen, wenn sich überall Bürger engagieren, in Gemeinderäten mitwirken und für das Amt des Bürgermeisters kandidieren. Als ersten Schritt wird die Militärregierung die Etablierung von Runden Tischen in allen Gemeinden unterstützen. In jedem Ort soll sich eine Gruppe von Bürgern zusammensetzen und überlegen, welche die dringlichsten Maßnahmen sind. Diese Bürger werden das Rückgrat des künftigen Gemeinderates bilden. Die Unternehmen, gerade auch die kleinen, fordere ich auf, ihren Mitarbeitern die Zeit für eine ehrenamtliche Tätigkeit bei den Runden Tischen zu geben. Die Militärregierung wird dafür Steuererleichterungen gewähren. Aber auch die Unternehmer selbst sind aufgerufen, sich an den Runden Tischen zu beteiligen. Nur der wirtschaftliche Sachverstand der kleinen und mittleren Unternehmen kann Deutschland wieder voranbringen. Nationalistischer und religiöser Wahn haben uns zwanzig Jahre zurückgeworfen. Aber ab morgen werden wir in die Hände spucken und Deutschland wiederaufbauen. Manche von Ihnen werden skeptisch sein und fragen, wie lange das denn dauern solle. Wir sagen, schon im nächsten Jahr wird es wieder aufwärts gehen. Wir werden wieder für Sicherheit sorgen, in jeder Stadt, in jedem Dorf. Die chauvinistischen und religiösen Terroristen sind verhaftet worden und können keine Anschläge mehr verüben. Wir werden in Kürze wieder ein demokratisches und sicheres Land sein, in dem niemand um seine Sicherheit fürchten muss. Deshalb rufen wir alle demokratisch gesinnten Mitbürger auf, sich in neuen Parteien, Gruppierungen, Initiativen oder anderen Organisationsformen zusammenzufinden und sich in den ersten freien Wahlen seit langer Zeit zur Wahl zu stellen. Die alten Parteien haben versagt, in fast allen Ländern der Welt. Überall haben sich im letzten halben Jahrhundert Karrieristen, Schwätzer, Populisten und Faulpelze der alten Parteien bemächtigt und deren Mitglieder und nicht zuletzt die Bürger mit leeren Versprechungen enttäuscht. Deshalb ist die Wahlbeteiligung immer mehr gesunken, weshalb oft nur 30 % der Wahlberechtigten den Präsidenten, Regierungschef oder die Parlamentsmehrheit gewählt haben. In vielen Staaten musste man mehrfacher Millionär oder eher Milliardär sein, um einen Wahlkampf bestreiten zu können. Ich verspreche, dass die Militärregierung solche Zustände verhindern wird. Liebe Mitbürger, wir können am heutigen Tag noch nicht sagen, wann die erste Gemeindewahl und die erste Parlamentswahl stattfinden werden. Ihr Bürger braucht Zeit, um euch zu einigen und Wahlprogramme zu formulieren. Und unsere Verwaltungen benötigen einen angemessenen Zeitraum zur Vorbereitung der Wahlen. Entschieden haben wir aber bereits jetzt: Jeder junge Mensch ab 16 Jahren wird wahlberechtigt sein. Gerade die ganz junge Generation soll sich frühzeitig an der Gestaltung ihrer Zukunft beteiligen. Die erste Kommunalwahl soll noch im Dezember stattfinden, die Parlamentswahl spätestens im April des nächsten Jahres. Kurz ansprechen möchte ich unsere Anliegen zur sozialen Gerechtigkeit. Schon vor langer Zeit haben Soziologen, Journalisten und einige wenige Politiker die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich beschworen. Aber um diese Kluft zu beseitigen, ist fast nichts geschehen. Die Reichen wurden reicher und immer mehr und die Armen ärmer und ebenfalls immer mehr. Warum muss ein Konzernvorstand tausend Mal so viel verdienen wie sein Pförtner? Warum verdienen Sportfunktionäre, Lobbyisten oder Funktionäre von Wirtschaftsverbänden zehn bis hundert Mal so viel wie der Kanzler? Leisten die alle so viel mehr? Das glaubt doch niemand. Solches Schmarotzertum werden wir unterbinden. Noch krasser als die Verteilung der Einkommen erscheint uns die Vermögensverteilung.“ Herbert räusperte sich. „Der Mann gefällt mir. Wenn der an die großen Vermögen rangeht, dann bin ich begeistert und ziehe meinen Hut.“ Helga bedeutete ihm zu schweigen und drückte ihre Brüste unter dem schwarzen Plisseekleid hoch und ließ sie wippen. Das Plisseekleid war nicht völlig undurchsichtig, und sie trug keinen Büstenhalter darunter. Sie lächelte und deutete auf den Monitor. Baudissin fuhr gerade fort: „Wir werden nicht länger akzeptieren, dass den zehn Prozent der Vermögenden siebzig Prozent des Volksvermögens gehören und die breite Masse nichts oder fast gar nichts besitzt. Bisher wurden durch eine viel zu niedrige Erbschaftssteuer ganze Generationen von Lebemännern und -damen, Nichtstuern und Schmarotzern in die Welt gesetzt. Dagegen wussten die Kinder von Geringverdienern schon von klein an: Wir werden nichts erben. Während das Leben für diese Menschen beim Start bei Null losging, hatte es die erste Generation der reichen Erben leicht, ihr Vermögen zu vermehren, und die folgenden Generationen konnten es leicht vervielfachen. Die Militärregierung sieht es als ihre Pflicht an, leistungslose Einkommen aus Vererbung erheblich höher zu besteuern. Wohlgemerkt, es geht uns nicht um das Einfamilienhäuschen, das kleine Aktienpaket und Omas Sparbriefe. Die sind und bleiben von der Erbschaftssteuer befreit. Es geht uns darum, die Macht der Erben riesiger Vermögen zu reduzieren. In den nächsten Wochen werden wir der Bevölkerung und den Runden Tischen unsere Vorschläge vorlegen. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und einen angenehmen Abend.“ Der Monitor wurde automatisch ausgeschaltet. Helga legte sich rücklings auf das Sofa, zog das schwarze Plisseekleid hoch und zeigte auf ihre nackte Scham. Nach einer Viertelstunde schliefen sie erschöpft ein. Schon am nächsten Tag klingelten sie an den Wohnungen in der Gemeinde und warfen Flugblätter zur Gründung des Runden Tisches in die Briefkästen. Wenn ihnen die Tür geöffnet wurde, nahmen sie die Gelegenheit wahr, ausgiebig mit den Bürgern zu sprechen. Es galt, die Menschen von der Diktatur zur Demokratie umzuerziehen. Zu ihrem Erstaunen waren die meisten Gesprächspartner geneigt, zu der Gründungsversammlung des Runden Tisches zu kommen. Am nächsten Donnerstag war der Gemeindesaal der evangelischen Kirche übervoll. Viele mussten sich mit Stehplätzen begnügen. Der evangelische Pfarrer, der katholische Priester und der muslimische Imam hatten sich auf diesen Saal geeinigt, weil er der größte im Ort war. Sie wollten den Runden Tisch gemeinsam beherbergen. Es ging einigermaßen gesittet zu, vielleicht, weil die Versammlung von mehreren Medien aufgezeichnet wurde und die drei Priester sichtbar anwesend waren. Geschickt lenkte Helga Schidlowski als gewählte Versammlungsleiterin die Diskutanten immer wieder auf die Kernthemen. Da sich die Menschen erst einmal kennenlernen sollten, verzichtete sie auf Beschlüsse, sondern bat, die vorgebrachten Ideen mit Nachbarn und Bekannten zu diskutieren. Man werde in der nächsten Woche wieder zusammenkommen, um abzustimmen. Nach der Veranstaltung sollten die Aktiven miteinander sprechen. Deshalb hatten die drei Priester einige Flaschen Grappa spendiert. Helga und Herbert sanken um zwei Uhr ziemlich betrunken ins Bett. Baudissin hatte die Offiziere des engeren Kreises der Militärregierung gebeten, nach seiner Rede in das Besprechungszimmer zu kommen „Meine Dame, meine Herren, Sie haben ja gehört, was ich erzählt habe. Nun kommt es darauf an, dass wir
Отрывок из книги
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
.....
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
.....