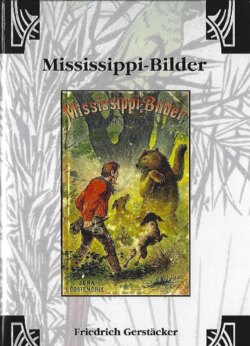Читать книгу Mississippi-Bilder - Gerstäcker Friedrich, Jurgen Schulze - Страница 1
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеGesammelte Schriften
Friedrich Gerstäcker
Mississippi-Bilder
Licht- und Schattenseiten transatlantischen Lebens
Volks- und Familien-Ausgabe Band Zehn
der Ausgabe Hermann Costenoble, Jena
Friedrich-Gerstäcker-Gesellschaft e.V., Braunschweig
Ungekürzte Ausgabe nach der ersten Buchausgabe, Arnoldische Buchhandlung, Dresden u. Leipzig, 1847 u. 1848 in 3 Bänden. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Thomas Ostwald und Prof. Dr. Wolfgang Hochbruck, sowie mit Hinweisen auf die Erstveröffentlichungen der Erzählungen.
Ein Teil der Illustrationen wurde dem Band Western Lands and Western Waters, 1864, London, entnommen.
Wir bedanken uns für die finanzielle Unterstützung bei der Realisierung der vorliegenden Buchausgabe beim Verkehrsverein Braunschweig – Netzwerk der Tradition.
Friedrich-Gerstäcker-Gesellschaft e.V. u. Edition Corsar
Braunschweig. Geschäftsstelle Am Uhlenbusch 17
38108 Braunschweig
Alle Rechte vorbehalten. © 2013 / 2020
Die Sklavin
Amerikanische Nachtstücke. Die Sclavin in:
Das Pfennig-Magazin für Belehrung und Unterhaltung. Neue Folge.- F. A. Brockhaus, Leipzig, 1845.
Das Mail- oder Postboot war eben von New Orleans angelangt, und über die von demselben ans Ufer geschobene Planke strömten in ununterbrochenem Zuge fast alle Geschäftsleute und Müßiggänger der kleinen Stadt Bayou Sara1 an Bord, um teils für sie angekommene Briefe und Pakete in Empfang zu nehmen, teils ihre Neugierde zu befriedigen, und an dem zierlich ausgeschmückten Schenkstande ein Glas Brandy und Eiswasser zu schlürfen.
Der Kapitän des Postbootes, ein kleiner Franzose mit grauem Rock, schwarzem Filzhut und außerordentlich blank gewichsten Stiefeln, schien überall zu sein, und während ihm große Schweißtropfen an der geröteten Stirn glänzten, schimpfte er in fürchterlich gebrochenem Englisch auf Gott und die Welt, vorzüglich aber auf den Postmeister, der ihm aus seinem Comptoir, eben als er kaum den Rücken gewandt, ein Paket Briefe in zu großem Amtseifer entführt und mit hinauf auf die Post genommen hatte.
„God dam him!“ wetterte der kleine Mann, mit der Faust auf das grünbeschlagene Pult niederschlagend, dass die Tinte hoch empor spritzte. „Was hat der Pflasterschmierer (der Postmeister hatte zu gleicher Zeit eine Apotheke und einen Kramladen, und ließ sich gern ,Doktor‘ nennen) in meinem Comptoir zu suchen? Schleppt Briefe hinauf, eh? Denkt nachher Wunder, was er getan hat; aber wart‘ – Du kommst mir wieder.“
„Kapitän! Briefe für mich angekommen?“ fragte ein junger, schlanker Mann, dem Erzürnten lachend dabei auf die Schulter klopfend.
„Geht in die Hölle oder zum Quacksalber hinauf!“ fluchte dieser weiter, ohne sich nur die Mühe zu nehmen, herumzuschauen, wer ihn angeredet habe.
„Hallo! Was ist wieder im Wind?“ lachte der junge Pflanzer. „Die Kessel voll zum Zerplatzen? Dampf genug, um drei gewöhnliche Boote in die Luft zu blasen! Immer noch der Alte! Ihr Franzosen seid doch sonderbares Volk; gleich Feuer und Flamme, wie Duponts Schießpulver!“2
„Der Postmeister hat die Briefe mit hinaufgenommen,“ antwortete der Buchhalter statt des Kapitäns.
„Dam him!“ rief dieser, und warf die Glastür hinter sich ins Schloss, dass die Scheiben klirrten. „Never mind“, sagte der Pflanzer, „er will gern seine Viertel-Dollars dafür ziehen – alles zu Onkel Sams3 Bestem, ‘s ist ein gar uneigennütziger Mann, ich kenne ihn wohl; wer einen Brief abholt, muss auch eine Kleinigkeit im Laden kaufen, oder eine Schachtel Medizin mitnehmen. Doch ich will hingehen und sehen, ob etwas für mich angekommen ist.“
Damit trat er hinaus auf den Gang, stieg die Kajütentreppe hinunter, und war eben über die Planke ans Ufer gesprungen, als er eine Hand auf seiner Schulter fühlte, und ihn eine freundliche, wohlbekannte Stimme anredete:
„Hoho, Ned, wohin so eilig? Rennst Du doch, als ob Du von einer Wahl kämst und die wichtigsten Neuigkeiten mitbrächtest!“
„Guston! Bei allen Teufeln und Engeln der vier Elemente“, rief der also Angeredete in freudigem Erstaunen aus. „Guston! Aber wie um des Himmels Willen kommst Du denn jetzt hierher, wo ich Dich ehrbar und fest in Connecticut angesiedelt glaubte; hast Du die östlichen Staaten schon satt?“
„Vollkommen, mein alter Junge, vollkommen“, entgegnete Guston. „Der Böse hole die freien Staaten; ein Pflanzer kann nun einmal da nicht existieren, wo kein Sklavenhandel ist. Ich hatte erst allerlei phantastische Ideen von der Freiheit und Gleichheit der Menschen“, fuhr er fort, als er seinen Arm in den des jungen Mannes hing und mit ihm an das Ufer hinauf schlenderte. „Ich glaubte es eine Sünde, meinen ,schwarzen Bruder‘, wie die Methodisten sagen, zu schinden und zu plagen, bat daher meinen Alten um Reisegeld und ging nach New York. Von dort aus schrieb ich Dir, dass ich gesonnen sei, mir ein Landgut zu kaufen und mich im Norden des Staates oder in Connecticut, zwischen den dort eingewanderten gemütlichen Pennsylvaniern niederzulassen. Es war damals meine Absicht, und hätte ich es getan, so ständen wir jetzt nicht hier auf louisianischem Grund und Boden zusammen; gerade damals lernte ich aber einen jungen Mann kennen, dem ich mich anschloss und dessen intimer Freund ich wurde, so dass ich, da er in Geschäften nach Europa musste, mit ihm ging und mit dem Great Western hinüber nach dem ,alten Lande‘ segelte.“
„So bist Du indessen in Europa gewesen?“ unterbrach ihn erstaunt der junge Pflanzer.
„Gewiss“, nickte Guston, „in England, Irland und Deutschland; durch die ersten beiden Länder begleitete ich meinen neugefundenen Freund, bis dieser sich plötzlich in ein irländisches Mädchen, und zwar so rasend verliebte, dass er in vier Wochen Hochzeit hielt, gegenwärtig mit allen möglichen alten Squires und jungen Gentlemen nach Füchsen und Kirchtürmen rennt, über alle nur aufzufindenden Hecken, Gräben und Mauern wegsetzt, und sich jetzt, wenn er nicht unter der Zeit den Hals gebrochen hat, ganz wohl befindet. Ich selbst hatte es da bald satt, ging zurück nach England und ließ mich von da nach Deutschland übersetzen. Dort hatte ich Gelegenheit, das Leben der unteren Volksklassen, das Leben der A r m e n kennen zu lernen, und, Ned, von dem Augenblick an bedauerte ich unsere Sklaven nicht mehr. Es muss hart sein, die Freiheit zu verlieren und der Willkür eines oft vielleicht zu strengen Herrn preisgegeben zu werden; aber das Elend, das ich dort gesehen, die N a h –
r u n g s s o r g e n der Unglücklichen, vor deren Augen die eigenen Kinder darben und verderben; der Frost noch dazu im Winter, wo der Vater, der einzige Brotverdiener, e i n g e k e r k e r t wird, wenn er den Jammer zu Hause nicht mehr mit anschauen mochte, und in den Wald ging, um ein paar Zweige abzubrechen und die Seinigen wenigstens zu erwärmen, wenn er sie nicht sättigen konnte – der eingebildete, förmlich wahnsinnige Stolz des Adels dabei, gegenüber den unglücklichen Armen – und außerdem noch eine ,gesetzliche‘ Willkür, die dem Unglücklichen mit dem vollen Pomp und Schein offenbarer Gerechtigkeit mit gierigen Händen das L e t z t e nimmt und dem Vernichteten in der Pracht und dem Luxus der Großen wie zum Hohn alles das zeigt, was er eben entbehren muss, nicht einmal imstande, seine Kinder so zu füttern, wie die H u n d e der Großen gefüttert werden – und das, Ned, füllte mich mit Ekel und Überdruss, und ich kann Dir gestehen, ich war froh, als ich das ,alte Land‘ wieder hinter mir hatte. Es mag denen dort zusagen, die es ihre H e i m a t nennen, der Eskimo liebt ja seine Eisberge und Trannahrung, aber dem, für den es diesen Zauber entbehrt, ist es ein trauriger Aufenthalt – ich möchte dort nicht leben. Nach kurzem Aufenthalt in Deutschland kehrte ich über Hamburg nach New Orleans zurück, und bin heut, wie Du mich siehst, mit dem Postboot heraufgekommen, um von hier zu Land meines Vaters Plantagen zu erreichen.“
„Das zu lernen, brauchtest Du wahrhaftig nicht nach Europa zu gehen“, lachte Ned, „das weiß jedes Kind, dass es unsere Neger besser haben als die armen Leute in Irland oder Deutschland, hol‘ sie der Henker, und doch murren die Kanaillen; aber heut Abend bleibst Du bei mir, und morgen früh nimmst Du mein Pferd, dein Alter hat Dich nun so lange nicht gesehen, dass es auf den einen Tag auch nicht ankommen wird.“
„Topp!“, rief Guston. „Doch lass uns den Schatten suchen, die Hitze hier am Ufer ist unausstehlich. Du wirst mich übrigens führen müssen, denn ich kenne Bayou Sara ja gar nicht wieder; kaum zehn Häuser waren’s, wie ich fort von hier ging, und jetzt steht eine ordentliche Stadt da.“
„Nun, die Mulattin Nelly lebt immer noch“, lachte Willis, „und führt so guten Brandy wie früher, da wollen wir denn vor allen Dingen einmal einsprechen, vielleicht findest Du dort einige alte Bekannte.“
Mit diesen Worten nahm er seines neu gefundenen Freundes Arm wieder in den seinigen und schlenderte mit ihm dem nahen Kaffeehause zu, aus dem ihnen lautes Lachen und Jubeln entgegen tönte.
Es war ein nicht sehr großes, nach der Straße zu offenes Zimmer, in das sie traten, und dessen Hintergrund ein langer Schenktisch ausfüllte. Der eigentliche Schenktisch (Bar) bestand aus einem aus gemasertem Holz verfertigten, etwas hohen Aufsatze, über den weiße Marmorplatten gelegt waren, um die darauf verschütteten Flüssigkeiten wieder leicht hinwegwischen zu können. Auf einem großen, mit weißem Tuch überdeckten Präsentierteller standen mehrere Dutzend reiner Trinkgläser, während auf einem anderen dicht daneben eine gläserne große Schale mit einem plattierten Deckel, geriebenen Zucker enthaltend, prangte. Neben ihr befanden sich wiederum zwei kleine Fläschchen, die, fest zugekorkt und mit einer durch den Stöpsel laufenden Federspule versehen, dazu dienten, die in ihnen enthaltenen Flüssigkeiten (Staunton-Bitters und Pfefferminze4) in die Getränke zu tröpfeln, um diesen einen pikanten Geschmack mitzuteilen. Hinter dem Schenktische nun waren in langer Reihe alle möglichen Arten von Getränken, Weine und Liköre, in zierlichen, farbigen und feingeschliffenen Flaschen und Karaffen angeordnet, und zwischen ihnen Orangen und Zitronen aufgeschichtet, was dem Ganzen einen frischen, heiteren Anschein gab. Unter dem Schenktische stand eine große Schüssel mit Eis, das in Stücken in die Gläser geworfen wurde, den Trank abzukühlen, und ein junger Mann in einer weißleinenen Jacke und eben solchen weiten Beinkleidern war emsig beschäftigt, den durstigen Gästen, die sich bei der übergroßen Hitze in beträchtlicher Anzahl eingefunden hatten, einzuschenken. Ein langer Doktor von der anderen Seite des Mississippis, von Pointe Coupé, schien übrigens besonders tätig, sein Glas immer wieder aufs Neue zu leeren, bei welchem Geschäft ihm denn alle anderen helfen mussten, weil er schwur, dass er nicht a l l e i n trinken wollte; und immer wieder ließ er das seinige wie die aller Anwesenden frisch füllen, obgleich er sich kaum noch selbst auf den Füßen halten konnte. Oft zwar versuchte ihm einer oder der andere zu entschlüpfen, aber mit Adlerblicken entdeckte und erwischte er die Deserteure, und ein frisches Glas war die Strafe, die ihrer wartete. Mehrere, unfähig noch einen Tropfen zu genießen, saßen in der Ecke, als unsere beiden Freunde zu Verstärkung anrückten und augenblicklich von dem Doktor mit offenen Armen empfangen wurden.
„Willis – eh?“, redete er diesen an. „Durstig? Immer durstig?“
„Hier, Doktor, ist ein Freund von mir, ein gewisser…“
„Ein Freund von Euch? Er muss mit mir trinken. Sir, geben Sie mir Ihre Hand – so – ich bin der Doktor Siel von Pointe Coupé, Sie müssen von mir gehört haben. Was wollt Ihr trinken? Hier, Barkeeper, schnell, hier ist ein Mann, der durstig ist – so recht, Gläser und Eis hinein, mir aber kein Eis, ich will’s heiß haben, heiß wie Lava, will Hitze mit Hitze kurieren. Zum Henker, wem gehört denn das lange Gesicht, was da zum Fenster hereinstiert? Kommen Sie herein, Sir, was wollen Sie trinken?“
„Danke, danke“, sagte der Neuangekommene, indem er rasch in die Tür trat und sich ohne weitere Umstände sein Glas füllen ließ.
Es war ein Mann von außergewöhnlicher Länge, der noch um mehrere Zoll über den schon ungeheuer langen Doktor hinausragte, mit vorstehenden Backenknochen und grauen, scharf und klug umherblickenden Augen, dessen ganze Gesichtszüge aber den Yankee nicht verkennen ließen. Ein blauer, langschößiger Frack war trotz des heißen, schwülen Wetters fest zugeknöpft, und ein hoher, weißer Filzhut, den er, etwas nach hinten gerückt, auf dem Kopfe trug, machte die lange Gestalt nur noch länger. Seine Stiefel waren nach der modernsten Facon gearbeitet und ganz neu, mochten ihn aber wohl gedrückt haben, denn auf beiden hatte er, gerade über den Zehen, mit einem Messer einen Kreuzschnitt gemacht, um seinen Füßen Raum zu gewähren; überhaupt schien er das Bequeme zu lieben, denn er setzte sich augenblicklich mit größtmöglicher Gemütsruhe auf den Ladentisch, wobei ihm seine Ausdehnung sehr zustatten kam, und leerte das ihm mit Wachholder und Wasser dargereichte Glas.
„Gentlemen“, begann jetzt der Yankee, nachdem er einige Kreuz- und Querfragen des Doktors mit ebenso vielen anderen Fragen beantwortet hatte, „ich denke, wir können ein Geschäft zusammen machen.“
„Ihr habt doch um Gottes Willen keine Wanduhren zu verkaufen?“, fragte mit komischen Schrecken der Doktor.
„Nein“, entgegnete lachend der Yankee, „damit befasse ich mich nicht.“
„Ihr Herren scheint Euch sonst nicht gerade an etwas Bestimmtes zu binden“, wandte Guston ein, indem er dem Langen näher trat.
„Für diesmal doch“, antwortete der Yankee, „ich habe mich auf den Menschenfleischhandel gelegt, und mit dem lässt sich nicht gut ein anderer vereinigen, Vieh- und Pferdehandel ausgenommen; doch habe ich meine letzten Mustangs5 in Baton Rouge6 verkauft und nur noch ein Negermädchen von ungefähr fünfzehn Jahren übrig behalten, die ich heute Nachmittag um vier Uhr in Müllers Kaffeehaus ausspielen will, um am Mittwoch wieder mit dem Mailboot nach New Orleans und von da nach meiner Heimat zurückkehren zu können.“
„Und was kostet das Los?“, fragte Willis.
„Fünf Dollar – wir wollen sie auswürfeln!“, lautete die Antwort. „Es ist ein kapitales Mädchen, gesund und kräftig, und die schönste Negerin, die Ihr je gesehen habt.“
„Aber wo steckt denn die Dirne?“, unterbrach ihn der Doktor. „Schafft sie doch einmal her, und sieht sie gut aus, nun so nehme ich drei oder vier Lose.“
„Sie ist nur wenige Schritte von hier entfernt“, sagte der Yankee, von seinem Sitz aufstehend. „Warten Sie einen Augenblick, und ich bringe sie herüber; es wollten sie überdies noch einige Herren hier ansehen.“ Mit diesen Worten verließ er das Schenkzimmer und kehrte bald mit einem schönen, jungen Negermädchen zurück.
Das kurze, wollige Haar hatte eine Rabenschwärze, die Nase war, ihrer äthiopischen Abkunft treu, breit gedrückt, aber klein und zierlich, und nur leicht aufgeworfen zeigten sich die kirschroten Lippen, zwischen denen, wenn sie sprach, ein Paar blendend weiße Reihen Zähne sichtbar wurden und umso mehr gegen die samtartige, schwarze Haut und die dunklen, glühenden Augen abstachen. Sie war nicht groß, aber schlank gewachsen und ungemein zierlich gebaut, so dass selbst der seiner Sinne kaum noch halb mächtige Doktor einen Fluch ausstieß und schwur, sie wäre eine verteufelt hübsche kleine Hexe.
Mehrere Pflanzer aus der Umgebung waren jetzt noch hinzugetreten, von denen fast alle Lose genommen hatten, und der Yankee führte das Mädchen wieder fort, um in St. Francisville oben noch mehr Teilnehmer für das Würfelspiel um ein menschliches Wesen zu finden.
Unmittelbar hinter dem Mädchen war, als ihr Herr sie zur Schau in die Schenkstube führte, ein junger blasser, aber sehr anständig gekleideter Mann eingetreten, der mit gespannter Aufmerksamkeit den ganzen Verhandlungen horchte und zuletzt, als jeder ein Los nahm, seine Barschaft ebenfalls hervorholte. Unstreitig hatte er beabsichtigt, zwei Lose zu kaufen, denn er überzählte sein Geld mehrere Mal; es musste aber wohl nicht zureichen, denn seufzend schob er einige Dollarnoten wieder in sein schmächtiges, stark abgenutztes Taschenbuch zurück und löste für fünf einzelne derselben ein einziges Los.
Bald darauf, als sich der Doktor wieder nach ihm umsah und bei allem, was im Himmel und auf Erden lebte, schwur, dass er mit ihm trinken oder sich mit ihm schlagen müsse, war er verschwunden.
Unterdessen rückte die vierte Nachmittagsstunde heran und eine große Anzahl von Menschen hatte sich vor dem eben erwähnten Kaffeehause versammelt, wo sie ungeduldig den Yankee erwarteten. Endlich kam er – an seiner Seite ging das Negermädchen und nicht weit von ihr entfernt, doch etwas zurück, der bleiche junge Mann.
Lärmender Jubel empfing die Neuankommenden, und der Doktor war der Ausgelassenste und Lustigste von allen. Das Billard im großen Schenkzimmer wurde jetzt schnell zum Würfeltisch hergerichtet, die Liste der Würfelnden noch einmal verlesen, und der Wirt postierte sich dann mit einem Stück Kreide an der Billardtafel, um den Namen dessen, der den höchsten Wurf tun würde, aufzuschreiben und die Zahl der geworfenen Augen dabei zu bemerken. Das Mädchen stand in einer Ecke auf einem zu diesem Zweck erhöhten Platz; um von allen gesehen zu werden, und zwei große, helle Tränen hingen an ihren dunklen, niedergeschlagenen Wimpern.
E i n Herz nur, in all‘ dem Drängen und Treiben, fühlte ihren Schmerz und teilte ihn – es war der bleiche, junge Mann, der, nur wenige Schritte von ihr entfernt, an ein Fenster gelehnt, mit zusammengepressten Lippen und für den Augenblick von Fieberhitze geröteten Wangen, die Arme fest ineinander verschränkt, da stand, vor sich niederstarrte und nur dann und wann schnell und mit einem die höchste Angst verratenden Blick das große, dunkle Auge zu ihr erhob. Als aber das Zeichen zum Anfang gegeben wurde und aller Aufmerksamkeit sich dem Billard zuwandte, als selbst das Opfer einen Moment schüchtern und bebend aufschaute, begegneten sich ihre Blicke; im Nu war er an ihrer Seite und flüsterte ihr, dicht bei ihr vorbeistreichend, zu: „Mut, Selinde, Mut, Du sollst mein werden, und wenn ich Dich aus ihrer Mitte stehlen müsste!“
Ein mattes Lächeln überflog für einen Augenblick das tränenfeuchte Antlitz des armen Kindes, bald aber schwand es wieder, und traurig senkte sie das Köpfchen und weinte still.
Das Spiel hatte unterdessen seinen Anfang genommen; dicht um das Billard gedrängt standen die Teilnehmer, mit gespannter Aufmerksamkeit die rollenden Würfel betrachtend, um schnell die fallenden Augen zu zählen.
„Fünfundvierzig!“, rief Willis, als sein dritter Wurf gefallen war. „Überbietet das, Doktor, wenn Ihr könnt!“
„Nun, ich habe fünf Lose und kann es schon eine Weile mit ansehen“, entgegnete dieser, „aber einmal will ich es doch jetzt auch versuchen.“
Er nahm die drei Würfel in den Becher, schüttelte sie und warf drei Einer.
„Das ist ein guter Anfang!“, rief er ärgerlich, als lautes Gelächter ihn von allen Seiten begrüßte. „Aber lasst nur, für dies erste Los werfe ich nicht mehr; könnte ja so nur, im günstigsten Fall, neununddreißig bekommen – ich will unterdessen eins trinken.“
Er trat vom Billard zurück, andere drängten sich hinzu, und eine Zeit lang herrschte ein gespanntes, ängstliches Stillschweigen, das nur von dem Klappern des Elfenbeins unterbrochen wurde. Der bleiche junge Mann, den niemand im Zimmer zu kennen schien, trat jetzt hinzu und rief mit leiser, aber fester Stimme: „Mir die Würfel!“
Nur schwach war der Laut, mit dem diese Worte gesprochen wurden; wie ein elektrischer Schlag aber durchzuckten sie den Körper des jungen Mädchens, das krampfhaft emporfuhr und mit geöffneten Lippen und angehaltenem Atem aufmerksam dem geringsten Laut horchte.
Einen Blick nur warf der Spieler auf die vorgebeugt lauschende Gestalt, einen anderen an die Decke, wie um da Hilfe zu erflehen, und dann rasselten mit fester Hand die entscheidenden Würfel auf das grüne Tuch – zwei Sechsen und eine Vier. „Sechzehn!“, zählte monoton der Anschreiber. „Noch einmal!“ – Wieder lagen dieselben Augen – zum dritten Mal warf er die Würfel in den Becher, schüttelte und – drei Zweien rollten hervor. „Achtunddreißig! – Schlecht!“, schrie der Ausrufer, und leichenblass trat der Unglückliche vom Billard zurück. Ein anderer nahm seinen Platz ein, und in sich zusammen-schaudernd hielt die Negerin kaum ihre zitternde Gestalt aufrecht; doch ermannte sie sich nach wenigen Augenblicken wieder, und bat mit leiser Stimme einen nicht sehr entfernt von ihr stehenden weißen Mann um ein Glas Wasser.
„Verdamm‘ Dich – hol‘ es selber, glaubst Du, dass ich Dein Nigger7 bin!“, rief dieser, sich unwirsch von ihr abwendend. Ohne ein Wort zu erwidern, schwankte sie zum Schenktisch, nahm ein dort stehendes Glas, füllte es mit dem kühlenden Eiswasser und trank es leer; neu gestärkt hierdurch, schritt sie leichten, fast elastischen Schrittes zu ihrem Platz zurück und barg, an die Wand gelehnt, das Gesicht in ihren Händen: sie nahm sichtbar keinen weiteren Teil an ihrem ferneren Geschick, und nur manchmal, wenn der rohe, freudige Ausruf eines glücklichen Würflers an ihr Ohr drang, schien eine plötzliche Angst ihr ganzes Innere zu durchbeben, und ein leichtes Zittern überflog ihre Glieder.
Wohl eine halbe Stunde mochte das Spiel so ununterbrochen fortgedauert haben und näherte sich jetzt seinem Ende, als der bleiche Mann, der sich auf kurze Zeit entfernt hatte und dem so viel an dem Besitz des jungen Mädchens gelegen zu sein schien, plötzlich zu dem Sklavenhändler wieder herantrat und ihn leise, mit verhaltener, aber zitternder Stimme um ein anderes Los bat.
„Gut, mein Herr, ich habe gerade noch zwei, wollte sie selbst werfen, aber um Ihnen einen Gefallen zu tun, ist hier eins davon“, antwortete dieser artig, „jedoch“, fuhr er, sich höflich verneigend, fort, „werden Sie einsehen, dass ich eine Gelegenheit, mein Eigentum selbst wieder zu gewinnen, nicht ganz umsonst aus den Händen geben sollte – ich kann Ihnen jetzt das Los nur für zehn Dollar lassen.“
„Mann“, fuhr der Unglückliche empor, indem er krampfhaft seine Schulter fasste, „ich habe alles veräußert, was ich bei mir hatte, um die lumpige Summe von fünf Dollar zu erschwingen, und jetzt wollt Ihr zehn; ich habe es nicht, mein ganzes Vermögen besteht in sechs Dollar.“
„Freilich kaum bedeutend genug, ein Geschäft anzufangen“, bedauerte der Yankee, „doch erinnere ich mich, dass mein Bruder Jesaiah einst…“
„Hier ist noch ein Ring“, unterbrach ihn plötzlich der andere, indem er einen einfachen, goldenen Reif von seinem Finger zog, „nehmt und gebt mir ein anderes Los. – Er ist das Doppelte wert“, fuhr er ungeduldig fort, als er sah, dass ihn der Yankee misstrauisch und aufmerksam in der Hand wog und dann betrachtete; es bedurfte jedoch keiner weiteren Beteuerung. Der Sklavenhändler kannte zu gut den Wert des Goldes, um nicht augenblicklich sich überzeugt zu haben, dass der junge Mann die Wahrheit rede, und reichte ihm eins seiner Lose, während er selbst an das Billard trat und seine drei Würfe tat. Das Glück war ihm nicht hold, und ruhig das Resultat des Spiels abwartend, zog er sich in eine Ecke des Zimmers zurück.
Der Doktor hatte jetzt seinen letzten Wurf getan und rief triumphierend: „Sechsundvierzig! – Das Mädchen ist mein!“
„Sechsundvierzig! Bester Wurf!“, schrie der Anschreiber eintönig nach.
„Halt! Ich habe noch ein Los!“ rief jetzt der fremde junge Mann und drängte sich zur Tafel.
„Warum habt Ihr denn da nicht schon lange geworfen?“ entgegnete ärgerlich der Doktor.
„Hatte ich nicht das Recht so gut wie Ihr, bis zuletzt zu warten?“, fragte ihn dieser empfindlich.
„Meinetwegen“, lachte der Doktor jetzt dagegen, „Ihr werft doch keine Sechsundvierzig, und hättet Eure fünf Dollar sparen können, aber halt!“, rief er aus und erfasste den Arm des jungen Mannes, der eben würfeln wollte. „Die Dirne gefällt mir, sie hat ein verdammt hübsches Gesicht – ich gebe Euch fünfzig Dollar, wenn Ihr zurücktretet.“
„Die Würfel mögen entscheiden!“ rief der junge Fremde, indem er sich von der Hand des Doktors losmachte und ihm für einen Augenblick das Blut so in die Schläfe trat, dass es ihm die Adern zu zersprengen drohte, in derselben Minute kehrte es aber zu seinem Herzen zurück und ließ nicht einen Tropfen in seinen Wangen. Die Würfel rasselten und eintönig zählte der Wirt die Augen.
„Siebzehn!“
„Beim Himmel, ein guter Wurf!“, riefen alle, die jetzt mit gespannter Erwartung die grüne Tafel umstanden.
Wieder rasselten die verhängnisvollen Stücke Elfenbein in dem ledernen Becher. Totenstille herrschte und aller Augen hingen an der Hand des Werfenden, während das arme, geängstigte Mädchen betend in die Knie gesunken war und ihr Gesicht mit den Händen bedeckt hielt. Ihr verhaltenes Schluchzen war das Einzige, was die grabesähnliche Stille unterbrach. Die Würfel lagen.
„Siebzehn! Noch einmal!“
„Verdammt!“, brummte der Doktor.
„Den dritten Wurf, den dritten Wurf!“ riefen alle ungeduldig, als sie sahen, dass der Fremde ängstlich sinnend einen Augenblick einhielt. Fast krampfhaft fasste er zweimal den Becher, jedes Mal wie zusammenschaudernd vor dem entscheidenden Wurf – aber er konnte nicht länger warten – die halb trunkene Schar wurde ungeduldig, und wieder rasselte der Becher; vorgebeugt umdrängten alle das Billard, die Würfel fielen – es waren nur elf.
„Hurra!“, jubelte der Doktor, sich auf das Billard wälzend in widerlicher Lust. „Ich habe gewonnen! Wer will trinken? Ich traktiere8 alles, was im Hause ist. Müller, he! Holla! Hierher! Füllt die Gläser, gebt jedem so viel, als er trinken will, ich bezahle alles!“ Und sich dann auf dem Billard niederlassend, rief er aus: „Bringt das Mädchen her, ich will sie betrachten!“
Als Selinde den jubelnden Triumphruf des Doktors hörte, wollten sie fast ihre Kräfte verlassen, und sie wäre gesunken, hätte sie nicht der Fremde unterstützt, doch jetzt ermannte sie sich mit wunderbarer Kraft und flüsterte nur, ehe sie dem Befehl ihres neuen Herrn Folge leistete, ihrem Beschützer leise zu: „Fliehe, Alfons, fliehe, ehe man Dich entdeckt!“, und trat dann festen und sicheren Schrittes vor ihren Gebieter, seine Befehle zu vernehmen.
„Sie ist ein hübsches Mädchen“, lallte dieser, von heftigem Schlucken unterbrochen, indem er sich mit dem rechten Ellbogen auf den Billardrand legte und mit gläsernen Augen zu ihr aufsah. „Gut, gut – meine Frau wird scheel sehen, wenn ich ihr den Nigger ins Haus bringe, aber…“
Er konnte nicht vollenden, die geistigen Getränke, die er an diesem Tage genossen hatte, gewannen durch die letzte Aufregung endlich die Oberhand, und bewusstlos sank er aufs Billard zurück, von dem er fortgetragen und in ein Bett gebracht wurde, um seinen Rausch auszuschlafen.
Der Wirt nahm die Negerin in seine Obhut und schloss sie in ein Zimmer ein, um sie ihrem Herrn nach dessen Erwachen zu überliefern.
Indessen hatte einige junge Leute, unter denen sich auch Willis befand, eifrig miteinander geflüstert und forschende Blicke auf den bleichen, jungen Mann geworfen, den die Negerin Alfons genannt und der teilnahmslos in einer Ecke lehnte. Sein krauses, rabenschwarzes Haar hing ihm in langen Locken über die bleiche Stirn herunter, seine Lippen waren bleich und seine Augen gerötet; plötzlich trat einer der jungen Leute auf ihn zu, legte ihm die Hand auf die Schulter und rief in barschem Ton: „Alfons!“
Wie von einer Schlange gebissen, sprang bei dem Klange dieses Namens der Unglückliche empor und starrte wild umher, auf den Kreis fremder, unbekannter Gesichter, die ihn umgaben, bis seine umherirrenden Blicke auf dem des ihm Gegenüberstehenden haften blieben, der ihn fest und durchdringend betrachtete. Als ihm aber dessen Züge klarer und deutlicher aufdämmerten, schlug er sich mit der geballten Faust vor die Stirn, stieß einen tiefen Seufzer aus und sank wie vernichtet auf seinen Stuhl zurück. Der junge Mann dagegen, der solche Veränderung in seinem ganzen Wesen hervorgebracht hatte, wandte sich triumphierend zu seinen Kameraden und rief:
„Ich kannte den Burschen, und Ihr mögt mich einen Schurken nennen, wenn es nicht ein erbärmlicher Nigger ist.“
„Was, ein Neger?“, riefen alle, sich um den regungslos Dasitzenden drängend. „Ein Neger? Und mischt sich zwischen Weiße?“
„Hinaus mit ihm! Schlagt ihn zu Boden, den Hund! Werft ihn aus dem Fenster!“ Das waren die Ausrufe, die mit Blitzesschnelle einander folgten, und nicht allein bei Ausrufen blieb es, sondern in demselben Augenblick fühlte sich auch der Unglückliche von kräftigen Händen gefasst, zu Boden geworfen, wieder aufgerissen und dem Fenster zugeschleppt, aus dem er wenige Sekunden später auf die Straße geschleudert wurde. Die Höhe, von der er hinunter stürzte, betrug jedoch kaum sieben Fuß, und nur wenig beschädigt fiel er zu Boden, schon aber hörte er das Rachegeschrei der Verfolger, die nicht gedachten, ihr Opfer so leichten Kaufs entwischen zu lassen, auf dem Hausflur.
Wohl sprang er empor und wandte das blutende Antlitz seinen Feinden entgegen, aber nicht Todesfurcht, nein, kalter Trotz und Verachtung des Schrecklichsten, was ihm begegnen könnte, lag in dem Blick, mit dem er seine Peiniger zu erwarten schien. Da scholl aus einem der oberen Fenster die Stimme Selindes, die ihm, den Untergang des Geliebten voraussehend, in Todesangst zurief:
„Flieh, Alfons, flieh – um meinetwillen!“
Einen Blick warf er hinauf zu der halb aus dem Fenster gebogenen schlanken Gestalt des armen Mädchens, einen Blick voll Liebe, Angst und Trotz; dann aber, wie von einem neuen Gedanken durchzuckt und ehe ihn noch der heranstürmende Haufen erreichen konnte, floh er mit Windesschnelle die Straße hinauf und war bald in den ihn verbergenden Baumgruppen, welche die Stadt umgeben, verschwunden.
Taumelnd und fluchend folgten ihm wohl noch einige der Nüchternsten eine kurze Strecke, gaben es aber bald auf, den schnellfüßigen Flüchtling zu erreichen, und kehrten in das Wirtshaus zurück, indem sie schwuren, dem verdammten Neger, wo er sich nur wieder blicken ließe, Füße und Hände zu binden und ihn in die Bayou zu werfen.
Guston hatte an dem ganzen Vorgange keinen Anteil genommen und ruhig, in einem Fenster lehnend, dem Auftritt zugesehen; einmal zwar, gerade als der Haufen den Unglücklichen auf die Straße schleuderte, war er zusammengezuckt, als ob er im Begriff gewesen wäre, ihm beizuspringen; hatte es aber nur so den Anschein gehabt, oder er sich eines Besseren besonnen, er fiel wieder in seine nachlässige Stellung zurück und blieb bei dem Ganzen ein untätiger, ja wie es fast schien, teilnahmsloser Zuschauer. Nur erst als die Gemüter sich wieder beruhigt hatten und der lärmende Haufen zum erneuerten Trinken in die Gaststube zurückgekehrt war, entfernte er sich leise, selbst nicht von Willis bemerkt, und ging nachdenkend die Straße nach St. Francisville hinauf.
Die Sonne war indessen untergegangen und tiefe Dämmerung lagerte sich über das Tal, als Guston den Fuß des Hügels erreichte, auf dem das Nachbarstädtchen erbaut ist. Zu seiner Linken sah er ein mattes Licht zwischen den Spalten eines kleinen Blockhauses hindurch schimmern, das, wie er noch von früher wusste, von zwei Mulattinnen, Mutter und Tochter, bewohnt war. Der Gedanke fuhr ihm durch den Kopf, dass sich dorthin der Verfolgte geflüchtet haben könne, und obwohl sich keines klaren Zwecks bewusst, ging er schnell an dem sanften Abhang des Hügels hinauf, und stand bald an der von innen verriegelten Tür des kleinen Hauses, aus dem leise flüsternde Stimmen heraustönten.
Guston legte sein Ohr an eine der Spalten und unterschied bald die tröstende Stimme des Mädchens, die jemand Mut zusprach, und dabei selbst dann und wann einen recht tiefen, tiefen Seufzer ausstieß. Guston war überzeugt, dass der Unglückliche hier Schutz gefunden hatte, aber noch unschlüssig, wie er sich Eingang verschaffen wollte, da die Inwohnenden in ihm unmöglich einen freundlich Gesinnten vermuten konnten, als er die Stimme der Alten hörte, die, an die Tür tretend, zu ihrer Tochter sagte:
„Ich muss noch die Wäsche hereinnehmen, die draußen hängt, sonst dürfte morgen früh wenig davon übrig geblieben sein; setze Du indessen den Kessel aufs Feuer – der arme Mensch wird Nahrung und Ruhe bedürfen.“ Zu gleicher Zeit wurde der große, schwere eiserne Riegel zurückgeschoben, und die alte Frau trat in die Tür, erblickte aber in demselben Augenblick den jungen Pflanzer und wollte, zurückschreckend, dieselbe wieder zuschlagen, als Guston schnell vorsprang und das Verriegeln derselben hinderte.
Die Frauen stießen einen Angstschrei aus, und Alfons, der sich matt und erschöpft aufs Bett geworfen hatte, sprang erschrocken empor und riss ein verborgen gehaltenes Messer aus seinem Gürtel; Guston aber hob die Hand zum Zeichen des Stillschweigens, half selbst, die Tür verriegeln, und dann einen Stuhl an den Tisch rückend, setzte er sich mit einer solchen Ruhe und Kaltblütigkeit nieder, als ob nicht das Geringste vorgefallen sei.
„Mr. Guston“, rief die alte Mulattin, die ihn erst jetzt erkannte, ganz erstaunt aus. „Mr. Guston! Wie um des Himmels Willen kommen Sie wieder nach Louisiana und in unsere Hütte? Sie wollen doch nicht dem armen Mann da…?“
„Sei nicht bange, Alte“, unterbrach sie der junge Pflanzer, „ich habe keine bösen Absichten, ich komme einzig und allein aus Neugierde, und kann dem armen Menschen sogar nützlich sein. Wie aber konntest Du es wagen“, wandte er sich jetzt an den stumm und regungslos vor sich hinstierenden Quadroon9, „Dich so dreist zwischen Weiße zu drängen und mit ihnen zu spielen und zu trinken?“
„Ich habe nicht mit ihnen getrunken“, antwortete eintönig Alfons.
„Gleichviel“, entgegnete Guston, „Du musstest recht gut wissen, welcher Gefahr Du Dich aussetzt, und das ohne irgendeinen Zweck oder Nutzen davon zu haben; denn wenn Du wirklich das Mädchen gewannst, so wäre sie Dir, unter den Verhältnissen, doch nicht gelassen worden.“
Alfons seufzte tief auf.
„Aber sage mir, wo bist Du her? Du bist so weiß wie irgendeiner von uns; ich selbst würde nie einen Verdacht geschöpft haben, dass Du von schwarzem Blute abstammst. In welchem Verhältnisse stehst Du zu der Negerin? Denn einen geheimen Grund musst Du gehabt haben, Du hättest sonst nie etwas so Tollkühnes unternommen.“
„Und was hülfe es mir und Euch, wenn ich die Geschichte meiner Leiden erzählte?“, sagte Alfons traurig. Es ist die Geschichte Tausender meiner Brüder, und Ihr mögt dieselbe in all‘ den südlichen Staaten dieses freien, gesegneten Landes finden! Oh, ein freies Land ist es!“, fuhr er, mit beiden Händen krampfhaft seine Schläfe fassend, fort.
„Du selbst bist doch kein Sklave?“, sagte, schnell vom Stuhl aufstehend, der Pflanzer.
„Nicht ich“, murmelte, traurig mit dem Kopf schüttelnd, der Unglückliche, „doch überzeugt Euch“, fuhr er, mehrere Papiere aus seiner Tasche hervor langend, fort, „überzeugt Euch selbst. Mein Vater schenkte mir die Freiheit; oh, ich glaubte es damals ein schönes Geschenk, ich wurde nicht mit den anderen Negerkindern, wie die jungen Mustang-Füllen, aufgezogen, ich durfte lesen und schreiben lernen und glaubte mich, durch die Weiße meiner Haut getäuscht, so frei und glücklich wie die Amerikaner. Es war ein kurzer, aber schöner Jugendtraum; überall kannte man mich, wusste, dass meine Mutter eine Mulattin sei, und der ‚verdammte Nigger‘ durfte sich an keinem Orte, wo sich Weiße aufhielten, sehen lassen, ohne die schmerzlichsten Kränkungen und Demütigungen zu erfahren.
Mit leichtem Herzen würde ich auch das Land meiner Geburt verlassen haben, hätte nicht eine Sklavin meines Vaters – dasselbe junge Mädchen, welches heute ausgewürfelt wurde“, fuhr er mit leisem, zitterndem Tone fort, „mein Herz und meine Seele auf jener Pflanzung gefesselt gehalten. Selinde liebte mich wieder und Priesterhand sollte uns vereinigen, denn mein Vater hatte mir versprochen, sie frei zu geben und mir zu schenken. Da entriss mir der Tod plötzlich das einzige Wesen, das noch einen schützenden Einfluss auf mich ausgeübt hatte, denn auch meine Mutter war ein Jahr vorher gestorben, und Fremde nahmen das Eigentum in Besitz, das durch unvorsichtige Spekulationen, wie mir gesagt wurde, verschuldet und verpfändet war. Ich wurde mit wenigen Dollar in die Welt hinaus gestoßen, und Selinde, mit anderen Sklaven und Sklavinnen, da der neue Eigentümer selbst deren einige fünfzig aus Georgia mitgebracht hatte, an einen Sklavenhändler verkauft. Dieser verließ Alabama und wandte sich nach New Orleans, um dort für einen höheren Preis die billig eingehandelten Schwarzen zu verkaufen, was ihm auch mit allen gelang, Selinde ausgenommen, die er für sich behalten wollte, bis er mit ihr hier nach Bayou Sara kam und es ihm einfiel, sie auszuwürfeln.
Ich war ihnen von meinem Geburtsort aus gefolgt und hatte oft mit Lebensgefahr das Mädchen, an dem mein Herz hing, zu sehen getrachtet; da hörte ich heute Morgen, hier eben angelangt, von dem beabsichtigten Würfelspiele. Neue Hoffnung belebte mich, ich glaubte mich hier von Niemandem gekannt, der weißen Farbe meiner Haut vertrauend, wagte ich mich in das Wirtshaus und wendete meinen letzten Cent, selbst einen Ring daran, den mir meine Mutter auf dem Sterbebett gegeben, um zwei Lose zu kaufen. Sie wissen das Übrige. Der junge Mann, der mich erkannte, ist ein Neffe meines Vaters – mein eigener Vetter.“
Alfons schwieg, die beiden Frauen aber saßen in der Ecke und schluchzten; selbst Guston war gerührt.
„Wie aber entgingst Du der Aufmerksamkeit des Sklavenhändlers?“, fragte er endlich nach einer Pause. „Der musste Dich doch auf Deines Vaters Pflanzung gesehen haben.“
„Oft genug“, fuhr Alfons fort, „da ich aber mit im Herrenhause schlief und von den Sklaven stets als ‚Mr. Alfons‘ angeredet wurde, hatte er nicht den leisesten Verdacht geschöpft, dass ich selbst zu jener verachteten Rasse gehören könne.“
„Und was denkst Du jetzt zu tun?“, fragte Guston teilnehmend, als er ihm die schnell durchgesehenen Papiere zurückgab.
„Was k a n n ich tun?“ hauchte leise der Quadroon.
„Sei morgen Abend wieder hier in diesem Hause“, sagte Guston aufstehend, „ich will mit dem Doktor morgen früh reden, vielleicht kann ich Dir helfen.“
Alfons schüttelte, bitter lächelnd, den Kopf.
„Heute ist so nichts mehr zu hoffen“, fuhr Guston, mehr zu sich selbst als zu dem anderen redend, fort, „um zehn Uhr fährt der Doktor mit der Dampffähre nach Pointe Coupé, und da wird für diesen…“
„Heut Abend um zehn Uhr?“, fragte Alfons hoch aufhorchend.
Die Dampffähre geht doch bei diesem niedrigen Wasserstande nicht mehr so spät in der Nacht?“, sagte die alte Mulattin, sich die Augen trocknend.
„Es sind, wie ich eben hörte, Damen von Taylors Pflanzung auf dieser Seite des Flusses, und die verlangen noch übergesetzt zu werden“, erwiderte Guston, „da wollen sie den Doktor so lange schlafen lassen und dann mitnehmen; bis dahin ist er nüchtern und kann auf seine Sklavin Acht geben. Doch genug für heut Abend“, unterbrach er sich selbst, „ich habe vielleicht Unrecht getan, Dir so teilnehmend zuzuhören, da Du nach den Gesetzen des Staates, in dem wir nun einmal leben, eigentlich eher Strafe als Mitgefühl verdient hättest; doch wollen wir das für jetzt dahingestellt sein lassen; also leb‘ wohl, bis morgen Abend will ich sehen, was sich für Dich tun lässt, und halte Dich ein wenig verborgen, dass Du Deinem V e t t e r nicht wieder vor die Augen kommst, er scheint keinen großen Gefallen an seiner Verwandtschaft zu finden. – Schon gut“, sagte er, etwas zurücktretend und eine abwehrende Bewegung machend, als er sah, dass Alfons seine Hand ergreifen wollte, „schon gut, Du bist mir weiter keinen Dank schuldig, als dass ich Dich nicht verrate, und dazu fühle ich nicht die mindeste Lust. Also gute Nacht, Alte, gute Nacht, Anna“, und den Riegel wieder zurückschiebend, sprang er von der hohen Schwelle hinunter und war bald in der Dunkelheit verschwunden.
Er hatte aber kaum die nach Bayou Sara führende breite Straße wieder erreicht und war auf dieser einige Schritte fortgegangen, als aus dem dichten Gestrüpp, das zu beiden Seiten des Weges wuchs, zwei dunkle Gestalten auf ihn zusprangen und ihn festhielten. Schon hatte er sein Messer ergriffen und wollte sich, nichts Gutes erwartend, Bahn machen, als er Willis Stimme erkannte, der, ihn loslassend, lachend, aber mit unterdrückter Stimme ausrief:
„Zum Henker! Einen von unseren Flüchtlingen haben wir gefangen, aber nicht den rechten; wo um Gottes Willen kommst Du hierher?“
„Ich wollte erst nach St. Francisville gehen, habe mich jedoch anders besonnen“, sagte Guston, „aber was im Namen alles gesunden Menschenverstandes tut Ihr hier, wie Straßenräuber auf dem breiten Fahrweg? Ich glaubte wahrhaftig im ersten Augenblick, ich wäre einigen entlaufenen Negern in die Hände gefallen, und wollte schon anfangen, mir mit meinem Messer Bahn zu hauen, als ich noch glücklicherweise Deine Stimme erkannte. Wer sind diese und was wollt Ihr alle hier?“, fuhr er, erstaunt umherblickend, fort, als er eine Menge Menschen nahen hörte, die in wenigen Sekunden an seiner Seite waren und in denen er die ganze Würfelgesellschaft erkannte. Der lange Sklavenhändler und der Ankläger und Vetter des Entflohenen schienen sie anzuführen.
„Still“, sagte Willis, „wir wissen, dass der freche Schuft, der sich so schändlicher Weise zwischen uns eingeschlichen hatte, hier links am Wege bei Mutter Hoyer sitzt, wir wollen jetzt das Haus umzingeln und den Burschen fangen; er soll doch auch wissen, wie Peitschenhiebe in Louisiana schmecken.“
„Wozu den armen Teufel noch einmal aufsuchen?“, fiel Guston gutmütig ein, „Ihr habt ihn einmal abgestraft, lasst in laufen, er wird sich so bald nicht wieder zwischen weiße Männer hineinwagen.“
„Still, Mann, aus Dir spricht der Europäer“, entgegnete trocken Willis, „mit so leichter Strafe kommt kein Neger davon, wenn i c h’s verhindern kann.“
„Es tut mir nur leide, dass wir ihn nicht gleich banden und in den Fluss warfen“, fiel ärgerlich, doch mit unterdrückter Stimme der Vetter des Unglücklichen ein, „ich konnte den Jungen nie leiden; aber kommt, wir verlieren unsere Zeit und dort schimmert das Licht.“
Guston drehte den gefühllosen Menschen verächtlich den Rücken und wandte sich nach der Stadt, während der Haufen leise gegen das kleine Blockhaus hinan schlich; plötzlich aber, wie von einem anderen Gedanken ergriffen, kehrte er schnell um und folgte seinen Freunden, leise dabei vor sich hinmurmelnd: „Sie sollen ihn doch wenigstens nicht töten!“
Wenige Schritte nur war er nach der Hütte zurückgegangen, als es ihm schien, als ob eine dunkle Gestalt über den Weg glitt. Er blieb stehen und rief sie mit unterdrückter Stimme an, aber keine Antwort erfolgte, und bald hatte er das Häuschen erreicht, das schon von den Männern geräuschlos umzingelt war, während die nichts Böses ahnenden Bewohner sich noch bei dem matten Schein der Lampe mit leiser Stimme unterhielten, und dann und wann ein leises Schluchzen durch die stille Nacht drang. Willis trat jetzt vor, und mit dem starken Ende einer ungeheuren ledernen Negerpeitsche, die er unterwegs mitgenommen, an die Tür schlagende, verlangte er Einlass. Einen Augenblick herrschte Totenstille; erst auf seine zweite Aufforderung ertönte die Stimme der Alten, die ihn ruhig bedeutete, weiter zu gehen – es sei Nacht und sie mache keinem Fremden die Tür auf, da sie nur zwei einzelne Frauen wären.
„Das wissen wir besser, Du verwünschte Hexe!“ rief jetzt Willis mit voller Stimme, indem er mit aller Kraft einen Schlag gegen die Tür führte, „öffne augenblicklich, oder wir reißen Dir Dein morsches Dach über dem Kopfe zusammen!“
Die Übrigen waren jetzt ebenfalls von allen Seiten hinzugetreten, und das Haus eng einschließend, schienen sie die Drohung im wahren Sinne des Wortes ausführen zu wollen, als der Riegel zurückgeschoben wurde. Ohne das Öffnen der Tür abzuwarten, sprang Willis mit aller Gewalt gegen dieselbe, und diese aufstoßend, warf er sich mit solcher Gewalt gegen den Kopf der Mulattin, dass die Unglückliche, von dem Schlage betäubt, besinnungslos zurücktaumelte und niederstürzte. Laut aufschreiend, warf sich das Mädchen über den Körper der Mutter; ihrer jedoch wenig achtend, stürmte, so schnell es ihnen der enge Eingang erlaubte, ein Teil der Verfolger in das Gemach, um ihr Opfer zu erfassen.
Vergebens sahen sie sich indessen nach ihrer Beute um, vergebens leuchteten sie in jeden Winkel, hinter jeden Kasten, vergebens warfen sie selbst die Betten der armen Frauen auf den Boden, den vielleicht darunter Versteckten zu entdecken, er blieb spurlos verschwunden, und drohend wandte sich jetzt Willis an die arme Alte, die sich, noch betäubt von dem Schlage, erschöpft an die Schulter ihrer Tochter lehnte.
„Wo ist der Bursche, der noch vor wenigen Minuten hier war? Willst Du reden, Alte, oder ich drehe Dir den Hals um!“
„Lasst meine arme Mutter, Herr!“, rief das Mädchen, den schon nach ihr ausgestreckten Arm des wütenden Willis zurückstoßend. „Lasst sie, Ihr habt sie ja schon beinahe getötet!“
„Nigger!“, rief dieser, sich zornig emporrichtend. „Willst Du mir sagen, was ich tun oder lassen soll?“ Und mit der Peitsche ausholend, wollte er eben das furchtlos ihm gegenüberstehende junge Mädchen niederschlagen, als er seinen Arm von Guston gefasst und festgehalten fühlte, der ihm leise zuflüsterte: „Du schlägst das Mädchen n i c h t, oder Du hast es mit mir zu tun!“
„Was zum Henker mischst Du Dich in mein Tun?“, fuhr Willis heftig gegen den Freund herum; aber dessen ernstem Blicke begegnend, ließ er den Arm sinken und sagte halb lachend, halb ärgerlich: „Warum ist das dumme Ding so trotzig? Ich wollte ihr übrigens kein Leid tun, sie soll nur sagen, wo der Bursche ist, der noch vor wenigen Minuten hier war!“
Einen ängstlichen Blick warf das junge Mädchen auf Guston, um zu erforschen, ob er sie verraten habe; bald aber schien sie diese Furcht aufzugeben, denn sie schüttelte leise mit dem Kopfe und hauchte: „Ich habe niemand gesehen.“
„Lügen!“, riefen jetzt mehrere Stimmen aus dem Haufen. „Er war hier, wir wissen es; seit wann ist er fort?“
„Ich habe niemand gesehen“, wiederholte leise das zitternde Mädchen.
„Gentlemen!“, sagte jetzt Guston, sich an die ihn dicht umdrängenden Männer wendend. „Sie sehen, der Mann ist fort, wohin, darf uns für den Augenblick sehr gleichgültig sein, denn wie könnten wir dem Einzelnen in der stockfinsteren Nacht folgen? Also kommen Sie mit mir in die Stadt zurück, und wir wollen noch ein halb Stündchen zusammen trinken, i c h traktiere, morgen haben wir vielleicht mit dem Auffinden des Burschen mehr Glück. Wer geht mit mir?“
„Nun, ich denke“, sagte der Sklavenhändler, indem er sich mit großer Seelenruhe von einer breiten Tafel Kautabak ein ungeheures Stück abschnitt und in den Mund schob, „wir gehen alle.“
„Ja, lasst und gehen; zum Teufel mit dem Nigger!“ riefen alle untereinander und drängten sich wieder aus der Tür hinaus, um im Wirtshaus ihr Gelage aufs Neue zu beginnen. Guston verließ das Haus zuletzt, und das Mädchen folgte ihm mit dem tränenden, dankbar ihm zugekehrten Blick – sie sah in ihm den Retter ihrer Mutter.
Lachend und jubelnd wanderten die Männer der Stadt zu und erreichten bald wieder das Haus, wo Guston, seinem Versprechen gemäß, sie auf seine Kosten trinken ließ, so viel sie wollten. Die Unterhaltung war sehr laut, und besonders schimpfte und fluchte der Sklavenhändler auf den Entflohenen, den er versicherte, mehr als zwanzigmal gesehen, immer aber für einen Weißen gehalten zu haben, als plötzlich der Doktor mit verschlafenem, bleichen Gesicht, sich dehnend und streckend, in der Tür erschien.
Mit allgemeinem Jubel wurde er empfangen und vernahm jetzt, mit Erstaunen über die unerhörte Frechheit des Niggers, die Erzählung dessen, was, während er schlief, vorgefallen war.
„Der N i g g e r!“, rief er endlich ganz entrüstet aus. „Ich glaubte selbst, er sei einer jener dunkelhäutigen Creolen, die man oft kaum von Mulatten, viel weniger von Quadroonen unterscheiden kann – aber Ihr habt ihn doch gleich geknebelt und abgestraft, oder wenigstens in Sicherheit gebracht?“
Etwas kleinlaut erzählte jetzt Willis, dass er ihnen entkommen sei, sie aber ernstliche Nachforschungen am anderen Morgen anstellen wollten.
„Ich habe einen vorzüglichen Negerhund“10, fuhr er in seinem Argumente fort, „und wenn wir den auf die Spur bringen…“
„Bah!“, rief der Doktor ärgerlich. „Glaubt Ihr, der wird sich lange hier in den Büschen oder Sümpfen herumtreiben, wo so viel B o o t e am Ufer liegen? Der stiehlt diese Nacht eins, wenn das nicht schon jetzt geschehen ist, und hat bis morgen früh wenig Spuren zurückgelassen, dafür steh‘ ich. Nun“, tröstete er sich endlich, „er kommt uns vielleicht ein anderes Mal wieder in den Wurf, und – ich kenne den Burschen jetzt. – Aber glaubt Ihr, ich sei ein Pulvermagazin, dass Ihr Euch hier alle um mich her drängt und mich so trocken haltet, als ob mich ein Tropfen Spiritus verderben könnte? He, Wirt! Etwas zu trinken! Ihr habt doch mein Mädchen ordentlich aufgehoben?“
„Alles in Sicherheit“, entgegnete dieser, dem Doktor ein Glas und eine Flasche hinschiebend, „aber, Doktor, die Fährleute werden gleich zum letzten Mal hinüberfahren. Punkt zehn Uhr will Mr. Taylor am Ufer sein.“
„Mr. Taylor“, sagte der Doktor, sein Glas halb füllend und leerend, „mag zu – Grase gehen! – Es wird aber doch besser sein, ich fahre mit; so bringt das Mädchen herunter und lasst sie sich bereit halten.“
„Ihr Bündel liegt in der Küche“, sagte der Yankee, „viel hat sie zwar nicht, aber…“
„Ihr Yankees werdet auch einen Sklaven viel Plunder mitnehmen lassen!“, unterbrach ihn lachend der Doktor. „Da müsste man Euch nicht kennen; nun, wenn sie fleißig und ordentlich ist, kaufe ich ihr ein paar neue Fähnchen.“
Guston hatte, an das Billard gelehnt, eine Zeit lang starr vor sich niedergesehen und dem Gespräch gehorcht; als er aber hörte, dass das Mädchen vor die Tür geführt ward und der Doktor sich selbst zum Überfahren rüstete, trat er auf diesen zu und bat ihn, einen Augenblick mit ihm zu gehen, da er ihm etwas zu sagen habe. Der Doktor folgte, und beide standen bald in der sternhellen Nacht auf der offenen, menschenleeren Straße unfern des unglücklichen Mädchens, das, die Hände auf dem Rücken befestigt, an einen Balken, der eigentlich zum Anhängen der Pferde diente, gebunden war und, an diesen gelehnt, in ihrem dünnen weißen Kleide traurig empor zu den goldenen Sternen blickte.
„Nun, was wollen Sie von mir, Sir?“, fragte endlich der Doktor, nur wenige Schritte von der Sklavin stehen bleibend.
„Ich wünschte, Ihnen dies Mädchen abzukaufen“, antwortete Guston fest und ruhig.
„Den Teufel auch!“, rief erstaunt der Doktor. „Was fällt Ihnen auf einmal ein?“
„Sie gefällt mir“, entgegnete in gleichgültigem Ton der junge Pflanzer.
„Mir auch“, sagte der Doktor lachend, „und ich verkaufe sie nicht wieder, nein, meine Frau wollte lange ein Hausmädchen haben, und d i e scheint mir wie geschaffen dafür: leicht, behände, hübsch und stark.“
„Doktor, es kommt mir auf einige Dollars nicht an; ich möchte aber das Mädchen haben, und wenn Sie nicht einen zu horrenden Preis fordern, so…“
„Nein, nein“, unterbrach ihn der Doktor, „aus unserem Handel wird nichts, wenn ich das Geld nötig brauchte, ja, dann wär es vielleicht etwas anderes, ich habe aber just gestern einen Wechsel von tausend Dollar bekommen, gut wie Silber, und da ist mir jetzt das Mädchen nicht feil. Fragt jedoch Weihnachten einmal wieder nach und – ich stehe Euch nicht dafür, dass das Geld so lange ausreicht – vielleicht noch früher, nur für den Augenblick wird nichts daraus.“
Das Mädchen hatte im Anfang, da sie hörte, wie nahe sie die Unterhaltung anging, erschrocken aufgehorcht, und versuchte vergebens eine Zeit lang mit ihren scharfen Augen die Finsternis zu durchdringen, um die Züge dessen zu erforschen, der sie zu erhandeln wünschte; da sie das aber unmöglich fand, verfiel sie wieder in ihre träumerische Stellung, wenig den Fortgang des Gesprächs und die Folgen, die es für sie haben musste, beachtend. Sie war daran gewöhnt, als ein Stück Ware betrachtet und verhandelt zu werden, und ihr schien es gleichgültig, wer von den beiden ihr neuer Herr werde, da Alfons doch unwiederbringlich für sie verloren war; nur zwei große Tränen traten ihr in die dunklen Augen und fanden, von anderen gefolgt, ihre Bahn die sammetweichen Wangen der Unglücklichen hinab. – Sie konnte sie nicht abtrocknen, ihre Hände waren gebunden.
Jetzt traten auch die übrigen Pflanzer und Kaufleute aus dem Hause und wanderten zusammen dem nicht fernen Flussufer zu, um den Doktor noch auf das Boot zu begleiten. Guston wandte sich ab und schritt schweigend an Willis Seite, der ihm tausend tolle Streiche und Schwänke erzählte, und sich wenig darum bekümmerte, ob sein Gefährte ihm zuhörte oder nicht, dem kleinen Städtchen St. Francisville zu, um dort zu übernachten und am nächsten Morgen seines Vaters Pflanzung zu erreichen.
Das Schicksal der beiden Unglücklichen hatte Guston, da er lange Zeit von den Sklavenstaaten entfernt gelebt, wirklich geschmerzt, und manch gutmütiger Plan für die Zukunft der beiden seinen Kopf durchkreuzt, als er dem Doktor das Mädchen abkaufen wollte. Da dieser aber nicht darauf eingegangen war, so glaubte er das Seinige getan zu haben und vergaß bald das Unglück von Leuten, denen er doch nicht helfen konnte. Noch hatte er nicht die Höhe des Hügels und mit ihm die ersten Häuser des Städtchens erreicht, als er schon ganz in Willis Laune einstimmte und diesem von seinen Reisen und Wanderungen erzählte.
Unterdessen waren die Passagiere, die noch nach Pointe Coupé übersetzen wollten, auf der Dampffähre eingeschifft, und Selinde wurde ebenfalls an Bord gebracht, jetzt jedoch, als das Boot vom Lande abstieß, losgebunden, und sie stand vorn am Bugspriet des kleinen, breiten Fahrzeugs, schaute über das niedrige Geländer hinab in den dunklen, reißenden Strom und hing ihren trüben, traurigen Gedanken nach.
In der Kajüte hatte sich indessen der Doktor mit noch zwei anderen Pflanzern zu Taylors Familie gesellt und erzählte diesen von den heutigen Vorfällen, während das Boot langsam am Ufer hinauflief und eben vor der kleinen Bayou, von der das Städtchen seinen Namen hat, vorüberfahren wollte.
„Geht denn der Herr nicht mehr mit, der da noch am Ufer steht?“, rief plötzlich der Steuermann, ein Deutscher, dem Master des Bootes zu, der unten, unfern der Sklavin, am Geländer lehnte.
„Nein, hat sein eigenes Boot“, war die lakonische Antwort, und der Ingenieur, der auch zugleich die Stelle des Feuermanns mit vertrat, gab dem Boote die ganze Kraft, um so schnell wie möglich die nächtliche Fahrt zu beenden.
Das Boot erreichte jetzt die ungefähre Höhe, von der aus sie hoffen durften, die gegenüberliegende Landung zu gewinnen; der Steuermann ließ also den Bug nach der Backbordseite abfallen, und bald zeigte das stärkere Rauschen am Bugspriet, dass es in reißendere Strömung geraten sei. Langsam bewegte es sich der Sandbank zu, die sich in den Sommermonaten, mitten im Flusse von einer kleinen Insel unterhalb ausgehend, wohl zwei Meilen hinaufzieht, und welche die Fähre, um an dem gewöhnlichen Landungsplatze in Pointe Coupé anzulegen, umfahren musste. Das Boot mochte kaum dreihundert Schritt von dem waldigen Ufer ab sein, als von der Mitte des Stromes aus dreimal der Ton eines Loon11 klagend über die glatte Wasserfläche herüber schallte. Der Master schien die oft gehörten Töne wenig zu beachten; Selinde aber fuhr schon beim zweiten Rufe, wie von einem plötzlichen Schreck durchschauert, auf und lauschte mit verhaltenem Atem dem dritten. Wenige Minuten war alles still, und dann schallten wieder dieselben drei wehmütigen Rufe des menschenscheuen Wasservogels zu ihr herüber, während sie mit vorgebeugtem Oberkörper und weitgeöffneten Augen die Finsternis zu durchdringen suchte, wie um den Urheber dieser Töne zu entdecken. „Der Loon schreit kläglich heut Abend!“, rief der Steuermann.
„Ja, wir bekommen Regen“, sagte der Master, indem er einen prüfenden Blick nach oben warf. Der Himmel schien aber seine Wetterprophezeiung nicht zu rechtfertigen, denn kein Wölkchen umhüllte die Myriaden Sterne, die in glühender Pracht von dem dunkelblauen Firmament hernieder schimmerten.
Das Boot durchschnitt jetzt, in die Nähe der Sandbank und dadurch in etwas stillere Wasser kommend, mit größerer Schnelle den Strom, während der Loon noch zweimal in kurzen Zwischenräumen seinen Ruf ertönen ließ, aber schwieg, sobald die Fähre heran rauschte.
„Halte stromauf!“, rief der Master jetzt dem Steuermann zu. „Du rückst dem Sande zu nahe. So – das wird genug sein!“
Sie liefen von da an ziemlich geschwind in ganz totem Wasser an der Sandbank hinauf und näherten sich mehr und mehr der Spitze, als der Steuermann ausrief, er sähe etwas Schwarzes vorn auf dem Wasser, das einem Kahne gliche.
„Ich kann nichts erkennen“, rief der Master, seine Augen anstrengend und sich vorn überbiegend.
„Kommt hierher, es muss ein losgerissenes Boot sein, was dort auf den Sand getrieben ist. Wenn wir unsere Jolle mit hätten, könnten wir es fangen.“
„Schändlich!“, rief der Master ärgerlich. „Die Burschen, die hinter uns mit dem Ruderboote kommen, werden es jetzt finden; wir dürfen aber nicht näher hinfahren, sonst bleiben wir sitzen.“
Sie waren unterdessen in gleiche Höhe mit dem dunklen Gegenstände gekommen, der sich wirklich als ein Kahn auswies, aber nicht als ein leerer, sondern ein einzelner Mann saß darin und ruderte, etwas vor dem Boote, auf dasselbe zu, als ob er dicht an demselben vorüberfahren wollte. In demselben Augenblick ließ sich auch der Loonruf, doch ganz in der Nähe und äußerst leise hören.
„Habt Acht! Ihr kommt unter die Fähre!“, schrie der Master vom Verdeck aus dem einsamen Ruderer zu, der jetzt fast auf Kahnlänge herangekommen war; die Warnung wurde aber nicht beachtet, und „Selinde!“ rief der fremde Mann leise herüber. In dem Augenblick berührte auch sein Kahn die Dampffähre, und mit einem Sprung lag das Mädchen an der Brust des Geliebten, glitt aber, wohl wissend, dass dieser seine Arme jetzt nötiger brauchte, als sie zu umfassen, behände in den Stern des Bootes, und dasselbe mit einem dort liegenden kurzen Ruder abstoßend, trieb der kleine Nachen, ehe sich die Fährleute nur von ihrer Überraschung erholen konnten, schnell in das Fahrwasser des Dampfers.
„Halt! Verdamm Euch! Hilfe! Haltet sie!“, riefen der Master und Steuermann zu gleicher Zeit, und ersterer sprang, mit Hintansetzung der Furcht für seine Gliedmaßen, mit einem Satz vom Steuer auf das untere Deck hinunter, um das Entkommen des Bootes zu verhindern; aber zu spät, schon verschwand es in der dichten Finsternis, und deutlich hörten sie, wie es, von kräftigen, regelmäßigen Ruderschlägen getrieben, schnell über die Fläche des Stromes dahin schoss.
„Was schreit Ihr denn so, als ob Ihr am Spieße steckt?“, rief der Doktor, als er jetzt mit anderen Männern aus der Kajüte kam. „Ist das nicht ein Höllenlärm…“
„Die Negerin ist fort!“, rief der Master.
„ W a s ist sie?“, schrie der Doktor und war mit wenigen Schritten an der Seite des selbst zum Tode erschrockenen Masters, der seinem Steuermann nur schnell zurief, das Boot zu wenden und stromab den Flüchtigen zu folgen, und dann dem Doktor mit wenigen Worten den ganzen Vorfall erzählte. Fluchend und tobend aber sprang dieser zum Steuer, bot dem Steuermann zehn Dollar, wenn er die Entflohenen wieder einhole, und vertrieb sich dann die Zeit damit, dass er, auf- und abgehend, überdachte, wie er die beiden, wenn er sie erst wieder eingefangen hätte, züchtigen wollte.
Der Master war indessen auch zu ihm herangetreten, und den Doktor in seinem Eifer und seinen Gestikulationen unterbrechend, rief er ihm zu, einen Augenblick ruhig zu sein, denn er glaube, er höre Ruderschläge. Sie horchten jetzt mit gespannter Aufmerksamkeit und vernahmen deutlich das regelmäßige Einschlagen von Rudern in das Wasser; es konnten aber nicht die Flüchtlinge sein, denn es kam von Bayou Sara herüber, und der Steuermann brach endlich das Schweigen, indem er versicherte, dass es das Segelboot wäre.
„Gut“, rief der Master, „die wollen wir doch bei unserer Jagd zu Hilfe rufen, es müsste dann mit dem Bösen zugehen, wenn wir das Pärchen nicht einfingen, ehe es Waterloo erreichen kann.“ Und die Hände trichterförmig an den Mund haltend, schrie er mit kräftiger Stimme sein „Boot ahoiii!“ über die ruhige Stromfläche hinüber.
Schon sein zweiter Ruf wurde von drüben beantwortet, und bald tönte auch auf sein langsam und deutlich ausgestoßenes „Kommt herüber!“ ein befriedigendes „Ay – ay!“ zurück.
Die Dampffähre schoss unterdessen mit bedeutender Schnelle an der Sandbank hin, gleichwohl sich etwa hundertfünfzig Schritt von ihr entfernt haltend, um nicht aufzulaufen, und aufmerksam beobachteten die Männer den zwischen ihnen und der Bank liegenden Wasserstreifen, da sie nicht ohne Grund vermuteten, dass der Entflohene eher versuchen würde, ihnen unter dem Schutze der Nacht zu entgehen, als sich auf seine eigene Kraft zu verlassen und die Mitte des Stromes zu suchen, wo ihm, wenn entdeckt, auch nicht die mindeste Hoffnung auf Entrinnen geblieben wäre.
Schon hatten sie sich auf wenige hundert Schritt der kleinen Insel genähert, als der Master plötzlich des Doktors Arm fasste und gerade sich gegenüber nach der Sandbank deutend, die hier etwa drei Fuß über die Wasserfläche herausragte, ausrief: „Dort sind sie, so wahr ich ein Christ bin; seht Ihr dort?“
„Wo? Wo?“, rief der Doktor, der nur das dunkle Boot mit den Augen gesucht hatte.
„Dort der weiße Punkt“, rief der Master, „das Kleid des Mädchens!“, und ohne eine weitere Antwort abzuwarten, sprang er mit einem Satz an das Steuerrad, und das Boot schnell wieder stromauf wendend, führte er es gerade auf den weißen Punkt zu. Der Flüchtige war aber hier allerdings in der Hoffnung angelaufen, unter dem mehrere Fuß hohen steilen Sandufer unbemerkt liegen zu bleiben und, wenn die Fähre vorbeigefahren wäre, schnell die Mitte des Stromes zu erreichen, wonach er dann, stromab, bald aus dem Bereiche augenblicklicher Verfolgung kommen konnte.
„Jetzt haben wir sie!“, rief der Master aus, als er sich, etwas näher rückend, wirklich überzeugt hatte, dass es die Flüchtigen waren. „Hier ist das Wasser tief, und ich müsste mich sehr irren, wenn wir nicht an den Burschen dicht heran laufen könnten; auf alle Fälle wollen wir’s versuchen.“
Die armen Flüchtigen befanden sich unterdessen in einer gar misslichen Lage, denn in der Tat hätte die nicht sehr tief im Wasser gehende Dampffähre gerade an dieser Stelle an sie heran laufen können. In diesem kritischen Augenblick verließ aber den in der Schule des Unglücks Gestählten die so nötige Geistesgegenwart nicht; mit raschen Ruderschlägen flog er, etwa fünfzig Schritt, seinen Verfolgern gerade entgegen, und als diese schon, in der Hoffnung, ihn bald in ihrer Gewalt zu haben, laut aufjubelten, der Doktor sogar ein Tau zurechtlegte, um den „damned nigger“, wie er sich ausdrückte, zu knebeln, schoss dieser plötzlich, einen schmalen Streifen leichten Wassers benutzend, der sich zwischen zwei langen Sandzungen hinzog, in seinem kleinen Boote rechts von der Fähre ab, die gleich nachher, durch das nur wenige Zoll tief gehende Boot irre geführt, in zu seichtes Wasser kam und auflief. Im nächsten Augenblick waren die Flüchtigen in der alles umlagernden Finsternis verschwunden.
Da schallte plötzlich ein nahes, deutliches „Hallo!“ herüber, und das angerufene, von Bayou Sara kommende Segelboot lag wenige Augenblicke später neben dem auf dem Sande sitzenden Dampffährboote.
„Hallo!“, rief noch einmal der im Stern des ersten behaglich hingestreckte Creole. „Was flucht Ihr denn hier so gotteslästerlich durch die stille Nacht? Das ist der Doktor, nicht wahr?“
„Beauvais!“, rief dieser. „Euch sendet uns der Himmel!“
„Wohl durch Euer Beten erweicht?“, lachte Beauvais.
„Kommt schnell heran, nehmt uns auf; mein Negermädchen ist mir hier vom Boote weg durch den weißen Nigger gestohlen, und vor kaum drei Minuten sind sie erst fort, wir müssen sie einholen.“
„Kommt herein denn, schnell!“, rief der Creole, das Boot an die Fähre anlenkend. „Und wenn meine vier Burschen den bleichen Schurken nicht in zehn Minuten haben, so will ich mein Leben lang keinen Gumbo12 mehr anrühren, und Doktor“, fuhr er lachend fort, „das würde mir so sauer werden als Euch, wenn Ihr dem Brandy entsagen solltet.“
Mit unglaublicher Schnelle verließ das Segelboot, das den Doktor, den Master und den anderen Pflanzer aufgenommen, die gestrandete Fähre und flog der Mitte des Stromes zu, um die Flüchtigen einzuholen.
„Ich höre das Ruder!“, rief der Master, der, die Hände hinter die Ohren haltend, einen Augenblick gelauscht hatte. „Ich höre das Ruder deutlich, gerade unter jenem hellen Stern. So – noch ein wenig rechts!“, rief er, als Beuvais schnell seinen Lauf danach änderte. „So – jetzt sind wir auf der Spur; nun, meine Burschen, streckt Euch!“
Das Boot berührte kaum die Wasserfläche und hoch auf spritzte der weiße Schaum am Bugspriet.
Unterdessen war Alfons nicht müßig gewesen; große Schweißtropfen perlten ihm an der durch die übermäßige Anstrengung des Ruderns erhitzten Stirn, und lange war kein Wort zwischen den Liebenden gewechselt; jetzt brach Selinde das Schweigen und flüsterte leise und bebend:
„Ich habe Dich verraten, Alfons, mein weißes Kleid zeigte den Verfolgern unser Versteck – oh, wie bin ich unglücklich!“
„Mein armes Mädchen“, tröstete sie Alfons, ohne einen Augenblick in seiner Arbeit nachzulassen, „beruhige Dich, ich entgehe ihnen dennoch; wäre nur das Segelboot nicht; ich hörte aber, wie sie es anriefen, und ich fürchte, wir werden landen und uns im Sumpfe verbergen müssen. Ich möchte ihnen nicht gern auf dem Wasser in die Hände fallen.“
„Aber sie müssen uns hören, Alfons“, seufzte das Mädchen, „die bösen Ruder knarren so, das tönt gar weit über das Wasser; ich höre das Boot ebenfalls hinter uns.“
„Ich habe nichts, um die Ruder zu umwickeln – jeder Augenblick, den ich verzögere, bringt uns dem gewissen Verderben näher“, sprach leise Alfons.
„Mein Kleid hat uns verraten, mein Kleid mag uns retten“, lächelte das Mädchen unter Tränen hervor, riss das dünne Zeug in Streifen herunter und legte es unter die Ruder. Geräuschlos glitt jetzt das Boot über die ruhige Wasserfläche, und leise betend sank die schlanke Gestalt des armen Kindes im Stern des kleinen Bootes nieder.
„Verdamm‘ die Hunde!“, rief der Doktor, als die Neger einen Augenblick rasteten und alle aufmerksam, aber vergebens horchten, um aufs Neue einen Ruderschlag der Entflohenen zu hören. „Nichts rührt sich mehr.“
„Dort unten treibt ein Flatboot“13, rief der Master, „vielleicht haben die Leute darauf etwas von den Flüchtigen gesehen.“
Sie steuerten, als kein Laut weiter gehört ward, schnell auf das unbehilfliche Fahrzeug zu, das sie auch gar bald erreichten, und der Doktor rief es ohne weiteres an:
„Habt Ihr ein Boot gesehen?“
„Etwa hundert Schritt an uns vorbei ruderte einer.“
„Welche Richtung?“
„Mehr nach dem Lande zu.“
„Wer saß darin?“
„Weiß nicht“, rief der Flatbootmann. „Ihr sucht einen weggelaufenen Sklaven?“
„Jawohl, Freund“, antwortete Beauvais, „woher wisst Ihr das?“
„Gut, ich denke, Ihr seid auf der rechten Fährte, der Bursche, der hier hinunterging, hatte die Ruder umwickelt, kam mir gleich verdächtig vor.“
„Sie sind es!“, schrie der Doktor. „Jetzt tapfer, meine Burschen, streicht aus!“
„Ihr sagtet, sie hielten sich nach dem Lande zu?“ frug der Master noch einmal zurück, als das Segelboot von dem Flatboot hinwegschoss.
„Ja“, lautete die Antwort, und zum dunklen Ufer hin, aber immer noch in etwas die Strömung benutzend, eilten die Verfolger dem unglücklichen Alfons nach, der sich wirklich näher dem Lande zugewendet hatte, um im Notfall das schützende Dunkel des Waldes zu erreichen.
Mehrere Minuten war das Segelboot so im wahren Sinne des Wortes über die Stromfläche fortgesprungen, als der Master, der im Vorderteil kauerte und aufmerksam über den Wasserspiegel hinschaute, in die Höhe sprang und ausrief:
„Dort sind sie, ich sehe das Boot!“
„Hurra, meine Burschen, greift aus!“, schrie der Doktor. „Und Ihr, Master, gebt mir Euer Messer, ich will dem bleichen Nigger einmal zeigen, was es zu bedeuten hat, in Louisiana einen Neger zu stehlen.“
Der Angeredete griff auch, ohne weiter ein Wort zu erwidern, unter seine Weste, holte sein langes Jagdmesser hervor und reichte es dem Doktor, der es aus der Scheide riss und jubelnd schwang.
Alfons hatte mit fast übermenschlicher Anstrengung seine Bahn verfolgt, als er aber die Ruderschläge der Verfolgenden immer näher und näher kommen hörte und nun einsah, dass er selbst nur noch eine kurze Zeit das seine Kräfte übersteigende Rudern würde aushalten können, wandte er sich näher zum Ufer. Hatte er den Wald einmal erreicht, so war alle Verfolgung im Dunklen und ohne Hunde unmöglich gemacht. Da – als Alfons seine letzten Kräfte anstrengte, das Werk zu vollenden, als er die Verfolger schon dicht hinter sich sah – brach ihm das rechte Ruder und sein Boot flog herum.
Beauvais und der Master erkannten augenblicklich, dass der Flüchtling in ihren Händen sei, und stießen ein Freudengeschrei aus. Der Erstere wandte sich nur noch an den Doktor und rief diesem ermahnend zu: „Bringt ihn nicht um!“, als das Boot auch schon an das andere hinan schoss und jener mit erhobenem Messer jubelnd hinübersprang.
Er sollte aber seinen Triumph nicht lange genießen, Alfons, wohl wissend, dass für ihn alle Hoffnung verschwunden sei, und fest entschlossen, nicht lebendig in die Hände seiner Peiniger zu fallen, war, mit dem Ende des abgebrochenen Ruders in der Hand, das er hochgeschwungen über seinem Kopfe hielt, auf das Sitzbrett gesprungen, und von schwerem Schlage getroffen, stürzte der Doktor rückwärts in das Boot, während das Messer seiner Hand entfiel und in den Fluten versank.
Beauvais, der im Begriff war, dem Doktor zu folgen, würde ein gleiches Schicksal mit dem Ersteren geteilt haben, hätte nicht der Master, der sich wohl hütete, in den gefährlichen Bereich des Ruders zu kommen, eine Pistole gezogen und sie schnell und besonnen auf den frei Dastehenden abgedrückt.
Beim Krach des Gewehres zuckte der Schwergetroffene zusammen, das wieder erhobene Ruder entfiel seiner Hand, und für einen Augenblick stand er aufrecht da, starr und fest zum Himmel empor sehend, dann stöhnte er „Selinde!“ und sank rückwärts in die Flut.
„Alfons!“, rief das Mädchen mit herzerschütterndem Schrei und folgte mit Gedankenschnelle dem Sinkenden, aber Beauvois, dies noch zur rechten Zeit gewahrend, sprang in das kleine Boot, und das weiße, flatternde Unterkleid erfassend, ehe es verschwand, zog er mit Hilfe seiner Leute die Ohnmächtige an Bord zurück.
_____
Vierzehn Tage waren nach diesem Abend verflossen, als der Doktor zuerst wieder nach Bayou Sara hinüberfuhr, sich aber dort sehr mäßig hielt, seine Geschäfte schnell besorgte und dann wieder hinüber nach Pointe Coupé fahren wollte. Er sah sehr blass aus, und eine breite, noch nicht ganz zugeheilte Narbe zog sich über seine Stirn.
Als er dem Flussufer zuschritt, um das Fährboot zu erreichen, das eben anlandete, hörte er seinen Namen rufen, und sich umwendend, erkannte er Guston, der ihm winkte und bald an seiner Seite war.
„Nun, Doktor, wie geht’s?“, fragte er diesen, die ihm entgegen gestreckte Hand schüttelnd. „Was macht die Stirn? Das muss ein höllischer Schlag gewesen sein!“
„War’s auch, Guston, war’s auch, warf mich nieder, wie ein Stück Holz; der Hund hat aber seine Bezahlung bekommen.“
„Er soll über Bord gefallen und ertrunken sein?“, fragte Guston, den Doktor von der Seite fixierend.
„Verdammt will ich sein, wenn ich weiß, wie er fortgekommen; als ich ihn zuletzt sah, stand er noch fest genug auf der Ruderbank, um mich mit dem scharfkantigen Holz zu Boden zu schlagen, aber der brave Master – Ihr geht mit nach Pointe Coupé, nicht wahr?“, unterbrach er sich plötzlich selbst.
„Der Master soll ihn erschossen haben – wie mir gesagt wurde“, fuhr Guston, die Zwischenfrage nicht beachtend, fort.
„Die Neger wissen nichts und können kein Zeugnis vor Gericht ablegen; ich wollte übrigens, ich hätte an jenem Abend Euren Vorschlag angenommen und Euch das Mädchen überlassen, ich wollte, ich hätte es!“
„Nun, seid Ihr nicht mit ihr zufrieden? Ich nehme mein Wort selbst jetzt noch nicht zurück – wenn auch nicht mehr aus derselben Ursache als neulich.“
„Leider“, fuhr der Doktor ärgerlich heraus, „habe ich sie heute Morgen begraben lassen.“
„ B e g r a b e n?“, frug Guston, erstaunt einen Schritt zurücktretend. „Begraben? Das junge, kräftige Mädchen?“
„Lieb wär mir’s, ich hätte weder sie noch den nichtswürdigen langen Yankee je mit Augen gesehen; die Dirne kostet mich ein schmähliches Geld, und dann legt sich der kleine weibliche Teufel hin und wird krank. Erst glaubte ich, sie wolle mich nur zum Narren haben, und ließ sie auf Anraten meiner Frau züchtigen, sie muckste aber nicht und wurde zuletzt ohnmächtig; nun ließ ich sie in ein Krankenhaus bringen und gab ihr eine alte Frau zur Pflege; ich mochte sie doch nicht gern verlieren, sie war wenigstens ihre fünfhundert Dollar wert. Da setzt sich der schwarze Racker in den Kopf, nichts mehr zu essen, legt sich hin und liegt da und rührt sich nicht. Umsonst ging ich selbst zu ihr und versuchte alles, um sie wieder zur Vernunft zu bringen, umsonst drohte ich ihr mit den fürchterlichsten Strafen, und ließ ihr wirklich, nur um ihr zu beweisen, dass es mein Ernst sei, einige Hiebe geben, es blieb vergebens; sie ließ alles ruhig mit sich anstellen, und gestern Mittag, als ich zu ihr ging, um noch einmal zu versuchen, ob stärkere Drohungen vielleicht einen größeren Einfluss auf sie haben möchten, richtet sie sich plötzlich auf ihrem Bett in die Höhe, schwatzt allerlei dummes Zeug von Alfons, Vater und Mutter, und fällt um – sie war tot.“
„Ich wollte doch, Ihr hättet sie mir damals überlassen“, sagte Guston, nachdenkend und verstimmt vor sich niedersehend – dann wandte er sich rasch von dem Doktor ab und schritt langsam nach Bayou Sara zurück.
Höhlenjagd in den westlichen Gebirgen
Novellen-Zeitung.- J. J. Weber, Leipzig, 1844. 1.Jg
An einem klaren, bitterkalten Nachmittag des Monats Februar, als die Sonne, von dünnen Nebelschleiern umzogen, nicht Kraft genug hatte, die schneidende Luft, die aus den nordwestlichen Prärien herüber wehte, zu mildern, und selbst an den fließenden Wasser, etwas in Arkansas sehr Ungewöhnliches, ein starker Eisrand hing, kletterten an den steilen Abhängen, welche die Quellen des ‚Spirit Creeks‘ einschließen, drei Männer über die rausten und unwegsamsten Stellen hinweg, die in der ganzen Gegend nur gefunden werden konnten, und obgleich oft kurze Strecken offenen, ebenen Bodens vor ihnen lagen, umgingen sie doch stets diese, und suchten wieder die schroffsten, wildesten Wände aus, an denen abgebrochene Felsblöcke, und toll und bunt durcheinander geworfene Steinmassen ihr Fortschreiten fast zu einer Unmöglichkeit machten.
Die drei Jäger – denn andere Leute konnten in solchem Fels-Chaos nichts zu suchen haben – hielten sich auch einige hundert Schritt voneinander entfernt, aufmerksam dabei den Boden und die Pflanzen, über dem und an denen sie hingingen, untersuchend, und nur sehr langsam bewegten sie sich vorwärts. Da lenkte plötzlich der Ruf des am tiefsten Dahinkletternden – eines Indianers – (die anderen beiden Jäger waren Weiße) – die Aufmerksamkeit seiner Gefährten dorthin, und sie stiegen auf sein Winken und seine Bewegungen, die ihnen zeigen sollten, dass er etwas gefunden habe, zu ihm hinab, um seine Entdeckung zu untersuchen.
Der Indianer war noch ein junger, rüstiger Mann, etwa 30 Jahre alt und schlank, aber kräftig gebaut, wenigstens verriet der nackte Arm, den er aus seiner wollenen Decke hervorstreckte, um den anderen das Zeichen zu geben, außerordentlich starke Sehnen und Muskeln.
Seine Beine waren mit ledernen Leggins, seine Füße mit Mokassins aus eben dem Stoff bekleidet, sein Jagdhemd aber, aus dünnem, buntfarbigem Kattun leicht zusammengeheftet, wurde eigentlich nur noch durch den Gürtel gehalten, denn in Streifen hing es ihm von den Schultern herunter; beide Arme waren nackt, doch hatte er seine wollene Decke mit einem dünnen Riemen von Hirschfell um die Hüften befestigt, dass sie ihn wie ein Mantel umhüllte. Sein Kopf war bloß, und die schwarzen, langen Haare hingen ihm über Stirn und Schläfe herab, auch zeigte sein Gesicht keine der sonst bei seinem Volke so gebräuchlichen, entstellenden Farben, sondern seinen eigenen, dunklen, kupferfarbenen Teint, aus dem ein Paar feurige Augen kühn und unternehmend hervor blitzten.
Auf der linken Schulter lag ihm die lange Büchse, und sein Gürtel hielt unter der Decke das Messer, den Tomahawk und einen Blechbecher.
Seine beiden Gefährten waren auf ähnliche Art wie er gekleidet, nur trugen sie lederne Jagdhemden, die Decken fest zusammengerollt auf dem Rücken, und der eine von ihnen, ein schlanker, hoch gewachsener Mann, dessen blondes Haar den Nordländer verriet, hatte eine rauhaarige, aus dem Fell eines Waschbären roh zusammengeheftete Mütze tief in die Stirn gedrückt, während sein Kamerad, dem eine kurze, deutsche Büchse an einem Riemen über die Schulter hing, eine wollene, gewebte Mütze als Kopfbedeckung führte.
An den rauen Weg gewöhnt, sprangen sie mit Leichtigkeit den steilen Abhang, von Fels zu Fels, hinunter, und waren bald an des Indianers Seite, der, als er sah, dass seinem Ruf Folge geleistet wurde, sich fest in seine Decke einhüllend sie erwartete. Als sie aber den Platz, wo er stand, erreichten, streckte er wieder seine eine Hand aus der Umhüllung hervor und rief, auf den Boden um sich herum, und viele abgebissene kleine Büsche zeigend:
„Der Bär liebt den Sassafras, denn er macht ein weiches Lager – wenn das Wetter warm wird, möchte eine Fährte von hier aus zu dem Bach hinunter gefunden werden.“
„Wenn wir’s nicht unter der Zeit vereiteln, Tessakeh!“, rief der schlanke Jäger, indem er aufmerksam die Zeichen, die den nahen Aufenthaltsort eines Bären verrieten, musterte. „Wo steckt aber der schwarze Bursche? Er muss seinen Eingang hier irgendwo in der Nähe haben, und doch sehe ich keine Höhle.“
„Wah!“, sagte der Indianer, als er auf ein Loch zeigte, das gerade da, wo er stand, senkrecht in den Boden hinein lief und kaum groß genug war, einem starken Mann den Eingang zu verstatten.
„Und wie kämen wir da hinunter?“ fragte der Deutsche, indem er seinen Kopf dicht an die Öffnung hielt und hinabzuschauen versuchte. „Hol’s der Henker, es scheint tief zu sein und ist stockfinster drunten.“ Mit diesen Worten warf er einen kleinen Stein hinein, und dessen hohles Klatschen und Plätschern verriet, dass er in Wasser gefallen sei.
„Wasser unten?“, rief der Engländer, indem er sich vorbeugte und lauschte. „Wasser unten, und etwa 20 Fuß tief? – Hol mich der Böse, wenn ich da einsteige, und läge das fetteste Bärenfleisch dort, das je in den Wäldern von Arkansas sich von Eicheln nährte. Da wird aber auch kein Bär sein, denn so dumm sind die alten Burschen doch nicht, sich ein nasses Lager zu wählen, wo es so viele trockene im Überfluss gibt.“
„Der Bär ist schlau“, erwiderte Tessakeh, indem er nochmals einen Stein hinab warf, und dabei dem Laute horchte. „Sehr schlau; er weiß den Platz zu finden, wo er sicher und trocken liegt, aber der weiße Mann hängt mit seinen Augen an den Wolken, wenn er seine Füße betrachten sollte – hat er den Zweig abgetreten, auf dem er steht?“
„Wahrhaftig“, rief Redham, indem er einen kleinen, verdorrten Sassafraszweig, der dicht am Rande der Öffnung lag, aufhob und betrachtete. „Den muss der Bär hergeschleppt haben, und das ist ein ziemlich sicherer Beweis, dass er darin steckt; aber verdammt will ich sein, wenn ich selbst folge, denn mein Leben ist mir doch lieber, als ein Stück fettes Fleisch, und ich begreife überhaupt nicht, wie wir ihn herausbekommen wollten, wenn wir ihn wirklich schössen.“
„Wenn die Krieger auf der Spur der Feinde sind, gehen sie nicht in Scharen neben einander, aber der Letzte tritt in die Fußstapfen des Ersten“, erwiderte Tessakeh.
„Ja, ja“, sprach der Deutsche, indem er mit dem Kopf nickte, „Stück für Stück müssen wir ihn herausschaffen, aber ich glaube auch, dass wir selbst nur auf dieselbe Art hinunter könnten, und das wäre denn doch weniger angenehm.“
Ohne weiter etwas zu erwidern, schaute Tessakeh einen Augenblick scharf umher, und stieg dann zu einem jungen, schlanken Hickory-Stamm hinauf, der, einige 50 Schritt über ihnen am Berge, gerade und schlank, wohl 40 Fuß hoch und nur einige Zoll stark, in die Höhe stieg, fällte denselben mit wenigen Schlägen seines Tomahawks, dass er dicht neben den zwei anderen Jägern niederschlug, befreite ihn von den Ästen, die er jedoch noch einige Zoll vom Stamm daran ließ, um einen Haltpunkt für die Füße zu bilden, und hob dann mit des Deutschen Hilfe, der bald begriff, zu welchem Zweck der junge Stamm benutzt werden sollte, die schnell fabrizierte L e i t e r in die Höhle hinab.
Da der Stamm länger als nötig war, nahmen sie ihn noch einmal heraus, schlugen etwa 8 Fuß von dem unteren, glatten und astlosen Ende ab, und hatten sich nun, wenigstens in diesen Schacht, einen Eingang gebildet.
„Nun, Redham, wollt Ihr nicht mit hinunter?“, fragte der Deutsche, als er seine Decke und Kugeltasche abwarf und das Pulverhorn mit einem kleinen Riemen dicht an seinem Körper befestigte – wir werden viel Spaß unten haben, und es wäre wirklich schade, wenn Ihr hier so ganz allein…“
„Ich gönne Euch all den Spaß, Werner, den Ihr Euch da unten machen könnt, ich gönne ihn Euch von ganzem Herzen“, unterbrach ihn Redham, indem er Feuer anschlug14, „geht nur hinab und bringt mir wenigstens noch vor Abend ein Stück von dem Bären herauf, denn ich bin wirklich hungrig, und wir haben unser letztes Fleisch schon heute Morgen verzehrt; ich will indessen ein gutes Feuer unterhalten und den Eingang bewachen.“
Tessakeh hatte ebenfalls seine Decke abgeworfen und ein kurzes, dickes Stück Wachslicht, roh aus den gelben Zellen eines wilden Bienenstockes zusammengeknetet, aus seiner Kugeltasche genommen, während Werner ein ähnliches, aber bedeutend längeres aus seiner Decke heraus wickelte. Der Indianer gürtete dann sein langes Jagdmesser fester, und legte die Büchse nahe zum Feuer nieder, das schon, von Redhams geschickter Hand geweckt, hoch emporloderte.
„So soll ich allein meine Büchse mitnehmen?“, sprach Werner, als er sah, wie sich Tessakeh bereit machte, ohne die seinige den Weg anzutreten.
„Tessakeh hat ein langes Rohr, und wenn der Ladestock herausgezogen wird, ist sie 4 Fuß länger“, erwiderte der Indianer.
„Nun, wenn diese Höhle so eng ist als die vorige, in die wir zusammen hineinkrochen“, lachte Werner, „so möchte die meinige zum Wiederladen ebenfalls zu lang sein, aber vorwärts, Tessakeh, vorwärts! Wir wollen diesem guten Mann hier oben zeigen, dass wir uns nicht vor einem tiefen Loch, und Wasser im Grunde, fürchten – ist ein Bär darin, so haben wir heut Abend Fleisch, und das ist ein Gegenstand, den wir höchst nötig brauchen.“
Mit diesen Worten wollte er, die Büchse auf den Rücken gehangen, zuerst hinab. Tessakeh hielt aber zurück und sprach, auf die Mündung der Waffe zeigend:
„Es ist gefährlich, in den Lauf eines Gewehres hinab zu sehen; ginge die Büchse zu früh los, so möchten die beiden Weißen heute Abend allein am Feuer liegen – ich will voransteigen und sind wir unten, so mag der Fremde sein Wachslicht dem Bären zuerst zeigen.“
Ohne weiter eine Antwort abzuwarten, ließ er sich dann in die Öffnung hinab, und war in wenigen Augenblicken verschwunden, während Werner schnell seinem Beispiele folgte, und Redham hatte nur noch Zeit, ihm zuzurufen:
„Habt Acht, Werner, habt Acht, schießt nicht, wenn Ihr nicht Eurer Sache gewiss seid, und bedenkt, dass die Kugel in solcher Höhle außerordentlich leicht und schnell aus dem Lauf fährt, verdammt schwer aber wieder mit einer gehörigen Ladung hineinzubringen ist, besonders, wenn man dabei eine verwundete Bestie abzuwehren hat.“
Werner nickte ihm noch einmal zu, rief ihm ein fröhliches „viel Vergnügen“ zurück, und verschwand ebenfalls in der engen Höhlung, aufmerksam auf seine Büchse achtend, dass diese nicht, unvorsichtig getragen, sich von selbst entladen möchte.15
Mit Leichtigkeit kletterten die beiden Männer an dem Stamme nieder, und bald stand Tessakeh am Fuß desselben im Wasser, das er vorher untersuchte und nicht tiefer als 6 bis 7 Zoll fand. Werner war an seiner Seite, und ihre Lichter emporhaltend, die einen matten Schein umher warfen, beschauten sie forschend den Raum, in dem sie sich befanden. Es war eine Art Gewölbe, etwa 9 Fuß hoch und 16 bis 18 Fuß weit, nach den Seiten zu abgedacht, wo sowohl oben, etwa 5 Fuß vom Boden, als unten im Wasser, ein Seitenzweig der Höhle in den Berg hineinlief.
Tessakeh erklomm mit Hilfe Werners die obere Öffnung, und dort Spuren von Bären und anderen wilden Tieren findend, kroch er darin weiter, um zu erfahren, ob der Bewohner der Höhle sich in dem trockenen oder nassen Gange einquartiert habe. Werner musste zurückbleiben, da er ohne andere Hilfe den engen, hoch vom Boden gelegenen Eingang nicht mit der Büchse erreicht haben könnte, und stand, bis über die Knöchel im kalten Wasser, in einer keineswegs angenehmen Stellung. Endlich, nach langem Harren, als ihn der Frost schon zu schütteln anfing, erschien Tessakeh wieder am Eingang des oberen Ganges und versicherte, derselbe liefe so eng und spitz aus, dass unmöglich ein großer Bär sich darin aufhalten könne; der alte Bursche müsse deshalb auf jeden Fall den tiefer liegenden nassen Weg gewählt haben, um zu irgend einem anderen trockenen Platze zu gelangen.
Höchst unbehaglich aber sah der Eingang zu der zweiten, mutmaßlichen Höhle aus, denn wenn auch der Gang etwa 20 Zoll hoch sein mochte und einen Menschen bequem hindurch gelassen hätte, so war er doch 5 – 7 Zoll tief mit Wasser gefüllt, und dunkel gähnte die schwarze Öffnung den beiden Jägern entgegen.
„Ein Bär ist darin“, brach endlich Tessakeh das Schweigen, nachdem beide bedenklich den Eingang einige Minuten lang betrachtet hatten. „Ein Bär ist darin, will aber mein Bruder sein Leben daran setzen, das Tier in seiner wohl verwahrten Festung anzugreifen? Es ist kalt, der Hirsch sucht die Eicheln, die an der Südseite der Berge liegen, und Redham ist ein großer Jäger – er wird Fleisch haben, ehe die Sonne wieder im Mittag steht.“
„Es ist wahr, Tessakeh“, sagte Werner, nachdenkend den gefährlichen, unbequemen Eingang betrachtend, „wir sind aber einmal hier und aller Wahrscheinlichkeit nach können wir auch, mit ein wenig Ausdauer, die Bestie finden und erlegen; willst Du mir also folgen, wenn ich vorangehe und Bahn breche, oder willst Du hier warten und vielleicht meinen Notruf von dort drinnen hören, ohne mir zu Hilfe eilen zu können? – Denn versuchen muss und will ich es!“
„Mein Bruder ist brav und mag den Versuch wagen, wenn er aber seinen Kopf wendet, wird er, wo er auch sei, in die Augen Tessakehs sehen“, antwortete der Indianer, und ohne weiter ein Wort zu verlieren, kniete Werner im Wasser, dicht an der Öffnung der Höhle nieder und leuchtete hinein. Kein besonderes Hindernis schien ihm entgegen zu stehen und die Büchse, den Lauf nach vorne, auf der linken Schulter mit der linken Hand, in der er das Licht trug, haltend, legte er sich auf den rechten Ellbogen nieder und kroch langsam in die schmale Mündung, von Tessakeh gefolgt, der sich, da er seine Flinte zurückgelassen hatte, leichter fortbewegen konnte. Wohl ragte nur Werners Kopf und der linke Arm mit der Schulter aus dem Wasser hervor, und er war genötigt, die Schnüre des Pulverhorns zwischen die Zähne zu nehmen, um dieses trocken zu halten, doch verfolgte er mutig und unerschrocken seinen gefährlichen dunklen Weg und erreichte, nachdem er etwa 30 – 40 Schritt auf solch unbequeme Art fortgekrochen war, zwar ganz durchnässt und vor Frost zitternd, aber doch wohlbehalten, den trockenen Teil der Höhle, die sich hier in die Höhe zog und in drei verschiedenen Mündungen auslief. Tessakeh war in demselben Augenblick, als er sich erhob, und den offenen Raum betrat, an seiner Seite und schüttelte sich wie ein Hund, der eben dem Wasser entstiegen ist; dann vorsichtig mit seinem Lichte umher leuchtend, betrachtete er mit vieler Aufmerksamkeit den weichen Boden, in dem eine Unmasse verschiedener Fährten eingedrückt waren, und wandte sich nun lächelnd zu dem weißen Freunde, der seinen Gürtel abgelegt hatte, sein Jagdhemd auszog und ausrang und seine Büchse untersuchte, ob sie nicht, trotz aller Vorsicht, durch eine unbeachtete Bewegung feucht geworden wäre.
„Die Jäger haben oft die Höhle gefunden, aber mein Bruder und Tessakeh waren nie unter ihnen; sie haben ihre Feuer am Eingange angezündet, aber bis hierher hat keiner einen Funken getragen; sie sind wie der Wolf, der das Lager des schlafenden Jägers umschleicht – sie wittern das aufgehangene Wild, aber sie fürchten den Blick des Menschen.“
„In welcher von den drei Höhlen mag die Bestie nun stecken?“, frug Werner, indem er das ausgerungene Jagdhemd wieder anzog und den Gürtel mit dem Messer darin umschnallte. „Sie sehen eine wie die andere aus und scheinen, hol’s der Henker, alle drei gleich unbequem.“
Tessakeh hatte unterdessen seine Beobachtungen fortgesetzt und jetzt auf eine breite Fährte zeigend, die in die linke Öffnung hineinlief und wo die eingehenden Spuren in die der ausgehenden eingedrückt waren, rief er, indem er genau die Tapfen beleuchtete und die Knöchel seiner rechten Hand darauf hielt, um die Größe des Feindes danach zu erkennen:
„Hier!“ Und die gebogenen Finger der Rechten, nach dem Maß der Fährte gespreizt, seinem Kameraden entgegenhaltend, fuhr er fort: „Er ist groß und schwer, seine Ballen sind tief eingedrückt und er wird schlafen!“
„Nun, wenn er schläft, Tessakeh“, entgegnete Werner, der jetzt mit seinen Zurüstungen fertig geworden war und eben ein neues Zündhütchen aufsetzte, um seines Schusses gewiss zu sein, „dann haben wir leichtes Spiel, und es wird mehr Mühe kosten den alten Burschen ans Tageslicht zu schaffen, als ihn zu erlegen. Aber“, fuhr er fort, indem er sein Licht vom Boden aufnahm, „wir dürfen keine Zeit mehr verlieren, Redham wird da oben schreckliche Langeweile haben, und ich hätte doch gerne, dass wir noch zum Abendessen ein tüchtiges Stück Fleisch am Feuer braten sähen.“
„Zum Abendessen?“, sagte Tessakeh lächelnd. „Unser Bruder wird die Sonne über die Gebirge kommen sehen, und immer noch am Feuer liegen und unser warten. Die Höhle ist eng, und hart werden wir arbeiten müssen, ehe wir die Last hinauf schaffen können.“
„Das sind schlechte Aussichten“, murmelte Werner für sich hin, dem die nassen Kleidungsstücke, die Tessakeh gar nicht zu beachten schien, eben nicht behaglich am Körper saßen, „hier ist aber kein anderer Weg als vorwärts, frisch darauf zu denn – je länger wir hier zögern, desto später kommen wir zu Ende – und nun, Tessakeh, go ahead!“
„Will mein Bruder mir die kurze Büchse anvertrauen und meiner Fährte folgen?“, fragte der Indianer stehen bleibend.
„Nein, nein, so war es nicht gemeint, Tessakeh“, entgegnete dieser, „ich krieche voran und verdammt will ich sein, wenn Du Furcht an mir bemerken sollst; nein, wenn mir auch für einen Augenblick die Aussicht auf ein langes Fasten nicht recht behagen wollte, so war das keineswegs aus Furcht oder sonstiger Besorgnis! – Hab Acht auf das Licht, dass wir im Hellen bleiben, denn Dunkelheit wäre weniger angenehm hier unten, und nun – mit Gott!“
Bei den letzten Worten hatte er sich dem Eingang der linken Höhle genährt und kroch, die Büchse vor sich her schiebend, das Licht in der linken Hand haltend, vorwärts, von Tessakeh gefolgt, der, als er jenen entschlossen sah, den engen Raum zuerst zu betreten, kein Wort weiter erwiderte und ganz zufrieden damit schien, dass der junge Mann die größte Gefahr freiwillig und gern übernahm.
Die Höhle war im Anfang so geräumig, dass beide Männer wenigstens auf den Knien fortkriechen konnten, nach etwa 50 Schritten aber wurde sie mit dem Fuß, den sie vorrückten, niedriger und der obere Teil senkte sich zuletzt bis auf 12 Zoll herab, so dass Werner, der eine kräftige, starke Brust und breite Schultern hatte, kaum hindurch konnte; dennoch presste er vorwärts, da er im weichen Grunde sah, dass der Bär ebenfalls durch diesen Engpass gekommen war, und erreichte wieder einen, um einige Zoll höheren Teil. Hier aber stellte sich ihnen eine neue Schwierigkeit entgegen, denn obgleich die Höhle geradeaus weiter in den Berg hineinlief, öffnete sich doch dicht vor ihnen eine brunnenartige Kluft, die, wenn auch nicht breiter als der Gang, in dem sie fortgekrochen waren, doch wohl fünf Fuß lang und Gott weiß wie viele tief sein mochte, denn Werner, obgleich er auf Armeslänge sein Licht hinunter hielt, konnte nichts als dichte Finsternis erkennen.
„Hört mein Bruder den Bär?“ fragte Tessakeh, als er bemerkte, dass jener sich nicht weiter bewegte.
„Nein, aber eine Schlucht ist hier, von der ich gerne erst wissen möchte, wie tief sie ist, ehe ich mich hinüber wage; ich weiß freilich nicht, auf welche Art, denn ich kann den Boden nicht sehen und habe auch keinen Stein hier zum Hinabwerfen.“
„Auch keine Kugeln in der Tasche?“, erwiderte lakonisch der Indianer.
„Recht, Tessakeh, an die dachte ich nicht, fünfe werde ich hier unten nicht verschießen“, erwiderte Werner, und nahm zu gleicher Zeit eine derselben aus einer kleinen, mit einer Klappe versehenen Tasche im Jagdhemd, die er in die Schlucht fallen ließ. Diese musste aber wohl einige dreißig Fuß tief sein, denn lange dauerte es, ehe der dumpfe Fall ins Wasser heraufschallte. Durch den Erfolg keineswegs beruhigt, rief er aus: „Hallo – das sind böse Aussichten, denn wenn ich auch wirklich durch Anklammern an beiden Seiten hinüber komme, wie zum Henker wollen wir den Bären zurückbringen? Ich weiß in der Tat jetzt nicht, was ich tun soll.“
„Vorwärts, wenn es irgend möglich ist“, erwiderte Tessakeh, „es ist schwer, einen Vogel zu wiegen, wenn er in der Luft schwebt: wenn Tessakeh das Blut des erlegten Wildes sieht, wird er auch wissen, wie es ans Tageslicht gebracht werden kann!“
„Gut, wenn Du meinst“, sagte Werner, „ich bin dabei, Du sollst es aber zu verantworten haben, wenn all‘ unsere Mühe und Arbeit umsonst war.“ Mit diesen Worten presste er, die Büchse sich um den Hals hängend, beide Ellbogen und Knie gegen die rauhen Wände der Höhle, und, fast in der Luft schwebend, den tiefen Abgrund unter sich, in den ihn das Nachlassen einer Sehne gestürzt haben würde, vorsichtig Zoll für Zoll fortrückend, erreichte er den anderen, abgerissenen Teil oder vielmehr die Fortsetzung des Ganges, die so eng war, dass er sich kaum umdrehen konnte, den Weg zu besehen, den er zurückgelegt hatte. Ohne auf den Indianer zu warten, den er hinter sich glaubte, kroch er weiter und folgte der Fährte, die auch hier deutlich im nicht ganz harten Boden abgedrückt war, wohl auf 100 Schritt, als er plötzlich einen leisen, winselnden Ton zu hören glaubte, der nicht weit von ihm entfernt aus dem Teil der Höhle, der vor ihm lag, her tönte. Er lauschte und vernahm deutlich den leisen, wimmernden Laut, den der Bär, an seinen Tatzen saugend, im Winterschlaf hören lässt.
„Tessakeh“, flüsterte er jetzt, den Kopf zurückwendend, da der Gang etwas geräumiger wurde, „Tessakeh, ich höre den Bären.“
Keine Antwort ward ihm von seinem Begleiter – dichte Finsternis lag hinter ihm.
„Tessakeh“, rief er lauter, da er glaubte, dass der Indianer noch etwas weiter zurück sei, und wieder lauschte er, die antwortende Stimme seines Gefährten zu hören, nur das ferne Winseln des Tieres unterbrach die totenähnliche Stille, und missmutig warf er sich für einen Augenblick ausruhend, auf die linke Seite, um zu überlegen, ob er seinen Weg allein fortsetzen und den Kampf wagen oder wieder umkehren sollte, um zu sehen, ob seinem Kameraden ein Unglück zugestoßen sei.
„Hm!“, murmelte er zuletzt leise vor sich hin. „Wär‘ er in die Schlucht gefallen, so hätte er um Hilfe gerufen, und ist er auf der anderen Seite geblieben, um mir zu überlassen, allein mit dem schwarzen Burschen fertig zu werden, wohl, so will ich ihm doch zeigen, dass ich ihn nicht dazu brauche, eine Büchse abzudrücken; der Bär kann nicht mehr tun, als mich fressen, und da muss ich auch erst noch dabei sein!“
Mit diesem Troste, der etwas unleugbar Vernünftiges hatte, begann er sich wieder nach vorn zu bewegen und näherte sich mehr und mehr dem Winseln, das jetzt immer deutlicher wurde.
Die Höhle war zwar nicht mehr so eng, aber eine solche Masse Tropfstein hing überall an den Wänden herunter und ragte aus dem immer steiniger werdenden Boden hervor, dass das Vorrücken ungeheuer erschwert wurde und Werners Knie und Ellbogen fürchterlich schmerzten.
In diesem Teil der Höhle hingen auch eine Masse Fledermäuse an den Hinterbeinen von der Decke herab und hielten hier ihren Winterschlaf, oft durch das etwas zu nahe unter ihnen weggehende Licht aufgestört und beunruhigt, was sie durch einen schrillen, zischenden Laut kund taten. Wenig aber beachtete der kühne Jäger dieselben, und war eben im Begriff, sich um eine kleine Biegung der Höhle zu drehen, als er dicht vor sich, etwas zu seiner Rechten und zwar so, dass, wenn er vorbeikroch, er sie fast berühren musste, eine aufgerollte, ungeheure Klapperschlange liegen sah, die, durch seine Nähe gestört, die kleinen, blitzenden Augen öffnete, aber, durch das Licht geblendet, augenblicklich wieder schloss und den Kopf zurückbiegend, aus dessen zusammengepressten Rachen die spitze, doppelte Zunge dann und wann hervorzuckte, den Schwanz erhob und die warnende Rassel ertönen ließ.
Werner fuhr unwillkürlich zurück und war unschlüssig, was er tun solle, denn obgleich er die Schlange nicht fürchtete, war ihm doch ihre Nähe nichts weniger als erfreulich, noch dazu, da er nicht wagen durfte, sie zu schießen, weil es in dem niedrigen Raum eine Unmöglichkeit gewesen sein würde, wieder zu laden.
Als er noch unschlüssig da lag, sah er zu seiner ungemeinen Beruhigung das Licht Tessakehs sich langsam nähern, und bald war der Indianer dicht bei ihm und frug, warum er zögere. Werner machte ihn durch wenige Worte mit seiner Lage bekannt.
„Zeigt sie die Fänge?“, flüsterte leise der Indianer.
„Nein – aber sie hat gewarnt.“
„Sie ist wie ein Hound auf der Fährte eines Bären! Sie warnt, aber wenn der Feind naht, zieht sie sich zurück – mein Bruder mag dreist an ihr vorbeikriechen, sie wird ihre Augen schließen und schlafen.“
Werner folgte, obgleich höchst ungern, dem gegebenen Rat und vorsichtig die Büchse voranschiebend, war er bald an der Seite der Schlage, die mehrere Male die kleinen Augen zu öffnen versuchte und stärker und drohender rasselte. Jetzt lag er dicht neben ihr, und obgleich er sich fest an die entgegengesetzte Wand schmiegte, war doch der Raum so eng, dass sein rechter Arm fast die zusammengerollte Gestalt des Feindes berührte.
Langsam zog er die Knie herauf und streckte sich weiter nach vorn, da öffnete die Schlange aufs Neue die Augen und dicht vor sich die helle Flamme erblickend, sperrte sie weit, mit zum Sprunge zurückgebeugtem Kopf, den Rachen auf, in dem, weiß und glänzend, die giftgefüllten Fänge an beiden Seiten der spielenden Zunge lagen, während ihre Augen in grünem Feuer leuchteten.
Entsetzt riss Werner das Messer aus der Scheide, in demselben Augenblick aber fühlte er Tessakehs Arm auf seiner Hüfte und dessen Tomahawk zischte, mit sicherer Hand geführt, zur Schlange hinüber, die sich in ihrem Blute wand.
Zwar wusste Werner, dass sie jetzt unschädlich war, dennoch schauderte er, als sie in ihren letzten Todeszuckungen sich in dem engen Raume umher wand, und ihre kalten Schuppen seine heiße Wange berührten. Mit rascher Hand drückte er sie von sich, Tessakeh aber erfasste den zuckenden Körper und schnitt ihm bedächtig die Klappern ab, die er an seinem Gürtel befestigte.
Das beendigt, wollte Werner seinen Weg fortsetzen, als er sich plötzlich durch die Hand Tessakehs gehalten fühlte, der ihm leise zuflüsterte:
„Hab Acht – ich höre kein Winseln mehr – der Bär ist erwacht und seine Augen sind offen. – Wenn er uns windet, wird er sich hören lassen, aber der Rauch unserer Lichter zieht zurück.“
„Wahrhaftig, Du hast Recht, Tessakeh“, erwiderte Werner, „der alte Bursche muss aufgewacht sein und wird eben kein freundliches Gesicht schneiden, wenn er die Lichter sieht. Die verwünschte Schlange hatte meine Aufmerksamkeit so in Anspruch genommen, dass ich in der Tat gar nicht mehr an den Bär dachte – Du warst gerade zur rechten Zeit gekommen, denn ich…“
„Hst!“, rief der Wilde, die Hand erhebend. „Ich höre den Bären – er wird unruhig!“
Beide Männer lauschten ein paar Minuten, aber Totenstille herrschte und kein Laut war vernehmbar. Werner jedoch sah nach seiner Büchse, ob das Zündhütchen noch richtig saß und das Korn nicht verschoben und glänzend sei, reinigte das Visier von dem Lehm, der sich hineingesetzt hatte, und rückte, von seinem Gefährten gefolgt, wieder leise vor.
Da tönte ein leises Brummen an sein Ohr und gleich darauf trat, aus der dichten Finsternis der Höhle, die dunkle Gestalt des Bären hervor, dessen Augen wie ein Paar glühende Kohlen im Lichte funkelten. Brummend zog er die Luft ein und hob die Nase, um die Natur der neuen Ankömmlinge zu erforschen; obgleich aber der Luftzug zurück ging und er nicht recht die Witterung von seinen Feinden bekommen konnte, waren sie ihm doch zu nahe, als dass er nicht hätte Unrat merken sollen, und schnaubend und blasend zog er sich wieder zurück, ehe Werner Zeit hatte, den immer beweglichen Kopf des schwarzen Gesellen aufs Korn zu nehmen.
Beide Jäger wussten, dass jetzt der Augenblick zum Handeln gekommen war und schoben sich lautlos über den rauen Boden hin, der zurückweichenden Bestie nach, die sie auch bald wieder erreichten und zwar, wie Werner zu seinem Entsetzen bemerkte, am Ende der Höhle, die hier wohl so geräumig wurde, dass er sich auf seinen Knien emporrichten konnte, aber auch nirgends mehr einen Ausweg als da bot, wo sie mit ihren Körpern den zum Äußersten getriebenen Bären jeden Weg zur Flucht abschnitten.
„Wah“, sagte Tessakeh, als er sich neben Werner aufrichtete, der sich eben bemühte, das Korn seiner Büchse mit dem funkelnden Auge des unruhigen Tieres in eine Richtung zu bringen. „Wah! Ein bequemer Wigwam, aber ein schlechter Kampfplatz“, und dann die Richtung von Werners Büchse bemerkend, flüsterte er diesem zu:
„Schieß‘ nicht nach dem Kopf; wenn Du fehlst, sind wir beide verloren und die Bestie ist nicht einen Augenblick ruhig – ziel‘ auf den Brustknochen, wenn auch die Kugel das Herz nicht trifft, so wird sich der tödlich Verwundete zusammenkauern und uns weniger gefährlich sein – aber warte! Ich will den Schwarzen einen Augenblick ruhig halten und nun möge mein weißer Bruder schnell zielen und gut treffen!“
Kaum hatte Tessakeh diese Worte beendet, als er täuschend den Ruf des Hirschkalbes nachahmte. Hochaufhorchend richtete sich der Bär, als er den schrillen, unerwarteten Laut hörte, empor, und in demselben Moment donnerte auch das massive Gewölbe den Krach der Büchse nach. Wie von einem elektrischen Schlage aber getroffen und ehe noch der Rauch von der Mündung des Rohres fortziehen konnte, stürzte sich der Bär auf den Schützen, dem nicht einmal Zeit blieb, die Büchse hinzuwerfen und sein breites Messer zu ziehen, sondern, zurückgeschleudert durch die fürchterliche Gewalt und Kraft des Untieres, traf er mit dem Kopf an die Felsenwand neben sich und brach bewusstlos zusammen.
Tessakeh jedoch, der, auf dem Bauche liegend, die scharfe Klinge in der Hand, unter dem Rauch hinweg das Anprallen des Verwundeten noch zur rechten Zeit bemerkte und wohl vermutete, dass der Bär weniger eine feindliche Absicht, als den Wunsch, das Freie zu erreichen habe, schmiegte sich dicht an den Boden, und stieß mit dem scharfen gezückten Stahl nach der über hin hinwegsetzenden und gleich darauf im Dunkel der Höhle verschwindenden Bestie.
Werner war zwar durch den Schlag betäubt worden, erholte sich aber augenblicklich wieder; doch konnte er sich nicht gleich besinnen, wo er war, denn rabenschwarze Nacht umgab ihn. Da hörte er das Anschlagen eines Messers an den Feuerstein und das Bewusstsein seiner Lage kehrte zu ihm zurück.
„Tessakeh“, rief er, „wo sind unsere Lichter?“
„Wenn sie der Bär nicht mitgenommen hat, müssen sie neben uns liegen“, antwortete lakonisch der Indianer, „aber mein Gesicht ist nass und ich schmecke Blut. Tessakehs Stoß ist sicher und der Bär wird nicht zurückkehren, um zu sehen, ob der Feind in seinem Lager ruhe.“
Er hatte unterdessen etwas Schwamm entzündet, riss ein Stück von seinem Jagdhemd herunter und bald leuchtete ihnen wieder eine freundliche Flamme entgegen. Sie untersuchten nun den Platz, wo er gelegen hatte und fanden dicke, schwarze Blutstropfen bis zu der Stelle, wo ihn Tessakeh verwundete, und von dort aus das Blut überall in der Höhle umher gespritzt; der Indianer war ganz bedeckt davon. Werner wollte jetzt erst die Büchse wieder laden, Tessakeh verhinderte ihn aber daran.
„Der Schuss war gut“, sagte er, „und wenn das Blut nicht gleich floss, so öffnete ihm mein Messer den Weg; wir werden nicht weit zu suchen brauchen um den Bären verendet zu finden; wozu die Büchse wieder laden?“
„Warum hattest Du aber Dein Licht ausgeblasen, Tessakeh? Die übermäßige Helle wird Dir doch wahrhaftig nicht die Augen geblendet haben?“
„Weiß mein Bruder, wie lange wir noch in der Höhle zubringen werden? Wenn der Bär in dem engen Gange liegen geblieben ist, der sich zwischen hier und der Schlucht hin dehnt, so wird der schlanke Mann am Feuer draußen die Sonne auf- und untergehen sehen, ehe wir zu ihm zurückkehren können.“
„Verwünscht!“, rief Werner. „An das habe ich gar nicht gedacht – wenn er dort steckt, so sind wir eingesperrt hier. Ha! Mir ist’s jetzt schon, als ob die Luft dichter würde – komm, Tessakeh, lass uns eilen, mir ist nicht wohl, bis ich weiß, was wir zu fürchten haben.“
Lautlos krochen die beiden Männer nun den Weg, den sie gekommen waren, zurück und erreichten, ohne auf den Bär gestoßen zu sein, die Schlucht, immer aber bewies das dicke, geronnene Blut in ihrem Wege, dass er, schwer verwundet, nicht mehr weit konnte geflohen sein.
„Es wäre doch schändlich“, murmelte Werner, der jetzt hinter dem Indianer zurückkroch, „wenn er unten in der Schlucht läge, da hätten wir den ganzen Spaß umsonst gehabt, denn der Henker soll mich holen, wenn ich ihm freiwillig da hinunter folge!“
„Wah!“, rief Tessakeh, der mit Werners Licht in der Hand, da er das seinige, als das kürzeste, noch aufsparen wollte, einen Augenblick in die Schlucht hinunter geleuchtet hatte und jetzt gegenüber dahin sah, von wo sie mit Lebensgefahr herübergekommen waren.
„Liegt er unten?“, frug der Deutsche hastig.
„Ich wollte, er läge“, murmelte der Indianer vor sich hin, „unsere Lichter werden niederbrennen und wir werden hungern und dursten, aber nicht die andere Seite der Schlucht erreichen.“
„Aber, Tessakeh, was ist denn im Weg? Warum sollten wir nicht die andere Seite erreichen?“, frug Werner ängstlich, indem er sich bemühte, an des Indianers Seite heran zu kriechen und die Ursache seiner Furcht zu sehen. Dieser schmiegte sich dicht an den Felsen an und sein Licht über die Schlucht haltend, dass sich die Strahlen an der anderen Seite brachen, rief er: „Hier ist die Schlucht, aber wo ist der Ausgang?“
Einen Schreckensruf stieß jetzt aber selbst der ruhigere Deutsche aus, als er den gegenüberliegenden Gang so mit dem Körper des wahrscheinlich verendeten Bären ausgefüllt sah, dass auch nicht die geringste Aussicht blieb, hinüber zu kommen, ohne in die Schlucht zu stürzen, da nicht ein Zoll breit fester Boden dort war, auf den sich Hand oder Arm hätte stützen können.
„Tessakeh“, brach endlich Werner das peinlich werdende Stillschweigen, „hier können wir nicht liegen bleiben, und von Redham dürfen wir auch keine Hilfe erwarten, da er kein Licht weiter hat und nie im Dunkeln den Weg durch das Wasser finden oder, wenn er ihn wirklich fände, antreten würde, wären auch sechs Menschenleben damit zu retten – was ich ihm übrigens gar nicht verdenken kann, denn mir hat es mit dem Lichte gegraut. – Da aber hier unsere Lage mit jedem Augenblick schwieriger wird, denn unsere Lichter brennen nieder, so will ich mit Gott den Versuch wagen. Kann ich mich neben den Bären nicht in die Höhle zwängen und stürze ich in die Schlucht, dann sieht es freilich traurig aus und wir sind ein Paar lebendig Begrabene, gelingt es mir aber, dann will ich den alten Burschen schon aus dem Wege rücken.“
Der Indianer erwiderte kein Wort, und Werner legte seine Büchse und Pulverhorn ab, zog die noch immer nassen und schweren Leggins aus, um nichts zu haben, was seine Bewegung hindern konnte, und wieder wie früher, Ellbogen und Knie gegen beide Seitenwände der Höhle pressend, schwebte er über der dunklen Schlucht und erreichte in wenigen Minuten die andere Seite. Vergebens aber suchte er hier den schweren, unbehilflichen Leichnam des erlegten Bären zu bewegen und sich Eingang zu verschaffen; regungslos lag das Ungetüm da, noch im Tode seinen Mördern schrecklich.
Mit aller Kraft, die ihm die Natur verliehen und die die Todesangst noch steigerte, machte er jetzt mit dem rechten Arm einen letzten Versuch, weil er den linken nicht von dem Felsen wegnehmen durfte, indem er fürchten musste, den Anhaltepunkt zu verlieren. Da glitt sein rechter Fuß von einem der hervorstehenden Tropfsteinzacken ab; die Stütze vermissend, rutschte der Körper nach, und unfehlbar wäre er in die Tiefe gestürzt, hätte er nicht noch zur rechten Zeit mit beiden Händen den Felsen gefasst und sich am Rande der Höhle gehalten.
Wenig Trost bot ihm das freilich und schien nur den gewissen Sturz um wenige Minuten zu verzögern, denn lange hätte er es in der Lage nicht aushalten können, da seine Kräfte schon von Hunger und Anstrengung erschöpft waren. Tessakeh aber, seine Gefahr mit schnellem Blick übersehend, rief ihm zu, sich nur noch wenige Minuten zu halten, er hoffe, ihn zu retten – und dann das Licht auf die Erde, an den Rand der Schlucht setzend, dass es nicht ausgehe und sie in völlige Finsternis begrabe, begann er den Übergang über die Kluft, jedoch – durch Werners Unfall gewarnt – rückwärts. Es gelang ihm auch, an der Seite des Bären seine beiden Beine hineinzupressen. Hierdurch war er wenigstens vor dem Hinunterstürzen gesichert und arbeitete nun mit der Kraft der Verzweiflung, seinen Körper, der bei weitem schlanker und geschmeidiger als der des Deutschen war, neben den des Bären einzuzwängen.
Die Höhle war fürchterlich eng und die verendete Bestie stark und dick, dennoch gelang es ihm, nach mehreren Minuten fast übermenschlicher Anstrengung, und bald fand er sich an der anderen Seite des Erlegten. Fast ebenso schwierig jedoch war es jetzt, diesen von der Stelle zu bewegen und nach sich hin zu ziehen, denn nicht ein Augenblick blieb ihm zum Ausruhen, wenn er seinen Gefährten retten wollte. Doch kam ihm jetzt der vorragende Tropfstein sehr zustatten, gegen den er seine Füße stemmte und das schwere Tier an sich zog.
Der Schweiß floss in Strömen an ihm herab und eben hielt er, nur um Atem zu schöpfen, einen Augenblick inne, da tönte die matte Stimme Werners an sein Ohr, der ihm versicherte, dass er seine Lage keine halbe Minute mehr aushalten könne.
„Mut, Mut“, rief Tessakeh, „das Tier bewegt sich und mein Bruder wird in kurzer Zeit frei atmen können, Mut!“ Und mit erneuter Kraft versuchte er, den Koloss zu rücken. Da gab er etwas nach – jetzt noch etwas – einen frischen Halt nahm er, und nun zog er die leblose Gestalt des erlegten Feindes wohl einen Fuß lang zu sich hin. Mit Blitzesschnelle presste er sich jetzt wieder an dem Leichnam vorbei und erfasste mit seiner Rechten das Handgelenk Werners.
„Schwing‘ Dich herauf – nur einmal, dass ich den Gürtel fasse“, rief er ihm zu. Werner war es aber nicht vermögend und hauchte nur: „Ich kann nicht mehr – ich muss los lassen.“
Seine Kräfte waren geschwunden – und Tessakeh sah es; er verlor daher keine weitere Zeit mit Worten, ließ das Gelenk des Weißen gehen, schnitt mit schneller Hand ein Loch in das Fell des Bären, in das er mit der Linken hineingriff, um einen festen Anhalt zu haben, bog sich dann hinunter und fasste mit der anderen in Werners Gürtel. Dieser fühlte kaum seine Arme, die ihm zu erstarren drohten, durch die kräftige Hilfe erleichtert, als er zu einem letzten Versuch noch einmal die Sehnen anstrengte – er hob sich und lag bald, durch den Indianer unterstützt, mit dem Oberkörper in der Höhle.
Weiter konnte er nicht hinein, denn der Leichnam des Bären versperrte noch immer die Öffnung, aber in dieser Stellung vermochte er wenigstens etwas auszuruhen und brauchte nicht mehr zu befürchten, in den Abgrund hinab zu stürzen. Tessakeh begann unterdessen aufs Neue seine Versuche, den Bär zu einem geräumigeren Platze zu rücken.
Endlich gelang es ihm und Werner schwang sich nun ganz hinauf. Beide Männer waren aber zum Tode erschöpft und besonders lag der Deutsche, nicht allein durch die körperliche Anstrengung, sondern auch durch Seelenangst abgespannt, fast besinnungslos wohl eine halbe Stunde lang da.
Tessakeh, der zwar selbst, wenigstens für eine kurze Zeit der Ruhe bedurfte, war der Erste wieder, der sich erholte, und seinen Gefährten ermunternd, warnte er ihn davor, sich dem Gefühle der Erschöpfung zu sehr hinzugeben.
„Unser Weg ist lang und beschwerlich“, sagte er, „und mein Bruder wird nicht lange mehr den nagenden Hunger aushalten – möchte er das Fleisch roh essen? Vor der Höhle lodert ein Feuer, und ein warmes Lager ladet uns zur Ruhe und Erholung ein. Hier ist die Luft feucht und Finsternis wird uns in kurzer Zeit umgeben – unsere Lichter sind niedergebrannt!“
Werner, der selbst einsah, wie wenig sie zaudern durften, wenn sie nicht ihren Weg in völliger Dunkelheit suchen wollten, wo er nur mit Grausen an die mit Wasser gefüllte Höhle dachte, ermannte sich und durch die vereinten Anstrengungen beider schafften sie jetzt die schwere, unbeholfene Fleischmasse, indem Werner schob und Tessakeh zog, mehr nach vorne, wo die Höhle sich eine kurze Strecke lang so erweiterte, dass sie doch aufrecht sitzen konnten.
Hier nun verließ der Indianer den Weißen, der mehr als der Ruhe bedurfte und kroch zu der Schlucht zurück, um jenes abgelegte Kleidungsstücke, die Büchse und die Lichter von der anderen Seite herüber zu schaffen. Das Licht war fast niedergebrannt, doch hatte er selbst noch ein kurzes Stück aufbewahrt, das ihnen bei ihrem weiteren Fortgange leuchten sollte, und schnell kehrte er zu dem Deutschen zurück, um das schwierige Geschäft, den unbehilflichen Körper des Bären in dem engen Raum fortzubewegen, zu beendigen.
Werner schlug nun zwar vor, ihn abzustreifen und bloß die Keulen und Rippen, in das Fell geschlagen, mit hinauf ans Tageslicht zu nehmen; davon wollte aber Tessakeh nichts wissen und behauptete, nicht ganz ohne Grund, dass sie des niedrigen Platzes wegen den Bär in eben der Zeit an den Ausgang der Höhle schaffen, als abstreifen und zerteilen könnten.
„Wie aber wollen wir ihn hinauf bringen?“, wandte Werner ein. „Es wird uns nachher nichts anderes übrig bleiben, als das jetzt verschobene Geschäft mitten im Wasser vorzunehmen; wir alle drei könnten selbst unmöglich das schwere Untier unzerlegt zu Tage fördern.“
„Mein weißer Bruder soll sehen, wie leicht wir unsere Beute in Sicherheit bringen und er wird sagen: Tessakeh hat Recht“, erwiderte der Indianer, und ohne weiter ihre Zeit mit Unterhandlungen zu verlieren, begannen sie ihre Arbeit, nachdem Werner erst wieder seine Leggins angezogen und befestigt hatte.
Langsam, sehr langsam rückten sie vor, doch erreichten sie nun den etwas geräumigeren Teil der Höhle und waren bald, ohne auch nur weiter ein Wort zu wechseln, da, wo das Wasser begann und wo sie, um wieder zum Tageslicht zu gelangen, erst ihren Weg durch dasselbe verfolgen mussten.
Bis hierher hatte ihnen auch ihr Wachslicht getreulich ausgehalten, jetzt aber war es niedergebrannt, flackerte noch einmal hell auf und verlöschte. – Dichte Finsternis umgab die Jäger, und einige Minuten lang wagte keiner ein Wort zu sprechen; endlich brach Tessakeh das Schweigen und sagte: „Es ist gut! Wir würden das Licht doch müssen zurückgelassen haben, denn mein Bruder hat nicht drei Hände, dass er mit zweien den Bären zieht und mit der dritten die Leuchte hält – wir wollen an die Arbeit gehen.“
„Aber, hol’s der Teufel, Tessakeh, in das dunkle, mit Wasser gefüllte Loch hier, noch dazu bei gänzlicher Finsternis einzutauchen, ist doch wahrhaftig keine Kleinigkeit“, entgegnete etwas niedergeschlagen der Deutsche.
„Besann sich mein Bruder die Felswand zu erfassen, als er im Begriff war, in die Schlucht zu stürzen?“, fragte der Indianer.
„Besinnen? Da war auch Zeit zum Besinnen“, lachte Werner, „was hätte ich anderes tun wollen?“
„Und was will mein Bruder hier anderes tun? Mein Ohr ist offen und lauscht den Tönen des weißen Mannes.“
„Du hast Recht, Tessakeh“, sagte Werner etwas beschämt, „jetzt wie immer, doch damit du siehst, dass ich es wieder gut machen will, so lass mich vorangehen – so – hier steht meine Büchse – wirf sie nicht um, wenn Du vorbeigehst, ich will sie später nachholen. Jetzt müssen wir uns freilich in Acht nehmen, unseren Weg nicht zu verfehlen.“
„Die Höhle ist gerade und es führt kein Seitenzweig ab“, sagte der Indianer, „es wird meinem Bruder kein Raum gelassen sein, vom rechten Pfade abzuweichen und bald wird uns das erwärmende Feuer des ‚schlanken Mannes‘ entgegen leuchten.“
Werner war vorangekrochen, und seinen Weg fühlend, zog er mit Tessakehs Hilfe den Bären ins Wasser.
Dunkle, rabenschwarze Nacht umgab die beiden Männer und ihre Lage, in einer engen, nicht zwei Fuß hohen Höhle, zum dritten Teil mit Wasser gefüllt, gehörte keineswegs zu den beneidenswerten, doch waren beider Herzen in den freien Wäldern unter immerwährenden Gefahren und Entbehrungen gestählt, und ohne einen Klagelaut setzten sie langsam, aber sicher ihren Weg fort.
So unangenehm übrigens der Aufenthalt im Wasser war, so viel leichter ließ sich auch die Last darin fortbewegen, die ihnen fast gar keine Schwierigkeit mehr machte, und nach kaum viertelstündiger Anstrengung glänzte ihnen, zum Lohne ihres kräftigen Ausharrens, das liebe Tageslicht von oben, durch die enge, schornsteinähnliche Öffnung herab, entgegen, als sie am Fuße des als Leiter dienenden Stammes ankamen.
„Hallo!“, schrie Werner aus voller Kehle und hielt die Hände trichterförmig an den Mund, dass der Schall so viel lauter emporstieg. „Hallo da oben!“
In demselben Augenblicke fast verdunkelte sich auch der Eingang und die fröhliche Stimme Redhams rief herunter: „Soll mich der Teufel holen, wenn ich nicht froh bin, dass Ihr endlich da seid – ich glaubte schon, Ihr wolltet da unten wohnen bleiben.“
„Nicht einen Augenblick länger, als nötig“, rief Werner, indem er mit der Gewandtheit einer Katze an dem rauen Stamme hinaufstieg und bald das heitere Sonnenlicht begrüßte. „Aber hallo!“, rief er noch einmal aus und zwar diesmal vor Erstaunen, denn um ein gewaltiges Feuer herum lagerten fünf kräftige backwoodsmen16 – Pferde wieherten, Hunde schlugen an und die Männer sprangen empor, ihn zu bewillkommnen.
Schnell kletterte er heraus aus dem finsteren Loche und stand hochaufatmend wieder in Gottes freier, herrlicher Natur. Tessakeh war fast in demselben Augenblick an seiner Seite und beide Männer sahen sich ebenso schnell von allen anderen umringt, die ihnen herzlich die Hand schüttelten und wissen wollten, wie die Jagd abgelaufen sei, denn der Indianer sowohl als der Deutsche waren mit Blut fast überzogen. Werner aber hob sich auf die Zehen, und über die Schultern der ihn Umgebenden nach dem Feuer hinschauend, wo er einige delikate Hirschrippen und gewaltige Stücken saftigen Truthahnfleisches braten sah, schob er die ihn im Wege Stehenden beiseite, zog, sich am Feuer niederlassend, sein Messer heraus, und begann nun vor allen Dingen den Lebensmitteln zuzusprechen, indem er mit vollen Backen versicherte, dass er, bis er nicht seinen wütenden Hunger gestillt habe, stumm wie ein Fisch sein würde.
Lachend folgten die Übrigen seinem Beispiel und erst nach einer vollen Viertelstunde, als alles am Feuer Bratende rein verzehrt war und frische Stücke wieder, auf frische Hölzer gespießt, eine zweite Mahlzeit versprachen, löste sich das Band seiner Zunge, und einen Becher heißen Kaffees leerend, den Redham für ihn gekocht hatte, begann er den hoch aufhorchenden Männern ihre bestandenen Mühseligkeiten und Gefahren zu schildern und ihnen zu erzählen, wie ihm Tessakeh zweimal das Leben gerettet habe. Damit reichte er dem braunen Sohn der Wildnis, der an seiner Seite noch sehr behaglich an einem Truthahnknochen nagte, die Rechte hinüber und drückte die fettige Hand des Indianers, die dieser sich nicht erst Mühe gab, abzuwischen, warm und herzlich, indem er sagte:
„Tessakeh, Du hast mich Dir auf ewig verpflichtet und es soll nicht meine Schuld sein, wenn ich es nicht einmal mit einem gleichen Liebesdienst zu vergelten suche.“
„Mein weißer Bruder spricht gut“, antwortete der also Angeredete, indem er seine Hand wieder aus der des Deutschen nahm und in seiner Beschäftigung fortfuhr, „es ist aber nicht die erste Fährte, der wir zusammen gefolgt sind, und soll nicht die letzte sein. Wo Tessakeh am Abend sein Lager aufschlägt, wird das Rindendach immer zwei Männer vor dem Regen schützen. Tessakeh und sein weißer Bruder sind eins!“
„Und haben denn Eure Lichter ausgereicht?“, frug Redham. „Hol’s der Henker, Ihr seid ja über achtzehn Stunden in dem Loche gewesen.“
„Aus sind sie gegangen und in der Dunkelheit mussten wir uns durchquälen“, entgegnete Werner, „ich sage Euch, Redham, die Finsternis war so dicht da unten, dass man mit einem Messer kaum durchstoßen konnte, und dazu die Wasserpartie – brrr – mich schauderts jetzt noch, wenn ich daran denke, dass ich noch einmal durch muss, um meine Büchse zu holen.“
„Habt Ihr denn den Bär dicht unter dem Eingang?“, fragte einer der Jäger.
„Er liegt an dem Stamme, der hinunterreicht.“
„Was zum Henker lagern wir denn hier und schauen ins Blaue?“, rief ein anderer. „Wenn kaum hundert Schritte von uns entfernt so herrliche Bärenrippen zu finden sind! Give us a lift, my lads!“, fuhr er fort, indem er aufsprang und vom Halse seines Pferdes, das wenige Schritte davon ruhig graste, einen langen Strick losband, der um denselben befestigt war. „Werner mag noch einmal hinunter gehen und das Seil hier um den Leib des Bären befestigen – er ist doch einmal nass – und während er dann seine Büchse holt, fördern wir den alten Burschen zu Tage!“
„Gut“, rief Werner, „ich bin’s zufrieden, hat aber keiner von Euch ein Licht mehr? Denn lieber mache ich doch die Partie im Hellen, da ich über dem nicht weiß, ob ich die Öffnung im Dunklen wieder finden könnte.“
„Hier ist ein Licht“, rief einer der hinzugekommenen Jäger, indem er eine starke Kerze aus seiner Decke herauswickelte, „und wenn Ihr Gesellschaft haben wollt, so begleite ich Euch.“
„Danke, danke“, sagte Werner, als er das Licht anzündete und sich der Höhle näherte, „das wäre unnötig und Ihr würdet Euch ganz zwecklos durchnässen; der Weg ist kurz und ich lege ihn schnell zurück – werft mir nur das Ende der Leine herunter.“
Damit verschwand er wieder in dem engen Loch und gab bald darauf das Zeichen zum Aufziehen; Tessakeh jedoch, der fürchtete, dass das einfache Seil von dem bedeutenden Gewichte reißen möchte, ließ noch ein anderes hinab, das Werner auf seinen Ruf unter den Vordertatzen um den Leib der Bestie schlang, und mit vereinten Anstrengungen und unter dem ermunternden Zuruf und dem fröhlichen Jauchzen der Jäger lag bald die so mühsam erworbene Beute neben dem Feuer, laut knurrend und bellend von der Meute Hunde begrüßt, sie sich schnappend um den Erlegten herum drängten und ihn beleckten.
Bald darauf, nachdem die aus dem Stegreif verfertigte Leiter wieder hinabgelassen war, die sie, um den Bär beq uemer zu Tage zu fördern, hatten herausnehmen müssen, erschien auch Werner mit seiner Büchse und fand in den schmorenden Bärenrippen den, wenn auch etwas schwachen Lohn für die überstandenen Gefahren; jedoch war er sowohl als Tessakeh der Meinung, dass sie, und wenn zwanzig Bären darin steckten, in d i e Höhle nicht mehr hineingingen, denn es wäre, wie der Indianer gar nicht unrichtig bemerkte: Zu viel Mühe und zu wenig Fleisch.
Die Silbermine in den Ozarkgebirgen
Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode. Anton Strauss sel.Wittwe, Wien, 1844
Der Donner rollte dumpf und drohend über den hohen Gipfeln der Ozarkgebirge hin, schmetternd sein Echo fordernd, aus den dunklen Schluchten und die Nebel niederpressend in die engen, schroff in die Hänge gerissenen Täler. Der Blitz zischte dabei grell und flammend an den Felsen nieder, der ganzen wilden Landschaft mit dem falben Lichte des scheidenden Tages eine eigene, unheimliche Beleuchtung gebend. Der Regen rasselte in Strömen auf die dichtbelaubten Eichen und Hickorys nieder, wurde aber trotzdem von dem durstigen Boden aufgesogen, ehe er das tiefliegende Bett des kleinen Flüsschens ‚Hurricane‘ erreichen konnte, in dem das Wasser selbst jetzt nur in einzelnen kleinen Lachen stand.
Da klommen, als das Gewitter gerade den höchsten Punkt erreicht zu haben schien, und Schlag auf Schlag, von vielfältigem Echo verdoppelt, in den Schluchten dahin raste, zwei Jäger, in große, weiße, wollene Decken gehüllt, die die ganze Figur, fast bis auf die befransten Mokassins hinunter, bedeckten, an den steilen Seitenwänden nieder, welche den Hurricane von seinen Quellen bis dahin, wo er sich in den Mulberry ergießt, umgeben. Sie hielten auch nicht eher, als bis sie sich auf dem untersten, terrassenförmigen Vorsprung befanden, von dem aus sie das steinige Bett des Flusses, das dicht in die ihn starr und steil umgebenden Felsen eingezwängt liegt, übersehen konnten.
„Hol‘ der Henker den Sturm!“, brach endlich der Ältere von ihnen das Schweigen, indem er stehen blieb und, seine Decke zurückschlagend, das mit Leder bedeckte Schloss seiner Büchse untersuchte, ob es auch noch trocken und wohlverwahrt sei. „Er tobt ja heute zwischen den alten Stämmen, als ob er den ganzen Wald mit der Wurzel ausreißen wollte; ich bin herzlich froh, dass wir den Fluss erreicht haben, denn mir sinken die Glieder fast von dem schnellen Marsch, und die scharfen Steine haben mir Mokassins und Füße zerrissen.“
„Also Du weißt sicher“, fragte der Jüngere, dessen Namen Thomson war, seinen wohl um zehn Jahre älteren Kameraden, „dass Du auf der richtigen Fährte bist? Und dass die Spanier diesen Weg eingeschlagen haben?“
„Ich sah heute Morgen mit Tagesanbruch ihr Wachtfeuer unten an dem kleinen Schilfbruch, etwa anderthalb Meilen von hier, und hörte die Glocken ihrer Maultiere“, antwortete Preston.
„Und wie viel Männer glaubst Du, dass zu dem Zuge gehörten?“, fragte der andere bedenklich.
„Ich habe Dir schon gesagt“, entgegnete der Ältere mürrisch, „dass, so oft diese Fremden nun schon hier gesehen worden sind, nie mehr als zwei Männer von der Mündung des Hurricane aufwärts gingen, obgleich acht oder neun, gewöhnlich am Ausfluss des Hurricane, die Rückkehr der beiden Erstgegangenen erwarten.“
„Ich kann aus der ganzen Geschichte nicht klug werden“, antwortete Thomson kopfschüttelnd, „und lieb wär es mir, wenn Du mir jetzt einmal reinen Wein einschenktest und alles, was Du davon weißt, erzählst; denn da wir das Abenteuer zusammen bestehen wollen, möchte ich doch auch nicht gerne im Dunkeln tappen.“
„Gut“, erwiderte sein Kamerad, „der Regen hat ziemlich nachgelassen; so wollen wir denn zum Wasser hinunter gehen und dort unser Lager aufschlagen; bei einem guten Feuer und gehörig gebratenem Stück Hirschfleisch erzählt sich die Sache viel besser, und aufrichtig gesagt, werden wir wohl zum morgenden Tag unsere Kräfte noch etwas gebrauchen. Es fängt auch schon an, recht dunkel hier unten zu werden, und wir möchten das schwache Licht nötig haben, um schnell das nasse Holz in Brand zu bringen.“
Damit, und ohne die Antwort seines Gefährten abzuwarten, klomm er einen schmalen Hirschpfad, der an den Fluss hinunter führte, abwärts und stand bald, von jenem gefolgt, an dem steinigen Bett des Hurricane, und zwar gerade da, wo dieser in einer Biegung, und in Folge einer unterirdischen Quelle, ein kleines Becken von tiefem, obgleich gegenwärtig durch den Regen etwas getrübtem Wasser enthielt.
Das Gewitter ließ jetzt nach; weit im fernen Norden verhallte der Donner, und an vielen Stellen schaute der blaue, azurne Himmel durch die weißlich grauen Wolkenschleier, die, von einem frischen Südostwind gejagt, in langen, wehenden Streifen über das Tal hinweg zogen.
Wenig aber schienen sich die beiden Männer des schönen Abends zu erfreuen, sondern waren nur eifrig bemüht, ein Feuer anzumachen, um sowohl bei der erwärmenden Glut Schutz gegen die keineswegs milde Nachtluft zu finden, als auch einige Stücke rohes Hirschfleisch, das Preston in einem frisch abgestreiften Fell umhängen hatte, zum Abendessen zuzubereiten. Thomson schlug jetzt Feuer an und entzündete einen, wohl mit Pulver eingeriebenen Lappen, während Preston kleine trockene Späne herbeibrachte, die er mit seinem Tomahawk aus einem umgestürzten, verdorrten Baume herausgehauen hatte. In wenigen Minuten flackerte auch, durch vereintes Blasen und Schwenken erweckt, eine schwache Flamme empor, die, durch schnell und sorgsam nachgelegte Stücke genährt, bald zur hohen, erwärmenden Glut emporloderte.
Die Jäger hingen nun ihre Decken zum Trocknen an in den Boden gestoßene Stangen, sammelten von den umherliegenden, oft schon halb verfaulten Stämmen einige Rinde, die sie auf die Erde breiteten, um nicht auf dem nassen Boden liegen zu müssen, steckten dann dünn geschnittene Scheiben Hirschfleisch auf zugespitzte Hölzer nahe an die glühenden Kohlen und suchten die Zeit, in welcher das Fleisch briet, zu benutzen, sich selbst ein wenig zu trocknen und auszuruhen.
Beide Männer waren in einfache, dunkelblaue Jagdhemden, aus grobem, wollenen Zeug gefertigt, gekleidet, doch hatte der Jüngere noch eine Art Garnitur von kurzen hellgelben Fransen an dem seinigen, mit der es am Kragen, an den Ärmeln und an allen Nähten besetzt war. Sie trugen lederne Leggins oder Gamaschen und Mokassins, und in ihren ledernen Gürteln, welche die Jagdhemden zusammenhielten, staken die breiten, langen Bärenmesser. – Prestons Kopf war mit einem alten, abgetragenen Filzhut bedeckt, während Thomson ein hellfarbiges Tuch fest um die Schläfe gebunden hatte, dass sein dunkles, lockiges Haar sich oben hindurch drängte.
Ihre langen Büchsen, mit darüber hinhängenden Kugeltaschen, hatten sie an einen jungen Baum gelehnt, und warfen sich nun selbst, müde und matt von der gehabten Anstrengung, auf die Rindenstücke ans Feuer, dass die verdunstende Feuchtigkeit ihres Anzuges in dichten Dampfwolken von ihnen emporstieg.
„Nun, Preston“, begann Thompson nach einiger Zeit, nachdem er sich eins der mit Fleisch besteckten Hölzer hingenommen, von den rohen Stücken die gar gekochten, dünnen Streifen abgeschnitten hatte, und das Übrige wieder zum Feuer zurück steckte, „rücke mit Deiner absonderlichen Erzählung einmal heraus, nenne die Gefahren und sage den möglichen Gewinn, dann werde ich Dich auch wissen lassen, ob ich mit von der Partie bin oder nicht.“
„Wissen lassen – Partie sein oder nicht?“, fragte verwundert der also Angeredete, indem er sich auf einem Ellbogen emporhob und den jüngeren Kameraden staunend anschaute. „Sind wir denn hier in Sturm und Ungewitter hergekommen, damit Du jetzt noch zweifelhaft wärest, was Du tun oder lassen solltest? Wartest Du vielleicht nur noch darauf, eine etwas weniger günstige Beschreibung des Ganzen zu hören, um wieder ruhig heimzukehren und mir allein die Entdeckung zu überlassen, an die ich, wie Du weißt, nun einmal mein Leben gesetzt habe?“
„Nun, nun“, lachte Thomson, „nur nicht so hitzig; heraus mit der Sprache; Du weißt, ich bin gewöhnlich der Letzte, der einen einmal gefassten Beschluss wieder aufgibt. Also klar und deutlich denn – was haben wir zu hoffen? Damit wir schnell und kräftig unsere Maßregeln treffen können.“
„Gesprochen wie ein Mann“, antwortete der Ältere, wieder in seine behagliche ruhende Stellung zurückgleitend; „und nun erfahre denn auch alles, was ich von dem ganzen geheimnisvollen Leben und Treiben der Spanier weiß, denen ich jetzt schon jahrelang nachspüre. Aber noch nie hat ein Fuchs einen Hound17 mehr zum Narren gehabt und öfter von der Fährte abgebracht, als diese verwünschten Señores mich, der ich ihnen nicht weniger treu und gierig gefolgt bin. Du weißt, dass schon seit Jahren die Cherokee von einer Silbermine gesprochen haben, die sich irgendwo an den Wassern des Hurricane18 befinden und außerordentlich reichhaltig sein solle; nie aber konnten alle nur erdenkliche Versprechungen auch nur Einen von ihnen bewegen, den Platz genauer zu beschreiben, da nach ihren Gesetzen der Tod auf dem Verrat stand, trotzdem, dass doch Keinem von ihnen das Geheimnis mehr etwas nützen konnte. Einige Spanier aber müssen im Besitz desselben sein, denn schon seit langen Jahren (seit drei Jahren beobachte ich sie selber) kommen mehrere in lange mexikanische Mäntel gehüllte Gestalten mit drei oder vier Maultieren an die Mündung des Hurricane, wo der größte Teil derselben in dem fast undurchdringlichen Dickicht, von dem der Fluss seinen Namen hat, lagert. Zwei steigen dann mit den Tieren den Berg an der linken Seite des Flusses hinauf, ziehen auf der zweiten Terrasse von oben fort, durchschneiden dort den ,flat mountain‘ oder die mehrere hundert Schritt breite, offene Stelle am Abhang des Berges, dem kleinen Rohrdickicht gegenüber, das etwa eine Meile von hier den Fluss hinauf liegt, wenden sich dann wieder ins Tal, indem sie ihre Maultiere in dem Rohrdickicht ausgehobbelt (mit zusammengebundenen Vorderfüßen) lassen, und suchen dann die Mine auf, die, Gott weiß wo, aber irgendwo in dieser Gegend liegen muss. Nach vierundzwanzig Stunden schon kehren sie gewöhnlich mit schwerbeladenen Tieren zu ihrer Gesellschaft zurück, und sind dann wieder für zwölf Monate verschwunden. – Drei Jahre nun passe ich ihnen schon auf und habe, wenn sie fortzogen, mit unermüdlicher Sorgfalt ihren Spuren nachgeforscht, beide Seitenwände des ganzen Flussbettes von oben bis unten durchwühlt, fast keinen Stein unumgewendet liegen gelassen, als ob sämtliche Bären von Arkansas nach Würmern gesucht hätten, und – alles vergebens. Vom Schilfdickicht aus waren sie mehrere hundert Schritt bergan gestiegen, hatten sich aber dann so zwischen den Felsen und dem Gestein gehalten, dass jede Spur verschwand und mein Auge, sonst keineswegs eins der schlechtesten, ihrer Spur nicht weiter zu folgen vermochte. Zwei Jahre hintereinander machte ich solch‘ vergebliche Versuche, und zu meiner Schande muss ich’s gestehen, dass mich auch eine von den Nachbarn erweckte Furcht abhielt, meinen Nachforschungen den gehörigen Erfolg zu sichern. Diese erzählen den finsteren Spaniern nämlich viele schauerlich klingende Geschichten nach, dass sie zum Beispiel, um ihr Geheimnis zu bewahren, Menschenblut nicht geachtet haben sollen, und einst einen einsamen Jäger, der sie zufällig bei ihren Arbeiten überraschte, ermordet hätten, und andere dergleichen schreckliche Geschichten.
War ich allein, so übermannte mich stets unwillkürlich eine fast weibische Furcht, wenn ich solchen Mordes gedachte, und scheu blickte ich dann wohl umher, hinter jedem vorspringenden Felsen oder umgestürzten Baumstamm die gespannte Büchse eines der dunkeläugigen Schufte vermutend. Jetzt ist das etwas Anderes; w i r sind unserer Zwei und sie sind Zwei; finden wir den Platz, wo sie graben, und sie entdecken uns und zeigen sich feindselig, wohl, so schießen unsere Büchsen so sicher als die Ihrigen, vielleicht noch sicherer. – Nehmen sie aber Vernunft an, desto besser, mich verlangt nicht nach Menschenblut, und es wird genug Silber für uns alle Vier vorhanden sein; aber wissen m u s s ich den Platz, und umsonst will ich nicht Jahre lang damit vergeudet haben, ihren Spuren nachgeschlichen zu sein, ohne meinen Zweck erreicht zu haben.“
Preston schwieg und schaute sinnend, über seinen Plänen brütend, in die zusammenfallenden Kohlen, während Thomson einige Minuten ebenfalls tiefes Schweigen beobachtete und mit seinem breiten Jagdmesser allerlei Figuren vor sich in die Erde grub; endlich wandte er den Kopf halb zu seinem Gefährten herum und frug, während er dabei die Spitze seines Messers auf den ledernen Leggins reinigte und sich damit die Zähne stocherte:
„Wann wollen wir aufbrechen?“
„Sobald der Mond aufgeht, und das geschieht ein Viertel nach Zwölf“, lautete die Antwort, „dann müssen wir dem Lauf des Flusses stromaufwärts folgen, bis wir an das Schilfdickicht kommen, und dort dasselbe umlauern, bis die Spanier, mit dem edlen Metall beladen, zu ihren Tieren zurückkehren. Sie werden den Weg oft machen müssen, und unserer Schlauheit ist es jetzt anheimgestellt, das Ganze friedlich, das heißt unbemerkt – oder feindselig, wenn entdeckt – abzumachen. Hunde haben sie nicht mit sich, von diesen ist also keine Entdeckung zu fürchten, und finden wir den Platz, so sind wir gemachte Leute.“
„Gut!“, rief Thomson, aufs Neue ein mit Fleisch bestecktes Holz vor sich hinpflanzend, welchem Beispiel diesmal sein ernsterer Jagdgefährte folgte. „Gut – ich bin dabei – es ist wenig Mühe und Gefahr und die Hoffnung auf ungeheuren Gewinn; da widersteh‘ ein Anderer. Wir wollen uns nur noch tüchtig stärken und ein halb Stündchen schlafen, denn wer weiß, wie wir’s nötig haben werden; kommt dann der Mond, so haben wir wieder Kräfte und ertragen, was uns in den Weg kommt, leichter und mit frischerem Mute.“
Schweigend beendeten die beiden Männer ihre Mahlzeit, schürten dann das Feuer auf, das, von dürrem Holz genährt, hoch emporloderte, hüllten sich in ihre Decken und versuchten, ihre Körper zu den bevorstehenden Anstrengungen auszuruhen.
Der Jüngere war bald sanft eingeschlafen, und sein tiefes, regelmäßiges Atmen bewies, wie wenig er die Gefahr, der er entgegenging, kannte, oder wenn er sie kannte, wie furchtlos er sie erwartete. Der Ältere wickelte sich zwar auch in seine Decke und schien, den Kopf auf ein Stück faulen Holzes gelegt, zu schlummern, seine Augen aber waren und blieben geöffnet, und sinnend schaute er hinauf zu den Myriaden von Sternen, die oben vom dunklen Nachthimmel friedlich und freundlich auf ihn herab funkelten.
Endlich erhellte sich an den östlichen Bergkuppen der Himmel – der Mond musste gleich erscheinen; da hob sich Preston von seinem harten Lager, dehnte und streckte die Glieder, weckte seinen Kameraden und ging dann zum nur wenige Schritte entfernten Wasser, sich Gesicht und Hände darin zu baden, um mit klaren Augen und hellem Verstand den gefährlichen Weg anzutreten.
Thomson sprang auf und folgte seinem Beispiel; beide wickelten dann ihre Decken zusammen und hingen sie sich über die Schulter, nahmen ihre Büchsen, schüttelten frisches Pulver auf die Pfanne und waren so gegen alles, was ihnen entgegentreten mochte, gerüstet.
„Sollen wir nicht lieber im Tale hingehen?“, fragte jetzt Thomson, als er sah, dass Preston an einigen steilen Felsstücken hinaufkletterte, um eine der Terrassen zu erreichen. „Wir haben auf jeden Fall besseren Weg und können schneller fortkommen; denn, hol’s der Henker, so in der Nacht zwischen den scharfen Steinen mit zerrissenen Mokassins umherzuklettern, ist eine verteufelt böse Sache – meine Füße brennen mir schon jetzt wie Feuer.“
„Wir müssen uns aus eben dem Grunde zwischen den Felsen halten, aus dem die Spanier den raueren Weg gewählt haben – um alle Fährten zu vermeiden. Bleiben wir unbemerkt, so ziehen wir uns leise und vorsichtig zurück, und erregen nicht den Verdacht der Fremden, die sicher, wenn sie auch nicht den Talweg einschlagen, doch hinunter spüren, ob sie keine verräterischen Fußspuren dort entdecken können.“
Mit rüstigen Schritten, ohne weiter ein Wort laut werden zu lassen, stieg der Ältere jetzt voran, und Thomson, wohl einsehend, dass der erfahrenere Kamerad Recht habe, folgte, dann und wann nur, wenn er gerade auf einen recht spitzigen Stein getreten war, seinen Schmerz mit einem halb unterdrückten Fluch beschwichtigend.
Eine kleine Stunde mochten sie so langsam fortgestiegen sein, der Mond goss freundlich vom hohen Himmel herab sein silbernes Licht durch den Wald, als Preston anhielt und, nach vorn deutend, seinem Kameraden zuflüsterte, dass dort das Schilfdickicht sei und er den Klang eines Glöckchens zu hören glaube. Klar und deutlich drang auch jetzt der feine, reine Ton einiger kleiner Schellen durch die Nacht, und die Männer hielten, um sich über ihr weiteres Vorschreiten zu beraten.
„Sind sie denn auf der rechten oder linken Seite des Flusses?“, fragte Thomson leise seinen Kameraden, der aufmerksam dem Schall der Glocken horchte, um zu wissen, wie viel Tiere sie diesmal mit sich führten.
„An der rechten“, flüsterte Preston zurück, „wenigstens gingen jedes Mal an dieser ihre Fußspuren hinauf; aber“, unterbrach er sich, „horch doch einmal, wie viele Glocken Du hörst – das bimmelt ja untereinander herum, als wenn es fünf oder sechs wären.“
Mit gespannter Aufmerksamkeit lauschten jetzt beide dem vermischten Klange, der aus dem Tal zu ihnen heraufdrang, bis Thomson endlich das Schweigen brach und leise vor sich hinmurmelte, dass er v i e r verschiedene Glocken gewiss höre.
„Und mir ist’s, als wären’s fünf“, erwiderte eben so leise Preston. – „Nun, zum Teufel, so lass es zehn sein!“, entgegnete unmutig Thomson. „Wir sind einmal hier, und auf ein paar Spanier mehr oder weniger wird es jetzt auch nicht ankommen; wir stehen hier auf Onkel Sams19 eigenem Grund und Boden, und haben die Fremden, im Fall sie uns entdecken sollten, böse Absichten, nun, so mögen sie sich’s selber zurechnen, wenn wir mit unserem Blei freigebig sind. – Aber was hast Du denn da?“, fragte er, sich unterbrechend, seinen Kameraden, der sich dicht niederbog und den Boden genau zu untersuchen schien.
„Eine Spur, so wahr ich lebe, und von einem beschuhten Fuß!“, rief Preston. „Sie müssen hier hinauf gegangen sein.“
„Pst“, flüsterte Thomson, seinen Arm ergreifend und festhaltend, „ich höre Schritte.“
In gespannter Erwartung horchten beide jetzt auf, und deutlich und immer näher kommend klang das Geräusch eines langsam bergan steigenden Mannes zu ihnen her. Lautlos schmiegten sie sich an die Erde, auf der sie standen, hinter einige zerstreut umherliegende Felsstücke, und erwarteten die Gestalt, die, in einen braunen, langen Mantel gehüllt, den Kopf mit einem breiträndigen schwarzen Filzhut bedeckt, langsam die Terrasse, an deren Rand die zwei Jäger lagen, erklomm, dort stehen blieb, sich etwa fünf Minuten lang vorsichtig umschaute, nach allen Himmelsrichtungen hinhorchte, und dann einen leisen, aber vernehmlichen Ruf, den Ton der Eule nachahmend, dreimal ertönen ließ.
Er wurde einmal aus dem Rohrdickicht heraus beantwortet, und darauf war alles wohl eine halbe Stunde lang still wie im Grabe; dann scholl derselbe Ruf wieder aus dem Tal herauf. Die Schildwache, denn etwas anderes konnte die hoch aufgerichtete, dunkle Gestalt, die, an einem Stamm lehnend, dem geringsten Laut zu horchen schien, nicht sein, antwortete wie das vorige Mal, stieg dann den Weg, den sie gekommen, wieder hinunter, und nach wenigen Minuten, als ihre Schritte in der Entfernung verhallt waren, lag die ganze Gegend so einsam und verlassen, als ob sie noch nie von einem menschlichen Fuß entweiht worden wäre.
Wohl noch eine Viertelstunde blieben die beiden Männer in ihrem Versteck, dann aber, als alles sicher zu sein schien und sie glauben konnten, dass sich die Fremden wieder entfernt hätten, hob Thomson den Kopf, schaute einen Augenblick in das von dem jetzt hoch stehenden Monde erhellte Tal, und wandte sich gegen seinen älteren Kameraden, der indessen ebenfalls aufgestanden war und wiederum nach dem Schloss seiner Büchse schaute, ob durch das Niederlegen des Gewehrs das Pulver nicht von der Pfanne gefallen sei.
„Nun, Preston, was hältst Du von der Erscheinung? – Mir gefiel sie gar nicht; ich hatte einmal große Lust vorzuspringen und dem langen Burschen das Messer in die Kehle zu stoßen – es wäre einer weniger gewesen!“
„Das würde so unbesonnen als töricht gewesen sein“, entgegnete mit halb unterdrückter Stimme der Angeredete, „und hätte unseren ganzen Plan nicht allein verderben, sondern uns auch der Rache sämtlicher brauner Schurken preisgeben können. Nein – mir ist es jetzt klar geworden – die Burschen müssen mit ihrer Beute im Tal herabkommen, und zwar im felsigen Bett des Bergstroms selbst, sonst hätte ich in früheren Jahren ihre Spuren gefunden, und dieser lange Gesell war nur hier oben aufgestellt, um sie vor irgend einer Überraschung von unten her zu sichern, während sie indessen ihre Last zum Sammelplatz brachten, um dort nachher alles bequem aufladen zu können. Wir haben aber jetzt keine Zeit mehr zu verlieren, denn wer weiß, ob sie den Weg noch mehr als einmal machen, und finden wir sie nicht beim Graben beschäftigt, so dass ich mir den Platz genau merken kann, so hilft unser ganzer Zug nichts.“
„Sie können aber doch unmöglich all‘ das beste Erz in der Nacht finden, und werden sicher ihre Arbeit noch nach Tagesanbruch fortsetzen“, antwortete Thomson.
„Was sie am gestrigen Tage erbeutet haben, schaffen sie jetzt in Sicherheit und vernichten wieder alle Spuren, die sie hinterlassen könnten“, entgegnete Preston, „nein, nein, auf Tagesanbruch dürfen wir nicht warten, überdies scheint es, als ob sie Verrat ahnten, was der Posten zur Genüge beweist. Komm also ins Tal hinunter, wir schleichen durch den Schilfbruch, wo sie schwerlich eine Wache zurückgelassen haben, und folgen leise dem Lauf des Flusses. Finden wir sie bei der Mine beschäftigt, so merken wir uns den Platz und entfernen uns wieder so schnell und leise als möglich, denn ich vermute nicht ohne Grund, dass sie diesmal in stärkerer Anzahl als gewöhnlich da sind. Lass sie dann, was sie gesammelt haben, mit fortnehmen – wenn sie das nächste Jahr wieder kommen, sollen sie’s schwerer finden, ihre ledernen Felleisen zu füllen, als bisher, das Silber müsste denn haufenweis in den Bergen vorkommen.“
Die Jäger stiegen jetzt vorsichtig in das enge Flusstal hinab, und krochen, Schlangen gleich, in den nicht sehr dicht stehenden kleinen Schilfbruch hinein, aufmerksam dabei auf das Geringste achtend, was ihnen Gefahr oder Entdeckung drohen konnte. Aber keine Wache war bei den Maultieren, die ruhig weideten und die Anschleichenden gar nicht zu beachten schienen, zurückgelassen, und hoch aufatmend erreichten sie wieder den offenen Wald oberhalb des Schilfs, wo Preston schnell weiter eilen wollte, als ihn Thomson am Arme hielt und frug, ob sie nicht lieber das Silber erst aufsuchen sollten, was die Spanier schon irgendwo hierher getragen haben.
„Geh zum Henker mit Deiner Torheit!“, entgegnete mürrisch Preston. „Nicht wahr, die Zeit hier mit Kinderspielen versäumen, um eine Sache aufzufinden, die wir nicht einmal anrühren dürfen, ohne augenblicklich Entdeckung fürchten zu müssen. – Komm, komm, wir können jeden Augenblick den wieder zurückkehrenden Schuften begegnen, und es wäre doch zu wünschen, dass wir sie eher hörten, ehe sie von unserer Nähe eine Ahnung hätten.“
Mit diesen Worten machte er sich von Thomsons Hand los und glitt mit unhörbarem Schritt über die runden, glatten Kiesel des Flussbettes, von seinem Kameraden ebenso geräuschlos gefolgt, wie zwei den Gräbern entstiegende dunkle Schatten der Unterwelt.
Wohl eine Weile mochten sie ungestört und ununterbrochen ihren Weg fortgesetzt haben, ohne auch nur das Geringste zu vernehmen, was die Nähe lebendiger Wesen hätte verraten können, als sie plötzlich, dicht vor sich, Stimmen hörten, und kaum noch Zeit behielten, sich in den Schatten einer umgestürzten Platane zu werfen, ehe fünf dunkle Gestalten, mit kleinen Säcken auf den Rücken, die übrigens, dem gebückten Gehen der Männer nach zu urteilen, ein bedeutendes Gewicht haben mussten, ihnen gerade entgegen kamen und lautlos, von einem großen Stein auf den anderen tretend, dem Schilfbruch zuwanderten. Als sie nur noch wenige Schritte von dem Versteck der Jäger entfernt waren, blieb der Führer stehen und richtete einige Worte in spanischer Sprache an die ihm Folgenden; gleich darauf aber setzte er wieder seinen Weg fort und war bald mit seinen Begleitern an einer Biegung des Hurricane hinter einer Felsecke verschwunden.
„Verstandest Du, was der lange Schuft da in den Bart murmelte?“, fragte Thomson seinen neben ihm liegenden Gefährten.
„Nicht ein Wort“, entgegnete dieser, „es ist das erste Mal, dass ich Spanisch reden höre; komm aber schnell, wir dürfen keinen Augenblick verlieren, vielleicht können wir die Mine noch entdecken, ehe jene zurückkehren, denn hol’s der Teufel, es sind ihrer doch mehr, als ich dachte, und die Burschen führen scharfe, lange Messer.“
Schnell und leise verfolgten beide wieder wohl noch mehrere tausend Schritt den Lauf des kleinen Stromes, als Preston plötzlich stehen blieb und auf mehrere Hacken und Hämmer deutete, die zerstreut, gerade in einem ausgetrockneten Teil des Flussbettes, umherlagen.
„Da, beim Himmel!“ rief er, krampfhaft Thomsons Schulter erfassend, der neben ihn getreten war. „Wir sind im Nest!“
„Und was ist das Dunkle dort, was da unter dem Busch liegt?“, fragte Thomson, indem er mit vorgestrecktem Oberkörper der fraglichen Stelle näher trat und sich niederbog, um den Gegenstand, der seine Aufmerksamkeit erregt hatte, zu erkennen. Aber mit einem Ruf des Schreckens und Erstaunens sprang er zurück, denn nur wenige Zoll von den seinigen entfernt blitzten ihm die dunklen Augen eines Mannes entgegen, der auch in demselben Augenblick mit gezogenem Messer auf die Füße sprang und einen lauten Notruf ausstieß.
„Teufel!“, schrie Preston, der bei der ersten Bewegung des Fremden sein Messer ebenfalls aus der Scheide gerissen hatte. „Teufel!“, und sprang von der Seite auf den Spanier los. Gar verderblich würde aber der Sprung für ihn gewesen sein, hätte nicht zufällig die Büchse, die er in der linken Hand hielt, den sicheren Stoß des Angegriffenen abgewandt, dem in demselben Augenblick das breite Messer des Jägers in der Brust saß, dass er aufschreiend zu Boden stürzte; im Falle selber aber riss er noch eine Pistole aus dem Gürtel und brannte sie auf den von ihm Zurückschreckenden ab.
Wohl fehlte die Kugel den, für welchen sie bestimmt war; doch zerschmetterte sie die linke Hand seines neben ihm stehenden Kameraden, die dieser eben erhoben hatte, um den Feind mit einem Kolbenschlage unschädlich zu machen.
Machtlos sank Thomsons Arm und seine Büchse rasselte in die Steine nieder; doch wie ein Tiger flog er auf den zum Tod Getroffenen zu und stieß dem schon Verschiedenen dreimal noch die breite Klinge in die Brust, bis Preston seinen Arm fasste und ihn zurückzog.
„Fort, fort“, rief dieser, „lass den, der hat genug, aber bald werden uns die Teufel auf der Fährte sein – fort! Ich möchte nicht um alle Silberminen der Welt mit ihren fünf Messern Bekanntschaft machen!“
„Ich bin verwundet“, flüsterte jetzt, mit verbissenem Schmerz, Thomson, „meine Hand ist zerschmettert.“
„Besser die Hand, als der Kopf“, knirschte Preston, die Büchse vom Boden aufhebend und seinem verstümmelten Kameraden hinreichend, „komm! – In fünf Minuten ist’s zu spät“, und mit schnellen Schritten eilte er, von Thomson, der die Nähe der Gefahr erkannte, gefolgt, eine kurze Strecke im Flussbett fort, und sprang dann an der rechten Talwand in die Höhe, um vielleicht noch vor den Verfolgern den Gipfel des Berges zu erreichen und dann an der anderen Seite desselben, unter dem Schutz der Nacht, leichter die Flucht zu bewerkstelligen.
Die zerschossene Hand vorn in der Brust geborgen, blieb Thomson, seinen Schmerz verbeißend, dicht an jenes Seite, und in wenigen Minuten waren beide in der Dunkelheit des Waldschattens verschwunden; in demselben Augenblick aber raschelten die Büsche, und fünf finstere Gestalten brachen durch die Sträucher auf den eben von den Flüchtigen verlassenen Wahlplatz.
E i n e n Schreckensruf stießen sie aus, als sie den Leichnam ihres gemordeten Kameraden erblickten, und spähende Blicke sandten sie umher, die Täter zu entdecken und ihrer Rache zu opfern; da mahnte eine schnelle, gebieterische Gebärde ihres Führers zum Schweigen, und wie eben so viele, aus dunklem Marmor gehauene Figuren standen die Männer, ohne auch nur zu atmen, da und lauschten hinein in den stillen, in heiliger Ruhe sie umgebenden Wald.
Einen Augenblick herrschte Todesschweigen, da scholl das Krachen eines dürren Astes an ihr Ohr – da noch einmal, und mit lautem Freudenruf – wie Hunde, die die Nähe ihres fliehenden Feindes, des Panthers, wittern – sprangen die fünf kräftigen Männer an der fast steilen Felswand, die das enge Tal einschloss, hinauf und folgten der Richtung, in der sie das Geräusch gehört hatten.
Schon hatten die beiden Flüchtigen, die durch einen Fehltritt und Sturz des verwundeten Thomson die Verfolger auf ihre Spur gebracht, die sechste Terrasse erreicht, und eilten in langen Sätzen einem Kastaniendickicht zu, das dunkel vor ihnen lag, als sie die Schritte des schnellsten ihrer Feinde hinter sich hörten. Preston riss gerade noch zur rechten Zeit seinen Gefährten in eine kleine Schlucht hinein, neben der, kaum zwei Schritte von ihnen entfernt, ein dunkler Abgrund sie angähnte, als eine lange, dunkle Gestalt an ihnen vorbeisprang und dem Dickicht zueilte. Dieser folgte rasch eine zweite und dritte, und schon hatten die beiden letzten den Rand der Terrasse erklommen und wollten dieselbe Richtung nehmen, als der eine von ihnen, ob aus Zufall oder durch den Instinkt, der ihm seinen Feind verriet, getrieben, nach dem dunklen Platze, der die beiden Verfolgten barg und der ihm verdächtig scheinen mochte, zusprang und aufmerksam darauf hinschaute.
Der Mond trat gerade hinter einer dünnen Wolke hervor, und der glänzende Büchsenlauf musste die Versteckten verraten haben, denn ein durch die Überraschung ausgepresstes „Ha!“ entfuhr den Lippen des Spaniers. Es war aber sein letzter Laut, denn Preston, als er sah, dass sie entdeckt waren, hatte ruhig die Büchse heraufgenommen und angelegt, und bei dem Krach des Gewehres zuckte auch der sicher Getroffene zusammen und stürzte mit schwerem Fall zwischen die Steine nieder.
„Mache den anderen Schuft kalt – schnell oder er entflieht“, rief er jetzt seinem Gefährten zu, der bleich und atemlos neben ihm am Felsen lehnte.
„Nimm mein Gewehr – ich kann es nicht mehr heben“, hauchte dieser und reichte ihm die Büchse, die Preston in fieberhafter Aufregung ergriff, um auch den anderen Feind unschädlich zu machen, doch dieser trat hinter eine starke Eiche, die ihn schützend bedeckte, und sein Ruf brachte in wenigen Minuten die anderen zur Stelle zurück, die, durch den Krach der Büchse in ihrem Lauf aufgehalten, jetzt mit wilder Freude dem Zeichen Folge leisteten.
Aber Preston war indessen nicht müßig gewesen und hatte, da er sah, dass sich der Spanier außer dem Bereich seiner Büchse hielt, Thomsons Gewehr hingestellt, das seinige wieder geladen, und schüttete gerade Pulver auf die Pfanne, als die dunklen Schatten der Verfolger sichtbar wurden, wie sie schnell durch die umhergestreuten Felsstücke und Stämme einher glitten. Mit wenigen Worten beschrieb der Zurückgebliebene den Schlupfwinkel ihrer Feinde und zeigte ihnen das neue Opfer, das durch Prestons sichere Hand gefallen; aber nur ein lauter, wilder Schrei der Rache, bei dem die beiden Verfolgten unwillkürlich zusammenzuckten, war die Antwort, und wie Tiger warfen sich die Spanier auf ihre Beute.
Preston lag im Anschlag, und der Erste, der, in der linken Hand eine Pistole, in der rechten ein Messer, kaum zehn Schritt von ihm entfernt, hinter einem Felsstück auf ihn ansprang, fiel, durch das Herz geschossen, nieder; seine Büchse dann wegwerfend, ergriff er die seines Kameraden und legte mit Blitzesschnelle auf den Nächsten an – aber harmlos berührte sein Finger den Drücker! Wohl schnappte der Hahn und die Funken flogen in die geöffnete Pfanne hinab, doch das Pulver war ihr beim Sturz entfallen, und erfolglos klappte der Stein gegen den Stahl. In dem Augenblick schoss ein scharfer Blitz hinter einem dicht neben ihm liegenden Fels hervor, und mit zerschmettertem Haupt sank Preston auf seinen Kameraden zurück.
Da sprang dieser, mit Zusammenraffen seiner letzten Kraft und gezücktem Messer unter der Leiche vor und verteidigte sich, Verwundung und Gefahr verachtend, mit wilder Verzweiflung gegen die drei auf ihn anstürmenden Feinde; doch ein Kolbenschlag machte ihn taumeln, und während er noch versuchte, mit der linken, zerschmetterten Hand anzuklammern, stürzte er mit dumpfem Fall und lautem Angstschrei in die tiefe, gähnende Schlucht an seiner Seite hinab.
*
Drei Tage waren vergangen, als ein Jäger aus den Ansiedlungen am Hurricane der Spur eines Hirsches folgte und Unmassen von Aasgeiern eine der Terrassen umkreisen sah.
Aus Neugierde, um zu sehen, was für ein Wild dort den Raubvögeln zur Beute gefallen sei, näherte er sich dem Platze und fand auf dem Berge ein, und in der Schlucht, durch die Geier geleitet, ein zweites Gerippe, nicht weit aber von dem ersten entfernt ein frisches Grab, und auf demselben, als Grabstein, einen breiträndigen schwarzen Filzhut, mit einem langen Messer auf den schnell aufgeworfenen Hügel festgespießt.
Wohl eilte er, so schnell er vermochte, in die Ansiedlungen zurück und brachte schon am nächsten Morgen alle Nachbarn, die er auftreiben konnte, auf den Wahlplatz, um von hier aus die leicht erratenen Täter zu verfolgen und zu bestrafen; vergebens aber blieben sie, mit dem Scharfsinn der Indianer, Tage lang auf der Fährte der Maultiere; die schlauen Spanier hatten sich und alles, was ihnen gehörte, auf Kanus in Sicherheit gebracht und nur einen mit den Lasttieren ins Land geschickt, um die Verfolger, die sie nach kurzer Zeit vermuten mussten, irre zu leiten. Dieser hatte dann die Tiere verkauft und war, ohne dass jemand auf ihn achtete, spurlos verschwunden.