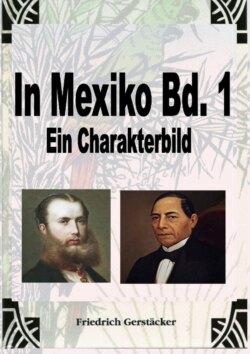Читать книгу In Mexiko Bd. 1 - Gerstäcker Friedrich, Jurgen Schulze - Страница 1
Gesammelte Schriften Friedrich Gerstäcker In Mexiko Ein Charakterbild 1. Band Volks- und Familien-Ausgabe 2. Serie Band Neun der Ausgabe Hermann Costenoble, Jena Friedrich-Gerstäcker-Gesellschaft e.V., Braunschweig Ungekürzte Ausgabe nach der von Friedrich Gerstäcker für die Gesammelten Schriften, H. Costenoble Verlag, Jena, eingerichteten Ausgabe „letzter Hand“. Herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von Thomas Ostwald. Unterstützt durch die Richard-Borek-Stiftung und die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, beide Braunschweig Friedrich-Gerstäcker-Gesellschaft e.V. u. Edition Corsar Braunschweig. Geschäftsstelle Am Uhlenbusch 17 38108 Braunschweig Alle Rechte vorbehalten. © 2020
Оглавление1.
Verschiedene Parteien.
Am 30. Mai des Jahres 1864 war die erste Etage des großen und schönen Hauses in Mexiko, das der General und frühere Präsident Miramon mit seiner jungen Frau bewohnte, festlich erleuchtet, und die geschäftige Dienerschaft noch in voller Arbeit, um die verschiedenen Säle für den Empfang der erwarteten Gäste in Stand zu setzen. Im Spielzimmer wurden die Tische arrangirt und die Lichter angezündet; im großen Saal rückte man das Instrument etwas von der Wand ab, und Alles verrieth, daß der Besuch ein sehr zahlreicher und auch äußerst glänzender sein würde - keine der gewöhnlichen Tertulias1, die in der letzten Zeit fast wöchentlich eine Anzahl von Freunden wie Gesinnungsgenossen in dem gastlichen Haus des jungen Kriegers und Staatsmannes versammelt hatten.
Es war auch in der That eine bewegte und lebendige Zeit in Mexiko - dies Frühjahr von 1864, denn es schien fast, als ob es Frühling im ganzen Lande werden, und Krieg und Blutvergießen, die ihre Schrecken seit langen Jahren über die schöne Erde gegossen, nun doch ein Ende nehmen sollten.
Allerdings standen die Franzosen überall im Land; das Blut, das ihre Waffen vergossen, rauchte noch aller Orten in den Thälern - mexikanisches Blut, den Herzen Derer entströmt, die sich den fremden Usurpatoren keck entgegengeworfen und ihr eigenes Vaterland, den eigenen Herd vertheidigt hatten; /2/ aber daran war man ja in Mexiko gewöhnt. So lange die jetzige Generation lebte, hatte sie cs - mit kurzen Unterbrechungen vielleicht - nie anders gesehen und gekannt, und was deren Eltern erzählten, drehte sich nur ebenfalls um Geschichten von Revolutionen und Pronunciamentos, um Erpressungen und Executionen. Sie wußten es nicht besser, und von der übrigen Welt so ziemlich abgeschlossen, schien es fast, als ob ein anderer staatlicher Zustand gar nicht denkbar sei.
Aehnlich wie jetzt war es freilich schon oft im Land, schlimmer aber noch nie gewesen; denn wie zu Zeiten der Spanier drang ein fremdes Heer herein und benutzte die eine Partei, um mit deren Hülfe die andere zu schlagen und zu unterjochen. Auch war ein Ende dieses Kampfes kaum vorauszusehen, konnte wenigstens noch lange Jahre dauern, und mußte dann Mexiko vollständig ruiniren.
Da plötzlich zeigte sich Rettung, und wie ein schönes, wunderbares Märchen klang es fast, denn drüben, weit drüben über dem Meere, in einem fremden Welttheile, auf hohem, die See überschauendem Felsenschloß, hatte ein Fürstensohn eingewilligt, die Zügel ihres Landes in die Hand zu nehmen, und schon, wie das Gerücht ging, trug ihn die Welle ihrem Ufer entgegen.
Es war eigenthümlich, welchen Eindruck diese Nachricht auf alle Parteien - wenigstens für kurze Zeit - hervorbrachte. Wie das Läuten der Friedensglocken die Streitenden trennt und sie dem Klange horchen, so schienen sich auch hier die Parteien für kurze Frist geeinigt zu haben, um wenigstens erst einmal den neuen Zustand der Dinge anzuschauen.
Das eigentliche Volk sehnte sich übrigens nach Frieden, und wer ihn brachte, war willkommen; jede der anderen Parteien aber hoffte den neuen Fürsten ihrer Seite zu gewinnen, und selbst zahlreiche Führer der Liberalen, die bis dahin noch auf des zurückgetriebenen Juarez Seite gestanden, waren es müde geworden, das schöne Land zu nichts als einem Schlachtfeld zu verwenden, auf dem sie den Boden ewig mit Blut düngten, ohne je ein Saatkorn hinein zu legen oder eine Ernte zu ziehen.
Ob die Führer der Parteien nicht ihre Absichten und /3/ Pläne dabei hatten und allein nach dem Grundsatz handelten, kein Mittel zu scheuen, um nur ihre Zwecke zu erreichen, sollte erst die Zeit enthüllen - jetzt zeigte sich, wenigstens äußerlich, nichts davon, und in der Hauptstadt selber schien Alles nur von dem Wunsch beseelt, die neue Monarchie in Kraft, in's Leben treten zu sehen. - Wie es nachher wurde - wen in dem ganzen weiten Reich hätte das gekümmert? Welcher Einzelne von all' den Hunderttausenden der spanischen Colonisten in ganz Amerika sorgte sich um das nächste Jahr, ja nur um den nächsten Tag, und eine neue Regierung? was hinderte sie, dieselbe wieder abzuschaffen, sobald sie ihnen nicht behagte? es war ja doch weiter nichts als ein Versuch. Daß irgend Jemand so thöricht sein könne, mit vollem und heiligem Ernst an eine solche Sache zu gehen und sein ganzes Leben, seine Ehre, sein Alles dafür einzusetzen, wäre ihnen nicht einmal im Traum eingefallen, selbst wenn sie nur einen Begriff von dem gehabt hätten, welchen Werth das Alles für einen europäischen Prinzen haben mußte.
Nur unter den höheren Klassen des Staates herrschten hier und da noch Zweifel, und Solche besonders, die mit den außermexikanischen Verhältnissen nur ein klein wenig vertraut waren, konnten es sich nicht denken, daß ein österreichischer Prinz, von Frankreich aufgefordert, sein ruhiges Asyl daheim verlassen sollte, um sich einen Palast über dem Krater eines Vulkans zu bauen. Das eigentliche Volk aber hatte keine solchen Bedenken, - es erwartete den versprochenen Kaiser und jubelte ihm schon von vornherein entgegen.
Allerdings stand mitten in der Stadt der alte Palast Iturbide. Das war auch ein Kaiser gewesen, - der Erste, seit Mexiko das spanische Joch abgeschüttelt, und sein Blut hatte den mexikanischen Boden gefärbt, mexikanisches Geschoß sein Herz durchbohrt - aber Niemand dachte daran, zwischen den beiden Kaisern, die ihren Thron inmitten einer Republik aufpflanzen wollten, eine Parallele zu ziehen, wahrend die mexikanische huate volée schon im Vorgenuß all' der Herrlichkeiten schwelgte, die ihr ein Kaiserreich ja im natürlichen Verlauf der Dinge bringen mußte. Waren sie doch gerade die eigentliche und einzige Aristokratie im Lande, ohne welche nun einmal kein /4/ Hof bestehen konnte - und was die politischen Schwierigkeiten betraf, ei! das blieb Sache des Kaisers wie seiner Räthe, und sie dachten nicht daran, sich darüber den Kopf zu zerbrechen.
General Miguel Miramon stand, wenn auch in vollständiger Toilette, sich aber um die Vorbereitungen in seinem Hause wenig kümmernd, und nur aufmerksam eine vor ihm ausgebreitete Karte von Mexiko betrachtend, in seinem Zimmer.
Er war von jeher eine der Hauptstützen der klerikalen Partei gewesen, und gerade diese hatte die Berufung des Kaisers am stärksten und unermüdlichsten betrieben, weil sie besonders auf einen österreichischen Prinzen ihre größte Hoffnung setzte. War nicht von dem Republikaner und Indianer Juarez2 die Kirche, und damit, ihrer Meinung nach, die ganze Religion unter die Füße getreten worden? Hatte er nicht die Kirchengüter confiscirt, ja sogar den Priestern verboten, in ihrem Ornat auf der Straße zu erscheinen? Durfte denn selbst unter seiner Regierung nur noch eine Procession die Stadt durchziehen, oder das Allerheiligste offen und frei einhergetragen werden? Das Letztere hatten nun allerdings die Franzosen schon wieder beseitigt, seit sie Juarez nach Norden hinausgejagt und unschädlich gemacht, aber die Liegenschaften der Kirche befanden sich noch immer in den Händen von Laien, die Gewalt selber hatten sie noch nicht zurückgewinnen können, und dazu sollte und mußte ihnen jetzt Maximilian helfen. Er mußte, denn nur durch sie war er auf den Thron berufen - nur durch sie konnte er sich, wie sie glaubten, halten.
Miramon dachte aber jetzt nicht an die Interessen der Geistlichkeit, wenn sie auch mit den seinigen vielleicht Hand in Hand gingen. Die Linke auf den Tisch gestützt, mit dem Zeigefinger der Rechten den Punkt bezeichnend, wohin die Franzosen seinen alten Feind und politischen Nebenbuhler Juarez getrieben, und wo er in dieser Zeit nur noch einen Rang wahrte, dem schon keine Macht mehr zur Seite stand, schweiften seine Gedanken dort hinauf und suchten die Möglichkeit eines entscheidenden Sieges zu erfassen. Und sollte Juarez /5/ noch einmal versuchen, von dort heraus zu brechen? Es war nicht denkbar - wenigstens jetzt nicht, wo das Land von französischen Soldaten schwärmte, und neue Kriegsschiffe mit dem Kaiser jeden Tag erwartet wurden. Selbst die schwankenden Mexikaner hätten sich dem Flüchtigen in dieser Zeit nicht wieder angeschlossen, und war da jetzt nicht vielleicht der Augenblick gekommen, wo man ihn, den gefährlichsten Gegner, von seinem nördlichen Fluchtweg abschneiden und völlig unschädlich machen konnte? Stand aber Juarez nicht mehr im Weg - ein leises, kaum merkbares Lächeln legte sich um die feingeschnittenen Lippen des jungen Mannes, und er hob sich hoch empor und schüttelte die vollen schwarzen Locken aus der Stirn. Da hörte er einen leichten Schritt in seinem Zimmer oder vielmehr das Rauschen von Gewändern, und sich rasch danach wendend, bemerkte er seine im vollen Glanz des Abends strahlende Gattin in der Thür.
Es war ein selten schönes Paar, wie sie Beide da einander gegenüberstanden, in voller Jugend, von Licht und Glanz und Glück umgeben, mit allen Gütern der Erde gesegnet, und ihrer bevorzugten Stellung im Leben sich dabei vollbewußt. Er, wie sie, hoch und schlank gewachsen, sein männlich intelligentes Gesicht von einem vollen Schnurr- und starken Knebelbart geziert, mit offenem Auge und einer hohen Stirn, mit kühn geschittenen Brauen, wobei selbst das nicht störte, daß die linke um ein wenig höher auflief als die rechte. - Sie dagegen mit jedem Zauber holder Weiblichkeit übergossen, und dennoch stolz und hoch wie eine Königin mit ihrem weiten wallenden Gewände, den blendend weißen Hals wie das raben-schwarze Haar von Edelsteinen geschmückt, und deren blitzender Glanz trotzdem von den wahrhaft zauberischen Augen des schönen Weibes übertroffen.
„Und willst Du nicht herüberkommen, Miguel?" sagte sie jetzt mit leiser wohlklingender Stimme - „oder" - setzte sie rascher und besorgt hinzu, „hast Du etwa neue und schlimme Nachrichten erhalten, daß Du wieder über Deinen Karten brütest? Ist etwas vorgefallen? Verheimliche es mir nicht."
„Nein, mein Kind," sagte ihr Gatte, indem er lächelnd mit dem Kopf schüttelte, und sein Auge mit Stolz und Freude /6/ auf ihr ruhte, „nichts wenigstens, was uns auch nur die geringste Besorgniß einflößen könnte."
„Und doch," erwiderte sie ernst, „dächte ich, hätten wir Grund genug dazu, denn Alles jubelt jetzt dem Kaiserreich entgegen."
„Und kennst Du unsere liebenswürdigen Landsleute nicht?" lächelte Miramon; „sie sind entzückt über jedes Neue, das sich ihnen bietet, und jetzt nun gar der Glanz eines neuen Hofes, der ihnen zwei Wünsche auf einmal befriedigt: zuerst die Festlichkeiten beim Einzug der Majestäten, und danach die erhoffte Befreiung von den Franzosen, die allerdings anfangen ein wenig unverschämt aufzutreten."
„Und gerade das beruhigt Dich?"
„Gewiß, wenn der Kaiser überhaupt kommt."
„So zweifelst Du noch daran?"
„Liebes Kind," sagte achselzuckend Miramon, „wenn das, was wir hier, allerdings noch unvollständig, von den Vorschlägen wissen, die Napoleon dem österreichischen Prinzen gemacht hat, und wonach dieser übernommen haben sollte die Kosten der französischen Besetzung zu tragen, so müßte er sich, um dies zu ermöglichen, auch einen ganz ungewöhnlichen Finanzmann oder eine sehr große Cassa mitbringen. Ich wenigstens hätte mich auf Derartiges nie im Leben eingelassen, und wie mir scheint, ist auch Maximilian stutzig geworden. Doch wir werden ja sehen, und wie sich Alles nachher gestaltet – quien sabe?“3
„Er kommt, darauf kannst Du Dich verlassen," sagte die junge Frau mit blitzenden Augen, „es ist nicht leicht, eine Kaiserkrone auszuschlagen."
„Und doch wohl leichter, als sie zu hehanpten."
„Das kommt auf den Mann an, der sie irägt," rief das schöne Weib, und ihr Auge suchte stolz den Blick des Gatten.
„Unser Volk hat diese blutigen Revolutionen satt, und wenn er die Sache ein klein wenig klug anfinge, - aber es ist eine Schmach für Mexiko, solcher Art einen Fremden in das Land zu rufen. Haben wir denn nicht selber Männer, die werth und würdig wären, an die Spitze des Volkes zu treten?"
Miramon schüttelte mit dem Kopf. „Und was hülfe es?" sagte er, „die letzten Jahrzehnte haben bewiesen, daß nur eine Revolution der andern folgte. Nein, ich selber stimmte mit für den fremden Kaiser, denn unser sehr souveränes Volk muß erst einmal durch Schaden klug werden. Nachher arrangirt sich vielleicht Alles viel leichter, als wir jetzt selber glauben."
„Souveränes Volk," sagte die junge Frau verächtlich, und ihre dunkeln Brauen zogen sich zusammen - „eine teigähnliche Masse ist es, die eine geschickte Hand in jede nur beliebige Form kneten kann." -
„Zu viel Hefe drin, Schatz," lachte Miramon, „zu viel Hefe drin, wenn wir das Bild denn einmal beibehalten wollen. Es wirft Blasen nach allen Seiten und zerstört sich selber. Aber ich glaube wahrhaftig, unsere Gäste kommen. Laß die Politik, Querida, oder - überlaß sie mir. Sie gehört nicht für das Haus - und besonders nicht für die jetzige Zeit. Wer auch etwas thun wollte, könnte es nicht und muß ruhig abwarten, wie sich Alles stellt: wir sowohl hier in der Hauptstadt, im augenblicklichen Sonnenschein des Sieges, wie der alte Panther da oben im Norden, der mit einer nicht zu gering anzuschlagenden Elasticität vor unseren Waffen zurückweicht, ohne ihnen mehr als aus dem Wege zu gehen. Pacienca, amiga - unsere Zeit kommt vielleicht auch wieder, und bis dahin wollen wir der Welt dieselbe freundliche Stirn zeigen, die sie bis jetzt gewohnt gewesen ist an uns zu sehen. - Ich glaube, ich höre schon Gäste auf der Treppe."
Miramon hatte sich nicht geirrt - die Gäste trafen allerdings ein und wenn auch anfangs noch vereinzelt, fuhr doch bald Wagen nach Wagen vor, so daß es rasch in den luftigen Räumen von geputzten Herren und Damen wogte. Und welchen Glanz der Toilette entfalteten die letzteren! Aber auch die Herren prangten im höchsten Staat, sowohl die im /8/ Civil mit Orden geschmückt, wie das Militär in reichgestickten mexikanischen wie französischen Uniformen. Ja selbst die hohe Geistlichkeit fehlte nicht und stach mit ihrer bunten, fast weibischen Tracht nur wenig von den Damen selber ab.
Das summte und wogte durcheinander, ein wunderlich blitzendes und lebendiges Bild voller Lust und Leben, und wer hier einen Blick in den Saal geworfen, hätte wahrlich nicht geglaubt, daß ein, kaum zu einem Abschnitt gelangter und nichts weniger als beendeter Bürgerkrieg das Land zerreiße, und selbst die Existenz dieser von Pracht und Glanz strahlenden Gestalten bedrohe.
In der That waren aber an dem Abend und in den Sälen Miramon's fast alle die Großen und Größen des neu zu schaffenden Reiches versammelt. Dort der kleine und magere, aber sehr lebendige Mann, mit vollem Bart, aber kurz geschnittenem Haar, mit kleinen wässerigen, aber doch stechenden Augen, in einer mit Goldstickerei fast bedeckten Uniform, der auf einen Stock gestützt durch den Saal hinkte, ist Leandro Marquez. Er war ein schon damals bekannter Bandenführer und ein treuer Kampfgenosse Miramon's - treu wenigstens und aufrichtig in seinem Haß gegen den von Beiden gleich stark verachteten Indianer Juarez - ein strenger Anhänger der Kirchenpartei, aber auch zugleich seiner schamlosen Grausamkeit wegen berüchtigt.
Neben ihm der Hochwürdenträger der Kirche, mit der Dame des Hauses im eifrigen Gespräch, jener Mann mit dem klugen Gesicht und dem stolzen Blick, dem nur das breite Kinn und der etwas große Mund etwas Sinnliches gab, während seine kräftigen Glieder die weibische Spitzentracht seines Standes umhüllte, war Labastida, der Erzbischof von Mexiko.
Dort drüben, sich eifrig und lebendig mit ein paar französischen Officieren unterhaltend, lehnte ein großer stattlicher Mann, ebenfalls in reichgestickter Uniform, an der das Officierskreuz der französischen Ehrenlegion glänzte. Er sah mit seinem dunkelblonden, etwas dünnen Haar, und starken, ebenfalls blonden Knebel- und Schnurrbart fast nicht aus wie ein Mexikaner, und doch war es Oberst Miguel Lopez, der sich /9/ in manchem heißen Gefecht schon wacker hervorgethan, und auf besonders freundlichem Fuße mit der französischen Occupationsarmee stand.
Da plötzlich theilten sich die Gruppen, als der vortretende Diener den Namen des Generals Bazaine nannte - Bazaine, in diesem Augenblick der Alleinherrscher von Mexiko, der Repräsentant des mächtigen Kaisers der Franzosen; und Alles gab ihm Raum und bildete ein Spalier, durch das der General, leicht grüßend, hindurchschritt, um vor Allem die Dame des Hauses aufzusuchen.
Der General glänzte und blitzte allerdings in dem Schmuck seiner Uniform und all' der Auszeichnungen, mit denen Napoleon seine Brust bedeckt, aber der Ausdruck seiner Züge war kalt, ja fast hart, und nicht wie ein Soldat, nein, fast wie selber ein Fürst durchschritt er den Saal, die ihm schuldigen Huldigungen entgegennehmend.
Bazaine war in der That in Mexiko weit mehr gefürchtet als geliebt, denn wenn ihn auch die Partei herbeigesehnt, ja selber mit allen Kräften theils offen, theils heimlich unterstützt haben mochte, so kannte und haßte man in ihm doch den Fremden, der hier überhaupt viel mehr Macht gewonnen oder sich angemaßt, als man je für möglich gehalten oder vorausgesehen hatte. Bazaine spielte gewissermaßen hier den Teufel, den der Zauberlehrling gerufen und nun nicht wieder bannen konnte. Und trotzdem brauchte man ihn, denn Juarez war weder todt, noch wirklich außer Landes getrieben, und die Mexikaner, während sich ihr Stolz gegen den Druck sträubte, fühlten doch, daß sie ihn noch nicht entbehren konnten. So erhofften sie denn allein durch ein selbstständiges Kaiserthum, in dem aber nur Jeder seine eigenen Wünsche verwirklicht sah, einen doppelten Schutz; einestheils gegen das Schreckbild der Liberalen, und andererseits selbst gegen den Mann, der ihnen für jetzt doch wenigstens diese in weiter Ferne hielt.
In Miramon's Haus waren heute fast alle Repräsentanten jener beiden mächtigen Parteien vertreten, die den Liberalen entgegenstanden und deshalb vereint einen Kaiser herbeigerufen, wenn sie auch beide sehr verschiedene Interessen verfolgten: die Aristokratie oder, besser gesagt, die /10/ Conservativen, und die Geistlichkeit. Viele der Aristokratie gehörten aber auch der letzteren an, während es die Conservativen, obgleich sie die Herrschaft der Liberalen nicht dulden wollten, doch nicht ungern gesehen hätten, daß Juarez, der rücksichtslose indianische Advocat, die Macht der stets intriguirenden Priester gebrochen. Natürlich erwarteten sie aber auch von einem Kaiserreich, daß die Gewalt in ihren Händen bleibe, denn ihrer ganzen gesellschaftlichen Stellung und ihrem Reichthum nach gebührte sie ihnen. Daß sich der Kaiser den Liberalen zuwenden könne, ließ sich natürlich nicht denken.
Die Geistlichkeit dagegen glaubte vollständig sicher zu sein, daß der neue Kaiser, der Prinz eines streng katholischen Reiches, das selber eins der für die Kirche günstigsten Concordate mit Rom abgeschlossen, auch hier den Gewaltmaßregeln gegen die Religion und ihre Priester entschieden entgegentreten würde. Er mußte deshalb dem Zustand, den die Franzosen allerdings nicht geschaffen, aber doch geduldet, ein Ende machen, er mußte mit ihnen gehen, und das konnte nur durch den Widerruf jenes Decrets geschehen, das der Kirche ihre Güter nahm und in profane Hände übertrug - es war das ja doch überhaupt Gotteslästerung.
Miramon, früher selber einmal Präsident des Staates, gehörte seiner Stellung nach allerdings den Conservativen an, stand aber im Herzen doch auf Seiten der Geistlichkeit - im Herzen? - vielleicht glaubte er auch seine eigenen Interessen am besten bei denselben vertreten, denn er kannte sein Vaterland zu gut, um nicht zu wissen, daß es nur zwei Wege gab, um darüber zu herrschen: entweder mit den Liberalen - d. h. mit dem Volke - oder mit der Geistlichkeit. - Ein Bündniß mit den ersteren widerstrebte aber seiner aristokratischen Natur, und es blieb ihm deshalb nichts übrig, als es - vorläufig wenigstens - mit den Priestern zu halten.
Spaltungen herrschten übrigens unter allen Parteien, und wie die Liberalen den Conservativen und der Geistlichkeit entgegenstanden, und die beiden letzteren nur auf eine Gelegenheit warteten, um einander wieder in die Haare zu gerathen, so waren sich der französische General Bazaine und der Erzbischof Labastida eben so feindlich gesinnt. Bazaine hatte /11/ allerdings manche von Juarez gegebene und für die Geistlichkeit drückende Gesetze aufgehoben; so unter anderen das Verbot, daß die Geistlichkeit nicht in ihrem Ornat auf der Straße erscheinen dürfe, wie er ebenso die öffentlichen Processionen wieder gestattete; aber trotzdem sah er sich doch nicht im Stande, Alles zu thun, was man von ihm, als Vertreter des „allerchristlichsten" Kaisers, verlangte. Er konnte und wollte nämlich den Verkauf der Kirchengüter, von denen sich die meisten schon in fremden Händen befanden, nicht wieder rückgängig machen; und als sich Labastida, der Erzbischof, in dem Gefühl seiner Unfehl- und Unantastbarkeit so weit vergaß, die französischen Soldaten einiger Uebergriffe wegen zu excommuniciren, zeigte ihm General Bazaine bald, wer eigentlich Herr im Lande sei. Er befand sich allerdings gerade im Norden des Reiches, um die Armee der noch bestehenden Liberalen aufzureiben und zu vernichten, kehrte aber augenblicklich nach der Hauptstadt zurück und zwang dort ohne Weiteres den rebellischen Erzbischof, den eben noch von ihm excommunicirten französischen Soldaten eigenhändig und auf offenem Platze vor der Kathedrale den verweigerten Segen zu ertheilen.
Welchen Grimm der Geistliche dafür im Herzen gegen den allmächtigen General trug, läßt sich denken, aber was schadet das in einer großen Gesellschaft unter gebildeten Leuten! Als sich Labastida umwandte, um mit anderen Freunden zu verkehren, traf es sich, daß ihn Bazaine gerade passiren wollte. Beide Herren konnten einander nicht mehr ausweichen, ohne auffällig zu werden, und daran war allen beiden in der jetzigen Zeit, wo man einer Entscheidung fast täglich entgegensah, nichts gelegen. Außerdem durfte selbst Bazaine dem Erzbischof nicht schroff entgegentreten, denn der schlaue Priester hatte sich an die rechte Quelle gewandt. Die Kaiserin Eugenie - die Beschützerin aller Pfaffen - war auch die seine geworden, und die letzten Briefe, die der General aus Paris erhielt, versäumten nicht, ihm die höchste Rücksicht für das „Haupt der Kirche in Meriko" aufzuerlegen.
Und Labastida? Es gab vielleicht keinen Menschen auf der Welt - den Indianer Juarez ausgenommen - den der Erzbischof aufrichtiger und ehrlicher haßte, als den französischen /12/
General Bazaine, aber Niemand würde in diesem Augenblick auch nur die Spur eines solchen Gefühls in seinen Zügen gelesen haben. Mit einem freundlich milden Lächeln wandte er sich gegen den Franzosen, und ihm die Hand zustreckend, sagte er:
„Nun, General, keine Neuigkeiten von unserem Freunde in Monterey oder da oben irgendwo im Norden?"
„Von Juarez?" lachte der General, die gebotene Hand nehmend, „es wird lange dauern, ehe wir von ihm wieder etwas erfahren, denn wir haben ihn das letzte Mal gründlich auf den Trab gebracht. Ich glaube kaum, daß seine jetzige Armee viel stärker ist, als unsere Gesellschaft heut Abend."
„Unser Freund Miramon hat Geschmack," nickte der Erzbischof, „aber was ich Sie fragen wollte, ist keine Depesche von Vera-Cruz eingetroffen?"
„Von Vera-Cruz? nein, außer daß vor wenigen Tagen ein heftiger Norder dort geweht und einige unserer Schiffe gefährdet hat."
„Also vom „Kaiser" noch keine Nachricht?"
„Kein Wort; aber ich glaube, daß wir ihn jeden Tag erwarten dürfen."
Der Erzbischof neigte sein Haupt, bis sein Kinn die Brust berührte, und schritt dann zu der andern Seite des Saales hinüber, wo er Miramon selber mit General Marquez und einem der höheren Geistlichen im Gespräch bemerkte.
Marquez war einer der erbittertsten Gegner der Liberalen, aber weniger des Systems, als der gerade am Ruder befindlichen Personen. Selber nur aus einer unbemittelten und niedrigen Familie entsprossen, hatte er sich, mehr durch sein rücksichtsloses Vorgehen auf ein bestimmtes Ziel, als durch besondere Bildung oder andere Fähigkeiten, einen Namen in der mexikanischen Geschichte gemacht. Welche Mittel er dabei gebrauchte, um seinen Zweck zu erreichen, war ihm völlig gleich, und er begrüßte deshalb den Einmarsch der Franzosen, die ihm halfen, den Indianer Juarez aus dem Felde zu schlagen, mit derselben Freude und Bereitwilligkeit, wie er /13/ sich den Nordamerikanern oder irgend einem andern Volksstamme zur Unterdrückung des Landes würde angeboten haben, sobald er dadurch für sich selber etwas zu erreichen hoffte. Vaterland? den Begriff kannte er nicht, und in seiner eigenen Heimath war er der gefürchtetste der Bandenführer. Ja die Mexikaner hatten damals, als Forey4 gegen die Hauptstadt anrückte, und Marquez ihm mit seinen Schwärmen vorauseilen wollte - selber den französischen Befehlshaber gebeten, die Hauptstadt zuerst von Franzosen besetzen zu lassen. Es waren das allerdings nur Fremde, aber die Bewohner von Mexiko wollten sich doch lieber diesen, als ihrem eigenen Landsmann Marquez anvertrauen.
Uebrigens gehörte er, ebenso wie Miramon, der Partei der Geistlichkeit an, war aber trotzdem bis jetzt den Franzosen eine treue Stütze gewesen und hatte sich auch bei vielen Angriffen so tollkühn der Gefahr ausgesetzt, daß er für einen der tapfersten, wie auch begabtesten Generale galt, - so weit sich eben das Wort Begabung auf diese Kriege anwenden ließ. Sein großer Vorzug bestand darin, daß er eine außerordentliche Terrainkenntniß besaß und sie richtig anzuwenden wußte. Man wollte auch in Mexiko behaupten, daß er früher Arriero oder Maulthiertreiber gewesen sei, wodurch er dann allerdings jeden Paß und Weg, jeden Fluß und Ucbergang genau kennen mußte. In einem Lande wie Mexiko aber war Terrainkenntniß die wichtigste und nothwendigste Eigenschaft eines Führers, und wenn dieser dann noch außerdem Muth genug besaß, um unerschrocken voranzugehen, so konnte er seines Erfolges so ziemlich sicher sein.
Mehr und mehr füllten sich die Säle, und besonders trafen noch viele Herren der hohen Geistlichkeit ein, von denen Miramon keinen übersprungen hatte. Oberst Mendez, ein anderer sehr tapferer mexikanischer Officier, der sich aber weit weniger zur geistlichen Partei hielt als Miramon und Marquez, erschien ebenfalls, wenn auch etwas später als die Uebrigen, da er erst an diesem Tag von einer Recognoscirungstour aus dem Westen zurückgekehrt war.
Mendez trug aber eben so wenig wie Lopez den mexikanischen Typus, und aus den ersten Blick hätte ihn wohl /14/ Jeder für einen etwas sehr dunkelhäutigcn Franzosen, oder auch vielleicht für einen Deutschen gehalten. Mit einem ziemlich runden Gesicht, mit braunem, nicht schwarzem Haar und einem Knebel- und Schnurrbart, verrieth nur die dunklere Färbung seines Gesichts indianische Abkunft, und er hatte außerdem etwas entschieden Soldatisches in seinem ganzen Wesen. Er mochte übrigens, wie schon vorerwähnt, von der Priesterwirthschaft nicht viel wissen, und stand deshalb auch nur wenig in Miramon's Gunst, aber er war ein wackerer Haudegen und haßte die Liberalen aus vollem Herzen - was Wunder denn, daß er sich den Franzosen, die er bald als tapfere Soldaten kennen lernte, mit voller Seele in die Arme warf. Wie die meisten seiner Landsleute jubelte er den Fremden entgegen, weil diese ihnen halfen, Rache an ihren persönlichen Feinden zu nehmen, und dachte nicht an eine kommende Zeit und wie es werden sollte, wenn diese einmal den Lohn für ihre Dienste verlangten. - Außerdem war er auch nur Soldat - die Politik mochte die Regierung besorgen und verantworten, und so lange er nur den Feind vor sich Hertreiben konnte, lag ihm das Andere wenig genug am Herzen.
Miramon, der den Erzbischof auf das Ehrerbietigste begrüßt und einige Worte mit ihm gewechselt hatte, wurde jetzt durch seine Eigenschaft als Wirth in Anspruch genommen. Viele der älteren Herren besuchten diese Tertulias nur, um ihre Partie dabei zu machen, und betrachteten jeden Augenblick, der ihnen daran gekürzt wurde, als unwiederbringlich verloren. Es blieb deshalb Sache des Wirths, sie in dem Arrangement zu unterstützen.
Eine kleine Gruppe mexikanischer wie französischer Officiere war eben im Begriff gewesen, in eins der Vorzimmer zu treten, wo auf der Credenz spirituöse Getränke, wie Cognac und Xeres, als auch Wasser und Zucker zum allseitigen Gebrauche stand, als sie den Erzbischof auf sich zuschreiten sahen und ihre Stärkung noch verschieben mußten, denn Monseňor konnten sie doch nicht gut mit dazu einladen.
Der Erzbischof befand sich in diesem Augenblick in einer ganz eigenthümlichen und nicht gerade angenehmen Stellung /15/ in Mexiko, denn selbst aus dem bisher regierenden Regentschaftsrathe, den er mit Bazaine und Minister Salas bildete, war er gewissermaßen ausgestoßen worden - er wurde wenigstens nicht mehr zu den Berathungen gezogen, und in Folge einer Malice Bazaine's gegen ihn auch der Ehrenposten von seiner Thür entfernt. Freundlich gestimmt konnte er deshalb nicht gegen die jetzigen Verhältnisse sein, und war es auch wahrlich nicht, aber der Gesellschaft zeigte er trotzdem ein glattes Angesicht.
Mit seinem Blick überflog er die Gruppe, und wohl sah er da manche „Gutgesinnte" - d. h. der Kirche vollkommen Angehörige - aber doch noch sehr viele „Zweifelhafte", ja Manche sogar, die er zu seinen entschiedenen Gegnern zählen durfte. Doch was that das? Das Oberhaupt der Kirche war es gewohnt, schwierige und oft sogar gefährliche Curven zu wandeln, und als sein Blick Obrist Lopez unter den Uebrigen erkannte, wandte er sich mit der ihm eigenen Leutseligkeit an diesen.
„Nun, lieber Obrist - guten Abend, meine Herren - ich habe Sie ja noch gar nicht wiedergesehen, seit Sie von Ihrem letzten wilden Zug zurückgekehrt sind. - Wie geht es Ihnen?"
„Diesmal war ich nicht so weit, Monseňor," lächelte Lopez, indem er sich aber doch zur Begrüßung straff und soldatisch emporrichtete. „Seit wir das Raubgesindel hier aus der Nachbarschaft trieben, hatte ich schon wieder die Ehre, in einer Soirée des Herrn Ministers Salas mit Ihnen zusammen zu treffen."
„Ach ja - ach ja - in der That! war mir wirklich entfallen; aber Sie dürfen mir deshalb nicht zürnen, Herr Obrist. Wir leben in einer ernsten Zeit, und unsere Gedanken werden unwillkürlich und immer nur unserer augenblicklichen precären Lage zugelenkt."
Lopez war zerstreut, denn an der Schulter des vor ihm stehenden Geistlichen vorbei erblickte er eine nicht in den Salon gehörende Gestalt, die er selber aber nur zu gut kannte. Es war anscheinend ein ganz gewöhnlicher Mexikaner aus den unteren Ständen, der sogar seine Zarape nach der Landessitte /16/ so umgeschlagen trug, daß sie ihm den untern Theil des Gesichts verdeckte. In der Hand aber hielt er ein zusammengefaltetes Papier, und augenscheinlich suchte er irgend Jemand im Saal.
Wie kam der Bursche hier in diese Räume, wie durch die Dienerschaft, und was wollte er? - suchte er ihn?
Der Erzbischof, dem Lopez' zerstreuter Blick nicht entging, wandte sich der Richtung zu, die dieser suchte, und war nicht minder erstaunt, den Peon5 in seiner Straßentracht, und wie er eben von der Straße kam, im Salon zu sehen. Aber dieser schien auch schon den, welchen er suchte, gefunden zu haben, und zwar General Miramon, der nicht weit vom Erzbischof an dem einen offenen Fenster stand. Auf diesen zugleitend, überreichte er ihm das Papier, das jedenfalls zu solcher Zeit, von einem solchen Boten gebracht, etwas Wichtiges enthalten mußte. Sobald er es aber übergeben, und, ohne eine Antwort abzuwarten, warf er den Blick zurück, als ob er nicht gleich wisse, nach welcher Richtung er sich wenden solle. Die hatte er jedoch bald gefunden, und jetzt, dicht an Lopez vorbeigleitend, flüsterte er ihm nur das Wort zu: „der Kaiser", und eilte jetzt, durch die ihm erstaunt Raum gebenden Gäste, aus dem Saal. Allerdings wollten ihn, schon an der Thür, die Diener noch zur Rede stellen, aber er ließ sich mit ihnen gar nicht ein, sprang die Stufen hinab und war im nächsten Augenblick in der dunkeln Straße verschwunden.
Die Aufmerksamkeit der Gäste wurde indessen schon im nächsten Moment von einem andern Gegenstand vollkommen abgelenkt, denn Miramon, der nur einen flüchtigen Blick auf das Blatt geworfen, trat rasch in die Mitte des Salons. Etwas Außerordentliches mußte geschehen sein - man sah, er wollte sprechen, und Alles drängte sich ihm zu.
„Meine Herren!" rief der Wirth des Hauses, das Blatt emporhebend, „soeben erhalte ich die Kunde, daß Seine Majestät der Kaiser Maximilian in Vera-Cruz gelandet ist."
„Der Kaiser! Der Kaiser!" - wie das Wort durch die /17/ ! Versammlung rauschte und wogte. „Also doch," flüsterte es fast unbewußt von vielen Lippen, denn trotz Allem hatten noch Viele an der Verwirklichung ihrer Hoffnungen gezweifelt, und es - wenn auch vielleicht unausgesprochen - für unmöglich gehalten, daß irgend Jemand seine Heimath, Ruhe und Sicherheit verlassen könne, um die Zügel eines so verwilderten und bis in seine untersten Schichten hinab zerrütteten Volkes in die Hand zu nehmen.
Und was nun? blieben die Franzosen noch länger in Mexiko, wenn der Kaiser die Regierung antrat, oder zogen sie ab? und was wurde dann in beiden Fällen?
Eigenthümlich war es, zu beobachten, wie die Thatsache, die Allen eine totale Umwälzung ihrer ganzen bisherigen Verhältnisse vor Augen stellte, für einen Moment fast lähmend auf die eben noch so geräuschvolle Gesellschaft wirkte. Kein Wunder auch; es blieb ein Jeder mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt und jeder Einzelne auch bei der ganzen Wendung der Dinge bald mehr, bald weniger betheiligt - betheiligt aber in jedem Fall. - Und was für Hoffnungen knüpften sich an die sie erwartende neue Welt!
Sie hatten wohl schon ein Kaiserthum in Mexiko gehabt: der unglückliche Iturbide lag mit zerschossener Brust unter mexikanischem Rasen - das aber war doch etwas Anderes gewesen, kein wirklicher Fürst, sondern nur ein Mann, der lange in ihrer Mitte gelebt, ein einfacher General und nachher ein Kaiser mehr dem Namen nach, und nicht viel mehr als eben ein erblicher Präsident. Er kam und ging auch so rasch, daß man kaum recht darüber zur Besinnung gelangte, und nachher jagten zahllose Regierungen immer eine die andere, und brachten nur Blut und Verderben über das ganze Land.
Und das sollte jetzt Alles anders werden? - eine feste Regierung bestehen, ein Kaiser eintreten, der, wenn er im Lauf der Jahre starb, ohne Revolution seinem Erben den Thron überließ, oder einen Andern für sich einsetzte? - Der Zustand war zu neu, zu unfaßbar, als daß sie sich da gleich hätten hineindenken können, und doch trat er in diesem Augenblick in's Leben. /18/
„Seine Majestät der Kaiser ist in Vera-Cruz gelandet." Die Worte lauteten so kurz und überzeugend, daß ein Zweifel daran unmöglich wurde. Außerdem hatte ja Miramon selber die Kunde erhalten, und der Bursche, der das Schreiben gebracht, war jedenfalls der Correo gewesen.
Bazaine allein schien die Ankunft des neuen Monarchen in dem nicht angenehmen Gefühl zu vergessen, daß General Miramon - ein Mexikaner, und nicht er die erste Botschaft erhalten. Aber von wem war sie ausgegangen, und wie war es möglich, daß man in Vera-Cruz versäumt haben sollte, ihm gerade zuerst das Wichtigste zu melden, was in diesem Augenblick das Land betreffen konnte.
Mit dem Erzbischof zusammen, der sich ebenfalls der Gruppe anschloß, trat er zu Miramon, um den Zettel mit eigenen Augen zu sehen, aber derselbe enthielt nur die wenigen Worte:
„Soeben läuft die Fregatte ein, die den Kaiser Maximilian an Bord hat." Es war nur ein Stück weißes Papier ohne Adresse, aber zusammengefaltet und rein, als ob es eben aus einem Couvert genommen wäre. Es enthielt auch keine weitere Bemerkung; nur unten noch die Zahl 28, die möglicher Weise das Datum andeuten konnte - aber wie kurze Zeit hatte dann freilich der Courier gebraucht, um hier herauf zu kommen!
„Und ist Ihnen das Papier so übergeben worden, General?" frug Bazaine, der es kopfschüttelnd in der Hand herumdrehte.
„Wie es da ist," sagte Miramon, „ich begreife es nicht recht - am Ende ein höchst ungeschickter Scherz, den sich Jemand mit uns erlaubt hat. Wir hatten den Boten nicht so rasch wieder fortlassen sollen."
„Kannten Sie ihn?" frug Labastida - Miramon verneinte es, Bazaine aber sagte:
„Mir kam er bekannt vor; ich habe das Gesicht jedenfalls schon gesehen."
„Ich kann mich nicht erinnern," meine Miramon, „und begreife außerdem nicht, daß man ihn so ohne Weiteres hereingelassen."
Ein weiteres Gespräch wurde unmöglich, denn von allen /19/ Seiten drängten jetzt die Damen herzu, die sich natürlich nicht mit der einfachen Nachricht begnügen, sondern Näheres erfahren wollten. Miramon aber kannte den Zauber, mit dem er im Stande war dies unruhige, wenn auch sehr hübsche Völkchen zu bannen. Selbstverständlich hatte er ein Musikcorps engagirt, denn ohne Tanz gehen die jungen Damen an solchen Abenden nie nach Hause; die Musici mußten deshalb ihre Plätze einnehmen, und wie, inmitten der allgemeinen Aufregung, die nicht unmelodischen Töne der mexikanischen National-Hymne ertönten, regte sich kein Laut mehr, und eine wirklich feierliche Stimmung erfaßte Alle. War es doch auch ein feierlicher Moment: der erste Schritt zu einem neuen Leben, vielleicht zu Glück und Frieden in dem schwergeprüften Lande – aber diese Stimmung dauerte nicht lange. Wie nur die Hymne verklungen und die Musiker, nach kurzer Pause, eine muntere Habanera begannen, verschwand im Nu der ernste Ton. Das junge Volk hatte Musik gehört, und das ganze neue Kaiserreich
erweckte ja für dieses Alter nur Bilder von Glanz und Lust, wie von sich aneinander reihenden Festlichkeiten. Was wußte es von dem Land selber und von dem darauf lastenden Jammer! bald schwatzte und lachte und flüsterte und kicherte es wieder untereinander in vollem Jubel, und heller blitzten und funkelten selbst nicht die Brillanten am Nacken und in den Ohren ihrer schönen Trägerinnen, als die Augen der wunderhübschen Mädchenschaar.
Und hatten die jungen Damen in Mexiko nicht auch alle Ursache, mit dem neuen Stand der Dinge zufrieden zu sein? Stellte ihnen nicht Frankreich, außer ihren gewöhnlichen und eingeborenen Anbetern und Tänzern, schon allein ein ganzes Officiercorps zur Disposition, während der neue Kaiser doch jetzt auch jedenfalls eine weitere Sammlung von jungen deutschen Officieren mit herüberbrachte? Und außerdem all' die bevorstehenden Festlichkeiten und Bälle - es war kein Wunder, daß sich eine fast übermüthige Laune ihrer bemächtigte und auf die übrige Gesellschaft ansteckend wirken mußte. Man erinnerte sich nicht, je einen vergnügteren Abend in Mexiko verlebt zu haben. /20/
Diese Heiterkeit erstreckte sich freilich nicht auf Alle, denn zu ernst trat das Leben in diesem neuen Abschnitt an Manche heran. Miramon selber hatte eine lange Unterredung mit dem Erzbischof Labastida, und selbst die älteren französischen und mexikanischen Officiere verhandelten eben so eifrig und die Gesellschaft gar nicht mehr beachtend mit Bazaine, denn wie plötzlich war das Alles gekommen!
Wohl mußten Alle auf den jetzt eingetretenen Fall schon vollkommen vorbereitet sein, und trotzdem waren doch so wenig wirkliche Vorbereitungen getroffen und noch von so Vielen die thatsächliche Annahme und Ankunft des Kaisers bezweifelt worden, so daß Maximilian jetzt fast wie ein unerwarteter Gast in seinem eigenen Reiche erschien. Alles das mußte nun in einem Zeitraum nachgeholt werden, der kaum so viel Tage dazu gestattete, als man sonst und unter gewöhnlichen Umständen Monate gebraucht haben würde.
Miramon und Labastida besprachen freilich andere Dinge, denn der Erzbischof sah in seinem jungen, der höchsten Aristokratie des Landes angehörenden Freunde seine festeste Stütze. Jetzt aber war die Zeit gekommen, wo die Wahl eines neuen Ministeriums die Richtung bezeichnen mußte, die das neue Kaiserreich zu nehmen gedachte - und konnte es eine andere als solche treffen, die ihm von den Conservativen wie der Geistlichkeit vorgezeichnet wurde? - Es schien nicht denkbar. Diese gerade hatten den Kaiser berufen und all' ihren Einfluß aufgeboten, um das Volk für ihn zu stimmen, nur mit ihnen konnte er sich deshalb auch halten. Es galt deshalb nur die Schritte anzubahnen, die gleich von Ansang an gethan werden mußten, um den jungen Kaiser zu bewahren, daß er nicht in falsche Hände geriethe.
Labastida fürchtete es kaum, aber Vorsicht konnte trotzdem nicht schaden.
Unter den jungen Leuten war indessen der Kaiser bald vergessen, oder lieferte doch nur erwünschten Stoff zu lebendiger Unterhaltung. Die munteren Töne der Habanera erklangen, und das junge fröhliche Volk gab sich der Lust des Tanzes mit ganzer Seele hin. /21/
2.
Die Landung des Kaisers.
Wenn man schon in der Hauptstadt Mexiko erstaunt über die Ankunft des Kaisers war, wo man ihn seit Monaten erwartet und einen solchen Fall besprochen hatte, so überraschte Maximilian die Bewohner von Vera-Cruz noch viel mehr und auf das Entschiedenste, denn gerade hier bestand fast die ganze gebildete Klasse der Bevölkerung aus fremden Kaufleuten, und hier gerade hatte man auch am allerwenigsten dem Gerücht geglaubt, daß ein österreichischer Prinz je dem Ruf eines Napoleon folgen werde. Besonders die Deutschen, von denen es sehr viele im Hafen gab, bestritten eine solche Behauptung, wenn auch noch so bestimmt von Mexikanern oder einzelnen Franzosen geäußert, auf das Entschiedenste - und trotzdem war es geschehen.
Draußen auf der gewöhnlichen Rhede, gerade vor der Stadt - nicht weiter oben im Hafen bei Sacrificio, wo die französische Flotte am Sammelplatz der Kriegsschiffe lag - hatte die „Novara" ihren Anker fallen lassen. Aber selbst als die wehenden Flaggen keinen Zweifel gestatteten, und sogar Boote schon herüber- und hinüberglitten lag es noch wie ein dumpfes Erstaunen auf der Hafenstadt, und nichts regte sich darin, kein Zeichen der Freude, keine Bewillkommnung des Herrschers auf dem neuen fremden Boden wurde laut.
Auf dem Quarterdeck der „Novara" indessen, die Kaiserin neben ihm, die Begleitung kurze Strecke entfernt von den beiden Monarchen, aber alle Blicke dem neuen, wunderlich aussehenden Lande zugewandt, stand Maximilian. Die linke Hand stützte er auf die Bulwarks, die das Deck umgaben, die rechte hatte er vorn in seinen Rock geschoben, und sein Auge hing still und forschend an der vor ihm liegenden flachen und eigentlich trostlosen Küste, an den braunen Häusern und eigenthümlichen Kuppeln der Hafenstadt.
Wie ein leichtes, spöttisches Lächeln legte es sich dabei über /22/ seine Züge, und als sein Blick für einen Moment nach der Kaiserin hinüber schweifte, und er den peinlichen Ausdruck bemerkte, der auf ihrem Antlitz ruhte, sagte er leise und ironisch:
„Nicht wahr, Charlotte, die Leute sind hier ganz außer sich vor Freude, daß sie uns endlich nur im Hafen haben."
„Sie wissen vielleicht gar nicht einmal, daß wir an Bord sind," erwiderte die Kaiserin, die nur mit Mühe ihre Erregung verbergen konnte.
„Und hat nicht die „Themis" unsere Ankunft angezeigt? Aber dort drüben kommt ein Boot vom Ankerplatz der Franzosen herüber - es trägt auch die französischen Farben."
„Es ist das Admiralitätsboot, Majestät," sagte der Capitain der Fregatte, der eben herantrat. „Man scheint uns noch gar nicht erwartet zu haben."
„Es scheint allerdings so," lächelte Maximilian. „Die Bewohner von Vera-Cruz sind wahrscheinlich nicht mit ihren Empfangsfeierlichkeiten fertig geworden, oder es ist auch vielleicht einmal wieder eine Revolution da drüben ausgebrochen - aber dann hätte man uns doch wenigstens mit etwas - und wenn es Kanonenkugeln gewesen wären, begrüßt."
Es wurde kein Wort weiter gesprochen, denn Alles war auf die Neuigkeiten gespannt, die das französische Boot unfehlbar bringen mußte! - Neuigkeiten? - es waren Lebensfragen, die dabei auf dem Spiele standen, denn die unheimliche Ruhe am Ufer konnte auch allerdings einen andern Grund, als nur bloße Gleichgültigkeit oder Vergeßlichkeit haben.
Das französische Admiralitätsboot kam indeß langseit, und der Contreadmiral Bosse sprang mit seinem Adjutanten die ausgelegte Treppe herauf. Das Erste aber, was der Kaiser von ihm hörte, war ein zorniger Ausbruch des Herrn gegen den Lootsen gerichtet, daß er die Fregatte hier geankert, und sie nicht zu der Sacrificio-Jnsel und zwischen die französische Flotte geführt habe.
Der Lootse entschuldigte sich durch ein Achselzucken, und der Admiral, kaum einen Gruß für das mexikanische Kaiserpaar für nöthig haltend, rief, sobald er nur das Quarterdeck betrat, in einem nichts weniger als höflichen Tone ms:
„Aber, Majestät, Sie haben Ihr Fahrzeug hier an der /23/ gefährlichsten Stelle ankern lassen, die es im ganzen Hafen giebt. Das gelbe Fieber herrscht in Vera-Cruz; die ganze Luft ist verpestet und streicht von dort gerade hier herüber. Sie konnten sich doch denken, daß die französische Flotte den besten und sichersten Platz auswählen würde, wohin Ihnen auch die „Themis" vorangegangen."
„Sonst folgt die Themis gewöhnlich erst," sagte der Kaiser trocken, die Ungezogenheit des Admirals vollständig ignorirend, „aber das Unglück ist einmal geschehen, und wir gedenken uns auch überhaupt nicht lange hier aufzuhalten. Sind alle Vorbereitungen zu unserer augenblicklichen Abreise nach der Hauptstadt getroffen?"
„So viel ich weiß, ist gar nichts geschehen," erwiderte der Franzose, der fest entschlossen schien, ungezogen zu bleiben, und sich darin nicht einmal durch die Gegenwart der Kaiserin stören ließ. „Mit dem Land selber habe ich allerdings, und Gott sei Dank, gar nichts zu thun, aber wir hatten hier keine Ahnung, daß Sie so bald eintreffen würden, und so viel ich weiß, ist Bazaine noch nicht einmal damit fertig geworden, nur die Landstraße von dem Juaristischen Raubgesindel zu säubern, dem Sie möglicher Weise sogar unterwegs begegnen können."
„Die Aussichten sind sehr freundlich," erwiderte der Kaiser, „und Sie haben eine vortreffliche Darstellungsgabe, Admiral."
„Ich übertreibe nicht, Majestät," rief der Seemann. „Hier unten geht sogar das Gerücht, daß sich in der tierra templada6 Banden gebildet hätten, um Sie mit Ihrer ganzen Escorte aufzuheben. Juarez wär's im Stande."
„Und was sagt Bazaine zu einem solchen Stand der Dinge?"
„Was kann er sagen?" zuckte der Admiral mit den Achseln; „er läßt die Wege wohl dann und wann von dem Gesindel rein fegen, das ist aber gerade, als ob man Wasser vom Deck kehren will, ohne Dalois zu haben, durch die es hinaus kann. Hinter ihm laufen sie wieder zusammen, und er wird nicht /24/ fertig. Bleiben Sie aber lange hier liegen, so kommen Sie gar nicht in die Gefahr. Vor vierzehn Tagen ankerte hier ein Schiff, auf dem in kaum achtundvierzig Stunden die ganze Mannschaft mit sämmtlichen Passagieren wegstarb, und Fälle, wo drei oder vier Personen an einem Tage, ja oft in einer Stunde wie die Fliegen umfallen, können Sie hier überall erfragen."
„Wir danken Ihnen für die Auskunft, Admiral," sagte der Kaiser ruhig und wieder mit einem leisen Spott um die Lippen, indem er sich zu seiner Gemahlin wandte und ihr den Arm bot. „Wir werden aber trotzdem hier die Ankunft der Behörden erwarten müssen, und dann erst unsere weiteren Beschlüsse fassen."
Damit ließ er den Contreadmiral stehen und stieg mit der Kaiserin in die Kajüte hinab. -
Jetzt schienen sich aber doch auch die Bewohner von Vera-Cruz ermannt zu haben und vielleicht zu fühlen, daß man eine Unschicklichkeit dem Kaiser gegenüber begehe. Die beiden Minister Salas und Almonte waren ebenfalls herbeigeschafft; ihnen schlossen sich die Spitzen der Behörden von Vera-Cruz an, um die Majestäten zu begrüßen. Die Schiffe im Hafen flaggten, ebenso die ganze französische Flotte, und als der Abend einbrach, donnerten - freilich etwas spät - die Salutschüsse vom Fort Ulloa. Die Kuppeln des gegenüberliegenden Vera-Cruz glühten in bengalischem Feuer, und aus der Stadt wie von den Kriegsschiffen aus stiegen zischend und strahlenwerfend die Raketen hoch in die Luft hinauf.
Das Kaiserreich hatte begonnen. Der Monarch war mit dem Land, wenn er auch noch keinen Fuß darauf gesetzt, in Verbindung getreten, und was auch jetzt geschah, ein Rücktritt war nicht mehr möglich.
Am nächsten Morgen, nach einer ziemlich unruhig verlebten Nacht, und nachdem erst Messe an Bord gelesen und ein flüchtiges Frühstück eingenommen worden, bestiegen die Majestäten mit ihrer Begleitung die Boote und ruderten jetzt dem festen Land entgegen - aber es blieb das dort trotzdem ein kalter, fast unheimlicher Empfang. Allerdings hatte man /25/ in der Eile einige Triumphbögen errichtet, Böller wurden gelöst und aus einzelnen Fenstern auch Tücher geschwenkt und Blumen geworfen; doch war es augenscheinlich, daß die Bewohner der Hafenstadt noch selber gar nicht wußten, wie sie sich eigentlich zu benehmen halten, oder was sie thun oder lassen sollten.
Gerade s i e hier, mit der Welt in steter Verbindung, und genau davon unterrichtet, was diese über den Zug des Erzherzogs dachte und welches Schicksal sie ihm prophezeite, wurden durch das Plötzliche seines Erscheinens nicht allein überrascht, sondern auch wirklich in Verlegenheit gebracht. Sie kannten den neuen Kaiser ja noch gar nicht, ob er es wirklich gut mit dem Lande meine, oder ob ihn nur die Lust zu Abenteuern hier in das ferne Reich getrieben: ein Versuch, eine Krone zu gewinnen, der er, wenn sich Alles ungünstig gestaltete, auch eben so leicht wieder entsagen konnte. Sie aber blieben dann mit ihrem Vermögen und Eigenthum festgebannt im Reich, und wenn die Regierung bald einmal wieder wechselte und sie sich jetzt zu großartigen Demonstrationen verleiten ließen, so durften sie sich auch darauf verlassen, daß sie später dafür büßen mußten. Und außerdem - war nicht Oesterreich selber ein streng ultramontaner Staat, mit einem damals noch durch nichts gebrochenen Concordat, das der Regierung, einer übermüthigen Hierarchie gegenüber, Hände und Füße zusammengeschnürt hielt? Und was wußte man mehr von dem Bruder des österreichischen Kaisers, als daß er ein intelligenter und braver, ja, wie das Gerücht ging, auch ziemlich freisinniger Mann sei - aber blieb er das auch, sobald er eine Krone trug? - Wie oft haben wir in Europa schon die Erfahrung gemacht, daß man - mit der Regierung eines Fürsten nicht zufrieden - die größten Hoffnungen auf den Kronprinzen oder Erbfolger setzte, bis dieser dann die Regierung an- und nach einer kleinen Weile genau in die Fußstapfcn seines Vorgängers eintrat.
Hätten sie gewußt, welches warme, treue Herz Maximilian dem Lande entgegenbrachte, - auf ihren Händen würden sie ihn in die Stadt getragen haben.
Außerdem konnte aber der neue Kaiser auch zu keiner un-/26/günstigeren Zeit in Vera-Cruz eintreffen, als gerade jetzt, wo das gelbe Fieber wirklich mit außergewöhnlicher Schärfe sein Reich begonnen. Wer überhaupt die Stadt verlassen konnte, entzog sich dem grimmen Feind durch die Flucht, und das eigentliche Volk, das zurückgeblieben? Lieber Gott, das war, wie schon gesagt, daran gewöhnt, seine Herrscher zu wechseln. Es sah in dem Erscheinen eines neuen nicht das geringste Außergewöhnliche und mochte sich am allerwenigsten dafür begeistern. Wer wußte denn überhaupt, wie lange er blieb, und das Resultat durften sie deshalb ruhig abwarten.
Der Empfang war trotzdem im Ganzen nicht unfreundlich, und man hätte ihn unter anderen Umständen sogar einen herzlichen nennen können, aber er wirkte dennoch erkältend auf das Herrscherpaar. Wie Maximilian sich nach dem Lande gesehnt, von dem er glaubte, daß es ihn fast einstimmig zum Kaiser ausgerufen, so schien er auch gehofft zu haben, daß er von dem mexikanischen Volke empfangen würde, und darin fand er sich denn allerdings getäuscht. Es war sein erstes Betreten des neuen Reiches: die Schwelle, auf der er stand, um seine künftige Heimath zu überschauen; und wenn auch die Begrüßung von Einzelnen stattfand, in seinem Herzen mochte er mehr erwartet haben.
Mit solchen Empfindungen, und durch den Gesundheitszustand der Stadt, der natürlich noch viel übertrieben wurde, ebenfalls beunruhigt, ja geängstigt, war es kein Wunder, daß das Kaiserpaar Vera-Cruz nur als flüchtige Station betrachtete und rasch hindurchfuhr, um den Bahnhof zu erreichen. Dort bestiegen der Kaiser und die Kaiserin einen besondern Salonwagen, von den europäischen dadurch unterschieden, daß der vordere Theil desselben vollkommen offen war, während der Nachtzeit, mit hellgrauem Tuch beschlagen, durch Glasfenster geschlossen werden konnte. Die Begleitung nahm die gewöhnlichen, mit Rohrsitzcn versehenen Salonwagen ein, und fort ging der Zug, die kurze Strecke Eisenbahn durch die tierra caliente benutzend, die von den Franzosen angelegt worden, um ihre Truppen so rasch als möglich durch das „heiße Land" zu bringen.
Eine andere, wenn auch nur geringe Enttäuschung beach-/27/teten sie kaum, denn der Kaiser sowohl als die Kaiserin hatten erwartet, den für sie bestimmten hiesigen Hofstaat schon in Vera-Cruz vorzufinden. Aber das gelbe Fieber langte vor ihnen an und scheuchte mit seiner drohenden Todtenhand den Schmuck und Glanz des Hofes zurück auf seiner Bahn. Die Cavaliere und Damen des Hofes hatten es vorgezogen, die Majestäten in Mexiko selber zu erwarten.
Der Zug brauste durch den weiten Wald; in dem Wagen saß der Kaiser mit der Kaiserin, und draußen schien die Sonne Mexicos auf das wilde, weite, aber von üppiger Vegetation strotzende Land, auf Palmenwipfel und blühende Lianen nieder, zwischen denen freilich die faulen Wasser der Vera-Cruz umgebenden Sümpfe liegen. Kein Wort wurde aber auf der ganzen Fahrt bis Soledad zwischen Beiden gewechselt, denn wie ein drückendes Gewicht lag es auf Beider Seele: dieser trübe, erste Empfang im neuen Reich, diese Flucht fast aus der kaum erreichten Hafenstadt.
Und wenn sie so ihre Hauptstadt betreten mußten? - kalt und herzlos von dem Volk empfangen, dem der junge Fürst sein ganzes Leben geopfert und in seiner Stellung daheim, moralisch ebenso wie Cortez, die Schiffe hinter sich verbrannt hatte? - War denn das Alles Täuschung, Lug und Trug gewesen, was man ihm daheim von der Stimmung dieses Landes gesagt? Galt er dem Volke hier, das ihn ja doch aus „freier Wahl" zu seinem Kaiser erhoben, nur als ein anfgezwungener Gast, den man wohl unter ein paar Triumphbogen durchziehen ließ, aber dann auch glaubte, sich bis auf Weiteres mit ihm abgefunden zu haben?
Wie schön und sonnig lag die Scenerie um sie her - den Sumpf hatten sie verlassen, und kleine, von Indianern bewohnte Hütten wurden zwischen dem Grün der Bäume sichtbar. Die Menschen darin sprangen auch in die Thür, aber nur in stumpfer Neugierde starrten sie dem vorüberbrausenden Zug nach, in dem ihre neuen Herrscher saßen.
Und was Alles zog in dieser kurzen Stunde gezwungener Unthätigkeit durch die Seele des Kaisers? Der erste ungeschliffene Empfang des französischen Admirals, das unangenehme Gefühl der, vielleicht nothwendigen, aber nur zu /28/ deutlich ausgesprochenen und überall zur Schau getragenen französischen Oberherrschaft. Die Zurückhaltung der Mexikaner, dabei mit dem Eindruck, den hier das noch wilde, fast unbenutzte sumpfige Land auf ihn machen mußte. - War er wirklich ein Opfer französischer Diplomatie geworden? ein Vorschiebsel, um Napoleon den Dritten aus einer ihm über den Kopf gewachsenen Verlegenheit zu ziehen? - Aber des Kaisers Lippen preßten sich fest zusammen. Wollten sie ihn wirklich hier nur zu einem Werkzeug machen, um das schöne Reich in Zwang und unter französischem Befehl zu halten, so hatten sie sich jedenfalls in der Person geirrt. Das Volk mußte ihn allerdings erst kennen lernen, ihn und die Absichten, die er mit dem Lande hatte und die nur aus reiner, edler Seele entsprungen. Stand es ihm dann aber so treu zur Seite, wie er entschlossen war bei ihm und mit ihm auszuhalten, so war es ein Leichtes, französische Hintergedanken zu kreuzen und den Thron fest gegen jede äußere Macht zu stellen.
Eine Wolke zog über die Sonne; düster lag der wilde, dicht verwachsene Wald an beiden Seiten, und häßliche Geier, die neben der Bahn an einem gefallenen Stück Vieh ihr ekles Mahl gehalten, strichen mit lautem Flügelschlag erschreckt zur Seite.
In dem Augenblick gellte der grelle Pfiff der Locomotive durch den Wald; sie näherten sich einer zum Halteplatz bestimmten Station, und wie der Zug einbremste und die Sonne wieder voll und fröhlich aus den flüchtigen Schleiern heraustrat, da grüßten die Klänge fröhlicher Musik das Ohr des Kaisers. Eine Menge geputzter Menschen war dort versammelt, eine kleine, mit Blumen und Kränzen geschmückte Halle zeigte sich dem Blick, mit lauter Jubel drang daraus dem Herrscherpaar entgegen.
Unwillkürlich suchte Maximilian's Auge das der Gattin, das er bis jetzt in seinem düstern Brüten gemieden; eine Thräne glänzte darin. War sie erst jetzt durch diesen ersten Lichtblick ihres neuen Lebens hervorgepreßt, oder hing sie noch an den Wimpern der hohen Frau, als Zeuge ähnlicher Ahnungen, wie sie auch kurz vorher des Gatten Herz bewegt? /29/
Es blieb ihm keine Zeit, auch nur eine Frage an sie zu richten, denn das Volk drängte herbei; Indianer mit Blumen und Früchten, Weiße und Mischlinge in ihrer Sonntagstracht, und da war nichts Gemachtes, keine auf Befehl in Scene gesetzte Demonstration. So einfach die Begrüßung war, so sicher kam sie von Herzen, und besonders die Indianer dort schaarten sich um den Kaiser, während ein nur halblaut und fast wie scheu ausgesprochenes Wort flüsternd durch ihre Reihen lief.
Von da an schien der Bann gebrochen, der auf Maximilian's Eintritt in sein fremdes Reich gelegen. Der erste Bote, der seine Ankunft in Mexikos Hauptstadt gemeldet, hatte die Kunde auch durch das Land getragen. Friede sollte von jetzt an herrschen. Der neue Kaiser kam, den eine alte indianische Sage schon seit Jahrhunderten verkündet, und von allen Seiten strömte das Volk herbei, um ihn zu begrüßen.
Und Mexiko, die Hauptstadt, durfte darin nicht zurückbleiben.
Wie ein Lauffeuer hatte sich die Kunde von der Ankunft des Kaiserpaares in der großen Stadt verbreitet und gerade hier auch ungetheilten Jubel hervorgerufen. Man war der französischen Herrschaft schon recht von Herzen müde geworden und sehnte sich nach einem andern Regiment, das - wenn es nur die Hälfte von dem hielt, was es versprach - Segen und Ruhe über das arme, fast zu Tod gehetzte Land ausschütten mußte. - Sagte denn nicht dieser neue Kaiser in seiner von Vera-Cruz aus datirten Proclamation, die ein zweiter Courier heraufgebracht:
„So schwer es mir auch wurde, meinem Geburtsland zu entsagen, so habe ich es doch in der Ueberzeugung gethan, daß mich der Allmächtige, durch Eure Vermittlung, zu der edlen Mission ausersehen hat, meine ganze Energie und mein ganzes Herz einem Volke zu weihen, das, von unheilvollen Kämpfen ermüdet, aufrichtig den Frieden wünscht. Die Segnungen des Himmels und mit ihnen der Fortschritt werden uns sicherlich nicht fehlen, wenn sich alle Parteien von einer starken und redlichen Regierung leiten lassen und sich einigen, um das vorgesteckte Ziel zu erreichen, und wenn wir stets /30/ fortfahren, von religiösen Gefühlen beseelt zu sein, diesem Kennzeichen unseres schönen Vaterlandes selbst in den schwierigsten Epochen. Was mich betrifft, so biete ich Euch einen aufrichtigen Willen, Redlichkeit und die feste Absicht an, Eure Gesetze zu achten und sie mit unerschütterlicher Autorität zur Achtung zu bringen. Einigen wir uns, um das gemeinsame Ziel zu erreichen; vergessen wir eine düstere Vergangenheit; begraben wir den Parteihaß, und die Morgenröthe des Friedens wird sich leuchtend über dem neuen Kaiserreich erheben."
So etwa lautete der kurze Inhalt des Schriftstückes, das rasch in Tausenden von Exemplaren in der Staatsdruckerei hergestellt und unter das Volk verbreitet wurde, und natürlich, seinem Inhalte nach, Jubel in allen Kreisen erregte. - Sah doch jede Partei darin eine Erfüllung dessen, was sie selbst erstrebte.
Es waren aber auch einfache-ehrliche Worte, die der neue Herrscher zu ihnen sprach, und man glaubte ihnen so gern, da sie doch für die nächste Zeit wenigstens bessere und geregelte Zustände verkündeten.
Am 12. Juni endlich wurde die Ankunft des Kaiserpaares, das sich unterwegs und zwar in Orizaba und Puebla länger aufgehalten, in der Hauptstadt Mexiko angekündigt, und alle Straßen fast prangten im Festschmuck, schwärmten von jubelnden Massen, und schienen ihr schönstes Festkleid angelegt zu haben.
Nur im kaiserlichen Palais selber gab cs noch unglückliche Menschen, die bis an die Schultern in Seifenwasser und Schaum staken, gab es noch Tischler und Tapezierer, noch Schlosser, Zimmerleute und Maurer, denn man war ja, nach ächt mexikanischer Art und Weise, gar nicht an die selbst nöthigsten Arbeiten gegangen, bis den Leuten das Feuer auf den Nägeln brannte - dann aber auch natürlich nicht fertig geworden. Wie ein Blitzstrahl schlug daher die Nachricht: „der Kaiser kommt!" bei allen den mit irgend einer Arbeit Betrauten ein, und richtete eine fabelhafte Verwirrung an.
Aber das kümmerte die geputzte Schaar im sonnigen Licht da draußen wahrlich nicht, und größeren Glanz hatte Mexiko noch nicht wieder seit der spanischen Zeit gesehen. Die ganze /31/ haute volée war nämlich heute ausgezogen, um das Herrscherpaar noch vor der Stadt zu begrüßen, jede Equipage außerdem in Anspruch genommen und mit dem Schönsten gefüllt, was die daran so reiche Stadt an schönen Frauen bietet. In aller Pracht mexikanischer Reitercostüme, Sattel und Zaum wie die Reiter selber mit schweren Silber- und Goldstickereien bedeckt, drängte sich dabei Roß an Roß auf der breiten Straße, und wie das von edlen Metallen und Juwelen funkelte und blitzte, so funkelten und blitzten die Augen der schönen Frauen in Lust und gespannter Erwartung. Standen sie doch an der Schwelle einer neuen Aera, die sich ihre lebendige Phantasie schon mit bunten Bildern bevölkerte, und Glanz hineinflocht, Licht und Sonnenschein.
Die Equipagen von Mexiko lassen allerdings sehr viel zu wünschen übrig; wer aber sah heute auf die Geschirre, wo sie in ihrem Innern solche Pracht entfalteten - und nur die herrlichen Pferde wurden zur Schau geritten, denn gerade im Sattel zeigt sich der Mexikaner in seiner kleidsamen und etwas phantastischen Tracht zum größten Vortheil.
Nicht weit von Pennon, wo die Herrschaften erwartet wurden, neben einem verhältnißmäßig sehr eleganten Wagen, in welchem eine ältere, eine junge Dame und zwei allerliebste kleine Mädchen saßen, die zwischen sich wohl ein paar Dutzend Bouquets der herrlichsten Blumen liegen hatten, hielten mehrere Reiter in ihrer Galatracht. Sie trugen die großen breitrandigen, schwer gestickten Filzhütc, - die schon manchen deutschen Hutmacher in Mexiko zum reichen Mann gemacht - die mit zahlreichen silbernen Knöpfen und anderer Stickerei versehenen Cherivallas oder Reitgamaschen, große, schwere silberne Sporen und Zaumzeug und Sattel von Silber strotzend, während besonders an letzterem der Sattelknopf, wie ein kleiner, etwas schräg stehender Teller, von dem edlen Metall vollkommen überzogen wurde.
Unter ihnen hielten sich ein älterer und ein jüngerer Herr dicht zu beiden Seiten des Wagens. Der ältere Herr war der Gatte und Vater der weiblichen Insassen des Wagens, Seňor Don Bautista Romero, während der Jüngere, der kaum mehr als zweiundzwanzig Jahre zählen mochte, durch /32/ die zärtliche Ehrfurcht, mit welcher er Dona Ines, die Tochter des alten Herrn, behandelte und fast nur an ihren Augen hing, ziemlich deutlich verrieth, daß er ebenfalls gern ein Verwandter des Hauses gewesen wäre. Dona Ines behandelte ihn aber - so weit man es hier wenigstens beobachten konnte - ziemlich kalt; ihr Blick begegnete dem seinen nur äußerst selten, und dann selbst flüchtig und nur für einen Moment. Desto aufmerksamer musterte sie aber dafür die Toiletten der Damen, und wechselte dann und wann mit ihrer Mutter, ohne dem Galan weitere Aufmerksamkeit zu schenken, ein paar lächelnde Worte - und doch in dem Lächeln, welche scharfe Kritik über irgend einen auffallenden Schmuck oder sonstigen Gegenstand der Toilette!
Neben Seňor Römers hielt ein alter Freund desselben, Bastiani, ein ältlicher Herr mit eisgrauem Schnurrbart und ebensolchen Augenbrauen. Er war auch früher Soldat und natürlich General gewesen, hatte sich aber nach dem amerikanischen Krieg zurückgezogen und lebte jetzt großentheils auf seiner Hacienda, unfern von Cuernavaca.
Seňor Romero besaß ein sehr schönes und prachtvoll eingerichtetes Haus in der Hauptstadt selber, und Don Silvestre, der junge Herr, der nach Romero's Töchterlein schmachtete, war ein Nachbar desselben, der Sohn eines früheren Ministers, Almeja mit Namen, dessen Familie ebenfalls zu den angesehensten der Stadt zählte. Die Equipagen beider Familien fuhren auch zusammen aus Mexiko ab, wurden aber in dem ungeheuern Gedränge von Wagen und Reitern getrennt, und mußten deshalb an verschiedenen und von einander entfernten Stellen Position nehmen.
Und das Kaiserpaar kam noch immer nicht. Wie unruhig die Damen schon wurden, und wie besorgt sie ihre reichen Blumenvorräthe musterten, denn wenn sie erst in der heißen Sonne welkten, konnte man sie den „Herrschaften" doch nicht zuwerfen. Außerdem war es aber auch kein besonderes Vergnügen, dort in Hitze und Staub zu halten, wenn auch das Gedränge selber Abwechselung und Unterhaltung genug bot.
Die ganze Cavalcade hatte sich wieder langsam in Bewegung gesetzt, und zwar schon der Thiere wegen, die nicht /33/ gern so lange ruhig stehen wollten; aber nach kurzer Fahrt stockte der Zug wieder, und nur einige Reiter waren ab- und vorausgeschickt worden, um zu erkunden, ob man noch nichts von den Erwarteten entdecken könne.
Der alte Bastiani hielt wieder dicht neben Romero's Wagen, und den Gedanken, die ihm indessen wohl die ganze Zeit im Kopf herumgegangen, endlich Worte gebend, sagte er zu dem Schwager gewandt:
„Wundern soll's mich doch, welchen Umschwung die Dinge hier nehmen werden, wenn der neue Kaiser alles das hält, was er in seiner Proclamation verspricht - und er verspricht eben Alles."
„Und eben deshalb kann er's nicht halten," sagte Romero trocken. „Haben Sie den Theil gelesen, der von dem „religiösen Gefühl" handelt, Bastiani?"
„Gewiß - die übliche Redensart, die er schon einer gewissen Menschcnklasse wegen nicht weglassen durfte, wenn er sie nicht gleich von vornherein vor den Kopf stoßen wollte."
„Das ist mehr als das," sagte Romero, den Kopf schüttelnd, „und cs sollte mich sehr wundern, wenn er sich nicht den Klerikalen inniger als irgend einer der übrigen Parteien zuneigte - ist auch von einem österreichischen Prinzen gar nicht anders zu erwarten. Die „Schwarzen" verlangen aber eine Unmöglichkeit: „Herausgabe der confiscirten Kirchengüter", und folgte er ihnen darin, so stieße er nicht allein den ganzen Besitz des Landes um, sondern brächte sich in die schwierigste Lage mit fremden Ansässigen und fremden Regierungen. Die meisten der „liegenden Gründe", die früher der Geistlichkeit gehörten, sind ja doch nun einmal in fremden Händen und wieder und wiederverkauft, so daß es eine Heidenconfusion gäbe, wenn man die Sache auf einmal wollte ungeschehen machen."
„Sie haben ja selber das Kloster San Sebastian gekauft," lächelte Bastiani.
„Allerdings," nickte Romero, aber mit etwas unterdrückter Stimme, indem er einen, wie scheuen Blick nach dem Wagen und seiner Frau hinüberwarf, „es bot mir die größten Vortheile. Aerger mußte ich aber genug dafür hinunterschlucken." /34/
„Ihre Frau war nicht damit einverstanden?"
„Außer sich darüber, amigo. Die verwünschten Pfaffen haben ihr die Hölle heiß gemacht und bohren und drängen selbst jetzt noch in einem fort. Macht der Kaiser dann noch einen unüberlegten Streich und läßt sich von der Geistlichkeit beschwatzen, so ist der Teufel vollständig los, denn er hat dann alle Pfaffen und Weiber auf seiner Seite."
„In der letzten Zeit habe ich übrigens gar nichts davon gehört, daß eins der noch leer stehenden Klöster verkauft wäre, und doch traten die Franzosen dem nirgends in den Weg," sagte Bastiani.
„Nein, das in der That nicht," meinte Romero; „wer aber soll unter den jetzigen Umständen, wo man gar nicht weiß, ob ein solcher Handel noch rechtskräftig gemacht wird, sein gutes Geld in die Schanze schlagen? Erst müssen wir abwarten, wie sich Maximilian der Geistlichkeit gegenüber stellt. Ich bin übrigens froh, daß ich nicht den Wirrwarr durchzumachen habe, der den neuen Kaiser erwartet. Viel Ruhe wird er nicht bekommen."
Bastiani nickte leise vor sich hin mit dem Kopf. „Wenn er das Decret," sagte er, „das die Güter der „todten Hand" ihren jetzigen Besitzern läßt, nicht annullirt, so ist die schönste Revolution gleich wieder fertig, denn die Geistlichen geben in dem Fall keine Ruhe."
„Und wenn er es annullirt, so treibt er die Hälfte seiner Anhänger in's Lager der Liberalen," erwiderte Romero; „ich möchte wahrhaftig nicht an seiner Stelle sein."
„Und doch giebt es Manche, die es möchten," sagte Bastian:, „und - vielleicht auch noch nicht alle Hoffnung aufgegeben haben."
„Möglich schon," nickte Romero, „aber wen meinen Sie?"
„Es ist besser, keine Namen zu nennen," sagte der vorsichtige Mexikaner, „wir wollen's abwarten. Uebrigens möchte ich den einzelnen Menschen sehen, dem es unter den gegenwärtigen Umständen gelingen sollte, Ruhe in diesem Land zu halten und den Frieden herzustellen."
„Und was würde ihn daran verhindern?"
„Nur vier Unmöglichkeiten," sagte Bastiani. „Erstlich /35/ und vor allen anderen die Kirchenfrage, die allein schon genügt; dann unsere äußere Schuld; dann der Haß der Parteien mit offener Revolution im ganzen Land, und zuletzt, aber nicht als Geringstes, das französische Heer, das ihm hier auf dem Halse sitzt und das wieder los zu werden, ihm Mühe genug kosten wird. Und dabei warten die Parteien nur darauf, zu sehen, welche er begünstigt, um dann ebenfalls über ihn herzufallen."
„Sie entwerfen ein freundliches Bild von unseren Zuständen," lachte Romero, „und ich fürchte fast, Sie haben in vielen Dingen Recht, aber que importa? - wir können nichts in der Sache thun, als sie eben abwarten, und das hat Maximilian doch wenigstens für sich, daß ihn das Volk in seiner ungeheuern Mehrzahl zum Kaiser selbst verlangte -"
„Aber bester Romero," sagte der alte Herr, „Sie reden von einer Abstimmung in Mexiko. Wissen Sie nicht, was eine solche zu bedeuten hat?"
„Nun, den Willen des Volkes," rief Romero eifrig aus, „und wenn Sie heute noch einmal den Versuch machten, bin ich fest überzeugt, daß er Tausende von Stimmen mehr bekommen würde."
„Gewiß würde er das," lachte Bastiani, „und weshalb nicht? Wollte er in diesem Augenblick über das Kaiserreich abstimmen lassen, so glaube ich nicht, daß es zehn Menschen in der ganzen Stadt und wenig mehr im benachbarten Land gäbe, die ihm ihre Stimme vorenthielten, aber was will das sagen? Lassen Sie Juarez aus seinen Bergen vorbrechen, die Franzosen einmal schlagen und nachher über ihn abstimmen, so haben Sie das nämliche Resultat für den Indianer. Daß Maximilian eine Abstimmung in Mexiko nur verlangte, beweist, daß er das Land nicht kennt, wenn nicht überhaupt die Annahme der Krone schon den vollgültigsten Beleg dafür böte."
„Sie kommen! sie kommen!" tonte der laute Ruf durch die Reihen, und natürlich war dadurch jedes weitere Gespräch abgebrochen, ja jeder andere Gedanke gebannt. Die Equipagen fuhren rechts und links zur Seite, die Reiter, von denen nur ein Theil als Escorte voraussprengte, trennten sich /36/ ebenfalls, und jetzt kam der Zug, von dem mehr und mehr anschwellenden Willkommensrufe begrüßt, heran. Zu einem wahren Enthusiasmus aber steigerte sich derselbe, als man das junge, schöne Paar im Wagen erst erkannte.
Das war in der That ein Fürst, wie sie ihn sich gedacht; das war eine Kaiserin, die an seiner Seite saß, edel und schön, stolz und königlich. Der Jubel schwoll auch zu einem wahren Freudenrausch an, als das hohe Paar langsam zwischen den Wagen und Reitern, die sich dem Zug dann anschlössen, hindurchfuhr. Die Damen warfen ihre Blumen in den Wagen und schwenkten die Tücher, die Herren hoben ihre Hüte, und die donnernden Vivats pflanzten sich fort auf der Straße bis in die künftige Residenz hinein.
Maximilian schaute hinaus auf sein neues Volk und auf dessen lauten und jetzt unzweifelhaft aus dem Herzen kommenden Jubel, und zwei helle Thränen glänzten in seinen Augen. Er war so ergriffen, daß er sich Mühe geben mußte, seine Ruhe zu bewahren. Desto unbefangener und fester zeigte sich aber die Kaiserin. Sie dankte mit huldvollem Lächeln nach allen Seiten hin, aber auf ihren schönen, doch etwas kalten Zügen lag deutlich die Freude und Genugthuung über diesen Empfang. Sie war sich des Augenblicks vollkommen bewußt und genoß ihn, während Maximilian selber, in der Erfüllung eines lange vorgeschwebten Zieles, alle Kraft anwenden mußte, um Fassung zu zeigen und dem Publikum nicht zu verrathen, welches tief empfundene Glück sein Herz in diesem Augenblick bewege.
Und der Zug wuchs. Als sie sich den Thoren der Stadt näherten, ritt an der rechten Seite des Kaisers General Ba zaine, der den Monarchen ehrfurchtsvoll begrüßt hatte. Mit ihm umgaben Graf Bombelles, der Commandant der Garde, die Adjutanten und viele andere Officiere die Equipage des Herrscherpaares. Voraus bildete sich dabei der Zug der Ayuntamientos und höheren Beamten, und nach folgte das Volk, mit zahllosen Indianern dazwischen, während Mexiko selber im Festschmuck prangte.
Eine Masse von Triumphbogen waren errichtet, die Straßen, durch welche der Zug ging, sämmtlich mit Guirlanden, Fahnen /37/und Draperien, die letzteren meist in den mexikanischen Farben, geschmückt; die Balköne, in der ersten wie zweiten Etage der Häuser, mit geputzten Damen und Kindern gefüllt, welche dann Blumen und seidene, mit Gedichten bedruckte Bänder über die vorbeifahrenden Majestäten ausschütteten.
Viele kleine Privataufzüge wurden dabei improvisirt, wie sie auch noch nie beim Einzug irgend eines der übrigen Präsidenten gefehlt hatten, und das geschieht fast stets mit Hülfe von kleinen, hübschen und phantastisch angezogenen Kindern, die entweder von mexikanischen Flaggen umgeben, in künstlichen Muscheln getragen oder auch von Maulthiercn gezogen werden. Die Figur oder auch Gruppe stattet man dabei stets allegorisch aus, worin die Mexikaner eine große Fertigkeit zeigen, so daß sie sinnbildlich das Land selber, bald die Freiheit, bald den Sieg, die Gerechtigkeit oder irgend etwas, womit man gerade dem Gefeierten schmeicheln will, vorstellen.
Alle diese kleinen Aufzüge suchten dem Kaiserpaar zu nahen und ihm ebenfalls Blumen und Gedichte in den Wagen zu werfen. Selbst die Bildnisse des Kaisers wie der Kaiserin fehlten nicht; Raketen aber wie anderes Feuerwerk stieg am hellen, sonnigen Tag in die Luft empor, wie das bei allen Feierlichkeiten die wunderliche Sitte in ganz Südamerika ist.
Auch an Miramon's Haus ging der Zug vorüber. Miramon selber stand mit seiner jungen, schönen Frau und den Kindern auf dem mittleren Balkon, und die Kinder streuten ebenfalls Blumen hinab. - Auch Seňora Miramon hielt einen lockern Strauß prachtvoller Rosen in der Hand und schaute, den rechten Arm auf die Balkonlehne gestützt, sinnend auf den gerade langsam vorbeifahrenden Wagen nieder. Mira mon sagte lächelnd:
„Das mexikanische Volk bleibt sich doch immer gleich. Bei meinem Einzug fehlten eben so wenig diese Allegorien, wie die Blumen und Gedichte, und es sollte mich gar nicht wundern, wenn viele dieser bunten Bänder die Reise aus Fenster oder Balkon in die Straße bei den verschiedensten Gelegenheiten schon vorher gemacht. Siehst Du, wie sie da einige Leute sorgsam aufheben?"
„Und wenn Du wieder einzögst," sagte die junge Frau, /38/ indem ihr Blick unten von dem lebendigen Bild abschweifte und am Leeren haftete, „so würde Dir das Volk ebenso entgegenjubeln."
„Gewiß, gewiß," nickte der General. „Volk bleibt Volk, und der Erfolg der alleinige Maßstab für dasselbe. Wohin Du siehst in der Welt, findest Du das Nämliche. Aber Du hast ja Deine Blumen nicht geworfen, Schatz?"
„In der That, nein," sagte die Senora, „ich habe wahrlich gar nicht daran gedacht, aber die Herrschaften werden nicht böse darüber sein. Sie sind ja jetzt schon von Blumen fast bedeckt und können das Gewicht kaum tragen. - Wie das so wunderbar wechselt auf der Welt," setzte sie dann nach einer kurzen Pause sinnend hinzu: „Du, der frühere Präsident der Republik, stehst jetzt hier oben auf dem Balkon und siehst dem Einzug eines Kaisers zu."
„Und ich darf dafür nicht einmal undankbar gegen mein Vaterland sein," lächelte der junge Mann, „denn Iturbide und Guerrero waren nicht so glücklich, das von sich sagen zu können."
„Und nennst Du das ein Glück?" sagte die junge, schöne Frau, die Oberlippe dabei leicht emporwerfend.
„Daß ich noch am Leben bin? gewiß," lachte Miramon, „aber paciencia, amiga, paciencia! Du kennst doch den Wahlspruch unseres Landes. Maximilian zieht zu einer bösen Zeit in Mexiko ein, böse in sofern, wenn er glaubt, daß er seine Herrscherwürde ruhig in den Schooß geworfen bekommt.
Er wird Arbeit und Aerger, wenn nicht Schlimmeres, gerade genug finden. Ich wäre der Letzte, ihm das Alles, nur des Namens wegen, zu mißgönnen. Schafft er sich wirklich Ruhe, was ich noch sehr stark bezweifle, so verdient er sie sich auch im vollen Maße, und ich irre mich vielleicht kaum, wenn ich denke, daß er doch trotz alledem nur eben wieder für einen Andern arbeitet."
„Für welchen Andern, Miguel?" frug rasch die Frau.
,,Quien sabe, Schatz," sagte achselzuckend Miramon, „jedenfalls erleben wir es noch, denn so lange dauert eine Umwandlung in unserem etwas veränderlichen Reiche nicht."
„Und wenn sich das Volk nun doch ihm fügen sollte? Es hat die ewigen Revolutionen satt." /39/ „Das Volk, liebes Herz, hat mit der Sache gar nichts zu thun," sagte Miramon kopfschüttelnd, „und wird zu allerletzt deshalb befragt. Außerdem ist es ein Fremder, und Du weißt, wie rasch die Creolen geneigt sind, gegen den Partei zu nehmen - wenn es nämlich einmal nöthig werden sollte. Doch das Alles liegt noch in weiter Ferne, und weshalb sollten wir uns damit jetzt schon den schönen Tag trüben. - Sieh, der Zug nähert sich der Kathedrale, und ich glaube es wird Zeit, daß wir an unsere Toilette denken; wir kommen sonst wirklich zu spät zum Empfang."
Die Seňora warf noch einen Blick die Straße hinab, dann sagte sie leise: „So habe ich Mexiko noch nie gesehen. Auch nicht ein Haus steht unbetheiligt an der Festlichkeit, und Kränze und Guirlanden winden sich von einem zum andern."
„Weil es heute gerade gar keine Parteien in Mexiko giebt, als eben nur die kaiserliche, und deshalb wäre es directer Wahnsinn, einzeln dagegen aufzutreten; man setzte sich der Gefahr aus, gesteinigt zu werden. Laß aber Maximilian nur in sechs Monaten noch einmal versuchen, ein solches „Familienfest" zu arrangiren, und ich fürchte fast, daß es schon bedeutend dürftiger ausfiele, als an diesem Tag."
„So kurze Zeit prophezeist Du dem Kaiserreich und hast Dich ihm doch selber zur Verfügung gestellt?"
„Weil ich nicht gern Unmögliches versuchen und gegen den Strom schwimmen mag, wenn ich einen Kanal finde, der mich in ruhiger und bequemer Weise vorwärts bringt. Wir müssen überhaupt erst sehen, was geschieht, und Labastida selber steht ja gegenwärtig vollkommen auf Seite des neuen Monarchen. So lange der aber dort aushält, haben wir einen ganz vortrefflichen Compaß, nach dem wir steuern können."
„Und wenn er von ihm weicht?"
„Paciencia. Siehst Du die dunkeln Wolken dort am Himmel aufsteigen? Vielleicht bedeuten sie Regen und Sturm, vielleicht ziehen sie harmlos vorüber. Wir werden ja sehen, wie sich Alles gestaltet, und nun laß uns an den Abend denken." /40/
*
„Wohin, Silvestre?" rief den von der Plaza zurückkehrenden jungen Almeja einer seiner Stadtfreundc an, der auf schaumbedeckten Pferde, wie auch selber staubig und erhitzt, seinen Rappen eben einzügelte und gar nicht in die festlich geschmückten Straßen zu passen schien, „ist die Ceremonie schon vorbei?"
„Noch nicht, Mauricio," sagte Silvestre, indem er sein eigenes Thier zum Stehen brachte. „Labastida hat sie eben an der Kathedrale empfangen, und dort wird jetzt ein Te Deum gefeiert, das mir ein wenig zu langweilig war, um es mitzumachen. Aber woher kommst Du, und weshalb hast Du den Einzug versäumt? Er war pompös."
„Carajo,"7 rief der junge Mann ärgerlich, und sein Pferd bäumte empor, weil er es unwillkürlich mit dem Sporn berührte, „ich habe die ganze Geschichte total verschlafen. Gestern Abend fingen wir in Tacubaja an zu spielen und spielten bis heute Morgen halb sechs Uhr. Da war ich denn so todmüde und eigentlich auch nicht in der rechten Stimmung."
„Du hast wieder verloren, wie?"
„Achttausend Pesos an den verwünschten Italiener, der mit Bazaine herübergekommen. Ich wollte, der Lump hätte Mexiko nie betreten, denn er hat entweder ein ganz unverschämtes Glück oder -"
„Oder?"
„Er spielt falsch," zischte der junge Mann zwischen den Zähnen durch; „aber Gnade ihm Gott, wenn ich ihn einmal dabei ertappe."
„Ich würde ihm nicht mehr zu nahe kommen."
„Ich muß mein Geld wieder haben."
„Cuidado! (Nimm dich in Acht) Aber wohin wolltest Du jetzt?" /41/
„Noch etwas vom Zuge oder von den Leuten sehen, wenn es möglich ist, und wohin willst Du?"
„Nach Hause, um mich zum Diner im Palais umzuziehen. Ihr seid doch auch geladen?"
„Wahrscheinlich, ich war nicht zu Hause; aber das hat noch Zeit, und außerdem liegt mir verwünscht wenig daran. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird dort weder geraucht, noch gespielt."
„Du bist unverbesserlich."
„Ich muß mein Geld wieder haben," sagte der junge, etwas wüst aussehende Mensch, der aber trotzdem einer der ersten Familien des Landes angehörte. Damit gab er seinem Thier die Sporen und trabte die Straße hinab der Plaza selber zu.
*
„Hallo, Rudolfo, Mensch, wo kommst Du her?" flüsterte ein Mestize, der etwa dem niedern Bürgerstande angehören mochte, einem Sambo8 zu, der, sein Gesicht mit einer alten Zarape halb verdeckt, einen arg mitgenommenen Strohhut auf dem Kopf und Sandalen an den Füßen, eben an ihm vorüber und die Straße hinab wollte. Der Mestize sah gegen ihn ganz anständig aus und war in die ächt mexikanische Tracht gekleidet, mit dem breitrandigen, sogar ein wenig geflickten Filzhut, den an der Außenseite geschlitzten und dicht mit runden Knöpfen besetzten Beinkleidern und schneeweißen Unterhosen, die durch den Schlitz sichtbar wurden. Das Begegnen des jedenfalls genau Gekannten schien ihn auch nicht besonders zu freuen, denn er warf den Blick wie ängstlich umher, als ob er fürchte, von irgend Jemandem hier öffentlich mit ihm gesehen zu werden.
„Carajo, Gcronimo," lachte der Sambo, der aber ebenfalls den Blick nach rechts und links die Straße hinabwarf, ohne die, sein Gesicht halbverhüllende Zarape herunter zu nehmen, „und was treibst D u hier in Mexiko? - Ave Maria, Mann, /42/ Du siehst ja wie ein Caballero aus! Die Geschäfte müssen gut gegangen sein. Komm, laß uns ein Glas Pulque9 zusammen trinken, denn hier draußen möchte ich nicht gern eine lange Unterhaltung führen."
„Und wenn Du erkannt wirst?"
„Bah," lachte der Sambo, „die Parteien wechseln jetzt so rasch, daß Keiner vom Andern weiß, ob er zu der oder jener gehört. Und wenn ich wirklich erkannt würde, so sagte ich einfach, daß ich gut kaiserlich geworden wäre, und ließe mich unter die Soldaten stecken. - Wäre noch außerdem Profit, denn ich brächte gleich eine gute Muskete mit nach Hause."
„Und wohin willst Du jetzt?" frug Gerónimo, indem er ihn am Arm faßte und einer der kleinen Seitenstraßen zuschob.
„Wohin? - vielleicht zu Juarez zurück nach Monterey - vielleicht bleibe ich noch in der Stadt."
„Bst - nicht so laut," meinte der vorsichtigere Mestize, - „es giebt in diesem Augenblick keinen gefährlicheren Namen als den in Mexiko."
„Er wird ihnen noch gefährlicher werden," lachte der Sambo, „denn der Schwindel hier kann ja doch nicht lange dauern."
„Und wie steht's dort oben?"
„Gut - die Franzosen, die Gott verdammen möge, haben uns allerdings eine Zeit lang hin und her gehetzt, aber nichts hilft's ihnen - es ist, als ob sie Quecksilber in einem Sieb fangen wollten, und bald genug werden sie dessen müde werden."
„Aber was kann er ausrichten?"
„Werdet's bald hier merken. Vor vier Wochen war ich über dem Rio Grande drüben; die Amerikaner sind ganz des Teufels darauf, hier einzurücken."
„Die haben selber alle Hände voll zu thun."
„Schadet nichts, werden schon damit fertig werden, und dann sind sie wie ein Wetter bei der Hand - aber da drüben /43/ ist die Pulqueria - komm, der Wirth ist ein alter Freund - dort können wir noch ein Stündchen zusammen plaudern, und dann muß ich wieder fort. Bin gerade zur rechten Zeit hier eingetroffen, um die Komödie mit anzusehen."
3.
Auf Chapultepec.
Die nächste Zeit verging den Bewohnern von Mexiko wie in einem Taumel, denn sie kamen vor lauter Festlichkeiten, Bällen, Paraden, Illuminationen und Aufzügen gar nicht zu sich selber. Den ersten außerordentlich glänzenden Ball veranstaltete der Kaiser im Theater, dann folgte Bazaine mit einem andern, der allerdings ein wenig böses Blut machte, denn die Einladungen waren ziemlich rücksichtslos abgefaßt. Aber wer hatte jetzt gerade Zeit, über derartige Kleinigkeiten lange nachzugrübeln, und wo sich nur das Kaiserpaar blicken ließ, empfing es ein so lauter und unverkennbar von Herzen kommender Jubel, daß Maximilian über die Stimmung, die in dieser Zeit in der Hauptstadt herrschte, wahrlich nicht in Zweifel sein konnte. Das aber setzte ihn über tausend andere Kleinigkeiten, die ihm sonst vielleicht störend genug entgegengetreten wären, leicht hinweg.
Im Palacio an der Plaza, wo er seine Wohnung nehmen sollte, war fast noch nichts zu seinem Empfang geschehen. Nichts wenigstens, wie es ein europäischer Fürstensohn aus solchem Stamm gewohnt gewesen, und auch hier erwartet haben mochte. Selbst die ganzen Baulichkeiten des Palastes entsprachen wohl dem Land und Klima, aber doch nicht größeren Ansprüchen, und die mit der Einrichtung betrauten Beamten geriethen fast außer sich, als sie die Gemächer sahen, in welchen der Kaiser und die Kaiserin wohnen sollten. /44/
Einzelne Stücke zeigten allerdings die höchste Pracht, so ein Toilettetisch z. B., den die Damen von Mexiko der Monarchin bescheert; sonst aber verriethen schon halb abgenutzte Teppiche, ordinäre Tapeten und tausend andere Dinge, daß die bisherigen Regenten Mexikos diese Räume früher wohl einmal bewohnt, aber noch nie Zeit und Gelegenheit gehabt hatten, sich selbst nur behaglich darin einzurichten.
Maximilian, an andere Umgebungen gewöhnt, konnte sich hier natürlich nicht wohl und zu Hause fühlen. Das aber waren doch nur Kleinigkeiten und Nebensachen, die sich alle mit der Zeit und einigem Kostenaufwand verbessern ließen. Dazu freilich war es nöthig, daß man eine Menge von Arbeitern in den Räumen beschäftigte, und um diesen theils aus dem Weg zu gehen, theils auch einem etwas romantischen Zug folgend, der ihn ja bis jetzt auf seiner ganzen Bahn geleitet, beschloß der Kaiser, den alten Königssitz Montezuma's, das etwa eine gute halbe Stunde von Mexiko gelegene Schloß Chapultepec, zu seinem nächsten Aufenthaltsort zu wählen.
Eine schönere Lage hat kein Schloß der Erde, in welchem Welttheil es auch liegen möge, und ob es auf hohem Fels am Meere, von Schneegebirgcn überragt, in schattige Buchen und dunkle Tannen hineingeschmiegt, oder von palmengekröntcn Hängen umgeben wäre.
Chapultepec, mit gerade nicht hervorragenden architektonischen Formen, ist aber, fast im Mittelpunkt des ganzen Thals von Mexiko, auf einem jener kleinen Hügel erbaut, die, unmittelbar aus der Ebene emporsteigend, der ganzen mexikanischen Hochebene charakteristisch und jedenfalls vulkanischen Ursprungs sind.
Am Fuß dieses Hügels, und wahrscheinlich die Ueberreste eines uralten, den Göttern geweihten Haines bildend, stehen jene mächtigen Cedern mit kolossalem Stamm und Wipfel, unter denen Geschlecht nach Geschlecht wandelte - und wandeln wird, und oben aus den Gipfel haben die früheren spanischen Vicekönige ein festes Schloß mit hohen Mauern und Wällen gesetzt, das eine Rundsicht bietet, wie sie auf der Welt kaum weiter gefunden wird.
Gerade voraus, nach Osten zu, vielleicht in Ost-Südost, /45/ liegen die herrlichen schneebedeckten Vulkane, der Popocatepetl und der Ixtaccihuatl oder die weiße Frau - der erstere spitz und pyramidenartig, der andere mit langgestrecktem Gipfel und in den Umrissen einer ruhenden, mit einem riesigen weißen Tuch überdeckten Frauengestalt nicht unähnlich.10 Links davon dehnte sich der Höhenzug aus, der die Thäler Mexikos und Pueblas von einander scheidet - den Mittelgrund bildeten die Seen, links die Texkoko, rechts der Chalco und Kochimilco, und den Vordergrund die weit ausgedehnte Hauptstadt mit ihren geradausgelegtcn Straßen und von zahllosen kleinen Dörfern, Städtchen und Hacienden umgeben, während links an den sich dort aufthürmenden Hängen der Wallfahrtsort Guadalupe, rechts das freundliche Tacubaya und viele andere kleine Ortschaften sichtbar wurden, und weitere Höhenzüge, sich an die vorderen anschließend, ein vollständiges und für sich abgeschlossenes Panorama bildeten.
Dort hinauf verlegte Maximilian, nur wenige Tage nach der Ankunft in der Hauptstadt, seine Residenz; und wenn er auch hier, vom Luxus ganz abgesehen, so wenig Bequemlichkeiten fand, daß er in der ersten Nacht genöthigt wurde auf einfacher Matratze in der Veranda des innern Schlosses zu schlafen, so setzte er sich in seiner liebenswürdigen Einfachheit leicht darüber hinweg. Die wundervolle Lage, die historische Erinnerung des Platzes entschädigte ihn für alles Uebrige, und selbst die sonst so stolze Kaiserin fügte sich, wenn auch vielleicht nicht so freudig und rückhaltlos, den augenblicklichen, etwas beschränkten Verhältnissen.
Aber Ruhe wurde ihm dort nicht viel gelassen, denn die verschiedensten Parteien wußten recht gut, daß sie die erste Zeit, wo nach keine festen Entschlüsse gefaßt sein konnten, auch benutzen müßten, um de» neuen Herrscher ihren Interessen zu gewinnen. Dem Kaiser selber lag aber natürlich ebenso daran, die verschiedenen Wünsche des Landes zu hören, wie dessen Bedürfnisse kennen zu lernen. Es war ihm wohlbekannt, welcher Zwiespalt die verschiedenen Klassen der Gesellschaft /46/ sowohl, wie die Parteien entzweite; und nur dadurch, daß er gründlich auf ihre Wünsche wie Forderungen hörte, glaubte er sich ein treues Bild des Ganzen zu bilden und dann nach eigenem Urtheil - immer ja nur das Beste des Landes im Auge haltend - seine Entscheidung zu treffen.
Am thätigsten zeigte sich dabei, wie das gewöhnlich und überall der Fall ist, die Kirchenpartei, die sich auch schon dadurch im Vortheil gegen die Uebrigen befand, daß sie nicht allein ein festgeschlossenes Ganze bildete, sondern auch ein ganz bestimmtes und scharf ausgeprägtes Ziel verfolgte. Ein Abweichen davon, ein Zwiespalt in ihren eigenen Gliedern fand nicht statt - und mit dem alten Kunstgriff, Religion und Kirche zu idcntificiren, hielt sie - die alte Geschichte - mit der rechten Hand das Kreuz und mit der linken den Klingelbeutel.
Es ist möglich, ja sogar wahrscheinlich, daß Maximilian, als er das Land betrat, die Absicht mitbrachte, die Klerikalen, deren Eifer und Unterstützung er ja doch zum großen Theil mit seine Wahl verdankte, von dem Druck zu befreien, den des Indianers Juarez Hand auf sie gelegt. Es kann recht gut sein, daß er sich früher - und ehe er die Verhältnisse näher kannte - mit dem Gedanken getragen, ja vielleicht selbst beabsichtigt hatte, die der Kirche entrissenen Güter wieder zurück zu erstatten und ein Gesetz aufzuheben, das Juarez schon im Jahre 1859 von Vera-Cruz aus gegeben, und das einfach sämmtliche Liegenschaften der Geistlichkeit - die wirklichen Kirchen ausgenommen - zu Gunsten des Staates mit Beschlag belegte. Ehe er aber an die Ausführung ging, war er vorsichtig genug gewesen, die Stimmung des ganzen Landes, d. h. wenigstens die Stimmung der verschiedenen Parteiführer darüber zu hören, und mußte denn allerdings bald finden, daß es - wenn auch von den „Liberalen" ausgegangen, schon so in alle Schichten der Gesellschaft eingegriffen hatte, um nicht mehr mit einem Federstrich beseitigt zu werden.
Maximilian war tief religiös, aber dabei auch zu aufgeklärt, um nicht zu fühlen, wie das geistliche Regiment mehr Rechte beanspruchte, als sich eigentlich mit der, trotzdem zur Schau getragenen, christlichen Demuth vertrug. So hatten /47/ diese Herren denn auch im ganzen Reiche eine solche Unmasse von Besitzungen an Gebäuden sowohl wie an Boden in Anspruch genommen, daß ihnen z. B. in Puebla reichlich ein Drittheil der ganzen Stadt gehörte, und der Kaiser konnte sich nicht verhehlen, daß für das Land selber ein Gesetz wohlthätig wirken müsse, welches diese ungeheuern Besitzungen in den Bereich industrieller Unternehmungen brachte.
Ob sich die Maßregel vom juristischen Standpunkt aus nicht anfechten ließ, war wieder eine Frage, obgleich auch diese wohl nicht zu Gunsten der Geistlichkeit entschieden wäre, da die Priester, als die früheren Herren des Landes, wohl kaum einen Quadratfuß dieser ganzen Liegenschaften wirklich gekauft, sondern was sie gebraucht oder auch nur gewünscht, einfach in Besitz genommen hatten. Jetzt aber gestaltete sich eine Wiederherausgabe der geistlichen Güter, wie Maximilian bald fand, fast zu einer Unmöglichkeit, denn wenn auch allerdings ein großer Theil derselben noch unverkauft lag, so waren doch schon zahlreiche Klöster, besonders in der Hauptstadt selber, nicht allein in den Besitz Einheimischer, sondern auch Fremder übergegangen, und theils durchbrochen, um Straßen herzustellen, theils auch in Wohnhäuser und Niederlagen umgewandelt worden.
Außerdem hatte die Geistlichkeit ihre früheren Reichthümer nicht etwa dazu benutzt, um das Land selber zu heben und durch Schulen oder andere Institute das Volk aufzuklären - das lag nicht in ihrem Zweck, sondern weit eher Revolutionen anzuzetteln und ihnen mißliebige Regierungen zu beseitigen. Durch Juarez' Decret war sie aber darin beschränkt worden, sie sah sich nicht allein beraubt sondern auch in ihrer „weltlichen Macht" gebrochen, und ihr Grimm darüber, wie der Eifer, den sie entwickelte, um ihre verlorenen „Rechte" wieder zu erobern, läßt sich erklären.
Maximilian erkannte vielleicht damals schon, in welcher schwierigen und gefährlichen Stellung er sich befand, wenn er von vornherein das ganze Pfaffenthum gegen sich bekam. Die verschiedenen Parteiführer, die er darüber sprach, verwirrten ihn aber noch mehr, denn kein einziger schien sich wirklich um das Beste des Landes zu kümmern, sondern nur /48/ immer und allein sein eigenes und damit das Interesse der besondern Partei im Auge zu haben.
Maximilian wollte selber sehen und hören, und trat deshalb schon im August seine Reise durch einen Theil der Staaten an. Bis zu seiner Rückkehr waren daher entscheidende Maßregeln, feste Besetzung der Ministerien, selbst ein Entschluß in der Kirchenfrage verschoben worden, und die Kaiserin regierte, mit Almonte11 an ihrer Seite, indessen in Mexiko, während die französischen Generale emsig bemüht blieben und in der That alle Kräfte aufboten, um im Norden wie Süden die noch bestehenden „Rebellenbanden", wie man die Republikaner nannte, zurückzuwerfen und aufzureiben.
So tapfer sich aber auch dabei die Franzosen zeigen mochten, so stellte ihnen doch das Land selber mit seiner unwegsamen Wildniß und ungeheuern Ausdehnung die größten Schwierigkeiten entgegen, und der Feind, zehnmal geschlagen, fand doch immer wieder Schlupfwinkel, durch die er entkommen und sich weiter entfernt wieder sammeln konnte. Die Franzosen nahmen fast alle Plätze, gegen die sie vorrückten, aber - sie konnten dieselben nicht behaupten, denn es war unmöglich, in diese Entfernungen das nöthige Kriegsmaterial wie Proviant zu schaffen. - Sowie sie sich zurückzogen, rückten die Republikaner wieder nach, und cs blieb nichts Anderes als eine Sisyphus-Arbeit, der sie sich unterzogen.
Während der Reise des Kaisers hielten sich die Führer der verschiedenen Parteien noch vollständig ruhig - sogar der Klerus schien geduldig vor allen Dingen die Rückkehr des Monarchen abzuwarten, wozu auch das viel beitragen mochte, daß Labastida, der Erzbischof, mit dem General Bazaine auf einem sehr gespannten Fuß stand und mit ihm unter keiner Bedingung verhandelt hätte. Als aber Maximilian endlich zurückkehrte, preßte die Geistlichkeit in geschlossener Phalanx vor.
Aber der Kaiser hatte in der Zeit doch eingesehen, daß er dem Drängen des Klerus nicht nachgeben durfte, wenn er nicht augenblicklich wieder eine Revolution heraufbeschwören wollte. Konnte doch dieselbe sogar noch durch die ganze Partei der Conservativen, also die Besitzenden, unterstützt werden, /49/ und mußte gefährliche Dimensionen annehmen, sobald sich diese mit den Liberalen vereinigten.
Uebrigens kannte Maximilian schon ziemlich genau die Stützen, welche der Klerus in der Hauptstadt hatte, und suchte sie für sich zu gewinnen - vergebenes Bemühen. Miramon selber war ein häufiger Gast auf Chapultepec, und mit seinem geschmeidigen Wesen fügte er sich in Alles, sobald es nicht die Hauptsache berührte. Dann aber hielt diese Partei ihm nur immer mit Achselzucken das starre Non possumus12 entgegen, und es ließ sich mit ihr eben in keiner Weise unterhandeln. Es gab da nur zwei Wege: er mußte sich ihr fügen oder sie bekämpfen. Ein Compromiß zwischen beiden lag nicht im Bereich der Möglichkeit. Das Einzige deshalb, worauf Maximilian hoffen konnte, war der Erfolg seines eigenen Strebens, daß die Mexikaner nämlich einsehen und erfahren sollten, wie er selber nur das Beste des Landes und der Bevölkerung im Auge habe. Gelang ihm das, so konnte er den Klerus wenigstens isoliren und brauchte ihn nicht mehr zu fürchten.
Unermüdlich war er dabei mit seinen Räthen beschäftigt, um dem Lande nützliche Gesetze und Verordnungen zu geben, die freilich anfangs nur noch auf dem Papier bleiben mußten, aber einmal erlassen auch in nur etwas ruhiger Zeit leicht ausgeführt werden konnten. Auch das Ministerium, das er ernannte, zeugte davon, daß er der liberalen Partei keinen Haß entgegentrug. Wie er selbst an Benito Juarez einen versöhnenden Brief schrieb, der aber von diesem kalt und halb drohend beantwortet wurde, so begünstigte er fast auffallend liberale Persönlichkeiten, und zwar so entschieden, daß man schon anfing, ihm einen Vorwurf daraus zu machen, aber er ließ sich nicht mehr beirren. Er hatte sich einmal seinen Weg vorgezeichnet und glaubte fest, daß es ihm gelingen müsse, sich die Herzen der Mexikaner zu erobern, wenn er ihnen nur erst einmal beweisen konnte, daß es ihm wirklich Ernst sei, dem Lande nicht allein geregelte, unparteiische Gesetze, sondern auch den Frieden zu geben, und dabei das Volk heranzubilden, den Ackerbau zu heben und Künste und Wissenschaften zu unterstützen.
Edle Vorsätze, eines großherzigen Fürsten würdig – aber /50/ wie wenig paßten sie für das mexikanische Volk, für das in völliger Auslösung begriffene Reich!
In der Woche arbeitete Maximilian unermüdlich mit seinen Räthen, revidirte nicht selten in eigener Person die Bureaux und entwarf und berieth neue Verordnungen, oder suchte eine Menge von eingerissenen Mißbräuchen abzustellen; den Sonntag dagegen verbrachte er in Chapultepec und gab dann auch Jedem, der ein dringendes Anliegen an ihn hatte, Audienz.
Damit bürdete er sich freilich eine Last auf; denn gerade in damaliger Zeit trafen eine Menge von Abenteurern in Mexiko ein, die, durch ein aufblühendes Kaiserreich angelockt, diesem ihre oft vollkommen werthlosen Dienste anboten, in der Hoffnung, in kurzer Zeit einen Theil seiner Schätze sich anzueignen, die sie noch aus Montezuma's Zeit vor ihrer Phantasie heraufbeschworen. Daß Maximilian ein anderes Ziel verfolgte, daß er wirklich mit ernstem Willen daran ging, das mexikanische Reich aus der Asche seiner Revolutionen erstehen zu lassen, kümmerte sie wenig genug. Sie wollten allein die Beute theilen, die ihrer Meinung nach dabei abfiel, und um erst festen Fuß im Lande zu fassen, bedurfte es natürlich einer einträglichen Stellung.
An solchen Sonntagen sah aber der Kaiser auch gern einzelne Gäste bei sich, mit denen er dann in freundschaftlichster und ungezwungenster Weise verkehrte. Er liebte ein offenes Wort, wenn es auch nicht immer mit seinen Ansichten übereinstimmte, und wich einer Debatte über streitige Punkte nie aus. Vorzugsweise gern unterhielt er sich aber mit Leuten, die das Land genau kannten, und hatte auch heute wieder Gäste bei sich gesehen.
Es waren Don Jose Fernando Ramirez, der neue Minister des Aeußern, der junge Obrist Lopez und der Erzbischof Labastida zur Tafel gezogen worden. Das Gespräch hatte sich hauptsächlich um die Zustände in den Vereinigten Staaten von Nordamerika gedreht, wo die Südstaaten wieder bedeutende Vortheile errungen haben sollten und jetzt sogar das Capitol von Washington bedrohten. Der Erzbischof schien sich aber nicht besonders wohl in der Gesellschaft zu fühlen; er hatte /51/ gehofft, sich ungestört mit dem Kaiser aussprechen zu können, und dabei störte ihn auf das Entschiedenste Ramirez, früher ein fester Anhänger des Expräsidenten Juarez und ebenfalls an dem Decret betheiligt, das im Jahre 1859 der Kirche fast jede Macht raubte. Bald nach aufgehobener Tafel schützte er Geschäfte vor, befahl seine Carrosse, und fuhr dann in dem mit sechs weißen Maulthieren bespannten Wagen in die Stadt zurück.
Maximilian lächelte, als er es bemerkte, wie Ramirez, sobald sie der Prälat verließ, aus tiefer Brust aufathmete, als ob ihm eine Last von der Seele genommen wäre.
„Sie sind nicht böse darüber, Ramirez," sagte er, „daß uns die „Kirche" verlassen hat, und Obrist Lopez schneidet ebenfalls ein ganz vergnügtes Gesicht."
„Ich muß gestehen, Majestät, daß ich den frommen Herrn lieber gehen, als kommen sehe," sagte Ramirez trocken, „denn Gutes bringt er nie, und da ich genau weiß, daß er mich lieber mit einem Strick um den Hals an einem Baume als in der Stellung sähe, die ich jetzt durch Eure Majestät Huld und Vertrauen bekleide, so - halte ich es immer für besser, ihm aus dem Weg zu gehen, denn vertragen werden wir uns doch nie im Leben."
„Sie thun ihm unrecht, Ramirez."
„Ich glaube nicht, Majestät, und außerdem haben wir einen festen Barometer solcher Gefühle in unserem eigenen Herzen. Haß wie Liebe sind fast immer gegenseitig."
„Glauben Sie wirklich?"
„Haben Majestät das noch nie erprobt? Wenn wir uns zu Jemandem recht innig hingezogen fühlen, so - liegt es entweder in der Zuneigung, die wir ihm entgegentragen, oder in einer Sympathie der Seelen, wer kann cs sagen, aber ein ähnliches, wenn auch vielleicht schwächeres Gefühl dürfen wir gewiß in ihm erwarten."
Der Kaiser war mit Ramirez auf die Terrasse hinausgetreten, die den freien und wunderherrlichen Blick nach den beiden Vulkanen öffnete. Ein Diener brachte auf seinen Wink Cigarren und Licht. Maximilian drehte den Kopf nach dem Saal zurück.
"Lopez," sagte er lächelnd, „ist noch bei den Damen ge-/52/blieben; er erzählt lebendig, und die Kaiserin besonders hört ihn gern von seinen wilden Zügen sprechen. Mexiko war bis jetzt in der That ein Schauplatz für Abenteuer, und ich hoffe nur zu Gott, daß wir im Stande sind, es in eine geregeltere und friedlichere Bahn zu lenken. - Doch wovon wir vorher sprachen - also Sie glauben an Etwas, was ich den „ersten Eindruck" nennen möchte."
„Das thue ich allerdings, Majestät."
„Ich möchte Ihnen fast Recht geben; aber ist es nicht trotzdem ein etwas gefährliches Experiment, gerade zu fest darauf zu bauen?"
„Ich gebe zu," sagte Ramirez, „daß wir oft durch eine glänzende Erscheinung bestochen werden können, aber -"
„Was halten Sie von Miramon?" unterbrach ihn der Kaiser.
„Wie kommen Majestät gerade auf Miramon?" sagte Ramirez, wirklich etwas betroffen, denn an denselben Mann hatte er in diesem Augenblick gedacht.
„Weil Sie von einer glänzenden Erscheinung sprechen. Miramon hat jedenfalls etwas ungemein Edles und Offenes in seinen Zügen. Meinen Sie nicht auch?"
„Ja," sagte Ramirez nach einigem Zögern, indem er langsam den Kopf halb zur Seite wandte; es war fast, als ob er sehen wollte, wer in seiner Nähe wäre. Der Diener aber hatte sich schon wieder zurückgezogen, und die Kaiserin verweilte noch mit ihren Damen und den gewöhnlichen Gästen des Hausstandes, bei denen Lopez zurückgeblieben, im Salon. „Eure Majestät haben Recht; man wird nicht leicht ein Gesicht finden, das so offen den Stempel seiner Seele zu tragen scheint, als gerade bei diesem, in vieler Hinsicht außerordentlich begabten und bevorzugten Mann -"
„Aber?" sagte der Kaiser, „Sie wollten ein „Aber" hinzusetzen, nicht wahr?"
„Ich weiß nicht, Majestät," sagte Ramirez ausweichend.
„Sie trauen ihm doch nicht?"
„Er ist ein treuer uud fester Anhänger des Klerus, Majestät, und die Kirche baut unbedingt auf ihn."
„Aber wie mir gesagt wurde," erwiderte Maximilian und /53/ wandte dabei den Blick ab, „so wechseln die Meinungen und - Parteien hier in Mexiko oft und sehr rasch die Farbe. Ein vollkommen consequentes Ausharren soll wenigstens sehr selten vorkommen."
Ramirez hatte seine Unterlippe mit den Zähnen gefaßt und sah einen Moment still vor sich nieder; der Kaiser war nicht selten in seinen Bemerkungen scharf und fast sarkastisch und er konnte diese recht gut auf sich selber beziehen; ob aber Maximilian fühlte, daß er vielleicht ein wenig zu weit gegangen sei und einen Mann nicht kränken dürfe, von dem er hoffte und wünschte, das schwere Werk eines Staatenbaues unter den jetzigen Verhältnissen zu vollenden, genug er fuhr lächelnd fort:
„Das darf ich ihnen jedoch nicht übel nehmen, denn ich habe selber meine Meinung, wenn ich sah, daß ich im Irrthum gewesen, schon verschiedene Male geändert, ohne mich dessen zu schämen. Ja ich war stolz darauf, wenn ich mir sagen konnte, ich habe es aus innerer Ueberzeugung gethan."
„Majestät verfolgten dabei nicht eigene Interessen," erwiderte Ramirez, der das Zugeständniß rasch fühlte, „aber Sie kennen unser Land doch noch nicht genügend, denn der Ehrgeiz hat hier schon manches sonst wackere Herz verdorben, und Miramon ist - wenn ich seine Gemahlin ausnehme - vielleicht der ehrgeizigste Mann Mexikos."
Der Kaiser lachte. „Also Sie halten die Seňora noch für ehrgeiziger?"
„Das thue ich allerdings," nickte der Minister, „und wenn Majestät meinem Rath folgen wollten, so suchten Sie gerade Miramon jetzt auf kurze Zeit - wenn es nicht anders sein kann - aus Mexiko zu entfernen. Wir sind augenblicklich in einer Entwickelung begriffen, in der wir keine störenden, ja selbst gefährlichen Elemente dulden sollten."
„Und halten Sie Miramon wirklich für gefährlich?"
„Ja -", sagte der Minister nach einer kurzen Pause, „denn der Klerus hat Niemanden weiter, auf den er sich so fest und sicher stützen kann, als auf ihn, sobald er nämlich steht, daß er von der Regierung Eurer Majestät nichts weiter für seine ungerechtfertigten Ansprüche hoffen und er-/54/warten kann. Ich weiß aber, daß Miramon gerade in der letzten Zeit häufige Konferenzen mit Labastida hatte, und was die beiden Herren mit einander verhandelten, ist nicht schwer zu durchschauen."
„Aber was kann ich mit ihm anfangen?" sagte Maximilian, der sich dadurch doch etwas beunruhigt fühlte.
„Geben Sie ihm irgend einen Gesandtschaftsposten in Europa," drängte der Minister, „er wird Mexiko überall würdig repräsentiren und kann dem Lande dort nützen, während er ihm hier -"
„Was wollen Sie sagen?"
„Vielleicht Schwierigkeiten bereitet."
„Ich glaube, Sie sehen zu schwarz, Ramirez" erwiderte Maximilian freundlich. „Besinnen Sie sich, wie wir vorhin über den „ersten Eindruck" sprachen. Ich kann mich nicht erinnern, in Mexiko ein Gesicht gesehen zu haben, das mir bei dem ersten Anblick mehr Vertrauen erweckte, als gerade Miramon's. Er ist jedenfalls ein ungewöhnlich begabter Mensch; und sollte er nicht, als geborener Mexikaner, wenn er sieht, daß Alles nur zum Besten seines eigenen Vaterlandes geschieht, ein vielleicht gefaßtes Vorurtheil fallen lassen und sich mit aufrichtigem Herzen der guten Sache widmen?"
Ramirez schwieg und sah eine Weile sinnend vor sich nieder.
„Es ist möglich, Majestät," sagte er nach einer längeren Pause, „aber es bleibt ein gefährliches Experiment. Nehmen Sie Marquez, den General, der der Kirchenpartei eben so entschieden an- oder vielmehr von ihr abhängt, als Miramon; den würde ich nie im Leben fürchten. Marquez ist vielleicht ein tapferer Soldat, was ich für meine Person aber ebenfalls bezweifle, denn wirklich tapfere Menschen sind nie grausam; aber um Marquez zu gewinnen, giebt es Mittel: Orden, Ehrenstellen, Geld. Miramon dagegen hat schon einmal den höchsten Ehrenposten des Staates inne gehabt, seine Frau war die Erste des Landes einst, und Beide vergessen das nie und nimmer im Leben." /55/
Maximilian schaute sinnend nach dem im vollen Glanz der Sonne liegenden und schneebedeckten Vulkane hinüber, und das Schauspiel dort lenkte bald und rasch seine Aufmerksamkeit von all' den unruhigen Gedanken ab, die ihn bis dahin wohl beschäftigt hatten.
„Oh, sehen Sie, Ramirez," rief er bewegt aus, indem sein Arm sich unwillkürlich den Bergen zu hob - „sehen Sie, wie wunderbar schön und herrlich! Die Sonne nähert sich dem Horizont! Die Kuppen da drüben fangen an zu glühen! Oh, wie wunderbar schön, wie reich und hochbegabt ist dieses Land, und daß nur die Menschen stets den einzigen Mißton darin bilden müssen!"
Einen Moment stand er in bewunderndem Staunen versunken; dann aber drängte es ihn, auch Andere um sich zu haben, die den wahrhaft prachtvollen Anblick mit ihm genoffen.
„Charlotte," rief er nach dem offenen Saal hinüber, „oh, versäumt den Sonnenuntergang nicht - was habt Ihr da drinnen noch im dumpfen Saale, während sich hier das Schönste und Herrlichste entfaltet, was die Welt an Scenerie Euch bieten kann!"
Die Kaiserin war herausgetreten; ihr folgte die übrige Gesellschaft, und still und bewegt sahen Alle nach den fernen, aber in der Abenddämmerung und der reinen Luft scheinbar nahe heranrückenden Bergen hinüber, deren klare Umrisse sich deutlich erkennen ließen und jetzt in den wunderbarsten Farben spielten.
Zuerst, als die Sonne noch nicht den Horizont berührte und nur hinter den Dunstkreis der Erde trat, zog sich ein leises, kaum merkliches Rosa über die beiden weißen Höhen des spitz auflaufenden Popocatepetl wie der links davon ruhenden, breit ausgedehnten „weißen Frau", dem Ixtaccihuatl, und täuschend wirklich war jetzt die Ähnlichkeit mit einer auf dem Rücken liegenden, von einem riesigen weißen Tuch überdeckten und lang ausgestreckten weiblichen Gestalt - aber immer glühender wurden die Farben, immer schärfer hoben sie sich vom dunkelblauen Hintergrund des östlichen Himmels ab; und lautlos - kaum athmend, stand der junge Kaiser /56/ und schwelgte in dem wunderbaren Schauspiel, das sich dort ihm bot.
Vor ihm ausgebreitet lag die Hauptstadt des Reiches, mit ihren Kuppeln und Thürmen, dahinter dehnten sich die noch in der Sonne blitzenden Seen; aber das Auge suchte nichts weiter, als die glühenden Kuppen der beiden Vulkane, die in fast überirdischer Pracht jetzt selber Feuer auszustrahlen schienen, während aus den von der Sonne nicht mehr erreichten Klüften der Kolosse milchweiße, ebenfalls von rosigem Licht übergossene Nebel aufstiegen, und wie sie entstanden, sich in phantastische Formen und Gruppen bildeten.
Und wieder wechselte das Farbenspiel; tiefer und tiefer sank die Sonne, und wie ein Schleier zog es sich aus der Tiefe herauf, wuchs höher und höher, bis es die Kuppen der Berge erreichte und bleigrau färbte, während die Nebelstreifen darüber noch für Momente ihren Duft bewahrten. Jetzt schwand auch der, die Berge schienen in der rasch einbrechenden Nacht zu vergehen, denn nur noch unvollkommen ließen sich ihre Umrisse erkennen, bis die Nacht völlig einbrach, die Kuppen beider Berge ganz plötzlich wieder zu strahlen anfingen und nun mit fast blendend weißem Schein herüberleuchteten.
Es lag etwas Geisterhaftes in diesem Anblick, und während die Damen mit einander zu flüstern anfingen, und das Bedürfniß fühlten, ihre Gedanken gegenseitig auszutauschen, stand Maximilian noch immer in stillem Anschauen versunken, und konnte sich nicht losreißen von dem Schauspiel.
Aber es war spät geworden, die Luft wehte kühl von den schneeigen Kuppen herüber, und da sich Maximilian heute nicht mehr in der Stimmung fühlte, ein politisches Gespräch wieder aufzunehmen, verabschiedete er sich mit einer freundlichen Handbewegung von seinen Gästen und schritt allein in das Schloß zurück. Aber auch dort litt es ihn nicht lange: die Mauern beengten ihn, und seinen Hut ergreifend, stieg er, von keinem Diener begleitet, allein den Schloßberg hinab, um dort, im Schatten der mächtigen Cedern, die am Fuß desselben standen, seinen eigenen Gedanken ungestört nachzuhängen.
Und wie still die Welt da unten lag, wie still und ausgestorben fast, während doch früher in diesem heiligen Hain /57/ Leben und Freude geherrscht hatte, und all' die Fürsten dieses Landes unter ihnen wandelten - bis sie ihr Geschick erreichte.
Schon zu Montezuma's Zeiten fingen diese Bäume mit ihren Aesten die Brise und rauschten im Abendwind; dort drüben hatte der unglückliche Kazike, dessen schönes Land die Fremden mit dem Kreuz und Schwert verwüsteten, seine Bäder. Nach ihm bauten die spanischen Vicekönige ein festes Schloß auf diesen Hügel, und hier wohnte nach ihnen Iturbide, der erste Kaiser dieses Reiches, und wie endete er! Wie oft mag auch er, mit Träumen von Glück und Macht, unter diesen Bäumen gewandelt sein, bis er entthront, verurteilt, dem eigenen Volk zum Opfer fiel, - und doch hatte er gerade das mexikanische Volk von dem spanischen Joch befreit. Und nach ihm all' die Präsidenten, die hier gehaust. War denn auch Einer nur von allen im Stande gewesen, dem schönen Lande den Frieden zu geben und Ruhe und Eintracht in das Volk zu bringen? Und würde i h m das jetzt gelingen, ihm, dem Fremden, der aus weiter Ferne, aus glücklichen Verhältnissen heraus, herüber kam an diese Küste?
Es war wohl ein heimlicher, aber nicht günstiger Platz zum Nachdenken über die Zukunft Mexikos, denn nur Blut und Zwietracht zeigte die Vergangenheit, und klagend rauschte dazu das Laub durch jene Aeste.
Maximilian warf sich unter dem stärksten der Bäume, den Kopf in die Hand gestützt, auf die Erde nieder, und trübe Bilder und Ahnungen stiegen in dieser Umgebung, und von dem Dunkel der Nacht gezeugt, vor seiner Seele empor. Im Geist sah er die blutigen Gestalten vergangener Zeiten an sich vorüberschreiten, den königlichen Indianer, den bleichen Iturbide13, den tapfern Kämpfer für Freiheit und Unabhängigkeit des Landes, Guerrero, und wie die Schatten - still und geräuschlos in duftiger Form - strichen sie an seinem innern Blick vorbei. Da - hatten sie Leben und Gestalt gewonnen? - er hob überrascht den Kopf und richtete sich mit klopfendem Herzen empor; deutlich vernahm er den langsam gemessenen Schritt eines Wandelnden im Laub und glaubte flüsternde Stimmen zu hören. Wer war das? Die Straßen um Mexiko galten für nichts weniger als sicher; hatte sich Raub-/58/gesindel selbst bis dicht an das Schloß gewagt? Und nicht einmal eine Waffe führte er bei sich.
Wie sein Blick an das Dunkel gewöhnt, die Nacht durchspähte, erkannte er zwei Gestalten, die langsam unter den Bäumen dahinschritten, von seiner Nähe aber keine Ahnung zu haben schienen. Sie unterhielten sich in halblautem Ton mit einander und blieben, im Eifer des Gesprächs, unfern von ihm stehen. Jetzt bewegten sie sich weiter. Maximilian rührte sich nicht; er wollte hier nicht gesehen sein, noch dazu, da er gar nicht wußte, mit wem er es zu thun hatte. Gerade unter der Gruppe der starken Bäume schritten sie hin, kaum wenige Ellen an ihm vorüber, und der Kaiser glaubte in dem langen Gewand des Einen einen Geistlichen vermuthen zu dürfen. War es sein eigener Kaplan, und mit wem unterhielt er sich hier in dunkler Nacht?
Wieder blieben die beiden Männer stehen, und der eine sagte jetzt, - noch immer nicht laut, aber in der kurzen Entfernung doch deutlich vernehmbar:
„Er muß sich fügen; der Klerus hat ihn hierher gerufen, und er kann ihn nicht abschütteln, ohne die Krone selber mit abzuwerfen."
„Und um was sind wir gebessert, wenn Juarez zurückkommt?" entgegnete der andere. „Maximilian kann mit der Zeit so weich wie Wachs werden, der Indianer dagegen ist hart wie Stein und eben so störrisch wie spröde."
„Wir brauchen weder den Einen noch den Andern," lautete die Gegenantwort. „Will das Volk absolut einen Kaiser, gut, so mag es ihn haben, ob er Maximilian oder Miramon heißt, bleibt sich gleich. Die Kirche kann und will sich ihre Rechte nicht vergeben, und wen wir nicht halten, der muß fallen."
Wieder schritten die Beiden vorüber, und die Worte, die sie jetzt mitsammen wechselten, konnte Maximilian nicht mehr verstehen; aber verschwunden waren auch in dem Moment die dunkeln Bilder, die bis dahin seine Seele erfüllt. Fast drohend blitzte sein Auge durch die Nacht, und einmal war es, als ob er aufspringen und den beiden Gestalten folgen wolle, um selber zu sehen, wer jenes übermüthige Wort ge-/59/sprochen. Aber weshalb? Er wußte, es war die Stimme des ganzen Klerus, die Gesinnung Roms, die er hier unter Montezuma's Cedern vernahm, und als er endlich langsam vom Boden wieder aufstand, hob sich seine Gestalt zu ihrer vollen Höhe, und mit einem leichten sarkastischen Lächeln um die Lippen murmelte er, als er den Ausweg zum Schloß wieder einschlug:
„Non possumus, Seňores.14“
4.
Die Kirche und ihre Söhne.
Mexiko hatte ein Kaiserreich erhalten - zwar nicht einen Kaiser, wie man ihn damals in Iturbide nur flüchtig und unvollkommen aus einem General gemacht, sondern einen wirklichen, eigenen Fürsten; und all' der Glanz und Prunk, mit blitzenden Uniformen, Orden, Bällen, brillanten Festen und Umzügen, war auf die Hauptstadt ausgeschüttet worden. Kein Wunder denn, daß sich die Bewohner derselben wohl darin fühlten, und es gab auch anscheinend wenigstens in dieser Zeit nur noch zwei Parteien im ganzen Lande: Kaiserliche und Republikaner, und die letzteren waren in verschwindender Minorität - und waren selbst diese letzteren wenigstens einig unter einander?
Fast täglich liefen Gerüchte ein, daß sich wieder ein oder der andere der Juaristischen Bandenführer von dem vertriebenen Präsidenten losgesagt habe und zu der kaiserlichen Partei offen übergetreten sei, und wenn man alledem glauben wollte, was man sich in der Residenz erzählte, so befanden sich die nördlichen Streitkräfte des Expräsidenten in voller Auflösung.
Aber auch in der Hauptstadt und zwischen der „kaiserlichen Partei" fingen kleine Zerwürfnisse an sich zu zeigen, die be-/60/sonders zwischen den Franzosen und den Beamten des Kaiserreichs begannen. Die Festlichkeiten des Empfangs waren kaum vorüber, so traten Symptome an's Licht, die kein so inniges Zusammenwirken verriethen, als man es hätte zwischen Franzosen und Oesterreichern voraussetzen sollen, und doch waren sie natürlich genug. Die Oesterreicher nämlich fingen an, sich als Herren des Landes zu betrachten, und die Franzosen , die sich darüber ärgerten, suchten sie fühlen zu lassen, daß sie das nur durch ihren Beistand wären und sein könnten. Selbst von den höchsten Kreisen ging ein solches Gefühl aus und pflanzte sich bis in die untersten Schichten hinab fort - und gerade deshalb so rasch und entschieden, weil es eben von oben kam und dadurch leichter Alles erfaßte.