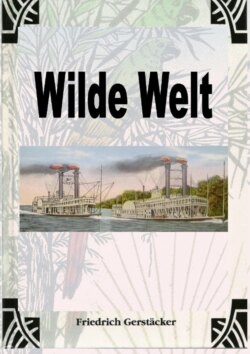Читать книгу Wilde Welt - Gerstäcker Friedrich, Jurgen Schulze - Страница 1
ОглавлениеGesammelte Schriften
von
Friedrich Gerstäcker.
Zweite Serie.
Vierter Band.
Volks- und Familien-Ausgabe.
Wilde Welt
Gesammelte Erzählungen
von
Friedrich Gerstäcker.
___
Jena, Hermann Costenoble
Friedrich-Gerstäcker-Gesellschaft e.V., Braunschweig
Ausgabe letzter Hand, ungekürzt, mit den Seitenzahlen der Vorlage
Friedrich-Gerstäcker-Gesellschaft e.V., Braunschweig, 2020
Unterstützt durch die Richard-Borek-Stiftung und
Die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, beide Braunschweig
Friedrich-Gerstäcker-Gesellschaft e.V. und Edition Corsar
Geschäftsstelle: Am Uhlenbusch 17, 38108 Braunschweig
Alle Rechte vorbehalten! © 2020
In den Pampas.
Geschrieben 1864 für Jugend-Album. Blätter zur angenehmen und lehrreichen Unterhaltung im häuslichen Kreise.Hallberger, Stuttgart. Laut eigenhändigem Werksverzeichnis vorgesehen für den Sammelband Buntes Treiben unter dem Titel Die Pampas-Indianer.
I.
Ueber die Steppe brauste der Pampers. Scheu duckte sich das Wild in's hohe Gras, das einem wogenden See fast täuschend ähnlich sah; die Heerden drehten dem Sturm das Rücktheil zu, senkten die Köpfe und schlossen vor den peitschenden Tropfen die Augen. Nur der Strauß kauerte sich, der Windsbraut gerade entgegen, dicht auf den Boden nieder, streckte den langen Hals voraus, den Kopf unter irgend einem Grasbüschel bergend, und ließ das Wetter über seine dicht angeschmiegten Federn ziehen.
Der Himmel war schwarz umzogen, grelle Blitze zuckten oft durch die düsteren Wolkenschleier, und von Zeit zu Zeit schlug ein schwerer Schauer auf den Boden nieder, unzählige kleine Lachen bis zum Rande füllend.
Ueber die Steppe, mit dem Sturme, brausten auf schäumenden, keuchenden Rossen zwei Reiter - wilde, abenteuerliche Gestalten wie die Scenerie, die sie umgab, und prächtig zu ihr passend.
Der Eine von ihnen war ein Indianer, der Andere ein Weißer - ein Gaucho oder Eingeborener des Landes, nur von weißen Eltern abstammend, aber Beide hatte die Steppe groß gezogen, Beide hatten von Jugend auf die freie grüne /2/ Ebene um sich gesehen und mit Bolas1 und Lasso das scheue Wild gejagt, und Beiden war das wackere Roß, das sie im Fluge über die Ebene trug, so unentbehrlich znm Leben geworden, daß sie sich eine Existenz außer dem Sattel kaum noch denken konnten.
Beiden Reitern, dazu gleich abgehärtet gegen Wind und Wetter, wie sie waren, schien das Element, in dem sie sich bewegten, gerade wie eigens für sie gemacht, und doch hatten Beider Sphären bis noch vor wenigen Tagen weit, weit auseinander gelegen.
Don Diego war einer edlen Familie entsprossen, die noch jetzt in Montevideo die höchsten Ehrenstellen bekleidete, und wenn auch in den Pampas erzogen, hatte er doch in Montevideo selber eine so gute und tüchtige Erziehung genossen, wie sie ihm Südamerika nur bieten konnte. Sein Begleiter dagegen, Osantos, ein Häuptling der früher mächtigen Nybygaren, war ganz und durchaus ein Wilder, von der mit einem wollenen Tuch umwundenen Stirn bis zu den Zehen nieder, /3/ die in der von einem Pferdebein gestreiften Haut staken. So verschieden sie aber sonst auch handeln und denken mochten, in diesem Augenblick schien Beiden ein gemeinsames Ziel gesteckt, und dicht neben einander hin brausten die Pferde, und schnaubten mit den Nüstern, wenn ein grellerer Blitz als vorher aus den Wolken zuckte und schmetternder Donner prasselnd hinterdrein über die Steppe brach.
Der Abend dämmerte schon - lange Reihen von Wildenten strichen schwirrend an ihnen vorbei - ein paar Mal schreckte ein Kasuar dicht vor den Hufen ihrer Pferde auf, daß die Thiere scheu zur Seite stoben, oder ein Hirsch fuhr aus seinem Bett empor und floh in weiten Sätzen die Steppe entlang. Aber keiner der Reiter drehte auch nur den Kopf nach dem Wild. Ihre Ponchos um sich her geschlungen, die Zügel fest in der Faust, mit scharfem Blick dabei am Boden spähend, die vielen kleinen Erdlöcher zu vermeiden, die der dachsartige Viscacho in die Erde gegraben, flogen sie dahin, kein Wort mitsammen wechselnd, bis ihnen plötzlich aus der Ferne einige matte Lichtstrahlen entgegenfunkelten.
Beide hatten die glänzenden Punkte zugleich gesehen - Beide zügelten zugleich ihre Pferde ein, und der Indianer, mit seiner langen Lanze dorthinüber deutend, sagte in spanischer, nur wenig gebrochener Sprache:
,,Dort, Don Diego - dort liegt Eruzalta - Ihr könnt den Weg dahin nicht mehr verfehlen - haltet Ihr Euch aber noch ein klein wenig mehr links, so trefft Ihr die Räderspuren der letzten Mendoza-Caravane, die gerade darauf zuführen."
„Und Du willst jetzt zurück, Osantos?"
„Noch nicht," lachte der Wilde. „Erst denke ich mir den Platz da drüben einmal selber ein wenig anzusehen - aber wir dürfen nicht Beide zusammengetroffen werden."
„Nimm Dich in Acht. So viel ich weiß, liegt argentinisches Militär darin," warnte ihn sein Gefährte.
„Und wenn auch,", zischte der Wilde, während sein Auge glühte. „Sie müssen rasch in den Sätteln sein, wenn sie dem Strauß der Pampas in der Nacht folgen wollen - und in den Bereich meiner Bolas wagen sie sich doch nicht." /4/
„Aber sie führen Gewehre."
„So viel für ihre Gewehre," knurrte der Indianer finster vor sich hin. „Im Dunkeln, wenn ich die Gestalt sehe, treffe ich mit meiner Bolas den Punkt - die Gewehre schießen vorbei am Hellen Tag. Habt keine Sorge um mich, Seňor - ich bin mit meinen Leuten an dem bestimmten Ort und zur rechten Zeit."
„Aber ich kann Dir bessere Nachricht bringen, wie Du selber je im Stande wärst, sie Dir zu holen," rieth noch einmal der Weiße ab, „und wenn sie Dich fingen, wäre unser ganzer Plan mißglückt."
„Mich fangen?" - lachte der Wilde, nur bei dem Gedanken an eine solche Unmöglichkeit - „sie sollen's versuchen. - Nein; ich will selber sehen - und jetzt genug. Hei! wie das stürmt, als ob es die Pferde vom Boden heben und mit fortreißen wollte. Aber gut - gut - bei solchem Wetter liegen die argentinischen Schufte bei ihrem caňa in den Pulperien2 und durch die Fenster kann man ihre Köpfe zählen. - Auf Wiedersehen, Seňor - und nehmt Euch selber in Acht, daß sie in Euch nicht den Unitarier erkennen. Ihre Messer sind scharf, ihre Hand ist schnell - und Rosas liebt die rothe Farbe des Blutes."
„Den Tod über sie; ich fürchte sie nicht," zürnte der Reiter, fast unwillkürlich aber dabei nach der eigenen Waffe, seinem Messer, greifend, ob sie noch zum Gebrauch bereit säße - „auf Wiedersehen denn, Osantos - doch ich kann Dir keine Zeit bestimmen."
„Vergeßt das Zeichen nicht," mahnte der Indianer.
„Bei dem Wetter aber zieht der Rauch am Boden hin!" rief Diego.
„Der Pampero hat bald ausgetobt," sagte der Wilde - „schon dreht er sich nach Süden herum. Morgen früh weht kein Luftzug."
„Desto besser dann, und nun a Dios, Compaňero," und mit den Worten preßte er die Flanken seines treuen Thieres, /5/ das scharf mit den Nüstern schnaubend den schönen Kopf auf und nieder warf. Und über die Steppe hin flog der Reiter, den fernen Lichtern entgegen, die ihm durch den dämmernden Abend entgegen funkelten.
Still und regungslos in dem Sturm hielt dagegen der Indianer, den Blick auf die Gestalt des Reiters geheftet, so lange er ihr in der Nacht mit den Augen folgen konnte. Sein brauner, mit weißen und schwarzen Fäden durchwebter Poncho schlug und flatterte im Winde, und wild und wirr peitschte ihm das lange nasse Haar um die Schläfe. So arg tobte dabei der Sturm über die Steppe, daß er die wohl vierzehn Fuß lange Rohrlanze nicht einmal gerade emporhalten konnte und sie vor dem heulenden Orkan senken mußte. Aber das Alles kümmerte ihn wenig genug, denn seit seiner Kindheit war die Steppe seine Heimath, und er mit allen ihren Freuden und Schrecken von Jugend auf so vertraut geworden, daß er den rasenden Pampero so wenig achtete, wie den leisen Südostwind und tiefblauen Himmel. Er kam eben und brauste vorüber - Pferd und Reiter wandten ihm nur den Rücken und ließen ihn seine Wuth an dem wehenden Grase der Pampas verschwenden - nicht einen Zoll breit konnte er sie von ihrer Stelle rücken.
Eine volle Stunde blieb er so halten wie eine dunkle, aus schwarzem Marmor gehauene Statue; der Regen peitschte nieder und der Donner rollte, die ganze Natur schien in Aufruhr - aber er rührte und regte sich nicht, und selbst das Roß schien sich endlich, so ungeduldig es im Anfange in sein Gebiß geschäumt, diesem regungslosen Ausharren ergeben zu haben. Es senkte den Kopf und lehnte sich gegen den Wind, das Zeichen des Reiters erwartend , wenn sie ihre dunkle Bahn fortsetzen wollten.
Endlich schien Osantos die rechte Zeit gekommen, das Lager seiner weißen Feinde zu besuchen. Langsam griff er die Zügel wieder auf, und nach seinen Waffen fühlend, nach Lasso und Bolas, ob beide zum Griff bereit säßen, und das Messer bequem im rauhen Bota oder Stiefel stecke, zog er dem kleinen Ort Cruzalta in einem leichten Trab entgegen. /6/
II.
In Cruzalta herrschte ein lebendiges Treiben. Der Ort bestand allerdings nur aus wenigen einzelnen niedrigen Hütten - Häuser, wie man sie dort nannte, aus sonngebrannten Lehmsteinen aufgebaut und fast alle mit Rinder- und Pferdehäuten gedeckt, und die Bevölkerung war sonst dünn genug. Die neuen Ausbrüche der im Süden wohnenden Indianer-Horden hatten aber die ganze Argentinische Republik in Aufregung gebracht, und während der Krieg gegen die sogenannten ,,Unitarier" in Montevideo fortwüthete, wurden Detachements argentinischer Kavallerie überall in die kleinen Orte an der Poststraße zwischen Buenos Ayres und Mendoza, am Fuße der Kordilleren, gelegt, um die blutdürstigen und raubgierigen Schaaren der Wilden wenigstens abzuhalten, diese Linie zu durchbrechen und das bebaute und reiche Land im Norden zu überfallen.
Eme wirklich malerische Schaar war diese argentinische Reiterei, die auch den Kern der südamerikanischen Truppen bildet. Sie trugen dunkelblaue Ponchos mit weißen Randstreifen und brennend rothem Futter - eben solche Mützen mit langen Zipfeln, die um den Kopf herumgelegt und vorn befestigt sind - gleiche Cheripas3 und weiße befranste Leggins oder Unterhosen; dabei als Waffen: Karabiner, ihre langen Messer, den Lasso, und ein Theil derselben auch Lanzen, um den wilden Horden, mit denen sie zu kämpfen hatten, völlig gewachsen zu sein. Und wahrlich, sie waren es in jeder Hinsicht: weiße Indianer, die sich nur in der Hautfarbe, Uniform und Disciplin von ihren rothen Brüdern unterschieden -, aber sonst ebenso im Sattel daheim – ebenso /7/ ein wildes, abenteuerliches Leben gewohnt, eben so mäßig in ihren Bedürfnissen, eben so blutdürstig und rachsüchtig in ihren Sitten, diese wilden Gauchos4 der Pampas, aus denen Rosas, der Dictator der Argentinischen Republik, seine Truppen wählte - aus deren Mitte er selber zum Thron der Republik - die wirklich nur im Spott eine solche genannt werden konnte - emporgestiegen.
Mit dem eisernen blutgefärbten Scepter, das er führte, hatte er bis jetzt auch gewußt, die Indianer, theils sie zu seinen revolutionären Zwecken benutzend, theils ihnen die volle Macht zeigend, im Zaum und entfernt von den Ansiedelungen zu halten. In letzter Zeit aber waren die braunen Horden wieder vom Süden heraufgekommen und hatten Raubzügc selbst bis in die Provinz Buenos Ayres unternommen, bei denen sie die Heerden zerstreuten oder mit sich führten, die Wohnungen plünderten, die Männer tödteten und junge Frauen und Mädchen in Gefangenschaft schleppten.
Das Gerücht ging dabei, daß sich Einzelne der zersprengten Unitarier ihnen nicht allein angeschlossen, sondern sie von Anfang an aufgehetzt hätten, die Republik zu überfallen und Rosas' Soldaten auswärts zu beschäftigen. So wollte man auch Weiße an ihrer Spitze gesehen haben, ihre Ueberfälle zu leiten; und die Punkte, die sie dazu gewählt, rechtfertigten allerdings den Verdacht, daß sie nicht eben nur auf's Gerathewohl in die Ansiedelung brächen. Und konnte sich Rosas deshalb beklagen? Er hatte mit allen Mitteln, die ihm zu Gebote standen, die ihm feindlichen Unitarier unterjocht und vertilgt. Messer und Blei hatte zwischen ihnen gewüthet, Blut war in Strömen geflossen, und die Banden seiner Henker durchzogen Monate lang Stadt und Land, in die ihnen bezeichneten Familien einzubrechen und ihre Opfer, oft am eigenen Herde, abzuschlachten. Die Unitarier übten da nur Vergeltungsrecht, /8/ und während Buenos Ayres vor dem Tyrannen zitterte und keiner Klage Laut zu geben wagte, trotzten sie ihm noch in Montevideo, oder durchstreiften einzeln und flüchtig das Land, die Bevölkerung aufzureizen, ihre Ketten endlich - endlich einmal abzuschütteln.
Wehe dem freilich, der in Rosas' Hände fiel; sein Tod war schnell besiegelt und Erbarmen nicht zu hoffen. Aber diese Männer kannten auch die Gefahr, die jeden ihrer Schritte bedrohte , und wußten ihr zu begegnen oder auszuweichen, und rüstig und unverdrossen arbeiteten sie der Zeit entgegen, in der sie das furchtbare Joch abschütteln und wieder frei würden aufathmen können in dem schönen Lande.
Don Diego gehörte zu der kleinen Zahl dieser wackeren Streiter, die, das eigene Leben nicht achtend, sich mitten zwischen die Späherbanden des Dictators hineinwagten, nicht allein die wahre Gesinnung der Argentiner kennen zu lernen, nein, auch den Tag des Ausbruchs zu beschleunigen. So mit all' dem kühnen Unternehmungsgeist seiner Jahre, von jung auf an ein bewegtes und oft gefährliches Leben gewöhnt, und von einem Haß gegen den Usurpator erfüllt, wie wohl Viele einen ähnlichen, aber Keiner einen heftigeren in sich trug, war Don Diego fest entschlossen, seinen Plan durchzuführen oder dabei selber unterzugehen.
Sein Bruder war schon im Kampf gegen Rosas geblieben; sein Schwager, der Gatte seiner Schwester, von Jenes Henkersknechten heimlich in Buenos Ayres überfallen und ermordet worden. Selbst sein Vater war damals nur mit genauer Noth den schon nach ihm ausgesandten Blutrichtern entgangen, und er hatte geschworen nicht eher zu ruhen und zu rasten, bis er die Ketten gebrochen hätte, die sein Vaterland umschlangen.
Die Gefahren, die sich ihm dabei entgegenstellten, ermaß er, wie schon angedeutet, nur zu wohl; er wußte aber ebenso, daß mit gewöhnlichen Mitteln nichts gegen den Dictator auszurichten sei, so geheim wie dieser seine Pläne nur mit sich selbst berieth, so vollständig abgeschlossen, wie er sich kaum je dem Volke zeigte, nur durch blutige grausame Thaten zu ihni sprechend und durch die Furcht, die Alles erfüllte, ununterbrochen Alle niederhaltend. Diese Pläne mußten jetzt erforscht /9/ werden, - mit welchen Mitteln immer, das blieb sich gleich. Dann sollte das Volk gegen seinen Bedränger aufgestachelt und Schlag auf Schlag gegen ihn geführt werden, bis der Tyrann erlag und die mißhandelten Provinzen wieder frei aufathmen konnten.
Aber nicht das allein hatte Don Diego diesmal nach Cruzalta geführt. In Buenos Ayres hatte eine von Frankreich stammende und seinen Eltern befreundete Familie gelebt, die, wie man durch einen Kundschafter in Montevideo erfuhr, sei's durch ihren Reichthum, sei's durch ihre Gesinnung, den Argwohn des allmächtigen Rosas wach gerufen. Diese sollte gewarnt werden, und Don Diego hatte es in keckem Jugendmuth unternommen, sich mitten unter die Creaturen Rosas' hineinzuwagen. Aber er kam zu spät: der Schlag war schon gefallen, Vater und Sohn von den Mashorqueros ermordet worden, die Mutter vor Gram und Entsetzen gestorben und das Haus, auf dem der Zorn des Dictators lag, verödet. - Das ganze Geschlecht war jedoch nicht ausgestorben. Heimliche Freunde gaben Don Diego die Kunde, daß noch ein Mitglied am Leben sei, eine Tochter, die kürzlich von Frankreich aus einer Erziehungsanstalt zurückkehrte. Rosas aber habe sie aus Buenos Ayres hinweg und in das Innere des Landes schaffen lassen - wohin, das wußte Niemand. Ja es wagte auch Niemand zu forschen. Auf wen der Dictator seine Hand gelegt, der galt ja doch für verloren.
Don Diego hatte daraus das Innere des Landes sowohl dieses Mädchens wegen durchstreift, als auch um seine schon lange gehegten Pläne gegen den Tyrannen in's Werk zu setzen. Mit Geld reichlich versehen und sich auf sein eignes Selbst, seinen frischen, fröhlichen Muth verlassend, brach er heimlich von Buenos Ayres auf. Aber vergebens durchstöberte er die ganze Gegend bis San Luis. Dort wurde er von Einem von Rosas' Leuten, einem früheren Bundesgenossen, erkannt und verrathen. Mühsam entging er durch die Flucht den nach ihm ausgesandten Henkern.
Wenn er nun freilich vor der Hand die Hoffnung aufgeben mußte, das verwaiste Mädchen zu finden und zu befreien, so hatte er doch mit Jubel den allgemeinen Haß wahrge-/10/nommen, der überall gegen den Dictator in der Bevölkerung herrschte. Gelang es, diesen Haß zu entfesseln, so war Don Diego überzeugt, das ganze Land werde sich erheben. Nur auf den Anlaß dazu kam es an und auf das Auffinden der ersten Mittel des Aufstandes. In dieser Absicht hatte sich Diego wieder nach Buenos Ayres begeben, als er unerwarteter Weise auf einer einzelnen Estancia die Kunde erhielt, daß das von ihm ohne Erfolg gesuchte Mädchen auf des Gouverneurs Befehl nach Cruzalta, einem kleinen Städtchen der Pampas, gebracht worden sei. Dort also lag jetzt sein Ziel, und von früher her mit den Sitten der neuerdings wieder gegen Rosas ausgebrochenen Indianer bekannt, wagte er es sogar, diese wilden Horden in ihren geheimsten Schlupfwinkeln aufzusuchen. Er wußte, wie wenig er sich für jetzt noch auf den Beistand der Weißen verlassen konnte. Eher war auf die Hülfe der Indianer zu rechnen.
Diese Hülfe war ihm denn wirklich durch einen der verwegensten ihrer Häuptlinge, durch Osantos, zugesichert worden, und so kühn der Plan auch sein mochte, den sich Diego ausgesonnen, so fühlte er sich demselben doch völlig gewachsen und Kraft und Muth genug, ihn durchzuführen.
Zu schärferem Ritt spornte er nun sein müdes Thier; er fühlte den Sturm nicht, der ihn umtobte, nicht den Regen, dessen kalte Tropfen an seine fieberheißen Wangen schlugen. Vorwärts! Dort drüben, wo die Lichter blinkten, lag sein Ziel, und dem strebte er mit aller Hast entgegen - wäre es auch nur gewesen den Gedanken zu entfliehen, die ihm zuweilen Herz und Kopf verwirren, betäuben wollten.
Der Weisung des Indianers folgend, erreichte er endlich die Spuren der Lastwagen, und wenn es auch indessen viel zu dunkel geworden war, sie zu erkennen, witterte doch das kluge Thier die Fährten, und trabte schärfer aus, den Reiter los zu werden und seine Freiheit für die Nacht zu erhalten. Stall und Futter hatte es doch nicht zu erwarten, denn die freie Pampas war jede Nacht sein Bett wie sein gedeckter Tisch.
Deutlicher wurden die Lichter - schon ließen sich lachende und singende Stimmen unterscheiden, und wenige Minuten /11/ später erreichte Don Diego die ersten Gebäude der kleinen, aber breiten Hauptstraße von Altacruz, in welcher er indessen keinem einzigen menschlichen Wesen begegnete.
Der Sturm hatte Alles in die Häuser getrieben, und das Lager jener Soldaten, die nicht unter ein festes Dach und Fach gebracht werden konnten, war auf der Südseite des kleinen Ortes nothdürftig aus rasch aufgeworfenen Erdwällen und rohen Häuten hergestellt.
Die kleinen Häuser standen allerdings fest verschlossen; aus den engen vergitterten Fenstern schimmerten aber die Lichter vor, und aus dem größten von ihnen tönten, trotz dem heulenden Sturm draußen, der über die Pampas fegte, die munteren Laute einer Guitarre und die schrille Stimme eines Sängers, die oft von lautem Lachen unterbrochen wurde.
Sorgloses Volk, das mitten in es umgebenden Gefahren seinen heitern, kecken, vielleicht auch nur leichten Sinn bewahrte. Draußen an etwas geschützten Plätzen waren fortwährend Pferde angebunden, bei der ersten Alarmirung bereit und beritten zu sein; in den Ecken der Gebäude, nahe zur Thür, standen die Waffen, und Lebensmittel hingen gepackt an ihren recados oder Sätteln - aber indessen tanzten und sangen sie, und was die nächste Stunde brachte, mochte die nächste Stunde auch bekämpfen - die jetzige gehörte noch der Lust.
Selten wählten die Indianer übrigens die Nacht zu ihrem Angriff, fast nie den Abend, und gewöhnlich brachen sie, wenn sie irgend einen Ort überfallen wollten, mit der frühen Morgendämmerung auf den Feind herein. In Cruzalta fürchteten die Bewohner aber kaum etwas Derartiges, wenn sie auch auf Alles gerüstet blieben, denn der kleine Trupp Militär, der bei ihnen lagerte, sollte die wilden Horden wohl abhalten, hierher ihren Zug zu richten, scheuten sich die Indianer doch vor den Feuerwaffen.
Vor der Pulpcria des Ortes hielt der nächtliche Reiter, und während er draußen mit der revenca5 an die Thür /12/ klopfte, rief er als Gruß die frommen Worte: Ave Maria -
„purisima!" lautete die Antwort von innen heraus, und gleich darauf wurde die Thür geöffnet. Der Reiter sprang vom Pferd, und Sattel und Zaum abnehmend, ließ er sein Thier, ohne sich weiter darum zu kümmern, mitten in der Straße frei. Er wußte, daß er es am Morgen auf dem nächsten Weideplatz schon wieder finden würde.
III.
Im ersten Augenblick schwieg der Lärm bei dem Eintreten des Gastes, denn ein Fremder war, noch dazu in dieser Zeit, eine viel zu seltene Erscheinung in den Pampas, ihm nicht die ganze Aufmerksamkeit zuzuwenden.
„Gott zum Gruß," sagte dieser aber, ohne sich weiter viel um die Insassen zu kümmern - „hier, Frau Wirthin, habt die Güte und gebt diesem Poncho einen Platz an irgend einem Feuer, denn er ist vollständig durchgeweicht, und für die Nacht werdet Ihr doch kein anderes Bett für mich haben. Bis dahin möcht' ich ihn trocken wissen."
„Nicht einmal einen Platz, wo Ihr Euch ausstrecken könntet, Seňor, findet Ihr im Haus," klagte aber die Wirthin - „Alles haben die Herren Soldaten besetzt bis in den letzten Winkel."
„Caramba, Seňora, Ihr werdet einen armen Teufel bei solchem Wetter nicht wieder in das „campo" hinausjagen wollen," lachte dagen der Fremde. „Die Herren Soldaten werden zurücken, denn ich gehe einmal nicht wieder fort. Cada uno pura si, y Dios para todos," und mit diesen Worten warf er seinen Poncho ab, unter dem die reiche, malerische Tracht eines jungen wohlhabenden Gaucho zum Vorschein kam.
Er trug die Cheripa, wie alle Anderen, aber vom feinsten buntgewirkten Stoff, und an dem breiten, mit reich verzierten /13/ Taschen versehenen Gürtel, der sie zusammenhielt, waren so dicht beisammen gehenkelte Doublonen und spanische Dollars befestigt, daß man die Stickerei darunter kaum erkennen konnte. Sein langes, hinten im Gürtel steckendes Messer zierte ein mit Gold eingelegter Elfenbeingriff, und die kurze Sammtjacke war mit runden Silberknöpfen dicht und reich besetzt.
Sein Gesicht hatte dabei etwas Edles und Kühnes, und als er den breiträndigen Panamahut abnahm, auf den Tisch warf und dann die Regentropfen aus dem rabenschwarzen lockigen Haar und dem vollen gekrausten Bart schüttelte, flüsterten die Mädchen mit einander und Don Diego konnte sicher sein, daß er den schönen Theil der Versammlung schon ganz auf seiner Seite hatte.
Der Officier des kleinen Reitertrupps, der hier auf nichts weniger als kriegerische Weise mit drei jungen reizenden Mädchen am Tisch saß und ihnen kleine Lieder auf einer Guitarre vorklimperte, hatte den Fremden im Anfang mißtrauisch betrachtet. Sein stattliches ungenirtes Aeußere aber imponirte ihm wieder, und er sagte lachend:
„Dios para todos, ja, Kamerad - aber nicht für die vermaledeiten Unitarier hoffentlich, die Ihr doch wohl davon ausgenommen habt."
„Wenig kümmern mich die," rief der Fremde gleichgültig. „Herr Wirth, eine Flasche Caňa, - oder habt Ihr Mendozawein?"
„Vom besten, Seňor," versicherte der herbeischlendernde Wirth. „Die Caravane, die vorgestern den Ort passirte, hat mir vier von ihren dickbäuchigsten Fässern dagelassen."
„Vortrefflich, Alter - vortrefflich," rief der Fremde, sich den Bart streichend. „Dann schafft rasch einmal ein halbes Dutzend Flaschen herbei. Ich hoffe nicht, daß mich die Herren hier werden allein trinken lassen."
„Caramba, nein," lachte der Soldat, „wenn Ihr des Gewichtes Eurer Knöpfe so müde seid, so findet Ihr an uns hier die rechten Leute. Aber wo kommt Ihr her?"
„Von Mendoza."
„Den ganzen Weg allein?" /14/
„Und warum nicht?" rief Diego. „Ich hatte mich dann nie über schlechte Gesellschaft zu beklagen."
„Aber die Indianer?" sagte der Wirth, der die verlangten Flaschen herbeischleppte. „Heilige Mutter Gottes, mir juckt der Hals schon, wenn ich daran denke, jetzt allein in die Pampas hinauszureiten, wo die rothen Schufte neben jedem Distelbusch im Hinterhalt liegen können."
„Bah, so viel für die Rothhäute!" sagte der Fremde verächtlich, indem er den Kork von einer der Flaschen warf - „die Senoritas trinken doch mit?"
Der Officier warf einen zweifelnden Blick aus die Mädchen, und zum ersten Mal schien in ihm der Gedanke aufzusteigen, daß der Fremde, wenn nicht politisch gefährlich, doch persönlich ihm lästig werden könnte.
Eins der Mädchen aber, ein junges frisches Ding von kaum sechzehn Jahren, rief lachend:
„Vielen Dank, Seňor, wir nehmen die Gabe an. Der geizige Wirth gäbe uns auch sonst keinen Schluck von seinem Weine, der selten genug an unsere Lippen kommt."
„Wollt Ihr nicht erst den Mateh6 kosten?" fiel hier die Wirthstochter ein, die hinter dem Tisch saß und gleich bei dem Eintritt des Gastes das übliche Getränk bereitet hatte. „Hier, Josefa, ich kann nicht hinaus - bitte, reiche Du dem Gast die Bombilla."
Das angeredete Mädchen, auf dem Diego's Blick schon so oft geruht hatte, als das unbemerkt geschehen konnte, nahm das kleine Gefäß mit der Röhre, und es dem Gast reichend, sagte sie mit einer gar lieben und weichen Stimme:
„Ist es Euch gefällig, Seňor?"
Die Sprache, die sie gebrauchte, war die des Landes, in dem sie sich befanden: Spanisch, und doch verrieth wieder ein leiser fremder Ton, daß die Sprechende dem Boden eigentlich nicht angehöre. Auch ihr Aussehen zeigte, daß in ihren /15/ Adern kein „castilianisches" Blut rolle, denn unter den kastanienbraunen Locken leuchteten ihm ein paar seelenvolle blaue Augen entgegen. Aber um die feingeschnittenen Lippen lag ein bitterer Zug von Schmerz und Leid, ja selbst ihr Lächeln hatte etwas unbeschreiblich Rührendes und Wehmüthiges, wie auch ihr Gewand die dunkle Farbe der Trauer zeigte.
Diego, wie ihr Blick sich zu ihm hob, vergaß in dem Moment fast die Mateh-Calabasse, die sie ihm entgegenhielt.
„Nehmen Sie, Seňor."
„Oh, tausend Dank, Senňrita - aber caramba, Sie sind keine Argentinerin - nicht in den Pampas wenigstens geboren."
„Nein, Seňor," sagte die Dame schüchtern, „ich -"
„Es ist eine junge Dame," unterbrach sie hier plötzlich der Officier - „die Tochter eines Cringo7 zwar, die aber unter meinem Schutze steht."
„Ah, wahrscheinlich Französin!" sagte der junge Fremde. Er war selber in Montevideo genug mit Franzosen zusammengekommen, sogar ihre Sprache fließend zu reden, ohne daß er es für zweckmäßig hielt, dem argentinischen Soldaten gegenüber mit einer solchen Kenntniß zu prahlen, die diesem jedenfalls verdächtig gewesen wäre.
Die junge Dame neigte leicht das Haupt, und sich zurückziehend, nahm sie den kaum verlassenen Platz wieder ein, auf dem sich ihre Nachbarin flüsternd zu ihr hinüberbog. Diego aber, die Matehschale ergreifend und die Bombilla, die eben noch von der Jungfrau Lippen berührt worden, an sich ziehend, sog den süßen und heißen Trank ein, und sah dabei wie träumend vor sich nieder.
Der Officier, dem dies Zwischenspiel anfing unangenehm zu werden, hatte die Guitarre wieder aufgegriffen und fiel nach einigen Accorden in einen der beliebten Tänze jener Gegenden, den er ziemlich geläufig ausführte.
Diego hatte eine ganze Weile diesen Klängen gelauscht, und erst der Wirth, der eine Anzahl Gläser und Becher hereinbrachte, störte ihn aus seinem Brüten auf. /16/
„Zum Henker auch," rief er da aus, „wir sitzen hier, während der Regen draußen niederpeitscht, allerdings trocken, aber zu trocken dürfen wir's auch nicht treiben. Ihr Name, Seňor?"
„Pasquale Herrero," sagte der Officier.
„Buono denn, Don Pasquale, hier ist Ihr Becher; füllen Sie ihn bis zum Rand und lassen Sie ihn uns auf das Wohl jener jungen Dame leeren. Seňorita, darf ich erfahren, wie Sie sich nennen?"
„Ich weiß nicht," unterbrach ihn der Argentiner, während das junge Mädchen erröthend vor sich nieder sah, , „ob Donna Josefa diese Artigkeit liebt, und in diesem Fall -"
„Schönen Augen dürfen wir zutrinken, Seňor," unterbrach ihn aber der Fremde, „Gott hat sie wie die Blumen auf unsern Weg gestreut, sie anzuschauen und an ihrem Glanz uns zu ergötzen. Ihr Lächeln ist der Duft der Blume, und so rauh wir Männer auch sein mögen, die Erinnerung an solch ein holdes Bild muß manche trübe Nacht, die wir draußen in Sturm und Wetter dann verleben, wieder erhellen und erwärmen. - Donna Josefa soll leben!"
Er leerte das gehobene Glas auf Einen Zug, und der Argentiner mußte sich wohl oder übel seinem Beispiel fügen. Don Diego ließ ihm aber nicht Zeit, sich zu besinnen. Auch den übrigen jungen Damen schob er Gläser hin, Andere der Gauchos rief er herbei zum Tisch, und auf seinen Wink brachte der Wirth neuen Vorrath, die rasch geleerten Flaschen zu ersetzen.
Das Gespräch wurde jetzt bald allgemein. Don Diego erfuhr, daß eins der jungen Mädchen die Tochter des Wirthes selber, das zweite aber eine Verwandte sei. Donna Josefa war dagegen erst vor kurzer Zeit von Buenos Ayres „als Gast" zu ihnen gekommen.
„Und um wen trauert sie?"
Der Wirth, der sich an seine Seite gesetzt hatte, bog sich zu ihm hinüber und flüsterte ihm in's Ohr:
„Bst, Seňor - reden wir lieber nicht davon. Rosas, den Gott erhalten möge, hat scharfe Ohren, und ihr Vater und Bruder" - die Worte wurden so leise gesprochen, daß /17/ sie der Fremde kaum verstehen konnte - „waren Verräther an der Konföderation."
Diego preßte das Glas, das er in der Hand hielt, so fest zusammen, daß es in Stücken sprang und der Wein ihm über die Hand und zu Boden lief.
„Caramba, Compaňero," rief er lachend aus, „Ihr führt schwaches Geschirr - ein anderes Glas für einen Toast."
„Bravo!" stimmte der Officier ein - „da seid Ihr mein Mann. So recht: füllt es bis zum Rande. Viva la confederacion – mueran – “8
„Los Unitarios!“ rief rasch Diego, sein Glas erhebend - „Tod allen Feinden."
Alles sprang von den Sitzen auf, dem Toast die nöthige Ehrfurcht zu erweisen, nur Josefa, das Gesicht in der linken Hand bergend, blieb sitzen.
„Seňorita, wir trinken der Federation," sagte der Officier.
Diego bog sich zu ihr und flüsterte:
„Meinen Toast dürft Ihr trinken."
Josefa richtete sich auf; sie war den Zwang der Republik gewohnt, und ihr Glas ergreifend, neigte sie es gegen den Fremden und nippte daran. Ihre Blicke begegneten sich dabei, und Diego sah in dem Glühen ihrer Wangen, dem Brennen ihres Auges den furchtbaren Haß, dessen Erfüllung sie von dem Schicksal brünstig erbat, als sie den Becher an die Lippen brachte.
„Ihr aber, Compaňero," wandte sich der Officier, dem das Betragen der Beiden nicht recht gefiel, plötzlich an den Fremden - „habt bei Eurem Toast die üblichen Beiworte weggelassen – salvajes, immundos asquerosos Unitatrios, die Devise unserer Bänder - doch ich sehe nicht einmal eins bei Euch? wo ist das?"
„Fragt den Pampero," lachte Don Diego, „in welchen Winkel der Pampas er es gefegt hat, wenn er es nicht in diesem Augenblick selber nach Buenos Ayres hinüberträgt. /18/ Außerdem bin ich ein freier Gaucho und kann tragen was ich will."
„Die Montevideer und die verdammten Unitarier nennen sich auch Gauchos," rief der Officier, emporfahrend, „ich hoffe nicht, daß -"
„Musik, Seňorcs, Musik," fiel hier der Wirth ängstlich in das Gespräch, denn den Officier durfte er nicht beleidigen, und den freigebigen Fremden hätte er um Alles nicht an seinem Tische missen mögen - „Ihr vergeßt ganz die Hauptsache. Die Seňoritas sitzen da und warten mit Schmerzen auf die versprochenen Lieder, und die Guitarre liegt stumm und todt auf dem Tisch. Das ist nicht Sitte in den Pampas, wenn Ihr's auch so vielleicht in Buenos Ayres haltet."
„Wahr, wahr, Amigo!" rief der Fremde, dem selber daran lag, dem Gespräch eine andere Wendung zu geben. „Wir dürfen die Seňoritas nicht kränken und langweilen. Gebt uns ein Lied, Seňor, Ihr spieltet so meisterhaft, als ich das Haus betrat, daß Ihr es mir nicht übel nehmen dürft, wenn ich mehr davon verlange."
„Dann haben wir nachher einen Rundgesang," rief der Wirth, dem fröhlich beistimmend, „ich hole alle Guitarren zusammen, die zu haben sind. Caramba, das soll ein fröhlicher Abend werden!"
Der Officier, durch das Lob des Fremden geschmeichelt, hatte die Guitarre aufgenommen, und ohne seine vorige Frage zu wiederholen, griff er einige Accorde und schien seine Gedanken zu dem bevorstehenden geistigen Wettkampf zu sammeln; Don Diego aber war aufgestanden und zur Thür getreten, zu sehen, ob der Sturm nachgelassen hätte. Der Pampero war auch in der That vorübergebraust; ein ziemlich frischer Südwind strich über die Ebene, und hell und klar funkelten die Sterne am Himmel. Nur fern im Norden lag noch eine düstere Wolkenschicht, und das Wetterleuchten dort drüben verrieth den Weg, den die furchtbaren Gewitter genommen hatten.
Don Diego lauschte die Straße auf und ab. Hatte Osantos wirklich gewagt, den mit Militär erfüllten Ort zu betreten? - Nirgends ließ sich ein Reiter erkennen; die Straße /19/ war vollkommen menschenleer, und nur aus einigen der benachbarten Häuser tönte der Klang von Guitarren und Liedern.
Als er in's Zimmer zurückkam, faud er die Tische schon zur Seite gerückt und die Stühle gestellt. - Die jungen Mädchen saßen an der einen Seite der Stube; dicht vor ihnen, und ihnen halb zugedreht, der argentinische Officier, die Guitarre im linken Arm und mit den Fingern der rechten Hand leicht die Saiten im Fandangotact schlagend. Drei oder vier andere Gauchos, die ihm gegenüber saßen, hielten ebenfalls Guitarren in den Händen, und suchten sie alle gleich zu stimmen, daß der Wechselgesang nicht durch einen Mißton gestört würde.
„Und spielt Ihr auch das Instrument, Seňor?" frug der Officier, als Don Diego durch die Stube schritt und, die Plätze neben den jungen Damen besetzt findend, einen Stuhl dem Soldaten gegenüber einnahm.
„Ein wenig wohl," erwiderte der Fremde, „aber meine Hand scheint sich besser mit den Schnüren von Lasso und Bolas, wie mit den dünnen Saiten der Guitarre zu befreunden. Nichtsdestoweniger ist mir der Gesang das Liebste auf der Welt."
Der Officier nickte lächelnd mit dem Kopf, und dann einige kräftige Accorde als Introduction anschlagend, begann er mit melodischer Stimme ein kleines spanisches Liebeslied, bei dem er ziemlich deutliche Blicke nach der schweigend vor sich nieder sehenden Josefa warf:
„Sag' mir, daß Du mich magst, Caramba,
Liebst von ganzem Herzen -
Lieb' ich's, wenn Du mir's sagst, Caramba,
Wollen dann singen und scherzen.
Heute wag' ich es kaum, Caramba,
Alles Dir zu verkünden.
Morgen wird wie ein Traum, Caramba,
Sorgen und Leid verschwinden. -
Sag' mir. daß Du mich magst, Caramba,
Liebst von ganzem Herzen,
Lieb' ich's, wenn Du mir's sagst, Caramba,
Wollen dann singen und scherzen."
/20/
Eins der jungen Mädchen hatte indessen ihrem Nachbar die Guitarre aus der Hand genommen, und mit einem leisen Lächeln präludirend, sang sie mit einer glockenhellen Stimme:
„Es sprengt ein Reiter die Steppe her -
Die Hufe berührten den Boden kaum.
Er kam herüber vom weiten Meer -
Und fand in den Pampas 'nen Ombubaum.
Einen Ombu, so hoch wie er keinen gesehn.
Und oben im Wipfel in Glanz und Licht,
Da saß ein Vogel so wunderschön -
Der Reiter verlangt ihn - bekommt ihn nicht."
Rasch griff der Argentiner in die Saiten:
„Da nimmt er den Lasso und wirft ihn hinein -
Die Schlinge fliegt aus und der Vogel ist sein."
In der Ecke saß ein alter Gaucho mit wildem, wirrem Bart, den Hut fest über die Augen gezogen. Er hatte bis jetzt mit seiner Guitarre die vorigen Melodien begleitet. Jetzt that er einen schrillen Griff und antwortete mit hoher, komisch klingender Fistelstimme, die Erwiderung des Mädchens nachahmend :
„Der Lasso ist kurz, und der Ombu ist hoch;
Das erste Mal nicht, daß der Wurf ihn betrog."
Die Zuhörer lachten, aber trotzig sang der Soldat:
„Und reicht nicht der Lasso - die Bolas zur Hand,
Die bringen den Vogel gewiß in den Sand."
Da sang die eine Wirthstochter wieder:
„Ei wollt Ihr mit Bolas ein Mädchen frei'n,
So möcht' ich Euch rathen, Seňor, laßt es sein.
Eine freundliche Statt findet wohl ein gut Wort,
Aber droht mit Gewalt und - der Vogel fliegt fort."
„Und flög' er auch fort," - sang der Officier,
„laß ihn fliegen, mein Kind, Ich sitze im Sattel und folge geschwind.
Den Zügel verhängt und den Lasso zur Hand,
/21/
Durch Dornen und Busch und den lockeren Sand,
Wohin er auch flöge, ich bleibe ihm nah.
Und setzt er sich einmal - im Nu bin da."
Da nahm Don Diego die neben ihn hingelegte Guitarre, und während keiner der anderen Gauchos es wagte, dem übermüthigen Soldaten entgegen zu treten, begann er mit leiser, aber wunderbar ergreifender und zum Herzen sprechender Stimme, die aber gegen das Erde des Verses mächtig anschwoll:
„Es war ein Vogel, so wunderschön.
Ich habe noch keinen so weiter gesehn.
Der kam von Osten, weit über das Meer,
Er brachte den Oelzweig im Schnabel her.
Sein Kleid war silbern, mit himmlischem Schein,
Er sang so lieblich - frei sollt Ihr sein!
Er brach die Ketten - des Spaniers Joch,
Er hieß „libertad" - und heißt so noch!"
,,Bravo - bravo!" jubelten die Gaucho's dem Sänger zu; der Alte mit dem greisen Bart aber griff wild in seine Saiten und sang mit voller, tönender Stimme:
„Und frei war das Volk und frei war das Land,
Das alle Stämme wie Brüder verband.
Ein Jubelschrei ging vor der Botschaft her,
Vom Atlantischen hin bis zum Stillen Meer."
Wieder griff Don Diego einige Accorde, und während ihm Alles still und schweigend lauschte und Josefens Auge besonders in wachsender Spannung an seinen Worten hing, begann der Fremde wieder, kaum die Saiten berührend:
„Da kam ein Jäger mit wildem Troß,
Der traf den Vogel mit seinem Geschoß,
Verschwunden war da der Farben Gluth,
Der Vogel zuckte jetzt roth im Blut!"9
/22/
Die Anspielung war zu deutlich, und der argentinische Officier, dem das Blut in die Schläfe schoß, entgegnete zornig, dem Fremden ohne Weiteres in sein Lied fallend:
„Du hast ihn bezeichnet den Feigen, Gesell,
Lavalia hieß er - doch mächtig und schnell
Erschien auch der Retter in dieser Noth
Und traf jenen feigen Verräther zum Tod.
Don Manuel Rosas war es - in Lust
Jauchzt ihm entgegen jedwede Brust,
Sein Schrei aber: Nieder der Schurken Troß
Mueran los Unitarios,
Und hoch auf den Händen, vom Volk gestellt,
Trug es den hohen, den göttlichen Held-
Trug es der Pampas würdigen Sohn,
Mit dem Rufe: Viva la federacion!"
Noch hatten sich die Insassen des Zimmers nicht entscheiden können, ob sie, schon aus alter Gewohnheit, in den Landesruf mit einstimmen sollten, als Diego, von seinem Sitz emporspringend, und wild dazu seine Saiten schlagend, einfiel:
„Viva la confederacion!
Den Schrei geb' ich mit, den Verräthern zum Hohn.
Viva das Volk und des Volkes Hort,
Die freie Wahl und das freie Wort -
Zu Boden mit Jedem, der wieder versucht,
Das Gut uns zu rauben der frech und verrucht
Den Gaucho auf's Neue mit Ketten bedeckt,
Die Freiheit entehrt und den Namen befleckt.
Und wie er auch heiße, und wer er auch sei.
Zu Boden mit ihm, denn der Boden sei frei!"
Es wäre unmöglich, den Tumult zu schildern - den diese wenigen Reime in der Versammlung hervorriefen.
„Viva la libertad!" donnerte der alte Gaucho mit dröhnender Stimme, „viva la libertad!“ tobten alle anwesenden Gauchos im Jubelruf mit ein, und nur der argentinische Officier stand schweigend, zürnend dazwischen. „Viva la libertad!" war auch Rosas' Schlagwort, aber er fühlte recht gut, daß die Männer hier die Freiheit nicht meinten, die ihnen der Dictator gebracht, und daß ein gefährlicher, rebel-/23/lischer Geist in den Burschen stecke. Wie aber war dem zu begegnen?
Noch dauerte die Aufregung, die das letzte Lied hervorgerufen, als eins der Mädchen, das durch Zufall den Blick auf das Fenster geworfen, laut und erschreckt ausrief:
„l,os indios! Gott sei uns gnädig."
Rasch drehte Don Diego den Kopf dorthin; aber er sah nur noch, wie, einem Schatten gleich, ein dunkler Schein vom Fenster glitt.
„Dort, dort war es!" wiederholte das Mädchen, den zitternden Arm der Gegend zustreckend, wo sie die Ursache ihres Schreckens gesehen haben wollte. Als ihr Aller Augen aber dahin folgten, ließ sich nichts weiter erkennen, und ein Theil der Gäste drängte jetzt der Thür zu, um die Straße draußen zu untersuchen.
IV.
Nur der argentinische Officier war noch zurückgeblieben und wandte sich, während sich Don Diego wieder auf seinen Stuhl niederließ und sein Glas füllte, an das junge Mädchen, um genauer zu erfahren, was sie so erschreckt habe.
Beatriz, des Wirthes Tochter, konnte ihm aber nichts weiter sagen, als daß sie einen dunkeln Kopf mit glühenden Augen am Fenster gesehen und im ersten Augenblick geglaubt habe, es sei ein Indianer. Die Bewohner der Pampas dachten in damaliger Zeit ja fast an nichts weiter, als an jene wilden Horden.
Nun war es schon außerordentlich unwahrscheinlich, daß sich ein einzelner Wilder hier in das von Soldaten gefüllte Städtchen gewagt haben sollte. Außerdem befanden sich aber unter dem argentinischen Militär eine Menge Mulatten und Neger, und jedenfalls hatte einer von diesen - wenn überhaupt Jemand - in das Fenster hereingesehen. Nichtsdestoweniger erforderte es die Pflicht des Officiers, nachzuschauen, und es gefiel ihm nur nicht, den ihm überhaupt verdächtigen /24/ Fremden mit den Mädchen allein zu lassen. - Aber was konnte er auch in den wenigen Minuten thun? Er war jetzt Commandirender in Cruzalta, und daß ihm der Fremde da nicht lästig werden sollte, dessen war er gewiß. - Was brauchte ein Officier der Argentinischen Republik oder vielmehr des allmächtigen Rosas auch große Umstände zu machen!
Er verließ das Zimmer, und Don Diego saß noch immer ruhig auf seinem Stuhl, nahm die Guitarre wieder und spielte leise und wie in Gedanken ein kleines spanisches Lied. Wieder und wieder schweifte sein Blick nach dem schönen fremden Mädchen hinüber, das sich jetzt mit den Freundinnen in die entfernteste Ecke des Zimmers zurückgezogen hatte, und nur Auge und Ohr für dieselben zu haben schien.
Der Wirth, der mit den Uebriqen vor die Thür getreten war, kam jetzt zurück, und sich neben Diego niedersetzend, sagte er lachend:
„Du hast einen schönen Lärm geschlagen, Beatriz, und mir die Gäste im Nu aus dem Haus gejagt. Ihr glaubt gar nicht, Seňor, welche Furcht die Dirnen vor den Indianern haben. Ich bin fest überzeugt, sie begegneten viel lieber dem leibhaftigen Gottseibeiuns auf den Straßen, als einem dieser kupferbraunen Burschen."
„Und habt Ihr sie schon hier in der Nähe gespürt?" frug Diego gleichgültig.
„Caramba, ja," sagte der Wirth schnell. „Ausgesandte Spione haben vor einigen Nächten gar nicht so weit von hier entfernt ein Lager der verwünschten Rothhäute angetroffen, - ihre Feuer wenigstens gesehen; denn sie getrauten sich nicht weiter hinan. Als die Soldaten aber von hier am nächsten Morgen dorthin aufbrachen, fanden sie keine Seele mehr daheim. Die Horde war wieder abgezogen, weil sie die Gegend für doch nicht so ganz sicher halten mochte."
„Und wie stark mag der Trupp gewesen sein?"
„Den Zeichen nach fünfzig Mann. Die Schurken ziehen ja gewöhnlich in so kleinen Banden umher, um einzelne Hütten zu überfallen und zu plündern und gelegentlich eine Heerde mit fortzutreiben. Der Correo wird einen schweren Stand haben, diesmal durchzukommen. Man munkelt schon wieder /25/ davon, daß sie Weiße zu Anführern hätten. Unitarier," - setzte er leise flüsternd hinzu, - „die sich der gerechten Regierung Sr. Excellenz nicht unterwerfen wollen."
„Das alte Lied," sagte Don Diego, mit den Achseln zuckend, - „aber wann glaubt Ihr wohl, Seňor, daß der Correo hier eintreffen kann? Ich erhoffe Briefe von Buenos Ayres, und möchte ihn gern erwarten, - Euch jedenfalls bitten, wenn ich früher fort müßte, meine Briefe hier zurück zu behalten. Meine nähere Adresse werde ich Euch noch geben."
„Wenn der Correo überhaupt unter den jetzigen Verhältnissen aus der „Stadt" ausgebrochen ist," sagte der Wirth, „so muß er morgen zu Mittag hier sein. Ich habe ihn eigentlich heute schon erwartet; denn er reitet gewöhnlich am 17. Von Buenos Ayres ab und übernachtet in der letzten
Estancia."
„Desto besser, dann treff' ich ihn gewiß," sagte Don Diego und die Guitarre neben sich hinlegend, nahm er aus seinem Gürtel ein kleines Stück Papier, schrieb mit einem Bleistift ein paar Worte darauf und schob es zurück. Langsam hob er dabei den Blick und begegnete dem Auge Josefa's, die vor dem Ausdruck in den Zügen des Fremden zusammenschrak. Der Blick galt ihr und barg ein Geheimniß.
„Seňor," flüsterte da der Wirth an seiner Seite, „wollt Ihr auf guten Rath hören?"
„Gewiß," sagte Don Diego rasch, „in diesen Zeiten ist ein guter Rath oft so viel und mehr werth, wie eine gute That."
„Gut - so nehmt Euch vor dem - Herrn Lieutenant in Acht."
„Ihr glaubt?"
„Er hat Böses mit Euch im Sinne," warnte der Mann, noch leiser fast als vorher. „Euer freies und keckes Lied über den Dictator - den Gott erhalten möge - ist ihm in die Krone gefahren, und Ihr wißt, eben so gut wie ich es Euch sagen könnte, daß es in jetziger Zeit wenig mehr als eines Verdachtes bedarf, um Leben und Freiheit irgend eines Menschen zu bedrohen?“ /26/
„Und nennt Ihr das ein freies Land?" lachte Don Diego verächtlich vor sich hin.
Der Wirth zuckte, während er einen scheuen Blick über die Schulter warf, mit den Achseln.
„Don Manuel ist allmächtig," setzte er dann flüsternd hinzu, „und gegen den Stachel kann Niemand lecken. Mir juckt die Kehle schon bei dem bloßen Gedanken, daß ich einmal den Unwillen des - des Herrn erregen könnte. Ich beschwöre Sie also -"
„Habt keine Angst um mich, Freund," erwiderte ruhig Don Diego, „übrigens danke ich Euch für die Theilnahme, die Ihr mir bewiesen. Selbst das ist schon mehr, als ich zu erwarten hatte - und nun macht Euch weiter keine Sorgen. Ich glaube, die Leute kommen zurück; Caramba, wäre es denn nicht möglich, heut Abend einen kleinen Fandango zu arrangiern? Es ist noch früh, und die Zeit vergeht beim Tanze rascher als je. Wie wäre es, Senoritas, wer von Ihnen hätte Lust, daran Theil zu nehmen?"
„Ach, an Mädchen soll cs nicht fehlen," lachte der Wirth, damit vollkommen einverstanden. „Wenn's einen Fandango giebt, habe ich in fünfzehn Minuten die ganze Nachbarschaft auf den Beinen."
„Und die Indianer?"
„Thorheit, - wer weiß, was für ein Mulattengesicht die Dirne gesehen hat. So frech sind die Burschen nicht, daß sie stch in des Tigers Rachen wagen sollten. Hier, Beatriz - hier, Mareguita, nehmt die Guitarren. Donna Josefa müßt Ihr entschuldigen, Seňor - sic trauert um liebe Freunde - nehmt die Guitarren, Mädchen, und beginnt die Melodie. Wir haben der ernsten Stoffe heute gerade genug gehabt."
Don Diego war aufgestanden, und seine Guitarre einer der jungen Damen überreichend, bog er sich dabei über Josefa hinüber. - Wieder hatte sein bittender, mahnender Blick sie getroffen, und zusammenschreckend fühlte sie, wie er unter der Guitarre einen kleinen Zettel in ihre Hand drückte. Im nächsten Augenblick trat er zurück und hatte gerade seinen Platz auf's Neue eingenommen, als die übrigen Gäste lachend und zusammen plaudernd zurückkehrten. /27/
Der Blick des argentinischen Officiers fiel zuerst wieder auf den Fremden, aber die muntern Töne der Guitarre regten in dem lebensfrohen Völkchen rasch die Lust zum Tanz. Die Stühle wurden bei Seite geschoben, die Tische aus dem Wegc gerückt, und ein paar junge Gauchos zogen lachend die Wirthstochter mit ihrer Base in die Mitte der Stube und begannen mit ihnen, während die Aelteren der Gesellschaft die Instrumente aufgriffen und ohne Weiteres in den volksthümlichen Tact- einfielen, den fröhlichen Fandango.
Der Wirth hatte dabei nicht zu viel versprochen und in weniger als einer Viertelstunde alles Tanzfähige ans dem kleinen Ort zusammengerufen. Das geschah aus so eigenthümliche wie ächt argentinische Art. Sein draußen angebundenes Pferd nämlich besteigend - denn es fällt keinem Gaucho ein, auch nur hundert Schritt zu Fuß zu gehen, wenn er nicht nothgedrungen muß - galoppirte er die Straße hinab; an jeder Thür aber zügelte er ein, schrie das Wort „Fandango" hinein und sprengte dann weiter. Große Toilette brauchten die Damen ebenfalls nicht zu machen; sie warfen ihre Mantilla um, und der Anzug war vollendet. Wie auch immer dabei die politischen Verhältnisse des Landes standen, ja, wenn die Indianer selber draußen im Lager gewesen wären und sie bedroht hätten, der Aussicht auf einen Fandango würden sie doch nicht haben widerstehen können, - noch dazu mit einem Lieutenant und zwei Fähnrichen im Ort. Wer wußte denn, ob ihnen solche Gelegenheit so bald wieder geboten wurde.
Bald nahm auch der Tanz Aller Aufmerksamkeit vollkommen in Anspruch. Während ihn aber im Ansang ein und zwei Paare abwechselnd aufführten, trat, wie der Abend weiter vorrückte, auch wohl eine einzelne Senorita auf. Stumm und lautlos schauten ihr dann die Uebrigen zu; aber ein Beifallssturm lohnte sie, wenn sie den schwierigen Anforderungen dieses Tanzes vollkommen genügt hatte. Ja, nicht selten flogen auch kleinere Silbermünzen, selbst Dollars, in den Ring, als ehrendes Geschenk für die Tänzerin, das sie mit einer freundlichen Verbeugung acceptirte und selber aufhob.
Don Diego hatte sich von alle dem ziemlich zurückgehalten. /28/
Es schien fast, als ob er noch einmal Gelegenheit suche, sich Josefa zu nähern. Wäre das aber wirklich der Fall gewesen, so vereitelte sie der argentinische Osficier vollkommen, indem er das trauernde Mädchen nicht aus den Augen ließ.
Wohl hatte Don Pasquale sogar versucht, sie trotz allem Weigern dazu zu bewegen, an dem fröhlichen Tanze Theil zu nehmen; aber sie wies ihn jedesmal, wenn auch nicht unfreundlich, doch ernst zurück, und er ließ sich endlich an ihrer Seite nieder, suchte die Hand zu ergreifen, die sie ihm jedoch entzog, und knüpfte ein leises, lebhaft geführtes Gespräch mit ihr an, das dem schönen Mädchen bald die Thränen in die Augen trieb. - Und dazu tönten die Guitarren, jauchzten die Zuschauer und hüpften die lachenden Tänzer und Tänzerinnen lustig im Zimmer auf und ab. Don Diego konnte den Anblick endlich nicht länger ertragen.
Er sprang auf, und in den Kreis der ihm willig Raum gebenden Zuschauer tretend, fand er Donna Beatriz gerade mitten in einem Fandango, den sic mit unbeschreiblicher Grazie und unter dem Beifalljauchzen der Gauchos ausführte.
Das junge Mädchen tanzte wirklich reizend, und so graziös wie züchtig bewegte sie sich bei den raschen, lebendigen Klängen der Melodie im Kreis und setzte dabei die kleinen niedlichen Füße so zierlich und gewandt, daß, als sie endlich schloß, ein Beifallssturm sie lohnte. Aber dabei blieb es nicht. Ein paar der jungen Burschen hatten rasch ihr Messer bei der Hand, und von den Gürteln die Dollarknöpfe losschneidend, warfen sie die der jungen Schönen zu.
„Silber? Caramba!" rief Don Diego, „lohnt Ihr mit Silber einen solchen Tanz? - der verdient Gold, denn es war die reine Musik der Füße, wie sie über den Boden mehr dahin spielten als tanzten," und mit seinem Messer eine Unze vom Gürtel trennend, warf er das große Goldstück vor die Füße des schönen Mädchens, das sich leicht erröthcnd und lächelnd gegen ihn neigte.
„Das ist kein Unitarier, Seňor," flüsterte der Wirth schmunzelnd dem Officier zu, der indessen ebenfalls aufgestanden war, dem Tanze zuzuschauen, „denn denen fehlt's /29/ immer am Besten, am rothen Golde, während es unser Amigo so leichtherzig von sich wirft, als ob er es gestern erst auf der Straße gefunden hätte."
„Der Teufel traue ihm, Compaňero," murmelte der Soldat leise vor sich hin. - „Sein voriges Lied hab' ich ihm noch nicht vergessen, und ehe wir Beiden von einander scheiden, soll er mir noch mehr Rede stehen, als ihm vielleicht lieb ist, oder - wir trennen uns gar nicht so bald wieder. Hat er Euch gesagt, wie lange er hier zu bleiben gedenkt?"
„So viel ich weiß, wartet er auf den Correo," sagte der Wirth, „der ihm Briefe von Buenos Ayres bringen soll."
„Briefe? - hm - es ist gut. Sein Name?"
„Don Diego."
„Aber weiter."
„Thut mir leid, Seňor, weiter kann ich nicht dienen. Ich habe noch nicht mehr davon gehört."
„So sorgt dafür, daß Ihr bis morgen früh mehr davon wißt," sagte der Officier streng. - „Ich weiß nicht, ob ich mich geirrt habe, aber mir schien, als ob Ihr in das vorige Viva la libertad jenes verdächtigen Burschen ebenfalls mit eingestimmt hättet, und da -"
„Seňor, ich bitte Euch um Gottes willen!" rief der Wirth erschreckt. „Ich halte dies Gasthaus nur durch die Gnade Sr. Excellenz, unsers vielgeliebten Don Manuel Rosas, dem der Allmächtige ein langes segensreiches Leben schenken möge. Ihr werdet doch nicht etwa glauben -"
„Ich sagte Euch, daß ich cs nicht gewiß weiß."
„Aber schon ein bloßer Verdacht genügte -"
„Da Ihr das wißt," erwiderte der Officier mit einem bedeutungsvollen Blick, „so denke ich, werdet Ihr auch wohl Alles thun, was in Euren Kräften steht, jeden solchen Verdacht von Euch fern zu halten, oder - wenn er etwa schon gefaßt sein sollte - zu entkräften. Ihr kennt Euren eigenen Vortheil viel zu gut, als daß ich Euch mehr zu sagen brauchte."
„Aber, Seňor, wenn nun -"
„Ruhig - der Tanz ist beendet. Morgen früh erwarte ich Antwort von Euch." Und ohne sich weiter um den Wirth zu bekümmern, drehte sich der Soldat von ihm ab und schritt /30/ dem Tisch wieder zu, an dem Don Diego die Männer jetzt um sich versammelte, ihm Trinken zu helfen.
Die spanische Race ist aber im trinken außerordentlich mäßig, und wenn Don Diego auch wohl unter den französischen Einwanderern in Montevideo andere Sitten angenommen hatte, konnte er hier die Leute doch nicht überreden, mehr als ein oder zwei Gläser von dein starken Wein mit ihm zu leeren. Der Abend war überdies auch schon ziemlich weit vorgerückt; die Frauen und Mädchen zogen sich in ihre verschiedenen Wohnungen zurück, die Männer folgten größtentheils dem Beispiel, und auch für die Gäste der Pulperia wurden, so weit es der Raum erlaubte, die Lagerstätten nothdürftig hergerichtet.
Dazu bedurfte es freilich keiner großen Vorbereitungen. Den Poncho, der die Nacht als Decke diente, führte jeder bei sich, eine Kuhhaut auf den nackten Boden oder auf eine dazu an der Wand angebrachte Lehmbank gebreitet, verrichtete Matratzendienste, der Sattel mit den dazu gehörigen Schaffellen bildete das Kopfkissen und das Bett war fertig.
Eine halbe Stunde später, und nicht ruhiger und stiller lag die Nacht draußen anf der dunkeln schweigsamen Steppe, als auf dem kleinen, von Bewaffneten gefüllten Ort, in dem kein einziges Licht mehr Leben und Bewegung kündete. Aber welch ein lebendiges Bild bot der nächste Morgen.
V.
Hell und klar stieg die Sonne aus dem weiten, ununterbrochenen Horizont der Pampas wie über einem Ocean empor, und der leichte Duft, der auf der Steppe lag, schwand in dem warmen Schein, oder strich in leichten wechselnden, oft phantastischen Schwaden vor der schwachen Ostluft hin, die dem Sonnenaufgang vorauszog. Ueberall, wohin das Auge traf, weideten kleine Hcerden von Rindern und Pferden, in Gruppen über den grünen Plan zerstreut, und besonders stachen /31/ die Rinder mit ihren bunten Farben wunderlich und schroff gegen den hellgrünen Boden ab.
Jetzt wurde es auch in dem Städtchen lebendig. Die Soldaten waren hinausgegangen, um ihre Thiere einzufangen und zu satteln, und hier und da jagten Einzelne, den Lasso um den Kopf schwingend, hinter den wildesten des Trupps her, sie entweder zurück zu treiben, oder mit der sichern Schlinge an ihre Pflicht in deutlicher Weise zu mahnen.
Müßig schlenderten die Gauchos dazwischen herum, und der einzige, wirklich thätige Mensch in Cruzalta trieb ein Pferd in einer wunderlichen Art von Mühle, und lag dabei auf einem von dem Schaft ausgehenden Baum auf dem Bauch, das eingeschirrte Pferd nur manchmal durch einen schrillen Ruf zur Thätigkeit aufschreckend. Die Mühle war dabei so eingerichtet, daß der Stein um jenen aufrecht stehenden Schaft fest saß - der davon ausgehende Baum, auf dem der kleine Bursch lag, diente aber zu gleicher Zeit als Deichsel, das Pferd daran zu befestigen, und während sich dieses im Kreis umherbewegtc und mit dem Schaft auch den Stein drehte, behielt es seinen Kutscher fortwährend hinter sich.
Ein anderer Junge, schmutzig und verwahrlost genug aussehend, mit Hemd, Cheripa und Gürtel, lag ebenfalls ausgestreckt neben der Stelle, wo das fertige Mehl durch einen Beutel von Rindshaut lief, nm das Verschütten dasselben zu überwachen.
Die ganze Arbeit gehörte übrigens zum Luxus des kleinen Ortes, ebenso wie das Mehl, das keineswegs zu Brod, sondern nur zu süßen Näschereien für die Seňoritas verarbeitet werden sollte. Wer von den Leuten dachte hier daran, Brod zu essen, wo sie Fleisch im größten Ueberfluß hatten! In der ganzen Nachbarschaft befand sich auch nicht ein einziges Feld, und der wenige Weizen, der hier und da neben den Häusern in einer ganz abgestreiften Rindshaut aufbewahrt wurde, war mit den Caravanen von dem fern gelegenen Mendoza gekommen.
Ueberall in den Häusern brodelte indessen das leckere Mahl: Fleischstücke auf ein Feuer von getrocknetem Kuhdünger und einigen holzigen Gräsern geworfen, denen der Mateh /32/ vorausgehen und folgen mußte. Die Cigarillen ersetzten danach alle weiteren Genüsse. Aber die rauhen Bewohner der Pampas waren an kein besseres Leben gewöhnt, noch verlangten sie es anders. Fleisch, Fleisch und Fleisch ihre Nahrung, der Sattel ihre Heimath, die Gefahren und Beschwerden der Steppe ihre Unterhaltung und Erholung - eine weitere Anforderung an das Dasein kannten und stellten sie nicht.
Don Diego war heut einer der Ersten mit auf, um draußen nach seinem wackern Thier zu sehen und sich dessen zu versichern. In der Pulperia traf er nachher eben zur rechten Zeit ein, das Frühmahl mit den übrigen Bewohnern zu theilen.
„Ihr wolltet mir Eure Adresse geben, Sektor," redete ihn der Wirth an, als er ihn einen Augenblick allein sprechen konnte, „falls Ihr den Correo verfehlen solltet."
„Allerdings," sagte der junge Mann. „Vor der Hand warte ich aber noch bis Mittag, ob er nicht kommt. Ihr glaubt, daß er bis dahin hier sein könnte!"
„Keine Gewißheit, Seňtor, keine Gewißheit," bemerkte achselzuckend der Wirth. „Jetzt, wo die Indios die Steppe unsicher machen, kann er eben so gut einen, wie acht Tage länger ausbleiben, darf er es doch nicht wagen, des Morgens, sein Nachtquartier zu verlassen, bis sich der Nebel vollständig von der Steppe verzogen hat. Ich - würde gar nicht auf ihn warten, wenn ich wie Ihr wäre," setzte er rasch und leise hinzu.
„Ihr meint wegen des Officiers?" lachte der Fremde. „Der kümmert mich weniger, als Ihr vielleicht denkt. Was kann er mir anhaben?"
„Was können die Soldaten Sr. Excellenz, unseres erhabenen Don Manuel, nicht thun!" erwiderte scheu der Wirth.
„So viel für seine Macht," gab Diego verächtlich zurück, indem er mit dem Finger schnalzte. „Er mag sich hüten, meinen Weg zu kreuzen, das ist Alles, was ich mit ihm noch zu schaffen habe. Aber über Eins könntet Ihr mir vielleicht Auskunft geben, und dabei ist weder Don Manuel, noch Euer Officier im Spiel. Seit wann ist jenes junge, schöne, in Trauer gekleidete Mädchen hier?" /33/
„Da seht Ihr wieder, wie wenig Ihr unsere Verhältnisse kennt," sagte der Wirth leise, „denn bei der jungen Dame sind gerade Don Manuel und jener Officier die Hauptpersonen."
„Der Officier?" rief Don Diego rasch und betroffen.
„Bst, um der heiligen Jungfrau willen, nicht so laut. Hier hat selbst die Luft Ohren und - Zunge. Ihr Vater und Bruder waren Verräther an - unserer Freiheit, und Se. Excellenz ließ sie unschädlich machen."
„Und hielt er die junge Dame ebenfalls für gefährlich?"
„Don Pasquale Herrero steht in hoher Gunst bei Sr. Excellenz," sagte ausweichend der Wirth. „Er selber, wenn ich nicht irre, führte den schwierigen und auch wohl gefährlichen Befehl aus, jene beiden Verräther zu - beseitigen. Zur Belohnung hat Se. Excellenz jetzt die junge Dame dem Schutz und der Bewachung Don Pasquale's übergeben."
„Zur Belohnung?" rief Diego erstaunt aus. „Ich, verstehe Euch nicht."
,,Ja, Seňor," sagte der Wirth bedeutungsvoll. „Es passiren manchmal Dinge in der Welt, die ich selber nicht verstehe, und ich lebe doch etwa schon noch einmal so lange darin, wie Ihr. Aber laßt Euch darüber keine grauen Haare wachsen," setzte er, noch leiser als vorher, hinzu. „Don Pasquale hat einmal das Täubchen in den Fängen, und wird es nicht wieder so leicht loslassen. Gutwillig giebt er es auch nicht her, nehmen kann man es ihm nicht, also muß man die Sache eben ihren Weg gehen lassen."
„Und die Seňorita wohnt nicht bei Euch? Sie wird auch nicht hier bleiben, wenn die Soldaten den Platz verlassen?"
„Ausgenommen Don Pasquale gäbe sie in meinen Schutz," versetzte der scheue Wirth, „und treueren Händen könnte er sie unmöglich anvertrauen."
„Glaubt Ihr, daß er sie, selbst gegen ihren Willen, mit fortnehmen würde?" frug Diego.
„Hat solch ein junges Ding schon einen Willen?" versetzte der Wirth. „Selbst wenn Se. Excellenz nicht schon vorher dafür gesorgt hätte? - Aber da kommen meine Leute. /34/ Ruhig, Seňor, wenn Euch Eure Sicherheit lieb ist und - habt ein wachsames Auge."
„Ich danke Euch, ich werde es befolgen."
„Und wollt Ihr mir einen Gefallen thun?"
„Euch? in welcher Art?"
„So gebt mir Eure Adresse," sagte der Wirth leise, „Don Pasquale verlangt sie von mir, und ich fürchte fast, er hat den Verdacht geschöpft, daß ich Euch freundlicher gesinnt sei, als es sich mit der - Sicherheit des Staates verträgt."
„Meine Adresse?" lachte Diego in sich hinein, „gut, die sollt Ihr haben, da Ihr mir so ehrlich die Ursache sagt," und ohne Zögern nahm er, während gerade die Frauen in das Zimmer traten und das Essen brachten, ein Stück Papier aus seinem Gürtel und schrieb den verlangten Namen darauf.
„Don Diego Matanzas?" sagte aber auch im nächsten Augenblick erstaunt der Wirth, wie er nur einen Blick darauf geworfen hatte. „Seid Ihr mit jenem Matanzas verwandt, der in Buenos Ayres jetzt, nach Don Manuel, der Erste ist?"
„Allerdings - ich bin sein Neffe," warf der Fremde leicht hin. „Nun, dünkt Euch der Name etwa gefährlich?"
„Nicht im Geringsten," entgegnete der Wirth rasch. Dann sich aber zu Don Diego überbiegend, flüsterte er diesem leise in das Ohr: „Wenn's eben Euer rechter wäre - bst - bitte Euch, seid ruhig. Mir genügt er," wehrte er ab, als sich Don Diego vertheidigen wollte, „und mögen sich Andere nicht damit beruhigen, gut, so können sie selber weiter forschen. Und jetzt, Seňor, theilt unser Mahl mit uns."
„Donna Josefa?"
„Läßt sich entschuldigen, Seňor," sprach die hinzutretende Beatriz. „Auf strengen Befehl wird sie vor der Hand ihr Zimmer nicht verlassen."
Diego fuhr auf, ein Blick des Wirthes aber mahnte ihn, auf seiner Hut zu sein, und im nächsten Augenblick erschien Don Pasquale, der argentinische Offerier, im Gemach, sein Frühstück ebenfalls zu verzehren.
Mit kurzem Gruß und ohne weitere Umstände, den Fremden von gestern Abend kaum eines Blickes würdigend, nahm er den Ehrenplatz am Tisch ein, suchte die besten Fleischstücke für
/35/ sich aus und winkte dann, als das Mahl beendet worden, dem Wirth, ihm vor die Thür zu folgen.
Don Diego war ebenfalls aufgestanden und an das Fenster getreten. Er schien nicht recht mit sich einig, ob er bleiben oder gehen solle. Da fiel sein Blick draußen auf den alten Gaucho, der am vorigen Abend so wild und trotzig, und so wenig die Gegenwart des Officiers achtend, in sein Freiheitslied eingefallen war. Möglich, daß er von dem Alten irgend eine Kunde erfahren konnte; auf keinen Fall durfte er einen Feind in ihm erwarten.
Der Alte schien gesonnen, hinaus in die Steppe zu reiten. Drüben, an der andern Seite der Straße war sein Pferd angebunden, und er selber stieg eben mit vorsichtigen und unbehülflichen Schritten, ein paar riesige, an seinen Fersen hängende Sporen nachschleifend, daraus zu. Der alte Bursche ging, als ob er lahm an allen Gliedern sei und kaum einen Fuß vor den andern setzen könne; sobald er aber nur mit der Linken Zaum und Mähne seines muntern Thieres erfaßt hatte, war er gleich ein anderer Mensch. Der Körper richtete sich empor, der Kopf hob sich, die Augen blitzten, und kaum hatte er sein Pferd gelöst, als er sich, wie von einer Feder emporgeschnellt, in den Sattel warf.
Das wackere Thier fühlte den mahnenden Schenkeldruck, hob sich auf die Hinterbeine, und im nächsten Augenblick wären Roß und Reiter die Straße hinabgeflogen, als der Blick des Alten auf den Fremden fiel und fast unwillkürlich die Hand den Zügel schärfer faßte. Don Diego wünschte aber gerade hier kein Gespräch mit ihm, und ebenfalls zu seinem Pferd schreitend, nickte er dem Alten nur zu, hob sich in den Sattel und sprengte rasch voraus der Richtung zu, die, wie er vorher gesehen, der alte Gaucho ebenfalls einschlagen wollte. Dieser war auch bald an seiner Seite, und neben ihm hinreitend rief er:
„Auch schon gerüstet, Seňor? - Ich glaube, es liegt uns Allen im Blut, daß wir keine Ruhe haben. Wenn wir's auch nicht sehen können, fühlen wir doch, daß da draußen ein Unheil für uns brütet."
„Und welches Unheil könnte uns noch hier bedrohen?" sagte Diego, der den Blick des Alten fest auf sich haften sah. /36/
„Los Indios“, sagte finster der Alte, indem sein Blick unwillkürlich nach dem weiten, unbegrenzten Süden der Steppe hinüberstreifte.
„Und habt Ihr etwas von ihnen gemerkt, Amigo?" frug Diego.
Der Alte antwortete nicht, der Blick aber, den er seinem Begleiter zuwarf, verrieth mehr, als er vielleicht sagen und aussprechen mochte.
„Nun? - Ihr habt etwas auf dem Herzen," drängte der Fremde. „Mißtraut Ihr mir, ob ich es ehrlich meine?"
„Ehrlich? - das ist ein weiter Begriff in unserer Zeit," brummte der Alte vor sich hin. „Ehrlich meint es Don Manuel auch - wie er wenigstens sagt. Ehrlich meint es der Officier, der das arme Mädchen als Gefangne mit sich schleppt - ehrlich - in ihrer Art - meinen es die Unitarier vielleicht ebenfalls - wenn man das auch nicht gerade überall aussprechen dürfte, und ehrlich meinen es selber die verwünschten Indianer; ehrlich nämlich im Rauben und Stehlen, woraus sie nicht das geringste Hehl machen und unsere Heerden demnach so gewaltsam als offen wegtreiben. Es ist ein wunderliches Wort und läßt sich zu Allem gebrauchen."
„Also als Gefangene?" rief Don Diego, der hierin eine Bestätigung des von dem Wirth Gehörten fand.
„Thut nur nicht so überrascht," sagte aber der Alte trocken. „Wenn Ihr das nicht schon früher wußtet, weshalb hättet Ihr dem Mädchen gestern Abend heimlich einen Zettel in die Hand gedrückt? Bah, bemüht Euch nicht; wenn ich Euch hätte verrathen wollen, wäre es lange geschehen. Von mir habt Ihr nichts zu fürchten."
„Auch nichts zu hoffen, Compaňero?" sagte der junge Mann rasch, und sein Blick haftete fest auf den wetterharten braunen Zügen des Alten, in denen eine wunderliche Mischung von Ehrlichkeit und Verschmitztheit lag.
„Alle Wetter," grinzte dieser, „Ihr reitet rasch und ziemlich unbekümmert vorwärts, Amigo. Aber Geduld, sonst überspringt Ihr Euer Ziel, und - das wäre gefährlich."
„Und haben wir nicht etwa Geduld genug gehabt?" sagte ingrimmig in sich hinein der junge Fremde. „Ist das etwa /37/ ein freies Land, wo Jeder, der ein freies Wort nur spricht, schon fürchten muß, in der nächsten Stunde die Banden der mashorca10 auf seinen Fersen zu haben."
„Ihr habt vollkommen Recht," sagte vorsichtig der Alte, indem er sein Pferd einzügelte und aufmerksam nach Osten hinüberschaute. „Aber was könnt Ihr thun? Nur der Schein einer Widersetzlichkeit, und unter dem Namen von Unitariern könnten wir ein eben so ruhiges und gemüthliches Leben führen, wie ein toller Hund mit dem Geschrei einer ganzen Stadt auf seiner Fährte."
„Aber Ihr seid Männer hier?"
„Ja - die ausgenommen, die eben Weiber sind," lachte der Alte. „Geduldet Euch, Amigo."
„Geduld und ewig Geduld!" rief Don Diego, indem seine Hand dabei unwillkürlich den Griff des Messers suchte. „Die Geduld eines Heiligen müßte ermüden, dieser jämmerlich ewigen Knechtschaft gegenüber."
„Aber was wollt Ihr thun?"
„Und wenn ich Euch nun Hülfe brächte?"
„Wahrt Euch vor der Hülfe, die Ihr im Sinne habt," sagte der Alte plötzlich sehr ernst. „Traut mir; ich bin ein alter Mann und in den Pampas groß geworden, kenne auch in der That keine andere Welt. Nur zweimal war ich in Buenos Ayres und einmal in Mendoza. Aber die Indianer kenn' ich und weiß, was wir von ihnen zu befahren haben. Es ist eine tapfere, wilde, urkräftige Nation, ja; aber falsch und verrätherisch gegen die Weißen, wie auch immer ihre Versprechungen mögen gelautet haben. - Laßt mich ausreden, Amigo. Ja, so lange ihr eigener Nutzen mit im Spiel ist, da dürft Ihr Euch auf sie verlassen, aber nicht eine Secunde darüber hinaus. Schließt heute mit einem ihrer Häuptlinge einen Vertrag gegen wen Ihr wollt, selbst gegen Rosas - denn hier zum Teufel - ist doch wenigstens Niemand, der uns hören kann - und Ihr werdet sie unermüdlich auf seinen Spuren finden. Laßt ihn aber in Unterhandlung mit ihnen treten und mehr bieten, und sie reißen ihre Pferde auf den /38/ Hinterbeinen herum und schleudern Euch die gegen ihn gehobenen Bolas an den Schädel. Trau' ihnen der Böse."
„Und wenn Ihr Alles mit ihnen erreicht habt, was Ihr erreichen wolltet?"
„Ja, wenn! Aber gut Ding will Weile haben, und nochmals, Seňor, Ihr spielt mit jenen rothen Horden ein gefährlich Spiel."
„Woher wißt Ihr, daß ich überhaupt je mit ihnen zusammenkam - daß ich nur Einen von ihnen kenne?"
„Erinnert Ihr Euch, daß Ihr am letzten Sonntag mit einem Trupp der rothen Halunken zusammen dem Rioquarto zurittet und daß der Führer der Horde dort ein einzeln weidendes Pferd fing?"
„Wer hat Euch das verrathen?" rief Don Diego, jetzt wirklich auf's Aeußerste erstaunt.
„Das Pferd hier, das ich reite," entgegnete der Alte mit verhaltenem Spott, „könnte Euch noch mehr davon erzählen, wie ich. Es ist das nämliche, das damals ein rothes Mädchen tragen mußte. Ich selber aber lag mit meinem Sattel unter ein paar Weidenbüschen ganz in der Nähe versteckt, und blieb auch dort bis spät in die Nacht, denn ich wußte recht gut, daß mein alter Brauner hier zu mir zurückkommen würde, sobald er sich nur halbweg frei und unbehindert sähe."
„Und Ihr habt mich erkannt?"
„Ihr standet nicht zehn Schritt von mir ab, als der rothe Heide seinen Lasso um den Hals meines Thieres warf," schmunzelte der Alte, „und einmal hatte ich gar nicht übel Lust, heraus zu fahren und ihm mein Messer zwischen die Rippen zu rennen. Zu Fuß ist der Mensch aber ein unbehülf- lich Geschöpf, und ich blieb lieber ruhig liegen, bis mein gutes Pferd zu mir kam, mich abzuholen."
„Habt Ihr dem Officier eine Anzeige davon gemacht?"
„Caracho!" fluchte der Alte tief in den Bart hinab, „er soll sich seine Kundschaft selber holen, wenn er dergleichen haben will. Rosas hat Alles von mir bekommen - oder genommen, was er je bekommen soll; wir Beiden sind fertig mit einander. Aber erscheint einmal die Zeit" - der Alte griff seinem Thier so ingrimmig in die Zügel, daß es hoch /39/ aufbäumte, sammelte sich jedoch rasch wieder, und dem Rosse beruhigend den Hals klopfend, fuhr er fort: „komm - komm - Brauner - du kannst nichts dafür, daß die beiden braven Jungen in's Gras beißen mußten. Waren ihnen doch bessere Leute schon vorangegangen."
„Ihr habt Freunde, Verwandte verloren?"
„Ja, Seňor, zwei Söhne."
„Im Kriege?"
„Wenn es im Krieg gewesen wäre, wollt' ich nichts sagen," sprach der alte Mann. „Es ist einmal unser Loos, daß wir draußen im Felde unser Leben, dem Feinde gegenüber, wagen. Thut der Feind doch auch dasselbe, und es bleibt immer ein gleiches Spiel. Meine beiden armen Jungen fielen aber auf andere Art in Rosas' Dienst, durch Rosas selber, und treuer haben doch nie zwei Herzen an seiner Sache gehangen, wie die Beiden!"
„Rosas ist eben nicht seiner Dankbarkeit wegen berühmt," knirschte Diego. „Ich kenne das, Amigo, auch meine Verwandten sanken unter seinen Streichen. Wo fielen Eure Söhne?"
„Sic waren in der Begleitung des tapfern und wackern Quiroga11," preßte der Alte zwischen den zusammengebissenen Zähnen hindurch. „Ihr kennt die Geschichte. Jeder Argentiner wenigstens kennt sie.
„Quiroga war in des Dictators Weg; er mußte bei Seite geräumt werden, denn er wußte zu viel von Rosas, und als er Buenos Ayres verließ, war die Mörderbande schon bereit, die ihn unschädlich machen solllc. - Heilige Jungfrau; es war ein furchtbarer Anblick, als wir die Leichen fanden. Quiroga selber hatte einen Schuß durch's Herz oder nahe am Herzen hin. Dazu zwanzig oder dreißig Messerstiche im Körper, von denen jeder einzelne genügt hätte, ihn aller weiteren Erdensorgen zu entheben. Seine Begleiter - wackere Jungen! Wie sie gekämpft haben mußten! Der Grund umher war mit Blut bedeckt, und Meilen weit fanden wir die rothen Spuren. Aber der Uebermacht konnten sie freilich nicht widerstehen, und wenn sie selber auch nichts gegen Se. Excellenz verbrochen hatten, durften sie doch nicht leben, um nicht gegen /40/ ihn oder einen seiner Helfershelfer zeugen zu können. Sie liegen alle unter dem grünen Rasen, und kleine rothe Kreuze bezeichnen die Stelle, an der sie ihre Ruhestätte fanden. Es will mir seither vorkommen, als ob es der Kreuze hier im Lande fast zu viele würden."
„Und ahnt Ihr nicht, daß in der Sache eine Aenderung eintreten muß?" sagte Diego leise, aber dringend.
„Ja," bestätigte ruhig der Alte. „Lange kann es nicht mehr so bleiben. Die Furcht hält allerdings noch selbst die Muthigsten im Zaum. Keiner wagt es, seine Meinung offen zu sagen oder gar Partei zu ergreifen. Der geringste Funke aber, der in das Pulverfaß fällt, und die ganze Bescherung platzt in Feuer, Flammen und Blut zusammen. Gnade Gott dann dem Besiegten!"
„Wenn nun der Funke schon geschleudert wäre, Amigo, - wenn - aber was habt Ihr dort nur in einem fort zu sehen?" unterbrach sich Diego plötzlich, als der Alte, aufmerksamer wie vorher, nach Osten hinüberschaute, und sich dabei, so hoch das gehen wollte, im Sattel emporrichtete.
„Dort," versetzte gelassen der Alte, „kommt der Correo mit den Privat-Depeschen Sr. Excellenz für die Gouverneure im Westen. Auch gewöhnlich noch mit einem Sack voll Unzen für Nebenzwecke. Wer weiß, wie manches Todesurtheil der lederne Mantelsack birgt, den er mit sich führt, wie mancher Tropfen Blut an den paar Depeschen hängt, die er bringt."
„Glaubt Ihr denn, daß jetzt gerade so viel Schlimmes im Werke ist?" fragte Diego gespannt.
„Das Volk erzählt sich wieder allerlei," antwortete der Alte, „und Gerüchte, so unbestimmt sie lauten mochten, gingen meist eben den grausamsten Thaten voran. So erzählte man sich damals schon heimlich in der ganzen Provinz Buenos Ayres, daß Quiroga mit seinen Begleitern den Staat Santa Fé nie glücklich passiren würde. Niemand wußte, woher das Gerücht kam, aber es war da, und als die blutige Kunde der Mordthat später eintraf, nickten die Leute nur schweigend mit den Köpfen und - die Sache war abgemacht."
„Und jetzt -?"
„Der Gouverneur von Mendoza scheint Sr. Excellenz im /41/ Wege zu sein," erklärte der Alte trocken. „Es passirt ihm so manchmal mit Einzelnen. Vielleicht läßt er ihn zu einer „Verständigung" nach Buenos Ayres laden. Aber ich verplaudere hier meine schöne Zeit, Seňor, während ich frische Pferde für den Correo und seine Packthiere eintreiben soll. Auf Wiedersehen denn, da Ihr schon in der Abreise begriffen seid."
„Nein, ich kehre nach Cruzalta zurück," sagte Diego.
„Zurück?" rief der Alte, wirklich erstaunt. „So wißt Ihr nicht, daß der Officier Argwohn gegen Euch geschöpft hat?"
„Ich fürchte ihn nicht," betheuerte der junge Mann mit kecker Miene. „Sagt mir nur, auf wie viele Arme der in Cruzalta rechnen könnte, welcher einen Schlag für die Freiheit des Landes versuchen sollte."
„Auf alle," brach der Alte schnell und mit funkelnden Augen los, „wenn es mit einiger Aussicht auf Erfolg und in Gemeinschaft mit anderen sich empörenden Orten geschieht. Auf keinen aber, wenn Ihr oder sonst Jemand wahnsinnig genug wäret, etwas Derartiges mit einer Horde blut- und beutegieriger Indianer zu unternehmen," setzte er ruhiger und fast abweisend hinzu.
„Wenn ich Euch nun bestimmte Beweise von Rosas' Verrätherei brächte?"
„Stecken sie vielleicht in dem Postfelleisen des Correo?" sagte lauernd der Alte. „Ja, wer sie in die Hand bekäme!"
„Es ist gut," lenkte Don Diego kurz ein. „Weshalb so viele Worte machen, wo doch nur Thaten überzeugen können. Ihr werdet mich nicht im Stich lassen, wenn ich wirklich Hülfe brauchen sollte, denn ich bin überzeugt, daß Ihr Euer Vaterland liebt und seinen Unterdrücker haßt, so heiß wie ich. Also Adios - wir treffen nachher wieder zusammen."
„Und wo wollt Ihr hin?"
„Einen kleinen Spazierritt machen, um nach dem-gestrigen Regen die frischen Spuren abzusuchen."
Der Alte sah ihn einen Augenblick forschend an, schüttelte dann leise mit einem tief aus der Brust geholten Seufzer den Kopf, drehte sein Pferd ab und ritt schweigend einer kleinen Heerde von Pferden zu, die unweit von da das süße Gras abweideten. /42/
VI.
Don Diego hielt sich nicht länger mit nutzlosen Betrachtungen auf, sondern seinem Thier die Sporen gebend, sprengte er mitten in die Steppe hinein, bis er, durch einige leichte Anschwellungen des Bodens verdeckt, von Cruzalta aus nicht mehr beobachtet werden konnte. Dann nahm er einen andern Cours gerade nach Westen hinüber, dem er aber kaum fünf- oder sechshundert Schritt weit folgte.
Niedriges holziges Gestrüpp deckte hier den Boden, harte, vertrocknete Distelarten und andere rauhe Gräser, von denen Diego bald einen Vorrath ansgerissen und in einem länglichen Haufen aufgeschichtet hatte. Das gethan, nahm er seine Messing-Zunderbüchse aus dem Gürtel, öffnete sie, hielt den Stein darunter und schlug Feuer. Wenige Secunden später stieg von dem noch von dem gestrigen Regen feuchten Reisig und Wurzelwerk ein leichter dunkler Qualm kerzengerade in die Luft empor.
Während das Pferd in der Nachbarschaft nach Futter suchte, blieb der Fremde eine Zeit lang neben dem Rauch sitzen, drehte sich eine kleine Papiercigarre, zündete sie an und blies den Dampf in die blaue Luft hinaus. Als er sie ausgeraucht hatte, stand er auf, schritt auf sein Pferd zu, sprang in den Sattel und schlug die nämliche Richtung ein, der er hierher, gefolgt war, bis er sich weit genug von dem angezündeten Feuer entfernt glauben mochte. Dann hielt er wieder dem Städtchen zu, das wie eine kleine Insel mitten in der Steppe lag, und erreichte es in demselben Augenblick, als durch die andere Straße der argentinische Correo mit zwei Packpferden und einem Postillon oder Treiber in vollem Galopp hereinsprengte.
Der Moment war für ihn auch insofern günstig, als der Officier jetzt durch die für ihn eingetroffenen Depeschen vollständig in Anspruch genommen wurde und sich für den Augenblick um nichts Anderes kümmern konnte. Don Diego kehrte indessen in die Pulperia zurück, wo der Correo eben sein abgeladenes Gepäck in eine Ecke der Stube aufschichtete, seine /43/ beiden Trinkhörner mit Caňa füllen ließ und selber einen kleinen Imbiß nahm.
Unser Freund erkundigte sich angelegentlich nach Briefen an Matanzas, der Correo sah vergebens seine Tasche durch und suchte dabei von den Umstehenden die neuesten Berichte über „los Indios" einzuziehen, die ihn außerordentlich interessirten. Wenig aber konnten ihm die Bewohner von Cruzalta erzählen, da die Indianer sich natürlich nicht an die mit Bewaffneten gefüllte Stadt hinangewagt hatten. An der Nähe waren sie gespürt worden, ja, und einzelne Rinder und Pferde hatten sie auch aus der Nachbarschaft, trotz des Militärs, mit fortgetrieben. Weiter aber wußte man nichts von ihnen, als daß sie sich immer noch im Süden in ihren alten Schlupfwinkeln hielten, sofern es ihnen nicht eben gefiel, von da aus zurückzukehren. Wie der Pampero stürmte sie dann heran, rasch und unaufhaltsam, und ehe man den Schlag ordentlich fühlte, waren sie auch schon wieder wie der Sturm verschwunden.
Die Bewohner von Cruzalta wollten jetzt ihrerseits ebenfalls Kunde von dem Erbfeind haben, und da kamen sie bei dem Courier gerade an den Rechten. Nicht umsonst hatte er die weite einsame Bahn durchritten und in jedem Ort, auf jeder estancia die schrecklichsten Geschichten über einst verübte und für künftig befürchtete indianische Greuelthaten aufgegriffen, um sie hier nicht wieder an dankbare und ängstlich lauschende Zuhörer verwerthen zu sollen. Um ihn hergedrängt in dichter Masse standen denn auch bald Männer und Frauen, seinen furchtbaren Schilderungen mit der gespanntesten Aufmerksamkeit zu horchen, und kein Wort, das er sprach, fiel auf unfruchtbaren Boden.
Der alte Gaucho kam indessen mit den eingetriebenen Pferden zurück, und daß diese augenblicklich vorgeführt und gesattelt wurden, verrieth Diego, wie kurze Zeit der Correo hier zu verweilen gedenke. Vergebens hatte er indessen gesucht, auch nur in die entfernteste Sicht von der jungen Fremden zu kommen, die von dem Argentiner so scharf gehütet wurde. Sie ließ sich auch draußen nirgends blicken. Nur jetzt eben glaubte er vom Hof aus an einem der kleinen Fen-/44/ster den Schein ihres lieben Antlitzes zu erkennen. Im Nu war es aber wieder verschwunden, und Don Pasquale selber, der in diesem Moment in den Hof trat, machte seinen weiteren Forschungen ein so rasches wie unvermutetes Ende.
„Seňor," sagte er, sich zu dem Fremden wendend, „ich möchte Sie fragen, wohinaus Ihr Ziel liegt?"
„Mein Ziel?" frug Don Diego erstaunt. „Ich weiß nicht, Seňor, ob Sie ein Recht haben, mich danach zu fragen. Da es aber gerade kein Geheimniß ist, so mögen Sie es auch eben so gut erfahren. Ich hatte im Anfang die Absicht, von hier nach Buenos Ayres zu gehen; die furchtbaren Geschichten aber, die der Correo von den Indianern erzählt, haben mir nicht gefallen, und ich werde mich hüten, meine Kehle ihrer Barmherzigkeit preiszugeben."
„Kehlen sind hier billig im Lande," brummte der Officier. „Es trägt Mancher eine mit sich herum, die er ungemein in Acht nimmt, während sie doch schon nicht einmal mehr sein ist und in der „Stadt" vielleicht für einen Spottpreis verkauft wurde."
„Sie haben Recht, Seňor," sagte kaltblütig der Fremde, „und wir thun möglicher Weise den Rothhäuten sehr unrecht, sie wild und grausam zu nennen. So flink mit ihren Messern sind sie noch immer nicht bei der Hand, als die Mashorqueros Sr. Excellenz, den Gott uns noch lange erhalten möge."
„Amigo," sagte der Officier, indem er zu ihm trat und seine Hand derb vertraulich auf dessen Schulter legte, „wenn man Ihnen in's Herz sehen könnte, möchte man vielleicht einen andern Wunsch darin finden, aber - was thut's? Jedenfalls habe ich um die Ehre Ihrer Gesellschaft nach San Luis zu bitten, wohin ich Auftrag habe, den Correo zu geleiten."
„San Luis?" scherzte Don Diego, „ich wüßte nicht, daß ich die mindeste Lust verspürte, San Luis zu besuchen. Meine Heimath ist in Cordova, und wenn ich Cruzalta verlasse, wird es nur geschehen, dorthin aufzubrechen."
„Sie werden sich den Befehlen Sr. Excellenz nicht widersetzen wollen."
„Den Befehlen Sr. Excellenz? Ich zweifle sehr, ob Sr. /45/ Excellenz überhaupt weiß, daß ich auf der Welt bin," engegnete Don Diego. – „Hier waltet jedenfalls ein Irrthum ob, oder – eine Willkür, der ich mich dann vielleicht nicht gutwillig fügen würde.“
„Wie Sie sich fügen, bleibt sich gleich, Seňor,'' sagte in barschem Ton der Officier, „daß Sie aber dem Befehl gehorchen, ist meine Sorge."
,Und kennen Sie mich denn überhaupt auch nur meinem Namen nach?"
„Wie Sie sich gegenwärtig nennen, bleibt sich gleich, sagte der Officier, „mir ist die Beschreibung Ihrer Person zugekommen; sie genügt."
„Von Buenos Ayres?"
„Von San Luis."
„Bueno," sagte Don Diego gefaßt, indem er sich abwandte, seine innere Bewegung zu verbergen. „Das Woher bleibt sich ebenfalls gleich. Einem Regierungsbefehl darf ich mich nicht widersetzen. Jedenfalls ist es ein Mißverständniß, das sich rasch aufklären wird. Wann reiten Sie?"
„In einer Viertelstunde."
„Allein mit dem Correo?"
„Ich habe Auftrag, ihn mit dreißig Mann zu begleiten."
„Pest," verschluckte Don Diego hinter den Zähnen und es war gut für ihn, daß Don Pasquale in diesem Augenblick seine Aufmerksamkeit weit mehr dem oberen Fenster, als seinem neuen Gefangenen zugewandt hatte. Zum Ueberlegen blieb ihm aber nicht mehr Zeit, die Würfel waren gefallen, und was jetzt geschehen sollte, mußte eben geschehen.
Einen Augenblick dachte er freilich an Flucht. Wenn er sich jetzt auf sein Pferd warf - es war ein wackeres, schnelles Thier, und einmal vor dem Feind einen Vorsprung, so konnte er vielleicht jene Gegend erreichen, in der, wie er wußte, die Indianer im Hinterhalt lagen - aber auch nur vielleicht. Außerdem berührte schon von draußen das Lachen und Schreien der sich sammelnden Reiter sein Ohr. Der Befehl zum Aufbruch war gegeben, und ein Blick auf die gerüstete Schaar überzeugte ihn, daß jeder Versuch zur Flucht Wahnsinn gewesen wäre. /46/
„Geduld," flüsterte da eine, leise vorsichtige Stimme an seiner Seite, und als er flink den Kopf danach wandte, sah er den alten Gaucho, der, ohne auch nur einen Blick auf ihn zu werfen, gleichgültig an ihm vorüber und dem Gepäck des Correo zuschritt, das er mit kundiger Hand begann auf die Sättel der beiden Lastthiere zu schnüren. Der Correo war zu ihm getreten und bezeichnete ihm die bequemste Lage der in rohe Häute fest eingeschnürten Packete, half ihm auch hier und da sie richten und heben, daß sie die Thiere nicht drückten oder sich wieder locker schüttelten, und schien im Augenblick für weiter nichts Sinn und Auge zu haben, als für seine Fracht.
„Sind Sie fertig, Seňor?" sagte da der Officier, der wieder an seine Seite trat. „Bedeutendes Gepäck werden Sie wohl überdies nicht mit sich führen - sonst mag es auf das Damenpferd geladen werden."
„Nichts weiter, als was in meiner Satteltasche Raum hat," sagte Diego - „aber nehmen Sie Damen mit?" - Ein leichtes Roth färbte die Wangen des Soldaten, als er antwortete:
„Ich selber bin in San Luis heimisch - Donna Josefa wird dort bei meiner Mutter wohnen, bis wir - die Unitarier ausgerottet haben."
„Donna Josefa -"
„Ist meine Braut," sagte mit einem festen und drohenden Blick der Soldat, und damit, als ob Alles erschöpft wäre, was sich über die Sache eben sagen ließ, wandte er Diego den Rücken und schritt langsam seinen Leuten zu.
Diese brauchten keine weitere Vorbereitung - nur ein breitgeschnittenes Stück Fleisch hieb sich jeder von einem vor wenigen Minuten erst mit den Lasso niedergerissenen und abgestochenen Stier, dem zwanzig geschickte Hände in kaum einer halben Minute die Haut abstreiften. Eben so rasch ward der noch blutige Braten zwischen dem Sattel und einem darauf gebreiteten Schaffell untergebracht; ein dünner Riemen schützte es vor dem Abfallen, und ihrer Nahrungsmittel so für den Tag versichert, standen die wilden Burschen, ihre Linke an der /47/
Mähne ihrer Thiere, schäkernd und plaudernd des Rufs gewärtig, der sie in ihre Sättel schnellte.
Dreißig sonnengebräunte, wettermitgenommene Gestalten, alle in die malerische Uniform der argentinischen Kavallerie gekleidet, lehnten so neben eben so vielen Pferden, während ihre Kameraden, deren Thiere noch draußen auf der Weide herumliefen, neugierig und auch wohl neidisch sie umdrängten. Die hatten es gut, die durften jetzt wieder frei und flüchtig über die Steppe jagen, vielleicht heute oder morgen schon den wilden Feind zu treffen, während sie hier, eingeengt in die schmutzigen, von Ungeziefer bevölkerten Lehmmauern, Tag um Tag verträumen mußten und vor Langerweile hätten an den Wänden hinauflaufen mögen.
Womit sich auch beschäftigen? - Geld hatte Keiner von ihnen, denn das Wenige, was sie gehabt, war lange in caňa vertrunken, und außerdem schon auf den nächsten Löhnungstag gesündigt, - womit sollten sie also spielen, und eine weitere Unterhaltung kannte Keiner von ihnen.
Die Aufmerksamkeit der Leute richtete sich plötzlich auf die schmale Thür, die in den innern Hof führte. Das Pferd mit dem Damensattel war dort vorgeführt; ein junger Bursche hielt es am Zaum, und der alte Gaucho, der heute bei dem Gepäck eine bedeutende Rolle zu spielen schien, ging hinein und kam nach etwa zehn Minuten mit einer kleinen leichten Satteltasche und zwei etwas schwereren Paketen heraus, die er rasch auf ein anderes Pferd befestigte.
Noch stand Diego, die Augen fest auf die Thür geheftet, in der er jeden Moment die Gestalt Josefa's zu sehen fürchtete, als der Alte an seine Seite trat und ihm sein eigenes Thier fertig gesattelt und gerüstet vorführte.
„Hier der Ring saß nicht mehr ordentlich fest," sagte er, indem er das eine Schaffell in die Höhe hob und aus den Sattel deutete, „ich habe es mit einem Riemen wieder angelegt."
Don Diego, ohne der Worte zu achten, warf nur einen fluchtigen Blick auf die bezeichnete Stelle; da sah er, wie der Alte vorsichtig ein kleines zusammengerolltes Papier unter den Ring schob, das Schaffell dann wieder fallen ließ und an seine /48/ andere Arbeit ging, als ob nichts vorgefallen wäre. Im Nu hatte Diego die Felle wieder zurückgeworfen - sah doch jetzt Jeder, wo es einen langen Ritt galt, nach seinem Sattel; im nächsten Moment rollte er das Papier auf und fand mit kleiner zierlicher, aber vollkommen deutlicher Schrift in französischer Sprache geschrieben die Worte: ,,Rettet mich!"
Langsam nahm er das Papier, holte seinen Tabak heraus, drehte sich davon eine Cigarre und steckte diese an, jeden möglichen Verrath dadurch vernichtend. - Also wider ihren Willen wurde sie fortgeführt; gefangen, wie er selbst gefangen war, hülflos und unschuldig, einem dieser argentinischen Henkersknechte übergeben, um sie aus dem Weg zu schaffen und unangenehme Erinnerungen an blutende Leichen zu vertilgen.
Aber was konnte er selber thun? - Er allein zwischen den Bewaffneten, die sich eben anschickten, sie an einen Ort zu führen, den er selber nicht wagen durfte zu betreten - San Luis, denn daß ihm gerade von dorther nachgespürt wurde, das zeigte ihm die dringende Gefahr, in der er selber sich befand. Jetzt dachte er jedoch nicht an sich - gerade aus dem Haus, das bleiche Antlitz von Thränen naß, von anderen ebenfalls weinenden Mädchen begleitet, trat Josefa, und hatte ihr Blick auch ihn vorher gesucht, so schrak sie doch jetzt zusammenschaudernd vor der wilden Schaar Bewaffneter zurück, die hier jede Aussicht auf Rettung erbarmungslos vernichtete.
Wie träumend stand Diego, und sah das Alles, als kaum der Wirklichkeit angehörend, an sich vorübergleiten, als der Wirth mit seiner gefüllten Satteltasche auf ihn zuschritt. .
„Seňor," sagte er freundlich und leise, „Sie sind nicht meiner Warnung gefolgt - ich wußte, daß Ihnen Uebles drohte, aber wir Alle haben Sie gestern lieb gewonnen, - wir Alle wünschen und hoffen, daß Sie dieser Gefahr wohlbehalten entgehen sollen. Hier in der Tasche finden Sie einen Imbiß, falls Sie - vielleicht den Soldatentrupp einmal verlieren sollten - keinen Dank, bitte, Ihre Zeche haben Sie schon mehr als reichlich bezahlt und - es ist Zeit zum Aufsitzen. Der Officier giebt das Zeichen. Wollen Sie mein/49/nem Rath jetzt folgen, so fügen Sie sich vor der Hand in das Unvermeidliche. Geduld, und kommt Zeit, so kommt Rath. Sie sehen mir gerade so aus, als ob Sie der Mann wären, den richtigen Augenblick zu benutzen.“
„In den Sattel!" dröhnte die Stimme des Officiers über den engen Hofraum hin, und noch war das Wort kaum über seine Lippen, als die Gaucho-Soldaten wie mit einem Schlag in ihren Sätteln saßen. Die Ponchos über die rechte Schulter zurückgeworfen, den rechten Arm für Lasso und Carabiner frei zu behalten, tummelten sie ihre Pferde dem Eingang zu. Nur der Correo, sich wenig um das militärische Commandowort kümmernd, zögerte noch; der eine Packen des zweiten Lastthieres schien ihm nicht recht fest zu liegen und er trat dort hinüber, das zu untersuchen, schnallte auch den wohl zwei Hände breiten Sattelgurt des armen Thieres, trotz dessen Stöhnen, noch fester, und Alles jetzt in Ordnung wissend, stieg er ebenfalls langsam und bedächtig in den Sattel.
„Fertig zum Aufbruch, Correo?" sagte der Officier.
„Wie Ihr seht, Seňor! Aber ich möchte Sie auf Eins aufmerksam machen -"
„Und das wäre?"
„Ich habe Sr. Excellenz fest versprechen müssen, spätestens am 2. in San Luis zu sein. Das Gold, das ich bei mir führe, muß an dem Tag abgeliefert werden, und wenn die Seňorita die Beschwerlichkeiten unseres scharfen Rittes nicht aushält -"
„Meine, eigenhändig von Sr. Excellenz unterschriebene Depesche lautet," erwiderte der Officier, „Euch, ohne Bestimmung eines Datums, sicher nach San Luis abzuliefern und die Dame in der Escorte mitzunehmen. Ich habe Euch die Schrift selber gezeigt."
„Bueno, wir werden sehen," sagte der alte Reiter; „daß Ihr mich richtig abliefert, ist also Eure Sorge, daß ich zu rechter Zeit dort eintreffe, die meine. Das Frauenzimmer geht, wie Ihr einsehen werdet, mich nichts an, und Ihr habt also weiter mchts zu thun, als mit mir Schritt zu halten. Daß ich nicht warte, darauf könnt Ihr Euch übrigens verlassen.“ /50/
„Was Eure Person betrifft, Seňor," sagte der Officier gemessen, „so mögt Ihr mit der machen, was Euch beliebt - Eure Depeschen und Gepäck sind mir anbefohlen und bleiben unter meinem Schutz."
„Haltet Ihr sie gewaltsam zurück," rief der Correo, „gut, so habe ich nichts dagegen einzuwenden; auf Euer Haupt aber auch nachher die Verantwortung. Und nun vamos, Seňor. Wir vergeuden hier die schöne Zeit in einem höchst nutzlosen Wortkampf."
Don Diego war im Sattel und, während Don Pasquale mit dem alten hartnäckigen Correo stritt, an Josefens Seite geritten.
„Ihr begleitet uns, Seňor?" flüsterte das schöne Mädchen schüchtern.
„Für jetzt nur als Gefangener, wie Ihr," sagte Don Diego rasch, „aber vertraut mir - Euer Bruder sendet mich von Montevideo - haltet Euch zu mir, wenn sich Gelegenheit zur Flucht bietet, und ich werde -"
Sein Flüstern wurde kurz abgebrochen, denn der alte Gaucho hieb plötzlich mit seiner Revenca Diego's Pferd so derb auf die Hüfte, daß es mit einem Satz nach vorn und mitten in den Hof flog. Es war die höchste Zeit gewesen, denn gerade wandte sich der Officier nach ihm um.
„Ach, ich sehe, Ihr seid beritten, Seňor - gut denn, vamos. Ihr werdet Euch an meiner Seite halten. Draußen im Freien - Euch die Unannehmlichkeit hier vor den Leuten zu ersparen - bitte ich Euch dann um Euer Messer und Euren Lasso - keine Widerrede, Seňor, ich bin berechtigt, Euch die Waffen abzunehmen und könnte sie gleich hier von Euch fordern."
„Paciencia!" rief in dem Augenblick der alte Gaucho dem einen Packthiere zu, das er kurz vorher erst selber durch einen Peitschenschlag, vielleicht absichtlich, gereizt hatte - „I'aciencia, amigo mio."
Don Diego neigte sich leicht gegen den Officier und sagte lächelnd:
„Ich danke für die Nachsicht; übrigens wäre es blos zu meiner eigenen Bequemlichkeit, wenn ich Messer und Lasso /51/ nicht unterwegs zu tragen brauche, denn unter solcher Bedeckung kann ich mich wohl auf kurze Zelt der Wehr begeben. Draußen also steht Ihnen, was Sie begehren, zu Diensten, Seňor, und ich hoffe nur, daß wir einen raschen und angenehmen Ritt haben, den mich betreffenden Irrthum in San Luis sobald als möglich aufgeklärt zu sehen."
Don Pasquale neigte statt aller Antwort nur den Kopf. Der Correo hatte aber indessen schon begonnen, den Zug anzuführen, obgleich ihn anfänglich die Unterofficiere daran zu verhindern suchten. - Den alten Gaucho als Postillon neben sich, trieb er mit seiner langen, schweren, nur mit einem kurzen hölzernen Stiel versehenen Peitsche die beiden Lastthiere vor sich her, daß sie trotz ihrer schweren Ladung in vollem Galopp die Straße hinabflogen. Was kümmerten ihn die Soldaten, ob sie folgten oder nicht, hatte er doch hier im Orte schon mehr Zeit versäumt, als er gut verantworten konnte, und das nächste Nachtquartier lag manche lange Legua von da entfernt.
Der Officier aber mußte wohl oder übel folgen, und einen derben Fluch über den unabhängigen und zu keiner Disciplin zu zwingenden Correo in den Bart murmelnd, ordnete er mit raschem Commandoruf seine Leute, und sprengte, Josefens Pferd neben sich haltend, mit Don Diego an seiner andern Seite, seiner Schaar voran, die Straße hinab und in die unabsehbaren Pampas hinaus.
VII.
Reihe und Glied hielten die Burschen, die da so wild und fröhlich auf ihren Pferden hingen, allerdings nicht, und erst einmal im „campo" draußen, und der ganze Zug löste sich in einen wilden, ordnungslosen Schwarm auf, der bald rechts, bald links hinaus von den Fährten der Caravanen seinen besten Pfad auf dem weichen Grasboden suchte. Mannszucht aber hatten sie doch genug, bei einem etwaigen Commandoruf wieder rasch in ihre Plätze einzufallen, und plötzliche Ge-/52/fahr war überhaupt nicht in den Pampas zu befürchten, wo der Horizont, so weit wie der des Meeres, einen Ueberblick nach allen Seiten gestattete.
Für das Nahen irgend einer der gefürchteten indianischen Schaaren gab es überhaupt bestimmte Anzeichen, die den Bedrohten Zeit genug gönnten, sich auf einen Angriff vorzubereiten, hätten sie den überhaupt bei ihrer Zahl und Stärke gescheut. Die wilden braunen Horden der Pampas sprengten gewöhnlich in breiten Zügen durch die Steppe, und vor ihnen flohen die Heerden, floh das gescheuchte Wild und wirbelte der Staub in Wolken auf. Auch konnten die Rothhäute nur von Süden herankommen, denn nördlich hinauf in das Land wagten sie sich schon nicht, weil ihnen dann der Rückweg durch die an der Mendozastraße stationirten Truppen leicht abzuschneiden war. So lange die im Süden sichtbaren Heerden noch ruhig und ungeschrcckt weideten, waren die Indianer auch noch fern, und die kleine Caravane konnte ihren Zug ohne besondere Vorsichtsmaßregeln fortsetzen.
Kaum aus der Stadt hinaus, forderte übrigens Don Pasquale seinem Gefangenen, wie er ihm vorher verkündigt, die Waffen ab - Messer und Lasso nämlich, denn eine andere Waffe trug ein Gaucho selten oder nie. Das Messer schob er in den eigenen Gürtel, den Lasso gab er Einem seiner Leute, ihn hinter sich auf den Sattel zu schnallen, und eigentlich wäre die Wegnahme des Lasso allein schon genügend gewesen, den Gefangenen unschädlich und eine Flucht für ihn unmöglich zu machen. Was konnte er in der Steppe ohne Lasso beginnen!
Don Diego dachte aber an nichts weniger als an Flucht, so lange er Josefen noch in der Gewalt des Soldaten wußte. Aengstlich schlug ihm dabei nur das Herz, wenn er der Folgen gedachte, die sein so schlau angelegter und jetzt völlig durchkreuzter Plan mit den Indianern für ihn haben konnte.
Seine Absicht war gewesen, den Correo mit seinem Postillon, die nie mit Bedeckung ritten, in seinen Hinterhalt zu bekommen, ihm die Depeschen abzunehmen und das Geld, das er bei sich führte, den Indianern als Beuteantheil zu lassen. Zu diesem Zweck hatte er heute Morgen das besprochene Zeichen /53/ durch den aufsteigenden Rauch gegeben, und der Verabredung nach sollte Osantos mit Vier oder Fünf seiner Horde an eier ihm genau bezeichneten Stelle - der Furth eines kleinen Flusses die der Correo passiven mußte, im Hinterhalt liegen.
Was aber konnten diese paar Wilden gegen die vortrefflich bewaffneten und eben so gut berittenen Soldaten ausrechten! Sie durften gar nicht einmal einen Angriff wagen, und zogen sich, sowie sie nur den starken Reitertrupp bemerkten, ohne sich zu zeigen, in ihre bahnlose Stcppenwildniß zurück. - Was jedoch dann? - Was wurde aus Josefen? Was aus ihm?
Von Süden herauf kamen zwei einzelne Reiter gesprengt; da sie aber den Trupp in voller Bewegung sahen, und sehr wohl wußten, der Correo würde nicht aus sie warten, hielten sie eine weite Strecke vor, um der Cavalcade weiter oben zu begegnen. Es waren zwei der zurückgebliebenen Soldaten, die ihrem Officicr, als sie herankamen, meldeten, sie hätten in der Steppe Rauch bemerkt und, vorsichtig den Platz rccognoscirend, weiter nichts gefunden, als ein angezündetes Feuer, jedenfalls bestimmt, irgend ein Zeichen für Jemand zu geben. Nur die Spuren eines einzelnen Pferdes seien in der Nähe zu finden gewesen.
Die Thatsache schien allerdings verdächtig; vor der Hand ließ sich aber nichts weiter damit beginnen, als daß Don Pasquale seinen Trupp mehr zusammenzog, eines Angriffes rascher gewärtig zu sein. Es blieb aber mehr als wahrscheinlich, daß irgend ein indianischer Spion seinen entfernter lagernden Kameraden ein Zeichen gegeben hatte, als die Abtheilung Altacruz verließ. Die Stadt wagten sie aber doch nicht anzugreifen, wo sie die Schußwaffen hinter den Wällen fürchteten, und gegen die Lehmmauern nichts mit ihren Lanzen, Bolas und Lassos ausrichten konnten, und dem gut bewaffneten Zuge, der sich schon eine lange Zeit vorher auf ihren Angriff vorbereiten konnte, hätten sie ebenfalls nicht ungestraft, selbst m großer Mehrzahl, nahen dürfen.
Einige Leguas weit hielt sich die Schaar auch, dem Befehl ihres Officiers gehorchend, in ziemlich fester Drdnung, nur eben so weit links oder rechts abbiegend, als es der aus aufgewühlten Viscacho-Löchern12 oder Distel-Dickichten bestehende /54/ Boden gestattete. Je weiter sie aber vorwärts rückten, und je weniger sich sehen ließ, desto weniger aufmerksam und wachsam wurden sie, und bald durchstreiften sie wieder nach Gefallen den weiten Plan, um hier und da holzige Gräser zusammen zu lesen und später ihr Mittagsmahl - das unter der Satteldecke liegende Fleisch - damit zu kochen.
Sie näherten sich jetzt einem jener kleinen Steppenströme, die ihr träges Wasser durch die Pampas theils dem La Pkata zutragen, theils auch in Sümpfen und kleinen Seen verlaufen, um in der trocknen Jahreszeit dort zu verdunsten. Meistentheils haben diese aber schlammige, schwer zu passirende Betten, denn ein Stein ist hier oft auf zwanzig Meilen weit nicht zu finden; Karren und Pferde können deshalb selten da hindurch, wo ihnen die kürzeste Bahn liegt, sondern müssen sich eben eine Furth, die freilich mit der Jahreszeit wechselt, suchen. Mit der Furth verändert sich denn auch die Straße, und in der Nähe solcher Wasser laufen die tief einschneidenden Wagengleise nach allen nur erdenklichen Richtungen aus - eine wirkliche Aufgabe für den Reisenden, die letzten darunter aufzusuchen und danach die Lage der Furth zu bestimmen.
Der Officier selber war mit dieser Gegend wenig oder gar nicht bekannt, obgleich er sie schon mehrmals passirt haben mochte. Da aber die Furthplätze wechseln, so wußte sogar der Correo nicht genau Bescheid, kümmerte sich auch nicht im Geringsten darum, denn es war des Postillons Sache, der in solchem Fall als Führer zu dienen hat und immer nur von einer Station zur andern mitgenommen wird, die zuletzt erhaltenen Pferde wieder zurückzuführen.
Der alte Gaucho, Felipe, wie ihn der Correo nannte, kannte nun allerdings den Weg vollkommen und hielt mit seinen Packthieren genau die Richtung ein, in der ein Trupp wilder Pferde, nahebei einem Weidengebüsch, graste. Der Correo folgte, mit seiner schweren kurzen Peitsche die armen gehetzten Thiere zu schärferem Galopp antreibend, und hatte eben einen mit höherem dichten Gras bewachsenen Fleck umritten, um dort oben nicht etwa mit dem Pferde in eins der zahllosen kleinen und durch das Gras versteckten Erdlöcher zu gerathen, als dicht vor der hinter ihm im vollen Trupp folgenden Cavallerie /55/ ein Kasuar aufstand und mit langen Schritten, wie ein von der Sehne geschnellter Pfeil, das Weite suchte.
Der alte Bursche hatte hier jedenfalls, entweder in voller Sicherheit, oder auch vielleicht durch etwas erschreckt, seinen Platz in dem langen kühlen Gras genommen, das ihn vollständig verdeckte. Den Correo mit seinen Packthieren ließ er dabei in kaum sechs Schritt an sich vorüber; waren sie ihm doch ausgewichcn und wußte er aus Erfahrung, wie viel gerathener es sei, den Feinden keine Gelegenheit zur Verfolgung zu geben. Das wilde Getrampel der nachfolgenden Schaar aber, die rechts und links von ihm durch das Gras brauste und selbst den Platz nicht schonte, auf dem er lag, schreckte ihn empor. Er hob den Kopf so dicht vor dem einen Pferd, daß dieses über die plötzliche Erscheinung jäh zurückfuhr. Im nächsten Moment, von den zähen eisenharten Läufen emporgeschnellt, von den kurzen unbehülflichen Flügeln im Gleichgewicht erhalten, floh das scheue Thier wie mit Gedankenschnelle durch das hohe Gras.
Unglückliches Thier, was half dir Flucht, wo du eine ganze Schaar deiner ärgsten und gefährlichsten Feinde so dicht auf den Fersen hattest! Der Correo hielt allerdings nicht in seinem Galopp ein, und er wie sein Postillon drehten nur, als sie das Geräusch des aufspringenden Vogels und den Lärm hinter sich hörten, die Köpfe danach um. Die Lust zum Hetzen stak wohl in ihnen, aber - sie durften ihre Zeit nicht damit versäumen.
Nicht so rücksichtslos dachten dagegen die argentinischen Soldaten über die ihnen unverhofft gebotene Beute. Ein wilder, gellender Schrei von dem ganzen mit fliegenden Ponchos dahinjagenden Trupp zerriß die Luft, und im Nu flog jedes Pferd, ohne daß der Reiter auch nur nöthig gehabt hätte den Zügel zu berühren, hinter dem davoneilenden Vogel her. Jede rechte Hand suchte dabei den Lasso, und ein prachtvolleres, lebendigeres Bild wäre kaum zu denken gewesen, als das dieser wilden Jäger hinter dem flüchtigen Strauß.
Nur drei Pferde behaupteten, wenn auch nicht aus eigenem Antrieb, ihre Stelle: das Don Pasquale's, Josefens und Don Diego's, und alle drei aus ganz verschiedenen Gründen. /56/
Josefa griff ihrem Thier erschreckt in die Zügel, als diese wilden Gaucho-Soldaten, einer Heerde von Teufeln ähnlicher wie Menschen, mit kreischendem Aufschrei hinter dem Wilde herbrachen. Don Pasquale dagegen, der seinem Gefangenen nicht traute und nicht sicher war, ob Don Diego nicht einen Versuch machen könnte, solch' einen günstigen Moment zur Flucht zu benutzen, kümmerte sich nicht um den Strauß, sondern griff unwillkürlich nach seinem eigenen Lasso, jedes derartige Beginnen im Voraus zu vereiteln.
Don Diego dachte aber nicht an dergleichen; den ganzen Weg war er düster und in sich brütend an seines Hüters Seite hingesprengt, dabei nur mit ängstlich forschendem Blick die Steppe musternd. Kaum brachte ihm aber vorhin eine leichte Schwellung des Bodens den Trupp weidender Pferde in Sicht, als sein Auge in peinlichster Spannung auf diesen haftete. Er sah den aufspringenden Strauß gar nicht, hörte den gellenden Schrei kaum, den die Verfolger ausstießen, denn dort, aus dem hohen Grase heraus, mitten zwischen den Pferden, hoben sich still und plötzlich zwei oder drei dunkle Köpfe und verschwanden eben so schnell wieder, wie sie aufgetaucht waren.
Wäre die Aufmerksamkeit des gesammten Reitertrupps, selbst des Corres und seines Postillons, nicht so völlig auf den gejagten Strauß gerichtet gewesen, so hätte Einer oder der Andere das Versteck des lauernden Feindes erkennen müssen. Die Indianer fürchteten nämlich, der Jubelschrei der Reiter sei auf ihren Hinterhalt gemünzt. Sie seien entdeckt und angegriffen. Darum hatte einige von den Voreiligsten die bestürzten Köpfe erhoben, aber eben so schnell sie auch wieder in das Gras geduckt, als sie mit einem Blick die Ursache des Lärmens erkannten. Mitten zwischen den am Boden lauernden Indianern hindurch sprengte in diesem Moment der Correo mit dem alten Gaucho und den Packthicren.
„Caracho," murmelte jedoch der Alte zwischen den zusammengebissenen Zähnen durch, als er auf einmal die fest in das Gras hineingeschmiegte dunkle Gestalt eines Indianers wahrnahm, - aber jetzt war es zu spät. Nur flüchtig schielte er über die Schulter nach dem Militär hinüber. /57/ Mit einem lästerlichen Fluch überzeugte er sich, daß alle ohne Ausnahme dicht hinter dem Kasuar drein stürmten. Den mußten sie allerdings in den nächsten Secunden einholen. Indessen hatte er sie aber auch schon auf wenigstens zweitausend Schritt in die Steppe hinausgelockt, und bis die Reiter zurück und hier zu Hülfe kamen, konnte dem Correo und dessen Begleitern zehnmal der Hals abgeschnitten sein. Ohne sich deshalb weder um den Postillon noch die Packthiere weiter zu kümmern, riß Felipe sein Pferd rechts herum, den einzigen Weg zur Rettung in der Richtung gegen die Soldaten hin suchend - aber auch das war zu spät.
Die Indianer sahen sich nicht allein entdeckt, sondern auch den richtigen Zeitpunkt für ihren Angriff gekommen. Während drei oder vier braune Gestalten aus dem hohen Gras emporsprangen, flogen eben so viele Bolas nach den beiden Packpferden, nach dem alten Gaucho und dem Correo hinüber.
Der Correo allein entging dem ihm zugedachten Wurf dadurch, daß sich eine der Kugeln, ehe sie ausflogen, an einem schwanken Weidenzweige fing und dadurch eine verkehrte Richtung bekam. Die beiden Packpferde dagegen brachen wie von einer Büchsenkugel getroffen zusammen, das eine mit gebrochenem Bein, das andere mit so verwickelten Vorderfüßen, daß es sich überschlug und mit der schweren Last nicht wieder empor konnte. Auch Felipe's Pferd war getroffen, aber nur verwickelt und konnte noch mit kurzen Sätzen springen, kam aber dadurch nicht rasch genug von der Stelle, und der Alte wußte, daß er solcher Art ein treffliches Ziel für einen zweiten Wurf abgeben würde. Ohne den deshalb abzuwarten, ließ er sich an der Seite seines Pferdes in's Gras fallen, um hier die Rückkehr der Soldaten oder sonst abzuwarten, wie sich das Ende gestalte. Konnte er so doch nur sein eigenes Leben in Sicherheit bringen.
Das Alles aber waren die Ereignisse weniger Secunden gewesen, und Don Pasquale war mit getheilter Aufmerksamkeit, halb dem Wild, halb seinem Gefangenen zugewandt, das eigene Pferd dabei nur locker im Zügel, bis dicht an die Indianer hinangesprengt. An den Krieg in den Pampas aber gewöhnt, übersah er im Nu die Gefahr, während sich sein /58/ Grimm unmittelbar gegen den Gefangenen kehrte. Die Depesche des Gouverneurs hatte ihm ja gesagt, daß der Fremde in starkem Verdacht stehe, mit den Indianern der Pampas gemeinsame Sache zu machen, um die Unitarier dadurch gegen die Förderalisten zu unterstützen. Deshalb eben sollte er Don Diego gefangen nach San Luis führen. Dieser Ueberfall war also nur sein Werk, und ihn vor Allen mußte die Rache trefren.
„Verfluchter Unitarier!" schrie der Officier, indem er sein Pferd herum und gegen Diego anwarf. „Das ist Deine That!" und mit den Worten hatte er sein haarscharfes Messer gegen den Feind gezückt. Don Diego war jedoch von dem Augenblick an, wo man sich dem indianischen Hinterhalt näherte, auf seiner Hut gewesen, und den Arm unter seinem Poncho vorstreckend, schmetterte er den Officier mit einer Pistolenkugel vom Pferde, ehe dieser mit seiner schneidenden Waffe nach ihm stoßen konnte.
„Heilige Jungfrau!" rief Josefa entsetzt. Don Diego selbst war erbleicht, denn die Entscheidung drängte heran. Der Schuß gab den versprengten Soldaten ein verhängnißvolles Signal. Der Knall meldete ihnen, um was es sich hier handle, und rief die Schaar mit einem Mal zurück. Gerade aber die rücksichtslose Hast, mit der sie heran zu stürmen suchten, sollte ihr Verderben werden.
Eben hatten sie den Kasuar ereilt; der Lasso des flüchtigsten Reiters flog aus und dem gehetzten Thier um den Hals. Im nächsten Moment warf sich das Pferd herum, und den noch fortstrebenden Kasuar allein schon durch sein Gewicht zu Boden reißend, wurde dieser nach einigen machtlosen Flügelschlägen von dem davongaloppirenden Pferde hinweggeschleift. Da fiel der Schuß. Diejenigen von den Soldaten, die am weitesten zurückgeblieben, konnten jetzt, wie sie ihre Pferde im Sprung herumdrehten, auch die ersten auf dem Kampfplatz sein. Sahen sie doch überdies nur fünf oder sechs Indianer, und diese nicht einmal im Sattel, - das war keine Macht, die sie zu scheuen gehabt hätten. Keiner von den umkehrenden Reitern dachte auch nur daran, den schon bereit gehaltenen Lasso aus der Hand zu legen und den Carabiner dafür zu /59/ greifen, die Schlinge war auch jetzt noch die richtige Waffe wider diesen Feind. Schreiend und die furchtbare Wehr um den Kopf schwingend, trieben die Argentiner mit den mächtigen Sporen ihre schon müde gehetzten Thiere zu noch schärferem Laufe an.
Rechts und links aber, vor ihnen und hinter ihnen tauchten plötzlich die Feinde empor. Bolas flogen, Lassos schwenkten aus, Lanzen wurden aus dem Gras heraufgestoßen, und acht bis neun der Argentiner lagen kampfunfähig im blutgefärbten Rasen, ehe ein einziger der Indianer getroffen war. Wie der Blitz fuhren diese jetzt nach ihren Pferden und hinauf, und wehe den überraschten, erschreckten und einzeln herbeistürmenden Weißen, die kein Commandoruf des Officiers traf, sie wieder in Reih' und Glied zu stellen! Ein paar von ihnen hatten allerdings ihre Carabiner vorgenommen, und einige zwischen die Horde gefeuerte Schüsse brachten zwei oder drei der Indianer zu Boden. Aber zum Laden blieb keine Zeit, und Todte und Verwundete zurücklassend, von den siegreichen Feinden überdies noch verfolgt, flohen Rosas' Reiter so rasch sie ihre Pferde trugen, gen Norden hinauf, den verfolgenden Indianern am sichersten zu entgehen.
So war es etwa dreißig Wilden, fast eben so vielen Soldaten der regulären Cavallerie entgegentretend, durch Ueberraschung und Zufall begünstigt gelungen, einen vollständigen Sieg zu erkämpfen und nicht allein dreizehn von den argentinischen Pferden zu erbeuten, sondern auch eben so viele Reiter theils zu tödten, theils kampfunfähig zu machen. Außerdem war das sämmtliche Gepäck des Correo in die Hände der Indianer gefallen, und übertraf, als sie den Mantelsack öffneten, an Reichthum selbst ihre kühnsten Erwartungen.
VIII.
Osantos, als Diego abgesprungen war, die, Beute zu untersuchen, hielt neben ihm auf seinem schnaubenden Pferde, sich mit der rechten Hand auf die gegen den Boden gestemmte /60/ lange Lanze stützend. Es war ein Bambusrohr, etwa zehn Fuß lang und oben mit einem zweischneidigen scharfen Messer bewehrt, an dem noch das Blut des Gemetzels in großen dunkeln Tropfen hing. Neben ihm hielten drei seiner Leute, die übrigen setzten noch hinter dem Feinde her, oder plünderten die Gefangenen und fingen die reitcrlos gewordenen Pferde ein.
Josefa, am ganzen Körper in Angst und Aufregung zitternd, saß regungslos im Sattel, ihr Pferd nur unwillkürlich Diego zudrängend, von dem allein sie Schutz und Hülfe erwartete. Aber Niemand näherte sich ihr, und seit der argentinische Officicr gestürzt und sein Sieger ihre Zügel ergriffen hatte, sie ein Stück zurück und dem ersten Anprall der herbeistürmenden Soldaten aus dem Weg zu bringen, war sie zwar von den einzeln gefeuerten Kugeln bedroht gewesen, aber glücklich verschont geblieben.
Jetzt, als Diego sie vollständig in Sicherheit wußte, sprang er erst aus dem Sattel, die lang erhoffte Beute, die Depeschen des Correo, in Besitz zu nehmen. Vergebens sah er sich aber unter den Getödteten nach der Leiche des Correo selber um. Der alte schlaue Bursche hatte sich aus dem Staube gemacht, und Diego war genöthigt, die beiden kleinen Schlösser des ziemlich umfangreichen Felleisens gewaltsam zu erbrechen, wo ihm dann, wie er nur die Kette gelöst, die gesuchten Papiere entgegenfielen.
Es waren Depeschen an die Gouverneure in San Luis sowohl wie in Mcndoza, und Briefe an fast alle Creatoren des Dictators in diesem Landstrich, einige von nicht unbeträchtlichen Summen Geldes begleitet. In jedem Ende des Felleisens fand sich auch ein schwerer Sack mit Doublonen, und Don Diego, der die Gier der Indianer nach Gold kannte, sagte, indem er sie dem Häuptling entgegenhielt:
„Da, Osantos - da hast Du, was Du willst. Es ist dreimal so viel, als ich zu finden glaubte und Euch versprach. Mir die Papiere, die Euch doch nichts helfen können, Euch dagegen das Gold, und was sich sonst noch vielleicht an Werthsachen vorfindet. Ich denke, Ihr könnt mit solchem Vertrage zufrieden sein."
„Ja," nickte der Wilde, und ein eigenthümliches Feuer /61/ glühte in seinen Augen, als sein Blick auf der zitternden Gestalt des schönen Mädchens ausruhte. „Dir die Papiere - uns alles Andere, das war der Vertrag. Don Diego ist ein guter Mann, er hält was er verspricht, und macht dann keine Ausflüchte. Ninm denn Deine Papiere und geh wohin Du willst; Osantos ist Dein Bruder; Sonne und Mond mögen auf Deinen Pfad scheinen und frisches Gras vor Dir emporsprießen."
Don Diego sah zu ihm auf und erfaßte den Blick, der glühend an Josefen hing. Ein unheimliches Gefühl drohender Gefahr durchzuckte ihn dabei; noch aber wußte er demselben keinen Namen zu geben. Indessen hatte er mit diesen wilden Stämmen schon zu viel zu thun gehabt, um nicht zu wissen, wie vorsichtig sie behandelt sein wollen. So fest verschlossen sie unter den eigenen eisernen und unbeweglichen Zügen ihre Absichten und Gefühle verbargen, so fest verschlossen mußte man ihnen gegenüber selber sein, wenn man sich nicht ganz in ihre Hände geben wollte. Nur wirklich Geschehenes hatte eine Berechtigung besprochen zu werden.
Glücklicher Weise war Josefa selber mit den Sitten dieser Stämme noch zu wenig bekannt, schon das Schlimmste zu fürchten. Die Pampas-Indianer ermorden nämlich gewöhnlich alle männlichen Gefangenen, die in ihre Hände fallen. Die Mädchen und Frauen aber schleppen sie mit sich in ihre Wildniß, aus der selten oder nie ein Entkommen ist. Ihre Häuptlinge setzen einen Stolz darauf, eine oder mehrere weiße Frauen in ihren Wigwams zu haben, und es läßt sich denken, welch' ein trostlos elendes Leben diese unter den Wilden führen.
Don Diego kannte und wußte das Alles, und wieder über das Felleisen gebeugt, seine aufsteigende Bewegung zu verbergen, wühlte er in den Papieren. Der Indianer aber achtete gar nicht auf ihn; sein Blick hing triumphirend an dem schönen Mädchen, und er wandte kaum den Kopf, als seine Leute einzeln und schweißbedeckt von der Verfolgung der zersprengten Feinde zurückkehrten.
Don Diego hatte indessen seine Untersuchung geschlossen und eine Masse unnützen Ballasts an Proclamationen, Zei-/62/tungcn und gleichgültigen Erlassen des Dictators herausgeworfen. Die Briefe und Depeschen schlug er dann in ein kleines Paket, um sie Abends ungestört durchzuarbeiten, steckte das in seine Satteltasche und nahm jetzt vor allen Dingen seine Waffen wieder an sich, sein Messer und seinen Lasso, lud sein abgeschossenes Pistol, und durchsuchte dann den Körper des gefallenen Officiers nach den Papieren, die er bei sich führte.
Während er über diesen gebeugt stand, hörte er eine leise flüsternde Stimme an seiner Seite: „Seňor - Seňor!"
Langsam drehte er den Kopf dorthin und erkannte den alten Gaucho Felipe, der vorsichtig auf dem Gras sein Antlitz ihm zuwandte und stöhnte:
„Schöne Geschichte das, caracho, die Sie uns mit den verdammten Indios eingebrockt haben. Meine Kehle wird wohl jetzt nur wenige Pesos noch werth und der Schluck caňs heute Morgen das letzte gewesen sein, was ohne auszulaufen hindurchgeflossen ist. Helfen Sie mir aus der Patsche, wenn es irgend geht, und ich will Ihnen zeitlebens dankbar sein - ich weiß aber schon, Zureden hilft bei den Canaillen so gut wie nichts, und wenn sie einmal Blut geschmeckt haben, wollen sie mehr und mehr -- bis sie eben satt sind."
Dem scharfen Ohr des Indianers war die Stimme nicht entgangen. So sehr er in den Anblick seiner Beute vertieft sein mochte, drang das Flüstern doch zu ihm, und rasch den Kopf hebend, erkannte er kaum die Richtung, aus der es kam, als er seinem Pferde die Sporen eindrückte und nach wenigen Sätzen, die Lanze zum Stoß erhebend, neben Felipe hielt.
„Halt, Osantos," rief aber Diego, rasch dazwischen springend und die Waffe fassend, „ohne den Mann da hätten wir unsere Beute nicht gewonnen. Er wußte um Alles und hat uns nicht verrathen. Er ist mein Freund und hat unsere Sache treu gefördert."
Osantos sah einen Augenblick unschlüssig von Diego hinüber zu dem Alten, der sich indessen langsam emporgerichtet hatte.
„Gut," sagte er endlich, „sein Leben gehört Dein sammt /63/ den Papieren. Er mag sein Pferd nehmen und nach Hause ziehen.“
„Daß sie ihm dort den Hals abschnitten, nicht wahr?“ lachte Diego, der rasch überdachte, wie er an dem alten schlauen Gesellen im Fall der Noth eine wackere Hilfe haben könne. „Nein, Osantos, die Weißen wissen, daß er sie verrathen hat und vergessen es ihm nie. Er so wenig wie ich dürfen wieder in jene Ansiedelungen zurückkehren, sondern müssen sehen, daß wir Montevideo erreichen können. Dort allein sind wir sicher."
„Und Rosas?"
„Nur diese Papiere, die wichtige Aufschlüsse über seine Absichten geben, bringe ich meinen Freunden," erwiderte Diego, „dann kehre ich mit frischer Hilfe zurück, und mit Eurem Beistand und dem noch vieler und treu gesinnter Gauchos wollen wir den Tyrannen lustig aus seinem Nest treiben und ihm das blutsattc Messer aus der Hand winden."
„Es ist gut - wir werden warten," sagte der Indianer, und sich dann zu seinen Leuten wendend, rief er ihnen in seiner Sprache die Befehle zu, nach denen sie sich rasch in vollem Trupp sammelten und zum Abmarsch bereit hielten. Die rothen Bursche hatten indessen schon Alles, was sie irgend gebrauchen konnten, zusammengepackt und zum Transport fertig gemacht. Die Sättel der getödteten oder verkrüppelten Pferde waren mit den Zäumen fest an einander geschnürt und auf eins der erbeuteten Pferde gebunden. Ebenso nahmen sie den erschlagenen Feinden Lasso, Bolas, Messer, Sporen und Kleidungsstücke ab. Auch die Carabiuer sammelten sie sorgsam mit den Patrontaschen, und als das Felleisen mit dem darin befindlichen Gelde ebenfalls vorsichtig zusammengeschnürt und aufgeladen war, gab ein gellender Schrei des Anführers das Zeichen znm Abmarsch. Sie wußten, daß die zersprengten Feinde fortgeeilt waren, Hilfe zu holen, und mußten, ehe sie ihnen wieder begegneten, vorher wenigstens ihren Raub in Sicherheit gebracht haben.
Don Diego hätte am liebsten sogleich die Indianer verlassen, aber er durfte nicht wagen, sich schon hier der Gefahr auszusetzen, mit einer andern Abtheilung der Truppen zu-/64/sammenzutreffen. Außerdem fürchtete er sich Osantos gegenüber das Wort auszusprechen, das, wie er voraussah, den trotzigen Häuptling zum Widerstände reizen würde - Josefa nämlich in seiner Begleitung mit fortzuführen. - Und welches Recht hatte der Wilde, sie ihm vorzuenthalten? Lieber Gott, wer frug hier in den Pampas nach einem andern Recht, als dem der Gewalt. Osantos hatte die Macht; Josefa gehörte mit zu dem überfallenen und zersprengten Trupp. Don Diego hatte ihm überdies von ihr früher kein Wort gesagt, sich nicht das geringste Anrecht auf sie ausbedungen - weil er überhaupt keine Ahnung hatte, daß sie je könnte dieser Gefahr ausgesetzt werden, und so vernünftig und billig es überhaupt gewesen wäre, sie selber entscheiden zu lassen, welchen Weg, welche Gesellschaft sie vorziehe, so dachten die Wilden doch keineswegs daran, einer Frau ein solches Recht zuzugestehen. Die Frau war nach ihren Begriffen vollständig abhängig vom Manne, als ihrem Herrn, und es verstand sich von selbst, daß sie ihm gehorchen müsse. Der Sieger hatte außerdem volle Macht über den Besiegten, also Osantos in diesem Fall einzig und allein zu entscheiden, was er für gut finde, zu thun und zu befehlen.
Der Trupp hatte sich indessen schon in Bewegung gesetzt, nach rechts und links dabei seine Späher aussendend, ob nicht ein oder der andere Feind versteckt dort liege. Osantos hielt noch immer auf der Stelle, aus Josefa wartend, und diese, ihr Pferd jetzt an Diego's Seite pressend, sagte in französischer Sprache:
„Seňor, ich vertraue Euch vollkommen und will mit der heiligen Jungfrau Beistand meine Sicherheit und Rettung in Eure Hand legen. Wollt Ihr aber Euer Versprechen halten, so führt mich, so rasch Ihr könnt, fort von hier, denn ich fühle, daß mir hier eben so große, wenn nicht noch größere Gefahr droht, wie von den Kreaturen des Dictators."
„Ihr überschätzt die Gefahr nicht, Seňorita," entgegnete mit einem scheuen Blick nach dem Häuptling hinüber der junge Mann - „aber um Eurer eigenen Sicherheit willen bewahrt noch Euren guten, kräftigen Muth - laßt ihn nicht ahnen, daß wir etwas fürchten. Ihr habt zwei treue Freunde in /65/ Eurer Nähe und so lange ich wenigstens athme - seid Ihr sicher vor irgend einem Leid. - Leider müssen wir noch m der Gesellschaft der Indianer, wenigstens für eine kurze Strecke, bleiben, den jedenfalls nachdrängenden Soldaten auszuweichen; heut Abend aber, denk' ich, trennen wir uns von dem Haupttrupp, und sei es auch nur, einen anderen Stamm aufzusuchen, bis ich Euch sicher nach Montevideo zurückführen kann."
„So handelt denn, wie Ihr es für gut und nützlich findet," flüsterte Josefa, indem ein leichtes Erröthen ihre lieben Züge überflog, „ich gebe mich ganz in Eure Hand, und der Himmel möge Euch verqelten, was Ihr an der armen Waise thut."
„Was sagt sie?" frug Osantos, dem das ihm unverständliche Gespräch zu lange dauerte, - „nicht in meiner Zunge redet sie, nicht in der Deinen; Osantos ist ein großer Häuptling, warum bleibt sein Ohr verschlossen?"
„Sie ist noch erschüttert von dem letzten Kampf, Osantos," entgegnete ruhig Diego, „und sehnt sich danach, zu ihren Freunden und Verwandten zurückzukehren. Osantos ist ein großer Häuptling; das Bewußtsein wird ihn erfreuen, ein armes schwaches Weib aus den Händen ihrer Feinde gerettet zu haben."
„Ugh!" sagte der Wilde, aber mit einem so völlig ausdruckslosen Antlitz, daß es nicht möglich war, darin zu lesen, wie er dies halbe, noch gar nicht verdiente Lob aufgenommen. Möglich, daß er auch einer weiteren Besprechung hierüber vor der Hand ausweichen wollte, denn er deutete mit seiner Lanze der eben davonsprengenden Horde nach, gab seinem Pferd die Sporen und galoppirte davon, ohne sich weiter um seine Gefangenen oder Bundesgenossen - der alte Felipe wußte nicht, für was er sich eigentlich halten sollte - zu bekümmern.
„Caracho," murmelte dieser seinem neuen Herrn, Diego zu, „wie wäre es, Compaňero, wenn wir hier ein wenig hielten, bis die rothen Schufte aus Sicht sind, und dann unsern Weg allein suchten. Den rothen Ponchos wollten wir schon ausweichen, wenn Euch nicht besonders viel daran läge, /66/ ihnen wieder mit den Postpaketen zu begegnen, und ich glaube fast -"
Ehe Don Diego etwas erwidern konnte, wandte sich Osantos im Sattel, und als er sah, daß die Weißen ihm noch nicht folgten, warf er sein Pferd herum und winkte ungeduldig mit dem Arm.
„Es geht nicht, Amigo," sagte Diego rasch. „Die Pferde der Indianer sind noch frisch, die unseren aber von dem Tagesmarsch ermüdet. Osantos würde mit seiner braunen wilden Schaar den Augenblick auf unseren Fährten sein, und sich dann in vollem Recht glauben, uns zu behandeln, wie es ihm gut dünkt. Vorwärts, daß er nicht ungeduldig wird. Haltet Euch nur an meine Seite, Seňorita. Bis heute Abend findet sich schon Gelegenheit, das Weitere zu besprechen, und auch Ihr, Felipe, daß wir keinen Verdacht erregen; wir haben überdies schon zu lange gezögert."
Bei den ersten Worten hatte er sein Pferd vorwärts getrieben, den Indianern nach, und während sich Josefa und Felipe dicht hinter ihm hielten, holten sie bald den ihrer wartenden Osantos ein. Osantos sagte aber kein Wort weiter; die Lanze vor sich schräg über die Mähne seines Pferdes gelegt, ließ er seinem wackern Hengst die Zügel, und bald setzte der kleine Trupp in voller Flucht durch das hohe Gras der Pampas, so viel Raum als möglich zwischen sich und die Feinde zu bringen, ehe diese zu einer Verfolgung herbeieilen konnten.
Dabei gebrauchten sie oft die List, mit dem Haupttrupp kurze Strecken nach rechts oder links abzubiegen, während sie einzeln wieder davon abgingen, ihre alte Richtung aufzunehmen. Sie wußten, wie sehr eine solche gestörte Fährte den Feind beirren und aufhalten mußte, um so mehr, als sich die Soldaten - wenn nicht in sehr starker Zahl - kaum getrauen durften, tiefer in das indianische Gebiet vorzudringen.
Dort waren die Rothhäute unumschränkte Herren, denn wenn auch Rosas auf der Landkarte dies Gebiet beanspruchte, hatte er es nur durch eine dort bleibend unterhaltene Militärmacht auch behaupten können. Wie ein Ocean von Gras lag die weite Steppe ausgebreitet, und zog ja einmal eine /67/ Schwadron der leichten Gaucho-Reiter hindurch, den Indianern in's Gedächtniß zurückzurufen, wer hier eigentlich den Oberbefehl beanspruche, so wichen die rothen Schaaren wohl eine kurze Strecke vor ihnen zurück und ließen sie ungehindert eindringen, so weit sie wollten, kaum aber traten sie den Rückweg an, so drängten die verschiedenen Horden von allen Seiten wieder herbei, wie die Fluth in das Fahrwasser des davoneilenden Schiffes quillt, und die Pampas gehörten den Indianern wie vorher.
IX.
Die Pferde der Weißen bedurften indessen einer kurzen Rast, an der sie durch den Ueberfall der Wilden verhindert worden. Die Thiere waren erschöpft, und Don Diego besonders lag daran, sie nicht unnöthiger Weise noch mehr zu ermatten, sondern ihnen ihre Frische und Kraft zurück zu geben. An einer Stelle angelangt, an der sie frisches klares Wasser fanden, bat er Osantos, einige Zeit zu halten, und während die Pferde ruhten, erbrach und durchflog er die verschiedenen Depeschen des Gouverneurs, die wichtigsten für sich zurück zu behalten und die übrigen, um nicht unnöthig damit beladen zu bleiben, zu vernichten.
Hier erkannte er denn auch, welch großer Gefahr er selber entgangen war. Denn wäre er nach San Luis gebracht und dort erkannt worden, so war sein Tod beschlossen und gewiß.
Lange ließ ihm Osantos, der bei der Untersuchung der Papiere neben ihm saß und ihm geduldig zuschaute, aber keine Zeit. Ihm lag daran, aus Gründen, die er freilich dem Weißen nicht angab, sobald als möglich seinen Hauptstamm zu erreichen, und einmal erst wieder im Sattel, setzten sie ihren Weg rasch und ungehindert immer gen Süden hin fort.
Einige Male begegneten sie auch kleinen Streifzügen anderer Stämme, und Osantos schien diesen besondere Befehle zu geben, denn jedesmal veränderten sie, nach kurzer Unter-/68/redung mit ihm, ihre Richtung. Diego frug den Häuptling deshalb, denn noch gestern hatten sie einen gemeinsamen Kriegszug gegen die Argentiner verabredet, in dem die Indianer durch jene verfolgten und von Rosas als seine bittersten Feinde betrachteten Unitarier unterstützt werden sollten. Heute schien er aber nicht mehr darauf eingehen zu wollen, gab ausweichende Antworten und vertröstete ihn auf eine spätere Zeit. - Der Weiße war ihm in seinen neuen Plänen lästig geworden, und er suchte ihn los zu werden.
Gegen Abend erreichten sie ein Dorf der Indianer. Frauen und Kinder kamen den Anreitenden in dichtem Trupp entgegen, und die kleinen braunen nackten Burschen sprangen in tollem Uebermuth auf die Pferde, oder faßten sie an den Schwänzen und ließen sich im raschesten Lauf mit fortziehen, ohne loszulassen. Jubelnd und kreischend tobten Andere hinterdrein, und Josefa bebte schaudernd in sich zusammen, als sie sich mitten in dem ungewohnten wilden Lärm jetzt sogar noch von den Freunden getrennt fand. Osantos hatte nämlich, als sie das Dorf erreichten, den Zügel ihres Pferdes ergriffen, und während die Eingeborenen in jubelnder Lust um den Häuptling herdrängten, trennten sie ihn von seinen weißen Begleitern. Allerdings versuchte Diego, ihm nachzukommen, aber es war nicht möglich, und von den Wilden überhaupt mit mißtrauischen Blicken betrachtet, mußten sie endlich ihre Pferde einzügeln, um nicht ein oder das andere Kind niederzureiten.
„Das geht recht schlecht," brummte Felipe leise seinem Begleiter zu, „denn der rothe Halunke da vorn hat Böses im Sinn. Ich fürchte fast, wir werden das arme Mädchen als Senora Osantos hier zurücklassen müssen, um später einmal die Mutter einer zahlreichen Nachkommenschaft von solch‘ halbrothen kleinen Teufeln zu werden, wie sie da überall an den Pferdeschwänzen hängen."
Diego griff seinem Thier in die Zügel, daß es hoch aufbäumte, und im wilden Trotz suchte die Hand unter dem Schutz des Ponchos nach dem Messergriff - aber was hätten sie jetzt - hier gegen die Ueberzahl der Feinde ausrichten können! /69/
„Er darf sie nicht haben, Felipe," zischte er endlich mit kaum verhaltener Wuth - „Du hast Recht, das ist sein Plan! Aber erst soll er meinen letzten Tropfen Blut genommen haben, ehe er das Mädchen sein nennen darf."
„Würde er auch mit dem größten Vergnügen nehmen," spottete der alte Gaucho bitter vor sich hin. „Die Dirne hat ihm einmal den Kopf verrückt, und er will und - wird sie haben, ja, und wenn er uns allen Beiden und noch zwanzig Anderen die Köpfe deshalb abschneiden sollte. Was liegt solch einem rothen Halunken an einer Menschenkehle? - Ihr dürft Euch aber eigentlich gar nicht beklagen," fuhr der Alte leiser fort, als ihm Don Diego kein Wort darauf erwiderte. „Ich habe Euch gewarnt, den rothen Canaillen zu sehr zu vertrauen, und Euch, um der heiligen Jungfrau willen, nicht weiter mit ihnen einzulassen, als Ihr sie mit einem Messer erreichen könnt. Jetzt seht Ihr, was daraus entstanden ist."
„Aber der Häuptling hat noch gar nicht gesagt, daß er das Mädchen zurückhalten will," warf Diego ein, sich an den letzten Strahl von Hoffnung klammernd.
„Bah!" brummte der Alte. „So viel für das, was er sagt und was er nicht sagt. Hier kommt cs darauf an, was er denkt und thut, und seht ihn da vor uns, wie er den Zügel ihres Pferdes hält - wie seine Blicke gierig an ihr hängen. Dort hinten geht die Sonne unter - wenn sie wieder aufsteigt, müßte ich mich sehr irren, oder sie begrüßt Senora Osantos an der Seite ihres wilden Gatten."
„Du hast Recht, Felipe, hier ist keine Zeit mehr zu verlieren," rief Diego rasch, indem er seinem Pferde die Sporen gab.
„Was wollt Ihr thun?" mahnte der Alte dringend. „Nur keinen dummen Streich!"
„Habt keine Furcht," sagte der junge Mann, „ich weiß, in wie weit Osantos über unser Leben gebieten kann, wenn ich auch kaum glaube, daß er an das meinige Hand legen würde."
„Denkt ja nicht, daß der etwa Rücksichten nimmt," sprach der Alte. Aber Diego hörte ihn schon nicht mehr, und durch /70/ die Indianer drängend, die ihm gar nicht recht willig Raum gaben, ritt er gerade zum Häuptling hinan.
„Was begehrt Don Diego?" sagte Osantos, langsam den Kopf nach ihm wendend, während Josefa dem Heraneilenden mit dankbarem Blick begrüßte. Hatte sie doch längst ein eisiges Entsetzen durchschauert, als sie sich durch die barbarische Horde von den Freunden, wenn auch nur für Momente, getrennt sah.
„Abschied will ich von Dir nehmen, Osantos," sagte der junge Mann.
„Du willst fort?" entgegnete der Häuptling erstaunt, aber Diego konnte es nicht entgehen, daß ein triumphirendes Lächeln, wenn auch nur wie ein flüchtiger Schein, über die dunkeln Züge flog. „Doch nicht noch heut Abend? Dein Pferd ist müd, und wenn Du dem Feind begegnest, mußt Du Dich verstecken."
„Nein, nicht heut Abend," sagte Diego, der vor innerer Aufregung über das Entscheidende des Augenblicks die Worte kaum über die Lippen brachte, „aber morgen mit Tagesanbruch will ich mich nach Osten hinüberziehen, um in der Nacht die Ansiedelungen der Feinde zu durchreiten. Josefa's Verwandte sind in ängstlicher Sorge um sie. Ich muß eilen, sie zurückzubringen."
„Josefa's Verwandte?" sagte Osantos düster, und seine Brauen zogen sich drohend zusammen. „Reite nur allein zu ihnen, und sage ihnen, daß das Mädchen eines Häuptlings Weib geworden ist und von jetzt an in seinem Zelt wohnen wird."
„Josefa Dein Weib?" versetzte Diego, und trotz der Gewalt, die er sich anthat, war er doch nicht im Stande, die Entrüstung zu unterdrücken, die diese Worte bei ihm hervorriefen. Wenn er auch das Schlimmste schon lange befürchtet hatte, so erhielt er doch hierdurch erst die Gewißheit, die seine ärgsten Ahnungen bestätigte. Aber sein überwallendes Gefühl gegen die hereinbrechende Gefahr war Zorn und trotzige Empörung.
„Und warum nicht?" fragte lauernd der Häuptling, indem ein halb spöttisches, halb tückisches Lächeln über seine dun-/71/keln Züge blitzte. „Oder hat der Weiße vielleicht beschlossen, sie selber als Belohnung dafür zu beanspruchen, daß ihn Osantos aus der Gefangenschaft der Föderalisten befreite?"
„Gefangenschaft?" rief Diego, der nicht begreifen konnte, woher der Wilde davon sollte Kunde erhalten haben.
„Vielleicht warst Du nicht gefangen," lächelte der Indianer vor sich hin, „und hast Dein Messer und Deinen Lasso den Freunden zu tragen gegeben. Aber es ist genug gesprochen. Reite zurück zu Deinen Freunden oder bleibe bei uns: es steht Dir frei. Osantos' Wille aber steht fest. Morgen Abend erreichen wir die Heimath, in die uns die Feinde nicht zu folgen wagen. Dort wird Osantos den Stamm zusammenrufen, wie es eines großen Häuptlings würdig ist, und drei Tage und drei Nächte den Festlichkeiten widmen. Don Diego soll willkommen sein, wenn er Zeuge von dem Glück des jungen Mädchens sein will - dann mag er nachher zu ihren Verwandten reiten und ihnen Kunde bringen."
„Rettet mich, Don Diego," flüsterte Josefa bei einer Biegung des Weges. Mit Entsetzen hatte sie den Worten gelauscht, die über ihr Schicksal entscheiden sollten. „Oder tödtet mich, wenn Ihr mich nicht befreien könnt," fügte sie in französischer Sprache hinzu.
„Aber hat Osantos auch das Mädchen selber gefragt, ob sie das Weib des Häuptlings werden will?" sagte Diego, der seine ganze Fassung wiedergewonnen hatte, ohne auf Josefa's Aufforderung mit Wort oder Blick zu antworten.
„Werden will?" sagte Osantos finster. „Hat das Weib auch einen Willen, wo Männer sprechen? Osantos hat es gesagt, das ist genug. Was Osantos gesagt hat, muß geschehen."
Diego neigte leicht das Haupt.
„Und was wird mit der Fremden geschehen, bis sie Osantos mit der gebührenden Feierlichkeit in sein Zelt nimmt?" fragte er, seinen Grimm verbeißend und um das starre, unbeugsame Verlangen des Indianers durch keinen ferneren Widerspruch oder dadurch zu reizen, daß er selber ein Recht auf das Mädchen geltend machte. /72/
„Sie wird den Frauen übergeben, zu denen sie fortan gehört," sagte Osantos ruhig.
„Das darfst Du nicht," siel da Josefa ein, die mit fieberhafter Angst auf die Rede des Häuptlings hingehorcht hatte. „Das darfst Du nicht, Indianer. Nie werd' ich Dein Weib, bei dem allbarmherzigen und mächtigen Gott da droben - nie, denn eher den Tod, als Dein."
„Ugh!" sagte der Wilde mit einem innerlichen Grinsen. „Die Weiber schwatzen und die Männer handeln. Was darf Osantos nicht!"
Ohne das Mädchen weiter eines Wortes zu würdigen, lenkte er sein Thier ab, und auf ein Zeichen drängten sich die Frauen des Stammes herbei, die Gefangene in ihre Mitte zu nehmen. Diego wollte sich ihr noch einmal nähern, aber die indianischen Weiber litten es nicht und wiesen ihn mit wildem Geschrei und zornigen Geberden zurück. Nur die Worte konnte er ihr in französischer Sprache zurufen: „Mit Tagesanbruch", als jene Megären den Zügel ihres Pferdes ergriffen und sie mitten in die Zelte hinwegführten. Dort verschwanden sie rasch mit ihr hinter einer der aus ungegerbtcn Häuten so roh als einfach hergestellten Hütten.
„Da habt Ihr die Bescherung," raunte ihm Felipe zu, der an Diego's Seite kam. „Kurz und bündig genug hat Osantos seinen Willen ausgesprochen, und seid versichert, daß er ihn durchsetzt. Ich wollte, wir wären fort von hier."
„Du kannst gehen, Felipe," sagte Diego ruhig. „Wir sind allein, der Schwarm hat sich zerstreut. Reite Du davon."
„Und Ihr?"
„Ich wanke und weiche nicht von hier, bis ich nicht den letzten, den verzweifelten Versuch gemacht habe, Josefen zu retten!" rief außer sich der Unitarier. „Tod dem elenden Indianer, wenn er mir entgegentritt!"
„Und das Bündniß mit Montevideo? Und alle die schönen Pläne zur Befreiung des Vaterlandes, zu der Ihr Euch mit den wackeren Rothfellen verbündet habt?" sagte der alte Mann. „Die Depeschen, die so blutig erkauft wurden?"
„Mein Leben hängt an dem Besitz Josefens."
„Ja, ja, Euer Leben," brummte Felipe in den Bart. /73/ „Ihr seid Euch doch Alle gleich, Unitarier und Föderalisten, wie auch der Führer, wie die Partei heißen möge. Was Euch regiert, ist der eigene Nutzen - und das Vaterland? - Ei, das mag eben zum Teufel gehen darüber, sobald es Lust hat, - Vaterland - lächerlich."
„Ich liebe mein Vaterland von ganzem Herzen," betheuerte Diego, „Blut und Leben habe ich mehr als einmal dafür in die Schanze geschlagen. Aber kann und darf ich dulden, daß dieser rothe Teufel in seiner bestialischen Lust kalt und trotzig jenen Engel opfert?"
„Engel, - bah," sagte Felipe, „es ist immer nur ein Leben und noch dazu das Leben einer Frau, was Euch von dem einmal gesteckten Ziel ablenken will. Raubt sie, und Ihr dürft nie zu dem Stamm zurückkehren, mit dessen Hülfe Ihr den Truppen Sr. Excellenz - den Gott erhalten möge, bis ihn der Teufel holt - trotzen könntet. Aber was hilft mein Reden," brach er plötzlich ab. „Ihr thut doch, was Eure Leidenschaft heischt, und je eher das dann geschieht, desto besser. Aber wenn etwas Gutes aus dem Ereignisse dieses Tages kommen soll, so dürfen wir nicht feiern."
Felipe war in der That ein viel zu praktischer Mann, als daß er sich mit unnützen Redensarten aufgehalten hätte. Er erkannte, was geschehen mußte, und so war es nicht seine Art, lange über die Nothwendigkeit zu philosophiren. Ein ächter Sohn der Pampas, hatte er aber auch selbst unter dem Gespräch mit Diego nicht einen Blick von dem Trupp der indianischen Frauen verwandt, die die Gefangene in das für sie bestimmte Zelt geleiteten. Er wußte deshalb auch genau, in welchem derselben die künfnge Gattin des Häuptlings ihre vorläufige Wohnung aufgeschlagen, und es blieb nur vor allen Dingen zu untersuchen, ob es möglich sein würde, heimlich dort hinein zu kommen.
„Euch raubt die Besorgniß um Josefa, wenn auch nicht den Muth, doch die volle Besonnenheit. Wollt Ihr mir folgen?" fragte Felipe.
„Wenn Du sie mit mir befreien willst, als Dein Diener, als Dein Sclave, alter Patron," versicherte Diego.
„Wir wollen zusehen, was ein Gaucho vermag, der kein /74/ Neuling in den Schlichen und Ränken Eurer lieben Verbündeten ist," gab Felipe in seiner trocknen Weise zurück und betrachtete mit ruhiger Aufmerksamkeit die Gegend und die Lagerplätze der Indianer. Danach traf er seine Maßregeln.
Er suchte zuvörderst einen Lagerplatz zu finden, wo sich ihre Thiere ordentlich erholen und reichlich weiden könnten. Starke, flinke Pferde mußten sie haben, wenn sie irgend etwas Entscheidendes unternehmen wollten. Ein solcher Lagerplatz war auch bald gefunden: Klee und Gras wuchs überall in Masse; ein kleiner Bach schlängelte sich mitten durch die Pampas, und führte wenigstens so viel Wasser mit sich, die Pferde davon zu tränken. Lebensmittel hatte Diego, Dank der Vorsorge des Wirthes zu Altacruz, ebenfalls genügend in seiner Satteltasche, selbst noch für den nächsten Tag auszuhalten, und die Satteldecken auf den nackten Boden gebreitet, die Sättel als Kopfkissen, die Ponchos als Decken, legten sie sich, nachdem sie ihr Abendbrod verzehrt, zur Ruhe nieder. -
Osantos selber hatte sich gar nicht mehr um sie gekümmert, ihnen nicht einmal ein Zelt anweisen lasten, aber Felipe sah nichtsdestoweniger, daß einzelne dunkle Gestalten den von ihnen gewählten Lagerplatz umkreisten, und hielt diese wohl mit Recht für von dem Häuptling ausgesandte Spione, die jede ihrer Bewegungen zu überwachen hätten.
Für den Augenblick war deshalb nichts auszurichten. Die Pferde mußten rasten, und am besten konnten sie die Wachsamkeit der Wilden einschläfern, wenn sie jetzt gar nicht thaten, als ob sie an irgend etwas anderes als Schlaf und Ruhe dächten. Wie nothwendig brauchten sie auch wirklich beides, Schlaf und Ruhe!
X.
So verging die Nacht. Die Indianer, denen kein Befehl zu frühem Aufbruch gegeben worden, lagen noch, theils in ihren Zelten, theils um einzelne niedergebrannte Feuer zerstreut, in tiefem Schlaf, und gar nicht weit vom Lager heulten /75/ die Steppenwölfe ihren Morgengruß, mit dem sie sich vor dem dämmernden Tage in ihre Schlupfwinkel zurückzogen. Diego erwachte und fuhr nach seinen Waffen greifend empor. Sein erster Blick war auch nach Felipe, aber dieser hatte sein „Bett" schon verlassen. -War er heimlich entwichen? - nein, sein Sattel lag noch dort, und während Diego, unschlüssig was jetzt ohne ihn zu beginnen, in die Dunkelheit hinausstarrte, kehrte der alte Gaucho schon mit leichtem, vollkommen geräuschlosem Schritt zurück.
„Du warst im Lager?"
„Ja," flüsterte der Alte - „Alles steht gut. Die rothen Schufte schlafen wie die Ratzen; ich war in dem Zelt."
„In Josefens Zelt?"
„Nicht so laut; es braucht keiner von ihnen zu wissen, daß wir munter sind. Ja wohl, ich hatte mir gestern Abend den Platz genau gemerkt, und sie glauben auch schwerlich, daß wir keck genug sind, den Ort zu betreten. Wenn die Dirne nur eine Ahnung davon hätte."
„Sie weiß, daß wir mit der Morgendämmerung versuchen wollen zu entfliehen."
„Gut, dann wird sie sich auch jetzt bereit halten - wenn sie's eben nicht verschläft. Sattelt die Pferde und haltet Euch fertig; ich will versuchen, das Mädchen abzuholen. Ihr Sattel liegt neben dem Zelt, den bring' ich mit."
„Felipe, wenn Du -"
„Bst - weiteres Reden ist nicht nöthig und sogar gefährlich. Fort, die Zeit vergeht; drüben im Osten färbt sich schon der Himmel, in einer halben Stunde haben wir Hellen Tag -" und ohne weiter eine Antwort abzuwarten, glitt der alte Bursche von Diego's Seite fort und wieder mitten zwischen die düsteren Zelte der Feinde hinein. Diego kannte aber ebenfalls die Gefahr, der sie sich aussetzten, vollkommen und wußte, wie wenig Zeit ihnen zu ihrer Flucht bleiben würde. Ohne deshalb auch nur einen Augenblick zu verlieren, griff er seinen Lasso auf und schritt rasch in die Pampas hinaus, wo er sein Pferd wußte. Das treue Thier, wenn es sich auch in der Nacht noch so weit entfernt haben mochte, kam gegen Morgen jedesmal zu dem Lagerplatz seines Herrn zurück. Kaum hatte /76/ dieser ihm auch das wohlbekannte Zeichen gegeben, als sein freudiges Schnauben schon die Stelle verrieth, an der es sich befand. Mit ihm weidete Felipe's Pferd, und Diego hatte in wenigen Minuten die beiden gesattelt und gezäumt. So vorsichtig er aber auch zu Werke ging, war er doch nicht im Stande, ein drittes einzufangen, denn die Pferde der Indianer hielten sich scheu von dem Weißen zurück. Wie er sich ihnen näherte, wichen sie schnaubend zur Seite, und er mußte es aufgeben, ihnen zu folgen, weil ihn das Geräusch, das sie machten, sonst sicher verrathen hätte.
Noch schwierigeren Auftrag hatte indessen Felipe, der wohl leicht genug das Zelt erreichte und den Damensattel mit seinem Zaum bei Seite legte, dann aber unschlüssig an der Zeltwand hielt, weil er nicht wußte, auf welcher Seite das weiße Mädchen lag. Weckte er aber eine ihrer Wächterinnen, dann konnte er sich fest darauf verlassen, das ganze Lager in wenigen Secunden alamirt zu haben - und was dann? Vorsichtig bog er endlich die Ecke des einen von der Sonne gedörrten Felles zurück, und es war ihm fast, als ob er im Innern sich etwas hätte bewegen sehen, doch ließ ihn die Dunkelheit nichts Deutliches erkennen. Sollte er zurückweichen? - War es eine der Indianerinnen, so hatte er doch nichts mehr zu hoffen, heimliche Flucht blieb dann unmöglich, war es aber Josefa, so mußte er ihr ein Zeichen geben, daß Freunde in der Nähe seien, und leise ahmte er den schilpenden Ton der kleinen Steppeneule nach, die zu Tausenden die Pampas beleben und Nachts besonders herüber und hinüber streichen. - Nichts antwortete, aber er konnte erkennen, daß der Zeltcingang geöffnet wurde - einen Moment war er im Stande, den helleren Himmel zu erkennen. Geräuschlos bewegte er sich zurück, und draußen neben ihm stand eine weibliche Gestalt.
„Don Diego?" flüsterte sie mit weicher, zitternder Stimme. Aber hier blieb keine Zeit zu Erklärungen. Der alte Gaucho ergriff die gegen ihn ausgestreckte Hand des Mädchens, und den neben ihm liegenden Sattel aufhebend, zog er sie rasch der nicht entfernten Stelle zu, wo er Diego mit den Pferden zu finden hoffte. /77/
„Josefa!" jauchzte der junge Mann, ihr entgegen springend, „gerettet - gerettet!"
„Noch lange nicht," zürnte der Alte, während die Jungfrau ängstlich den Blick nach den Zelten zurückwarf. „Das sind nur zwei Pferde und wir brauchen drei."
„Ich war nicht im Stande ein drittes zu bekommen," erwiderte Diego. „Scheu wichen sie vor mir zurück und schnauften so laut, daß ich Verrath durch ihre Unruhe fürchtete.
Ich nehme Josefen auf mein Pferd."
„Daß uns die rothen Schufte in der ersten Stunde einholen, nicht wahr?" brummte der Gaucho, indem er seinen Sattel abschnallte und zu Boden warf, um dem Damensattel aufzulegen.
„Und weshalb das?" frug Diego erstaunt.
„Hinweg mit Euch!" sagte darauf der Alte. „Ihr habt keine Secunde übrig. An den sieben Kreuzen find' ich Euch wieder. Kennt Ihr den Platz?"
„Eine Legua von Altacruz."
„Ja, und fort, sag' ich. Ich komme nach!" und wie ein Kind griff er das junge Mädchen auf und hob es in den Sattel, während Diego schon fertig an ihrer Seite hielt. Ein eigenthümliches Schnalzen mit der Zunge gab zu gleicher Zeit dem Pferd des alten Gaucho ein Zeichen zu voller Flucht, und Josefa konnte nur eben den Zügel richtig fassen, als auch schon das muthige Thier mit ihr die Steppe entlang flog. Diego war trotz Sporen und Peitsche kaum im Stande, an ihrer Seite zu bleiben.
Noch stand der alte Bursche und horchte den verhallenden Schlägen der Hufe, wobei er kopfschüttelnd murmelte:
„Alter Esel, der ich bin; was geht's mich eigentlich an, ob das junge Ding einen kupferbrauncn oder weißen Mann bekommt, daß ich mich jetzt hier selber festreite und nicht rück- und vorwärts kann. Wenn jetzt die verdammten Indianer - aber laß sie zum Henker kommen, bis dahin wird doch wohl irgend ein Pferd aufzutreiben sein, und daß ich nicht wählerisch bin, will ich ihnen bald bewefien - wenn es Osantos' bester Renner wäre."
Mit den Worten, und still vor sich hin lachend, griff er /78/ seinen Sattel und Lasso anf, und wollte sich eben hinaus in die Pampas wenden, um dort einen Trupp Pferde aufzusuchen, als ans dem Lager heraus, schon im Sattel und ihre Lanzen in den Händen, sechs Indianer, den Häuptling an der Spitze, gesprengt kamen, die in gestrecktem Galopp an dem Lagerplatz vorüber wollten. Als sie aber den Weißen gewahrten, den sie wahrscheinlich hier gar nicht mehr vermuthet hatten, zügelten sie im Nu ihre Pferde ein, und zugleich rief Osantos:
„Wo ist Dein Gefährte, Amigo? Und was für Thiere waren das, die dort eben fort galoppirten?"
„Unsere eigenen," versetzte Felipe, ungewiß darüber, ob die Wilden die Flucht ihrer Gefangenen schon entdeckt hätten oder nicht. „Welche sollen's sonst sein? Diego ist hinter ihnen her und sucht sie zu fangen. Wir wollen fort."
„So früh?"
„In der Morgenkühle reitet sich's am besten; was sollen wir hier?"
Osantos sah zaudernd zu dem Mann nieder, und sich dann zu seinen Begleitern wendend, gab er ihnen in ihrer eigenen Sprache einige Befehle. Drei von ihnen sprengten augenblicklich fort, und zwar derselben Richtung zu, in der Diego mit seiner schönen Beute geflohen. Aber es war noch nicht hell genug, schon Spuren verfolgen zu können. Nur dem Schall der Hufe konnten sie nacheilen, aber auch dieses Geräusch war schon lange auf dem weichen Grasboden verklungen. Die anderen Indianer hielten noch still neben dem Weißen.
Felipe wurde es unbehaglich. Zwar war in keinem Fall die Flucht Josefens schon entdeckt, sonst hätte Osantos selber wahrlich nicht so ruhig seinen Platz behauptet, aber jeden Augenblick konnte und mußte die Entdeckung geschehen. Was wurde dann aus dem Alten? Unter jeder Bedingung mußte er aus der unmittelbaren Nähe der Wilden zu kommen suchen. Draußen in dem hohen Gras der Steppe, selbst wenn er nicht so bald ein Pferd erhaschte, konnte er sich eher verstecken und etwaigen Nachforschungen ausweichen. Vor Allem durfte er keine Verlegenheit blicken lassen. Ohne sich daher weiter um die Wilden zu bekümmern, warf er den Sattel auf die /79/Schulter, richtete seinen Lasso bequem zum Wurf, und schritt dann ohne weiteren Gruß in den jetzt dämmernden Morgen hinaus.
Osantos sah ihm unschlüssig ein paar Augenblicke lang nach, als ein Lärm im Lager seine Aufmerksamkeit dorthin ablenkte. Felipe aber hatte den gellenden Aufschrei der weiblichen Stimmen ebenfalls gehört. Er wußte, was der Tumult bedeutete. Daher kaum aus Sicht der Rothhäute, denen seine dunkle Kleidung mit dem Steppengras verschmolz, schnallte er seine Sporen ab und sprang in flüchtigen Sätzen der Richtung zu, in der er Pferde hatte wiehern hören. Wie eine Katze kroch er, gegen den Wind, an sie heran, und als er sie in richtiger Wurfesuähe hatte und sich emporrichtete, den Lasso zu schleudern, schreckten die Thiere zu spät vor ihm zurück. Die Schlinge flog aus, und wenn ihn das gefangene Thier auch noch eine Strecke schleifte, schnürte ihm das scharfe Seil doch bald durch das Gewicht des daran hängenden Körpers die Kehle zu. Im nächsten Augenblick hatte es Felipe an der Mähne gepackt, Sattel und Zaum darauf geworfen, im Nu saß er oben, und das Anlegen der Sporen auf eine andere Zeit verschiebend, ließ er es ausgreifen, was es laufen wollte. Galt es doch, den jedenfalls bald nachfolgenden Feinden auf Leben und Tod einen tüchtigen Vorsprung abzugewinnen.
Nur wenige Minuten später, und über die Pampas flog eine Schaar dunkler wilder Gestalten auf schnaubenden Rossen, lange schlanke Rohrlanzen in der Rechten, den grauen wollenen Poncho um die Schultern, das lange, schwarze, straffe Haar ihre Schläfe peitschend. Hier und da, wo eine Schwellung des Bodens einen Ueberblick über einen Abschnitt der Steppe möglich machte, hielt der Trupp, und all' die schwarzen Adleraugen spähten scharf umher. Aber sie waren schon einige Male getäuscht worden in ihrer Suche - erst von ein paar einzelnen Hirschen, dann durch einen Trupp Strauße, - und das hatte sie von der Richtung abgezogen, in welcher Felipe dahinjagte.
Jetzt theilte sich die Schaar - langaus breiteten sich die Indianer, den weiten Plan einzeln abzusuchen, aber sobald ein forschendes Auge irgend einen verdächtigen Gegenstand /80/ entdeckt, sammelte ein Schrei die Gefährten, und in toller Hast sausten die wilden Gesellen der bezeichneten Beute nach - und wiederum getäuscht und vergebens.
Nach rechts und links waren, weit ab von dem Haupttrupp, ein paar Kundschafter abgesandt worden: Meilen weit konnten sie jetzt nach allen Richtungen hin die Steppe übersehen. Da kam denn der Eine von ihnen auf schweißbedecktem, schäumendem Thier heran. Er schwenkte die Lanze, und im wilden Jubel gab Osantos das Zeichen zur Verfolgung nach der bezeichneten Linie hin. Nach einer Weile erreichten Osantos' Gefährten einen Streifen höher gelegenen Landes. Dort vor ihnen, so nahe, daß sie die einzelnen Gestalten in dem hellen Sonnenschein deutlich unterscheiden konnten, sprengten zwei Reiter: ein Mann und ein Weib, in gerader Richtung den Ansiedelungen der Weißen zu.
Im Nu war der Plan, die Flüchtigen von dem mit Militär besetzten Ort abzuschneiden, gefaßt. „Vorwärts - da hinüber, vorwärts!" befahl Osantos, und die Hufe der behenden und zähen Steppenrosse berührten kaum den Boden in ihrem Sturmeslauf.
Ueber die Pampas hin, Glück und Seligkeit im Herzen und die Gefahr, die ihnen noch immer drohte, nicht achtend, floh Diego mit dem lieben Mädchen. Josefa saß wacker im Sattel, und des alten Gaucho Pferd war ein tüchtiger Renner, wie die weite Steppe keinen besseren je getragen. Weit hintenaus warfen sie den Rasen, und die Vorsicht, die Diego gebraucht hatte, im Anfang und so lange sie noch unter dem Schutz der Nacht dahin ritten, die Verfolger durch kurze Kreuz- und Querritte von der Fährte zu bringen oder wenigstens aufzuhalten, erwies sich für's Erste wirksam genug, um ihnen einen beträchtlichen Vorsprung zu verschaffen. Aber auf die Dauer freilich hatten sie die wilden Söhne der Pampas nicht zu täuschen vermocht. Nun waren sie entdeckt, und unaufhaltsam, das bewegliche Ziel vor Augen, preßten die Verfolger näher und näher heran.
Diego hatte sie längst bemerkt. Schon als die Ersten von dem Trupp aus dem höher liegenden Erdkamm erschienen, erkannte er die drohenden Gestalten gegen den hellen Himmel. /81/ Aber er trieb die Pferde deshalb nicht zu größerer Eile an, damit ihre Kräfte nicht im entscheidenden Augenblick versagen sollten. Noch lag eine weite Strecke zwischen ihnen und den Verfolgern, die ihre eigene Sicherheit mehr und mehr gefährdeten, je näher sie der kleinen Stadt Cruzalta kamen. Daß er sich selber nicht ungestraft dort durfte blicken lassen, galt ihm gleich. Was lag ihm an seinem Leben, wenn er nur Josefen dem furchtbaren Schicksal entreißen konnte, dem sie unter den Wilden verfallen gewesen.
Weiter stürmten die wackeren Renner, weiter und immer weiter, aber der flüchtige und scheue Blick, den Diego zurück über seine Schulter warf, zeigte ihm auch, daß die Verfolger - wenn sie nicht bessere Pferde hatten - doch rücksichtslos um späteres Ermatten sie antrieben, und daß sich die Entfernung, die noch zwischen ihnen lag, mit jedem Augenblick verringerte.
Josefa hatte im Anfang keine Ahnung davon, daß ihnen die Feinde so nahe wären; Diego's häufiges Zurückbleiben machte sie aber endlich ebenfalls aufmerksam, und schaudernd gewahrte sie die wachsende Gefahr. Aber kein Wort wurde zwischen den Beiden gewechselt. Rascher trieben sie ihre Pferde an, und im wilden Flug durchschnitten sie den grünen Plan. Doch umsonst; näher und näher rückten ihnen die Wilden auf den Leib, und schon klang ihnen deutlich das jubelnde Hohngeschrei der Horde in die Ohren.
Da richtete sich Diego hoch im Sattel auf. Nicht mehr nach den Verfolgern schaute er zurück, denn ein Etwas hatte seinen Blick gefesselt, was vor ihrer Bahn war.
„Wir sind verloren," stöhnte Josefa an seiner Seite.
„Noch nicht," rief er ermuthigend. „Seht Ihr dort drüben den dunkeln Fleck auf der grünen Fläche?"
„Eine weidende Heerde," sagte die Jungfrau, und scheu streifte ihr Blick zurück nach den wilden Gestalten, die sie immer bestimmter hinter sich erkennen konnten.
„Das ist keine Heerde," jauchzte aber Diego. „Größer und größer ist der Fleck geworden, und er wächst mit jedem Sprung, den wir vorwärts thun." /82/
„Ihr verändert die Richtung, Seňor," rief Josefa, „kommen uns die Wilden nicht dadurch näher?"
„Ja, aber von jenseit nahen die Retter," jubelte Diego. „Der lange Streifen, der sich dort drüben mehr und mehr entwickelt, ist argentinische Kavallerie."
„Die Wilden würden sich schwerlich so weit in deren Nähe wagen."
„Sie haben sie noch nicht bemerkt," rief Diego - „der Strich, den sie jetzt durchreiten, liegt tiefer als der, auf dem wir uns im Augenblick befinden. Aber ihre Ueberraschung wird desto größer sein. Wenn unsere Pferde nur noch eine halbe Stunde aushalten, so sind wir geborgen."
Josefa strengte ihre Augen an, die sich vor ihnen entwickelnde Schaar zu erkennen. Wenn es am Ende, anstatt einer Gauchotruppe, nur eine andere Horde von Wilden war, so blieb ihnen nichts übrig, als Unterwerfung unter ihr Schicksal. Näher und näher kamen indeß die Feinde, aber Diego hatte schon den rothen Schein der argentinischen Ponchos, das Blitzen der Sonne auf den Karabinern erkannt, und dachte jetzt an die Rettung seiner eigenen Person und an die Mittel, Josefa vor der Rückkehr in Rosas' Gewalt zu bewahren.
Sobald die Indianer nämlich das Militär entdeckten, was in den nächsten Minuten geschehen mußte, so hoffte er, daß sie Halt machen und die Verfolgung aufgeben würden: die Soldaten warfen sich ihnen dann entgegen, und diese Zeit eben hatte er zu benutzen, um sich mit seiner schönen Schutzbefohlenen dem einen wie dem andern Trupp zu entziehen. Waren ihm doch beide so ziemlich in gleichem Grade gefährlich. Noch aber hielten die Wilden nicht in ihrer tollen Hetze ein, und als er den Blick jetzt wieder nach den Argentinern hinüberrichtete, war die Schaar wie in den Boden hinein verschwunden.
Diego indessen, zu gut mit der Steppe und den Gebräuchen derselben bekannt, errieth sofort den Plan der Soldaten, die, von den Indianern vielleicht noch nicht entdeckt, jetzt dieselbe List gegen die gebrauchen wollten, die ihnen gestern verderblich geworden. Sie hatten es hier aber mit einem viel zu schlauen Feind zuthun, der nicht so leicht in eine ihm gelegte Falle ging. /83/
Allerdings waren es die heranrückenden Soldaten gewesen, welche die ansprengende Horde, und zwar durch eine aufwirbelnde Staubwolke entdeckten, als sie gerade einen trockensandigen Landstrich passirte. Rasch warfen sie sich daher von ihren Pferden, die braunen Reiter so dicht als möglich heranzulassen, oder gar zwischen sich und die Ansiedelungen zu bringen. Von den beiden Flüchtigen zwischen den einander begegnenden Schaaren hatten die Argentiner bis dahin noch nichts bemerkt. Osantos dagegen folgte diesen auch jetzt noch in voller leidenschaftlicher Hast und glaubte seine Bente schon erreicht zu haben, als er plötzlich die in einem dichten Trupp zusammenstehenden Pferde gewahrte, von denen die Argentiner abgesprungen.
Allerdings benutzten diese Thiere den ihnen gegönnten freien Moment alsbald dazu, das ihnen zunächst liegende Futter abzuweiden. Aber der scharfe Blick des Indianers fand das geschlossene Beisammensein derselben verdächtig. Eine Anzahl reiterloser Pferde hätte sich in den Pampas, außer vielleicht von Wölfen bedrängt, nicht so dicht vereint gehalten, und nur erst einmal aufmerksam gemacht, wurde sein Verdacht bald zur Gewißheit.
Was Osantos' Argwohn bestätigte, war, daß die von ihm Verfolgten, denen die jenseitige Schaar längst in die Augen gerathen sein mußte, dorthin ihren Weg gelenkt hatten. Der schrille Ruf des rothhäutigen Führers bannte also die sich um ihn sammelnden Genossen plötzlich an die Stelle.
„Sie halten!" sprach Josefa aufathmend, die mit immer ängstlicher klopfendem Herzen um sich geblickt hatte, je mehr sich die Entfernung zwischen ihnen und den nachsetzenden Wilden verringerte. „Sie halten - wir sind gerettet - wir sind frei."
„So frei," murmelte Diego vor sich hin, „wie man es in argentinischer Gefangenschaft nur irgend sein kann. - Aber zügelt Euer Pferd ein, Senorita," setzte er lauter hinzu „wir müssen die Thiere verschnaufen lassen, denn von den Indianern haben wir in der That nichts mehr zu fürchten."
„Aber von den Soldaten?"
„Es steht jetzt bei Euch, Josefa, Euch in ihren Schutz zu /84/ begeben, oder mit mir noch eine weite wüste Strecke der Pampas zu durchreiten - wenn es nämlich gelingt, daß wir der Aufmerksamkeit jener Leute entgehen. Wählt, denn die Zeit ist kostbar."
„Ich verabscheue Rosas - ich hasse seine Schergen! Führt mich zu meinem Bruder," lautete die Bitte der Jungfrau, während hohe Räthe ihre Züge übergoß.
Diego sprach kein Wort, aber seine ausgestreckte Aand ergriff die Hand Josefa's, sein Blick ruhte auf ihrem lieben Angesicht einige flüchtige Secunden, dann jedoch vollständig mit sich im Reinen, faßte er den Zügel ihres Pferdes und führte es langsam in einen muldenartigen Einschnitt der Steppe hinab, in dem sie für eine gute Strecke hin beiden feindlichen Trupps aus Sicht gebracht wurden.
XI.
Wahrscheinlich blieb es, daß die Soldaten noch eine kurze Zeit warten würden, bis sich entweder die Indianer zurückzogen, oder sie auf andere Weise ihre List mißlungen sahen; dann aber machten sie auch jedenfalls einen directen Angriff auf den Feind, den Ueberfall von gestern Morgen aus frischer That zu rächen, und ungehindert konnten die Flüchtlinge vielleicht die Zeit benutzen, beiden Theilen aus dem Weg zu kommen.
Rechnete Diego indessen auf eine feige Flucht der Wilden, so hatte er sich darin vollständig geirrt, denn Osantos, noch siegestrunken von dein gestrigen Kampf, und zum Aeußersteu entschlossen, das schöne weiße Mädchen wieder in seine Gewalt zu bekommen, dachte nicht daran, sich die schon gesichert geglaubte Beute durch einen Trupp zufällig auftauchender Soldaten entreißen zu lassen. Aus der veränderten Richtung, die Diego einschlug, erkannte der schlaue Wilde sofort, daß Jener fürchte, mit den Argentinern zusammen zu treffen; sein Plan mußte dann sein, zwischen ihnen hindurch zu schlüpfen, und den gedachte ihm Osantos zu vereiteln. /85/
Kaum daher, daß die beiden Flüchtigen in der muldenartigen Senkung des Landes verschwanden, nahm Osantos zwei von seinen Leuten zu sich, und bog mit diesen, nach einem dem Haupttrupp gegebenen kurzen Befehl, links ab, seine Gefangene wieder zu gewinnen, ehe die Soldaten einen Angriff auf ihn machen konnten. Hier begünstigte ihn auch nicht allein das Terrain, sondern die völlige Sicherheit Diego's, der nicht an die Möglichkeit dachte, im Angesicht eines argentinischen Reitertrupps von den Wilden überfallen zu werden. In der festen Ueberzeugung, beide Theile vollständig mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt zu wissen, hatte er die Thiere eingezügelt und ritt im Schritt die schmale Senkung hin, die ihn vollständig den Blicken seiner Feinde entzog.
„Was ist das?" flüsterte da plötzlich Josefa an seiner Seite. „Das klang wie der Hufschlag eines galoppirendcn Pferdes, - gleich dort drüben."
Diego behielt aber keine Zeit, ihr auch nur Antwort zu geben, denn aus dem hohen Gras hob sich ein brauner Kopf mit blitzenden Augen, ein Arm schwenkte darüber aus, und er war kaum im Stande, sich aus die rechte Seite vom Pferde zu werfen, als auch schon eine kurze Bola nach ihm flog und dicht über seinen Kopf hin zischte.
Im nächsten Moment war er wieder im Sattel, und Josefens Pferd der andern, höheren Seite zudrängend, hatte er gerade seine Pistole gezogen und gespannt, als sich wieder ein brauner Arm mit geschwungenem Lasso erhob. Diego sah nur die unbestimmten düsteren Umrisse im Gras, aber sowie sein Schuß über die Steppe dröhnte, sank der Wilde zusammen. Die Gefahr war jedoch dadurch noch lange nicht beseitigt, denn in demselben Moment fast tauchte Osantos in eigener Person vor ihnen auf; ein anderer Wilder spornte sein Pferd in die flache Schlucht, gerade vor ihre Bahn, und streckte die Hand nach Josefens Zügel aus. Ein Sporendruck, und Diego's Thier schnellte sich in einem mächtigen Satz an seine Seite, und mit wildem Aufschrei stürzte der Indianer blutend aus seinem Sattel.
Verderblich wäre dieser Sieg aber freilich für Diego geworden, hätte nicht eine andere Hand den gewissen Tod von /86/ ihm abgewandt. Osantos, der seine beiden Gefährten rechts und links von sich fallen sah, stieß einen Racheschrei aus, und seine lange Rohrlanze gesenkt, die scharfe Stahlspitze in zitternder Bewegung auf- und niederschwenkend, flog er gegen Diego an. Unmöglich hätte dieser dem sichern und tödtlichen Stoße ausweichen können, denn links war er durch Josefens, rechts durch des getödteten Indianers Pferd eingehemmt, und angstvoll streckte sich sein rechter, noch mit dem langen Messer bewehrter Arm aus, in der thörichten Hoffnung, so den Stoß zu pariren. Wohl sah er, wie ein anderer Reiter auf den Kampfplatz sprengte, sah, wie dessen Lasso ausflog - vielleicht nach ihm selber, ihn vom Pferd zu reißen, als sich die Lanzenspitze plötzlich, schon dicht vor seiner Brust, zu Boden senkte und der Häuptling auch in demselben Moment machtlos in's Gras geschleudert wurde.
„Paciencia, amigo," sagte dabei die ruhige Stimme Felipe's, der seinem Pferde, indem er es zur Seite riß, die Sporen gab und dadurch den so glücklich geworfenen Lasso nur fester um die Arme des gefangenen Häuptlings schnürte, „mit solchen Stahlspitzen solltest Du etwas vorsichtiger gegen Christen sein. Aber, quien rompe, pay! Stoßt zu, Seňor, und zahlt dem Schuft für seine Thaten!"
Diego war in der That im ersten Augenblick, als er den Indianer machtlos in seiner Gewalt sah, vom Pferd und mit der blanken Klinge auf ihn zugesprungen. Osantos erwartete nichts Anderes als den Tod, und blickte seinem Feind nur fest und starr in's Auge, hätte dieser von ihm, in gleichem Falle, doch auch nichts Besseres zu erwarten gehabt - aber ein anderer Gedanke durchzuckte den jungen Mann. Felipe, der hier so zur rechten Zeit eingetroffen, hielt auf höherem Boden, von wo aus er ein weiteres Stück der Pampas überschauen konnte.
„Was treiben die Soldaten, Amigo?" rief er diesem zu.
„Santa Maria," rief der Alte verwundert, „stoßt dem Schuft erst Euer Messer in den Leib, dann ist es Zeit genug, sich um die zu kümmern, die jetzt in vollem Angriff auf die Wilden sind."
„Und die Indianer?"
„Sehen ans, als ob sie Stand halten wollten, sie spielen /87/ ihr altes Spiel, lassen ein paar von den Soldaten in's Gras beißen, und wenn sie merken, daß sie den Kürzeren ziehen, stieben sie auseinander, wie ein Schwarm Papageien - wer will sie fangen! So stoßt zu und kommt."
Der Indianer lag still und regungslos; er wußte, daß der Stahl sein Leben treffen mußte, ehe er im Stande gewesen wäre die tiefgeschnürte Schlinge abzuwerfen, und er durfte keine Furcht vor dem Tode zeigen.
„Paciencia, amigo!" lachte da der junge Mann, während Josefa schaudernd ihr Angesicht verhüllte, den neuen und vielleicht nothwendigen Mord nicht ansehen zu müssen - „paciencia! Du hast mir die alte Warnung oft genug zugerufen. Wie steht der Kampf jetzt?"
Kopfschüttelnd wandte sich der Alte der Gegend zu.
„Jetzt prallen sie gegen einander," rief er plötzlich. „Beim Himmel, die rothen Burschen halten sich besser, wie ich gedacht; es sieht ans, als ob sie sich hierher werfen wollten."
Osantos zuckte krampfhaft mit dem Arm, aber der Lasso hielt und die Hand Diego's mit dem Messer hob sich wie zum Stoß.
„Kommen sie?" fragte Diego finster.
„Nein, sie wenden sich," rief Felipe, - „hei, da hinten scheint noch ein anderer Trupp Soldaten aufzutauchen, der sie in die Flanke fassen will. Jetzt geht die Flucht Hals über Kopf steppein."
Wieder knirschte der Wilde in seinen Banden, und wieder hob sich das vorher gesenkte Messer, ohne aber nach des Feindes Herz zu suchen.
„Und jetzt?"
„Ueber die Pampas flieht der ganze Schwarm," rief der alte Gaucho, der jetzt selber Interesse an der Jagd zu nehmen schien, - „weit, weit hinaus, von wo sie hergekommen. Hnrrah! die Bahn ist frei und wir haben die wilden Steppenwölfe nicht mehr zu fürchten."
Diego, ohne ein Wort zu erwidern, bog sich nieder und löste des Häuptlings Bande, während Felipe mit einem Fluch und Schreckensruf dazwischen sprang.
„Carachao!“ rief er aus, „Ihr laßt den rothen Teufel los - wißt Ihr, was Ihr damit beginnt?" /88/
„Geh, Osantos," sagte aber Diego, indem er zu seinem Pferde fort und in den Sattel sprang - „dort drüben fliehen Deine Leute, schließ Dich ihnen wieder an - wenn wir von jetzt an auch keine Freunde sein können, sind wir doch und bleiben wir gemeinsame Feinde jenes Tyrannen, der Euch und uns bedrückt. Willst Du vergessen, was hier geschehen ist, wenn wir einander wieder begegnen?"
Finster und wild blickte ihn der Indianer an und schaute dann nach seinem Pferd hinüber, das nur wenige Schritte von ihm entfernt das süße Gras abzupfte. Don Diego hatte ruhig sein Messer in die Scheide zurückgestoßen und lud die vorher abgeschossenen Pistolen wieder. Jetzt schnalzte der Wilde mit der Zunge; das Pferd spitzte die Ohren und kam langsam näher.
„Und versprichst Du mir, uns nicht weiter zu verfolgen?" fragte Diego.
Osantos griff seine Lanze auf, faßte die Mähne seines neben ihm stehenden Thieres und blickte trotzig den Weißen an. Was ihm aber auch für dunkle Pläne das Hirn gekreuzt, er mußte fühlen, daß er den beiden Männern nicht gewachsen war, wenn selbst das eben geschenkte Leben ihn nicht gebunden hätte. Kein Laut öffnete dabei seine Lippen; nur einmal schweifte sein glühender Blick über Josefens zitternde Gestalt, dann schnellte er sich in den Sattel, und als Felipe fast unwillkürlich den Lasso wieder aufgriff und Diego die indeß geladene Pistole hob, glitt das Pferd des Häuptlings wie ein Pfeil zwischen ihnen durch, hinaus in die Pampas.
Diego sprengte jetzt ebenfalls auf die Erhöhung, dem flüchtigen Wilden nachzuschauen, aber lange konnte er ihm mit den Blicken nicht in dem hohen Steppengras folgen, da er sich noch dazu ganz auf den Sattel niederbog. Er floh, die Seinen wieder einzuholen und dabei zugleich der Aufmerksamkeit vielleicht hier und da gelagerter Späher zu entgehen. Sie selber hatten nichts von ihm zu fürchten.
„Wenn Ihr es nur nicht bereuen müßt, dem Burschen das Leben geschenkt zu haben," brummte Felipe - „es thut nie gut, denn hätte er mir gestern den Hals abgeschnitten, /89/ wie es ihre Sitte ist, so wäre ihm heute mein Lasso nicht in die Quere gekommen."
„Es ist der bitterste Feind, den Rosas hat," sagte aber Diego, „den mußte ich ihm erhalten. Treffen wir wieder zusammen, wer weiß, ob es dann nicht aus einer Seite im Felde geschieht, und Rosas selber gäbe Tausende von Dollars, den braunen Arm unschädlich zu wissen. Aber nun fort; die argentinische Besatzung von Altacruz ist uns gefährlicher wie jener wilde Sohn der Pampas - die müssen wir vor allen Dingen vermeiden."
„Und wir gehen nicht nach Altacruz zurück?" frug Josefa rasch.
„Nicht wieder in Euer Gefängniß," lachte Diego fröhlich. „Während die rothen Ponchos hinter den Indianern hersetzen und dort die abhanden gekommenen Depeschen suchen, schneiden wir sicher nach dem La Plata hinüber, wo mir der Freunde viele leben. Einmal dort, und wir sind gerettet, und durch Entre Rios oder den La Plata hinab, schaffe ich Euch sicher nach Montevideo. - Und gehst Du mit, Felipe?",
„Dank Euch," sagte der Alte ruhig - „bis jetzt kann mir Niemand etwas in den Weg legen; selbst mit der Depeschengeschichte habe ich nichts zu thun gehabt. Daß ich geflohen bin, kann mir Niemand verdenken, der Correo hat's nicht besser gemacht, deshalb reit' ich jetzt ruhig wieder nach Hause, die Dinge abzuwarten. Bringt Ihr einmal wirklich Hülfe, nun wer weiß, wie ich Euch dann nützen kann."
„Ein Wort, ein Mann," rief Diego ihm die Hand entgegenstreckend - „und jetzt -"
„Möchte ich nur die Seňorita bitten, daß wir wieder die Pferde mit einander tauschen," lachte Felipe. „Ich bin einmal an den Alten gewöhnt und er an mich, überdies ist das Thier, das ich bis jetzt geritten, frischer und wird sie besser tragen."
Damit war er schon aus dem Sattel, warf diesen ab, half Josefen vom Pferd und hatte in wenigen Secunden den Tausch nicht allein beendet, sondern das schöne Mädchen auch schon wieder in den Sattel gehoben. /90/
„Und jetzt mit Gott! Vivan los salvajes Unitarios, Muera el enemigo Rosas!"
„Muera!" jubelte Don Diego, und Felipe's Revenka traf das Pferd Josefens, daß es mit raschem Satz nach vorn sprang.
„Fort mit Euch," rief der alte Mann dabei, „die Zeit vergeht, und erst über der Mendozastraße drüben dürft Ihr Eure Thiere verschnaufen lassen."
Diego streckte ihm die Hand hinüber, die er herzlich drückte.
„Ich werde Euch den Dienst im Leben nicht vergessen."
„Bah," lachte der Alte, „war schon vorher bezahlt," und den Hut gegen Josefa schwenkend, die ihm noch ein letztes Lebewohl zuwinkte, blieb Felipe noch eine ganze Weile halten und sah den beiden jungen Leuten nach. Dann wandte er sich um, die beiden Messer der erschlagenen Indianer an sich zu nehmen, denn die Lassos hatten die flüchtig gewordenen Pferde mit fortgenommen, stieg wieder in den Sattel, warf noch einen Blick nach den beiden schon in weiter Ferne verschwindenden Reitern hinüber, und kehrte dann langsam, ohne sich weiter um Militär oder Indianer zu bekümmern, nach Cruzalta zurück.
Die Fcuerjagd auf Hyänen in Afrika.
Erstabdruck: Gartenlaube.Illustrirtes Familienblatt, a.a.O., Nr. 14, Seiten 220 – 223, 1863
Wenn man in Europa afrikanische Jagd erwähnen hört, so denkt man gewöhnlich an die massenhaften Wildzerstörungen eines Cumming, Gerard13 usw.usf. und bevölkert im Geist den ganzen ungeheuern Continent mit einer wahren Unzahl von Raubthieren, Elephanten, Giraffen, Straußen etc.
Die Berichie der verschiedenen Naiurforscher, denen wir hauptsächlich Nachrichten über jene Länder verdanken, tragen dazu nicht wenig bei, denn Naturforscher sind sehr selten, fast nie wirkliche Jäger, wenn sie auch gern und viel schießen. Es ist auch ganz natürlich, denn sie gehen nur darauf aus, besondere Species von Thieren zu finden, und ein kleiner neuer Vogel interessirt sie viel mehr, als ein in allen zoologischen Gärten schon vorhandenes Raubthier. Sie schießen deshalb, wo sie etwas Interessantes finden, und zerstören sich mit dem Knall vielleicht die wundervollste Jagd für den ganzen Tag. Ihre Berichte über Jagd sind deshalb auch mit großer Vorsicht aufzunehmen, und die Heuglin'schen Schilderungen14 der Jagd in den nämlichen Strecken, welche die kleine Expedition des Herzogs von Coburg durchzog, geben dafür nur wieder den Beweis.
Man war danach berechtigt, oder wurde vielmehr verleitet zu glauben, daß jener Landstrich von Wild schwärme, eine /92/ Hoffnung, die sich allerdings nicht erfüllte. Dennoch gab es auch selbst für den Jäger manches Interessante, und dem Jäger in Deutschland wird es deshalb erwünscht sein, einen kurzen und getreuen Bericht von Jemandem über jenen Landstrich zu hören, der sich selber einen Jäger nennen darf. Ich spreche hier natürlich nur von dem District, den wir selber besuchten.
Um mit dem edelsten Wild, dem Löwen, zu beginnen, so giebt es deren in Samhara sowohl wie in den Bergen; die Fährte dieses sogenannten Königs der Wüste ist an vielen Stellen in den Sand eingedrückt, wenn wir auch - mit einer einzigen Ausnahme, wo Prinz Leiningen eine Löwin flüchtig davongehen sah - keins dieser Thiere zu Gesicht bekamen. Wie alle Raubthiere, liegt er den Tag über versteckt und geht nur des Nachts auf Beute aus, kommt ihm aber am Tag ein Mensch zufällig zu nah und hört er nur den Schritt desselben, so läuft er eben wie alle übrigen Raubthiere und versteckt sich an anderer Stelle. Dahin reduciren sich alle Mordgeschichten vom Löwen, über dessen Großmuth und die Gewalt des menschlichen Auges über ihn so viele sehr schöne Geschichten im Umlauf sind. Fühlt er sich freilich verwundet und vom Menschen, seinem Feind, bedrängt, dann wendet er sich natürlich gegen ihn, und daß er die Kraft hat ihn zu vernichten, ist sicher. Ebendasselbe thut der Hirsch und zu gewissen Zeiten selbst der Rehbock; das Nämliche thut die wilde Katze.
Es ist möglich, daß, in der Samhara15 besonders, mit einer großen Anzahl von Treibern eine glückliche Löwenjagd zu Stande gebracht werden könnte. Die Eingeborenen selber haben aber keinen Begriff von einer solchen Jagd und würden nur schwer dazu zu bringen sein, und da es nie versucht wurde, läßt sich auch weiter nichts darüber sagen. Hielte man sich übrigens Monate lang, und und zwar zu einer Zeit wo die Heerden dort weiden, in der Samhara auf, so ist es recht leicht möglich, daß man einmal nach eifrigem Bürschen einem Löwen begegnen und ihn dann auch erlegen könnte. Bei einem bloßen Durchmarsch aber wäre das nur reiner Zufall. /92/ Hoffnung, die sich allerdings nicht erfüllte. Dennoch gab es auch selbst für den Jäger manches Interessante, und dem Jäger in Deutschland wird es deshalb erwünscht sein, einen kurzen und getreuen Bericht von Jemandem über jenen Landstrich zu hören, der sich selber einen Jäger nennen darf. Ich spreche hier natürlich nur von dem District, den wir selber besuchten16.
Um mit dem edelsten Wild, dem Löwen, zu beginnen, so giebt es deren in Samhara sowohl wie in den Bergen; die Fährte dieses sogenannten Königs der Wüste ist an vielen Stellen in den Sand eingedrückt, wenn wir auch - mit einer einzigen Ausnahme, wo Prinz Leiningen eine Löwin flüchtig davongehen sah - keins dieser Thiere zu Gesicht bekamen. Wie alle Raubthiere, liegt er den Tag über versteckt und geht nur des Nachts auf Beute aus, kommt ihm aber am Tag ein Mensch zufällig zu nah und hört er nur den Schritt desselben, so läuft er eben wie alle übrigen Raubthiere und versteckt sich an anderer Stelle. Dahin reduciren sich alle Mordgeschichten vom Löwen, über dessen Großmuth und die Gewalt des menschlichen Auges über ihn so viele sehr schöne Geschichten im Umlauf sind. Fühlt er sich freilich verwundet und vom Menschen, seinem Feind, bedrängt, dann wendet er sich natürlich gegen ihn, und daß er die Kraft hat ihn zu vernichten, ist sicher. Ebendasselbe thut der Hirsch und zu gewissen Zeiten selbst der Rehbock; das Nämliche thut die wilde Katze.
Es ist möglich, daß, in der Samhara besonders, mit einer großen Anzahl von Treibern eine glückliche Löwenjagd zu Stande gebracht werden könnte. Die Eingeborenen selber haben aber keinen Begriff von einer solchen Jagd und würden nur schwer dazu zu bringen sein, und da es nie versucht wurde, läßt sich auch weiter nichts darüber sagen. Hielte man sich übrigens Monate lang, und und zwar zu einer Zeit wo die Heerden dort weiden, in der Samhara auf, so ist es recht leicht möglich, daß man einmal nach eifrigem Bürschen einem Löwen begegnen und ihn dann auch erlegen könnte. Bei einem bloßen Durchmarsch aber wäre das nur reiner Zufall. /93/
Leoparden giebt es ebenfalls in den Bergen, und vielleicht mehr als man denkt; aber in den furchtbaren Mimosendickichten und steilen Hängen ist ihnen noch viel schwerer beizukommen, wie den Löwen in der Samhara, und eine wirkliche Jagd auf sie zu machen, ganz unmöglich. Das Einzige, was man vielleicht thun könnte, wäre einen Luderplatz herzustellen und Nacht auf Nacht auf dem Anstand zu sitzen; aber selbst da würde man seine ewige Noth mit den Hyänen haben, die ganz unglaubliche Quantitäten Fleisch in einer einzigen Nacht fressen und davontragen. Auch die Jagd auf Leoparden ist deshalb keine, auf die man fest rechnen kann; der Leopard ist außerdem so scheu wie der Löwe und versteckt sich am Tage, wenn ihn nicht der Hunger heraustreibt, eben so sorfältig.
Hyänen giebt es dagegen genug, und man scheucht sie zuweilen über Tag bei einem Bürschgang auf, oder kann sie auch mit einiger Ausdauer Nachts an irgend einer Stelle bei ausgeworfener Lockspeise schießen, denn sic kommen mit der größtmöglichsten Unverschämtheit bis dicht an die Zelte und Hecken heran. Ihretwegen sind auch in der That alle Dörfer oder einzelnen Wohnungen im Land mit dichten Dornenhecken umgeben, denn es ist schon vorgekommen, daß sie, von scharfem Hunger getrieben, in die Hütten der Eingeborenen hineingefahren sind und ein gerade schreiendes Kind erfaßt und davongeschleppt haben, und was sie einmal mit ihrem furchtbaren Gebiß packen, das lassen sie auch sicher nicht wieder los.
Uebrigens sind sie, trotz ihrer Gier und Gefräßigkeit, doch ziemlich schlau und scheu, und obgleich der Herzog, Fürst Hohenlohe, Prinz Leiningen und ich viele lange Nächte auf dem Anstand lagen, so wurde doch bei dieser Gelegenheit nur eine einzige vom Prinzen Leiningen geschossen. Sie wählen auch kluger Weise dunkle Nächte am liebsten zu ihren Raubzügen und kommen gewöhnlich erst, wenn der Mond unter ist; bei Vollmond dagegen sehr spät, fast immer gegen zwei Uhr Morgens.
Schakals giebt es ebenfalls in ziemlicher Anzahl. Der Schakal ist eine Art Prairiewolf; ein Mittelding zwischen /94/ Wolf und Fuchs, ohne den Muth des ersteren und die Schlauheit des letzteren. Er schleicht scheu und feige des Nachts auf Raub aus und sucht sich von dem zu nähren, was ihm die größeren Bestien überlassen, oder was er stehlen kann.
Das sind die Raubthiere dieses Landestheils, von denen meiner festen Ueberzeugung nach der Mensch für sich selber auch nicht das Geringste zu fürchten hat. Der Jäger mag allein durch alle jene Wildniß und Berge bürschen, und er wird sich keiner größeren Gefahr aussetzen, wie im Thüringer Wald daheim, außer er träfe vielleicht in unmittelbarer Nähe mit einem Löwen zusammen und liefe selber davon - vielleicht bekäme dann der König der Thiere Courage. Wer nur ein klein wenig Muth und Geistesgegenwart hat - was selten einem wirklichen Jäger fehlt -- der mag getrost allein die Jagd auf alle diese Thiere betreiben; auf die Eingeborenen, die er mitnehmen könnte, ist überdies kein Verlaß, denn bei wirklicher Gefahr darf er vollkommen versichert sein, daß sie ihn doch im Stich lassen.
Was das übrige Wild betirfft, so findet sich die schlanke Gazelle in der Samhara am häufigsten, und da, besonders nah dem Bergen zu, das Terrain mehr gebrochen und überall mit kleinen Büschen bedeckt ist, so bietet die Bürsche auf dieses Wild nicht allein Unterhaltung, sondern die Gazelle selber auch einen delicaten Braten für das Lagerfeuer. Wie bei der Gemse haben Bock und Geis aufgesetzt, der Bock aber natürlich stärker, mit einem etwas mehr ausgebogenen Gehörn, das wie bei dem Gemskrickel in eine niedergebogene, aber stets nach innen gedrehte Spitze ausläuft. Das Gehörn ist außerdem nicht glatt, sondern die ganze Länge hinaus wie mit dem Finger rund herum eingedrückt.
Ein ganz ähnliches Gehörn hat die Semaringi-Anti lope, nur natürlich viel stärker und ein klein wenig anders gebogen wie die Gazelle. Die Semaringi-Antilope ist aber auch im Wildpret meistens zwei- oder dreimal so stark, sonst aber in der Lebensart der Gazelle vollkommen gleich, nur wo möglich noch scheuer. Es gelang uns nur sehr wenige davon zu erlegen. Sie hat wie die Gazelle eine braungelbe Färbung, aber die hintere Hälfte der Keulen ist, wie der /95/ Bauch, vollkommen weiß. Auch bei diesen Antilopen haben die Geisen aufgesetzt und tragen nur etwas schlankeres, dünneres Gehörn wie der Bock, der unter seinem tüchtigen Kopfschmuck gar stattlich einherschreitet. Das Wildpret ist vortrefflich.
Außer diesen kommt in der Samhara auch noch, wie in den Bergen, die kleine Zwergantilope vor, bei der der Bock ein paar zierliche kleine Spieße auf hat. Die Zwergantilope ist an Körper etwa unseren Hasen gleich, mit schlanken allerliebsten Läufen und leicht gefleckt, ja sieht fast einem frisch gesetzten Wildkalb ähnlich. Dabei ist ihr Wildpret süßlich und man ißt cs sich leicht zuwider, ja man schießt die Thiere zuletzt sogar mit Widerwillen, weil es gerade einem Wildkalb so ähnlich sieht, und ich habe später auch nur darauf geschossen, wenn ich für die Nacht vielleicht eine Lockspeise brauchte. Sie sind übrigens wenigstens viermal so groß wie der javanische Zwerghirsch.
Außer diesen soll es in der Samhara noch die große Oryx-Antilope geben, mit langem geraden Gehörn, sie wurde aber aus dem Strich, den die Expedition nahm, nirgends angetroffen. Man darf übrigens nicht etwa glauben, daß alle diese Antilopen und Gazellen in großen Mengen vorhanden und gar vertraut wären. Was an Wild dort vorkommt, ist außerordentlich scheu, und man kann viele Stunden lang bürschen, ohne auch nur ein einziges Stück zu Gesicht zu bekommen. Jedenfalls ist die Jagd hinlänglich schwierig und beschwerlich, um interessant zu sein. Strauße sollen in der Samhara manchmal vorkommen und Einer der Herren traf am vorletzten Tag auf seinem Bürschgang vier; die andere Gesellschaft dagegen nicht einen einzigen, ja nicht einmal im Sand die doch leicht kenntlichen und auffallenden Fährten.
Giraffen und Elephanten kommen in der Samhara gar nicht vor; die letzteren treffen wir aber wunderbarer Weise schon in den steilen, alpenähnlichen Hängen der Gebirgskette; welche die Bogosländer von dem Küstenstrich trennt, und dort scheinen sie sich vorzugsweise von den jungen Olivenzweigen zu nähren, die in einigen Districten in großer Menge wild wachsen. /96/
Die Jagd auf Elephanten ist an diesen Stellen außerordentlich beschwerlich, denn der Jäger muß ungeheure Strecken weit in den steilen, dornbewachsenen Hängen umherklettern, ehe er dies sehr scheue Wild nur zu Gesicht bekommt. Große Vorsicht ist dabei unumgänglich nöthig, denn einmal beunruhigt, verlassen die Elephanten augenblicklich den ganzen District und wandern dann enorme Strecken weit, ehe sie sich wieder sicher fühlen und auf's Neue ihren festen Aufenthalt nehmen.
In diesen Gebirgen kann der Elephant natürlich nur an gebürscht werden und es ist rathsam, daß bei dieser Jagd mehrere Schützen zusammen sind, um einem angeschossenen gleich eine Anzahl von Kugeln aufzusetzen. Eine einzelne Kugel kann ihn tödten, aber der Fleck in der großen, hellen Körperfläche ist klein und unsicher zu treffen. Der sicherste Fleck soll dicht hinter dem Gehör sein, und zwar in der Vertiefung der Knochen.
Diese Jagd kann gefährlich werden, wenn auf dem rauhen, keine rasche Bewegung erlaubenden Boden der Jäger dem ungeschlachten Wild gerade in den Weg kommt, oder sich unnöthiger Weise sehr bemerkbar macht. Der Elephant ist nicht sehr ängstlich mit Ausweichen und was er, mit dem Gewicht natürlich, unter den Fuß bekommt, ist rettungslos verloren.
Die Eingeborenen jagen den Elephanten ebenfalls, und zwar mit ihren alten Gewehren, bürschen sich dann aber stets dicht an ihn an. Uebrigens ist es ganz unnöthig, daß die Kugel, mit der ein solches Thier erlegt werden soll, eine eiserne Spitze haben oder überhaupt Spitzkugel sein muß. Auch die runde Kugel schlägt, auf nicht zu große Entfernung, überall durch die Decke und macht jedenfalls eine bessere Wunde als die Spitzkugel, die, meiner Meinung nach, das Schlechteste ist, was ein Jäger auf Wild verschießen kann - wenn er nicht eben ganz ausgezeichnete Hunde bei sich hat. Wo das aber nicht der Fall ist, kann man sich fest darauf verlassen, daß man sehr häufig ein noch so gut geschossenes Wild verlieren wird, weil es mit einer Spitzkugelwunde ganz unverhältnißmäßig wenig schweißt.
Vom Elephanten werden, wie bekannt, die Fangzähne /97/ genommen, und die Eingeborenen schneiden sich noch außerdem zwei runde Stücken Decke aus den beiden Schulterblättern, aus denen sie ihre runden Schilde verfertigen. Aus dem Fleisch scheinen sie sich wenig oder gar nichts zu machen, oder essen es auch vielleicht nur deshalb nicht, weil sie dem noch lebenden Thier nicht nahe genug kommen können, um es, wie es ihnen ihre Religion gebietet, abschlachten oder schächten zu können.
In den Gebirgen selber treffen wir aber auch noch anderes Wild, und zwar vor allem andern die Sassa-Antilope oder afrikanische Gemse - nicht mit dem Gemsbock des Cap zu verwechseln, der ein ganz anderes und viel größeres und stärkeres Wild ist, auch außerdem nicht die geringste Aehnlichkcit mit einer Gemse hat.
Die Sassa-Antilope, ein viel kleineres und schlankeres Thier jedoch wie unsere europäische Gemse, ähnelt dieser, wenn man sie, besonders von Weitem, auf einem spitzen Stein stehen oder in den Felsen herumklettern sieht, außerordentlich. In der Nähe fällt dieser Unterschied aber bedeutend weg, denn in ihren einzelnen Theilen zeigt sie wohl eine Verwandtschaft mit der Gemse, aber weiter nichts. Wie diese, liebt sie jedoch felsiges Gestein zu ihrem Aufenthalt und kommt nie in das flache Land herunter. Sie klettert ebenfalls ganz ausgezeichnet und geht besonders über die schrägen und glatten Granitplatten mit einer Sicherheit, mit der es ihr kein anderes Thier ihres Geschlechts, ihre Base, die Gemse, ausgenommen, gleichthun könnte.
Der Bock trägt ein nicht sehr langes, aber gerades und sehr spitzes Gehörn, ziemlich ähnlich wie die Zwergantilope, nur natürlich etwas größer. Die Geis hat dagegen, unähnlich der europäischen Gemse, nicht auf.
Merkwürdig bröckelig ist das Haar der Sassa, sehr rauh und grob dabei, von heller, fast weißer Farbe, bis oben am Ende, wo es sich dunkelbraun ausschattirt und in eine flache, hellgelbe Spitze ausläuft. Es biegt sich aber gar nicht, sondern knickt bei dem geringsten Versuch dazu ein. Die Farbe der Sassa, wenn sie draußen im Gebirg steht, ist eine braungraue, ähnlich den Granitblöcken, zwischen denen sie sich aufhält. Sie ist ziemlich häufig. /98/
Mit der Sassa bewohnt noch eine prachtvolle andere Antilope die nämlichen Gebirge, und zwar die Kudu-Antilope.
Die Kudu-Antilope ist die stärkste, die uns zu Gesicht gekommen. Nur der Bock hat auf, und zwar ein mächtiges gewundenes Gehörn, das ihm ein ganz imposantes Ansehen giebt. Die Farbe der Kudu-Antilope ist lichtbraun mit an der einen Seite drei, an der andern vier mattweißen schmalen Streifen, die vom Rückgrat nach dem untern Theil des Wanstes hinablaufen. Nur ein einziger Bock wurde von der Expedition angetroffen und erlegt, so viel Thiere desselben Geschlechts auch zu Gesicht und Schuß kamen. Dieser Bock wog, mit dem Aufbruch, sicherlich seine sechshundert Pfund (genau gewogen konnte er natürlich droben nicht werden) und war ein mächtiges Thier von wildem, trotzigem Aussehen. Die Thiere sind aber ebenfalls nicht klein und wenigstens so groß wie ein starkes Altthier in den Tyroler Bergen - bekanntlich die stärksten an Körper in Europa.
Dieser Bock stand einzeln, jedenfalls geht er aber zu gewissen Jahreszeiten mit dem ganzen Rudel zusammen; in dieser Zeit aber, in der wir die Berge durchstreiften, waren in den Rudeln nur Thiere und Kälber, und die Rudel zwar sehr klein, nur höchstens fünf oder sechs Stück, die sich nur sehr schwer ankommen ließen. Es wurden auch nur drei Stück im Ganzen erlegt.
Sauen giebt es ebenfalls in den Gebirgen, und zwar eine ganz wunderliche, rothfuchsige Art mit herunterhängendem Gehör und außerordentlich starkem Gewehr, aber sie sind selten und scheu, und wir waren nicht im Stande, eine davon zu erlegen, auch freilich nicht in der Gegend, wo sie sich am meisten aufhalten sollen.
Ich selber begegnete eines Tages, als ich einen Platz wieder aufsuchte, wo ich am vorigen Tag eine einzelne Sau angetroffen, einem den Hang herabkommenden Honigdachs, der erste, der, wie ich glaube, in Abyssinien geschossen ist. Es war an einer Stelle, wo es sehr viele Frankolinhühner gab, und ich hatte eben die Schrotflinte in der Hand, als ich die dunkle Gestalt über mir ziemlich rasch durch die Felsen gleiten sah. Natürlich wußte ich im ersten Augenblick gar nicht, was es /99/ war, feuerte aber auf etwa achtzig Schritt. Der Dachs drehte jetzt, kam auf etwa dreißig Schritt bei mir vorüber und fiel mit dem zweiten Rohr.
Er war nicht ganz so stark wie unser Dachs, mit ziemlich niedrigen Läufen, schwarz, mit einem sehr breiten weißen Streifen auf dem Rücken und einem ganz durchdringenden fast unerträglichen Moschusgeruch. Jedenfalls ist das Thier hier sehr selten.
An Geflügel giebt es dagegen desto mehr für den Jäger, wenn er eben blos für die Küche sorgen will, denn man geht doch eigentlich nicht nach Afrika, um Hühner zu schießen, und der Knall des Gewehres - wenn er das benachbarte Wild nicht gleich verscheucht - macht es doch jedenfalls aufmerksam und vorsichtig, so daß es sich bei dem geringsten verdächtigen Geräusch in das Dickicht zurückzieht.
Die beiden Hauptarten von Hühnern, die hier vorkommen, sind Frankolin- und Perlhuhn, und von dem ersteren wieder eine Menge Varietäten. Die Jagd auf diese Hühner ist aber keineswegs sehr angenehm, denn sie stehen nicht auf, sondern laufen - sobald sie den Jäger sehen oder ein Schuß fällt - in die Mimosen hinein und darin fort, daß es gewöhnlich zur Unmöglichkeit wird, ihnen darin zu folgen oder sie wieder zu finden.
Die Perlhühner sind bekannt, denn es giebt deren genug in Deutschland zahm. Sie leben in den Bergen besonders in Völkern von zwanzig bis dreißig Stück zusammen.
Trifft man frische Völker an, die noch nicht oder lange nicht gejagt sind, so lassen sie den Schützen ziemlich nahe heran; sind sie aber schon kürzlich beschossen worden, dann ist an Halten kein Gedanke und sie streichen entweder in weitester Entfernung ab, oder laufen zwischen Felsen und Gestrüpp hinein, in dem sie, ohne Hunde, spurlos verschwinden.
Das Frankolinhuhn, ein schönes braunes Huhn, so groß wie das Perlhuhn, macht es genau so, lockt aber häufiger und verräth dadurch eher seinen Aufenthalt. Wenn man diesen Ruf nachahmen könnte, so würde man ohne Zweifel in sehr bequemer Art eine große Anzahl schießen; nun aber muß /100/ man jedes einzelnen wegen in die Dornen und Felsen hineinklettern, und wie oft noch außerdem vergeblich.
Die Zwergantilope hält sich sehr gern zwischen diesen Hühnern auf und wird häufig in ihrer Nähe, oft mitten in einem Volk, angetroffen.
Das Wüstenhuhn kommt hauptsächlich in der Samhara oder den nächsten Thälern vor. Es ist ein ganz reizendes Huhn, das aber eigentlich, besonders im Flug, viel mehr Ähnlichkeit mit der Taube hat. Jedenfalls bildet es vom Huhn zur Taube den Uebergang. Es ist außerdem nicht ganz so groß wie eine Holztaube, lebt aber in Völkern und streicht, wenn aufgescheucht, niedrig und nicht sehr weit ab, läuft dagegen sehr wenig.
Am Ainsaba kommt unser gewöhnliches Rebhuhn in verschiedenen Arten häufig vor; auch findet es sich am Abhang der Gebirge einzeln in den Durhafeldern. Die Wachtel dagegen ist aller Orten und Enden ziemlich oft, besonders aber im flachen Lande anzutreffen.
Von Affen, die man aber eigentlich nicht zum Wild rechnen kann, denn meinem Gefühl nach ist nur der Naturforscher berechtigt, einen Affen zu schießen, giebt es, oder trafen wir nur zwei Arten: den kleinen braunen, langgeschwänzten Baumaffen und den Mantelaffen - beide Arten an den Stellen, wo sie sich aufhalten, ziemlich häufig.
So ist der Wildstand in jenem Landstrich, welchen die kleine Expedition besuchte und durchstreifte. Es giebt Wild dort, das ist keine Frage, und ein guter Jäger kann auch zur Noth so viel erlegen, wie er für sich und ein paar Diener braucht, aber er darf sich die Sache um Gottes willen nicht so leicht denken, und wenn er nicht gerade auf Hühner oder Zwergantilopen ausgeht, so kann er recht zufrieden sein, wenn er durchschnittlich ein Stück Wild im Tag erlegt - wir konnten es nicht und haben uns gewiß Mühe genug gegeben. Was m i ch besonders in Afrika reizte, war das: auch einmal in diesem Welttheil die Feuerjagd zu versuchen.
Seit ich dieselbe vor vielen Jahren in Nordamerika getrieben und dann wieder nach Europa zurückgekehrt war, hatte ich stets den Wunsch gehegt, den Versuch mit der Pfanne /101/ auch einmal in anderen Ländern zu machen - aber immer vergebens. Entweder war bei sonst günstiger Gelegenheit keine Pfanne oder kein Kien da, oder irgend ein anderes Hinderniß bot sich und es blieb stets bei dem guten Willen. In Deutschland versuchte ich es ein einziges Mal in der Nähe von Leipzig auf Enten. Als ich eines Tages aber vollständig ausgerüstet mit dem Bahnzug an Ort und Stelle fuhr und mein Experiment beginnen wollte, erhob sich ein furchtbarer Wind, daß ich unverrichteter Sache wieder heimkehren mußte. Es unterblieb also auch diesmal, und erst hier in Cairo, wo ich vortrefflichen Kien fand, erwachte auf's Neue die Lust in mir, diese wundervolle Jagd, die bis jetzt nur allein in Nordamerika getrieben wird, auch in Afrika anzuwenden.
Ich habe die Feuerjagd allerdings in meinen ,,Streif- und Jagdzügen"17 genau beschrieben, darf aber nicht voraussetzen, daß die Beschreibung dem, der jene wirklich gelesen, noch geläufig ist, und es wird deshalb nöthig sein, vorher ein paar Worte zur Erläuterung beizufügen. In Nordamerika, besonders in den westlichen Wäldern dieses wildreichen Landes, ist die Feuerjagd etwas ganz Allgewöhnliches, und trotzdem schüttelt der deutsche Jäger gewöhnlich dazu den Kopf, weil er gewohnt ist, aus alten Jagdbüchern - leider ist das jetzt bei uns nicht mehr nöthig - gelesen zu haben, daß man das Wild gerade durch Feuer abhält und verscheucht; er hält also eine Jagd damit für unmöglich. In Afrika ist dasselbe der Fall. Die Raubthiere werden durch angezündete Feuer abgehalten, und trotzdem habe ich eine glückliche Jagd gerade auf Raubthiere und mit Feuer gemacht.
In Nordamerika ist das Wild allerdings die Feuer gewöhnt, denn überall im Westen werden, besonders im Frühjahr, die Wälder angezündet, um das dürre Gras und die Dornen abzubrennen und Wild und Heerden frische und freie Weiden zu bieten. Eine Menge von alten Stämmen glimmen und brennen dann noch Monate lang nach, und besonders im April, wo die Insecten dem Wild am schärfsten zusetzen, stellen sich die Hirsche außerordentlich gern in den Rauch eines solchen alten Baumes, um hier etwas mehr vor den Bissen der Mosquitos und Fliegen geschützt zu sein. Geht /102/ nun der Jäger mit seiner Fackel oder Pfanne, in welcher Kien brennt, in den Wald, so darf man nicht etwa glauben, daß das Wild zum Feuer kommt und gewissermaßen herangelockt wird, aber es scheut sich wenigstens nicht davor, oder es wird von der plötzlichen Erscheinung der hellen, sich bewegenden Flamme so überrascht, daß es staunend stehen bleibt und den Jäger dadurch in Schußnähe kommen läßt.
In Nordamerika wird die Feuerjagd auf zwei verschiedene Arten betrieben. Bei der einen errichtet sich der Jäger an irgend einer der zahlreichen natürlichen Salzlecken, die sich überall im Walde finden, ein Gestell, auf das er vier bis fünf Zoll Erde legt, und auf diesem die gespaltenen Kienspähne entzündet. Die Hirsche, die gewohnt sind, die Salzlecke zu besuchen, kehren sich nicht im Geringsten an das Feuer, sondern kommen zu der Lecke wie gewöhnlich, wo sie den unter dem Gestell sitzenden Schützen nicht sehen können und von diesem leicht erlegt werden. Der Jäger sitzt nämlich vollkommen im Schatten, und das Wild wird, wenn es nach ihm hinschaut, durch die über ihm lodernde Flamme geblendet. Der Wind scheint hierbei auch nicht von großem Einfluß zu sein, wenn man besonders die Flamme gut in Brand hält, weil der Geruch des Kiens die Witterung des Menschen ziemlich zerstört; wenigstens ist mir Wild an der Salzlccke von allen Seiten und selbst mit schlechtem Winde angekommen.
Viel vorsichtiger muß man dagegen sein - wofür ich eigentlich keinen Grund anzugeben weiß - wenn man mit der Pfanne oder Fackel in den Wald geht. Möglich, daß das Wild durch das sich bewegende Licht und die Gestalt des Jägers (wenn es diese auch nur sehr undeutlich sehen kann) scheuer und vorsichtiger gemacht wird, aber Thatsache ist, daß man mit schlechtem Wind Nachts nie an ein Stück Wild hinankommt.
Zu der Fackcljagd gehört eine eiserne, langstielige Bratpfanne, deren Stiel auf ein etwa vier Fuß langes und etwa vier Zoll breites Brett so fest als irgend möglich aufgebunden wird. Vorn in das Brett wird dann ein Loch eingebohrt und eine Holzgabel eingesteckt, um darein beim Schießen die Büchse zu legen, und in der Pfanne selbst der Kien entzündet, daß er seine helle Flamme weit umherwirft. /103/
Die Eigenthümlichkeit bei der Feuerjagd ist aber die, daß man nicht etwa das Wild bei dem Schein der Fackel zu sehen bekommt, denn dazu müßte man ihm schon wenigstens bis auf dreißig Schritt genaht sein, sondern nur die Augen oder „Lichter" des Wildes leuchten sieht. Ist das Stück Wild noch weit entfernt, so bilden die beiden Augen ein einziges Licht. Kommt man näher, so trennen sich diese langsam, und man ist in Schußnähe, wenn man sie in der richtigen und natürlichen Entfernung vor sich sieht. Nicht immer kommt man auch nahe genug, selbst nur die Umrisse des Körpers - der bei dem Fackellicht fast vollkommen weiß erscheint - unterscheiden zu können, und es bleibt dann nichts übrig, als mit der Kugel zwischen die Augen zu halten. Es schießt sich überdies bei Fackellicht vortrefflich und sicher, denn die Büchse liegt fest in der Gabel vorn, und das Licht der Flamme wirft seinen Schein so deutlich auf das helle Korn gerade von hinten, daß man es klar und genau im Visir unterscheiden kann. Beim Angehen beobachte man aber ja, daß man nie direct auf das Wild zugeht, sobald man erst in dessen Nähe ist, sondern immer etwas seitwärts davon abhält. Es wird in dem Fall viel eher stehen bleiben und in die Flamme schauen. Geht man zu scharf darauf zu, so erschrickt es schon an und für sich vor der sich nähernden Flamme und entflieht, oder weicht wenigstens eine weite Strecke zurück, so daß man von vorn beginnen muß. Auch davor muß man sich ganz besonders hüten, daß man nicht auf dürres Holz tritt oder sonst ein Geräusch macht. Sobald das Wild nur Verdacht schöpft, daß ein Mensch mit dem Feuer in Verbindung steht, ist es spurlos verschwunden und zeigt seine Lichter nicht wieder. Sind die Lichter des Wildes nach dem Schuß verschwunden und hört man gar nichts sich entfernen, so kann man ziemlich fest annehmen, daß man gefehlt hat. Ist das Wild dagegen getroffen, so verschwinden die Lichter allerdings ebenfalls, aber man hört es hastig nnd wild davon poltern, und in dem Fall kann man fest darauf rechnen, daß man auf dem Anschuß Schweiß findet.
Unbedingt nothwendig zu einer Feuerjagd ist aber eine vollkommen dunkle und ruhige Nacht, mit eben Luftzug genug, /104/ um den Rauch zurück zu treiben. Je offener die Gegend dabei ist, desto besser, denn desto weiter ist man in dem Fall im Stande, die Lichter zu erkennen. Bemerken kann ich noch hierbei, daß der Schein des Feuers gewöhnlich zu sehr auf den dem Auge des Jägers zugedrehten Theil des Visirs blitzt. Man verhindert das leicht dadurch, daß man das Visir vorher ein wenig über den Kienrauch hält, wodurch sich eine dünne Rußschicht bildet die ihm jeden störenden Glanz nimmt.
Als wir nach Mensa, in die Hochgebirge Abyssiniens und in ein vortrefflich zu dieser Jagd geeignetes Plateau gekommen waren, stellten sich ihr zwei Hindernisse entgegen. Erstlich war Mondschein, und dann - gab es kein Wild, auf das man hätte in der ganzen weiten Ebene jagen können. In Nordamerika wenigstens gelang es uns nie, einen Panther - bei Fackellicht und mit der Pfanne - zu schießen, denn der amerikanische Panther sieht wohl einen Moment scheu in die Flamme, wendet aber dann rasch wieder den Kopf und umkreist den Jäger, der die Fackel trägt, so lange, bis er Wind von ihm bekommt und dann entflieht. Nur ein einziges Mal in den langen Jahren glückte es mir, einen Panther bei Feuerlicht an der Salzlecke, unter einem Gestell sitzend, zu schießen. Der Panther war an die ziemlich hoch ausgewaschene Salzlecke gekommen, um nachzusehen, ob er nicht vielleicht einen Hirsch darin fände, den er anspringen könnte.
Aus diesem Grunde machte ich gar keinen Versuch, mit der Pfanne hinaus zu gehen und erst den letzten Abend, als wir vergebens die mondhellen Nächte auf dem Anstand gesessen und durch die ganze Gesellschaft erst eine einzige Hyäne erlegt war, holte ich den mitgenommenen Kien vor. An dem nämlichen Morgen war überdies ein Stück Vieh nicht weit hinter unserem Lager gefallen, und cs ließ sich denken, daß sich die Bestien rasch darüber hermachen würden. Der Mond war jetzt ebenfalls im Abnehmen und ging erst etwa um elf Uhr auf - Zeit genug also bis dahin, um einen Versuch zu machen.
Dicht hinter mnserem Lager befand sich ein mit rauhen Granitblöcken von allen Größen wild überstreuter Platz, den /105/ ich passiren mußte, um zu der Stelle zu kommen, wo das gefallene Rind lag. Hier war mir der Wind auch nicht günstig; ich achtete aber nicht darauf, weil ich die Raubthiere alle an jener Stelle glaubte. Mit der Pfanne, in welcher der brennende Kien loderte, auf dem Rücken, einen Sack mit gespaltenem Kien zum Nachlegen umgehängt, die Büchse in der Hand, stieg ich langsam in die Felsen hinein, und „suchte" noch nicht einmal.
Man „sucht" nämlich bei der Fackcljagd dadurch, daß man den Schatten des eigenen Kopfes - der durch die hinten getragene Flamme nach vorn fällt - überall langsam im Kreis umhergleiten läßt, denn nur in diesem Schatten oder unmittelbar daneben leuchten die Lichter des Wildes (der Jagdausdruck „Licht" paßt bei dieser Jagd wirklich vortrefflich). Der Boden war hier auch sehr rauh, und ich hatte genug zu thun, auf den Weg zu sehen, als ich, kaum fünfzig Schritt vom Lager entfernt, zufällig einmal emporschaute und dicht vor mir nicht allein die blitzenden Augen einer Hyäne leuchten sah, sondern sogar die ganze ekle, in der Flamme lichtgelb aussehende Gestalt der Bestie erkannte. Sie stand kaum zehn Schritt vor mir und hatte mich wahrscheinlich schon eine ganze Weile betrachtet.
Ueberrascht fuhr ich mit der Büchse in die Höhe; die Bestie war aber zu nah, um in dieser Entfernung lange auszuhalten. Ehe ich zielen konnte, glitt der helle Körper zwischen die Felsbrocken hinein und eine halbe Minute später vielleicht sah ich etwa auf fünfzig Schritt Entfernung erst die Lichter wieder scheinen.
Hätt' ich mir jetzt Zeit genommen, so mußte ich ihr die Kugel jetzt mitten dazwischen hineinsetzen, so aber war ich zu hitzig geworden, zielte rasch und drückte ab, und mit dem Knall war die Bestie verschwunden. Jedenfalls schoß ich zu hoch. Ich hatte in der That gar nicht darauf gerechnet, zum Schuß zu kommen, und deshalb sogar meine Kugeltasche im Zelt gelassen. Jetzt sprang ich rasch genug zurück, sie zu holen und den abgeschossenen Lauf wieder zu laden, und umging diesmal den steinigen Platz, um mit besserem Wind der Hyäne in den Rücken zu kommen. /106/
Der Platz, wo der gefallene Stier gelegen - denn seit Dunkelwerden hatten ihn die gefräßigen Bestien schon total verzehrt oder zerrissen und in das Dickicht geschleppt - war eine kleine offene Wiese von vielleicht zweihundert Schritt im Durchmesser, und hier begegnete ich zuerst einem der kleinen Schakals, die kaum etwas größer als ein starker Fuchs sind. Er sah mich mit den kleinen brennenden Lichtern einen Moment scharf an, verschwand dann aber im Nu und ließ sich, obgleich ich überall aufmerksam absuchte, nirgends wieder blicken. Er hatte die Flamme außerordentlich übel genommen. Weiter durch die Büsche gehend, traf ich wieder auf die Lichter einer Hyäne, die mich lange und aufmerksam anglotzte. Die Lichter standen aber noch zu nah zusammen, sie war zu weit entfernt, und als ich sie angehen wollte, wich sie furchtsam zurück, verschwand für wenige Minuten und tauchte viel weiter zurück wieder auf. Ich folgte ihr auch dahin, aber sie kreuzte jetzt eine dicht mit Dornbüschen bewachsene Schlucht, und dahin konnte ich ihr nicht mit der Pfanne nachgehen, denn die stachligen Zweige hätten mir die brennenden Kienspähne bei jedem Schritt hinabgeworfen. Ich suchte nachher noch einen großen Theil der Hochebene ab, ob sich nicht vielleicht ein anderes Raubthier in die Nähe der menschlichen Wohnungen gezogen hätte, aber es blieb Alles leer und dunkel, und ich mußte endlich, als mein mitgenommener Kienvorrath verbrannt war, unverrichteter Sache wieder abziehen.
Am nächsten Morgen brachen wir zurück nach Umkullo auf. Ich hatte aber doch jetzt den Beweis bekommen, daß es in Afrika möglich sei, auf Raubthiere mit Feuer auszugehen, und wenn unsere Zeit dort auch nur auf zwei Nächte beschränkt war, wollte ich doch wenigstens einen Versuch machen.
Am ersten Abend war ich zu erschöpft, denn ich hatte den ganzen Tag durch die glühende Samhara gebürscht und kam erst etwa eine Stunde nach Sonnenuntergang mit einem tüchtigen Semaringibock in Umkullo an. Am nächsten Tage bereitete ich aber Alles vor, und da Fürst Hohenlohe der nächtlichen Suche gern einmal beiwohnen wollte, holte ich ihn etwa elf Uhr Nachts ab, wo die Hunde zum ersten Mal an-/107/schlugen, und ich also wußte, daß sich unsere nächtlichen Besucher wieder eingefunden.
Schon als ich mit der Fackel nach den nächsten Gebäuden hinüberging, sah ich die Lichter von zwei Hyänen scheinen, die etwa zweihundert Schritt entfernt sein mochten und die Flamme erstaunt anstarrten. Ich ließ sie aber noch unbelästigt stehen und suchte dann, etwa zehn Minuten später, mit dem Fürsten zusammen und jetzt mit gutem Winde den Platz wieder ab, ohne sie gleich wieder zu finden. Etwas weiter hin trafen wir aber eine andere Hyäne, der wir jetzt mit aller Vorsicht und gutem Wind anzukommen suchten - umsonst. Die Bestie wich scheu vor uns zurück, hielt bis auf etwa hundert Schritt und drehte dann den Kopf ab, um nach einer Weile wieder eine Strecke entfernt auf's Neue herüber zu starren.
Um das Lager herum machten wir jetzt einen halben Bogen und trafen nach kaum einer Viertelstunde wieder eine Hyäne, die uns gerade so behandelte. Sie ließ sich das Licht nicht gefallen, obgleich nichts auf dieser Jagd Nöthiges versäumt und jede Regel befolgt wurde. Allerdings ging der Fürst vor mir her, weil ich mit der Flamme hinter ihm bleiben mußte, damit er die Augen konnte leuchten sehen, und es mag vielleicht sein, daß die Bestien dadurch die Umrisse der von der Flamme erleuchteten Gestalt zu deutlich sahen, aber anderthalb Stunden wanderten wir etwa herum, ohne zum Schuß zu kommen, und gaben die Jagd endlich in Verzweiflung auf.
Ich begleitete den Fürsten mit der Fackel bis zu seiner Wohnung, denn die Nacht war stockdunkel, und kehrte dann nach meinem eigenen Zelt zurück, um mich ebenfalls schlafen zu legen.
Die Entfernung zwischen den beiden Häusergruppen betrug etwa vier- bis fünfhundert Schritt - vielleicht etwas mehr - durch die vollkommen flache, nur mit einzelnen niedrigen Büschen bewachsene Ebene, und gleich dicht an den Häusern traf ich wieder einen der kleinen Schakals, der aber ebenfalls nicht Stand hielt und im Nu verschwand. Ich hatte nur für einen Moment seine Lichter blitzen sehen. Ich /108/ kümmerte mich auch weiter nicht um ihn, sondern legte nur frischen Kien auf, um meinen Weg zurück zu finden, und schritt dann rasch den andern Häusern zu. Noch hunderundfünfzig Schritt mochte ich davon entfernt sein, als ich plötzlich wieder die zwei Paar Lichter vor mir sah, die ich schon früher einmal getroffen.
Ich hatte nun heute Abend nur meine Zündnadelflinte mitgenommen und grobe Hasenschrotpatronen darin, weil ich den Fürsten zum Schuß zu bringen hoffte. Die Patronen halten aber tüchtig zusammen, und ich suchte an die jetzt stehenden Hyänen heran zu kommen. Sowie ich aber die Flinte mit der rechten Hand in die Höhe hob, setzten sich die Thiere wieder in Bewegung, und so dicht war ich jetzt an die eine Hyäne herangekommen, daß ich den lichten Schein ihres Körpers erkannte, wie sie, den Kopf mir zugedreht, etwa fünfzig Schritt fortgaloppirte. Dort blieb sie wieder stehen, die beiden großen Lichter leuchteten wie ein Paar glühende Kohlen, der Wind war ebenfalls günstig; ich hielt rechts von ihr ab, als ob ich mit der Fackel an ihr vorübergehen wollte, die Flinte dabei schon vorn in die Gabel des Brettes gelegt, und als ich mich jetzt, selbst für einen Schrotschuß, nah genug wußte, drückte ich ab.
Fast mit dem Schuß verschwanden die Lichter, aber ich sah für einen Moment den glühenden Schein am Boden, und als ich rasch darauf zuging, lag die Hyäne, ein großes ekles Weibchen, mit blutigem, schäumendem Gebiß verendet am Boden. Sie zuckte wenigstens nicht einmal mehr. Die Augen blitzten mich aber noch so tückisch an, daß ich, um ganz sicher zu sein, ihr auch noch den zweiten Schrotlauf gab und sie dann liegen ließ und zu Bett ging. Die zweite Hyäne war nach dem Schuß verschwunden.
Irgend ein anderes erlegtes Thier wäre nun von diesen Bestien schon vor Tagesanbruch vollständig zerrissen und verzehrt gewesen. Ihr eigenes Geschlecht rühren sie aber nicht an, bis es wirklich in Verwesung übergeht und den ihm eigenthümlichen Geruch verloren hat - dann fressen sie es ebenfalls. Es war eine gefleckte Hyäne gewesen, die in dieser Gegend ausschließlich vorzukommen scheint; alle wenigstens, /109/ die unsere Gesellschaft gesehen oder erlegt hatte, gehörten dieser Gattung an. Am nächsten Morgen kamen aber schon die Aasgeier in Schwärmen herbei, und gleich nach Sonnenaufgang, als sie nur die erste Scheu überwunden hatten, fielen sie darüber her, ihr ekles Mahl zu halten.
Ueber die Farbe der verschiedenen Augen der Thiere bei Feuerlicht möchte ich nur noch ein paar Worte erwähnen. Am schärfsten leuchten natürlich und glühen mit rothem Licht die Augen sämmtlicher Raubthiere, vorzüglich der Katzenarten. Die Lichter der Hyäne strahlten ebenfalls groß und roth, aber schienen nicht so concentrirt. Das amerikanische Rothwild hat einen prächtigen rothen Feuerschein, aber ebenso Pferd und Hund, und wo diese frei draußen herumlaufen, muß man sich in Acht nehmen, sie für ein Wild zu halten. In Nordamerika hat schon mancher Farmer Nachts aus Versehen sein eigenes Füllen erschossen, das er für einen Hirsch hielt. Die Augen des Rindviehs dagegen leuchten mit einem sehr matten, grünlichen Licht, das man nur auf geringe Entfernung sieht. Ebenso ist es mit dem Hasen der Fall. Der Alligator hat Augen, die wie rothglühende Kohlen leuchten; Wiesel und Marder wie helle Johanniskäfer. /110/
Der verlorene Ring.
Erstabdruck: Hausblätter, a.a.O.,4. Bd. Seiten 72-80. 1864
Im August des Jahres 1860, wo ich in Ecuador auf das englische Schiff wartete, das von London aus Einwanderer und Ansiedler bringen sollte, mußte ich notgedrungen der Jagd obliegen, wenn ich überhaupt Fleisch wollte zu essen haben, hätte mich nicht schon meine eigene Neigung dazu getrieben. Die Jagd war freilich in jenen furchtbaren Wäldern weit mehr eine Arbeit, als eine Erholung, und es dabei oft ein Kunststück, die Büchse in den ewigen Regen und nassen Büschen trocken und schußfähig zu erhalten.
So war ich auch am 22. August Morgens mit einem Begleiter, dem Alcalden des kleinen Indianerdorfes aber sonst einem intelligenten und wirklich liebenswürdigen Burschen, aufgebrochen, um den Seyno's oder wilden Schweinen den Krieg anzukündigen. Allerdings gab es deren dort genug, aber der Wald war auch so furchtbar dicht, daß es ungemein schwer hielt, geräuschlos und unbemerkt an sie anzukommen, und zwei- oder dreimal mißglückte es vollständig. - Endlich, etwa um zwei Uhr Nachmittags hörten wir wieder das Geräusch der brechenden Thiere, die aber, wie wir bald ausfanden, von uns fortzogen, und denen wir deshalb folgen mußten.
Bis dahin hatten wir uns in einer sogenannten trocha - einem mit Messerhieben angezeigten Pfad, oder doch wenig-/111/stens in dessen unmittelbarer Nähe gehalten. Jetzt half es nichts weiter, wir mußten mitten in den Wald hinein, und während ich, mit der Büchse im Anschlag, unbesorgt auf den Fährten folgte, denn ich führte ja meinen Compaß bei mir und wußte, daß ich die trocha immer wieder finden könne, - knickte der vorsichtigere Eingeborene, der der kleinen Messingkapsel nicht so recht trauen mochte, hier und da einen Zweig ein, um sich an diesen sehr schwachen Merkmalen im Nothfall wieder zurück zu finden.
Etwa eine halbe Stunde mochten wir den Thieren, fast eben so viel nach dem Geruch wie auf der Fährte gefolgt sein, denn sie tragen eine Stinkdrüse auf dem Rücken, die mit dem Winde weithin ihren Duft verbreitet - als wir ihr Brechen wieder in den Büschen hörten, und ich meinen Begleiter nun zurückließ, um allein an sie anzubürschen. Es liegt indessen nicht in meiner Absicht, hier eine Schweinsjagd genauer zu beschreiben, und ich will nur kurz bemerken, daß ich nach einigen Schwierigkeiten eine junge Bache erlegte und nachher auch noch einen ziemlich starken Keiler hätte erlegen können. In jener feuchten und heißen Zone ist es aber fast unmöglich, frisches Fleisch lange gut zu erhalten, außerdem hatten wir an der Bache gerade genug durch diesen Wald zu tragen, und als ich meine Büchse wieder geladen hatte, zerwirkten wir das Stück Schwarzwild, schulterten jeder unseren Theil und wanderten heimwärts.
Allerdings wollte mein Begleiter jetzt seinen eingeknickten Zweigen zurückfolgen; das würde uns aber zu lange aufgehalten haben, denn wir hatten noch drei gute Stunden zu marschiren, und nach Dunkelwerden ist es unmöglich, durch diese Dickichte und Dornen, Sümpfe und Lagunen zu dringen. Ich schlug daher nach meinem Compaß einen geraden Cours ein, der uns bald, sehr zum Erstaunen meines Begleiters, wieder in die trocha führte, und von dort hatten wir ein verhältnismäßig leichteres Gehen mit unserer Last.
Etwa noch eine halbe Stunde Weges von der Seeküste entfernt, wo das kleine Indianerdorf San Lorenzo lag, das meine jetzige Heimath bildete, trafen wir ein Volk pavas - die ecuadorianischen kleinen Truthühner, die nicht größer als /112/ ein amerikanisches Prairiehuhn sind und auch mit diesen einige Ähnlichkeit haben - in den Bäumen sitzen. Der Abend rückte allerdings schon scharf heran, aber ich warf doch meine Last ab und holte noch einen der Burschen herunter. Die übrigen flogen fort. Jetzt wollte ich wieder laden, aber ein jäher Schreck zuckte mir durch die Glieder, denn ich fand mein Lademaß nicht, und an dem Lademaß war mein Trauring befestigt.
Wohl ist das ein wunderlicher Platz, ihn zu tragen als ich mir aber vor Jahren in Tyrol auf der Gemsjagd den Goldfinger der linken Hand zerschossen hatte und den Ring nicht an die rechte Hand bringen konnte, knüpfte ich ihn damals, um ihn nicht zu verlieren, an die grüne Schnur meines Pulvermaßes und hatte ihn daran die langen Jahre behalten und sorgsam bewahrt. Jetzt war das Lademaß fort und mit ihm der Ring, und ich zweifelte keinen Augenblick, daß ich ihn dort verloren haben mußte, wo ich das Seyno geschossen nnd meine Büchse wieder geladen hatte.
Was nun? - An diesem Abend war es allerdings nicht möglich, an einen Rückweg zu denken; wir mußten tüchtig zumarschiren, um nur noch das nahe Dorf vor einbrechender Nacht zu erreichen, da noch eine wohl kurze, aber sehr böse Sumpfstrecke zu passiren blieb, während wir den Platz, wo ich geschossen, gar nicht mehr hätten finden können; aber ich beschloß am nächsten Morgen in aller Frühe wieder draußen zu sein und, mit Lebensmitteln versorgt, jene Stelle so lange abzusuchen, bis ich das Verlorene wieder finde. Mein Indianer hielt dazu treulich bei mir aus, und kaum dämmerte im Osten der Tag, trotzdem daß es wieder einmal wie mit Kübeln vom Himmel goß, so waren wir schon, ich meine Büchse, er seine Lanze geschultert, auf dem Weg.
Die ersten Stunden schritten wir, um kein Wild uns kümmernd, rasch vorwärts, bis wir die ungefähre Gegend erreichten, wo wir vom Weg aus links, im Dickicht drin, die Scynos zuerst gehört und dann, ihnen nach, abgebogen waren. Es zeigte sich aber gar nicht so leicht, den Platz jetzt genau wieder anzugeben, denn der ganze Wald bestand aus nichts als niederen wellenförmigen Hügeln mit schmalen, von /113/ Negrito bewachsenen Sumpfstellen dazwischen, die einander stets vollkommen gleich sehen. Außerdem hatte gestern keiner von uns Beiden genau, oder auch nur überhaupt darauf geachtet, wo wir abbogen. Ein paar Stellen, die wir für die richtigen hielten, wurden deshalb vergebens abgesucht, um in der Nähe der Trocha eingeknickte Zweige zu finden, und es war schon fast wieder Mittag geworden, als mein Begleiter sich eines Baumes mit gebrochenem Wipfel erinnerte, der ganz in der Nähe von dort gestanden haben sollte. Kaum hundert Schritt weiter entdeckten wir denselben wirklich, und dort begannen auch die ersten Spuren durch einen eingeknickten Busch.
Es war keine leichte Arbeit, jetzt der Bahn zu folgen, denn nur alle zehn bis fünfzehn Schritt trafen wir wieder auf ein ähnliches Zeichen, und oft verloren wir in dem furchtbaren Dickicht diese schwachen Merkmale und mußten weit umhersuchen, ehe wir sie wieder fanden. Einer von uns Beiden ging in dem Fall stets zu dem letztgefundenen Merkmal zurück, um dieses nicht auch zu verlieren, während der Andere weiter suchte und bei glücklichem Fund das Zeichen durch ein lautes „aqui" gab.
So rückten wir allerdings sehr langsam, aber doch vollkommen sicher vorwärts, und nach einer guten Stunde etwa erreichten wir den Platz, wo das erlegte Seyno von uns zerwirkt war. Nur die Blutspuren bezeichneten ihn freilich noch, denn kleine Raubthiere schienen alles Uebriggebliebene schon beseitigt zu haben. Selbst der Kopf war durch eine der dort ziemlich zahlreichen Tigerkatzen eine kurze Strecke fortgeschleppt worden.
Das Seyno aber hatte ich nicht auf der Stelle todt, sondern erst angeschossen gehabt, so daß es noch etwa hundert oder hundertundfünfzig Schritt lief, ehe es zusammenbrach. Dort auf dem Anschuß war ich auch, als ich Schweiß fand, stehen geblieben, um wieder zu laden, und es galt jetzt - wahrlich keine Kleinigkeit, - den Anschuß oder die Stelle, auf der das Wild von der Kugel zuerst getroffen worden, wieder zu finden. An jedem andern Orte der Welt würde das auch der strö-/114/mende Regen, der den ganzen Morgen gefallen war, unmöglich gemacht haben - in diesen dichten Wäldern nicht. Die Wipfel derselben schließen so dicht und massenhaft ineinander, daß kein einziger Regentropfen direct auf die Erde niederschlägt, sondern nur von den Blättern langsam niederträufelt.
Ohne meinen indianischen Begleiter weiß ich freilich nicht, ob ich der fast verwaschenen Spur hätte folgen können; er aber blieb mit ziemlicher Leichtigkeit darauf, bis wir zu einer Stelle kamen, an der ich das Terrain selber erkannte. Dort stand der Baum, hinter dem das Seyno, von dem ganzen Rudel gefolgt, herausbrach - dahinüberzu hatte ich geschossen, und einmal den ungefähren Platz festgestellt, hieb ich rings herum die Büsche ein - und jetzt begann das Suchen.
Meinem Begleiter hatte ich übrigens vier Dollars versprochen, wenn er so glücklich sein sollte, das Lademaß, das ich ihm genau beschrieb und das mit der langen grünen Schnur auch ziemlich auffällig blieb, zu finden. Vier Dollars waren für ihn ein Capital, und wie ein Spürhund suchte er Busch nach Busch durch, drebte jedes Blatt um und entwickelte einen ordentlich rührenden Eifer. Natürlich stand ich nicht müßig dabei, und wir hatten schon den größten Theil jener kleinen Blöße durchsucht, als er plötzlich einen Sprung nach vorn machte und wie ein Geier auf das Gefundene niederstieß. Ein Jubelschrei verkündete mir zugleich den Fund, und ich selber hielt jetzt die viele Mühe, die es uns gekostet, um mitten in einem solchen Urwald einen so kleinen Gegenstand wieder zu finden, für reich belohnt.
Beide sehr zufrieden, kehrten wir, ohne heute weiter zu jagen, nach San Lorenzo zurück und hielten dort ein lukullisches Mahl an Seynofleisch, Reis und Austern und junger Cocosmilch mit Chocolade - lauter Landeserzeugnisse, die aber nur höchst selten gemeinschaftlich zu erhalten waren.
Ich bin nicht abergläubischer als wir Alle miteinander, denn einen kleinen Theil von Aberglauben trägt ein Jeder mit sich herum, aber ich muß gestehen, daß ich mich recht herzlich über das Wiederfinden des Ringes freute und ihn jetzt auch, wie schwer es ging, an die rechte Hand zwang, um ihn nicht wieder zu verlieren. /115/
Giebt es Ahnungen oder Vorbedeutungen, - oder spielt ein tückischer Zufall nur manchmal so boshaft mit unseren Gefühlen und Empfindungen? - Ein Jahr später - genau in der nämlichen Nacht, in der mein Ring allein im Wald von Ecuador gelegen, starb daheim allein - während ich noch meinen mühseligen Ritt durch Brasilien verfolgte, mein braves Weib. Es war die Nacht vom 22. zum 23. August.
Eine Mississippi-Fahrt.
Erstabdruck: Illustr. Familienbuch, 4. Band, Neue Folge, Seiten 35-38. Triest: Oest. Lloyd, 1864
Was für ein wildes Leben die Leute doch in all' jenen noch halb civilisirten Ländern der bekannten Erde führen! Wir hier haben wahrlich keine Idee davon, und halten einen Menschen, der einmal Nachts draußen im Freien hinter einem Heuhaufen schläft, schon gewöhnlich für einen entsetzlichen Strolch, auf den die hochlöbliche Polizei nur um Gottes willen ein wachsames Auge haben müsse. Und wie treiben sich Tausende nachher dort drüben herum, die, als sie auswanderten, von goldenen Bergen und Carrièren träumten, und denen es, in vielen Fällen, auch in der That nicht an der Wiege gesungen wurde, wie und auf welche Art sich sich später einmal durch die Welt schlagen und am Leben erhalten sollten, nur ganz allein eben des Lebens wegen.
Dort drüben stehen Grafen und Barone neben dem Neger vor den Kesseln der Dampfer, mit der Schürstange in der Hand, oder hinter dem Schenktisch, um irgend einem durstigen Gast ein Glas Cognac und Wasser zu mischen, oder hinter der Tadle d'hote - an der sie sonst die Kellner springen ließen - mit der Serviette unter dem Arm; dort drüben klopfen Gelehrte und Ungelehrte Steine an den Chausseen oder hüten Schafe oder Kinder (fand ich doch in Australien selber einen österreichischen Lieutenant als Kindermädchen) - da kehren alle Schichten der Gesellschaft die Straßen, tragen Theaterzettel und Zeitungen aus, schleppen für Reisende Koffer /117/ von der Landung in's Haus, oder Mehl- und Kaffecsäcke, und rollen Fässer mit Schweinefleisch oder Spiritus vor sich her - um kargen Lohn.
Aber wunderbarer Weise schadet es ihnen gar nichts - wenn auch einmal ein oder das andere Muttersöhnchen dabei zu Grunde geht. Sie sind deshalb von der „Gesellschaft", die sich daheim mit Entrüstung von einem solchen Individuum abwenden würde - nicht weniger geachtet, weil sie sich ihr Brod ehrlich verdienen, und haben sie sich etwas verdient, daß sie sich wieder in die Gesellschaft mischen können, dann frägt keine Seele nachher, was sie zu der oder der Zeit getrieben - ob sie selber gedient oder sich einen Diener gehalten haben.
Wunderlich, ganz erstaunlich wunderlich geht es da drüben zu, und wer draußen in der Welt herumfährt und sich eben diese Welt nicht blos durch das Kajütenfenster eines bequemen Dampfers und nachher aus der ersten Etage eines ersten Hotels betrachtet, kann da oft ganz sonderbare Sachen zu sehen bekommen.
Wenn ich so manchmal zurückdenke, welche Leute ich, und in welchen Stellungen und Situationen ich sie getroffen habe, und wie die Familien, deren alten Namen sie tragen, indessen hier in Deutschland spazieren gehen - ich könnte bunte Geschichten davon erzählen. Aber haben Sie keine Furcht, meine Gnädigen, ich bin nicht indiscret, und was ich hier erzählen wollte, ist einfach eine Scene aus meinem eigenen Leben, denn ich habe mich eben so wild zu meiner Zeit dnrch's Leben schlagen müssen, und eben so wenig wie es den Anderen geschadet, hat es mir selber etwas angethan.
Ich war in Cincinnati wieder einmal total ohne Geld, was mir verschiedene Male passirte. Kellner oder Ausschenker mochte ich nicht werden - ich habe immer lieber Holz geschlagen oder auf einem Dampfer gefeuert - das Jagen hatte ich ebenfalls für eine Weile satt zum Ueberdruß, denn die furchtbaren Sumpfpartien von Arkansas lagen mir noch frisch in den Gliedern. Da hörte ich, daß jetzt jenes Rohr, durch das ich mir so manchmal mit triefender Stirne Bahn gehauen, und dessen junge Stengel im Norden zu den kurzen Pfeifen- /118/röhren benutzt und viel gekauft werden, gänzlich fehle, weil der Mississippi seine Ufer überfluthet habe und kein Mensch hinab könne, um es zu schneiden.