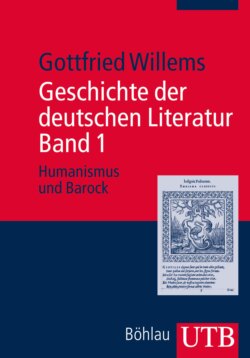Оглавление
Gottfried Willems. Geschichte der deutschen Literatur. Band 1
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Einleitung. 1.1 Die Literatur der frühen Neuzeit im kulturellen Gedächtnis
1.2 Literaturgeschichte als Ort der Begegnung mit dem Fremden
2 Humanismus und Reformation Kultur- und ideengeschichtliche Voraussetzungen der literarischen Entwicklung
2.1 Humanismus und Literatur. 2.1.1 Humanismus und Humanisten
2.1.2 Die Literaturreform von Martin Opitz und die Literatur des Barock
2.2 Reformation und Literatur
2.2.1 Die Spaltung der Christenheit
2.2.2 Christentum und Kunst
2.2.3 Luthers Fabeln und der Literaturbegriff der frühen Neuzeit
2.2.4 Religiöse Vorbehalte gegenüber der Literatur und Restriktionen des literarischen Lebens
2.3 Die Aufwertung von Kunst und Literatur in der frühen Neuzeit. 2.3.1 Das Renaissancebild des 19. Jahrhunderts
2.3.2 Neue Möglichkeiten und alte Grenzen von Kunst und Literatur
2.3.3 Humanistisches Dichterlob: Gedichte auf Opitz
3 Literatur und Ständegesellschaft Sozialgeschichtliche Voraussetzungen der literarischen Entwicklung. 3.1 Ständegesellschaft und sozialer Wandel in der frühen Neuzeit. 3.1.1 Das Bild der Gesellschaft in Zesens „Adriatischer Rosemund“
3.1.2 Das Bild der Gesellschaft in Grimmelshausens „Simplicissimus“
3.1.3 Spuren des Frühkapitalismus im „Pegnesischen Schäfergedicht“ von Harsdörffer und Klaj
3.2 Literatur und höfisches Leben
3.2.1 Die Fürsten- und Hofspiegel des Humanismus und die Nähe von Literatur und Sachbuch
3.2.2 Lohensteins „Cleopatra“ als Fürsten- und Hofspiegel
3.2.3 Kritik am höfischen Leben und Schäferdichtung
4 Humanismus und Popularliteratur
4.1 Dichtung bei Hans Sachs
4.2 Dichtung bei Paul Fleming
4.3 Erasmus als Kritiker der Popularliteratur
4.4 Grimmelshausen als Kritiker der humanistischen Literatur. 4.4.1 Grimmelshausen und sein Roman „Der Abentheurliche Simplicissimus“
4.4.2 Kritik am Humanismus und seiner Literatur
4.4.2.1 Schäferdichtung
4.4.2.2 Liebeslyrik
4.4.2.3 Roman
4.4.2.4 Mythos
5 Literatur als Unterhaltung und Belehrung Das Beispiel des Schwanks. 5.1 Der Literaturbegriff der frühen Neuzeit
5.2 Schwank und Literatur
5.3 Probleme bei der Interpretation von Schwänken
5.4 Schwänke als Unterhaltungsliteratur
5.5 Der Schwank als Mittel der Belehrung
5.6 Unterhaltung und Belehrung in Gryphius’ „Peter Squentz“
6 Erasmus von Rotterdam und sein „Lob der Torheit“ 6.1 Erasmus und die Literatur
6.2 Die „Adagien“ von Erasmus und die Bildlichkeit der frühneuzeitlichen Literatur
6.3 Unterhaltung und Belehrung im „Lob der Torheit“
6.4 Das „Lob der Torheit“ und der Tor der „Narrensatire“
6.5 Das „Lob der Torheit“ und der Weise des Neustoizismus
6.6 Vom „Lob der Torheit“ zur modernen Literatur
Anhang. Siglen
Literaturhinweise. Zur Geschichte der frühen Neuzeit
Zur Sozial- und Kulturgeschichte
Zur Literaturgeschichte
Forschungsbericht
Personenregister
Отрывок из книги
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Böhlau Verlag · Wien · Köln · Weimar
.....
Dabei ging man mit größter Selbstverständlichkeit von zwei Voraussetzungen aus, die sich keineswegs von selbst verstehen, die vielmehr durchaus problematisch sind und einer kritischen Prüfung bedürfen. Zum einen begriff man die nationale Identität als Basis der Identität des Individuums; das Ich sollte nur in eben dem Maße zu sich selbst finden, mit sich ins reine kommen können, in dem es sich seines deutschen Charakters bewußt wurde und den „deutschen Volksgeist“, die „deutsche Volksseele“ an sich selbst kultivierte. Und zum anderen verstand man Identität als eine statische Größe; das „deutsche Wesen“ sollte sich dank des immer gleichen deutschen „Bluts und Bodens“ zu allen Zeiten gleich geblieben sein.
Und so suchte man denn in allen Phasen der Literaturgeschichte, selbst in den ältesten Zeiten, selbst in der altgermanischen Sagenwelt und im Umfeld des ersten namhaften Germanenfürsten Hermann des Cheruskers – jenes Arminius, der den Römern 9 n. Chr. die Schlacht im Teutoburger Wald geliefert haben soll – die Spuren dieses unwandelbaren „deutschen Wesens“. Man kann sich aus heutiger Sicht nur darüber wundern, wie genau man seinerzeit zu wissen meinte, was „deutsche Eigenart“ sei; so war man sich etwa dessen sicher, daß Treue, Biederkeit, Frömmigkeit und Tiefsinn typisch deutsche Werte seien. In sämtlichen bedeutenden Werken der deutschen Literatur sollte sich derlei bald mehr und bald weniger deutlich gezeigt haben, am deutlichsten aber in denen der beiden „Blütezeiten“, der „mittelhochdeutschen“ und der „Weimarer Klassik“. Da sollte alles, was die Identität der Deutschen phasenweise hatte überlagern und niederhalten können, entweder völlig abgeschüttelt oder restlos in „deutsche Eigenart“ verwandelt worden sein.
.....