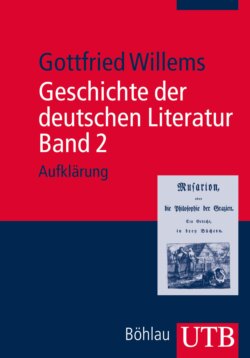Оглавление
Gottfried Willems. Geschichte der deutschen Literatur. Band 2
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung. 1.1 Das Studium des 18. Jahrhunderts als Zugang zur Moderne
1.2 Modernisierung im 18. Jahrhundert: Aufklärung
1.3 Literatur im 18. Jahrhundert
2 Eine Reise zu Voltaire und Rousseau Kulturgeschichtliche Voraussetzungen der literarischen Entwicklung. 2.1 James Boswell und seine „Grand Tour“
2.1.1 Reisebeschreibung, Tagebuch, Brief und Konversation als Quellen der Kulturgeschichte
2.1.2 James Boswell als Autor der Aufklärung
2.1.3 Literatur und Individualisierung
2.1.4 Aufklärung im Alltag
2.2 Voltaire, Rousseau und die Entwicklung der Literatur im 18. Jahrhundert
2.2.1 Voltaire und der Weg zur Autonomie der Literatur
2.2.2 Rousseau und der neue Subjektivismus der Literatur
2.2.3 Literatur im Alltag
2.3 Boswell bei Rousseau und Voltaire. 2.3.1 Boswell bei Rousseau
2.3.2 Boswell bei Voltaire
2.3.3 Boswells Gespräche mit Rousseau und Voltaire
3 Zentrale Impulse der Aufklärung Ideengeschichtliche Voraussetzungen der literarischen Entwicklung. 3.1 Popes „Essay on Man“ und Voltaires „Philosophische Briefe“
3.1.1 Ein Profil der frühen Aufklärung: Alexander Pope
3.1.2 Themen und Formen des Aufklärungsdiskurses
3.1.3 Die Literatur zwischen Philosophie und Dichtung
3.1.4 Selbstbescheidung der Vernunft
3.1.5 Die Auseinandersetzung mit Humanismusund Konfessionalismus
3.1.6 Skeptischer Pragmatismus
3.2 Der „Philosoph auf dem Thron“: Friedrich II. von Preußen
3.3 Natur und Gesellschaft. 3.3.1 „Naturzustand“ und „bürgerliche Gesellschaft“ bei Rousseau
3.3.2 „Naturzustand“ und „Goldenes Alter“
3.3.3 Das „Goldene Alter“ bei Voltaire und bei Goethe
4 Aufklärung in der deutschen Literatur Lessings „Nathan“ und Wielands „Musarion“ 4.1 Lessing und Wieland als Aufklärer
4.2 Lessings „Nathan der Weise“ 4.2.1 Die Ring-Parabel
4.2.2 Sympathie, Religion, Vernunft und Dichtung
4.2.3 Die Literatur der Aufklärung – eine Tugendpredigt?
4.3 Wielands „Musarion“ 4.3.1 Die Eingangsszene
4.3.2 Zur Form der „Musarion“
4.3.3 Die Antike in der Literatur der Aufklärung
4.3.4 Humanistisches Bildungsgut bei Wieland
4.3.5 Zur Handlung der „Musarion“
4.3.6 Skeptischer Pragmatismus
4.3.7 Ironie und Psychologie
4.3.8 Menschlichkeit
5 Zur Entwicklung der Literatur im 18. Jahrhundert
5.1 Wandlungen im System der literarischen Gattungen
5.2 Annäherung von Tragödie und Komödie im „bürgerlichen Trauerspiel“ und im „rührenden Lustspiel“
5.3 Jenseits der Gattungsgrenzen: die Libretti da Pontes für Mozart
5.4 Das Beispiel „Così fan tutte“
Anhang. Siglen
Literaturhinweise. Zur Geschichte des 18. Jahrhunderts
Zur Sozial- und Kulturgeschichte
Zur Ideengeschichte
Zur Begriffsgeschichte von „Aufklärung“
Zur Literaturgeschichte
Forschungsberichte
Personenregister
Отрывок из книги
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Böhlau Verlag · Wien · Köln · Weimar
.....
Dagegen machen die Aufklärer Front, so sehr sie selbst als Intellektuelle auch mit Büchern leben, selbst immerzu mit Lesen und Schreiben beschäftigt sind. Was die Aufklärer des 18. Jahrhunderts von den christlichen Theologen und den Humanisten des 16. und 17. Jahrhunderts vor allem trennt, ist ihre Absage an Buchgelehrsamkeit und Schriftgläubigkeit. Bücher sind für sie nur Hilfsmittel; worauf es ihnen vor allem ankommt, ist das, was im wirklichen Leben geschieht, oder, wie sie selbst lieber sagen, was in der „lebendigen Natur“ vor sich geht, was „natürlich“ ist. In dem berühmtesten Werk von Lessing, dem „dramatischen Gedicht“ „Nathan der Weise“, von dem hier noch ausführlich die Rede sein soll, heißt es einmal von Nathan, daß er „die kalte Buchgelehrsamkeit“ nicht liebe, „die sich mit toten Zeichen ins Gehirn nur drückt“ (LN V, 382 –385); das ist typisch. Demgemäß suchen die Aufklärer Gott weniger in der Bibel als in der „lebendigen Natur“ und suchen sie Wissenschaft und Kunst weniger in den Schriften der Alten als in eben dieser Natur.
Die Kritik an der Buchgelehrsamkeit und am Buchgelehrten ist gerade für die Literatur ein dankbares Feld gewesen. Es gibt kaum ein Werk von Bedeutung im 18. Jahrhundert, das nicht an irgendeiner Stelle zur Gelehrtensatire wird und sich über die Verstiegenheit
.....