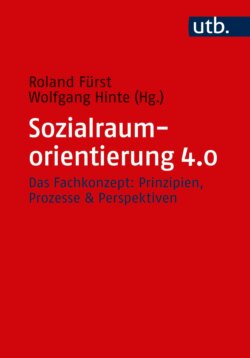Оглавление
Группа авторов. Sozialraumorientierung 4.0
Roland Fürst/Wolfgang Hinte (Hg.) Sozialraumorientierung 4.0. Das Fachkonzept: Prinzipien, Prozesse & Perspektiven
Inhalt
Einleitung
Wolfgang Hinte. 1.Original oder Karaoke – was kennzeichnet das Fachkonzept Sozialraumorientierung?
1.„Sozialraumorientierung umsetzen?“
2.Bewährte Strukturelemente
3.Zur Gestaltung von Reformprozessen
Literatur
Fußnoten
2.Die fünf Prinzipien: Grundlagen, Vertiefungen und Praxisbeispiele. Manfred Tauchner „Ja, dürfen’s denn das?“ – Die Welt als normierter Wille und sozialräumliches Vorstellungsvermögen
1.Kritik der Kritik aus dem Elfenbeinturm
2.Historischer Exkurs: Bürokratischer Paternalismus und der Versuch einer Normierung des Willens
3.Sozialraumorientierung versus Status quo – wes Brot ich ess‘, des Lied ich sing
4.Fiat voluntas tua – Dein Wille geschehe?
5.Mangelware sozialräumliches Vorstellungsvermögen?
6.Sozialraumorientierung braucht, aber ist nicht Sozialmonitoring – „Fiant statisticae et pereat mundus!“
Conclusio
Literatur
Fußnoten
Bernhard Demmel. Die Orientierung am Willen in der Praxis – einfach, aber nicht leicht
1.Willensorientierung zwischen Theorie und Praxis
2.Stolpersteine bei der Willenserkundung
3.Anforderungen an die Fachkräfte
4.Schluss
Literatur
Fußnoten
Frank Dieckbreder/Sarah Dieckbreder-Vedder „Uns wird der Arsch nicht mehr hinterhergetragen.“ – Behinderte Menschen und die Umsetzung des BTHG1 in Deutschland. 1.Verortung des zweiten Prinzips in den fünf Prinzipien
2.Das zweite Prinzip: Eine semantische Tiefenbohrung
2.1.„Aktivierende Arbeit hat grundsätzlich Vorrang vor betreuender Tätigkeit“
2.2.„Arbeite nie härter als Dein Klient“
2.3.„Aktivierende Arbeit hat grundsätzlich Vorrang vor betreuender Tätigkeit: ‚Arbeite nie härter als Dein Klient‘“
3.Das deutsche Bundesteilhabegesetz (BTHG) als Anlass zur Anwendung des zweiten Prinzips. 3.1.Zu Kontext und Inhalt des BTHG
3.2.Sozialräumliche Erzählung zum BTHG am Beispiel Ludwig-Steil-Hof
Literatur
Fußnoten
Andrea Stonis/Thomas Steinberg/Karen Haubenreisser. Personelle und sozialräumliche Ressourcen kreativ verbinden. 1.Neue Wege in der Hamburger Eingliederungshilfe
2.Es wird flexibler: Hamburger Rahmenvereinbarung ermöglicht Innovation
3.Qplus: Ansatz und Ziele
4.Es wirkt doppelt: Wie verändert sich die Teilhabe durch Qplus?
Literatur
Fußnoten
Michael Noack. Diverse Gruppen im Quartier
1.Quartiermanagement zur integrierten Stadt(teil)entwicklung: Wer managt was?
2.Differenz und Person: Wer nimmt wen, warum und wie wahr?
3.Gemeinwesenarbeit: Wie lassen sich soziale Kontexte im Wohnquartier erkunden?
4.Stadtteilmoderation und ämterübergreifende Zusammenarbeit: Wie kann zwischen Quartier und Verwaltung vermittelt werden?
5.Resümee
Literatur
Fußnoten
Wolfgang Hinte/Roland Fürst. Die Dominanz des ökonomischen Systems verhindert Solidarität – Finanzierungsparadigmen als Hürde für Kooperation
1.Wie könnte der Umbau gelingen?
2.Fallunabhängige Finanzierungsformen im Kontext der Sozialraumorientierung wirken
3.Fazit
Literatur
Fußnoten
3.Prozesse und Projekte. Hanne Stiefvater/Karen Haubenreisser/Armin Oertel. Von der Sonderwelt ins Quartier – Organisations- und Konzeptentwicklung (in) der Evangelischen Stiftung Alsterdorf
1.Sozialraumorientierung bei der ESA: der konzeptionelle Unterbau
2.Sozialraumorientierte Praxis in der ESA
3.Zwischenstand: Wie sehen wir die Entwicklung bis hierher?
Literatur
Fußnoten
Ingrid Krammer/Michael Terler. Weniger ist mehr: Innovation durch Kooperation in der Grazer Kinder- und Jugendhilfe. 1.Einleitung
2.Innovation als wichtiger Zukunftsfaktor
3.Der Faktor „Wettbewerb“ als Innovationsförderer
4.Sozialinnovationen – die Grenzen des Wettbewerbs
5.Die Ursprünge der Sozialraumorientierung in Graz
6.Der Paradigmenwechsel als Basis für soziale Innovationen
7.Kooperation als wesentlicher Erfolgsfaktor in Graz
8.Sozialraumorientierung – eine soziale Innovation
Literatur
Christa Quick/Matthias Kormann. Professionelle Gestaltung von flexiblen Unterstützungsprozessen am Beispiel Familien Support Bern West
1.Vom Kinderheim zur flexiblen Dienstleistungsorganisation. 1.1.Wie alles begann…
1.2.…und wie es heute aussieht
2.Die Gestaltung von Unterstützungsprozessen. 2.1.Die Systematik der Leistungserbringung
2.2.Zur Umsetzung. 2.2.1.Intake
2.2.2.Prozessgestaltung
3.Die Prozessgestaltung in der Praxis
4.Fazit
Fußnoten
Walerich Berger. Sozialraumorientierung: Ein Paradigmenwechsel für Unternehmen, Mitarbeitende und Menschen mit Behinderungen
Thomas Wittmann. Sozialraumorientierte Jugendhilfe in der Stadt Rosenheim: Ein Finanzierungsmodell zur Unterstützung sozialarbeiterischer Fachlichkeit
1.Die Monetarisierung der Hilfen zur Erziehung und ihre Nebenwirkung
2.Vorgehen und Struktur in der sozialraumorientierten Jugendhilfe der Stadt Rosenheim
3.Grundsätze des Finanzierungsmodells
4.Der Etat: Prozess und Details
Literatur
André Chavanne. Zwischen Abgabemustern und Elternaktivierung: Von der Notwendigkeit Grenzen neu zu denken
1.Kurzporträt Schoio AG
2.Zwei Beispiele
3.Die fünf Elemente von Wolfgang Hinte
4.Herangehensweisen mit Familien
5.Fazit
Margrit Lienhart/Alexander Kobel. Passgenaue Massnahmen im Rahmen sozialräumlicher Kooperationen von Sozialdiensten und Leistungserbringern im Kanton Bern. 1.Einleitung
2.Pilotprojekt „Flexible Jugend- und Familienhilfe im Sozialraum Bern Ost“ 2.1.Am Anfang war das Feuer: Wo ein Wille ist…
2.2.Schulung der Beteiligten
2.3.Commitment!
2.4.Arbeiten im Sozialraumteam: üben, üben, üben – von Tücken und Freuden
2.5.Zwischenevaluation – erste Tendenzen
3.SORA für Familien – vom stationären Träger zum flexiblen Dienstleistungserbringer
3.1.Fachliches Selbstverständnis der Mitarbeitenden
3.2.Form follows Function
Literatur
Fußnoten
Hannes Schindler/Bettina Oschgan/Elisabeth Pilch/Matthias Liebenwein/Martin Baumann. Ein Unternehmen integriert Sozialraumorientierung
1.1.Vom Zugeständnis, ein Fachkonzept in einer Institution zu verankern, hin zu einer strategischen Neuorientierung
1.2.Geschäftsfeld Quartiersentwicklung und Sozialraumorientierung
1.3.Konzeptionelle und strategische Entwicklung der Sozialraumorientierung in der Diakonie de La Tour
2.1.Quartiersentwicklung Viktring – ein Stadtteil mit vielen Ressourcen
2.2.Sozialraumkoordination Viktring: in drei Schritten zur erfolgreichen Umsetzung
2.3.Finanzierungsdilemma
3.„Volle Erziehung“ sozialraumorientiert umgesetzt – ein Fallverlauf aus zwei Perspektiven erzählt. 3.1.Irgendwo in Österreich – „Dominik“: Variante 1
3.2.Arbeitsgemeinschaft 4Raum – Graz – „Dominik“: Variante 2
3.3.Conclusio
4.Möglichkeiten, Spannungsfelder und kritischer Ausblick
Literatur
Birgit Stephan. Sozialraumorientierung in der Freien und Hansestadt Hamburg – dargestellt am Jugendamt Wandsbek
1.Auf ministerieller Ebene
2.Sozialraumorientierung in den Bezirken
2.1.Spezielle „Sozialraumprojekte“ in den Bezirken
2.2.SRO-Umsetzung organisieren – das Beispiel Wandsbek
A.Inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Fachkonzept Sozialraumorientierung
B.Definition der notwendigen Veränderungen
C.Handlungsplan erstellen
D.Umsetzung der geplanten Schritte
4.Rollen und Aufgaben im Veränderungsprozess
5.Gelingensfaktoren und Umgang mit Stolpersteinen im Prozess
6.Ängste und Befürchtungen
7.Vertrauen schaffen durch Transparenz und Authentizität
8.Veränderung als Chance
Literatur
Fußnoten
4.Forschungsbefunde und Perspektiven. Michael Noack. „Gibt es dazu auch Forschungsergebnisse?“ – Zur Empirie der „Big Five“
1.Ausgangspunkt jeglicher Arbeit sind der Wille/die Interessen der leistungsberechtigten Menschen
2.Aktivierende Arbeit hat grundsätzlich Vorrang vor betreuender Tätigkeit
3.Bei der Gestaltung der Hilfe spielen personale und sozialräumliche Ressourcen eine wesentliche Rolle
4.Aktivitäten sind immer zielgruppen- und bereichsübergreifend angelegt
5.Vernetzung und Integration der verschiedenen sozialen Dienste sind Grundlage für funktionierende Einzelfallhilfe
6.Fazit
Literatur
Fußnoten
Roland Fürst. Professionelles Schreiben und Dokumentieren als Grundlage fachlicher sozialräumlicher Sozialer Arbeit
1.Schreiben als methodisches Handwerkszeug für Sozialarbeitende
1.1.Die größten Schwächen
1.2.Auch die Klärung des Kontextes ist wichtig
2.Exkurs: Reflektierte Perzeption und der Konstruktivismus
3.Der Wille als möglicher Ausgangspunkt für mehr Fachlichkeit bei Dokumentation und Berichten
Literatur
Fußnoten
Stefan Bestmann. Auf dem Weg zu einer Theorie Sozialer Arbeit? Baustellen, Entwicklungsnotwendigkeiten und Perspektiven. 1.Hinführung
2.Wieso, weshalb, wozu?
3.Entwicklungsnotwendigkeiten im bestehenden konzeptionellen Rahmen
4.Entwicklungsnotwendigkeiten in den konkreten Umsetzungen
5.Ausblick
Literatur
Autoreninformationen