Abwägen und Anwenden
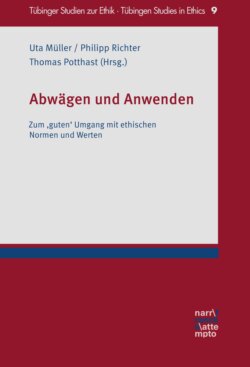
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Группа авторов. Abwägen und Anwenden
Inhalt
Einleitung
Literatur
I. Konzepte und Methodologien. Abwägen als Moment klugen Handelns
Literatur
Die Unhintergehbarkeit der Reflexion in der anwendungsbezogenen Ethik – eine Positionsbestimmung in klugheitsethisch-topischer Perspektive
1. Reflexivität und Ergebnisoffenheit – das Problem abschließender Antworten
2. Der Topos vom „ungelösten Theorienpluralismus in der normativen Ethik“ – das Problem einer Ethik vor der Ethik
3. „Bereichsspezifische Moral- und Ethikgeschichten“ – Probleme der Bereichsethik-Konzeption
4. „Das Allgemeine und das Besondere“ – Probleme einer Modellierung des angewandten ethischen Urteils (nach Hegel)
5. Anwendung als „Urteilskraft + X“? Das Problem normativer Ansprüche
6. Perspektive eines Ausweges? Nicht „Anwenden“, sondern klugheitsethisch-topisch Argumentieren
Literatur
Das Problem der epistemisch-evaluativen Abwägung bei Entscheidungen unter Unsicherheit
1. Einleitung
2. Teleologische und deontologische Prinzipien
3. Situationen unter Unsicherheit
4. Deontologische Prinzipien für Entscheidungen unter Unsicherheit
4.1. Prinzipien für Entscheidungen unter Ungewissheit
4.2. Prinzipien für Entscheidungen unter Risiko
5. Teleologische Prinzipien für Entscheidungen unter Unsicherheit
5.1. Prinzipien für Entscheidungen unter Risiko
5.2. Prinzipien für Entscheidungen unter Ungewissheit
6. Fazit und Forschungsperspektiven
Literatur
Zur Rolle von Vorstellungen des Guten in der Angewandten Ethik – der gesellschaftliche Diskurs um biologische Altersforschung als Beispiel
Einleitung
Fallbeispiel: Das Altern abschaffen?
„Für immer jung?“ – ein Beispiel für die Thematisierung von Biogerontologie in den Medien
Angewandte Ethik als Mahnerin und Bremserin?
Vorstellungen des Guten in der Ethik
Altern als integraler Bestandteil eines ganzen menschlichen Lebens
Individuelle und gesellschaftliche Vorstellungen des Guten
Fazit
Literatur
II. Ethik, Recht, Medizin „Wenig, weniger, zu wenig“: Minimalstandards als ‚Abkürzung‘ im Abwägungsprozess
1. Ansatzpunkte einer allgemeinen Typologie normativer Minimalstandards
2. Schwellenwerte des Existenzminimums: „absolut“, „relativ“ – oder beides?
Der Capability Approach: „functionings“, „capabilities“ und „freedom“
Fähigkeiten und Schwellenwerte eines menschenwürdigen Lebens nach Martha C. Nussbaum
3. Ausblick
Literatur
Anwendung und Abwägung bei der Bestimmung des maßgeblichen Rechts
I. Besonderheiten der Abwägung und im Internationalen Privatrecht
II. Die grundsätzliche Bestimmung des maßgeblichen Rechts
1. Die Prinzipienabwägung als Grundsatz des Internationalen Privatrechts
2. Die hilfsweise Anknüpfung an die engste Verbindung
III. Die Ausweichklausel als Ausnahme
IV. Nichtanwendung des fremden Rechts
1. Leihmutterschaft
a) Die Zuordnung des Kindes zu den Wunscheltern als ordre public-Verstoß?
aa) Die Prüfung des ordre public als Prüfung eines Prinzipienkonflikts
bb) Die besondere Bedeutung einer ethischen Grundentscheidung des Gesetzgebers
2. Kinderehen
V. Zusammenfassung
Literatur
Wie Explikation ethische Abwägungsprozesse beeinflusst: Moralpsychologische Forschungsfragen
Ethisches Abwägen in der beruflichen Praxis
Prinzipienethik
Ethische Explikation
Psychologische Befunde
Forschungsfragen
Pragmatische Implikationen
Literatur
III. Bildung und Ausbildung. Zur Abwägung befähigen: Kompetenzorientierte Vermittlung ethischer Werte und Normen in der Weiterbildung
Einleitung
Was ist ethische Kompetenz?
Was zeichnet kompetenzorientierte Weiterbildungen aus?
Wie lässt sich ethische Kompetenz vermitteln?
Perspektiven für die Weiterbildung
Fazit
Literatur
Die Rolle ethischer Abwägung in der Sozialen Arbeit: Überlegungen zur beruflichen Weiterbildung in sozialen Organisationen
1. Einleitung
2. Vorüberlegungen zu ethischen Abwägungsprozessen. 2.1. Formulieren und Inbezugsetzen von Gegenstand, Kriterium und Ziel
2.2. Identifikation und Gewichtung normativer Geltungsansprüche
3. Strukturmerkmale, Spannungsfelder und Herausforderungen in der Sozialen Arbeit
3.1 Primat der Parteilichkeit, Alltagsorientierung und asymmetrische Beziehungen
3.2. Professionelle Distanz und Grundhaltung
3.3. Pädagogisches Paradox
3.4. Situative Offenheit vs. Ökonomisierungsdruck
4. Ausblick: Der Beitrag wissenschaftlicher Weiterbildung
Literatur
Moralische Kompetenz und Medizinethikausbildung im Medizinstudium
Ziele und Realität medizinethischer Ausbildung
Begründung und Rechtfertigung in der Ethik
Potenzielle Auswirkungen von unterschiedlichen Rechtfertigungsstrategien und Formen des Schlussfolgerns auf Ergebnisse des Medizinethikunterrichts
Fazit
Literatur
Kurzbiographien der Autoren und Autorinnen
Fußnoten. Einleitung
Abwägen als Moment klugen Handelns
Die Unhintergehbarkeit der Reflexion in der anwendungsbezogenen Ethik – eine Positionsbestimmung in klugheitsethisch-topischer Perspektive
1. Reflexivität und Ergebnisoffenheit – das Problem abschließender Antworten
2. Der Topos vom „ungelösten Theorienpluralismus in der normativen Ethik“ – das Problem einer Ethik vor der Ethik
3. „Bereichsspezifische Moral- und Ethikgeschichten“ – Probleme der Bereichsethik-Konzeption
4. „Das Allgemeine und das Besondere“ – Probleme einer Modellierung des angewandten ethischen Urteils (nach Hegel)
1. Einleitung
2. Teleologische und deontologische Prinzipien
3. Situationen unter Unsicherheit
4.1. Prinzipien für Entscheidungen unter Ungewissheit
5.1. Prinzipien für Entscheidungen unter Risiko
5.2. Prinzipien für Entscheidungen unter Ungewissheit
6. Fazit und Forschungsperspektiven
Fallbeispiel: Das Altern abschaffen?
„Für immer jung?“ – ein Beispiel für die Thematisierung von Biogerontologie in den Medien
Angewandte Ethik als Mahnerin und Bremserin?
Vorstellungen des Guten in der Ethik
Altern als integraler Bestandteil eines ganzen menschlichen Lebens
Individuelle und gesellschaftliche Vorstellungen des Guten
Fazit
2. Schwellenwerte des Existenzminimums: „absolut“, „relativ“ – oder beides?
Der Capability Approach: „functionings“, „capabilities“ und „freedom“
Fähigkeiten und Schwellenwerte eines menschenwürdigen Lebens nach Martha C. Nussbaum
I. Besonderheiten der Abwägung und im Internationalen Privatrecht
1. Die Prinzipienabwägung als Grundsatz des Internationalen Privatrechts
2. Die hilfsweise Anknüpfung an die engste Verbindung
III. Die Ausweichklausel als Ausnahme
IV. Nichtanwendung des fremden Rechts
1. Leihmutterschaft
bb) Die besondere Bedeutung einer ethischen Grundentscheidung des Gesetzgebers
2. Kinderehen
Ethisches Abwägen in der beruflichen Praxis
Psychologische Befunde
Forschungsfragen
1. Einleitung
2.1. Formulieren und Inbezugsetzen von Gegenstand, Kriterium und Ziel
2.2. Identifikation und Gewichtung normativer Geltungsansprüche
3. Strukturmerkmale, Spannungsfelder und Herausforderungen in der Sozialen Arbeit
3.1 Primat der Parteilichkeit, Alltagsorientierung und asymmetrische Beziehungen
3.2. Professionelle Distanz und Grundhaltung
3.3. Pädagogisches Paradox
3.4. Situative Offenheit vs. Ökonomisierungsdruck
4. Ausblick: Der Beitrag wissenschaftlicher Weiterbildung
Moralische Kompetenz und Medizinethikausbildung im Medizinstudium
Ziele und Realität medizinethischer Ausbildung
Begründung und Rechtfertigung in der Ethik
Отрывок из книги
Uta Müller / Philipp Richter / Thomas Potthast
Abwägen und Anwenden
.....
Werner, Micha H. (2004). Kants pflichtenethischer Rigorismus und die Diskursethik. Eine maximenethische Deutung des Anwendungsproblems. In: Gottschalk-Mazouz, Niels (Hrsg.). Perspektiven der Diskursethik. Würzburg: Königshausen & Neumann, 81-110.
Wieland, Wolfgang (1989). Aporien der praktischen Vernunft. Frankfurt a. M.: Klostermann.
.....