Wortbildung im Deutschen
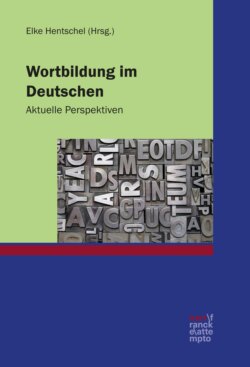
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Группа авторов. Wortbildung im Deutschen
Inhalt
Zu diesem Band
Zwischen Verbalparadigma und WortbildungWortbildung
1 Fragestellung und Vorgehen
2 Infinitivkonversionen: Beobachtungen
3 Analyse der Belege
4 Infinite Verbalformen im DeutschenDeutsch
5 SprachvergleichSprachvergleich: KonverbenKonverb
6 Abschließende Bemerkungen
Abkürzungsverzeichnis
Literatur
Quellen für Sprachbelege: Monographien
Quellen für Sprachbelege: Internetquellen
Der Einfluss von SprachkontaktSprachkontakt und SilbenstrukturSilbenstruktur auf die WortbildungWortbildung
1 Einleitung
2 Neue Suffixe durch EntlehnungEntlehnung
3 EntlehnungEntlehnung von WortbildungsmusternEntlehnung von Wortbildungsmustern
4 Neue Suffixe durch Einfluss auf der Ebene der SilbenstrukturSilbenstruktur
Literatur
AQ + IS
1 Einleitung: Vorhaben und Vorgehen
2 AkronymeAkronym und Kurzwortforschung
3 Die Referenzialisierungen terroristischer Gruppen in deutschsprachigen Medien
4 Kleiner Exkurs zum sogenannten Islamischen Staat (IS)
5 Einige Hypothesen zu Organisationsakronymen
Literatur
Ist die NominalisierungNominalisierung von PartikelverbenPartikelverb im DeutschenDeutsch Argument für deren lexikalische Bildung?
1 Einführung
2 VerbpartikelnVerbpartikel im DeutschenDeutsch. 2.1 Das Problem der Kategorisierung
2.2 Kopfpositionen im Verbalkomplex
2.3 VerbpartikelnVerbpartikel als Wortglieder?
3 NominalisierungNominalisierung als Beweis für die lexikalische Bildung von PartikelverbenPartikelverb? 3.1 NominalisierungNominalisierung von komm- und ihre Eigenschaften
3.2 NominalisierungNominalisierung vs. Nominalkomposition
4 Schluss: Wie werden also PartikelverbenPartikelverb nominalisiert?
Literatur
WissensvermittlungWissensvermittlung durch Substantivkomposita im frühmittelalterlichen Kloster
1 Einleitung
2 Materialgrundlage und Untersuchungsgegenstand. 2.1 Das Korpus: Notkers althochdeutsches Übersetzungswerk
2.2 Untersuchungsgegenstand: Substantivkomposita
3 Theoretischer Rahmen: Kulturanalyse
3.1 Was ist Kultur? – Begriffsbestimmung
3.2 Kulturtansfer und Rekontextualisierung
4 Beispielanalysen
4.1 Metaphorische Substantivkomposita zur Bezeichnung theologischer Konzepte
4.2 Übersetzung lateinischer Fachbegriffe mit Substantivkomposita
5 Zusammenfassung
Literatur. Primärliteratur
Sekundärliteratur
WortbildungWortbildung und SyntaxSyntax von AbstraktaAbstraktum bei Friedrich Schiller1
1 Einführung
2 Statistische Angaben zu ung-AbstraktumAbstraktum vs.substantiviertemSubstantivierung InfinitivInfinitiv
3 Konkurrenz von ung-AbstraktumAbstraktum undsubstantiviertemSubstantivierung InfinitivInfinitiv
4 KompositaKompositum mit ung-AbstraktumAbstraktum undsubstantiviertemSubstantivierung InfinitivInfinitiv im Vorderglied
5 Der morphologische Wandel
6 Fazit
Literatur
Toponymische KompositaKompositum in einem schweizerdeutschen Dialekt: vom nichttoponymischen Sprachgebrauch abweichende Wortakzentverhältnisse
1 Vorbemerkung
2 Zur Fragestellung
3 KompositaKompositum
4 Untersuchungsmaterial
5 Erste Auswertung
5.1 Erster Erklärungsansatz: Personnennamen im Erstglied
5.2 Zweiter Erklärungsansatz: rechts erweiterte/postdeterminierte Namen
5.3 Dritter Erklärungsansatz: Übertragung der Finalbetonung auf typisch toponymische Appellative/TopofixeTopofix
5.4 Vierter Erklärungsansatz: Finalbetonung als verallgemeinerter Marker der ToponymizitätToponymizität?
5.5 Zur regionalen Ausbreitung
6 Fazit
Literatur
Neue Wörter als Grundlage für hessische FlurnamenFlurname?
1 Einleitung und Hintergrund der Abhandlung
2 Konzeptionelle außersprachliche und sprachliche Grundlagen
3 Ergebnis1
4 Auswertende Zusammenfassung
5 Abschließende Kritik
Literatur
Anhang: hier behandelte Flurnamen, deren Dorfzugehörigkeiten, Typisierungen, mündliche Nennungsfrequenzen und Sachbezeichnungen
Von Blätterchen und Bäumchen: Die Entwicklung der PluralPlural-DiminutiveDiminutiv und Diminutiv Plurale im DeutschenDeutsch und LuxemburgischenLuxemburgisch1
1 Einleitung und Zielsetzung
2 Der PluralPlural-DiminutivDiminutiv in den Varietäten
2.1 DeutschDeutsch
2.1.1 Entstehung, Ausbreitung und Rückgang der PluralPlural-DiminutiveDiminutiv
2.1.2 Der heutige Stand
2.2 MoselfränkischeMoselfränkisch Dialekte
2.3 LuxemburgischLuxemburgisch
3 Rückgang im DeutschenDeutsch und MoselfränkischenMoselfränkisch – Erfolgsmodell im LuxemburgischenLuxemburgisch
4 Synchrone Interpretation der PluralPlural-DiminutiveDiminutiv
5 Fazit
Literatur
Von Gäul-s-bauer, April-s-narr und Getreid-s-gabel. Die Verwendung und Verbreitung des Fugen-s im OstfränkischenOstfränkisch1
1 Einführendes
2 Die KompositionsstammformKompositionsstammform
3 Systematik der FugenelementeFugenelement des DeutschenDeutsch
4 Zur Funktionalität der FugenelementeFugenelement – Überblick über den aktuellen Forschungsstand
4.1 FugenelementeFugenelement als Kasus- und Numerusmarker
4.2 Phonetisch-phonologische Funktionsweisen der FugenelementeFugenelement
4.3 Morphologisch-funktionale Aspekte des Fugen-s
5 Korpusanalyse: Zur Datengrundlage und Methodik
6 Untersuchungsergebnisse
6.1 Das Fugen-s nach SimpliziaSimplizia
6.2 Verfugung und Kontraktion
6.3 Fugen-s nach derivationsmorphologisch komplexen Erstgliedern
7 Zusammenfassende Darstellung des Analyseergebnisses und Ausblick
Literatur
Reduplikationen im Thailändischen und ihre Entsprechungen im Deutschen
1 Einleitung
2 Reduplikation im Deutschen und im Thailändischen. 2.1 Reduplikation im Deutschen
2.2 Reduplikation im Thailändischen
3 Daten und Analysemethode
4 Ergebnisse. 4.1 Übersicht der thailändischen Reduplikationen bei den einzelnen Kurzgeschichten
4.2 Funktionen der thailändischen Reduplikationen und ihre Entsprechungen im Deutschen. 4.2.1 Konstruktion einer neuen Bedeutung
4.2.2 TranspositionTransposition
4.2.3 PluralisierungPluralisierung und DistributionDistribution
4.2.4 Intensivierung & Extra-Intensivierung
4.2.5 AbschwächungAbschwächung und ReduzierungReduzierung des Bestimmtheitsgrads
4.2.6 Wechsel oder Ausdruck der AspektualitätAspektualität
4.2.7 Ausdruck der Modalität und Expressivität
4.3 Deutsche Entsprechungen thailändischer Reduplikationen
4.4 Deutsche Wortbildungsmittel als Entsprechungen der thailändischen Reduplikationen
4.4.1 Komposition
4.4.2 Derivation
5 Schlussbemerkung und Ausblick
Literatur
KonstruktionsmorphologieKonstruktionsmorphologie – echt top?
1 Einführung
2 Zur Etymologie von dt. Top(-)/top(-)
3 Die Verwendung von dt. Top(-)/top(-) 3.1 Lexikographische Daten
3.2 Korpusdaten
4 Zum kategorialen Status von dt. Top(-)/top(-)
5 Der konstruktionsmorphologische Ansatz
6 ‚top‘ im SprachvergleichSprachvergleich
6.1 NiederländischNiederländisch
6.2 SchwedischSchwedisch
7 Schlussbemerkungen
Literatur
Das Vollverb fahrenfahren mit seinen möglichen Kombinationen mit trennbarentrennbar und untrennbarenuntrennbar Präfixen und die Äquivalente im AlbanischenAlbanisch
1 Einleitung
2 WortbildungWortbildung des VerbsVerb kontrastiv: DeutschDeutsch – AlbanischAlbanisch
3 DerivationDerivation
3.1 Präfixderivation
3.2 Suffixderivation
3.3 Zirkumfigierung
4 KompositionKomposition
5 Konversion
6 Rückbildung
7 fahrenfahren alsPräfixPräfix- undPartikelverbPartikelverb
8 Korpusanalyse
9 Zusammenfassung
Literatur
Deutsche Substantivkomposita und ihre EntsprechungenEntsprechung im AlbanischenAlbanisch
1 Einleitung
2 Substantivkomposita im deutsch-albanischen Vergleich
3 Die Entsprechungstypen der deutschen KompositaKompositum im AlbanischenAlbanisch
3.1 Entsprechungstyp I: dt. Substantivkompositum → alb. Wortgruppe im Genitiv
3.2 Entsprechungstyp II: dt. Substantivkompositum → alb. Ablativ-Wortgruppe
3.3 Entsprechungstyp III: dt. Substantivkompositum → alb. adjektivische Wortgruppe
3.4 Entsprechungstyp IV: dt. Substantivkompositum → alb. SimplexSimplex oder Derivat
3.5 Entsprechungstyp V: dt. Substantivkompositum → alb. Substantivkompositum
3.6 Entsprechungstyp VI: dt. Substantivkompositum → alb. präpositionale Wortgruppe
4 Zusammenfassung
Literatur
Verzeichnis der Autorinnen und Autoren
Sachregister
Ableitung (siehe auch Derivation)
Abschwächung
Abstraktum
Adjektiv
Adjektiv, unflektiertes
Affix
Affixoid
agglutinierend
Akronym
Albanisch
Althochdeutsch
Ambiguität
Apokopierung
AQ**
Aspektualität
Augmentation
Äußerungen, satzäquivalente
Basis
Basismorphem
Debonding
Derivation
Deutsch
Diminution
Diminutiv
Diminutivsuffix
Distribution
empathisch
Entlehnung
Entlehnung von Wortbildungsmustern
Entsprechung
etymologisch
Expressivität
Extra-Intensivierung
fahren
Flurname
Flurnamentyp
Fugenelement
Fügung
Funktionen
Gerundium
Gerundiv
Infinitiv
Intensivierung
isolierend
Iteration
Iterativ
Kategorienwechsel
Kindersprache
Komposition
Kompositionsstammform
Kompositum
Kompositum, komplexes
Konfix
Konstruktionsmorphologie
Konverb
Konxif
Konzeptualisierung
Kopie
Korpusuntersuchung
Kurzwort
Landwirtschaft
lautmalerisch
Lehnpräfix
Lehnsuffix
Lehnübersetzung
Lehnwort
-lich
Linksköpfigkeit
Luxemburgisch
mentales Lexikon
Metapher
Modalität
Moselfränkisch
Nennungshäufigkeit
Niederdeutsch
Niederländisch
Nominalisierung
Notker III. von St. Gallen
Onomatopoetika
onymisch
Onymisierung
Organisation
Organisationsakronym
Ostfränkisch
Partikelverb
Plural
Pluralisierung
Polysemie
Postdetermination
Präfigierung
Präfix
Präfixoid
pragmatisch
Rechtserweiterung
rechtsverzweigt
Reduplikation
complex reduplication
emphatic reduplication
evocative reduplication
negative reduplication
semantic reduplication
simple reduplication
totale und partielle
Totalreduplikation
Reduplikationstypen
Reduzierung
Referenz
Reimbildung
Repetitionen
Schema
Schematizität
Schwedisch
Schweizerdeutsch
Selbstkomposita
Siedlungsnamengrundwort
Silbenkontakt
Silbenstruktur
Simplex
Simplizia
Sprachkontakt
Sprachvergleich
Standarddeutsch
Strukturwandel
Substantiv
Substantivierung
Substantivkomposition
Suffixbildung
syntaktisch komplexes Prädikat
Syntax
synthetisch
Terrorismus
textlinguistisch
Thailändisch
Tonwechsel
Topofix
Toponomastik
toponomastisch
Toponymizität
Transposition
trennbar
Türkisch
Umgangssprache
untrennbar
Verb
Verbpartikel
Verfugungsvarianz
Vokalkürzung
Wissensvermittlung
Wortakzent
Wortbildung
Wortbildungselement
Wortbildungsmuster
Wortbildungsprodukt
Wortbildungsverfahren, universelle
Wortdoppelung
Zusammensetzung (siehe auch Kompositum)
Fußnoten. 2 Infinitivkonversionen: Beobachtungen
4 Infinite Verbalformen im Deutschen
5 Sprachvergleich: Konverben
AQ + IS
1 Einleitung: Vorhaben und Vorgehen
2 Akronyme und Kurzwortforschung
3 Die Referenzialisierungen terroristischer Gruppen in deutschsprachigen Medien
4 Kleiner Exkurs zum sogenannten Islamischen Staat (IS)
5 Einige Hypothesen zu Organisationsakronymen
1 Einführung
2.1 Das Problem der Kategorisierung
2.2 Kopfpositionen im Verbalkomplex
2.3 Verbpartikeln als Wortglieder?
3.1 Nominalisierung von komm- und ihre Eigenschaften
1 Einleitung
2.1 Das Korpus: Notkers althochdeutsches Übersetzungswerk
2.2 Untersuchungsgegenstand: Substantivkomposita
3.2 Kulturtansfer und Rekontextualisierung
4.1 Metaphorische Substantivkomposita zur Bezeichnung theologischer Konzepte
4.2 Übersetzung lateinischer Fachbegriffe mit Substantivkomposita
Wortbildung und Syntax von Abstrakta bei Friedrich Schiller
1 Einführung
2 Statistische Angaben zu ung-Abstraktum vs. substantiviertem Infinitiv
3 Konkurrenz von ung-Abstraktum und substantiviertem Infinitiv
4 Komposita mit ung-Abstraktum und substantiviertem Infinitiv im Vorderglied
5 Der morphologische Wandel
3 Komposita
4 Untersuchungsmaterial
1 Einleitung und Hintergrund der Abhandlung
2 Konzeptionelle außersprachliche und sprachliche Grundlagen
3 Ergebnis
4 Auswertende Zusammenfassung
Von Blätterchen und Bäumchen: Die Entwicklung der Plural-Diminutive und Diminutiv Plurale im Deutschen und Luxemburgischen
1 Einleitung und Zielsetzung
2.1 Deutsch
2.2 Moselfränkische Dialekte
2.3 Luxemburgisch
3 Rückgang im Deutschen und Moselfränkischen – Erfolgsmodell im Luxemburgischen
4 Synchrone Interpretation der Plural-Diminutive
Von Gäul-s-bauer, April-s-narr und Getreid-s-gabel. Die Verwendung und Verbreitung des Fugen-s im Ostfränkischen
2 Die Kompositionsstammform
3 Systematik der Fugenelemente des Deutschen
6.1 Das Fugen-s nach Simplizia
6.2 Verfugung und Kontraktion
6.3 Fugen-s nach derivationsmorphologisch komplexen Erstgliedern
1 Einleitung
2.2 Reduplikation im Thailändischen
4.3 Deutsche Entsprechungen thailändischer Reduplikationen
1 Einführung
2 Zur Etymologie von dt. Top(-)/top(-)
3.1 Lexikographische Daten
6.2 Schwedisch
2 Wortbildung des Verbs kontrastiv: Deutsch – Albanisch
3.1 Präfixderivation
3.1 Entsprechungstyp I: dt. Substantivkompositum → alb. Wortgruppe im Genitiv
Отрывок из книги
Wortbildung im Deutschen
Aktuelle Perspektiven
.....
[…] obwohl das „sich einfach nicht mehr melden“ nur von ihm ausging.
Ebenso schwanken Groß- und Kleinschreibung in den gesammelten Belegen stark. In der Mehrzahl der Fälle werden die InfinitiveInfinitiv jedoch auch beim Vorhandensein eines Artikels nicht groß geschrieben, was den vorsichtigen Schluss nahe legt, dass sie von den Schreibenden nicht als Substantivierungen, sondern als Verbformen wahrgenommen werden.
.....