Ketzer, Held und Prediger
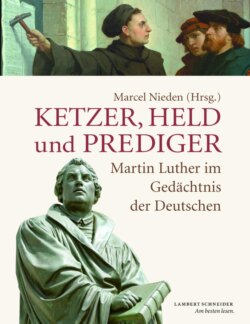
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Группа авторов. Ketzer, Held und Prediger
KETZER, HELD UND. PREDIGER
Impressum
Menü
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
16. Jahrhundert. DIE ANFÄNGE DER LUTHERMEMORIA. Marcel Nieden. Friedlich und sanft entschlafen – Faktensicherung
Verlust des Propheten und Lehrers – Traueransprachen
Geteiltes Gedächtnis – Grabstätte und Grabmal
Konkurrenzgedenken – Einzel-, Sammel- und Werkausgaben
„Geschichte von Leben und Taten“ – Biographien
Luther im Jahreskreis – Öffentliche Gedenktage
Imago Lutheri – Darstellungen in der Kunst
Luther kontrovers – Bild und Anti-Bild
17. Jahrhundert. DER REFORMATOR IN DER SELBSTINSZENIERUNG DES LUTHERTUMS. Wolfgang Sommer
Die Lutherbilder zur ersten Jahrhundertfeier der Reformation im Jahr 1617
Die „Lutherrose“ als Siegel Martin Luthers
Die Obrigkeit als Schutzherr der evangelischen Lehre
Jan Hus und Martin Luther – Gans und Schwan
Die antipäpstliche Polemik in den Lutherbildern von 1617
Die antilutherische Polemik der Katholiken
Der Konfessionshader am Beginn des Dreißigjährigen Krieges
Die Weissagung des Jan Hus auf das Wirken Martin Luthers
Die Lutherbilder zur Hundertjahrfeier der Übergabe der Confessio Augustana 1630 und zum Augsburger Religionsfrieden 1655
Der Bildtypus „Luther mit dem Schwan“ als Hauptmotiv der Lutherbilder im 17. und 18. Jahrhundert
Der Einfluss des Pietismus auf die Gestaltung der Lutherbilder
Das Geburtshaus Luthers in Eisleben als historisches Museum
Die Lutherbilder in plastischen Werken, Reliefs und Statuen in Kirchen
Die Lutherbilder in Buchillustrationen
Die Beziehung zwischen Lutherbild und zeitgenössischem Lutherverständnis
18. Jahrhundert. LUTHERERINNERUNG IM ZEICHEN VON AUFKLÄRUNG UND EMANZIPATION. Albrecht Geck. Johann Andreas Cramers „Ode auf D. Martin Luther“ (1773)
Lutherlob und Lutherschelte, oder: cum Luthero contra Lutherum
Die „Memorial-Trias“ des 18. Jahrhunderts
Die Zweihundertjahrfeier des Thesenanschlags im Jahre 1717
Die Zweihundertjahrfeier des Augsburger Bekenntnisses 1730
Die Zweihundertjahrfeier des Augsburger Religionsfriedens 1755
Das Reformationsjubiläum 1817 und die Errichtung eines Denkmals für Luther im öffentlichen Raum
19. Jahrhundert. NATIONALE, KONFESSIONELLE UND TOURISTISCHE ERINNERUNGSKULTUREN. Tim Lorentzen „Was ist das.“ Mit Luther durch ein langes Jahrhundert
Traditionsgründungen: das Reformationsjubiläum 1817
„Lebendige Denkmäler“ als Erinnerungsalternativen
Identitätsstiftung in konfessioneller Konkurrenz
Luthergedenkstätten: neue Wallfahrtsorte und Reliquien
Illustration und Historienmalerei: Luther auf der Bühne der Geschichte
Mit Podest und Pathos: Lutherdenkmäler
Vollendung: Protestantismus und Preußentum im Kaiserreich
20. Jahrhundert. VOM SOCKEL INS BODENLOSE? Klaus Fitschen. Die Nachwirkungen der Denkmalskultur des 19. Jahrhunderts und der Bruch damit
Und wenn die Welt voll Teufel wär: Luther im Ersten Weltkrieg
Ideologisch überformte und zerstörte Erinnerung im Dritten Reich
Der restaurierte Luther: Selbstvergewisserung nach dem Zweiten Weltkrieg
Erinnerung im Zeichen des Zweifels
Der geteilte Luther: deutsch-deutsche Erinnerung im Jahre 1983
Der medialisierte und popularisierte Luther
Der Höhepunkt der Erinnerung? 2017
Was bleibt?
ANMERKUNGEN
Literaturverzeichnis
BILDNACHWEISE
PERSONENREGISTER
Informationen zum Buch
Informationen zu den Autoren
Отрывок из книги
Marcel Nieden (Hrsg.)
Martin Luther im
.....
Abb. 12: Von den Lutherpredigten (Historien) des Joachimsthaler Pfarrers Johannes Mathesius waren bis 1600 bereits 13 Ausgaben erschienen; Titelblatt der Ausgabe Nürnberg 1600.
Melanchthon berichtet in seinem Vorwort zum zweiten Band der Wittenberger Ausgabe der lateinischen Schriften Luthers, dass der Reformator seine Freunde hatte hoffen lassen, „er werde seinen Lebenslauf wie auch die Anlässe seiner Kämpfe erzählen.“36 Doch sei ihm der Tod zuvorgekommen. Melanchthon versucht nun seinerseits und stellvertretend, das Leben im Zusammenhang einer humanistischen Laudatio zu erzählen, bietet allerdings in seiner Historia de vita et actis Martini Lutheri (Geschichte von Leben und Taten Martin Luthers, 1546) nur eine an der inneren Entwicklung Luthers orientierte Beschreibung der Jugend und frühen Wittenberger Zeit (bis ca. 1519), die recht abrupt auf sein Ende 1546 ausgreift und dann vor allem auf seine Bedeutung für die Nachwelt zu sprechen kommt.37 Das mit den Lebensaufzeichnungen verbundene Interesse galt nicht oder zumindest nicht ausschließlich der beschriebenen Person, sondern letztlich den zeitgenössischen Lesern. Die Historia sollte zum einen den Lesern durch die Betrachtung der Luthervita Beispiele zur Gestaltung der eigenen Lebenspraxis – in den Worten Melanchthons „zur Stärkung der Frömmigkeit“38 – anbieten, zum anderen aber auch durch eine Gegendarstellung helfen, konfessionspolemische Lutherlegenden zu entkräften.
.....