Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten, Band 3
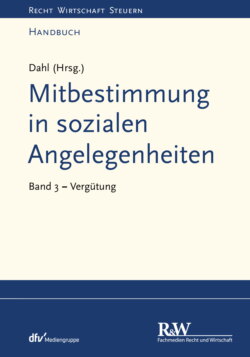
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Holger Dahl. Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten, Band 3
Mitbestimmung in. sozialen Angelegenheiten. Band 3 – Vergütung
Vorwort
Autorenverzeichnis
Bearbeiterverzeichnis
Inhaltsverzeichnis. Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Einführung: Ausgestaltung zeitgemäßer Vergütungssysteme
I. Zielsetzungen festlegen
II. Die Funktions- und Stellenstruktur
III. Die Vergütungsstruktur
IV. Performance Management und Prozesse
V. Die Steuerung des Vergütungssystems
VI. Variable Vergütung
VII. Fazit: Universallösungen gibt es nicht
Abschnitt 1 – Perspektive Arbeitgeberin. I. Einleitung
II. Bestimmung des Normzwecks
1. Begründungsformel: Gewährleistung innerbetrieblicher Lohngerechtigkeit
2. Schutz der Arbeitnehmer
III. Maßstab der Grenzziehung
1. Bedeutung der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit nach Art. 12 GG
2. Schutzbedürftigkeit in Abhängigkeit der Machtposition des Arbeitgebers
3. Zwischenergebnis
IV. Grenzen der Mitbestimmung
1. Höhe der Vergütung
a) Wortlaut und Systematik
b) Unternehmerische Freiheit und Schutzbedürftigkeit der Arbeitnehmer
c) Innerbetriebliche Lohngerechtigkeit
d) Zwischenergebnis
2. Zweckbestimmung und Festlegung des begünstigten Personenkreises
3. Fehlender Regelungsspielraum des Arbeitgebers
V. Bedeutung für die Praxis
VI. Fazit
Abschnitt 2 – Perspektive Betriebsrat. I. Einleitung
II. Grundsätze der Mitbestimmung nach § 87 BetrVG
1. Begriffsentwicklung
a) Entlohnungsgrundsatz
b) Entlohnungsmethode
2. Verhältnis von Entlohnungsgrundsatz und Entlohnungsmethode
3. Bedeutung von „Insbesondere“
III. Reichweite der Mitbestimmung. 1. Vergütungsfindung
2. Mitbestimmungsfreiheit hinsichtlich der Entgelthöhe
3. Mitbestimmung bei der Aufstellung von Bandbreiten
a) BAG, Beschluss vom 21.2.2017 – 1 ABR 12/15
b) LAG Düsseldorf, Beschluss vom 10.8.2016 – 4 TaBV 135/15
4. Mitbestimmung bei dem Verhältnis zwischen Festvergütung und variabler Vergütung. a) BAG, Beschluss vom 6.12.1988 – 1 ABR 44/87
b) Geltung des Günstigkeitsprinzips
c) Abschaffung einer einzelvertraglichen festgelegten variablen Vergütung zugunsten einer Festvergütung
aa) Änderungskündigung
bb) Kollektiver Regelungsbezug
cc) Zusammenfassung
5. Informationsanspruch des Betriebsrats
a) Allgemeiner Informationsanspruch
b) Grenzen der Unterrichtung?
IV. Fazit
Abschnitt 1 – Perspektive Arbeitgeber. I. Einleitung
II. Tarifgebundene Unternehmen. 1. Grundsatz: Mitbestimmung hinsichtlich Vergütungsgruppen ausgeschlossen
2. Ausnahme: Fehlende Regelung durch die Tarifparteien
3. Keine Festlegung des konkreten Gehalts durch die Einigungsstelle
4. Einheitliche Regelung im (Haus-)Tarifvertrag sinnvoll
III. Nicht tarifgebundene Unternehmen. 1. Grundsatz: Volle Mitbestimmung bei Aufstellung der Vergütungsgruppen
2. Aber: Keine Festlegung des Geldfaktors
3. Wahrung einer gewissen Flexibilität auch in der Einigungsstelle möglich
4. Auf Umsetzungsfähigkeit achten
IV. Zusammenfassung
Abschnitt 2 – Perspektive Betriebsrat. I. Allgemeines. 1. § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG als Generalklausel
2. Schutzzweck
3. Reichweite
4. Initiativrecht des Betriebsrats
II. Was ist bei der Einrichtung von Vergütungsgruppen mitbestimmungspflichtig? 1. Vergütungsgruppen
2. Gegenstand der Mitbestimmung
3. Regelungsbeispiel20
III. Mitbestimmung bei Bandbreitenregelungen und im Band. 1. Bandbreitenregelungen
2. Art und Weise der Mitbestimmung im Band
IV. Kann der Arbeitgeberin (per Spruch der Einigungsstelle) die Bewegung ins Band ins pflichtgemäße Ermessen gestellt werden? 1. Freie Vereinbarung der Betriebsparteien
2. Spruch der Einigungsstelle
3. Regelungsbeispiele
V. Kann der Arbeitgeberin bei einem Gehaltsband die jährliche Bestimmung eines Medians nach Marktvergleichen überlassen werden? 1. Freie Vereinbarung der Betriebsparteien
2. Spruch der Einigungsstelle
VI. Wie schlägt sich der Mindestlohn auf die Vergütungsgruppen nieder? 1. Keine Einschränkung der Mitbestimmung durch das MiLoG
2. Erweiterung der Mitbestimmung aus (Mindest-)Dotierung
3. Auswirkung auf bestehende Vergütungsgruppen
4. MiLoG als eigene Vergütungsordnung?
Abschnitt 1 – Perspektive Arbeitgeber. I. Einleitung
II. Allgemeine Grundsätze zum Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG
1. Vorliegen eines kollektiven Tatbestandes
2. Umfang der Mitbestimmung bei § 87 Abs. 1 BetrVG
a) Initiativrecht
b) Tarifvorrang
c) Freiwillige Leistungen
3. Unternehmerische Entscheidungsfreiheit als Grenze
III. Mitbestimmungspflichtige Angelegenheiten bei freiwilligen Zulagen. 1. Einführung
2. Höhe
3. Zweck und begünstigter Personenkreis
4. Verteilungsgrundsätze
5. Widerruf, Freiwilligkeitsvorbehalt und Anrechnung
a) Anrechnung einer Tariflohnerhöhung auf die übertarifliche Zulage
b) Widerruf und Freiwilligkeitsvorbehalt
IV. Verfahren vor der Einigungsstelle
V. Folge fehlender Mitbestimmung bei Zulagen
VI. Verwirkung und Verzicht auf das Mitbestimmungsrecht
VII. Betriebsratsbildung nach Einführung der Zulage
VIII. Gerichtliche Durchsetzung der Mitbestimmungsrechte
IX. Resümee
Abschnitt 2 – Perspektive Betriebsrat. I. Einleitung
II. Das Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG
III. Rechtsprechung des BAG
1. BAG vom 30.1.1990 – 1 ABR 2/89
2. BAG vom 18.10.1994 – 1 ABR 17/94
IV. Die Reichweite des Initiativrechts bei Fragen der Lohngestaltung
V. Rückwirkende Mitbestimmung
VI. Fazit
Abschnitt 1 – Perspektive Arbeitgeberin. I. Einleitung
II. Informationsrechte des Betriebsrats als „Vorstufe“ der Mitbestimmung
III. Umfang der Mitbestimmung
1. Tarifvorbehalt/Tarifvorrang
a) Tarifvorbehalt
b) Tarifvorrang
c) Verhältnis Tarifvorbehalt/Tarifvorrang
d) Beschränkung der Mitbestimmungsrechte bei Öffnung nur für freiwillige Betriebsvereinbarungen?
2. Kollektiver Tatbestand
IV. Mitbestimmungsrechte im Einzelnen
1. § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG
a) Umfang und Grenzen der Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG
2. § 87 Abs. 1 Nr. 11 BetrVG
a) Akkord- und Prämienlohn
aa) Akkordlohn
bb) Prämienlohn
b) Vergleichbares leistungsbezogenes Entgeltsystem
aa) „Prämienentscheidung“ des BAG und Schutzzweck des § 87 Abs. 1 Nr. 11 BetrVG
bb) Urteil des BAG aus dem Jahr 2003
c) Eigene Auffassung
3. § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG
4. Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG
5. Mitbestimmung nach § 94 Abs. 2 BetrVG
V. Weitere in Betracht kommende Mitbestimmungsrechte
VI. Rechtsfolgen der Nichtbeteiligung des Betriebsrats
VII. Ende
Abschnitt 2 – Perspektive Betriebsrat. I. Bestimmt der Betriebsrat bei Zielvereinbarungen mit?
II. Anknüpfungen für die Mitbestimmung
III. § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG hilft nur beschränkt
IV. § 87 Abs. 1 Nr. 11 BetrVG vermittelt weitere Rechte
V. Können Zielvereinbarungen unter § 87 Abs. 1 Nr. 11 fallen?
VI. Die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes
VII. Was das für Zielvereinbarungen genau bedeutet
VIII. Das ablehnende Lager
IX. Das aufgeschlossene Lager
X. Stellungnahme
XI. Mitbestimmung bei generellen Unternehmenszielen
XII. Ziele, deren Erfüllung vom Vorgesetzten bewertet werden
XIII. Mitbestimmung bei individuellen Umsatzzielen einzelner Mitarbeiter
XIV. Andere individuelle Ziele
Abschnitt 1 – Perspektive Arbeitgeberin
I. Allgemeine Beurteilungsgrundsätze
1. Unzuständigkeit für leitende Angestellte
2. Definition
3. Rechte des Betriebsrats
4. Mögliche Regelungsinhalte einer Betriebsvereinbarung
5. Gang in die Einigungsstelle
II. Die Mitbestimmung bei Zielvereinbarungen
1. § 94 Abs. 2 BetrVG
2. § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG
3. § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG
a) Kollektiver Tatbestand
b) Abstrakter Rahmen
aa) Rahmenregelungen
(1) Meinungsstand
(2) Stellungnahme
(3) Weitere Regelungen
4. § 87 Abs. 1 Nr. 11 BetrVG
a) Anwendungsbereich
5. Rechtsfolgen
a) § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG
b) § 87 Abs. 1 Nr. 11 BetrVG
Abschnitt 2 – Perspektive Betriebsrat. I. Grundlagen der Mitbestimmung bei Beurteilungsgrundsätzen, Zielvereinbarungen oder Zielvorgaben
II. Unterschiede der Mitbestimmung bei Beurteilungsgrundsätzen und Zielvereinbarungen und Zielvorgaben
III. Mitbestimmung bei Beurteilungsgrundsätzen
IV. Mitbestimmung bei Zielvereinbarungen/Zielvorgaben
Abschnitt 1 – Perspektive Arbeitgeber. I. Einführung
II. Vorteile einer Betriebsvereinbarung aus Arbeitgebersicht
III. Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats
1. Kollektiver Tatbestand
2. Dienstwagenüberlassung als Teil der betrieblichen Lohngestaltung
a) Dienstwagenüberlassung zur dienstlichen Nutzung
b) Dienstwagenüberlassung auch zur privaten Nutzung
3. Weitere Mitbestimmungstatbestände
IV. Zentrale Regelungsinhalte einer Betriebsvereinbarung Dienstwagen
1. Kreis der Dienstwagenberechtigten
2. Auswahl des Fahrzeugmodells und Ausstattung
3. Nutzungsumfang
4. Kostenverteilung
5. Widerrufsvorbehalt
Abschnitt 2 – Perspektive Betriebsrat
I. Individual-arbeitsrechtliche Grundlagen der Dienstwagennutzung
II. Voraussetzungen eines Mitbestimmungsrechts des Betriebsrats bei privater Nutzung von Dienstwagen
1. Grundlagen der Mitbestimmung
2. Unstreitiges zur privaten Nutzung eines Dienstwagens
a) Das „Ob“ der Nutzung
b) Kollektiver Tatbestand
c) Nur bei privater Nutzung
3. Streitiges zur Nutzung: Ist die private Nutzung des Dienstwagens Teil des Entgelts?
a) LAG München, Beschluss vom 20.2.1981 – 4 (6) TaBV 33/80
b) LAG Hessen, Beschluss vom 24.5.1983 – 5 TaBV 20/83
c) Landesarbeitsgericht Hamm, Beschluss vom 7.2.2014 – 13 TaBV 86/13
d) Mögliche Auffassung des Bundesarbeitsgerichts
e) Eigene Auffassung
aa) Auslegung des Wortlautes
bb) Systematische Auslegung
cc) Auslegung des Sinns und Zwecks
dd) Auslegung der Gesetzgebungsmaterialien
ee) Verwertung der bisherigen LAG-Rechtsprechung
III. Reichweite des Mitbestimmungsrechts
IV. Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats über Gewährung sonstiger Sachbezüge
V. Zusammenfassung und Ausblick
VI. Beispiele aus der Praxis
1. Regelung des Nutzungsumfangs im Überlassungsvertrag. a) Benutzungsregeln. aa) Ständiger Fahrzeugbesitzer
bb) Nutzung
cc) Dienstliche Nutzung
dd) Private Nutzung
ee) Fahrten ins Ausland
ff) Fahrberechtigte Personen
b) Widerrufsregelung im Überlassungsvertrag. aa) Beendigung der Überlassung
bb) Regelung im Falle einer Freistellung (bspw. bei Vertragsbeendigungen etc.)
2. Zuteilung von Fahrzeugtypen in Betriebsvereinbarung
3. Regelung der Zusatzausstattung in Betriebsvereinbarung
Abschnitt 1 – Perspektive Arbeitgeber
I. Regelungen des BetrVG zur Mitbestimmung in Entgeltangelegenheiten
1. Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG
2. Weitere Mitbestimmungstatbestände
3. Freiwillige Betriebsvereinbarungen
II. Verhältnis der erzwingbaren Mitbestimmung zu tariflichen Regelungen
1. Tarifvorrang oder Tarifvorbehalt?
2. Reichweite des Tarifvorrangs
III. Folgerungen für die Mitbestimmung in Entgeltangelegenheiten
IV. Einzelne Bereiche betrieblicher Mitbestimmung bei tarifgebundenen Arbeitgebern in Entgeltfragen
1. Außertarifliche und übertarifliche Leistungen
a) Mitbestimmung bei der Einführung außer- und übertariflicher Leistungen
b) Mitbestimmung bei Einstellung und Änderung außer- und übertariflicher Leistungen
2. Mitbestimmung bei der Feststellung stellenbezogener Anforderungen
3. Mitbestimmung bei außertariflichen Angestellten (AT-Angestellten)
4. Mitbestimmung bei Wegfall der Tarifbindung
5. Vereinheitlichung der Tarifanwendung durch Mitbestimmung
V. Fazit
Abschnitt 2 – Perspektive Betriebsrat. I. Vorbemerkung
II. In welchen Grenzen bewegt sich die Mitbestimmung bei der Vergütung tarifgebundener Arbeitgeber? 1. Tarifvorbehalt. a) Verhältnis zur Regelungssperre des § 77 Abs. 3 BetrVG
b) Persönlicher Anwendungsbereich des Tarifvorbehalts
c) Zeitlicher Anwendungsbereich des Tarifvorbehalts
2. Regelungssperre
3. Bezugnahme der Betriebsvereinbarung auf den Tarifvertrag als Ausweg aus der „Endlosdynamisierung“?
III. Übertarifliche Leistungen. 1. Verhältnis zum tariflich festgelegten Gehalt. a) Erzwingbare Mitbestimmung
b) Freiwillige Regelungen
2. Anrechnung/Widerruf übertariflicher Leistungen
IV. Tarifliche Gestaltungsspielräume: Besteht Mitbestimmung bei der Feststellung stellenbezogener Anforderungen? 1. Grundsatz
2. Beispiel REGA
3. Methoden zur Ermittlung der stellenbezogenen Anforderungen als mitbestimmungsbedürftige Vorfrage
4. Mitbestimmung auch bei der entgeltbezogenen Stellenbewertung?
V. Wie ist die Mitbestimmung bei außertariflichen Mitarbeitern ausgestaltet? 1. Grundsatz
2. Vergütungsgrundsätze
3. Abstandsklausel zum Tarifgehalt
VI. Zusammenfassung
Abschnitt 1 – Perspektive Arbeitgeber. I. Aktienoptionen
II. Umfang und Reichweite des Mitbestimmungsrechts. 1. Mitbestimmungsfreie Inhalte
2. Mitbestimmungspflichtige Inhalte. a) Mitbestimmungstatbestand
b) Inhalt und Reichweite des Mitbestimmungsrechts
III. Optionsprogramme insbesondere ausländischer Konzerngesellschaften. 1. Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats
a) Kein Arbeitslohn im Sinne von § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG
2. Auskunftsansprüche des Betriebsrats
a) Rechtsprechung bis einschließlich 2017
b) BAG, Beschluss vom 20.3.2018 – 1 ABR 15/17
c) Entgelttransparenzgesetz
Abschnitt 2 – Perspektive Betriebsrat. I. Was regelt die Mitbestimmung bei Aktienoptionsplänen?
1. Aktienoptionen sind Lohn
2. Mitbestimmungsfreie Aspekte. a) Berechtigtenkreis und Leistungszweck
b) Verdrängung des BetrVG wegen Betonung der gesellschaftsrechtlichen Beteiligung?
c) § 193 Abs. 2 Nr. 4 AktG
3. Mitbestimmungspflichtige Inhalte
4. Zuständigkeit. a) Unternehmen mit Betriebsrat und einem Betrieb
b) Unternehmen mit einem Gesamtbetriebsrat
c) Konzern mit Konzernbetriebsrat
II. Welchen Unterschied macht es, wenn der Aktienoptionsplan von einer (ausländischen) Gruppengesellschaft gewährt wird?
1. LAG Hessen, 3.8.2017 – 5 TaBV 23/17
a) Entscheidung des LAG Nürnberg vom 22.1.2002 – 6 TaBV 19/01
b) Entscheidung des BAG vom 16.1.2008 – 7 AZR 887/06
2. LAG Bremen, 27.7.2016 – 3 TaBV 2/16
3. LAG München, 11.8.2017 – 9 TaBV 34/17
4. LAG Baden-Württemberg, 17.1.2017 – 19 TaBV 3/16
5. BAG, 20.3.2018 – 1 ABR 15/17
6. Rechtsbeschwerde gegen die Entscheidung des LAG Hessen, 3.8.2017 – 5 TaBV 23/17 anhängig unter BAG, 1 ABR 57/17
Abschnitt 1 – Perspektive Arbeitgeberin. I. Einführung. 1. Das Gebot der Entgeltgleichheit
2. Entgelttransparenzgesetz
II. Beteiligungsrechte des Betriebsrats. 1. Allgemeines
2. Informationsrechte des Betriebsrats. a) Einsichtsrecht in Listen über Bruttolöhne und -gehälter (§§ 80 Abs. 2 Satz 2 Hs. 2 BetrVG, 13 Abs. 2, Abs. 3 EntgTranspG)
aa) Inhalt und Reichweite des Einsichtsrechts
bb) Zuständigkeiten
b) Erklärung über die Anwendung tariflicher Entgeltregelungen (§ 13 Abs. 5 Satz 1 EntgTranspG)
c) Informationsrecht über eingehende Auskunftsverlangen und Antwort des Arbeitgebers (§§ 14 Abs. 2 Satz 3, 15 Abs. 2 EntgTranspG)
d) Informationsrecht bei Auskunftserteilung durch den Betriebsrat bei nicht tarifgebundenem und nicht tarifanwendendem Arbeitgeber (§ 15 Abs. 4 Satz 5 EntgTranspG)
e) Unterrichtungsrecht über Planung des betrieblichen Prüfverfahrens (§ 20 Abs. 1 EntgTranspG)
3. Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten (§ 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG) a) Allgemeines
b) Konkrete Anknüpfungspunkte des Gebots der Entgeltgleichheit
c) Initiativrecht des Betriebsrats
4. Mitbestimmung in personellen Angelegenheiten. a) Aufstellung allgemeiner Beurteilungsgrundsätze (§ 94 Abs. 2 BetrVG)
b) Auswahlrichtlinien (§ 95 Abs. 1, Abs. 2 BetrVG)
c) Personelle Einzelmaßnahmen (§ 99 BetrVG)
III. Fazit
Abschnitt 2 – Perspektive Betriebsrat1
I. Der Gender Pay Gap. 1. Die jüngere Vergangenheit
2. Der Gender Pay Gap und weitere Indikatoren
3. Der „bereinigte Gender Pay Gap“
II. Nichts kommt von selbst10
1. Das Entgeltgleichheitsgebot
a) Art. 3 Abs. 2 GG
b) Art. 157 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)
c) § 17 Abs. 1 Allgemeines Gleichstellungsgesetz (AGG)
d) ILO-Übereinkommen 100
e) Art. 4 RL 2006/54/EG
f) § 4 Entgelttransparenzgesetz (EntgTranspG)
III. Die Rolle des Arbeitgebers und des Betriebsrats. 1. Arbeitgeber
2. Betriebsrat
IV. Der Unterrichtungsanspruch des Betriebsrats. 1. Unterrichtung über die Entgeltstrukturen
2. Ggf. Unterrichtung zur Eingruppierung
V. Die Ermittlung der stellenbezogenen Anforderungen
VI. Die Mitbestimmung. 1. Generalklauselcharakter des § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG
2. Die Mitbestimmung erstreckt sich auf die Methodik
3. Methodik zur Ermittlung stellenbezogener Anforderungen
4. Das Erfordernis der Verbindung zur Lohnfindung
5. Keine Regelungssperre
6. Mitbestimmung zur Reduzierung des Gender Pay Gaps
VII. Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Sachregister
Sachregister A
Sachregister B
Sachregister C
Sachregister D
Sachregister E
Sachregister F
Sachregister G
Sachregister I
Sachregister J
Sachregister K
Sachregister L
Sachregister M
Sachregister N
Sachregister P
Sachregister R
Sachregister S
Sachregister T
Sachregister U
Sachregister V
Sachregister W
Sachregister Z
Отрывок из книги
Herausgegeben von
Holger Dahl
.....
Mitte 2013 erfuhr der Betriebsrat, dass die Vergütung eines Beschäftigten an den oberen Rand des Gehaltsbandes angehoben wurde, ohne hierzu den Betriebsrat zu beteiligen. Der Betriebsrat war der Auffassung, ihm stehe ein Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG zu.
Das LAG sprach dem Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht sowohl bzgl. der inhaltlichen Ausgestaltung als auch der Festlegung von Kriterien und Grundsätzen für die Ersteingruppierung und die Änderungen innerhalb eines Gehaltsbandes zu.
.....