Handbuch des Strafrechts
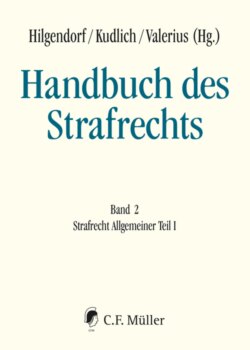
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Jan C. Joerden. Handbuch des Strafrechts
Handbuch des. Strafrechts
Impressum
Vorwort
Inhalt Band 2
Verfasser
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Verzeichnis der Festschriften/Festgaben. und Gedächtnisschriften
6. Abschnitt: Die Straftat
§ 27 System- und Begriffsbildung im Strafrecht
A. Systematik und Rechtsstaatlichkeit
I. Terminologie
II. Der Verbrechensbegriff
III. Internationale Perspektiven
B. Methodologische Orientierung
C. Geistesgeschichtlicher Hintergrund
I. Zum Systemdenken im Recht
II. Varianten des Systemdenkens
D. Strafrecht zwischen Systembindung und Willkür
I. Albert Friedrich Berner
II. Franz von Liszt und Ernst Beling
III. Der Neukantianismus
IV. Politisch motivierte „Ganzheitsbetrachtung“
V. Der Finalismus
VI. Rückkehr zur teleologischen Begriffs- und Systembildung
VII. Gegenwart
VIII. Zusammenfassende Bewertung
F. Zur systematischen Trennung von Unrecht und Schuld
I. Die Kritik Michael Pawliks
II. Die Kritik Wolfgang Frischs
G. „Normativ“ und „Normativismus“ – Kritik zweier Modevokabeln
I. Bedeutungsvarianten von „normativ“
II. Normativismus
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
§ 28 Handlung
A. Die Funktionen des Handlungsbegriffs
I. Die kausale Handlungslehre
II. Der finale Handlungsbegriff
III. Stellungnahme
IV. Handlung als Straftat oder als normwidriges Verhalten
I. Der Streit um die Notwendigkeit eines Handlungsbegriffs als Gegenstand strafrechtlicher Bewertungen
II. Handlung als menschliches Verhalten
III. Der natürliche Handlungsbegriff
IV. Der negative Handlungsbegriff
V. Der soziale Handlungsbegriff
1. Die Entwicklung der Konzeption
2. Vertreter einer personalen Handlungslehre
3. Kritik am personalen Handlungsbegriff
VII. Die systematische Verortung des Handlungsbegriffs
D. Die Filterfunktion des Handlungsbegriffs
I. Gedanken, Gesinnungen, Einstellungen
II. Akte von Verbänden und juristischen Personen
III. Wirkungen bloßer Körperlichkeit oder körperlicher Handlungsunfähigkeit
IV. Geschehnisse im Zustand der Bewusstlosigkeit
V. Reflex- und Schockreaktionen, Automatismen, Affekttaten
VI. Besitzdelikte
E. Fazit
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
§ 29 Handlungs- und Erfolgsunrecht sowie Gesinnungsunwert der Tat[1]
I. Das Unrecht als zentraler Begriff der allgemeinen Verbrechenslehre
1. Unrecht und Tatbestand
2. Unrecht und Unwert
3. Unrecht und Rechtswidrigkeit
B. Die (notwendigen) Komponenten des Unrechts
I. Entwicklung der Unrechtslehre[28]
II. Unrechtslehre „de lege lata“?
III. Fazit: Partikulärer Unrechtsbegriff?
I. Ausgangspunkt
II. Unrechtskompensierende Elemente
1. Erlaubnistatbestandsirrtum (Wegfall des Handlungs- bzw. Intentionsunrechts?)
2. Umgekehrter Erlaubnistatbestandsirrtum (Wegfall des Erfolgsunrechts?)
1. Inhalt
2. Erfolgsunrecht und Verbrechenslehre
IV. Handlungsunrecht
1. Vorsatz als Intentionsunrecht
2. Objektives Handlungsunrecht
a) Konkretisierung des objektiven Handlungsunrechts über die Dogmatik der objektiven Zurechnung
b) Kritik
3. Konstitutive Handlungsunrechtselemente beim Vorsatzdelikt – zum Wechselspiel von Intentionsunrecht und objektiven Handlungsunrechtselementen
a) „Fahrlässigkeit“ als Voraussetzung jedes Vorsatzdelikts?
b) Kritik
c) Extensiverer Maßstab beim Vorsatzdelikt wegen fehlenden Drohens einer Überforderung
4. Zusammenwirken von objektiven und subjektiven Handlungsunrechtselementen
D. Erfolgs- und Handlungsunrecht in der Rechtsprechung
E. Zusammenfassung
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
7. Abschnitt: Geltungsbereich des Strafrechts
§ 30 Zeitlicher Geltungsbereich
I. Vorgeschichte des Grundsatzes „nullum crimen, nulla poena sine lege“ und des „lex mitior“-Prinzips bis zur Aufklärung
1. Rückwirkungsverbot
2. Milderungsgebot
III. Das Rückwirkungsverbot und das Milderungsgebot im Nationalsozialismus
IV. Wiedereinführung des Milderungsgebots nach dem Zweiten Weltkrieg und Regelung im Einigungsvertrag
I. Grundsätzliches
II. Ausgestaltung des intertemporalen Strafrechts in § 2 StGB
1. Prinzipien des intertemporalen Strafrechts
a) Konkretisierung des verfassungsrechtlichen Rückwirkungsverbots durch § 2 Abs. 1 und 2 StGB
b) Meistbegünstigungsprinzip
c) Durchbrechung des Meistbegünstigungsprinzips für Zeitgesetze
d) Sonderregelung für Verfall, Einziehung und Unbrauchbarmachung
e) Sonderregelung für Maßregeln der Besserung und Sicherung
2. Zeitlicher Geltungs- und Anwendungsbereich von Strafgesetzen
a) Inkrafttreten und Derogation von Gesetzen
b) Dogmatische und systematische Konzeption des § 2 StGB
c) Regelung des zeitlichen Anwendungsbereichs durch § 2 StGB
d) § 2 StGB als Rechtsgeltungsregel für das frühere Gesetz
e) Grundsätzliche Geltung des Urteilszeitrechts
f) Praktische Bedeutung der unterschiedlichen Konzeptionen des § 2 StGB
3. Regelungsgehalt des § 2 Abs. 1 StGB: limitierende Funktion der aufgehobenen Rechtsnormen
a) Anwendungsbereich des § 2 Abs. 1 StGB
b) Materielles Strafrecht
c) Strafverfahrensrecht
d) Änderungen der Rechtsprechung
e) Geltung des Gesetzes „zur Zeit der Tat“
f) Änderungen der Strafbarkeit während der Begehung der Tat
4. Regelungsgehalt des § 2 Abs. 2 StGB: Änderungen der Strafart und Strafdrohung zwischen Beginn und Beendigung der Tat
5. Regelungsgehalt des § 2 Abs. 3 StGB: Meistbegünstigungsprinzip
a) Anwendung des mildesten Gesetzes bei Gesetzesänderungen zwischen Beendigung der Tat und Entscheidung
b) Bestimmung des mildesten „Gesetzes“
aa) Anforderungen an die Unrechtskontinuität
bb) Anwendbarkeit des Milderungsgebots auf Blankettvorschriften
cc) Anwendbarkeit des Milderungsgebots auf rechtsnormative Tatbestandsmerkmale
c) Feststellung des mildesten Gesetzes
d) Mehrfache Gesetzesänderungen und Zwischengesetze
6. Sonderregelungen für Zeitgesetze
a) Grundlagen
b) Begriff des Zeitgesetzes
c) Vorbehalt für abweichende Regelungen
7. Verfall, Einziehung und Unbrauchbarmachung
8. Ausnahme für Maßregeln der Sicherung und Besserung
I. Rückwirkungsverbot
1. Art. 7 EMRK
2. Art. 49 Abs. 1 S. 3 GRCh
1. Verortung des Milderungsgebots im Grundsatz „nullum crimen sine lege“ (Art. 7 EMRK) durch den EGMR
2. Art. 49 Abs. 1 S. 3 GR-Charta
a) Eröffnung des Anwendungsbereichs der Grundrechtecharta
b) Erstreckung des Milderungsgebots auf Richtlinien, Verordnungen und Rahmenbeschlüsse
c) Erstreckung des Milderungsgebots auf den Anwendungsvorrang des Unionsrechts?
d) Verdrängung der Sonderregelung für Zeitgesetze in § 2 Abs. 4 StGB durch Art. 49 Abs. 1 S. 3 GRCh?
1. Rückwirkungsverbot
a) Tötungen an der innerdeutschen Grenze
b) Geltung des Rückwirkungsverbots für Maßregeln der Besserung und Sicherung?
a) Anforderungen an eine Ahndungslücke
b) Möglichkeiten zur Schließung einer intertemporalen Ahndungslücke durch den Gesetzgeber
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
§ 31 Räumlicher Geltungsbereich
A. Einführung
I. Grundlagen
1. Territorialitäts- und Ubiquitätsprinzip
2. Flaggenprinzip
3. (Aktives und passives) Personalitätsprinzip
4. Realprinzip
5. Weltrechtsprinzip
6. Prinzip der stellvertretenden Strafrechtspflege
1. Überblick über die Regelung in Deutschland
a) § 3 StGB: Territorialitätsprinzip
aa) Grundlagen
bb) Begehungsort der Tat (§ 9 Abs. 1 StGB)
cc) Begehungsort der Teilnahme (§ 9 Abs. 2 StGB)
a) § 4 StGB: Flaggenprinzip
b) § 5 StGB: Realprinzip und sonstige legitimierende Anknüpfungspunkte
c) § 6 StGB: Weltrechtsprinzip
d) § 7 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 StGB: Personalitätsprinzipien
e) § 7 Abs. 2 Nr. 2 StGB: Prinzip der stellvertretenden Strafrechtspflege
4. Ungeschriebene Beschränkung auf inländische Rechtsgüter
1. Begehungsort der Tat nach § 9 Abs. 1 StGB
2. Täter und Teilnehmer im Strafanwendungsrecht
3. Irrtümer über das Strafanwendungsrecht
1. Reichweite des nationalen Strafrechts im Internet
2. Grenzüberschreitende Kooperation
3. „Straftatentourismus“
4. Strafanwendungsrecht als Kollisionsrecht?
I. Das Strafanwendungsrecht in Österreich
II. Das Strafanwendungsrecht in der Schweiz
E. Bezüge zum Strafverfahrensrecht
F. Fazit
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
8. Abschnitt: Unrechtsbegründung: Tatbestand
§ 32 Geschriebene objektive Tatbestandsmerkmale
A. Einführung und Thematik
B. Funktionen des objektiven Tatbestandes
I. Straf- und Bußgeldtatbestände des Kern- und Nebenstrafrechts
II. Allgemeiner Teil des Strafgesetzbuchs
D. Inhalt des objektiven Tatbestandes
I. Deskriptive und normative Tatbestandsmerkmale
II. Zivilrechtsakzessorische Tatbestandsmerkmale
1. Begriffliche Verwaltungsaktsakzessorietät
2. Verwaltungsaktsakzessorietät
1. Straftatbestände
2. Ordnungswidrigkeitenrecht
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
§ 33 Kausalität und objektive Zurechnung
A. Die Kausalität
I. Das Erfordernis der Kausalität bei Erfolgsdelikten
II. Die Äquivalenztheorie
III. Die Formel von der gesetzmäßigen Bedingung
IV. Einzelheiten zur Äquivalenztheorie
1. Hypothetische Kausalverläufe
2. Abbruch rettender Kausalverläufe
3. Alternative Kausalität
4. Kumulative Kausalität
5. Überholende Kausalität
6. Kausalität bei Gremienentscheidungen
7. Kausalität beim Fahrlässigkeitsdelikt
8. Kausalität beim Unterlassungsdelikt
V. Abweichende Kausalitätstheorien
VI. Die generelle Kausalität
B. Die objektive Zurechnung
I. Die historische Entwicklung der Lehre von der objektiven Zurechnung
II. Der Grundgedanke der objektiven Zurechnung
III. Argumente für und wider die Lehre von der objektiven Zurechnung in der Wissenschaft
1. Argumente der Befürworter der Lehre
2. Kritikpunkte an der Lehre von der objektiven Zurechnung
3. Stellungnahme
IV. Der Standpunkt der Rechtsprechung zur objektiven Zurechnung
V. Die Lehre von der objektiven Zurechnung im Einzelnen
1. Schaffung einer rechtlich missbilligten Gefahr
a) Der Täter schafft überhaupt keine Gefahr
b) Die Fälle des erlaubten Risikos
c) Die Konstellation der Risikoverringerung
2. Die Realisierung der rechtlich missbilligten Gefahrschaffung im tatbestandlichen Erfolg
a) Der atypische Kausalverlauf
b) Die eigenverantwortliche Selbstgefährdung
c) Eingreifen Dritter in den Geschehensablauf
d) Der Pflichtwidrigkeitszusammenhang
e) Der Schutzzweckgedanke
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
§ 34 Der subjektive Tatbestand
A. Der subjektive Tatbestand als Wesen und Grund strafrechtlicher Zurechnung
B. Grundlegung des subjektiven Tatbestands bei Hegel: Handlung, Vorsatz, Schuld und Absicht
C. Der subjektive Tatbestand beim Versuch und als praktischer Syllogismus
D. Abweichende subjektive Tatbestände: Über die Behandlung von Irrtümern
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
§ 35 Vorsatz
A. Handlungstheoretischer und verbrechenssystematischer Kontext
I. „Kennen“
II. „Wollen“
III. Verbindung von „Kennen“ und „Wollen“
C. Erscheinungsformen
I. Absicht
II. Sicheres Wissen
III. Bedingter Vorsatz
D. Bezugsgegenstand
E. Tatzeitpunkt
F. Zukunftsperspektiven
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
§ 36 Fahrlässigkeit[1]
I. Strafgrund, Kritik, Reformüberlegungen
1. Strafgrund und Unrechtsgehalt
2. Kritik an der Bestrafung fahrlässigen Verhaltens
a) Vereinbarkeit mit dem Bestimmtheitsgrundsatz, Art. 103 II GG
b) Unzulässige Generalisierung und Fiktionalisierung
3. Reformansätze
1. Eigenständigkeit des Fahrlässigkeitsdelikts
2. Abgrenzung zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit
III. Kategorien der Fahrlässigkeit
B. Relevante Tatbestände
C. Voraussetzungen
I. Die Kriterien fahrlässigen Verhaltens
1. Taterfolg
a) Allgemeines
b) Außerachtlassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt
c) Konkretisierungen des Maßstabs
d) Abweichung des tatsächlichen vom sorgfaltsgerechten Verhalten
e) Spezifischer Maßstab: Vertrauensgrundsatz
aa) Vertrauensgrundsatz im Straßenverkehr
bb) Vertrauensgrundsatz in Fällen arbeitsteiligen Zusammenwirkens
cc) Vertrauensgrundsatz im Zusammenhang mit von Dritten begangenen vorsätzlichen Straftaten
dd) Weitergehende Funktion des Vertrauensgrundsatzes
ee) Ausnahmen vom Vertrauensgrundsatz
f) Spezifischer Maßstab: Übernahmeverschulden[190]
3. Objektive Vorhersehbarkeit des Erfolgs
a) Conditio sine qua non
b) Objektive Zurechnung
aa) Allgemeines Lebensrisiko/erlaubtes Risiko
bb) Freiverantwortliche Selbstschädigung und -gefährdung des Opfers
cc) Eigenverantwortliches Dazwischentreten eines Dritten
dd) Schutzzweck der Norm
ee) Pflichtwidrigkeitszusammenhang[235]
a) Allgemeines
b) Rechtfertigende Einwilligung
c) Das „erlaubte Risiko“ als Rechtfertigungsgrund
a) Allgemeines
b) Persönliche Vorwerfbarkeit
aa) Individuelle Vorhersehbarkeit
bb) Individuelle Vermeidbarkeit
c) Unzumutbarkeit sorgfaltsgemäßen Verhaltens
d) Spezielle strafschärfende oder -mildernde Schuldmerkmale
II. Täterschaft und Teilnahme
I. Allgemeines
II. Grundsätzliche Kritik am Kriterium
III. Systematische Stellung
IV. Bestimmung des erlaubten Risikos
E. Gesetze, Normen und Standards als Konkretisierung des Sorgfaltsmaßstabs[324]
I. Staatliche Gesetze
1. Allgemeines
2. Bezugnahme auf „private“ Standards und Normen
III. Indizwirkung der den Sorgfaltsmaßstab konkretisierenden Normen
F. Aktuelle Sonderprobleme
I. „Raser“-Fälle
II. Autonome bzw. Lernende Systeme
III. Sexualdelikte
IV. Medizinstrafrecht
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
9. Abschnitt: Unrechtsausschluss: Rechtswidrigkeit
§ 37 Rechtfertigungsgründe – Grundlagen und Wirkung
A. Allgemeines
B. Die Funktionsweise von Rechtfertigungsgründen
I. Grundbedingung der Strafbarkeit: Widerrechtliches Verhalten
II. Weitere Bedingung: Hinreichend bestimmter Deliktstatbestand
III. Rechtfertigungsgründe als Ausnahme von der Verbotswürdigkeit
C. Das Verhältnis von Tatbestand und Rechtfertigung
1. Ausgangspunkt
2. Würdigung
1. Ausgangspunkt
2. Normlogische Problematik
a) Die Wertungsfreiheit des Deliktstatbestands
b) Das Argument der Appellfunktion
3. Die Schwächen der Gegenposition
a) Negative Tatbestandsmerkmale und Gesetzlichkeitsprinzip
b) Der Duldungspflicht-Einwand
c) Das Problem des monströsen Vorsatzes
III. Der „unechte“ zweistufige Verbrechensaufbau
I. Rechtmäßigkeit des gerechtfertigten Verhaltens
1. Keine strafrechtliche Sanktionierung
2. Rechtfertigung als Eingriffsbefugnis
3. Duldungspflicht des Betroffenen
4. Rechtswidrigkeit und (Sprach-)Logik
1. Die Verbotsbezogenheit der Rechtfertigungsgründe
2. Rechtsgebietsübergreifende Geltung von Rechtfertigungsgründen?
III. Die Unterscheidung zwischen Rechtfertigungs- und Strafunrechtsausschließungsgründen
1. Der Begriff des Strafunrechts
2. Die Existenz von Strafunrechtsausschließungsgründen
I. Ausgangspunkt (rechtmäßig vs. rechtswidrig)
II. Die dritte Kategorie („unverboten“)
III. Das Problem paradoxer Rechtmäßigkeit
I. Grundkonsens: Objektiver und subjektiver Erlaubnistatbestand
II. Der objektive Rechtfertigungstatbestand
1. Erfordernis eines subjektiven Rechtfertigungstatbestands
2. Der Inhalt des subjektiven Rechtfertigungstatbestands
a) Das kognitive Element des Rechtfertigungsvorsatzes
b) Das voluntative Element des Rechtfertigungsvorsatzes
IV. Die Rechtsfolge beim Handeln in Unkenntnis der Rechtfertigungslage
V. Erfordernis eines subjektiven Rechtfertigungselements beim Fahrlässigkeitsdelikt
I. Bestehen eines Legitimationsbedürfnisses
II. Monistische Theorien
III. Dualistische Theorien
IV. Pluralistische Theorien · Stellungnahme
I. Grundsatzfrage: Anwendbarkeit auf Rechtfertigungsgründe?
1. Contra-Argumente
2. Pro-Argumente
3. Kein Verbot ungeschriebener Besserstellung
1. Analogieverbot (Gebot der Beachtung von Erlaubnistatbestandsmerkmalen)
2. Rückwirkungsverbot (Verbot der nachträglichen Beschränkung/Aufhebung von Rechtfertigungsgründen)
3. Bestimmtheitsgebot?
1. Grundsatz: Unanwendbarkeit des Gesetzlichkeitsprinzips
2. Einschränkung bei mittelbarer Täterbelastung?
I. Begriffliches
II. Mehrere Rechtfertigungsgründe bei idealkonkurrierenden Deliktstatbestandsverwirklichungen
III. Grundsatz: Keine Verdrängung
IV. Sonderkonstellationen
1. Vorrangverhältnisse mit Auffangmöglichkeit
2. Verdrängung durch abschließende Erlaubnistatbestände
3. Spezielle Sonder-Erlaubnistatbestände
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
§ 38 Notwehr
I. Die Rechtsfolge der Notwehr
II. Der Normzweck der Notwehr
1. Der überindividualistische Ansatz
2. Der Kombinationsansatz
3. Der individualistische Ansatz
III. Die Notwehr im System der Notrechte
I. Der Angriff auf ein notwehrfähiges Rechtsgut
1. Die Beurteilungsperspektive
2. Die Voraussetzungen des Angriffs
3. Die notwehrfähigen Rechtsgüter
a) Die Notwehrfähigkeit von Individualrechtsgütern
b) Keine Notwehrfähigkeit von Rechtsgütern der Allgemeinheit
II. Die Gegenwärtigkeit
1. Die Beurteilungsperspektive
2. Das unmittelbare Bevorstehen des Angriffs
3. Das Fortdauern des Angriffs
4. Die Gegenwärtigkeit beim Angriff durch Unterlassen
5. Die Gegenwärtigkeit des Angriffs bei Nötigungen und Erpressungen
6. Die antizipierte Notwehr
III. Die Rechtswidrigkeit
1. Der Begriff der Rechtswidrigkeit im Kontext des § 32 StGB
2. Einverständliche Prügeleien
3. Die Rechtswidrigkeit bei Angriffen durch Amtsträger
I. Die Verteidigung
II. Die Erforderlichkeit
1. Die Geeignetheit
2. Das relativ mildestes Mittel
a) Der Einsatz lebensgefährlicher Mittel
b) Mehrere Verteidiger
c) Automatisierte Gegenwehr
d) Die Verteidigung gegen Nötigungen und Erpressungen
3. Die Subsidiarität der Notwehr gegenüber der staatlichen Gefahrenabwehr
III. Die Nothilfe
1. Das Verbot der aufgedrängten Nothilfe
2. Die Pflicht zur Nothilfe
3. Nothilfe gegen tatbestandslose Schwangerschaftsabbrüche
IV. Die Notwehrbefugnis von Amtsträgern
1. Die befugniserweiternde Lösung
2. Die polizeirechtliche Lösung
3. Die Lösung des Rollenwechsels
4. Die Aufspaltungslösung
I. Das Problem des gesetzlichen Anknüpfungspunktes
II. Die Begründung von Notwehreinschränkungen
1. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz als allgemeine Notwehrschranke
a) Das Argument des staatlichen Eingriffs
b) Das Schutzpflichtargument
2. Die Grundgedanken der sozialethischen Einschränkungen
III. Die Fallgruppen
1. Die extrem unverhältnismäßige Verteidigung
2. Der Angriff im Zustand fehlender oder verminderter Schuld
3. Enge persönliche Beziehungen
4. Der provozierte Angriff
a) Der Begriff der Provokation
b) Die Absichtsprovokation
c) Die sonst vorwerfbare Provokation
d) Der provozierte Angriff in Nothilfekonstellationen
e) Die provozierte Provokation
f) Die Abwehrprovokation
5. Die tödliche Notwehr zur Verteidigung von Sachgütern
6. Die sog. Rettungsfolter
a) Die sog. Rettungsfolter durch Amtsträger
b) Die sog. Rettungsfolter durch Private
7. Die Verteidigung gegen Nötigungen und Erpressungen
8. Die aufgedrängte Nothilfe
9. Die unrechtliche Lebensführung
10. Die Nothilfe gegen tatbestandslose Schwangerschaftsabbrüche im Sinne von § 218a
E. Das subjektive Notwehrelement
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
§ 39 Rechtfertigender Notstand
A. Rechte und Pflichten im Notstand[1]
B. Begründungsversuche für eine Rechtfertigung im Notstand
I. Kants Position zum Notrecht
II. Hegels Vorschlag
III. Utilitaristische Interpretation
I. Grundstrukturen und Interessenabwägung
II. Einhegung des Utilitarismus im Notstandsrecht
III. Zur Allgemeinen Defensivnotstandbefugnis
I. „Rechtswidrigkeit“ der Gefahr
II. Nötigungsgefahren von Menschen
III. Notstandshandlungen des Staates?
IV. Angemessenheitsklausel (§ 34 S. 2 StGB)
V. Zur „actio illicita in causa“
I. Zumutbarkeit bei allgemeinen Obhutspflichten
II. Zumutbarkeit bei Sicherungspflichten
III. Zumutbarkeit bei speziellen Obhutspflichten
F. Mit dem rechtfertigenden Notstand verwandte Rechtsinstitute
I. Rechtfertigender Notstand und mutmaßliche Einwilligung
II. Rechtfertigender Notstand und rechtfertigende Pflichtenkollision
III. Rechtfertigender Notstand und (zivilrechtliche) Selbsthilferechte
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
§ 40 Einwilligung
A. Die fragmentarische Regelung der Einwilligung
1. Gem. § 228 StGB bei den Körperverletzungsdelikten
2. Bei anderen Delikten gegen disponible Individualrechtsgüter
II. Ausschluss schon des Straftatbestandes oder erst des Strafunrechts?
1. Tatbestandsmerkmale, die durch eine Einwilligung ausgeschlossen werden?
a) Merkmale, die allgemeinsprachlich auf ein Verhalten ohne Einwilligung des Rechtsgutsinhabers hindeuten
b) Merkmale der strafrechtlichen Missbilligung der tatbestandlichen Folgen und des tatbestandlichen Verhaltens
2. Gründe für eine tatbestandsausschließende Wirkung der Einwilligung?
1. Vollständiger Ausschluss der strafrechtlichen Missbilligung
2. Partieller Ausschluss der strafrechtlichen Missbilligung[23]
a) Ausschluss nur der strafrechtlichen Missbilligung der strafrechtlichen Folgen durch eine objektiv gegebene Einwilligung
b) Ausschluss nur der strafrechtlichen Missbilligung des Verhaltens bei fehlender Einwilligung, aber sorgfaltsgemäßer Annahme einer Einwilligung
I. Disponibles Rechtsgut
II. Die Grenzen der Dispositionsbefugnis bei Individualrechtsgütern
aa) Der Grundsatz: Ausschluss der Dispositionsbefugnis gem. § 216 StGB
(1) Die vom BGH postulierte Dispositionsbefugnis in Fällen der Sterbehilfe
(2) Dispositionsbefugnis gem. §§ 1901a–1904 BGB
(3) Gesetzliche Dispositionsbefugnis im Hinblick auf Unterlassungen
(4) Dispositionsbefugnis analog § 1901a BGB
b) Gegenüber nicht vorsatzdeliktischen Lebensgefährdungen
a) Die Begrenzung der Dispositionsbefugnis für spezielle Eingriffe in die körperliche Integrität
b) Die Begrenzung der Dispositionsbefugnis durch § 228 StGB
III. Die zur Disposition berechtigten Personen
1. Die Dispositionsbefugnis der personensorgeberechtigen Eltern
a) Gesetzliche Dispositionsbefugnisse
b) Gewillkürte Vertretung
IV. Die Zustimmung
a) Die grundsätzliche Entbehrlichkeit einer Zustimmungserklärung
b) Die Voraussetzungen der inneren Zustimmung
aa) Die kognitive Voraussetzung: Die Kenntnis der tatbestandsmäßigen Gefahr für das Rechtsgut
(1) Einsichts- und Urteilsfähigkeit
(2) Kein einwilligungsrelevanter rechtsgutsbezogener Irrtum
bb) Die voluntative Voraussetzung: Die Entscheidung für die tatbestandsmäßige Gefahr
2. Die nur erklärte, nicht innerliche Zustimmung
V. Die Freiwilligkeit der Zustimmung als Wirksamkeitsvoraussetzung?
VI. Bedingungen als Zustimmungsvoraussetzungen?
VII. Die zeitliche Kongruenz von Zustimmung und Tatbegehung
1. Kein Ausschluss des Strafunrechts durch eine nachträgliche Zustimmung
2. Kein Ausschluss des Strafunrechts durch eine hypothetische Einwilligung
a) Kein Ausschluss des Folgenunrechts
b) Kein Ausschluss des Verhaltensunrechts
c) Kein Ausschluss des nötigen Zusammenhangs zwischen Verhaltens- und Folgenunrecht
VIII. Notwendigkeit eines subjektiven Rechtfertigungselements?
1. Das kognitive Rechtfertigungselement als Teil der sorgfaltsgemäßen ex-ante-Sicht oder als nur vorsatzausschließender Erlaubnistatbestandsirrtum
2. Die Irrelevanz des voluntativen Rechtfertigungselements für den Ausschluss des Strafunrechts
D. Das tatbestandsausschließende Einverständnis: ein Fall der Einwilligung
I. Deliktssystematische Gemeinsamkeiten von Einverständnis und Einwilligung
II. Die funktionelle Entsprechung von Einverständnis und Einwilligung
III. Widersprüchliche Bewertungen bei unterschiedlichen Wirksamkeitsvoraussetzungen von Einverständnis und Einwilligung
I. Das Prinzip des Strafunrechtsausschlusses bei der mutmaßlichen Einwilligung
II. Die Rechtsfolge der mutmaßlichen Einwilligung: Ausschluss des Verhaltensunrechts, nicht des Folgenunrechts
III. Die Voraussetzungen des Strafunrechtsausschlusses durch mutmaßliche Einwilligung
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
§ 41 Rechtfertigende Pflichtenkollision
I. Die Situation der Pflichtenkollision
II. Die Kollision verschiedenrangiger Rechtspflichten
III. Die Kollision gleichrangiger oder geringfügig differierender Rechtspflichten
I. Die Situation der Kollision gleichrangiger Handlungspflichten
1. Entschuldigung
2. Rechtfertigung
3. Ausschluss des Tatbestands
4. Der Ausschluss der Rechtswidrigkeit
5. Rechtsfreier Raum
I. Die relevante Fallsituation
II. Die rechtliche Beurteilung der Kollision gleichrangiger Unterlassungspflichten
I. Die relevante Fallsituation
II. Die rechtliche Beurteilung der Kollision gleichrangiger Handlungs- und Unterlassungspflichten
I. Die grundsätzliche Problematik
II. Die Auffassung des BVerfG
III. Auseinandersetzung
1. Das Brett des Karneades[61]
2. Der Mignonette-Fall
3. Der Bergsteiger-Fall
1. Der Euthanasie-Fall
2. Der Flugzeugabschuss-Fall
III. Die Rettung eines Familienmitglieds unter Vernichtung des Lebens Dritter
1. Garantenpflicht und allgemeine Hilfspflicht
2. Kollision von Garantenpflichten
G. Verallgemeinerungsfähige Lösungsprinzipien
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
§ 42 Sonstige Rechtfertigungsgründe
A. Einheitliches oder gespaltenes Modell des Unrechtsausschlusses?
I. Historie und Anwendungsfelder
II. Grundgedanke und Struktur des Rechtfertigungstatbestands
III. Voraussetzungen
1. Pflichtgemäße Prüfung als Rechtfertigungsvoraussetzung
2. Weitere Probleme um die mutmaßliche Einwilligung
3. Speziell: mutmaßliche Einwilligung bei einwilligungsunfähigen Schwerkranken/Moribunden
I. Einführung
II. Exposition: Diskussion vorgeblicher Tatbestands-Elemente
III. Schluss
I. Einleitung und Struktur
1. Objektive Rechtfertigungsseite
2. Subjektive Rechtfertigungsseite
3. Prüfungspflicht
1. Grundsätzliches
2. Kein deutliches Überwiegen des zu rettenden Interesses
1. Kein Unrecht?
2. Schuldausschluss
III. Konflikt nicht-gleichrangiger Pflichtenappelle
1. Widerstandsrecht
2. Elementarschutz der verfassungsrechtlichen Grundordnung
3. Gegen offenkundigen Umsturz
4. Deutschenvorbehalt
II. Irrtum
III. Andere Fälle von Staatsnothilfe?
I. Problemaufriss und Normexegese
1. Tatbestands-Voraussetzungen
2. Tatverdacht oder Tat erforderlich?
3. Verhaftungsgrund
4. Mitteleinsatz
II. Irrtum/Verhältnis zur EMRK
I. Problemaufriss
II. Weisung, Befehl
III. Schusswaffengebrauch
I. Problemaufriss
II. Leitgedanke
J. Ausnahme
I. Anlass
II. Problem und Andeutung einer Lösung
I. Übersicht
II. Leitgedanke
1. Typologie
2. Verhältnismäßigkeit
3. Subjektiver Rechtfertigungsseite
4. Unterschiedliche Schneidigkeit in den Sparten der ordentlichen Gerichtsbarkeit
IV. Erlaubnistatbestand-Irrtum
V. Selbsthilfe des Besitzers
VI. Unbestellte Leistungen
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
10. Abschnitt: Schuldbegründung und Schuldausschluss
§ 43 Grundlagen der Schuld
A. Einleitung
I. Freiheitsorientierte Schuldbegriffe
a) Etablierte Begründungsmodelle und ihre Reichweite
b) Freiheitsdiagnose zwischen Empirie und normativen Ansprüchen
a) Sühnetheorie
b) Vergeltung/Schuldausgleich
c) Tadel
II. „Neo-klassische“ Schuldverständnisse
III. Der „soziale Schuldbegriff“
1. Grundlagen
2. Zentrale Einwände gegen ein systemtheoretisches Schuldverständnis
1. Grundlagen
2. Freiheit und Schuldfähigkeit
3. Sozialwissenschaftliche Analyse als Grundlage normativer Diskussion
1. Moderne Hirnforschung als Ausgangspunkt für ein Zweckstrafrecht
2. Verhältnismäßigkeitsprinzip anstelle Schuldprinzip
3. Unrechtsvorwurf anstelle Schuldvorwurf
I. Die Freiheitsfrage
II. Neuere Schuldmodelle
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
§ 44 Schuldfähigkeit
I. Historische Grundlagen[1]
II. Grundsätze des aktuellen Rechts
III. Strafrechtliche Schuld und Willensfreiheit
IV. Aufbau der §§ 20, 21 StGB
V. Biologisch-psychologische Ebene
1. Krankhafte seelische Störung
2. Tiefgreifende Bewusstseinsstörungen
3. Schwachsinn
4. Schwere andere seelische Abartigkeit
VI. Einsichts- und Steuerungsfähigkeit
1. Einsichtsfähigkeit
2. Steuerungsfähigkeit
3. Feststellung der Einsichts- und Steuerungsfähigkeit durch Sachverständige und Richter
4. Die verminderte Schuldfähigkeit (§ 21 StGB)
VII. Koinzidenzprinzip und Vorverschulden
1. Abgrenzung zur Schuldunfähigkeit nach Versuchsbeginn
2. Actio libera in causa
3. Vollrausch (§ 323a StGB)
4. Wiedererlangung der Schuldfähigkeit
1. Alle Straftaten
2. Deliktsbezogene Anwendungshäufigkeit
IX. Rechtsfolgen im Überblick[169]
B. Psychische Störung als Voraussetzung für die nachträgliche Sicherungsverwahrung oder die Unterbringung nach dem Therapieunterbringungsgesetz
C. Begutachtung bei Kooperationsverweigerung
D. Verhältnis zu § 3 JGG und § 19 StGB
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
§ 45 Entschuldigungs- und Strafausschließungsgründe
I. Allgemeines
1. Entstehungsgeschichte
2. Rechtsnatur
a) Die objektiven Voraussetzungen
aa) Der intensive Notwehrexzess
bb) Der nachzeitig-extensive Notwehrexzess
cc) Der vorzeitig-extensive Notwehrexzess
dd) Der räumlich-extensive Notwehrexzess
ee) Der Putativnotwehrexzess
aa) Verteidigungswille
bb) Vorsatz oder Fahrlässigkeit
cc) Handeln aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken
4. Die Rechtsfolgen des § 33 StGB
5. Anwendbarkeit des § 33 StGB auf andere Rechtfertigungsgründe?
1. Entstehungsgeschichte
2. Rechtsnatur
a) Gegenwärtige Gefahr für Leib, Leben, Freiheit des Täters, eines Angehörigen oder einer anderen ihm nahe stehenden Person
aa) Die notstandsfähigen Rechtsgüter Leben, Leib, Freiheit
bb) Die gegenwärtige Gefahr
cc) Gefahr für den Täter, einen Angehörigen oder für eine dem Täter nahe stehende Person
b) Die Erforderlichkeit der Notstandshandlung
c) Die Gefahrabwendungsabsicht
d) Die Zumutbarkeitsklausel in § 35 Abs. 1 S. 2 StGB
aa) Gefahrverursachung durch den Täter
bb) Besonderes Rechtsverhältnis
cc) Weitere dem § 35 Abs. 1 S. 2 StGB unterfallende Konstellationen
4. Die Rechtsfolgen des § 35 StGB
5. Der Putativnotstand gemäß § 35 Abs. 2 StGB
IV. Der übergesetzliche entschuldigende Notstand
1. Allgemeine Bemerkungen
2. Die Voraussetzungen des übergesetzlichen entschuldigenden Notstands
V. Gewissensnot als Entschuldigungsgrund?
VI. Dienstliche Weisung
1. Verbindliche Weisung
2. Unverbindliche Weisung
VII. Besondere Entschuldigungsgründe bei einzelnen Delikten
1. § 258 Abs. 5 StGB
2. §§ 139 Abs. 3 S. 1, 258 Abs. 6 StGB
VIII. Die Unzumutbarkeit normgemäßen Verhaltens
I. Allgemeines
II. Einzelne Strafausschließungsgründe
III. Irrtum und Strafausschließungsgründe
IV. In dubio pro reo und Strafausschließungsgründe
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
11. Abschnitt: Irrtümer im Strafrecht im Einzelnen
§ 46 Irrtümer auf Tatbestandsebene
I. Der Begriff des Tatbestands
1. Bezugspunkte eines Irrtums
2. Der Irrtum als Bewusstseinsform
a) Der Wahrnehmungsirrtum
b) Sonstige Irrtümer
1. Geschichtliche Entwicklung
a) Abs. 1 (Tatbestandsirrtum)
b) Absatz 2 (Irrige Annahme privilegierender Umstände)
1. Das Verhältnis zu § 15 StGB
2. Das Verhältnis zu § 17 StGB
3. Kritik des legislativen Konzepts
III. Das Verhältnis zu § 22 StGB
IV. Das Verhältnis zu § 20 StGB
V. Sonderregelungen
I. Allgemeines zum Begriff der Tatumstände
II. Umstände, die den Täter betreffen
1. Umstände, die das Angriffsobjekt betreffen
2. Sonstige Umstände der Tatsituation
IV. Die Handlung oder Unterlassung des Täters
a) Rechtsprechung und überwiegendes Schrifttum
b) Die Lehre von der Vorsatzzurechnung
c) Andere Konzepte zu der Frage, welche Abweichungen wesentlich sind
2. Kritik und Alternative
3. Dolus-generalis-Fälle
4. Identitätsirrtümer
a) Aberratio ictus und Error in persona in der herrschenden Dogmatik
b) Kritik und Alternative
c) Der bewusste Objektwechsel nach Tatbeginn
5. Der Irrtum über Tatbestandsalternativen
6. Zusammenfassung zu den Abweichungsfällen
a) Der Unterschied zwischen diesen Merkmalen
b) Denkbare Bezugspunkte des Vorsatzes
c) Der Vorsatz bei normativen Tatbestandsmerkmalen nach h.M
d) Der Vorsatz bei Blankettmerkmalen nach h.M
e) Kritik und abweichende Ansichten
2. Genehmigungserfordernisse
a) Die irrige Annahme einer Genehmigung
b) Das Verkennen eines Genehmigungserfordernisses
c) Kritik
3. Das Handeln entgegen einer Untersagung
4. Die unklare Rechtslage
I. Unmittelbare Anwendung des § 16 Abs. 2 StGB
II. Entsprechende (analoge) Anwendung des § 16 Abs. 2 StGB
I. „Doppelter Tatbestandsirrtum“?
II. Tatbestandsirrtum und Wahndelikt
I. Völkerstrafrecht[233]
II. Europäisches Recht
1. Deutschsprachiger Rechtskreis (Österreich und Schweiz)
2. Osteuropa (Polen und Ungarn)
3. Romanischer Rechtskreis (Frankreich, Italien, Spanien und Chile)
4. Rechtskreis des Common law (Großbritannien und Vereinigte Staaten)
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
§ 47 Irrtümer auf der Ebene der Rechtswidrigkeit
A. Struktur des Erlaubnistatbestandsirrtums
B. Gesetzes- und Rechtsprechungsgeschichte
1. Strenge und eingeschränkte Vorsatztheorie
2. Modifizierte Vorsatztheorie
1. Strenge vs. eingeschränkte Schuldtheorie
2. Grundgedanke und Spielarten der eingeschränkten Schuldtheorie
aa) Grundgedanke und Leistungsfähigkeit
bb) Kritik
b) Analoge Anwendung des § 16 StGB (Gesamtanalogie)
c) Rechtsfolgenverweisende Schuldtheorie
3. Strenge Schuldtheorie
a) „Unselbstständige Schuldtheorie“
b) „Modifizierte“ strenge Schuldtheorie
D. Kriterien zur Entscheidung des Theorienstreits
I. Maßstab der gesetzlichen Vorgaben
II. Dogmatische Konsistenz
1. Die „Stufen“ der Straftat
2. Abspaltung des „Vorsatzunrechts“ bzw. der „Vorsatzschuld“ vom „Vorsatz“
III. Angemessenheit der rechtlichen Folgen
1. Vorsatz- oder Fahrlässigkeitsstrafbarkeit des Täters
2. Teilnehmerstrafbarkeit
a) Differenzen zwischen den unterschiedlichen Theorien
b) Wertung der unterschiedlichen Ergebnisse
IV. Gesamtbilanz
I. Zweifel hinsichtlich des Vorliegens einer rechtfertigenden Situation
II. Abergläubische Fehlvorstellungen
III. Irrtum im Bereich normativer Merkmale
IV. „Doppelirrtum“
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
§ 48 Verbotsirrtum und sonstige Irrtümer
I. Struktur des Verbotsirrtums
II. Dogmen- und gesetzesgeschichtliche Entwicklung
I. Verhältnis von Unrechtsbewusstsein und Verbotsirrtum
II. Normkenntnis und Normorientierung
III. Gegenstand des Unrechtsbewusstseins
1. Sittenordnung
2. Sozialschädlichkeit der Handlung
3. Materiale Wertordnung des Rechts
4. Unrechtsbewusstsein als Bewusstsein des Verstoßes gegen ein sanktionsbewehrtes rechtliches Verbot
aa) Rechtliche Korrigierbarkeit und rechtliche Sanktionierbarkeit
bb) Ordnungswidrigkeitenrecht und Disziplinarrecht
b) Kenntnis der sozialen Bedeutung des Verbots
5. Unrechtsbewusstsein im „Unrechtsstaat“
1. Aktualität des Unrechtsbewusstseins
2. Bedingtes Unrechtsbewusstsein (Unrechtszweifel)
3. Tatbestandsbezogenheit des Unrechtsbewusstseins
4. Überzeugungs- und Gewissenstäter
I. Direkter und indirekter Verbotsirrtum
II. Irrtum über die Gültigkeit der Verbotsnorm
III. Subsumtionsirrtum
IV. Irrtum über objektive Bedingungen der Strafbarkeit
V. Irrtum bei kontroverser Rechtsprechung
I. Reales und potenzielles Unrechtsbewusstsein
II. Normative und psychologische Kriterien
III. Moralische Vergewisserung und Informationsbeschaffung
1. Individualisierende oder generalisierende Beurteilung
2. Vergleich zum Maßstab der Tatfahrlässigkeit
V. Voraussetzungen der Vermeidbarkeit
1. Anlass zur Überprüfung
2. Anforderungen an die Prüfung
aa) Rückwirkende Änderung einer gefestigten Rechtsprechung
bb) Inkonsistente Rechtsprechung von Gerichten unterschiedlichen Ranges
cc) Inkonsistente Rechtsprechung von Gerichten gleicher Rangordnung
dd) Vertrauen auf rechtfertigende (Einzel-)Entscheidungen
b) Einholen von Auskünften
aa) Auskunftspersonen
bb) Zweifel infolge besonderer Umstände
cc) Zur Relevanz hypothetischer Auskünfte
VI. Vermeidbarkeit des Verbotsirrtums bei naturrechtlich begründeter Strafbarkeit
VII. Fakultative Strafmilderung
I. Fahrlässigkeitsdelikte
II. Nebenstrafrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht
F. Irrtum über die Rechtswidrigkeit der Tat bei Handeln auf Befehl
G. Prozessuale Fragen
I. Anlass zur Prüfung eines Verbotsirrtums
II. Anforderungen an den Nachweis eines Verbotsirrtums
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
Stichwortverzeichnis
Register der Gesetzesverweise
AEUV. Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
AMG. Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (Arzneimittelgesetz – AMG) [1]
Anmerkungen
AO. Abgabenordnung (AO)
AWG. Außenwirtschaftsgesetz [3]
Anmerkungen
AktG. Aktiengesetz
AufenthG. Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz – AufenthG) [4][5]
Anmerkungen
BBG. Bundesbeamtengesetz (BBG) [6]
Anmerkungen
BGB. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) [7]
Anmerkungen
BJagdG. Bundesjagdgesetz
Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln (Betäubungsmittelgesetz – BtMG)
EGBGB. Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche
EMRK. Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten [10]
Anmerkungen
FPersG. Gesetz über das Fahrpersonal von Kraftfahrzeugen und Straßenbahnen (Fahrpersonalgesetz – FPersG)
GG. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
GO NRW. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
GVG. Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)
GWB. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
GenTG. Gesetz zur Regelung der Gentechnik (Gentechnikgesetz – GenTG)
GmbHG. Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG)
HGB. Handelsgesetzbuch (HGB)
IRG. Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG)
IfSG. Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG)
JGG. Jugendgerichtsgesetz (JGG) [11]
Anmerkungen
KWG. Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz – KWG)
KastrG. Gesetz über die freiwillige Kastration und andere Behandlungsmethoden
KrWG. Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG) [12]
Anmerkungen
Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch – LFGB) [13][14][15]
Anmerkungen
LuftSiG. Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG)
MarkenG. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz – MarkenG) [16]
Anmerkungen
OWiG. Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)
PBefG. Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
PatG. Patentgesetz
SG. Gesetz über die Rechtsstellung der Soldaten (Soldatengesetz – SG)
StGB. Strafgesetzbuch (StGB)
StPO. Strafprozessordnung (StPO)
StVG. Straßenverkehrsgesetz (StVG)
StVO. Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
StVollzG. Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung (Strafvollzugsgesetz – StVollzG)
TPG. Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen und Geweben (Transplantationsgesetz – TPG) [17]
Anmerkungen
TierSchG. Tierschutzgesetz
UStG. Umsatzsteuergesetz (UStG)
UrhG. Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz)
VwGO. Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
VwVfG. Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
WaffG. Waffengesetz (WaffG)
WStG. Wehrstrafgesetz (WStG)
ZDG. Gesetz über den Zivildienst der Kriegsdienstverweigerer (Zivildienstgesetz – ZDG)
ZPO. Zivilprozessordnung (ZPO)
Anmerkungen
Отрывок из книги
Herausgegeben von
Eric Hilgendorf, Hans Kudlich und Brian Valerius
.....
[151]
Frisch, GA 2019, 181 ff., 196 ff.
.....