Handbuch des Strafrechts
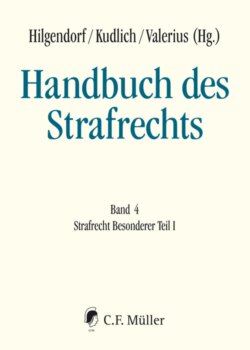
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Jörg Eisele. Handbuch des Strafrechts
Handbuch des. Strafrechts
Impressum
Vorwort
Inhalt Band 4
Verfasser
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Verzeichnis der Festschriften/Festgaben. und Gedächtnisschriften
1. Abschnitt: Schutz von Leib und Leben
§ 1 Tötungsdelikte
I. Geschichte
II. Reform
I. Tatbestände
1. Tatobjekt Mensch
2. Täter-Opfer-Differenz
3. Taterfolg Tod
4. Tathandlung Tötung
1. Totschlag
a) Geschichte
b) Reformbestrebungen
c) Verhältnis zum Totschlag
d) Grundgedanken der Mordmerkmale
e) Mordmerkmale § 211 Abs. 2 StGB – 1. Gruppe
aa) Mordlust
bb) Zur Befriedigung des Geschlechtstriebs
cc) Habgier
dd) Sonstige niedrige Beweggründe
f) Mordmerkmale § 211 Abs. 2 StGB – 2. Gruppe
aa) Heimtücke
bb) Grausamkeit
cc) Mit gemeingefährlichen Mitteln
aa) Allgemeines
bb) Zur Ermöglichung einer anderen Straftat
cc) Zur Verdeckung einer anderen Straftat
h) Unterlassen
i) Täterschaft und Tatbeteiligung
j) Versuch und Vorbereitung
k) Sanktionen
l) „Rechtsfolgenlösung“
m) Mordähnlicher besonders schwerer Fall des Totschlags (§ 212 Abs. 2 StGB)
a) Geschichte
b) Systematik
c) Grundtatbestand
d) Qualifikationen
e) Täterschaft und Teilnahme
f) Versuch
1. Fahrlässige Tötung
2. Todeserfolgsqualifizierte Delikte
3. Lebensgefährdungsdelikte
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
§ 2 Sterbehilfe[1]
I. Recht auf Leben
II. Menschenwürde
III. Selbstbestimmungsrecht
I. Beginn des menschlichen Lebens
II. Ende des menschlichen Lebens
1. Abgrenzung Sterbehilfe im engeren und im weiteren Sinn
a) Direkte aktive Sterbehilfe
b) Indirekte aktive Sterbehilfe
a) Begriff
b) Technischer Behandlungsabbruch als Unterlassen
1. Der normativ-wertende Oberbegriff des Behandlungsabbruchs
2. Würdigung
I. Prinzipielle Straflosigkeit der Suizidbeihilfe
1. Allgemeines
2. Objektiver Tatbestand
3. Subjektiver Tatbestand
4. Strafausschliessungsgrund des Abs. 2
5. Kritik
I. Verfassungsrechtliche Erwägung
1. Indirekte aktive Sterbehilfe
2. Direkte aktive Sterbehilfe
3. Passive Sterbehilfe
III. Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
§ 3 Schwangerschaftsabbruch[1]
A. Rechtsgut und Angriffsobjekt
B. Das Lebensrecht eines ungeborenen Kindes
I. Schutzumfang Ungeborener nach dem Grundgesetz und nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
II. Schutzumfang der Schwangeren nach dem Grundgesetz und nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
III. Schutzumfang Ungeborener nach der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
IV. Schutzumfang Ungeborener nach der Charta der Grundrechte der Europäischen Union
V. Schutzumfang Ungeborener nach dem Internationalen Pakt über die bürgerlichen und politischen Rechte
VI. Schutzumfang Ungeborener nach dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes
C. Beginn des menschlichen Lebens
I. Schutzbereich im Allgemeinen
II. Schutzwürdigkeit und Schutzstadien
III. Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruchs (§ 218 StGB)
IV. Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs (§ 218a StGB)
1. Tatbestandsausschluss (Abs. 1)
2. Indikationenmodell (Abs. 2 und 3)
a) Medizinisch-soziale Indikation (Abs. 2)
b) Kriminologische Indikation (Abs. 3)
c) Exkurs: Embryopathische Indikation
d) Exkurs: Schwangerschaftsabbruch bei minderjährigen Schwangeren
e) Exkurs: Schwangerschaftsabbruch bei einer einwilligungsunfähigen Schwangeren
f) Spätabbruch
3. Persönlicher Strafausschlussgrund der Schwangeren (Abs. 4)
V. Schwangerschaftsabbruch ohne ärztliche Feststellung oder mit unrichtiger ärztlicher Feststellung (§ 218b StGB)
1. Verstoß gegen das Feststellungsverfahren (Abs. 1)
a) Schwangerschaftsabbruch ohne ärztliche Feststellung (Abs. 1 S. 1)
b) Unrichtige ärztliche Indikationsfeststellung (Abs. 1 S. 2)
2. Feststellungsverbot des Arztes (Abs. 2)
a) Endgültige Untersagung der Indikationsfeststellung
b) Vorläufige Untersagung der Indikationsfeststellung
VI. Ärztliche Pflichtverletzung bei einem Schwangerschaftsabbruch (§ 218c StGB)
1. Gelegenheit zur Begründung des Abbruchsverhaltens (Abs. 1 Nr. 1)
2. Ärztliche Beratung (Abs. 1 Nr. 2)
3. Ärztliche Feststellung des Schwangerschaftsabbruchs (Abs. 1 Nr. 3)
4. Eigene Beratung (Abs. 1 Nr. 4)
VII. Beratung der Schwangeren in einer Not- und Konfliktlage (§ 219 StGB)
1. Durchführung des Beratungsgesprächs (Abs. 1)
2. Ausstellen der Beratungsbescheinigung (Abs. 2)
3. Strafbarkeit bei Verstoß gegen § 219 StGB
VIII. Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft (§ 219a StGB)
1. Strafbare Handlungen (Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2)
2. Ausschluss der Strafbarkeit (Abs. 2 und 3)
IX. Inverkehrbringen von Mitteln zum Abbruch der Schwangerschaft (§ 219b StGB)
X. Praxis des Schwangerschaftsabbruchs in Deutschland
I. Menschenwürde und Recht auf Leben
II. Regelungen des Schwangerschaftsabbruchs im Schweizerischen Strafgesetzbuch
1. Strafbarer Schwangerschaftsabbruch (Art. 118 schwStGB)
2. Strafloser Schwangerschaftsabbruch (Art. 119 schwStGB)
3. Übertretungen durch Ärzte (Art. 120 schwStGB)
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
§ 4 Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit[1]
A. Einführung
I. Verfassungsrechtliche Vorgaben aus Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG
II. Begriff, gesellschaftliche Bewertung und Formen der Gewalt
III. Praktische Bedeutung des Bereichs
IV. Kriminologische Einordnung
1. Rechtsgut und Schutzobjekt
a) Grundtatbestand des § 223 Abs. 1 StGB
b) Qualifikationen wegen besonderer Gefährlichkeit (§ 224 StGB)
c) (Erfolgs-)Qualifikationen wegen dauerhafter schwerer Folgen (§ 226 StGB)
d) Erfolgsqualifikation wegen eingetretener Todesfolge (§ 227 StGB)
e) Beteiligung an einer Schlägerei (§ 231 StGB)
f) Weitere Tatbestände (§§ 225, 226a, 229 StGB)
3. Verhältnis zu anderen Tatbeständen
4. Strafrahmen und Strafzumessung in der Praxis
1. Bagatellgrenze
2. Eigenverantwortliche Selbstgefährdung und. einverständliche Fremdgefährdung
3. Kausalität und Produkthaftung
1. Rechtfertigungsgründe, erlaubte Verletzungen
2. Einwilligung und ihre Grenzen
a) Grenze des § 228 StGB
b) Einzelne Fallgruppen
3. Der ärztliche Heileingriff im Besonderen
a) Einordnung und rechtliche Behandlung
b) Mutmaßliche Einwilligung
c) Hypothetische Einwilligung
4. Amtsbefugnisse im Besonderen
1. Präventionsorientierung
2. Häusliche Gewalt
3. Besonderer Schutz bestimmter Berufsgruppen
4. Reformbestrebungen des Gesetzgebers
I. Historische Entwicklung der Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit im deutschen StGB
II. Rechtsvergleich
III. Bezüge zum Strafverfahrensrecht
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
2. Abschnitt: Schutz der persönlichen Freiheit
§ 5 Nötigung, Bedrohung und Zwangsheirat
A. Einführung
I. Verfassungsrechtliche Grundfragen
II. Rechtshistorische Hintergründe, Gefahren und rechtspolitische Überlegungen
1. Geschützte Rechtsgüter
2. Mittel der Einflussnahme auf das Opfer
aa) Begriffsbestimmung
bb) Erscheinungsformen der Gewalt
aa) Begriffsbestimmung
bb) Erscheinungsformen der Drohung mit einem empfindlichen Übel
2. Nötigung(shandlung) und Nötigungserfolg
a) Grundlagen
b) Ausgangsdefinition und Bezugspunkte der Verwerflichkeit
c) Gesamtwürdigung und weitere Kriterien
4. Subjektiver Tatbestand
a) Menschliche und sonstige Blockaden
b) Nötigungen im Straßenverkehr
c) Nötigungen im Rechtsverkehr
1. Online-Demonstrationen
2. Mobbing
3. Reformbestrebungen
1. Tatbestände zum Schutz der persönlichen Freiheit
2. Mittel der einfachen Nötigung
3. Eingrenzung des Anwendungsbereichs der Nötigung
1. Tatbestände zum Schutz der persönlichen Freiheit
2. Mittel der einfachen Nötigung
3. Eingrenzung des Anwendungsbereichs der Nötigung
E. Bezüge zum Strafverfahrensrecht
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
§ 6 Freiheitsberaubung und Nachstellung
A. Einführung
B. Rechtshistorische Grundfragen
C. Freiheitsberaubung
I. Geschütztes Rechtsgut
1. Inhalt der körperlichen Fortbewegungsfreiheit
2. Anforderungen an den Fortbewegungswillen
1. Tatopfer: Anderer Mensch
2. Tathandlungen
a) Einsperren
b) Freiheitsberaubung auf andere Weise
c) Unterlassen
3. Taterfolg: Freiheitsberaubung
4. Normative Korrekturen
a) Gewalt
b) Drohungen
c) Psychischer Zwang und List
5. Tatbestandsausschließendes Einverständnis
6. Subjektiver Tatbestand
III. Rechtswidrigkeit
IV. Beteiligung
V. Vollendung und Versuch
VI. Strafrahmenverschiebungen und Strafzumessung
1. Freiheitsberaubung von über einer Woche (§ 239 Abs. 3 Nr. 1 StGB)
2. Verursachung einer schweren Gesundheitsschädigung oder des Todes (§ 239 Abs. 3 Nr. 2, Abs. 4 StGB)
VII. Konkurrenzfragen
D. Nachstellung
1. Kriminologische Aspekte
a) § 238 StGB als symbolisches Strafrecht?
b) Vorrangige Regelung im Gewaltschutzgesetz?
c) Rechtspolitische Bedenken gegen die konkrete Ausgestaltung
3. Verfassungsrechtliche Aspekte
II. Geschütztes Rechtsgut
III. Tatbestandliche Voraussetzungen
1. Grundtatbestand der Nachstellung
a) Fälle der Kontaktaufnahme (§ 238 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 StGB)
aa) Aufsuchen der räumlichen Nähe (Nr. 1)
bb) Versuch der Kontaktherstellung (Nr. 2)
cc) Mittelbare Kontaktherstellung unter missbräuchlicher Verwendung personenbezogener Daten (Nr. 3)
b) Bedrohen des Opfers, eines Angehörigen oder einer nahestehenden Person (§ 238 Abs. 1 Nr. 4 StGB)
c) Auffangtatbestand für vergleichbare Handlungen (§ 238 Abs. 1 Nr. 5 StGB)
d) Beharrlichkeit der Nachstellung
aa) Dogmatische Bedeutung
bb) Inhaltliche Bedeutung
f) Eignung zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Lebensgestaltung des Opfers
g) Subjektiver Tatbestand
a) Strafschärfende Folgen
b) Opferkreis
c) Erfordernis eines gefahrspezifischen Zusammenhangs
1. Versuch und Vollendung
2. Beteiligung
3. Verhältnis zu anderen Tatbeständen
V. Bezüge zum Strafverfahrensrecht
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
§ 7 Erpresserischer Menschenraub und Geiselnahme
A. Einführung
I. Entstehungsgeschichte
II. Internationale Bezüge
I. Struktur
II. Rechtsgut
1. Das Verhältnis der beiden Tathandlungen
2. Weitere Anforderungen an das Sich-Bemächtigen
a) List als Tathandlung
b) Bereits bestehendes Herrschaftsverhältnis
c) Person des Tatopfers
3. Restriktive Auslegung im Zwei-Personen-Verhältnis
aa) Frühere Ansätze
bb) Stabile Zwischenlage als Tatbestandsvoraussetzung
cc) Kritik an dem Erfordernis einer stabilen Zwischenlage
b) Alternative Konzepte im Schrifttum
aa) Modifikationen bei der Nötigungshandlung
bb) Lösung auf Konkurrenzebene
c) Fazit
II. Besondere Voraussetzungen des § 239a Abs. 1 Var. 1 StGB (Entführungstatbestand)
a) Voraussetzungen der Erpressung
b) Raub als in Aussicht genommene Tat
a) Sorge um das Wohl des Opfers
b) Auswirkungen auf die Erpressungshandlungen
3. Ausnutzen: Funktionaler und zeitlicher Zusammenhang
1. Konstellationen des Ausnutzungstatbestands
2. Schaffung der Entführungs- bzw. Bemächtigungslage
3. Ausnutzung zu einer Erpressung
a) Zeitlicher und funktionaler Zusammenhang
b) Versuchte oder vollendete Erpressungstat
4. Einschränkungen des Tatbestandes
5. Subjektiver Tatbestand
IV. Erfolgsqualifikation nach § 239a Abs. 3 StGB
1. Opfer i.S.d. Erfolgsqualifikation
2. Gefahrspezifischer Zusammenhang
a) Handlungen des Täters
b) Handlungen des Opfers
c) Handlungen eines Dritten
1. Beteiligung
2. Versuch und Vollendung
3. Tätige Reue
aa) Handlung des Zurückgelangenlassens
bb) Lebenskreis des Opfers
cc) Verzicht auf die erstrebte Leistung
dd) Freiwilligkeit der Tataufgabe
b) § 239a Abs. 4 S. 2 StGB
c) Folgen der tätigen Reue
4. Strafzumessung
5. Konkurrenzen
VI. Weitere Vorschriften
E. Geiselnahme (§ 239b StGB)
1. Objektiver Tatbestand
2. Subjektiver Tatbestand
a) Nötigungsmittel
b) Adressat der Nötigung
c) Ziel der Nötigung
d) Tatbestandliche Reduktionen
II. Besondere Voraussetzungen des § 239b Abs. 1 Var. 2 StGB (Ausnutzungstatbestand)
1. Beteiligung und Versuchsstrafbarkeit
2. Verweis in § 239b Abs. 2 auf § 239a Abs. 2 bis 4 StGB
3. Konkurrenzen
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
§ 8 Sonstige Freiheitsdelikte
1. Rechtspolitische Hintergründe
2. Internationale Vorgaben
3. Gesetzgebung zu den Menschenhandelsdelikten
4. Der Begriff der Ausbeutung
5. Die einzelnen Ausbeutungsformen
a) Ausbeutung der Sexualität
b) Beschäftigung zu ungünstigen Arbeitsbedingungen
c) Ausbeutung der Bettelei
d) Ausbeutung bei der Begehung von mit Strafe bedrohten Handlungen
e) Sklaverei, Leibeigenschaft, Schuldknechtschaft
f) Rechtswidrige Organentnahme
1. Überblick
2. Die Grundfälle des Menschenhandels (§ 232 Abs. 1 StGB)
3. Schwerer Menschenhandel (§ 232 Abs. 2 und 3 S. 1 StGB)
4. Besonders schwerer Menschenhandel (§ 232 Abs. 3 S. 2 StGB)
1. Überblick
2. Die Grundfälle der Zwangsprostitution (§ 232a Abs. 1 StGB)
3. Schwere Zwangsprostitution (§ 232a Abs. 3 und 4 StGB)
4. Besonders schwere Zwangsprostitution (§ 232a Abs. 3 und 4 StGB)
5. Die Freierstrafbarkeit (§ 232a Abs. 6 StGB)
IV. Zwangsarbeit (§ 232b StGB)
V. Ausbeutung der Arbeitskraft (§ 233 StGB)
1. Der Grundtatbestand der Arbeitsausbeutung
2. Qualifizierte Arbeitsausbeutung
3. Vorschubleisten zur Arbeitsausbeutung
VI. Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung (§ 233a StGB)
VII. Bezüge zum Strafverfahrensrecht
VIII. Überblick über die Rechtslage in Österreich und in der Schweiz
1. Rechtslage in Österreich
2. Rechtslage in der Schweiz
I. Allgemeines
II. Menschenraub (§ 234 StGB)
III. Verschleppung und politische Verdächtigung (§§ 234a, 241a StGB)
1. Rechtslage in Österreich
2. Rechtslage in der Schweiz
I. Allgemeines
II. Entziehung Minderjähriger (§ 235 StGB)
III. Kinderhandel (§ 236 StGB)
1. Rechtslage in Österreich
2. Rechtslage in der Schweiz
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
3. Abschnitt: Schutz der sexuellen Selbstbestimmung
§ 9 Sexueller Übergriff, sexuelle Nötigung, sexueller Missbrauch
A. Einführung
B. Geschichtliche Entwicklung
1. Geschützte Rechtsposition
2. Der Begriff der sexuellen Handlung
1. Die Systematik des § 177 StGB
2. Der sexuelle Übergriff (§ 177 Abs. 1 StGB)
3. Fälle ausgeschlossener oder unzumutbarer Kommunikation nach § 177 Abs. 2 StGB
a) Fehlende Fähigkeit zur Bildung oder Äußerung eines Willens (Nr. 1)
b) Eingeschränkte Fähigkeit zur Willensbildung oder -äußerung (Nr. 2)
c) Ausnutzung eines Überraschungsmoments (Nr. 3)
d) Ausnutzung einer Nötigungslage (Nr. 4)
e) Nötigung (Nr. 5)
4. Sexuelle Nötigung nach § 177 Abs. 5 StGB
a) Gewalt (Nr. 1)
b) Drohung (Nr. 2)
c) Die Fortwirkung von Nötigungsmitteln
d) Ausnutzen einer schutzlosen Lage (Nr. 3)
e) Subjektiver Tatbestand
5. Die Regelbeispiele nach Abs. 6: Vergewaltigung und gemeinschaftliche Tatbegehung
6. Qualifikationen nach Abs. 7 und 8
7. Einige Bemerkungen zu den Rechtsfolgen
8. Sexueller Übergriff, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit Todesfolge (§ 178 StGB)
III. Missbrauch institutioneller Abhängigkeit
1. Sexueller Missbrauch in Zusammenhang mit einer Freiheitsentziehung (§§ 174a Abs. 1, 174b StGB)
2. Sexueller Missbrauch bei hilfsbedürftigen Personen (§§ 174a Abs. 2, 174c StGB)
1. Die Systematik der Schutzaltersgrenzen
a) Normzweck und Systematik
b) Sexuelle Handlungen mit Kindern (§ 176 Abs. 1 und 2 StGB)
c) Sexueller Missbrauch ohne Körperkontakt (§ 176 Abs. 4 StGB)
d) Anbieten oder Verabreden zum sexuellen Missbrauch (§ 176 Abs. 5 StGB)
e) Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern (§ 176a StGB)
f) Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge (§ 176b StGB)
a) Normzweck und Systematik
b) Ausnutzung eines Abhängigkeitsverhältnisses (Abs. 1 Nr. 1)
c) Missbrauch eines Abhängigkeitsverhältnisses (Abs. 1 Nr. 2)
d) Missbrauch in der Familie (Abs. 1 Nr. 3)
e) Missbrauch an Erziehungseinrichtungen (Abs. 2)
f) Sexueller Missbrauch ohne Körperkontakt (Abs. 3)
g) Absehen von Strafe (Abs. 5)
a) Normzweck und Systematik
b) Kuppelei an Personen unter 16 Jahren (Abs. 1)
c) Kuppelei an Personen unter 18 Jahren (Abs. 2)
d) Kuppelei an minderjährigen Schutzbefohlenen (Abs. 3)
a) Normzweck und Systematik
b) Ausnutzung einer Zwangslage (Abs. 1)
c) Entgeltliche Sexualkontakte (Abs. 2)
d) Ausnutzung der fehlenden Fähigkeit zur sexuellen Selbstbestimmung (Abs. 3)
e) Absehen von Strafe
V. Reformbestrebungen
D. Überblick über die Rechtslage in Österreich und in der Schweiz
1. Allgemeines
2. Vergewaltigung, geschlechtliche Nötigung, Missbrauch und Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung
3. Jugendschutztatbestände
4. Der Missbrauch institutioneller Abhängigkeit
5. Blutschande
1. Allgemeines
2. Jugendschutztatbestände
3. Sexuelle Nötigung, Vergewaltigung, Schändung
4. Der Missbrauch institutioneller Abhängigkeit
E. Bezüge zum Strafverfahrensrecht
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
§ 10 Verbreitung pornographischer Schriften
A. Einleitung
I. Der konservative Strafrechtsmoralismus
II. Konsequentialistischer Strafrechtsliberalismus: Rechtsgutslehre, Harm-Principle
III. Deontologisch beschränkter Strafrechtsliberalismus
1. Feministischer Strafrechtsmoralismus
2. Moralistischer Liberalismus bzw. politisch-illiberaler Libertinismus
V. Offense Principle bzw. Belästigungsprinzip?
VI. Erstes Fazit: allgemeine Leitlinie
C. Kritik einiger kursierenden Pornographiebegriffe
D. Sog. einfache Pornographie: Verbreitung pornographischer Schriften (§ 184 Abs. 1 StGB)
1. Einleitung
2. Jugendschutz als Schutz der ungestörten sexuellen Entwicklung
3. Jugendschutz als Schutz des elterlichen Erziehungsrechts
4. Der Begriff der jugendschutzbezogenen Pornographie
5. Erzieherprivileg
1. Konfrontationsschutz als Schutz der sexuellen Selbstbestimmung
2. Der Begriff konfrontationsschutzbezogener Pornographie
III. Zum Kerngedanken hinter den Verboten einfacher Pornographie: Jugendschutz und Konfrontationsschutz als Schutz eines Kontrollrechts in sexuellen Angelegenheiten
IV. Einfache Pornographie und Kunst[133]
I. Gewaltpornographie (§ 184a S. 1 Alt. 1 StGB)
II. Tierpornographie (§ 184a S. 1 Alt. 2 StGB)
I. Historie
1. Kinderpornographie
2. Jugendpornographie
III. Der Begriff der Kinderpornographie
1. Kind
2. Pornographie
a) Sexuelle Handlungen von, an oder vor einem Kind (Absatz 1 Nr. 1 a])
b) Wiedergabe eines ganz oder teilweise unbekleideten Kindes in unnatürlich geschlechtsbetonter Körperhaltung (Absatz 1 Nr. 1 b])
c) Sexuell aufreizende Wiedergabe der unbekleideten Genitalien oder des unbekleideten Gesäßes eines Kindes (Absatz 1 Nr. 1 c])
IV. Jugendpornographie
V. Besitzstrafbarkeit[209]
G. Pornographie und Internet
I. Strafbarkeit des „bloßen Betrachtens“ von Kinder- und Jugendpornographie
II. Internetspezifischer Verbreitungsbegriff
III. Jugendschützende Pornographie im Internet
IV. Strafbarkeit von Access- und Host-Service-Providern
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
§ 11 Sonstige Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
I. Systematik
II. Die rechtsethische Bewertung der Prostitution
1. Überblick
2. Ausbeutung von Prostituierten (Abs. 1)
3. Ausbeutung von minderjährigen Prostituierten (Abs. 2 Nr. 1)
4. Ausbeutung von Prostituierten durch den Wohnungsinhaber (Abs. 2 Nr. 2)
5. Sonderproblem: Beihilfe des Amtsträgers durch Unterlassen
1. Überblick
2. „Besondere Beziehungen, die über den Einzelfall hinausgehen“
3. Die ausbeuterische Zuhälterei (Abs. 1 Nr. 1)
4. Die dirigistische Zuhälterei (Abs. 1 Nr. 2)
5. Die fördernde Zuhälterei (Abs. 2)
V. Verbotene Ausübung der Prostitution (§§ 184f, 184g StGB)
VI. Reformbedarf
VII. Bezüge zum Strafverfahrensrecht
1. Rechtslage in Österreich
2. Rechtslage in der Schweiz
I. Systematik
II. Exhibitionismus (§ 183 StGB)
III. Erregung öffentlichen Ärgernisses (§ 183a StGB)
IV. Sexuelle Belästigung i.e.S. (§ 184i StGB)
V. Straftaten aus Gruppen (§ 184j StGB)
VI. Reformbedarf
1. Rechtslage in Österreich
2. Rechtslage in der Schweiz
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
4. Abschnitt: Schutz der Ehre
§ 12 Beleidigungsdelikte
A. Vorbemerkungen
I. Schutzgut
1. Natürliche Personen
2. Personengemeinschaften
3. Beleidigung (des Einzelnen) unter einer Kollektivbezeichnung
4. Familienehre?
III. Rechtspolitische Berechtigung des strafrechtlichen Ehrschutzes
1. Allgemeines
2. Konkurrenzfragen
3. Zur Bedeutung der Wahrheitsfrage bei §§ 185 ff. StGB
C. Beleidigung, § 185 StGB
1. Verletzung des verdienten Achtungsanspruchs
2. Kundgabe
3. Tatbestandsausschluss durch Einverständnis
II. Subjektiver Tatbestand
D. Üble Nachrede, § 186 StGB
I. Die Wahrheitsfrage bei § 186 StGB
1. Die Einstufung als objektive Bedingung der Strafbarkeit
2. Kritik an der Einstufung als objektive Strafbarkeitsbedingung
3. Abweichende Auffassungen
1. Der Drittbezug der Aussage
2. Tatsachenbezug der Aussage
3. Behaupten oder Verbreiten
4. Ehrenrührigkeit der Tatsachenaussage
5. Qualifikation
III. Der subjektive Tatbestand
IV. Objektive Bedingung der Strafbarkeit
E. Verleumdung, § 187 StGB
I. Die Unwahrheit als Tatbestandsmerkmal
II. Subjektiver Tatbestand
III. Rechtfertigung
I. Rechtsnatur und Anwendungsbereich von § 193 StGB
1. Rechtfertigungsgrund bei Tatsachenaussagen
a) Meinungsfreiheit
b) Kunstfreiheit
1. Das berechtigte Interesse
2. Interessenabwägung
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
5. Abschnitt: Schutz des persönlichen Lebens- und Geheimbereichs
§ 13 Verletzung des Rechts am eigenen Wort und Bild
A. Einführung
I. Verfassungsrechtliche Grundlagen
1. Reichweite der §§ 201, 201a StGB
2. Rechte am eigenen Wort und Bild und Pressefreiheit
III. Internationale Komponenten
1. Geschützte Rechtsgüter
2. Zivilrechtlicher Schutz der Rechte am eigenen Wort und Bild
a) Nichtöffentlich gesprochenes Wort (§ 201 StGB)
b) Bildaufnahmen in bestimmten Räumen oder mit bestimmten Inhalten (§ 201a StGB)
c) Stellungnahme
aa) Tathandlungen nach Abs. 1 Nr. 1
bb) Tathandlungen nach Abs. 2 S. 1 Nr. 1
b) Verletzungen des Rechts am eigenen Bild (§ 201a StGB)
aa) Tathandlungen nach Abs. 1 Nr. 2
bb) Tathandlungen nach Abs. 2 S. 1 Nr. 2
aa) Tathandlungen nach Abs. 1 Nr. 3 und Nr. 4 sowie nach Abs. 2
bb) Tathandlungen nach Abs. 3
c) Stellungnahme
4. Unbefugt
5. Subjektiver Tatbestand
a) Einwilligung und mutmaßliche Einwilligung
b) Wahrnehmung öffentlicher bzw. berechtigter Interessen
c) Sonstige Rechtfertigungsgründe
1. Heimliche Aufzeichnungen zu Beweiszwecken
2. Investigativer Journalismus
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
§ 14 Ausspähen und Abfangen von Daten
A. Einführung
B. Grundfragen
1. „Daten“ (§ 202a Abs. 2 StGB) als gemeinsames Tatobjekt der §§ 202a–202d StGB
a) Zum Tatobjekt
b) Zugangsverschaffung
c) Überwindung einer bestehenden Zugangssicherung
d) Subjektive Elemente
e) „Unbefugtes“ Handeln
3. Abfangen von Daten (§ 202b StGB)
a) Ausspionieren nichtöffentlich übermittelter Daten
b) Ausspionieren von Daten einer Datenverarbeitungsanlage
4. Vorfeldtatbestand (§ 202c StGB)
a) Allgemeines
b) Einzelheiten
II. Klassische Fragestellungen
III. Ausblick
D. Europäische und internationale Bezüge
E. Rechtsvergleich
I. Strafantrag als Prozessvoraussetzung
II. Besondere Ermittlungseingriffsbefugnisse und Zuständigkeiten
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
§ 15 Sonstige Verletzungen des persönlichen Lebens- und Geheimbereichs
A. Einführung
B. Grundfragen
a) Allgemeines
b) Die tatbestandlichen Voraussetzungen
c) Rechtfertigung
aa) Zum Begriff des „Geheimnisses“
bb) Die Verpflichtung zum getreuen Umgang mit privaten Geheimnissen
aa) Berufsbezogene Verschwiegenheit (Abs. 1)
bb) Amtsverschwiegenheit (Abs. 2 S. 1)
(1) Das Offenbaren des Geheimnisses (Abs. 1, Abs. 2 S. 1, Abs. 4 S. 1)
(2) Verantwortlichkeit bei Offenbarung durch mitwirkende Personen
dd) Befugtes Offenbaren
ee) Qualifikation (Abs. 5)
c) Die Verwertung des Geheimnisses (§ 204 StGB)
3. Kernstrafrechtlicher Datenschutz: § 203 Abs. 2 S. 2 StGB
a) Verletzungen des Post- bzw. Fernmeldegeheimnisses von Seiten des Dienstleisters
(1) Der Tatbestand
(2) Rechtfertigung
bb) Ausforschen anvertrauter Sendungen (Abs. 2 Nr. 1)
b) Verlängerter Geheimnisschutz nach hoheitlichen Eingriffen (Abs. 4)
c) Übermittlungsgarantie (Abs. 2 Nr. 2)
1. Die Funktion des Merkmals „unbefugt“
2. Zivilrechtliche Folgewirkungen
III. Herausforderungen
I. Voraussetzungen der strafrechtlichen Verfolgung
II. Der begrenzte Respekt des Strafverfahrensrechts vor strafrechtlich geschützten Geheimbereichen
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
6. Abschnitt: Schutz des Staates
§ 16 Verratsdelikte
I. Einleitung
II. Geschichtlicher Rückblick
III. Überblick über die Rationes der Zentralvorschriften
1. Der Friedensverrat (§§ 80 a.F., 80a StGB)[15]
2. Verbrechen der Aggression (§ 13 VStGB)
3. Hochverrats-Delikte (§§ 81 ff. StGB)
4. Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates
a) Fortführung einer für verfassungswidrig erklärten Partei (§ 84 StGB)
b) Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen (§ 86 StGB)
c) Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (§ 86a StGB)
d) Agententätigkeit zu Sabotagezwecken (§ 87 StGB)
e) Verfassungsfeindliche Sabotage (§ 88 StGB)
f) Verfassungsfeindliche Einwirkung auf Bundeswehr und öffentliche Sicherheitsorgane (§ 89 StGB)
g) Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat (§ 89a StGB)
h) Aufnahme von Beziehungen zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat (§ 89b StGB)
i) Terrorismusfinanzierung (§ 89c StGB)
j) Verunglimpfung des Bundespräsidenten (§ 90 StGB)
k) Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole (§ 90a StGB)
l) Verfassungsfeindliche Verunglimpfung von Verfassungsorganen (§ 90b StGB)
m) Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat (§ 91 StGB)
n) § 91a bis § 92b StGB
B. Landesverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit
I. Die Definition des Staatsgeheimnisses
1. Landesverrat (§ 94 StGB)
2. Offenbaren von Staatsgeheimnissen (§ 95 StGB)
3. Landesverräterische Ausspähung; Auskundschaften von Staatsgeheimnissen (§ 96 StGB)
4. Preisgabe von Staatsgeheimnissen (§ 97 StGB)
5. Verrat illegaler Geheimnisse (§ 97a StGB)
6. Verrat in irriger Annahme eines illegalen Geheimnisses (§ 97b StGB)
7. Landesverräterische Agententätigkeit (§ 98 StGB)
8. Geheimdienstliche Agententätigkeit (§ 99 StGB)
9. Friedensgefährdende Beziehungen (§ 100 StGB)
10. Landesverräterische Fälschung (§ 100a StGB)
11. Nebenfolgen (§ 101 StGB) und Einziehung (§ 101a StGB)
C. Prozessuale Spezifika
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
§ 17 Straftaten gegen Verfassungsorgane sowie bei Wahlen und Abstimmungen
A. Einführung
I. Allgemeine Erläuterungen zu §§ 105 bis 106b StGB
1. Historie
2. Kriminalpolitische Bedeutung
a) Geschützte Verfassungsorgane
b) Nötigungsmittel, insbesondere Gewaltbegriff und -maßstab
c) Nötigungserfolg
d) Rechtswidrigkeit, insbesondere Erlaubnistatbestände des Grundgesetzes
2. Nötigung des Bundespräsidenten und von Mitgliedern eines Verfassungsorgans (§ 106 StGB)
3. Störung der Tätigkeit eines Gesetzgebungsorgans (§ 106b StGB)
III. Allgemeine Erläuterungen zu den Wahlstraftatbeständen §§ 107 bis 108d StGB
1. Historie
2. Kriminalpolitische Bedeutung
1. Begriff der Wahl
2. Wahlbehinderung (§ 107 StGB)
3. §§ 107a, 107b, 108, 108a StGB
a) Unbefugtes Wählen
b) Sonstiges Herbeiführen eines unrichtigen Wahlergebnisses oder Ergebnisverfälschung
c) Unrichtiges Verkünden oder Verkündenlassen des Ergebnisses
d) Fälschung von Wahlunterlagen (§ 107b StGB)
e) Wählernötigung (§ 108 StGB)
f) Wählertäuschung (§ 108a StGB)
g) Wählerbestechung (§ 108b StGB)
h) Verletzung des Wahlgeheimnisses (§ 107c StGB)
i) Wahlgeheimnis im Strafprozess
1. Historie
2. Kriminalpolitische Bedeutung
1. Täterkreis
2. Ungerechtfertigter Vorteil
3. Unrechtsvereinbarung
4. „Handlung im Auftrag oder auf Weisung“
5. Strafprozessuale Zuständigkeitsregelung
C. Fazit
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
§ 18 Straftaten zum Schutz der Landesverteidigung
A. Einführung
1. Geschichtliche Entwicklung der Delikte des 5. Abschnitts
2. Kriminalpolitische Bedeutung
1. Begriff der Landesverteidigung
2. Straftaten gegen die personellen Voraussetzungen der Landesverteidigung (§§ 109, 109a StGB)
a) Aussetzung der Wehrpflicht seit 2011
b) Einbeziehung des Wehrersatzdiensts (Zivildienst)
c) Wehrpflichtentziehung durch Verstümmelung oder in anderer Weise (§ 109 StGB)
d) Wehrpflichtentziehung durch Täuschung (§ 109a StGB)
3. Straftaten gegen die sachlichen Verteidigungsmittel (§§ 109d, 109e, 109f, 109g StGB)
a) Sabotagehandlungen (§§ 109d und 109e StGB)
aa) Störpropaganda
bb) Sabotagehandlungen an Verteidigungsmitteln
b) Straftaten im Vorfeld des Landesverrats (§§ 109f und 109g StGB)
aa) Sicherheitsgefährdender Nachrichtendienst (§ 109f StGB)
bb) Sicherheitsgefährdendes Abbilden (§ 109g StGB)
a) Schutzzweck
b) Tatbestandliche Konstruktion
C. Fazit
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
§ 19 Straftaten gegen ausländische Staaten
A. Vorbemerkungen
I. Angriff gegen Organe und Vertreter ausländischer Staaten (§ 102 StGB)
II. Beleidigung von Organen und Vertretern ausländischer Staaten (§ 103 StGB a.F.)
III. Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten (§ 104 StGB)
IV. Voraussetzungen der Strafverfolgung (§ 104a StGB)
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
7. Abschnitt: Schutz von Staatsgewalt und öffentlicher Ordnung
§ 20 Widerstand gegen die Staatsgewalt
A. Einführung: sechster Abschnitt des StGB
1. Kriminal- und Strafverfolgungsstatistik
2. Kriminologie
II. Verfassungsrechtliche Spannungszonen, Gesetzgebungsgeschichte, moderne Rechtssetzung
1. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte
a) Staatsverständnisse und Leitbilder potentieller Straftäter
b) Moderne Rechtssetzung
c) Resultat: Verlust rechtssystematischer Kohärenz und dessen Folgen
2. Aufforderung zu Straftaten
C. Widerstand gegen und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte
1. Rechtsgüter
2. Verhältnis von § 113 zu § 240 StGB
a) Von einer Privilegierung zu einer verschärften Bestrafung
b) Sperrwirkung
II. Objektiver Tatbestand der §§ 113, 114 StGB
1. Täter und geschützter Personenkreis
2. Tatsituation
a) Die Notwendigkeit einer Vollstreckungshandlung in § 113 Abs. 1 StGB
b) Anknüpfung an eine Diensthandlung in § 114 Abs. 1 StGB
3. Erweiterung durch § 115 StGB
4. Tathandlungen
a) Leisten von Widerstand (Abs. 1 Alt. 1)
b) Drohen mit Gewalt
c) Tätlicher Angriff
1. Grundlagen
2. Dogmatische Einordnung der Rechtmäßigkeit
a) Anforderungen
b) Fallgruppen des Kriteriums der sachlichen Richtigkeit
4. Abweichende Auffassungen
a) Verwaltungsrechtlicher Rechtmäßigkeitsbegriff („Wirksamkeitslehre“)
b) Vollstreckungsrechtlicher Rechtmäßigkeitsbegriff
c) Grundrechtsspezifische Korrekturen des BVerfG
1. Vorsatz
2. Irrtümer über die Rechtmäßigkeit der Diensthandlung
1. Verhältnis von § 113 zu § 240 StGB
2. Verhältnis von § 113 zu § 114 StGB
3. Verhältnis zu § 115 Abs. 3 StGB
4. Verhältnis zu den §§ 223 ff. StGB
1. Regelstrafrahmen
2. Besonders schwere Fälle
VII. Bezüge zum Strafverfahrensrecht
1. Grundfragen
2. Tatbestand (§ 111 Abs. 1 StGB)
a) Rechtswidrige Tat
b) Auffordern
c) Begehungsweisen
d) Vorsatz
3. Tathandlung (§ 111 Abs. 2 StGB)
a) Sonstige Straftatvoraussetzungen
b) Konkurrenzen
5. Rechtsfolgen
1. Gefangenenbefreiung (§ 120 StGB)
a) Tatbestand (§ 120 Abs. 1, Abs. 4 StGB)
b) Gefangenenbefreiung im Amt (§ 120 Abs. 2 StGB)
c) Weitere Straftatvoraussetzungen und Rechtsfolgen
2. Gefangenenmeuterei (§ 121 StGB)
a) Tatbestand (§ 121 Abs. 1, 4 StGB)
b) Weitere Strafbarkeitsmerkmale
c) Rechtsfolgen
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
§ 21 Falsche uneidliche Aussage und Meineid
I. Überblick über die Tatbestände des neunten Abschnitts
II. Kriminalpolitische Bedeutung und Reform
1. Die getrennte Betrachtung von Meineid und falscher uneidlicher Aussage
2. Die Trilateralität der Schutzbereiche
3. Chronologische Darstellung
a) Meineid und falsche Aussage in den frühen Rechtsordnungen
b) Weltliche Bestrafung durch den Einfluss des kanonischen Rechts
c) Von der Carolina zu den Kodifikationen der Aufklärung
d) Die Lehre von der publica fides und der Einfluss Franz v. Liszts
e) Die Entwicklung seit dem Reichsstrafgesetzbuch
f) Die Beteiligung an der Aussage aus historischer Sicht
1. Schutzrichtung
2. Präzisierung der Schutzrichtung
a) Eigenhändigkeit
b) Gefährdungsdelikte
c) Keine Sonderdelikte
1. Falschheit der Aussage oder Versicherung
a) Objektive Theorie
b) Subjektive Theorien
c) Wahrnehmungstheorie
2. Thematische bzw. inhaltliche Eingrenzung der strafrechtlich relevanten Aussage
3. Der Zeitpunkt der Vollendung
4. Normative Beschränkung
a) Strafzumessungslösung
b) Verwertbarkeitslösung
c) Schutzzwecktheorie
5. Meineid (§ 154 StGB)
6. Die falsche Versicherung an Eides Statt (§ 156 StGB)
a) Handlungen außerhalb eines Prozesses
b) Handlungen im Prozess als strafbare Teilnahme
aa) Das Bewirken der Zeugenladung
bb) Kommunikationsakte im Prozess als strafbare Teilnahmehandlungen
c) Sonderrolle des Angeklagten und seines Verteidigers
aa) Der Beschuldigte bzw. Angeklagte
bb) Der Verteidiger
d) Teilnahme durch Unterlassen
8. Verleitung zur Falschaussage (§ 160 StGB)
9. Der fahrlässige Falscheid (§ 161 StGB)
10. Versuchte Anstiftung zur Falschaussage (§ 159 StGB)
11. Aussagenotstand (§ 157 StGB)
12. Die rechtzeitige Berichtigung (§ 158 StGB)
C. Fazit
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
§ 22 Falsche Verdächtigung und Vortäuschen einer Straftat
A. Einführung
I. Historische Grundlagen
II. Rechtstatsächliche Grundlagen
I. Vortäuschen einer Straftat (§ 145d StGB)
1. Deliktscharakter; geschütztes Rechtsgut
a) Adressat der Täuschung: Behörde oder zuständige Stelle
b) Täuschung über Begehung einer rechtswidrigen Tat
c) Täuschung über Bevorstehen einer rechtswidrigen Tat
d) Täuschung über Beteiligten an einer Tat
e) Konkurrenzen
3. Neuere Entwicklungen
4. Rechtspolitische Überlegungen
II. Falsche Verdächtigung (§ 164 StGB)
1. Deliktscharakter; geschütztes Rechtsgut
a) Adressat der Verdächtigung: Behörde oder zuständiger Amtsträger[91]
b) Unwahrheit der Verdächtigung
c) Formen der Verdächtigung: Behaupten, Manipulieren von Beweismitteln, Leugnen
d) Auswirkungen rechtfertigender und entschuldigender Umstände
e) Innere Tatseite
f) Täterschaft und Teilnahme
3. Neuere Entwicklungen
4. Rechtspolitische Überlegungen
III. Bekanntgabe der Verurteilung (§ 165 StGB)
D. Internationale Bezüge
I. Österreich
II. Schweiz
III. Frankreich
IV. England
V. Vereinigte Staaten
F. Bezüge zum Strafverfahrensrecht
G. Fazit
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
§ 23 Strafvereitelung
I. Vorbemerkung
1. Reform- und Gesetzgebungsgeschichte des 21. Abschnitts des Strafgesetzbuchs
2. Generelle Interpretations- und Systematisierungsfragen des 21. Abschnitts
III. Kriminologie und Rechtstatsachen zu den Anschlussdelikten
1. Dogmatische Grundlagen der Lehre von der Sozialadäquanz
2. Zur Ablehnung des Ansatzes für den Bereich der Strafvereitelung mangels Erforderlichkeit
1. Strafverteidigung – Strafvereitelung – Strafjustizvereitelung
2. Dogmatischer Ausgangspunkt im prozessrechtsgemäßen Verhalten
3. Grenzen der (straflosen) Teilnahme des Strafverteidigers an strafloser Selbstbegünstigung
III. Weitere verfassungsrechtliche Fragestellungen des § 258 StGB
1. Das Rechtsgut des § 258 StGB
2. § 258 StGB als Erfolgsdelikt
3. Die Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme
4. Die Abgrenzung zur Beteiligung an der Vortat
5. Die Strafvereitelung durch Unterlassen
a) Das Erfordernis einer rechtswidrigen Vortat
b) Die Straflosigkeit der Selbstbegünstigung
c) Die Beschränkung des Tatbestands auf Strafen und Maßnahmen
aa) Das Erfordernis gänzlicher oder teilweiser Vereitelung als Taterfolg
bb) Die Vereitelungshandlung
cc) Fragen der Kausalität und der objektiven Zurechnung
e) Der subjektive Strafvereitelungstatbestand
aa) Vorsatz hinsichtlich der Vortat
bb) Typische Irrtumskonstellationen
cc) Vorsatz hinsichtlich des Erfolgseintritts
a) Das Vorliegen einer vollstreckbaren Strafe oder Maßnahme
aa) Das Erfordernis einer gänzlichen oder teilweisen Vereitelung
bb) Zeitliche Voraussetzungen der Tathandlung
cc) Die Zahlung einer Geldstrafe mit Mitteln eines Dritten
c) Probleme im Zusammenhang mit dem subjektiven Vollstreckungsvereitelungstatbestand
3. Die Versuchsstrafbarkeit gemäß § 258 Abs. 4 StGB; Vollendung und Beendigung
4. Strafvereitelung durch den Vortäter zu seinen Gunsten und zugunsten eines anderen (§ 258 Abs. 5 StGB) als persönlicher Strafausschließungsgrund
5. Das Angehörigenprivileg gemäß § 258 Abs. 6 StGB als weiterer persönlicher Strafausschließungsgrund
6. Problem der Teilnahme an einer tatbestandslosen Selbstbegünstigung
7. Die Rechtsfolgen der Strafvereitelung
I. Generelle Bezüge der Anschlussdelikte der §§ 257–262 StGB zum Strafverfahrensrecht
II. Die Bezüge von § 258 StGB zum Strafverfahrensrecht im Speziellen
1. § 258a StGB als Qualifikationstatbestand
2. Die versuchte Strafvereitelung im Amt (§ 258a Abs. 2 StGB)
3. Täterschaft und Teilnahme bei § 258a StGB
4. Die Strafvereitelung im Amt durch Unterlassen
a) Der Täterkreis der Strafvereitelung im Amt
b) Pflicht zum Einschreiten im Falle außerdienstlicher Kenntniserlangung
c) Der subjektive Tatbestand der Strafvereitelung im Amt
d) Die Rechtsfolgen der Strafvereitelung im Amt (§ 258a Abs. 3 StGB)
2. Aktuelle und zukünftige Herausforderungen: Der gesetzesaverse „Deal“ als Strafvereitelung im Amt
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
§ 24 Begünstigung
A. Vorbemerkung und Einführung
B. Verfassungsrechtliche Grundfrage: Sachliche Begünstigung durch Strafverteidigerhandeln?
1. Der Streit um das Rechtsgut des Begünstigungstatbestands: Die modifizierte Restitutionstheorie
2. Der Zeitpunkt der Hilfeleistung – Abgrenzung zur Beihilfe
3. Der Charakter des § 257 StGB als verselbstständigtes Versuchsunrecht
4. Die Straflosigkeit der versuchten Begünstigung
5. Die Begünstigung durch Unterlassen
1. Das Erfordernis einer rechtswidrigen Vortat
2. Die Verbesserung der Situation des Vortäters
3. Die Straflosigkeit der Selbstbegünstigung
a) Tatvorsatz und Irrtumsfragen
b) Die Vorteilssicherungsabsicht
5. Die Strafausschließungsgründe des § 257 Abs. 3 StGB und des § 258 Abs. 5 und 6 StGB (analog)
6. Rechtsfolgen der Begünstigung (§ 257 Abs. 2 StGB) und Strafantragserfordernis (§ 257 Abs. 4 StGB)
D. Aktuelle und zukünftige Herausforderungen: Der Ankauf von Steuerdaten als strafbare Begünstigung
E. Bezüge zum Strafverfahrensrecht
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
§ 25 Straftaten gegen die öffentliche Ordnung
I. Die Begriffe öffentliche Ordnung und öffentliches Interesse
II. Straftatenbezogene Straftaten
1. Straftaten, die eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit begründen
2. Straftaten, die eine Gefahr für den öffentlichen Frieden begründen
3. Sonstige straftatenbezogene Straftaten
1. Künftige Gefahren
2. Gegenwärtige Gefahren
IV. Straftaten gegen die Zwecke behördlicher oder gerichtlicher Amtshandlungen
V. Straftaten gegen Statusfunktionen
I. Übersicht
II. Das Hausrecht als Schutzgut
III. Bezug zur öffentlichen Sicherheit
IV. Weitere Zwecke
1. Zutrittserlaubnis
2. Unterlassung, den Ort zu verlassen
3. Konkurrenzen
C. Der Landfriedensbruch, § 125 StGB
1. Öffentliche Sicherheit und Friede als Rechtsgüter
2. Zweck des allgemeinen Gewaltverbots
3. Individualschutz
4. Öffentliche Interessen
5. Weitere Aspekte
1. Übersicht über die Tathandlungen
2. Gewalttätigkeit gegen Menschen oder Sachen
3. Gefahr für die öffentliche Sicherheit
4. Zeitliche Extension
5. Personelle Extension
6. Begehung aus einer Menschenmenge
7. Bezug zur polizeilichen Kriminalprävention
8. Die Bedrohungen mit einer Gewalttätigkeit
9. Bedrohung mit Gewalt gegen Sachen
10. Aufwieglerischer Landfriedensbruch
I. Tathandlungen
II. Schutzgut
E. Bildung bewaffneter Gruppen, § 127 StGB
I. Überblick
II. Zwecke des Verbots und der Strafdrohung
III. Strafbarkeitsausweitung durch Präventivdelikte
1. Begriff des Gefährdungsdelikts
2. Begriff des Präventivdelikts
3. Die Ausweitung der Teilnehmerstrafbarkeit
IV. Kriterien zur Beurteilung einer präventiven Deliktsbildung in Anwendung auf die Vereinigungsdelikte
1. Gefahr der Verwirklichung von Straftaten
2. Eignung zur Tatverhinderung
3. Kompatibilität mit strafrechtlichen Prinzipien
a) Strafzwecke und Strafmaß
b) Definition der Tat – insbesondere „Beteiligung an einer Vereinigung“
c) Schuldprinzip
1. Die Vereinigung als Organisation
2. Legaldefinition und Rechtsprechung
a) Wille und Zurechnung
b) Kenntnis und Gefährlichkeit
1. Übersicht über die Delikte
2. Schutzgut und Tathandlungen
3. Die Eignung zur Friedensstörung
1. Tatbestände
2. Würdeschutz als Verbotszweck
a) Schutz des Selbstverständnisses der Bundesrepublik
b) Schutz des öffentlichen Friedens
a) Leugnen und Vorsatz
b) Gefährdung und Verletzung des öffentlichen Friedens
H. Anleitung zu Straftaten, § 130a StGB
I. Gewaltdarstellung, § 131 StGB
I. Zweck des Verbots
II. Tathandlungen
K. Missbrauch von Titeln, Berufsbezeichnungen und Abzeichen, § 132a StGB
L. Sachbezogene Straftaten gegen die Zwecke von Amtshandlungen, §§ 133, 134, 136 StGB
I. Verwahrungsbruch, § 133 Abs. 1 StGB
II. Verletzung amtlicher Bekanntmachungen, § 134 StGB
III. Verstrickungsbruch, § 136 Abs. 1 StGB
IV. Siegelbruch, § 136 Abs. 2 StGB
I. Deliktsinhalt
II. Charakter des Handlungsgebots
III. Beurteilungsmaßstab
N. Belohnung und Billigung von Straftaten, § 140 StGB
O. Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln, § 145 StGB
P. Verstoß gegen Weisungen während der Führungsaufsicht bzw. das Berufsverbot, § 145a und § 145c StGB
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
§ 26 Straftaten gegen Religion und Weltanschauung
I. Recht und Religion in systematischer Perspektive
II. Recht und Religion in historischer Perspektive – einige Anmerkungen
III. Berechtigung eines Religionsstrafrechts im säkularen Staat
B. Zur Reichweite des Schutzbereichs des Art. 4 GG
I. Die Systematik der Religionsdelikte
II. Bekenntnisbeschimpfung (§ 166 StGB)
1. Rechtsgutskonzeption
2. Tatbestand
(1) Bekenntnis
(2) Religiöses oder weltanschauliches Bekenntnis
(3) Inhalt des Bekenntnisses
(4) Bekenntnis eines anderen
bb) Kirchen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungen, ihre Einrichtungen und Gebräuche
b) Tathandlung
c) Die Eignungsklausel
d) Subjektiver Tatbestand
3. Keine analoge Anwendung des § 193 StGB – Wahrnehmung berechtigter Interessen
4. Die Aktualität der Vorschrift
5. Reformbestrebungen[235]
a) Verschärfung
b) Streichung
c) Fazit
III. Störung der Religionsausübung (§ 167 StGB)
1. Rechtsgut
2. Tatbestand
IV. Störung einer Bestattungsfeier (§ 167a StGB)
V. Störung der Totenruhe (§ 168 StGB)
D. Die religiöse und kulturelle Pluralisierung der Gesellschaft und ihre Auswirkungen auf die Dogmatik des Allgemeinen Teils des Strafrechts
1. Ablehnung eines Rechtfertigungsgrundes der „cultural defense“
2. Unmittelbare Wirkung von Art. 4 GG im Ausnahmefall
II. Religion, Kultur und Schuld
1. Der Verbotsirrtum und seine Vermeidbarkeit nach § 17 StGB
2. Die Gewissenstat und die unmittelbare Wirkung von Art. 4 GG auf Schuldebene
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
§ 27 Straftaten gegen den Personenstand, die Ehe und die Familie
I. Ehe- und Familienschutz im StGB
II. Zur Geschichte des 12. Gesetzesabschnitts
III. Regelungen in Österreich und der Schweiz
I. Der statusrechtliche Rahmen; praktische Bedeutung
II. Rechtsgut und dogmatische Einordnung
III. Tathandlungen
1. Unterschieben eines Kindes
2. Falsche Angaben des Personenstandes
3. Unterdrücken des Personenstandes
4. Zuständige Behörde
IV. Subjektive Tatseite
V. Rechtfertigung, namentlich bei Babyklappe und anonymer Geburt
VI. Vollendung; Konkurrenzen
C. Verletzung der Unterhaltspflicht (§ 170 StGB)
1. Gesetzeshistorie
2. Rechtsgut; Deliktsnatur
3. Tatbestandsvoraussetzungen
a) Gesetzliche Unterhaltspflicht; Bindung an zivilgerichtliche Entscheidungen
b) Leistungsfähigkeit
c) Sich-Entziehen
d) Taterfolg
e) Subjektiver Tatbestand; Irrtümer
1. Historie
2. Tatbestand
III. Konkurrenzen
I. Gesetzeshistorie
II. Rechtsgut
III. Der Fürsorge- und Erziehungspflichtige
IV. Grobe Verletzung der Fürsorge und Erziehungspflicht
V. Taterfolg
VI. Vorsatz; Beteiligung; Konkurrenzen
I. Gesetzeshistorie; praktische Bedeutung
II. Struktur und Rechtsgut der Norm
III. Bestehen einer Ehe oder einer Lebenspartnerschaft
IV. Tathandlung
V. Subjektiver Tatbestand
VI. Rechtfertigungsgründe; Irrtümer; Täterschaft und Teilnahme; Konkurrenzen
I. Struktur und Geschichte
II. Die kriminalpolitische und verfassungsrechtliche Diskussion
III. Schutzzweck der Norm
IV. Tathandlungen
V. Vorsatz
VI. Täterschaft und Teilnahme; Auslandsfälle; Konkurrenzen
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
Stichwortverzeichnis
Register der Gesetzesverweise
AGG. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) [1]
Anmerkungen
AMG. Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (Arzneimittelgesetz – AMG) [2]
Anmerkungen
Abgabenordnung (AO)
AbgG. Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages (Abgeordnetengesetz – AbgG)
AktG. Aktiengesetz
Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz – AufenthG) [3][4]
Anmerkungen
BBG. Bundesbeamtengesetz (BBG) [5]
Anmerkungen
BGB. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) [6]
Anmerkungen
BRAO. Bundesrechtsanwaltsordnung
BSIG. Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI-Gesetz – BSIG) [7]
Anmerkungen
BV. Verfassung des Freistaates Bayern
BVerfGG. Gesetz über das Bundesverfassungsgericht (Bundesverfassungsgerichtsgesetz – BVerfGG)
BWahlG. Bundeswahlgesetz
BZRG. Gesetz über das Zentralregister und das Erziehungsregister (Bundeszentralregistergesetz – BZRG)
Anmerkungen
Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln (Betäubungsmittelgesetz – BtMG)
DSGVO. Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)
Anmerkungen
EGBGB. Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche
EMRK. Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten [10]
Anmerkungen
EStG. Einkommensteuergesetz (EStG)
EUV. Vertrag über die Europäische Union
GG. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
GVG. Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)
GewO. Gewerbeordnung
GewSchG. Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen (Gewaltschutzgesetz – GewSchG) [11]
Anmerkungen
HGB. Handelsgesetzbuch (HGB)
IfSG. Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG)
InsO. Insolvenzordnung (InsO)
JGG. Jugendgerichtsgesetz (JGG) [12]
Anmerkungen
KastrG. Gesetz über die freiwillige Kastration und andere Behandlungsmethoden
Ausführungsgesetz zu Artikel 26 Abs. 2 des Grundgesetzes (Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen)
KunstUrhG. Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Fotografie[13]
Anmerkungen
LPartG. Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft (Lebenspartnerschaftsgesetz – LPartG) [14]
Anmerkungen
MPG. Gesetz über Medizinprodukte (Medizinproduktegesetz – MPG) [15]
Anmerkungen
OWiG. Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)
PStG. Personenstandsgesetz (PStG) [16]
Anmerkungen
PostG. Postgesetz (PostG)
PsychThG. Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Psychotherapeutengesetz – PsychThG) [17]
Anmerkungen
SGB IX. Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (Neuntes Buch Sozialgesetzbuch – SGB IX) [18]
Anmerkungen
Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) Kinder- und Jugendhilfe
Anmerkungen
SGB X. Zehntes Buch Sozialgesetzbuch – Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz – (SGB X)
SchKG. Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten (Schwangerschaftskonfliktgesetz – SchKG) [20]
Anmerkungen
Strafgesetzbuch (StGB)
Anmerkungen
StPO. Strafprozessordnung (StPO)
Anmerkungen
StVO. Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
StVollzG. Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung (Strafvollzugsgesetz – StVollzG)
TFG. Gesetz zur Regelung des Transfusionswesens (Transfusionsgesetz – TFG) [24]
Anmerkungen
TKG. Telekommunikationsgesetz (TKG) [25]
Anmerkungen
TMG. Telemediengesetz (TMG) [26]
Anmerkungen
Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen und Geweben (Transplantationsgesetz – TPG) [27]
Anmerkungen
TierSchG. Tierschutzgesetz
UWG. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) [28]
Anmerkungen
UrhG. Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz)
VwGO. Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
VwVG NRW. Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW – VwVG NRW)
WPflG. Wehrpflichtgesetz (WPflG)
Anmerkungen
Waffengesetz (WaffG)
ZDG. Gesetz über den Zivildienst der Kriegsdienstverweigerer (Zivildienstgesetz – ZDG)
ZPO. Zivilprozessordnung (ZPO)
Отрывок из книги
Herausgegeben von
Eric Hilgendorf, Hans Kudlich und Brian Valerius
.....
[151]
Roxin, AT, Bd. 1, § 20 Rn. 61.
.....