Burnout
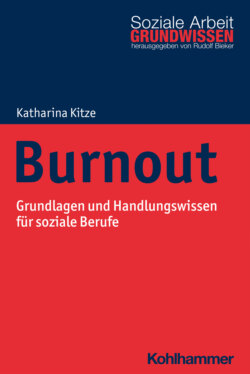
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Katharina Kitze. Burnout
Vorwort zur Reihe
Zu diesem Buch
Inhalt
1 Die Herausforderungen des Burnouts – eine Einführung in das Thema
Was Sie in diesem Kapitel lernen können
1.1 Zur Bedeutung von Burnout
1.1.1 Arbeitsbeeinträchtigung durch Burnout
Diagnose ≠ Häufigkeit von Burnout
Arbeitsunfähigkeitsrichtlinien des Gemeinsamen Bundesauschusses (Auszug)
1.1.2 Prävalenz von Burnout. Prävalenz
1.1.3 Relevanz in unserer Gesellschaft
Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz – PrävG) vom 17. Juli 2015 (Auszüge)
Das Bild von Burnout in der Gesellschaf
1.1.4 Aufgaben sozialer Berufe
Berufsbild für Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagogen*innen (Auszug)
1.2 Betroffenheit in sozialen Berufen
1.2.1 Burnout der Helfenden
1.2.2 Ein Beitrag zur Professionalisierung Sozialer Arbeit
Literaturempfehlungen. Literatur zur Relevanz von Burnout
Literatur zu Burnout und Soziale Arbeit
2 Das Phänomen Burnout
Was Sie in diesem Kapitel lernen können
Eine Fallgeschichte zu Burnout
2.1 Alltags- und Wissenschaftsbegriff
2.2 Was ist Burnout?
Definition von Burnout
2.3 Merkmale von Burnout. Die Geschichte mit dem Stein
2.3.1 Emotionale Erschöpfung
2.3.2 Depersonalisation
2.3.3 Gefühl reduzierter Leistungsfähigkeit
Burnout ist
2.4 Was Burnout nicht ist
2.4.1 Mehr als bloße Unzufriedenheit, Ärger, Frustration
2.4.2 Ermüdung und Erschöpfung
2.4.3 Abgrenzung zu Stress
Was ist Stress?
2.4.4 Unterschied zu verschiedenen Erkrankungen
Die zwei Hauptformen der Neurasthenie
Chronic Fatigue Syndrom
Depression
Z73 Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung
Was Burnout nicht ist
2.5 Zum Verlauf von Burnout – Phasenmodelle
2.6 Auswirkungen von Burnout
2.6.1 Folgen auf Ebene der Betroffenen
2.6.2 Folgen für Arbeitsorganisationen
2.6.3 Folgen für die Gesellschaft
2.7 Burnout einer Lehrerin
Literaturempfehlungen
3 Wie Burnout entsteht – Ursachen und Einflussfaktoren
Was Sie in diesem Kapitel lernen können
Disposition
Einflussfaktoren
3.1 Erklärungsmodelle zur Burnout-Entstehung
3.1.1 Burnout als Form der Stressbewältigung
Beispiel: Der neue Kollege
Beispiel: Der neue Kollege
Beispiel: Der neue Kollege
Beispiel: Der neue Kollege
3.1.2 Arbeitsanforderungen versus Ressourcen
Beispiel: Der neue Kollege
Beispiel: Der neue Kollege
3.2 Persönliche Faktoren als Nährboden für Burnout
3.2.1 Zur Bedeutung demografischer Merkmale. Alter und Burnout
Je älter, desto weniger Burnout?
Geschlecht und Burnout
Brennen Frauen eher aus?
Familienverhältnisse
Ist die Familie ein Schutzfaktor?
Bildung und Burnout
Trifft Burnout nur die Gebildeten?
3.2.2 Ursachen in genetischen und biologischen Faktoren
Wird Burnout vererbt?
3.2.3 Persönlichkeit, Fähig- und Fertigkeiten, Werte
Persönlichkeit
Beispiel: Der neue Kollege
Beispiel: Der neue Kollege
Beispiel: Der neue Kollege
Schwache Menschen bekommen Depressionen, starke Menschen Burnout?
Stressbewältigungskompetenz
Wer sein Leben ›im Griff‹ hat, bleibt verschont
Wertvorstellungen
Nur wer einmal gebrannt hat, kann auch ausbrennen
3.2.4 Beziehungsfähigkeit
Das Privatleben hat nichts mit Burnout zu tun?
3.3 Situative Einflüsse
3.3.1 Faktoren der Arbeitstätigkeit
Wer viel arbeitet, bekommt einen Burnout?
3.3.2 Faktoren der Arbeitsorganisation
Wer keine Luft bekommt, brennt aus
3.3.3 Die Berufswahl als Einflussfaktor
Tritt Burnout nur bei Manager*innen auf? Oder trifft es nur die Helfenden?
3.3.4 Gesellschaftliche Einflussfaktoren
Tertiärisierung
Informatisierung
Subjektivierung
Akzeleration
Neue Arbeitsformen
Burnout – eine Modeerkrankung?
Arbeitskulturen als Einflussfaktoren
Leistungsgesellschaften und Burnout
3.4 Besondere Einflüsse in der Sozialen Arbeit
3.4.1 Das Helfersyndrom
Berufsethik der Sozialen Arbeit
3.4.2 Spezifische Arbeitsbedingungen
Ein Beruf ›mitten im Leben‹
3.4.4 Öffentliche Wahrnehmung der Sozialen Arbeit
Literaturempfehlungen. Literatur zur Übersicht über Burnout-Entstehung
Literatur zur Forschungsübersicht und Meta-Analysen
4 Die Begegnung mit dem Burnout
Was Sie in diesem Kapitel lernen können
4.1 Identifizieren von Burnout
4.1.1 Erkennen bei sich selbst
Selbstbeobachtung
Feedback
Selbst-Diagnose
4.1.2 Frühwarnsymptome
Frühwarnsymptome im Arbeitskontext
4.1.3 Erhebung im Kontext der Organisation
Betroffenenbefragung
Befragung von potenziell ausgebrannten Personen
Teamanalyse
Belastungsdiagnostik
Arbeitsschutzgesetz ArbSchG – § 5 Beurteilungen der Arbeitsbedingungen
4.2 Messen von Burnout
4.2.1 Maslach Burnout Inventory MBI
4.2.2 Tedium Measure TM
4.2.3 Arbeitsbezogene Verhaltens- und Erlebnismuster AVEM
4.2.4 Weitere Fragebögen und Erhebungsinstrumente
Burnout-Screening-Skalen BOSS
Copenhagen Burnout Inventory CBI
Hamburger Burnout-Inventar HBI
Oldenburg Burnout-Inventar OLBI
4.3 Differenzialdiagnostik
Literaturempfehlungen
5 Wege aus dem Burnout
Was Sie in diesem Kapitel lernen können
5.1 Behandlung – der Eingriff in das Burnout-Geschehen
5.2 Persönliche Strategien gegen Burnout
Personenbezogene Behandlung von Burnout
5.2.1 Wirksame Therapien für die Bewältigung von Burnout
Kognitive Verhaltenstherapie KVT
Kognitive Verhaltenstherapie KVT
Rational Emotive Verhaltenstherapie REVT
Rational Emotive Verhaltenstherapie REVT
5.2.2 Aufbau von Bewältigungskompetenzen
Stressbewältigung
Instrumentelles Stressmanagement
Kognitives Stressmanagement
Palliativ-regeneratives Stressmanagement
5.2.3 Stressbewältigungsprogramme
Zwischenfazit zur personenbezogenen Behandlung von Burnout
5.2.4 Aufgaben Sozialer Arbeit bei der persönlichen Burnout-Bewältigung
Methodenunspezifische Wirkfaktoren
Empowerment bei Burnout
Aufgaben Sozialer Arbeit bei der persönlichen Burnout-Bewältigung:
5.3 Entlastung im Arbeitsbereich
Bedingungsbezogene Behandlung von Burnout
Betriebliches Eingliederungsmanagement nach § 167 Prävention SGB IX (Auszug)
5.3.1 Verbesserung der Arbeitssituation
Arbeitsbedingungen
Arbeitsaufgaben
5.3.2 Soziale Unterstützung in der Arbeit
Informationelle Unterstützung
Instrumentelle Unterstützung
Emotionale Unterstützung
5.3.3 Aufgaben Sozialer Arbeit bei der situativen Burnout-Bewältigung
Betriebliche Sozialarbeit
Aufgaben Sozialer Arbeit bei der situativen Burnout-Bewältigung
5.4 Wirksam kombinierte Behandlungen von Burnout
Literaturempfehlungen
Literatur zur persönlichen Burnout-Bewältigung
Literatur zur arbeitsbezogenen Burnout-Bewältigung
6 Mit gesunder Arbeit dem Burnout vorbeugen
Was Sie in diesem Kapitel lernen können
6.1 Was Prävention von Burnout bedeutet
Zur Erinnerung: Burnout-Ursachen
Prävention von Burnout
6.1.1 Präventionsstrategien gegen Burnout
6.1.2 Präventive Soziale Arbeit
Soziale Arbeit in der personenbezogenen Burnout-Prävention
Soziale Arbeit in der arbeitsbezogenen Burnout-Prävention
Soziale Arbeit in der gesellschaftsbezogenen Burnout-Prävention
6.2 Personenbezogene Präventionsmaßnahmen
6.2.1 Einfluss auf die Ursachen nehmen
Im Erziehungsbereich
Im Bildungsbereich
Im Arbeitsbereich
6.2.2 Stärkung der Widerstandskraft und der Ressourcen
Fallbeispiel
Förderung der Resilienz
Was bedeutet es, resilient zu sein?
Was bedeutet das für unser Fallbeispiel?
6.3 Präventionsansätze in der Organisation
6.3.1 Arbeitsbezogene Risikofaktoren angehen
6.3.2 Protektiver Einfluss der Arbeit
6.3.3 Gesundheitsfördernde Organisationsentwicklung
6.4 Präventionsstrategien auf der Gesellschaftsebene
6.5 Burnout-Prävention für soziale Berufe
6.5.1 Besondere Herausforderungen sozialer Berufe
Distanzierte Anteilnahme
6.5.2 Ausbildung und Studium
6.5.3 Professionalisierung Sozialer Arbeit
Literaturempfehlungen. Literatur zu Burnout-präventiven Maßnahmen
Spezielle Literatur zur Profession Soziale Arbeit
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis. A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
N
P
R
S
U
W
Отрывок из книги
Die Autorin
Prof. Dr. Katharina Kitze lehrt seit 2017 psychosoziale Gesundheit und psychosoziale Versorgung im Lebenslauf an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Sie ist als Diplom-Psychologin sowie Systemischer Coach ausgebildet und war viele Jahre als psychosoziale Beraterin tätig. Ihre aktuellen Lehr- und Forschungsinteressen liegen im Bereich der Resilienz und deren Relevanz für die Soziale Arbeit sowie in der Entwicklung sozialen Engagements.
.....
§ 20 Primäre Prävention und Gesundheitsförderung
(1) Die Krankenkasse sieht in der Satzung Leistungen zur Verhinderung und Verminderung von Krankheitsrisiken (primäre Prävention) sowie zur Förderung des selbstbestimmten gesundheitsorientierten Handelns der Versicherten (Gesundheitsförderung) vor …
.....