Helene Bandelberg - die verlorene Rose
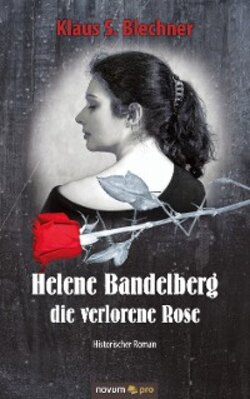
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Klaus S. Blechner. Helene Bandelberg - die verlorene Rose
Impressum
1. Helenes Geburt, Kindheit und Jugend
Die Zeche „Concordia“ in Oberhausen/Lirich mit der Bergmannssiedlung „Glück auf!“. Hier wurde Helene geboren, hier verlebte sie ihre Kindheit. Ort der Handlung: Oberhausen/Lirich, Zeche „Concordia“ Bergbausiedlung „Glück auf!“ Zeit: Ende April 1906. Wie ein verspäteter himmlischer Gruß teilten die goldenen Lichtspeere einer milden Frühlingssonne das Halbdunkel der winzigen Schlafkammer der vor wenigen Minuten von ihrer vierten Tochter entbundenen Marie Luise Bandelberg und zauberten – nach einem Kontrollblick auf das Neugeborene – jetzt endlich ein schüchternes Lächeln in das immer noch mädchenhaft blasse Antlitz der Mutter. „Ach ja, mein Fritz, ich weiß, du hast gewiss – nach drei Engeln – diesmal fest auf einen kleinen Bengel gehofft! Aber wenn ich sehe, wie viele der besten jungen Männer schon so früh in der Dunkelheit des Pütts verschwinden, um danach – nur wenige Jahre später – mit schwarzer Lunge wieder ans Tageslicht zurückzukehren, so hätte ich unserem Sohn ein solches Schicksal auch niemals gewünscht!“ „Oh meine tapfere Marie! Glaub mir, ich bin doch nur froh und dankbar, dass ihr beide hier gesund und munter seid und das Kindbettfieber dich verschont hat!“, platzte es jetzt aus Vater Friedrichs tiefstem Herzen heraus. Es gab in diesem Moment nur die pure Dankbarkeit und die größte Erleichterung für den jungen Familienvater und Steiger der Zeche „Concordia“ in Oberhausen an diesem milden Frühlingstag, dem 26. April 1906! Das geradezu magersüchtige rote Ziegelhäuschen mit Stallanbau der Bandelbergs in der neuen Bergbausiedlung „Glück auf!“ der Zeche „Concordia“ im Stadtteil Lirich platzte jetzt endgültig aus allen Nähten, denn neben den nun vier Bandelberg-Töchtern und ihren Eltern musste es auch noch der hochbetagten Steigerwitwe Anna Burdenski und ihrer geliebten „Kosa Lisa“, einer schneeweißen Milchziege, Platz zum Leben bieten. Das eineinhalbgeschossige dürftig eingerichtete Bergarbeiterdomizil mit der Hausnummer 312 war längst bis in die letzte schräge Dachkammer ausgebucht und der handwerklich begabte Familienvater stellte seit Langem Überlegungen an, ob er nicht den „Heuboden“ im Anbau in ein weiteres „Kinderzimmer“ verwandeln könnte. „Im nächsten Urlaub werde ich mit ‚Jupp‘ und ‚Theo‘, meinen besten Kumpels, hier anrücken, damit ‚Lieschen‘ und ‚Friedchen‘ endlich aus dem feuchten Keller herauskommen!“ Dieses Versprechen gab er nun seiner Marie und der staunenden Hebamme bekannt, und die vierfache Mutter wusste, auf das Wort ihres Friedrich war schon felsenfest Verlass! „Schau, Fritz, welche hohe Stirn unser kleines Schätzchen schmückt: Es wird ganz gewiss eine sehr gescheite und praktische Frau!“, stellte Mutter Marie nun ihre neugeborene Daumenlutscherin dem stolzen Vater und den älteren Töchtern vor. „Ich fände, ‚Helene‘ wäre ein recht passender Name für unser Nesthäkchen, oder?“ „Nun lassen wir es mal gut sein mit ’ner Lene Bandelberg“, brummte Vater Friedrich zustimmend. Und damit hieß die hübsche vierte Tochter der Bandelbergs „Helene“, welch hohe Verpflichtung! Die dunkelblond gelockte und quicklebendige stupsnasige Lene erwies sich in der Tat als ein sehr verständiges, doch dabei eigenständiges Mädchen, ohne größere Probleme in der häuslichen wie schulischen Erziehung: Nach der 6. Klasse der Volksschule Oberhausen/Lirich kam Helene mit einem Zeugnis nach Hause, das den Notendurchschnitt aller Schwestern deutlich übertraf. „Nur in Reli hat mir der alte Weißbrot eine blöde Vier verpasst, weil ich ihm nicht glauben wollte, dass die ganze Welt in nur sieben Tagen entstanden sein soll!“ „Dieser Mensch ist ungerecht und nie im Leben ein guter Christ!“, entrüstete sich Helene. „Der hat doch nur seine ganz speziellen Lieblinge, nämlich die, die ihm immer wie Papageien alles nachplappern! Pfui Teufel, welch ein Schmierentheater, aber nicht mit mir!“ Helene wollte sich und ihren Idealen jedenfalls treu bleiben, ganz gleich wie der Herr Prediger ihre ganz persönliche Einstellung zur „Hölle“, zum „Himmel“ – und das viele Unrecht dazwischen – bewerten und verurteilen mochte. Auf diese Weise hatte diese schultägliche Auseinandersetzung mit dem greisen Prediger Helenes Willenskraft und ihr Rechtsbewusstsein schon früh geweckt und ihr damit offenbar eine überaus eigenständige Persönlichkeit beschert. Helenes ältere Schwester Elfriede (das „Friedchen“) war – vermutlich durch einen Geburtsschaden – ein wenig geistig zurückgeblieben. Sie konnte demzufolge erst mit 8 Jahren eingeschult werden und hatte auch danach erhebliche Schwierigkeiten, das Lesen, Schreiben und Rechnen zu erlernen … Helene und ihre Schwestern halfen ihr, so gut sie nur konnten, aber im rauen Schulalltag war „Friedchen“ natürlich ein leichtes Opfer von Hohn, Spott und Ausgrenzung: „Seht doch mal das Friedchen, kein Hirn und kein Tittchen!“, intonierten eines Tages einige fiese Rüpel von „Rudis Klopperbande“, als Elfriede gemeinsam mit ihren Schwestern gerade den Heimweg von der Liricher Volksschule zu ihrem Elternhaus antrat „So, das reicht! Die knöpfen wir uns vor! Luise, hol dort drüben vom Kohlenhändler einen Eimer mit Eierkohle! Anni, schnapp du dir dort den alten Straßenbesen und ich werde die große Plattschüppe schwingen!“, dirigierte unmissverständlich Helene jetzt ihre Schwestern. Und innerhalb weniger Augenblicke hatte sich der kleine Trupp braver Schulmädchen in ein kampfbereites „Trio infernale“ zur Verteidigung ihrer behinderten Schwester verwandelt. Dieses furiose „Dreigestirn“ versetzte ab sofort die „Saujungs“ von „Rudis Klopperbande“ mit gezielten Eierkohlewürfen sowie gekonnten Besenstiel- und Schüppenattacken in wahrhaft panischen Schrecken, sodass sie unter dem militärischen Rückzugs-Kommando Rudis, nämlich „Volle Deckung und dann: Rette sich, wer kann!“ blitzartig die Flucht antreten mussten. Kein Wunder, dass unsere Helene von den Liricher Kindern bald als „Kriemhild von Bandelberg“ geadelt wurde. Die beste Waffe aber gegen eine geschlechtliche Unterdrückung – so glaubte Helene fest – ist wohl die Bildung: Und so quengelte und drängelte sie so lange bei ihren Eltern, bis diese schließlich ihre Genehmigung zum Besuch einer höheren Bildungsanstalt, einem sogenannten „Lyzeum“ für Mädchen im Alter von 12–18 Jahren erteilten! Am 1. April 1918 wurde Helene Bandelberg – übrigens als einziges Mädchen ihres Jahrgangs aus der Bergmannssiedlung – ins Schülerverzeichnis des ersten „Lyzeums“ in Oberhausen aufgenommen. Ihre großen Schwestern konnten Helene allerdings von nun an nicht mehr bei den Schularbeiten zur Seite stehen, denn Latein, Englisch oder höhere Mathematik wurde an Volksschulen bis dato nicht unterrichtet „Na Lenchen, du hast heute wieder solch ein gefährlich schönes Leuchten in deinen Augen!“, bemerkte Mutter Marie wiederholt, wenn ihr 16-jähriger Teenager gegen 17:00 Uhr von seinem Naturkunde-Kurs nach Hause kam. „Habt ihr Backfische etwa heute wieder dem ‚süßen Eddi Eisenstein‘, eurem jungen Assessor für Bio und Chemie, nach dem Herzen geschmachtet?“ Marie Bandelberg kannte ihre Zopfträgerinnen mit all ihren individuellen „Zickereien“, gerade so, wie es eine gute Mutter denn auch wissen sollte. So wusste sie auch, dass die propere Luise ihren Klassenlehrer häufig die letzten Schritte bis zur Klassentür begleitete und ihm dabei liebend gerne seine hochheilige Lehrertasche trug „Igittigitt! Wer gut schmiert, der gut fährt!“, war der recht eindeutige Kommentar aus Helenes Mund, als sie von dieser „Kriecherei“ Wind bekam „Selbst ist die Frau!“, war dagegen ihre klare Maxime und dementsprechend legte sie besonders im „Sport“ und in den „Naturwissenschaften“ richtig los und gehörte bald zu den Besten ihres Jahrgangs. Ende März 1926 konnte Helene jedenfalls von sich sagen, dass sie die erste Bandelberg mit einem sehenswerten Reifezeugnis sei und somit sogar die Chance hätte, ein Studium beginnen zu können „Alte Geschichte“ interessierte sie brennend: Der wundervolle kulturelle Aufstieg der Menschheit, gefesselt von den festen Regeln und Versprechungen der großen Weltreligionen, welch faszinierende Studienobjekte warteten da auf sie … „Also, Lenchen, schlag dir das bloß aus dem Kopf, mit einem langjährigen Studium ohne jede Garantie auf ein regelmäßiges Einkommen! Ne, ne! Dein Vater ist kein Bergwerksbesitzer oder Hüttenfabrikant, er heißt auch nicht ‚Krupp‘ oder ‚Thyssen‘, sondern Bandelberg! Helene, dein Vater und ich waren immer heilfroh, wenn wir euch alle satt bekommen haben!“ Dies war das überdeutlich mahnende „Veto“ ihrer stets pragmatisch denkenden und handelnden Mutter Marie, dem hatte selbst ein so willensstarkes Persönchen wie Helene es war vorerst nichts Überzeugendes entgegenzusetzen. Ein Seitenblick auf den beruflichen Werdegang ihrer Schwestern konnte die Worte ihrer Mutter nur noch bestätigen: Martha, Helenes älteste Schwester, hatte ohne jedes Murren eine Schneiderlehre absolviert; Luise war gegenwärtig in der Ausbildung zur „Hutmacherin“ und das Nesthäkchen Anna Maria bediente – mit einer langen weißen Schürze dekoriert – im vornehmen Feinkostladen „Künzel“ in der Marktstraße eine anspruchsvolle Kundschaft. Und selbst das „liebe Friedchen“ – da ohne Schulabschluss – konnte sich noch als „Haushaltshilfe“ bei den Gärtners, einer sehr begüterten Familie mit Lebensmittel-Spedition so einige „Naturalien“ verdienen. „Wenn ich’s recht bedenke, kann ich nicht in diesen schweren Zeiten auf Kosten meiner tüchtigen Eltern und fleißigen Geschwister ein langjähriges Studium beginnen!“ In diesem Moment hielt Helene sich ganz ehrlich und selbstkritisch einen großen Spiegel vor: „Aber vielleicht finde ich beruflich doch wenigstens etwas, das über ‚Ackerbau und Viehzucht‘ hinausgeht, nichts Handfestes produziert, aber dafür meine geistigen Gaben und Interessen herausfordert …!“, resümierte Helene ernsthaft. „Ich glaube, ich muss jetzt endlich die Haustür meines kleinen Elternhauses weit öffnen und mich hinauswagen ins wirkliche Leben!“
2. Helenes erste Liebe
Donoper Teich (bei Detmold): Bei einem Rundgang um diesen zauberhaften Waldsee verliebte sich Helene zum ersten Mal „Erstklassig geführte Anwaltskanzlei im Raum Bielefeld sucht junge zuverlässige Frau zur Ausbildung als ‚Rechtsanwalts- und Notar-Gehilfin‘ mit Aufstiegsmöglichkeit zur ‚Büroleitung‘: Bewerbungen (bis 30.04.1926) an Rechtsanwalts- und Notar-Sozietät Dr. jur. Dietrich Düsterwald und Siegfried Schönborn, Bielefeld, Ostpark 10.“ „Versuch macht klug!“, dachte Helene nach der Lektüre dieser Offerte, die sie im „Oberhauser Stadtboten“ entdeckt hatte und kümmerte sich umgehend um ein passendes Foto für ihre dünne Bewerbungsmappe. Nach weniger als einer Woche hatte sie schon alle notwendigen Papiere zusammen und schickte dann ihren Bewerbungsbrief per Eilboten nach Bielefeld. „Wenn die mal überhaupt antworten“, orakelte ihre Schwester Luise (die „Hutmacherin“). „Für mich wär’ dat sowieso nix: Dat Bielefeld is’ doch woll ein Stück kalte Heimat oder?“ Und als nach vier Wochen nicht einmal eine Eingangsbestätigung von Helenes Bewerbungsmappe eingetroffen war, hatten wohl inzwischen alle Bandelbergs die Hoffnung auf eine Zusage aus Bielefeld aufgegeben … Jedoch weitere 14 Tage später geschah das kleine Wunder: „He, schönen guten Tag, wer von euch Grazien ist denn wohl Fräulein Helene Bandelberg?“, befragte eines Samstagmorgens Mitte Mai ein absolut elegant gekleideter junger Mann in einem dunkelblauen Anzug und silbernen Hut eine Schar von Nachbarskindern der Bandelbergs unmittelbar gegenüber der Toreinfahrt zum Haus Nr. 312 „Falls Sie etwa Helene suchen, die ist gerade mal beim Bäcker. Den Bandelbergs ist wohl wieder mal das Brot ausgegangen. Aber sie wohnt doch gleich hier drüben in der Nummer 312 im Keller.“, klärte die couragierte Lieselotte Kempowski, eine Nachbarstochter, den noblen jungen Fremden jetzt auf „Ah so, vielen herzlichen Dank! Dann will ich mal bei den Eltern dieser jungen Dame vorstellig werden und dort auf die Besagte warten, was?!“ antwortete der so vornehm gekleidete Fremde der Kinderschar und verschwand schon bald im Torbogen des Bandelbergschen Hauses. Genau in diesem Moment kam Helene um die Ecke, zwei Brote und eine große Tüte Brötchen vor der Brust tragend, und wurde natürlich von ihren besten Freundinnen schon sehnsüchtig erwartet. „Du Lenchen, da ist eben gerade so ein ganz feiner Pinkel hier aufgetaucht, der hat genau nach dir gefragt und is getz bei euch inner Bude: Wat der wohl im Schilde führt? Kannste uns nachher mal verraten, sonst platzen wir hier noch, verstehste?!“ Oh, oh, wie ein geölter Blitz war Helene jetzt aber in ihrer kleinen Kellerbude verschwunden, um sich in Windeseile umzuziehen. „Helene, kommst du mal bitte schnell in die gute Stube!“, meldete sich die Stimme ihrer Mutter Marie in einem sehr resoluten Ton. „Hier ist Besuch für dich!“ Ein letzter Blick in den Kommodenspiegel und Helene war bereit zum ersten Auftritt: Ihr dunkelblondes Haar in „Bubikopf-Frisur“ kräuselte sich lebenslustig um ihr ovales Mädchengesicht mit den seidig leuchtenden braunen Augen und der typischen kleinen Stupsnase aller Bandelberg-Töchter. „Das, liebe Helene, ist Herr Rechtsanwalt Schönborn aus Bielefeld. Stell dir vor, Herr Schönborn hatte hier in Mühlheim einen Termin und hat wegen deiner Bewerbung heute einen Abstecher zu uns gemacht, um dich zuerst persönlich kennenzulernen.“ „Einen schönen guten Tag, Fräulein Bandelberg. Wir haben Ihre Bewerbung aus gut einem Dutzend anderer ausgewählt und mein Seniorpartner, Herr Dr. Düsterwald, hat mich gebeten, Sie – bei Gefallen – einzuladen, in unserer Bielefelder Kanzlei zunächst ein dreimonatiges Praktikum probeweise zu starten, das dann eventuell später in eine reguläre zweijährige Lehre zur ‚ReNo-Gehilfin‘ übergehen könnte. Was halten Sie davon?“ „Welche Frage!“, dachte Helene und ihr Herz schlug ihr bis zum Halse: So froh und glücklich war sie über dieses solide Angebot des jungen Anwalts „Oh, das gefällt mir natürlich sehr, Herr Schönborn, wann darf ich denn nach Bielefeld anreisen?“, wollte sie jetzt bald wissen. „Am liebsten würde ich Sie gleich mitnehmen, aber Sie haben sicher noch einige Vorkehrungen zu treffen, schätze ich … Wenn wir uns aber – gemeinsam mit Ihren Eltern – einig sind, werde ich mich in Bielefeld schon einmal um eine kleine Wohnung für Sie kümmern, Fräulein Bandelberg. Für heute darf ich mich aber nun verabschieden und Ihnen sagen, dass ich mich auf eine Zusammenarbeit mit Ihnen sehr freue!“ Mit diesen klaren Worten gab der junge Jurist Helene und ihren Eltern die Hand – und das wirkte wie ein Treue-Versprechen – und verließ wieder das kleine Haus der Bandelbergs … Und wie es sich für einen Juristen gehört – hielt der junge Notar tatsächlich Wort: Nur eine Woche später erhielt Helene sowohl den Arbeitsvertrag als auch ihre neue Adresse in Bielefeld zugesandt. Sie würde demnächst in der Fröbelstraße Nr. 33, das heißt ganz in der Nähe ihres Büros am Ostpark eine kleine Zweizimmerwohnung in einem Anbau bewohnen, sogar mit eigenem Hauseingang „Endlich unabhängig von Eltern und Geschwistern, welche Freiheit!“, freute sie sich auf ihr neues Heim „Ich habe mir gedacht: Am Anfang fehlt es an so vielen Dingen, darum sollte Ihre Wohnung schon möbliert sein. Wir könnten uns für die Zeit Ihrer Ausbildung mit 50 % der Mietkosten beteiligen, Fräulein Bandelberg!“, versüßte ihr Herr Schönborn darüber hinaus den Einzug in das neue Domizil. Voller Stolz berichtete Helene ihren Eltern von ihrer ersten kleinen Wohnung: „Ich wohne zwar mitten in der Großstadt, aber schaue von meinem Küchenfenster ins Grüne, einen alten Obstgarten, der mir hoffentlich im Herbst einige leckere Früchte schenkt!“, jubelte sie. Am 01. Juni 1926 startete Helene offiziell in ihr „neues Leben“: An diesem Tage begrüßte sie nämlich ihr Senior-Chef, Herr Dr. jur. Dietrich Düsterwald, an ihrem zukünftigen Arbeitsplatz. „Herzlich willkommen in unserer Kanzlei, Fräulein Bandelberg! Ich hoffe, mein junger Kollege hat Ihnen Ihr häusliches und berufliches Nest hübsch weich gepolstert. Was mir als ‚altem Hasen‘ jedoch äußerst wichtig erscheint, ist, dass jeder Mitarbeiter in unserer Kanzlei sich zu strengster Geheimhaltung aller Personaldaten und Fakten verpflichtet fühlen sollte, die ihm bei der alltäglichen Fallbearbeitung bekannt geworden sind. Diese Pflicht zur absoluten Verschwiegenheit, liebes Fräulein Bandelberg, möchte ich Ihnen hier und heute ganz eng ans Herz legen! Ansonsten dürfen Sie gerne immer höflich und freundlich zu unseren Klienten sein. Konflikte überlassen Sie bitte mir oder meinem jungen Kollegen. Doch genug der Mahnung für heute, ich wünsche Ihnen einen reibungslosen Start und stets gute Zusammenarbeit! Prosit, Fräulein Bandelberg!“ Mit diesem letzten „Prosit“ reichte Herr Dr. Düsterwald Helene und seinem „Sozius“ ein Glas Sekt und stieß dann mit beiden auf eine gute Zusammenarbeit an … Helenes erste Denkaufgaben bestanden darin, sich nach einer Übersicht über die generelle Aktenhaltung einen Einblick in die Ordnung der unterschiedlichen Rechtsverträge zu verschaffen: Ein „Kaufvertrag“ oder eine „Schenkung“ waren etwas anderes als ein „Erbvertrag“, und eine „Vorsorgevollmacht“ war noch längst keine „Entmündigung“! Helenes „Achtung“ vor dem Beruf des Notars steigerte sich dabei langsam, aber stetig zur „Hochachtung“ vor den äußerst verantwortungsvollen Aufgaben eines jeden soliden Juristen „Welch eine Freude und Ehre, diesen Herren dabei behilflich sein zu dürfen, dem Recht und der Gerechtigkeit in der Welt zum ‚Siege zu verhelfen!‘, dachte Helene über den Sinn ihrer Arbeit nach, als sie mal eine kleine Pause hatte … „Bielefeld, den 15. August 1926: Liebe Eltern! Liebe Schwestern! Heute komme ich endlich dazu, ein Lebenszeichen von mir zu geben. Verzeiht bitte, aber es ist in den ersten Wochen meines neuen Lebens so viel auf mich eingestürzt, dass ich es nicht eher geschafft habe. Ich glaube, ich habe es hier in Bielefeld mit meinem Arbeitgeber, meinen Kolleginnen und meiner hübschen Wohnung vorzüglich getroffen. Jedenfalls bin ich rundherum zufrieden und dankbar für mein neues Glück! Wenn auch mein Einkommen noch keine ‚großen Sprünge‘ zulässt, so komme ich mit einiger Bescheidenheit doch gut ‚über die Runden‘ Also macht euch keine Sorgen um eure Helene, eine echte Bandelberg lässt sich so leicht nicht unterkriegen! P.S. Herr Dr. Düsterwald hat mir schon mündlich zugesagt, dass ich ab 01.09.’26 eine offizielle Lehre als ‚ReNo-Gehilfin‘ absolvieren könnte: Ist das nicht wunderbar!!! Schließlich hoffe ich, dass es euch ‚Oberhausener Kohlennasen‘ allesamt noch gut geht und grüße euch aus dem fernen (grünen) Bielefeld ganz, ganz herzlich! Eure Helene.“ Der nächste Sonntag bescherte der grünen Großstadt am Teutoburger Wald und ihrer „Neubürgerin“ Helene einen strahlenden Spätsommertag. Helene hatte gerade einen alten Sessel aus dem Geräteschuppen unter den schiefen Apfelbaum-Veteranen geschleppt, um dort im Schatten der alten „Biesterfelder Goldrenette“ diesen herrlichen Tag zu genießen, als es plötzlich dreimal vor ihrer Tür hupte. Helene warf einen überraschten Blick über ihr blaues Gartentor und entdeckte sofort die Quelle des kleinen Hupkonzerts: Wummernd und tuckernd parkte doch dort einer dieser silbernen Sportwagen der „Auto Union“, und am Steuer dieses offenen Cabriolets mit nur zwei Ledersitzen saß tatsächlich – Herr Notar Schönborn und winkte Helene freundlich zu. „Hallo, Hallo, Fräulein Bandelberg! Wie wär’s mit einer kleinen Spritztour in meinem neuen ‚Audi‘?“ „Oh, Herr Schönborn, welch eine Überraschung! Dankeschön für Ihre Einladung, aber für mich ist solch eine Autofahrt eine absolute Premiere. Was zieht man denn bloß dazu an?“, war Helenes Gegenfrage „Eine Windjacke und ein Kopftuch wären schon hilfreich!“, lachte der junge Notar und freute sich über die mutige Helene. So schnell hatte Helene sich noch nie umgezogen, denn nur zehn Minuten später saß sie im silbernen Cabriolet auf dem roten Beifahrersitz, und zwar mit erwartungsvollen Blicken auf ihren Chauffeur und laut klopfendem Herzen. „Wo soll denn unsere Sonntagsreise hinführen, Herr Schönborn?“ „Oh, das lassen Sie mal eine hübsche kleine Überraschung für Sie sein, Fräulein Bandelberg! Es geht jedenfalls in die Urheimat Ihres Vaters, so viel kann ich verraten.“, schmunzelte der junge Notar geheimnisvoll … Und dann gab er richtig Gas, um die ersten Steigungen zum Teutoburger Wald mit einem unüberhörbaren Tuckern des kleinen Sportwagens zu überwinden. Nach vielen Kurven und einem munteren Auf und Ab in der Mittelgebirgskette mit überwiegendem Nadelholzbestand hielt Herr Schönborn plötzlich an einem kleinen See mitten im Kiefernwald. „Das ist der ‚Donoper Teich‘, hier könnten wir eine kleine Rast mit Kaffee und Kuchen einlegen. Sie sind natürlich mein Gast, liebes Fräulein Bandelberg!“ „Herzlichen Dank, aber ich weiß gar nicht, wie ich Ihre liebevolle Fürsorge zurückgeben könnte!“ „Darüber zerbrechen Sie sich bitte mal nicht Ihren hübschen Kopf!“, lautet das Resümee des jungen Notars und mit diesen Worten holte er aus einem kleinen Lederkoffer im Heck des Wagens zwei Emailletassen, eine Kaffeeflasche aus Aluminium sowie einen kleinen Gugelhupf, der ganz mit weißem Puderzucker überstäubt war und herrlich nach Mandeln duftete … „Herr Schönborn, Sie sind im Zweitberuf sicher Zauberer, stimmt’s?“, platzte es jetzt aber aus Helene heraus „Wenn ich ehrlich bleiben will, muss ich Ihnen, liebe Helene, nun aber eingestehen, dass meine tüchtige Mutter Elisabeth den Kuchen ‚gezaubert‘ hat, als ich ihr mein Vorhaben geschildert habe … Aber, lassen Sie uns bitte eine kleine Runde um den See wandern, bevor ich das eigentliche Ziel unserer Tour ansteuere!“, schlug Herr Schönborn schließlich vor und Helene war froh, sich ein wenig die schlanken Beine vertreten zu können. Aber der schmale Rundwanderweg um den See war von den dicken Wurzelsträngen der betagten Rotfichten und Schwarzkiefern, die den „Donoper Teich“ bewachten, überwuchert und man musste höllisch aufpassen, nicht mit einem Fuß an jenen hängen zu bleiben. Aber bevor Herr Schönborn, der links neben Helene ging, noch eine Warnung geben konnte, war sie mit dem rechten Fuß in einer Wurzelschlaufe gefangen, und drohte der Länge nach den Hang hinabzustürzen. Der junge Notar hörte ihren kurzen Schrei und fing Helene gerade noch rechtzeitig im Sturz mit beiden Armen auf; und beide lehnten sich – tief atmend und mit zitternden Knien – an die Stammruine einer alten Eiche „Na Helene, das ging ja noch einmal gut. Aber ich glaube, diese Wildnis hier ist uns beiden Bürokraten ‚nicht geneigt‘. Lassen Sie uns lieber umkehren!“, und mit diesen Worten bot Herr Schönborn Helene seine starke rechte Hand und Helene nahm sie dankbar und erleichtert an und hielt sie dann ganz fest. Als Herr Schönborn – wenige Minuten später – wieder den starken Motor seines „Audi“ startete, war Helene doch heilfroh, auf glattem Asphalt ihrem eigentlichen Ziel entgegengebracht zu werden als über Stock und Stein stolpern zu müssen. Nun ging es aber erst recht in engen Serpentinen und kontinuierlichen Steigungen bergan. Helene wusste bis dato nicht, dass der „Teuto“ solche Erhebungen vorweisen konnte. Nach ungezählten Kurven jedenfalls, erreichten sie ein Hochplateau, das als „Parkplatz“ ausgewiesen war. Hier stieg Helene nach ihrem Chauffeur aus und bemerkte sofort den Wind, der sie hier oben umschmeichelte … „Wir müssen durch die Schranke dort und dann nach links den breiten Pflasterweg hinan!“, lotste Herr Schönborn Helene in (ihr) unbekanntes Terrain. Sie waren nun nur wenige hundert Meter weiter bergan gestiegen, als Helene „ihn“ sah, den „grünen Hünen“ mit seinem gewaltigen Schwert, von dem sie zwar aus väterlichem Munde schon oft etwas gehört, aber ihn noch nie „in natura“ zu sehen bekommen hatte. „Himmel, der Hermann! Welch ein Koloss!“ „Ja, und wissen Sie was, liebe Helene? Ihr Familienname hat mich erst auf die Idee gebracht, Sie einmal auf den eigentlichen ‚Bandelberg‘ hier oberhalb von Lippe-Detmold zu bringen. Denn diesen ‚grünen Hünen‘ hat ein Ernst von Bandel 1875 als sein Lebenswerk auf diesem Berg errichtet, der allerdings auf allen Karten als ‚die Grotenburg‘ bezeichnet wird …“, klärte der junge Notar unsere Helene auf. „Fräulein Helene, lassen Sie uns dort zur ‚Bandelhütte‘ gehen, dort können Sie mehr erfahren …“ „Welch eine kluge Idee, welch liebevolle ausgewählte Route speziell für mich!“, dachte Helene und spürte förmlich, wie ihr Herz höher schlug, wenn sie Herrn Schönborn anschaute oder ihm zuhörte. Und als die beiden jungen Menschen eine Stunde später die etlichen Stufen des Denkmals erklommen hatten und begeistert nebeneinanderstehend den Blick über das zauberhafte „Lipperland“ und den Teutoburger Wald schweifen lassen konnten, drückte Helene urplötzlich den jungen Notar und Reiseführer fest an sich und sagte nur: „Danke! Danke! Danke!“ Als Helene am Abend dieses wunderschönen Spätsommertages in ihrem Kuschelbett lag und mit vollem Herzen über den Ablauf dieser „Fahrt ins Blaue“ nachdachte, stellte sich in ihr ein beruhigendes Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit ein. Es war die Gewissheit, jetzt endgültig in ihrer „zweiten Heimat“ angekommen zu sein „Offenbar reicht dazu allein die Präsenz und die Herzlichkeit eines einzelnen lieben Menschen, auf den man bauen, und dem man vertrauen kann!“, philosophierte Helene kurz vor dem Einschlafen. Und wer damit gemeint war, daran gab es seit heute nun keinen Zweifel, nämlich Siegfried Schönborn, Helenes „ritterlicher Chauffeur“ durch das neue Kapitel ihres Lebens. Getragen von diesem Glücksgefühl machte jetzt die Arbeit im Notariat doppelt so viel Spaß und Helenes zwei Lehrjahre zur „ReNo-Gehilfin“ flogen dahin wie lebensfrohe Schwalben im Sommer … Regelmäßig trafen sich der junge Notar und Helene nun in ihrer Wohnung, um gemeinsam zu lernen, zu kochen oder Pläne über Spritztouren in die nähere Umgebung zu schmieden. Helene hatte Siegfried inzwischen auch mitgeteilt, dass ihr Vater Friedrich der Nacherbe (Anerbe) eines uralten Fachwerkkottens im „Mühlbachtal“ eines kleinen lippischen Dorfes namens „Hermannsthal“ sei und nun waren beide natürlich sehr neugierig, diese „Urheimat“ der Bandelbergs so bald wie möglich zu erkunden „Nächsten Sonnabend könnten wir das Erbe deines Vaters einmal in Augenschein nehmen“, bekundete Siegfried seiner neuen Herzensdame eines Tages im September. Gesagt, getan: An jenem Samstagmittag tuckerten Siegfried und Helene durch das westliche „Lipperland“ – immer dem Teutoburger Wald nach Süden folgend – bis in die Nähe der „Externsteine“ in ein wildromantisches Bachtal, wo schließlich eine alte Frau, die gerade im Bach ihre Kartoffeln wusch, nach dem „Bandelbergschen Hof“ befragt werden musste „Dort nebenan das alte Fachwerk mit der dicken Kastanie davor, das ist es“, informierte sie das junge Paar. Und Augenblicke später fuhren sie bis zur Kastanie vor, stiegen aus und näherten sich dem großen grünen Dielentor, das halb geöffnet war … „Hallo, guten Tag, ist hier jemand zu Hause?“, rief Siegfried jetzt in die dunkle Diele des alten Kottens. Eine lange Minute hörte man nur das Knurren und Bellen eines kleinen Hundes, aber dann wankte eine uralte korpulente Dame mit langer silbergrauer Kittelschürze ins Tageslicht. „Jau, jau, eck kumm oll reike! Watt wutt jui vandage?“ (LP1) „Guten Tag, Frau Schlüter! Mein Name ist Schönborn, ich bin Notar in Bielefeld und wollte Fräulein Helene Bandelberg, hier an meiner Seite, einmal das Erbe ihres Vaters Friedrich zeigen. Dürfen wir kurz zu Ihnen hineinkommen?“ „Ochott, ochott, dat Lenchen! Seo graut un seo scheun biste worn! Na, denn kümmt harümme: Öbber pass upp, dat jühr nich stölkert!“ (LP2) Und diese letzte Warnung in „Lippisch Platt“ war wohl dringend nötig, denn in der dunklen großen Diele standen überall irgendwelche Arbeitsgeräte, Holzkisten, Schüsseln und Eimer herum, und zwar nach einem System, welches allein die alte „Tante Minna“ überblickte … „Gong man sitten iner Hurke uppe Obenbank!“, (LP3) bot ihnen nun die alte Frau einen Platz direkt am Ofen an und die beiden fanden tatsächlich ein kleines freies Plätzchen auf der warmen Ofenbank „Eck häw just paar lippske Pickerts van dage: De könn jai eten, dänn shinnt de Sunne!“ (LP4) Nach dem Genuss der leckeren goldgelben „lippischen Pickerts“ erzählte der junge Notar der alten Tante Minna, was er von den Zukunftsplänen des Anerben Friedrich an Wichtigem erfahren hatte: Helenes Vater Friedrich war gegenwärtig noch in einer gut bezahlten Position als „Steiger“ einer Oberhausener Zeche tätig und beabsichtigte diese Position bis zum Jahre 1935 dort auszuüben, soweit nicht gesundheitliche Probleme dagegensprechen würden … „Ab spätestens Sommer ’35 will Herr Bandelberg also wohl hier im Hermannsthal sein Erbe antreten und dann wieder Landwirtschaft mit Ackerbau und Viehzucht betreiben.“, klärte Siegfried die alte Frau auf „Wenn eck denn man blauß man nich unnern Torwe liege!“, (LP5) befürchtete diese nach einer kurzen Denkpause „Na, denn soll mui de Herrenmüller man paar Jahr hälpen!“ (LP6) Der „Herrenmüller“ hatte nämlich bis dato einen großen Teil der Felder und Wiesen der Bandelbergs gepachtet und besaß – neben einer eigenen Dreschmaschine – sowohl einige Pferde als auch den ersten Traktor im Dorfe, sodass er kleineren Bauern – gegen gute Bezahlung – aushelfen konnte, die karge Ernte einzubringen. Helene hatte sich das Erbe ihres Vaters im Hermannsthal längst nicht so groß und weitläufig vorgestellt. Jetzt verstand sie, warum sich ihr Vater wohl immer schon einen Sohn gewünscht hatte … Na ja, vielleicht angelte sich eine ihrer Schwestern doch noch einen jungen Bauernsohn, der dann dem Vater bei Ackerbau und Viehzucht später zur Hand gehen konnte, so hoffte Helene, als sie sich mit Siegfried am späten Nachmittag von „Tante Minna“ mit herzlichem Dank verabschiedete und dann über die lippischen Walddörfer wieder in die Großstadt zurückkehrte „Welch eine andere Welt ist doch solch ein Walddorf. Ohne Pferd oder Kutsche bist du hier ein Niemand! Ansonsten dreht sich (dort) wohl alles um die menschlichen Grundbedürfnisse, nämlich Nahrung, Kleidung und Wohnung: Für Kultur ist im rauen Alltag dort kaum Platz!“, gruselte sich Helene und war froh, wieder in ihrem „kleinen Reich“ in Bielefeld zurück zu sein. Andererseits schien solch eine dörfliche Gemeinschaft immun zu sein gegen den wohl größten „Unruhestifter“ dieser Zeit, nämlich die Arbeits- und Besitzlosigkeit. Jeder schien sich hier irgendwie in den Kampf ums tägliche Leben zu stürzen und selbst ein kleiner Garten wurde zur „Schatztruhe“, die den Familien ihre Grundnahrungsmittel und ihre „Dauerbeschäftigung“ in frischer Luft sicherte … Helene hatte trotz ihres recht behüteten Elternhauses in Oberhausen längst die bedrückende Not der Millionen Arbeitslosen in der 20er-Jahren wahrgenommen. Aber sie misstraute gleichzeitig erheblich diesem aalglatten und skrupellosen neuen „Rattenfänger“ aus Österreich, der dem „Deutschen Volk“ alles versprach, was es jetzt hören wollte: „Arbeitsplätze, Wohlstand, Autonomie und internationale Anerkennung, Lebensraum und Weltmachtstatus!“ „Eindeutig zu dick aufgetragen, was dieser braune Schreihals landauf, landab in seinen Wahlkampfreden verkündet!“, vermerkte Helene am 15. Januar 1933 in ihrem „geheimen“ Tagebuch, das sie von Oberhausen nach Bielefeld mit geschleust hatte und dessen Inhalt nicht einmal Siegfried kannte „Habe aber noch die Hoffnung, dass es neben den vielen machthungrigen deutschen Männern in braunen Uniformen auch ausreichend kluge friedliebende deutsche Frauen gibt, die – hoffentlich! – das Schlimmste verhindern könnten, nämlich ‚Bürgerkrieg‘ oder gar ‚Völkerkrieg‘!!!“, ergänzte sie ihren Tagebucheintrag an diesem Tage, welcher der „NSDAP“ einen gewaltigen Zuwachs an Stimmen (+14 %) und Mandaten (40 %) bei den Landtagswahlen zum „Lippischen Landtag“ (im Ländchen „Schaumburg-Lippe“) bescherte. Traditionell war unter der Oberhausener Bevölkerung der „kleinen Leute“ die „SPD“ seit „Kaisers Zeiten“ parteipolitischer „Marktführer“ gewesen und Helenes Vater Friedrich war stets überzeugter „Sozialdemokrat“ mit gewerkschaftlichem Engagement in seiner Zeche. So war es nicht verwunderlich, dass auch seine klügste Tochter Helene in die Fußstapfen ihres geliebten Vaters treten wollte „Vielleicht lässt sich ja innerhalb der ‚SPD‘ so etwas wie eine ‚Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen‘ einrichten, die ein gewisses Gegengewicht gegen männliche Großmannssucht (Siegermentalität) bilden könnte!“, hoffte sie inständig. Helene und Siegfried waren sich inzwischen so nah gekommen, dass sie gemeinsam einen festen Plan für ihre nahe Zukunft schmieden konnten: Wenn alles gut klappte, wollte der junge Notar ab 01.04.1935 eine eigene Sozietät in Detmold, der lippischen Residenzstadt, eröffnen. Dort, nur wenige Kilometer von Friedrich Bandelbergs Erbhof entfernt, sollte dann Helene seine „rechte Hand“ im Notariat sein und ihn nach besten Kräften unterstützen. Da Vater Friedrich ebenfalls diesen Zeitpunkt für eine Übersiedlung seiner Familie von Oberhausen nach Hermannsthal vorgesehen hatte, wäre Helene dann ganz in der Nähe ihrer Lieben, so war der schöne Plan. Aber „Der Mensch denkt und Gott lenkt!“ wie Helenes Mutter des Öfteren den veränderten Ablauf des Alltags zu kommentieren pflegte. An einem trüben Nebeltag im November 1934 wollte Siegfried von Bielefeld kommend, nach einem kurzen Abstecher in die neu eingerichtete Detmolder Kanzlei, zu einem wichtigen Beurkundungstermin nach Paderborn. Der schnellste, wenn auch steilste Weg, das wusste er, führte mitten über den Kamm des Teutoburger Waldes, nämlich die „Gauseköte“ zwischen Detmold und Schlangen. Jetzt, im November, war dieser „Gebirgspass“ zum Glück noch nicht gesperrt. Also wählte er diese gefährliche Abkürzung, um eine Menge Zeit zu sparen … Nach der Überwindung des höchsten Punktes ging es nun in langen geraden Bodenwellen immer bergab „Mal sehen, was mein Audi noch so drauf hat!“, dachte er und ließ den rechten Fuß auf dem Gaspedal … Schon tauchte vor Siegfried die schnurgerade nach Süden verlaufende „Fürstenallee“ auf, mit den uralten gewaltigen Eichenbäumen beiderseits der Fahrbahn. Sie waren dann auch das Letzte, was der junge Notar noch verschwommen im Nebel wahrnehmen konnte, ehe – mit einem fürchterlichen Schlag – sein junges Lebenslicht ausgelöscht wurde: Ein kapitaler Rothirschbulle hatte auf seiner blinden Verfolgungsjagd hinter seinen Hirschkühen die Fahrbahn von links nach rechts kreuzen wollen und war dabei mit dem kleinen Sportwagen heftig kollidiert
Die Fürstenallee bei Schlangen: Hier verunglückte Siegfried tödlich! Übersetzung der plattdeutschen Passagen (Beruhend auf dem „Wörterbuch: Hochdeutsch – Lippisches Plattdeutsch“; Herausgeber vom „Lippischen Heimatbund“ – 2003 – in der Bearbeitung von Sabine Schierholz nach einer Vorlage von Fritz Platenau) LP1. Jau, jau, eck kumm oll reike! = Ja, Ja, ich komme ganz schnell! Watt wutt jui vandage? = Was wollt ihr denn (nur)? LP2. Ochott, ochott, dat Lenchen! Seo graut un seo scheun biste worn! = Ach Gott, ach Gott, das Lenchen! So groß und schön bist du geworden! Na, denn kümmt harümme: Öbber pass upp, dat jühr nich stölkert! = Nun denn kommt mal rein: Aber passt gut auf, dass ihr nicht stolpert! LP3. Gong man sitten iner Hurke uppe Obenbank! = Nun hockt euch erst mal auf die warme Ofenbank! LP4. Eck häw just paar lippske Pickerts van dage: De könn jai eten, dänn shinnt de Sunne! = Ich habe heute gerade mal ein paar Lippische Pickerts: Die könnt ihr futtern! Dann scheint die Sonne! LP5. Wenn eck denn man blauß man nich unnern Torwe liege! = Wenn ich dann mal nicht schon unter der Erde bin! LP6. Na, denn soll mui de Herrenmüller man paar Jahr hälpen! = Nun, dann muss nur der Herrenmüller noch ein paar Jahre aushelfen! Hermannsdenkmal (Detmold/Lippe): Von der Höhe dieses Denkmals auf der Grotenburg bei Detmold bewunderten Helene und Siegfried das wunderschöne Lipperland, die Heimat von Helenes Vater
3. Helenes feste Heiratspläne. Sieben wunderschöne Jahre hatte Helene mit Siegfried erleben dürfen, bevor ein brutales Unglück ihre Pläne für eine eheliche Gemeinschaft mit dem geliebten Partner zunichtemachte. Helene hatte in weiblich verständlicher Voraussicht – im Heimatdorf ihres Vaters, gleich in der Nachbarschaft zum Erbhof, im Hause des Lehrers Recker – ein großes weitläufiges Zimmer gemietet, das sie – nach und nach – mit wertvollen Schlafzimmermöbeln in Eiche mit echten Messingbeschlägen ausstatten ließ. Hinzu kaufte sie noch zwei Garnituren einer mit Rosen bestickten Bettwäsche und ein hochwertiges Kaffeeservice mit goldener Umrandung. Das alles sollte Helenes „Aussteuer“ für die möglichst baldige Ehe mit Siegfried darstellen. Und jetzt, nach seinem urplötzlichen Tod, fühlte sie sich wie eine Witwe im Alter von nur 26 Jahren, wenn sie an den Wochenenden in ihrem luxuriösen „Aussteuer-Salon“ in Hermannsthal übernachtete … Nichts und niemand, auch kein „gnädiger Herrgott“, konnte Helene jetzt in ihrer tiefen Trauer trösten. So blieb ihr hier in dieser erzwungenen Isolation nur ihr altes Tagebuch, dem sie ihre Gefühle und geheimsten Gedanken anvertrauen mochte. Dabei tauchten als dunkle Schatten immer wieder die Wahrnehmungen der aktuellen politischen Verwerfungen, angezettelt durch diese menschenverachtenden braunen Horden, wie Sturmwolken über dem kleinen persönlichen Sehnsuchtshimmel unserer Helene auf … Nun, da der „alte Mann des Ausgleichs“ das Zepter der Staatsmacht an diesen jungen Heißsporn und Schreihals abgegeben hatte, sah man sich als „freigeistiger“ Mensch ständig in der Gefahr, als „Volksverräter“ und „Führerfeind“ denunziert zu werden „Selbst mein lieber Vater Friedrich muss sich jetzt hüten, sein Bekenntnis zu den Sozialdemokraten öffentlich zu machen!“, sorgte sich Helene in einer Eintragung ins Tagebuch vom Februar 1933. Helene, die nun auch in ihrer äußeren Erscheinung gänzlich das Erscheinungsbild einer tief trauernden Witwe widerspiegelte, verglich sich bald in ihren Tagträumen mit einer wunderschönen, jedoch tieftraurigen einsamen „schwarzen Rose“ Und darum zeichnete sie (auch) auf die Innenseite des Tagebuchumschlages nun eine große schwarze Rose und kündigte ihre weiteren Einträge unter der Rubrik an: „Süßes oder Saures aus dem Leben der ‚Schwarzen Rose!‘“ Die Nachbarsfrauen im „Mühlbachtal“, deren Alltag überwiegend mit der Versorgung und Aufzucht ihrer bäuerlichen Großfamilien ausgefüllt war, beobachteten argwöhnisch, neidisch oder gar missgünstig die elegante, gebildete und dazu noch sehr hübsche junge Dame, die aus der Großstadt kommend, hier im kleinen „Bauerndorf“ Quartier bezogen hatte und neuerdings beinahe ganz in Schwarz gekleidet erschien. Gerüchteweise hatte sie kürzlich ihren „Zukünftigen“, einen jungen Notar aus Bielefeld, durch einen Autounfall verloren: Und schon hatte Helene bei jenen schlichten Gemütern einen heimlichen Spottnamen zugeteilt bekommen: „Helene, die ewige Braut!“ Genau das flüsterten sich die Nachbarinnen mit brutaler Häme regelmäßig zu, wenn Helene am Wochenende mit ihrem kleinen schwarzen Rollkoffer, vom Bahnhof kommend, ihr kleines Quartier im großen Lehrerhaus ansteuerte … Oder: „Mal sehen, wer sich als Nächster mit ihr verlobt!“ Helene ließ diesen Spott, soweit sie von ihm erfuhr, erst einmal dort, wo er hingehörte: nämlich auf den Misthaufen jener missgünstigen Bauersfrauen. Stattdessen suchte sie die echte Freundschaft und das Vertrauen von nur drei klugen Frauen im „Mühlbachtal“: Das war zum Ersten die alte blinde Schwester des Lehrers Recker, „Tante Anna“, die Helene mit ihrer ganz großen Lebensklugheit mütterlich beratend zur Seite stand; zum Zweiten die hochgebildete Tochter „Auguste“ des Regierungsrates a. D. Schwappe, und zum Dritten die stets charmante und sportliche Bürgermeistertochter „Elisabeth“ „Weniger ist mehr!“ Nach dieser Devise verfuhr Helene bei der Auswahl ihrer „vertrauten Freundinnen“, und das war gut so, wie sie noch später erfahren sollte … Die Externsteine (bei Horn/Lippe): Mystische Felsengruppe im südlichen Teutoburger Wald, wenige Kilometer davon entfernt lag der Erbhof von Helenes Vater Friedrich
5. Helene verliert ihr Elternhaus
Der Bandelbergsche Kotten im Winter 1938 vor dem Brand. Helenes Vater, Friedrich Bandelberg, der schon mit dreißig Jahren aus dem ländlichen „Lipperland“ ins industriell „explodierende“ Ruhrgebiet mit seinen unzähligen Kohlenzechen gegangen war, wo er als gelernter Maurermeister recht bald einen Posten als „Steiger“ an der Zeche „Concordia“ in Oberhausen/Lirich erhielt, bemerkte, dass in den letzten Jahren sein Rücken dieser schweren Aufgabe in zunehmendem Maße nicht mehr gewachsen war. Deshalb stand im Herbst des Jahres 1935 für ihn fest, ab Frühjahr 1936 in „Frührente“ zu gehen und mit seiner Restfamilie von „Oberhausen“ nach „Hermannsthal“ umzusiedeln, um dort auf seinem Erbhof, dem über 200 Jahre alten Fachwerkkotten im wildromantischen „Mühlbachtal“, seinen Lebensabend zu verbringen. Und nachdem bis März 1936 alle bürokratischen Formalitäten erledigt waren, packten die Bandelbergs Anfang April 1936 ihre „Siebensachen“, räumten das oft viel zu kleine Bergmannsheim in Oberhausen und fuhren per Eisenbahn in ihr neues altes Heimatdorf Hermannsthal ins südliche „Lipperland“! Hier wartete in Friedrichs Erbhof nur noch die alte, inzwischen fast ganz erblindete „Tante Minna“ auf die Bandelbergs: „O chott, o chott! Fritze! Geot dat diu endlick kümmst! Dat Lieben mott foidergohn hürteo lanne!“, (LP1) rief sie ihm aus tiefstem Herzen entgegen. Und dann nahm Friedrich die alte treue Tante Minna erst einmal lange in seine kräftigen Arme und beruhigte sie dann mit den Worten: „Liebe Tante Minna, ab heute hast du wieder eine Familie. Wir wollen dir ab heute nämlich alle helfen, hier in Hermannsthal über die Runden zu kommen. Und tausend mal Dankeschön, dass du so lange durchgehalten hast!“ Und damit nahmen die Bandelbergs das uralte Bauernhaus mit Schleppdach sowie einem Stall-Anbau für die Ziegen-, Schweine- und Hühnerhaltung in Besitz. Das heißt nach und nach füllten sich wieder die einzelnen Räumlichkeiten mit Mobiliar, mit Lebens- oder Futtermitteln und – mit Haustieren! Ein Jahr nach dem Einzug, also etwa im Sommer 1937, hatte Friedrich Bandelberg auch schon mit den Nachbarbauern und dem „Herrenmüller“ so guten Kontakt, dass etwa die Hälfte seiner Felder von zuverlässigen Pächtern bearbeitet und abgeerntet wurde. Friedrich erhielt dafür nicht immer Bargeld, sondern meistens „Naturalien“ in Form von Kartoffeln, Obst, Rüben oder Getreide, die ihm halfen, über den langen lippischen Winter zu kommen … Heu und Stroh waren Friedrich auch willkommene Pachtgaben, die er für die Ziegen- und Schweinehaltung gut gebrauchen konnte: Sie lagerten dicht gepresst ab dem Spätsommer „frisch“ auf dem großen Dachboden in zwei Etagen. Helenes Mutter Marie beäugte zunächst alle Räumlichkeiten und das karge Inventar mit erheblicher großstädtischer Skepsis: Sie hielt ihre Oberhausener Wohnung nachträglich für „klein, aber fein“! Am meisten störte sie aber die ständige „Dämmerung“ in der Diele des alten Kottens: „Friedchen, lass mal schön die Sonne ins Haus: Mach ruhig die Dielentür ganz weit auf!“, rief sie das ein oder andere Mal ihrer jüngsten Tochter zu. „Dann können wir sogar den Mühlenbach plätschern hören.“ Ja, dies alte wettergegerbte Bauernhaus war für die langjährigen Großstädter doch recht „gewöhnungsbedürftig“, um das Wort „primitiv“ zu vermeiden. Na, vielleicht waren ja wenigstens die neuen Nachbarn im „Mühlbachtal“ etwas „einladender“, so hoffte Marie Bandelberg von Herzen … Aber die schlichte feiste „Lina“ im Nachbarhaus links nebenan hatte mit der „Aufzucht“ von (bislang) fünf Kindern und etlichen Haustieren eine solche Überfülle an alltäglicher Last zu tragen, dass sie kaum Zeit zum Luft-Schnappen, geschweige denn zur Muße auf der schiefen Gartenbank hatte. Und die Nachbarin zur Rechten, die Ehefrau Charlotte des Ortsbürgermeisters Berkel, trug die Nase so hoch, dass sie Halsschmerzen befürchtete, wenn sie etwa auf diese neuen „Krauter“ aus dem „Kohlenpott“ herabzublicken genötigt wäre. Am Ende eines sonnenreichen Sommers des Jahres 1939 war jedenfalls der Strohboden des alten Bauernhauses prall gefüllt mit frischem Heu und neuem Stroh: Friedrich hatte von seinem Getreidefeld auf dem großen Acker südlich des Kottens eine besonders gute Ernte an Weizen und Hafer einbringen können. So war nun der Giebel des Fachwerkhauses bis in den letzten Winkel dicht bepackt mit Nahrung oder Streu für Friedrichs Haustiere: Zwei weiße Milchziegen, zwei Sauen, ein Dutzend bunte Hühner („Italiener“ genannt) und zehn Gänse! An einem schwülwarmen Samstagnachmittag im August wollte Hausherr Friedrich sich gerade auf seiner stabilen selbst gezimmerten „Feierabendbank“ im Schatten des alten Zwetschgenbaumes gemütlich machen, als er über seinem Kopf ein endloses Summen und Brummen vernahm, was ihn in seinem Ruhebedürfnis erheblich störte. Es war ein Schwarm wilder Hornissen, die offenbar unterhalb des Schleppdaches ein neues „Heim“ für ihre „Großfamilie“ bauten „Baut, was ihr wollt, aber nicht bei mir!“, dachte Friedrich und hatte noch die Gräuelmärchen aus der Kindheit im Gedächtnis, nämlich, dass drei Hornissenstiche einen Menschen, aber sieben sogar ein Pferd töten könnten. Und deshalb standen diese an sich sehr scheuen Insekten auf Friedrichs schwarzer Liste „unwürdiger Kreaturen“ ganz vorne, sodass er nicht lang überlegte, wie man diese „elenden Biester“ auf schnellstem Wege wieder loswerden konnte. Und schon bald kam ihm die unselige Idee, den Hornissenschwarm samt seiner Brut im Kokon auszuräuchern! Dazu benötigte er jetzt eine lange Bohnenstange, einen alten Putzlappen, ein Stück Draht und einen tüchtigen Schuss Petroleum aus der Stalllaterne. In wenigen Minuten hatte Friedrich seine gewaltige „Räucherstange“ mithilfe seines Feuerzeuges in Brand gesetzt: Der Putzlappen brannte lichterloh und sandte dicke schwarze Rußwolken in den azurblauen Sommerhimmel. Jetzt fuchtelte Friedrich mit seiner verlängerten Brandfackel direkt unter dem Hornissennest hin und her, dabei berührte er wohl auch das papierähnliche Nest, das am Dachbalken klebte, und sich in Sekunden mit einer hellen Stichflamme entzündete: Die so „gefeuerten“ Insekten schwärmten brennend zu ihrem allerletzten Flug durch die offen stehende Dachluke in den strohgefüllten Giebel und entzündeten dort hundertfach zunächst kleine Feuer, die sich jedoch innerhalb von wenigen Minuten zu einem großen Inferno aus Flammen vereinigten. „Marie, Marie! Anna! Friedchen! Tante Minna! Kommt sofort raus und holt Wasser aus dem Mühlbach! Anna, lauf zum Spritzenhaus und sag dem Fritz Blume, er soll sofort mit der Handpumpenspritze anrücken! Friedchen, sag dem Bürgermeister Bescheid und allen Nachbarn!“ Friedrichs Stimme wurde aber schon bald übertönt vom Brausen, Knistern und Knacken der gierigen Flammen, die jetzt schon hoch über das Dach hinausschossen und in dem alten Fachwerkkotten beste Nahrung fanden. Wie ein Lauffeuer hatte sich die Nachricht im kleinen Hermannsthal verbreitet: Bei den Bandelbergs brennt es! Und die ersten Nachbarn kamen jetzt mit Eimern in der Hand, liefen zum „Mühlbach“ hinab, und schleppten ihren kleinen „Löschbeitrag“ bis zur großen Kastanie an der Straße: Näher konnten sie nicht an die Brandstelle gehen, denn die Strahlungshitze war außerordentlich groß. Als nach etwa dreißig Minuten auch Fritz Blume mit seiner Handpumpe und drei Feuerwehrmännern anrückte und in der Nähe des „Mühlbaches“ Aufstellung nahm, war bereits schon die südliche Hälfte mitsamt dem Schleppdach ein Raub der Flammen geworden: So konnte aber wenigstens die der Straße zugewandte Nordhälfte des alten Fachwerkkottens mithilfe des Bachwassers gerettet werden. Dies wurde von den Feuerwehrmännern als ein „Glück im Unglück“ gewertet, aber das war für Friedrich Bandelberg sicherlich kein Trost: Er stand dort lange an dem ebenfalls in Mitleidenschaft gezogenen Stamm der Rosskastanie, war erstarrt wie ein Fels und schämte sich jetzt zutiefst für seinen Leichtsinn und seine Unbedachtheit! Friedrich war in diesem Moment der Auffassung, dass dies der tiefste Punkt seiner Lebenslinie sein müsste; aber es war gut, dass er kein Hellseher war: Denn da warteten noch einige tiefe „Täler“ auf ihn und seine Lieben … Der Bandelbergkotten als Brandruine im Mai 1940
7. Helenes große Liebe. Ehemaliger Wohntrakt der NS-Heil- und Pflegeanstalt „Eichenhof“ bei Lemgo/Lippe: Hier wurde Helene 1939 bis 1944 zwangsweise als „Geisteskranke“ stigmatisiert und entwürdigt
9. Helene wird Mutter auf Zeit. Während Johannes in Hadamar mehr und mehr den Eindruck gewann, von Dr. Julius Müller in einen Vorhof der Hölle zwangsversetzt worden zu sein, bedeutete der kleine werdende Mensch in Helenes Gebärmutter ein wunderbares Licht der Hoffnung, welches sie nun wärmte und aus ihrer alten dunklen Depression herausführte. Wenn es nur diesen alten geilen Bock eines Anstaltsleiters nicht mehr gäbe, von dem sich Helene beinahe täglich bedrängt fühlte. Hoffentlich entdeckte er nicht so bald ihr süßes Geheimnis, sodass der kleine Mensch überhaupt eine Chance bekam, das Licht der Welt und das liebende Gesicht seiner Mutter erblicken zu können. Jeden Abend waren dies Helenes Wünsche für die nahe Zukunft und sie nahm sie bald in ihr Nachtgebet auf. Bei der nächsten Visite bat Helene um ein reines Vieraugengespräch mit dem Direktor. Es wurde ihr gewährt und sie flüsterte ihm, dem „überaus soliden Familienvater im langjährigen glücklichen Ehestand“ etwas so Abschreckendes ins Ohr, dass dieser tatsächlich für die nächste Zeit zu Helenes Körper eine ausreichende Distanz bewahrte. Auch Helenes Flurnachbarinnen, die 42-jährige blonde Irmgard mit den wasserhellen blauen Augen und die 50-jährige mollige Waltraud mit dem dunkelblonden „Bubikopf“, den braunen Augen und der frechen Stupsnase, kamen aus dem Staunen nicht heraus: „Du, Lenchen, du musst dem geilen Julius aber einen gehörigen Schrecken versetzt haben, denn der lässt dich, seine liebste Patientin, urplötzlich ganz links liegen!“, stellte Waltraud beim gemeinsamen Abendessen fest „Na, wenn der sich nicht mal bald eine neue Favoritin ausguckt!“, warnte Irmgard. Und wie recht sie hatte: In den nächsten Tagen sah man Dr. Julius Müller auffallend häufig – meist kurz nach Mittag oder spät nach dem Abendessen – über den Flur der „Schizo-Frauen“ (Heim-Jargon) schleichen, um dann bald – mit kleinen Geschenken ausgerüstet – in Irmgards Pflegezimmer, am Ende des langen Flures gelegen, zu verschwinden. „Kein Zweifel“, folgerte Helene, „der alte Bock hat sich die blonde langhaarige Irmgard auserkoren, weil sie seinem ‚arischen Idealbild‘ einer deutschen Frau offenbar am nächsten kam!“ Dass Irmgard ihn ab und zu mit „Nicki“ anredete, ihrem längst verstorbenen ersten Geliebten, störte den Oberpsychiater überhaupt nicht: Das war für Julius Müller sogar ein ganz besonderes Kompliment, immerhin hielt Irmgard ihn trotz seiner Korpulenz und seines Alters offenbar noch für einen „feurigen Liebhaber“. Wie schmeichelhaft! „Soll er in seiner gockelhaften Verliebtheit die einsame Irmgard so viel beglücken, wie er mag“, dachte Helene. „Solange er mich und mein kleines Glück nicht bedroht, kann es mir eigentlich egal sein!“ Aber gleichzeitig schämte sie sich doch ein wenig, weil sie es gewagt hatte, einmal nur ganz an sich zu denken … Falls es jedoch irgendwann Dr. Julius Müller gefallen sollte, sich an ihr, Helene, trotz ihrer Schwangerschaft zu vergreifen und sie zum Verkehr zu zwingen, hatte sie sich geschworen, diesen geilen alten Bock endgültig in die Hölle zu befördern. Ein kleines Depot mit den für diesen speziellen Fall notwendigen „Beförderungsmitteln“ hatte sich die medizinisch nicht unerfahrene Patientin unter den Slips in der untersten Schublade ihres Nachtischschränkchens angelegt: Es war eine Sammlung von Resten der stärksten Medikamente gegen Epilepsie und Schizophrenie einerseits sowie drei steril verpackte Leerspritzen. Und ihre „Wunderwaffe“, nämlich „Digitalis purpurea“, jenes hochwirksame, aber auch hochgiftige Glykosid gegen zum Beispiel Herzinsuffizienz oder Vorhofflimmern! Das letztere Medikament hatte Helene während der Nachtschicht und bei Abwesenheit der diensthabenden Nachtschwester Martha aus dem „Giftschrank“ entnommen. Nur wenige Tropfen zu viel führten zum Herzstillstand, so viel wusste Helene. Darum sollte die Verwendung von „Digitalis“ für sie immer nur der letzte Ausweg sein: Zum Angriff auf ihre Todfeinde oder zur Flucht aus einem unerträglichen Leben. Zunächst fieberte sie jedoch dem möglichen Niederkunftstermin Mitte Mai 1943 entgegen. Ob ihr „Kind der Liebe“ eine kleine Johanna oder ein kleiner Johannes sein würde, war Helene wirklich einerlei: Sie würde dieses Geschenk mit der ganzen heißen Liebe ihres Herzens annehmen und pflegen, dessen war sie sich ganz gewiss. Und so wartete Helene ungeduldig auf den errechneten Termin, nämlich den 15. Mai, und betete, dass nichts „Störendes“ dazwischenkam. Doch nur wenige Tage vor dem Geburtstermin erhielt die hochschwangere Helene von ihrem ehemaligen Chef, Herrn Notar Dr. Düsterwald, eine wundervolle Nachricht: Jener unselige Antrag des Dr. Müller vom 20.12.1942 auf Unfruchtbarmachung (Zwangssterilisierung) der Patientin Helene Bandelberg wurde vom zuständigen Erbgesundheitsgericht in D. abgelehnt. Helene konnte ihr Glück erst mal gar nicht fassen: Gab es in diesem Staat tatsächlich doch eine Institution, die der Willkür Einzelner Grenzen setzen konnte? „Nun, das habe ich sicherlich eher dem segensreichen Einfluss des Herrn Dr. Düsterwald zu verdanken!“, war sie schließlich überzeugt „Dieser kluge und ehrliche Mann wäre doch der ideale Pate für mein Kind!“, schoss es ihr durch den Kopf „Ich werde ihn zu gegebener Zeit bitten, mir diesen Herzenswunsch zu erfüllen!“, nahm sie sich fest vor … Durch einen weiteren „Geheimbefehl“ des Führers wurde etwa ab Sommer 1941 in weitgehender Autonomie durch die Leiter gewisser geschlossener Irrenanstalten die Selektion und Tötung „lebensunwerter Geisteskranker“ angeordnet: Besonders geisteskranke „Nicht-Arier“, „idiotische Kinder“ und „KZ-Häftlinge“ wurden gnadenlos aussortiert, um – nach einer kurzen Umverlegung – zum Beispiel in Grafeneck, Brandenburg, Hartheim, Sonnenstein und Hadamar ins Gas geschickt oder per Giftspritze (z. B. mit „Veronal“, „Luminal“, „Morphium-Skopolamin“) getötet zu werden („liquidiert“) Aufgrund dieser streng geheimen Erlasslage avancierten die Leiter bestimmter geschlossener Anstalten zu „Herren über Leben und Tod“ gesteuert von rassistischen Wahnvorstellungen und persönlichem „Ehrgeiz“ war letztlich niemand unter den psychisch Kranken seines Lebens mehr sicher. Auch Julius Müller verspürte in seiner Funktion als leitender Direktor des „Eichenhofs“ einen permanenten Machtzuwachs ohne jede staatliche Kontrolle. Er entschied letztlich, zusammen mit seinem Stellvertreter, Oberarzt Dr. Seicht, und der Oberschwester Martha Stumme, welcher Patient als „lebensunwert“ eingestuft werden sollte: Helene bemerkte nun beim morgendlichen Blick aus ihrem Fenster in den Innenhof, dass sich die Reihen der Patienten dort unten auf dem Hof nach und nach „lichteten“ Besonders die nach Gangbild und Aussehen besonders auffälligen Patienten verschwanden nach kurzem „Zwischenspiel“ und tauchten auch im Hause (z. B. Speisesaal) später nicht mehr auf. Direktor Müller sorgte offensichtlich stets für eine „diskrete Entsorgung“ und eine verschleiernde Falschmeldung an die entsprechenden nahen Angehörigen „Wer soll diesen braunen Menschenschinder und Überzeugungstäter denn nur stoppen?“, fragte sich Helene immer häufiger … Und sie nahm sich vor, nein, sie schwor sich, dass sie bei der nächsten sexuellen Belästigung durch Dr. Julius Müller handeln müsse, auch im Interesse und zum Schutz ihrer hilflosen Mitpatientinnen! Aber zunächst wartete sie auf das einzigartige Ereignis in ihrem viel zu langen Anstaltsleben: Die Geburt ihres ersten Kindes. Während der letzten acht Wochen hatte sich das kleine werdende Menschenkind in ihrem Uterus durch zunehmende „Strampeltätigkeit“ bemerkbar gemacht: „Temperament und Sportlichkeit sind schon deutlich spürbar!“, berichtete Helene ihren vertrauten Freundinnen das eine und andere Mal richtig stolz „Na, dann kommt das Baby ganz nach seiner Mutter!“, bekam sie dann häufig zur Antwort. In der Nacht vom 14. auf den 15. Mai kam zum Strampeln allerdings ein ziehender Schmerz im Unterleib dazu, sodass Helene lieber die Nachtschwester Berta hinzurief. Schwester Berta war eine etwa 50-jährige Krankenschwester mit langjähriger Erfahrung in einer Kinderklinik: So konnte sie Helenes Unterleibsschmerzen eindeutig als „Geburtswehen“ identifizieren und ihr Verhaltensregeln empfehlen. „Tief Luft holen und dann hecheln, wieder Luft holen und nun pressen!“, ordnete sie jetzt wiederholt an und Helene war nur dankbar für diese „Regieführung“ „Schloss Hamborn“ wurde in der NS-Zeit als Mutterschutz-Heim zwangsverwaltet: Hier wurde u. a. der kleine Felix, nach seiner Trennung von seiner Mutter Helene, von 1943 bis 1945 untergebracht!
15. Helenes letztes Leid „Helene, ich hab ein kleines, aber feines Nest für uns drei gefunden! Es liegt ganz romantisch am Waldrand und ein kleiner Bach schlängelt sich mitten durch den Obstgarten. Dann haben wir ein kleines Paradies für uns ganz allein!“ Mit diesem Jubelschrei weckte Johannes eines Morgens im Herbst 1947 Helene und Felix aus dem „Spätschlaf“ „Hallo, guten Morgen, Johannes! Ich bin aber keine Vogelmutter und Felix kein Vogelei! Sag, welches Nest wartet auf uns?“ „Ein alter Fachwerkkotten, den ich aber in ein urgemütliches Heim verwandeln lassen werde, morgen zeige ich euch beiden unser neues endgültiges Zuhause!“, gab Johannes zur Antwort. „Oh, da bin ich aber gespannt wie ein Flitzebogen, lieber Johannes!“ Am nächsten Tag fuhr Johannes mit seinen beiden Lieblingen hinaus in das kleine benachbarte Walddorf. Und ganz am Ende des kleinen Dorfes hielt er vor einem greisen Fachwerkkotten, dessen linkes Dach beinahe bis auf die Erde ragte, ganz als duckte sich das alte Haus vor Wind und Regen oder sonstige „Unbilden“ des Lebens. Hinter dem Haus ragte ein Dutzend alter Obstbäume in den Himmel und ein kleines Bächlein lugte vorwitzig um die Ecke des Ziegelschuppens, der sich an das Schleppdach anfügte … „Oh, Johannes! Das ist ja ein zauberhaftes Nest, das du uns da ausgesucht hast, da kuschele ich gerne mit euch beiden!“, lobte Helene Johannes Geschmack jetzt in höchsten Tönen „Sieh mal, Felix, hier im Bach kannst du Schiffchen fahren lassen oder baden gehen! Oder Papa Johannes baut uns eine kleine Wassermühle!“, fügte Helene in grenzenloser Begeisterung hinzu. Und einen Augenblick später hatte sie ihre Schuhe und Felix Sandalen ausgezogen und patschte ein paar kurze Schritte ins glasklare Nass des Bächleins „Oho, ich sehe schon, das ‚Nest‘ scheint zu gefallen! Dann will ich mal schnellstens den Kaufvertrag abschließen und zuverlässige Handwerker suchen, damit wir spätestens im nächsten Frühjahr hier einziehen können!“, freute sich Johannes, weil er jetzt wusste, die richtige Wahl getroffen zu haben. Insgeheim hatte Johannes aber die baldige Entlassung seiner Helene aus der jetzigen Pflegeeinrichtung – so schön die Unterkunft gegenwärtig auch war – längst vorbereitet: Der letzte Befund aus dem „Eichenhof“ und seine neuesten Beobachtungen der langjährigen Patientin Helene fielen derart positiv aus, dass nach seiner Ansicht einer endgültigen Entlassung eigentlich nichts mehr im Wege stand. Helene musste nur für die nahe Zukunft ganz stabile soziale Verhältnisse erfahren, insbesondere keine Enttäuschungen: Und dafür verbürgte er sich voll und ganz als Mensch und Mann, der Helene unbedingt und grenzenlos liebte und verehrte „Wenn alles nach Plan laufen würde, so könnte zum nächsten Geburtstag des kleinen Felix, dem 15.5.1948, sowohl der Einzug ins neue Domizil als auch die Verlobung der leiblichen Eltern gefeiert werden!“, orakelte Johannes auf der Rückfahrt nach Liebenburg in seinem Tagtraum, allerdings ohne Erfolgsgarantie. Von nun an drehte sich für Helene und Johannes das Lebenskarussell immer schneller und im Mittelpunkt stand ihr kleiner Garten „Eden“, wie Helene ihr neues Domizil heimlich getauft hatte. Bei schönem Wetter musste nun Johannes oft „anspannen“, um Helene und Felix per PKW nach „Heimerode“ zu bringen, wo Helene mit ihrem Sohn oft mehrere Stunden im Obstgarten oder der näheren Umgebung bummelten. Etwa 1000 m westlich ihres Kottens mündete der kleine Bach in einen Weiher, der teilweise verlandet war und im Herbst mit dem nobelsten aller Schilfe, dem „großen Rohrkolben“, geschmückt war. Helene hatte schon längst Gefallen an dieser imposanten Wasserpflanze gefunden, sodass sie sich vornahm, im Winter, wenn man über die dann zugefrorene Wasserfläche leicht an die schlanken „Rohrkolben“ gelangen konnte, ein schönes Bündel dieser stolzen Pflanzen zu ernten. Und nun – Anfang Dezember – wartete Helene sehnsüchtig darauf, dass der Weiher zufrieren möge. Als das Thermometer am 5. Dezember 1947 morgens 5 Grad unter null anzeigte, bat sie wieder einmal Johannes, sie und den kleinen Felix gegen Mittag für etwa zwei Stunden an den kleinen Weiher zu kutschieren. Ein Holzschlitten sollte für den nötigen Spaß dabei sein. Johannes ließ die beiden am Ende eines Wirtschaftsweges aus dem Auto, lud den Schlitten aus und umarmte seine beiden Lieben noch einmal herzlich, ihnen fest versprechend, dass er spätestens gegen 16:00 Uhr wieder zurückkehren wollte … Helene, die sich schon den prächtigen Strauß brauner Rohrkolben in einer Bodenvase stehend ausmalte, stürmte jetzt – mit dem kleinen Felix auf dem Schlitten im Schlepptau hinter sich ziehend – auf den einsamen Weiher – im Winterschlaf – hinaus. Und tatsächlich war der Weiher – bis auf eine kleine kreisrunde Fläche in der Mitte – offensichtlich zugefroren. Allerdings war das Eis nur wenige Meter vom Rand entfernt, nur so dick, dass es ein leichtes Kind oder die Schar von Wasservögeln tragen hätte können. Nicht aber Helene! Als sie nur noch wenige Schritte von den Rohrkolben entfernt war, krachte und ächzte es unter ihren Füßen und dann sank Helene langsam – aber unaufhaltsam – in das eiskalte Wasser bis sie endlich im Schlick des Weihers hüfttief feststeckte. Der kleine Felix saß stattdessen – hinter ihr – immer noch auf dem Holzschlitten und schrie: „Mama, Mama! Komm raus!“ Aber Helene war so geschockt, dass sie erstarrte wie ein Fels. Sie wusste, wenn sie an der Leine zum Schlitten zöge, würde Felix unweigerlich im Eiswasserloch versinken. Auch daher durfte sie sich auf keinen Fall von der Stelle rühren! Die unerbittliche Kälte des Eiswassers kroch in Helenes Körper hinauf und lähmte jede Regung ihrer Muskeln. Sie nahm jetzt ihre letzten Lebensgeister zusammen und schrie: „Hilfe, Hilfe! Wir sind hier eingebrochen! Wer hilft uns?“ Aber so oft Helene auch rief: Der Weiher war zu weit vom letzten Haus im Dorf entfernt, als dass ihre zitternde Frauenstimme gehört werden konnte. Aber eine Schar von Graugänsen landete einen Steinwurf weit von Helene und fing an zu schreien, als sie Helene und Felix bemerkten. Die Gänseschreie wiederum waren das Signal für zwei Hunde, die von ihren Herren, zwei rüstigen Rentnern, von der Leine gelassen waren und nun auf die Gänseschar zustürmten. Die Wasservögel flatterten in Todesangst auf die einzige offene Wasserfläche in der Mitte des Weihers und waren damit erst mal vor den gefährlichen Vierbeinern sicher. Die beiden Hunde, ein Husky und ein Collie, hatten inzwischen die beiden Menschen am Eisloch entdeckt und verbellten unüberhörbar laut ihre Entdeckung. Daraufhin lenkten die beiden Hundehalter ihre Schritte Richtung des Gebells und schließlich sahen sie die Frau im Eisloch mit ihrem kleinen Jungen auf dem Schlitten. „Egon, wir holen rasch die Holzleiter, die hinter dem kleinen Bootshaus hängt, damit könnten wir die Frau wohl rausfischen!“ „Jau, Herbert, das ist ’ne gute Idee, lass uns mal tenger machen!“ Und nach wenigen Minuten waren die beiden mit der Leiter am Schilfgürtel, schoben sie dann horizontal wie einen langen Schlitten auf dem Eis bis an das Loch, in welchem Helene steckte, und dann kroch einer der beiden von Sprosse zu Sprosse auf der Leiter, bis er Helenes Hände fassen konnte. „Legen Sie sich mit dem Oberkörper auf die Leiter und halten Sie sich ganz fest! Die Schlittenleine übernehme ich!“ „Erst den Jungen, bitte!“, bettelte Helene noch und dann fiel sie in Ohnmacht. So konnte sie nicht mehr mitbekommen, dass tatsächlich zunächst der kleine Felix – auf seinem Schlitten sitzend – vom Eis geholt und danach Helene – auf der Leiter liegend – ebenfalls an Land geschleift wurde „Egon, lauf du zum Bäcker: Die sollen sofort einen Krankenwagen hierhin schicken, die Frau ist total unterkühlt und ohnmächtig!“, ordnete Herbert an, der im Krieg kurzfristig als Sanitäter ausgeholfen hatte. Seine schwere Lederjacke deckte er über Helenes Unterleib. Dann nahm er Helenes blau gefrorene Hände in seine warmen Männerhände und knetete sie durch. Auch Felix zog er seinen Schafwollpullover über. Nach etwa 15 Minuten traf der Krankenwagen ein und Helene wurde samt Felix ins Klinikum nach Salzgitter gebracht, wo sie auf der Intensivstation vom „Beinahe-Tod“ ins Leben zurückgeholt wurde. Felix hatte zum Glück außer einem gehörigen Schnupfen keine bleibenden Schäden davongetragen. Aber als Helene – nach etwa drei Stunden – aus ihrer Ohnmacht erwachte, sah sie in das tief besorgte Gesicht ihres Johannes. Dem war nämlich inzwischen der erste Befund des Stationsarztes mitgeteilt worden: Verdacht auf Lungenentzündung und schwere Erfrierungen in beiden Beinen. „Herr Kollege, die Lungenentzündung hoffen wir wieder expedieren zu können; aber richtige Sorgen machen uns die Erfrierungen an beiden Unterbeinen: Ohne Amputation werden wir vermutlich nicht zurechtkommen!“ Das hatte Johannes dem ersten Bericht des Stationsarztes entnehmen müssen. Und nun machte er sich als Mediziner und als engster Partner von Helene Sorgen, ob Helene überhaupt diese brutale Wahrheit verkraften würde können. Johannes kam nun jeden Tag für etwa zwei Stunden zu Helene in die Klinik. Sie machte einen körperlich erschöpften und seelisch niedergeschlagenen Eindruck. „Lieber Johannes, wie es um mich steht, so werde ich wohl doch nicht den Einzug in unseren ‚Garten Eden‘ mitfeiern können … Aber wie schön, dass du unseren Sohn wieder bei dir hast. Felix ist so ein freundlicher Junge, er wird dich, lieber Johannes, auf deinem weiteren Weg treu begleiten und dir über viele Hürden hinweghelfen. Vertragt euch nur immer wieder und behaltet mich stets in eurem Herzen! Mehr wünsch ich mir nicht in diesem zu Ende gehenden Erdenleben!“ Oh, wie blutete Johannes da sein Herz, als er diese Worte vernahm und deutete: Seine sonst so starke Helene war nun äußerst schwach und hatte mit ihrem Leben schon fast abgeschlossen. Johannes musste unverzüglich seinen vermutlich letzten Trumpf ausspielen, um Helene noch einmal, vielleicht zum allerletzten Mal lächeln sehen zu können … Gleich am nächsten Morgen nahm Johannes Kontakt mit einem befreundeten evangelischen Pfarrer in Salzgitter auf und bat ihn um einen ganz besonderen Gefallen … Am Nachmittag des übernächsten Tages erschien Johannes in Helenes Krankenzimmer in Begleitung des kleinen Felix und des großen Freundes. „Liebste Helene, heute habe ich mir Verstärkung mitgebracht für das, was mir so lange auf dem Herzen liegt: Helene, ich möchte dich hier und heute in Anwesenheit dieser beiden Zeugen fragen: Willst du mich heiraten?“ „Oh, lieber Johannes, das will ich schon ewig! Aber wie steht’s mit dir?“, antwortete Helene mit schwacher Stimme. „Helene, du bist die Liebe meines Lebens: Das ist so und wird immer so bleiben! – Herr Pfarrer, lieber Peter, bitte, bitte, trauen Sie uns und geben Sie uns Gottes Segen!“ Und so holte Johannes die beiden weißgoldenen Eheringe, die er schon eine Weile versteckt hatte, aus dem kleinen blauen Samtkästchen und steckte ihn, nach dem obligatorischen Sermon und dem Segensspruch, seiner Helene an den Ringfinger ihrer rechten Hand! „Johannes, Sie dürfen die Braut jetzt küssen!“,wollte der Pfarrer gerade sagen, als Johannes schon Helenes Kopf ganz, ganz zärtlich in beide Hände nahm, um dann ihren blassen Mund unendlich lange zu küssen … Helene, die das Geschehen kaum fassen konnte, ließ zunächst ihren Tränen freien Lauf, aber da es natürlich diesmal Freudentränen waren, fiel es ihr nicht schwer, gleich darauf ihre süßen Grübchen als schönste Dekoration zu einem Lächeln zu zeigen. „Felix, mein allerliebster Schatz, gib doch bitte deiner Mama auch ein Küsschen, ja?!“ Und wie der kleine Lockenkopf daraufhin zu seiner todkranken Mama lief und sie mit seinem kleinen Schnütchen immer wieder küsste, das war nicht arrangiert oder geprobt. Einige Augenblicke später, als gerade der kindliche Ansturm an Liebesbezeugungen gestillt war, rief Helene noch einmal Johannes zu sich: „Bitte, seid mal ganz still! Johannes, ich höre in der Ferne irgendwo Glocken läuten: Das sind wohl die Abendglocken, oder?“ Johannes blickte in diesem Moment dankbar zu seinem Freund, dem Pfarrer Peter, der ganz verschmitzt lächelte. „Nein, liebe Helene, das sind keine Abendglocken, sondern unsere Hochzeitsglocken! Danke Peter, für deinen freundlichen Sonderdienst am heutigen Abend!“ Nach einer kurzen Pause erklärte Johannes: „Nun wollen wir aber Helene ihre wohlverdiente Ruhe gönnen nach diesem aufregenden Tag. Sieh, liebe Helene, nur auf die dunklen Rosen hier und glaube fest an unseren heiligen Bund, dann wird sich schon alles zum Besten wenden!“ Mit diesen Worten und einem Gutenachtkuss verabschiedete sich Johannes mit seinen beiden „Zeugen“ von Helene. Doch dieser innige Kuss sollte für Helene und Johannes der allerletzte Liebesbeweis ihrer tiefen Verbundenheit sein: Als hätte Helene erst noch diesen lang ersehnten Traum zu Ende träumen wollen, hörte in der folgenden Nacht ihr so liebevolles, aber schwaches Herz auf, zu schlagen. Helene Bandelberg, die Tochter so vieler Tränen, verließ ganz sanft und glücklich diese enge kleine Welt und ihre so einzigartige Seele vermählte sich mit den unzähligen Kreationen göttlicher Schöpferkraft und Schöpferliebe in diesem Universum. Johannes‘ Sehnsucht nach der Liebe seines Lebens aber war so groß, dass er sich neben dem kalten rosafarbenen Grabstein in Herzform einen markanten heißen Stern am Nachthimmel aussuchte als letzte Heimat für Helenes strahlende Seele … und als Licht auf seinem weiteren Lebensweg …
16. Helenes Vermächtnis. Rund sechs Jahre nach Helenes Tod im Dezember 1947 erhielt Johannes eines Abends im Oktober 1953 ein für ihn zunächst rätselhaftes kleines Paket: Als Absender war der Name „Anna Maria Bachner (geborene Bandelberg) in Hermannsthal/Lippe, Am Mühlenbach Nr.42“ angegeben. Das war wohl Helenes Lieblingsschwester, wie sie ihm damals – noch im „Eichenhof“ lebend – erzählt hatte … „Was wollte die denn nur von ihm nach so langer ‚Funkstille‘?“, fragte sich jetzt Johannes und hatte es plötzlich eilig, das kleine Paket zu öffnen. Zum Vorschein kam ein in Sütterlin geschriebener Begleitbrief und ein sehr verwaschenes, in weinrotes Leinen gebundenes Büchlein, offenbar ein fragmentarisches Tagebuch, dessen Eintragungen abrupt im November 1939 endeten: „Das war der Zeitpunkt, zu dem Helene in den ‚Eichenhof‘ verbracht wurde“, kombinierte Johannes und dann las er erst mal den Text des Begleitbriefes: „Hermannsthal, 20.10. 1953. Lieber Schwager Johannes! Heute – wenngleich viel zu spät – möchte ich mit diesen Zeilen nachträglich um Verzeihung bitten, dass wir Bandelbergs seinerzeit nicht zur Beerdigung unserer geliebten Helene nach Liebenburg kommen konnten, insbesondere, weil Papa Friedrich mit einer schweren Grippe darniederlag und weil mein Josef nur über ein altes, nicht wintertaugliches Motorrad verfügte, das er eigentlich als Schwerkriegsbeschädigter gar nicht führen dürfte! Also noch mal: Es war kein böser Wille, sondern ein aufgezwungenes Schicksal, welches uns seinerzeit hinderte, unserer allseits geliebten Helene die letzte Ehre erweisen zu können! Aber nun hat mich ein besonderes Ereignis darin bestärkt, die abgerissene Verbindung zu dir, lieber Johannes, und Felix wieder aufleben zu lassen: Im Päckchen findest du nämlich ein kleines Tagebuch unserer Helene, das sie offensichtlich sporadisch geführt hat, wenn sie in Hermannsthal in ihrem Refugium bei der Lehrerfamilie ‚Reker‘ ungestört war … Dieses kleine Büchlein in Helenes ureigener Handschrift haben unsere beiden ältesten Söhne, Ulrich (geboren 1940) und Klaus (geboren 1942) beim Stöbern auf dem Dachboden unseres kleinen Ziegelhauses aufgefunden. Sie haben es – Gott sei Dank – gleich mir weitergereicht. (Vielleicht weil sie die Sütterlin-Schrift nicht entziffern konnten.) Und nun möchte ich es dir, lieber Johannes, als ein ‚Vermächtnis‘ unserer Helene zur endgültigen Aufbewahrung übersenden. Vielleicht enthält es einige Wahrheiten über Helenes tatsächliche Empfindungen und Einstellungen angesichts des mannigfaltigen Unrechts, das sie damals schon umgab und sie schließlich auf den langen Leidensweg führte, von dem du, lieber Johannes, sie erst kurz vor ihrem Tode heruntergeholt hast! Für heute grüßt dich herzlichst in der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen in unserem schönen Lipperland. Deine Schwägerin Anna Maria“ „Welch eine liebe und kluge Schwester hatte meine Helene in dieser Anna Maria!“, staunte Johannes erst mal, als er den Inhalt des Briefes verinnerlicht hatte. Aber danach wandte er sich akribisch dem Studium des kleinen weinroten Büchleins zu, Helenes letztes Vermächtnis an ihn und die interessierte Nachwelt … Gleich auf der ersten Seite stand eine knappe Widmung: „In diesem Tagebuch findest du ‚Süßes‘ und ‚Saures‘ aus dem Leben einer ‚Schwarzen Rose‘!“ Und dann folgten „Rosengedichte“ der Autorin: „Lieblich und lockend, herzlich und warm, betörend, verführend, wie in Amors Arm: So kennt ihr die Rosen. als Schmuck dieser Welt, doch blühten sie schwarz: Wie arm wär das Feld!“ Und als politischer Aufruf an die „weisen Frauen“ ihrer Zeit: „Die schwarze Rose, Die schwarze Rose. weigert sich, zu locken und zu duften, zu lieben und zu fruchten … Auf, auf, ihr weisen Frauen. all der verführten deutschen Krieger, verwandelt euch in schwarze Rosen. und nennt am End euch wahrlich Sieger.“ Und offenbar in prophetischer Vorausahnung ihres Schicksals dichtete sie: „Einst bin ich erwacht, in grabesstiller Nacht, ganz ohne jeden Sternenschein, auch ohne edlen Festtagswein. lag ich in meinem ungewollten Elend: Ein splitternacktes, karges Sein, gottfern, hilflos – und ganz allein! Sag, wer oder was mag ich wohl sein?“ Wohl unmittelbar nach dem plötzlichen Unfalltod ihrer „ersten großen Liebe“ resümiert Helene: „Das kleine Glück, das mir zuteil, zerfiel zu oft. in tausend Scherben: Mein Recht zu leben. war eher Unheil als Geschenk; mein Wunsch zu sterben. wurde nie erhört. von Engeln, Teufeln – oder Gottes Erben!“ Und gegenüber dem menschenverachtenden NS-Regime gibt es heftige Kritik: „Ein einzelner ‚Vordenker‘ reduziert. den Reichtum unseres deutschen Volkes. mit all seinen geistigen Größen. auf einen bildungsfernen und. menschenverachtenden ‚Schreihals‘!“ „Alle Menschen dieser Erde sind. vor Gottes Antlitz gleich, vor Teufels Fratze jedoch ungleich!“ „Das Glaubensbekenntnis. eines Menschen begründet. niemals seine genetische. oder rassistische Herkunft!“ „Es gibt keine ‚Herrenmenschen‘ oder ‚Untermenschen‘, nur gleichwertige menschliche. Individuen in variabler. Außenhülle!“ „Geistig oder körperlich behinderte. Menschen sind nicht ‚lebensunwert‘, sondern sind für eine menschliche. Gesellschaft eine Herausforderung. zu besonderem Schutz und. brüderlicher Hilfe!“ „Auch zwischen den Völkern. und Nationen der Erde darf es keine. Rangfolge ihrer ‚Wertigkeit‘ geben: ‚Indianer‘ sind z. B. nicht ‚minderwertige Amerikaner‘!“ „Verletzte Ehre, Neid und Missgunst, sowie die Gier, immer ‚Sieger‘ sein zu wollen, sind keine Berechtigung, irgendwo und irgendwann. einen Krieg zu beginnen!“ „Dankbarkeit für und Demut. vor der Einmaligkeit unserer Welt. sollten wieder in die Herzen. und Köpfe aller Menschen zurückkehren: Dann gibt es (vielleicht) wieder. Frieden auf der Erde!“ PS: Weitere Informationen zum Inhalt des vorliegenden „Doku-Romans“ siehe Epilog „Danke dir, Helene, für alles, was du uns geschenkt; und danke deinem Schöpfer, dass es dich gab!!“ Klaus S. Blechner, Bad Meinberg im Dezember 2018
Die Unsterbliche. Nichts kann ihr wundersames Bild verwischen, nichts ihren zauberhaften Duft verwehen: die letzte Rose dieses Sommers. bleibt unverfälscht in meines Herzens Grund bestehen! Kann ich sie auch nicht hier erblicken, bewundern ihren scheuen Charme, wird sie mich doch zutiefst beglücken. und grüßen mich so zärtlich warm. Glaubt’ ich sie längst verloren, lebt sie schon längst in mir: Zum Lieben auserkoren. Als Gottes allerschönste Zier! Klaus S. Blechner. Autor von „Helene Bandelberg – die verlorene Rose“ Herbst 2019
Bildverzeichnis
Отрывок из книги
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
.....
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
.....