Sprachenlernen im Tandem
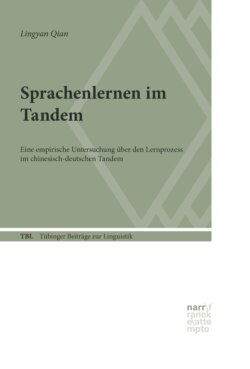
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Lingyan Qian. Sprachenlernen im Tandem
Inhalt
Danksagung
Einleitung
1 Lehr- und Lernpotenziale von Interaktionen. 1.1 Zum Begriff Interaktion
1.1.1 Interaktion und Zweitspracherwerb
1.1.1.1 Gesteuerter Zweitspracherwerb in Interaktionen
1.1.1.1.1 Lehrer-Lerner-Interaktionen im Fremdsprachenunterricht
1.1.1.1.2 Lerner-Lerner-Interaktionen im Fremdsprachenunterricht
1.1.1.1.3 Gesprochene Sprache im DaF-Unterricht
1.1.1.2 Ungesteuerter Zweitspracherwerb in Interaktionen
1.1.1.2.1 Ungesteuerter Zweitspracherwerb des Kindes
1.1.1.2.2 Ungesteuerter Zweitspracherwerb der erwachsenen Lerner
1.1.2 Tandem: eine besondere Interaktionsform für Zweitspracherwerb
1.1.2.1 Geschichte des Begriffs
1.1.2.2 Formen des Sprachenlernens im Tandem
1.1.2.3 Tandemforschung
1.1.2.3.1 Das Sprachenlernen im Tandem
1.1.2.3.2 Das interkulturelle Lernen im Tandem
1.1.2.3.3 Beratungen und Begleitungen
1.2 Zusammenfassung
2 Untersuchungsmethode. 2.1 Konversationsanalytischer Ansatz
2.1.1 Grundprinzipien der Konversationsanalyse
2.1.2 Konversationsanalyse in der Linguistik
2.1.3 Konversationsanalyse und Kommunikation mit nicht kompetenten Sprechern
2.1.3.1 Besonderheiten der Erwachsenen-Kind-Kommunikation
2.1.3.2 Besonderheiten der MS-NMS-Kommunikation
2.1.3.3 Fremdsprachenunterrichtliche Kommunikation
2.2 Zu den Daten
2.2.1 Datenerhebung
2.2.2 Zu den Probanden
2.2.3 Die Aufbereitung der Daten
3 Tandemgespräch: eine besondere kommunikative Gattung. 3.1 Das Konzept: kommunikative Gattung
3.1.1 Die Struktur kommunikativer Gattungen
3.1.2 Forschung kommunikativer Gattungen
3.2 Alltägliche Gespräche
3.3 Unterrichtsinteraktion
3.4 Das Tandemgespräch als kommunikative Gattung
3.4.1 Der Wechsel vom Alltagsgespräch zur Lehr-Lern-Sequenz
3.4.1.1 Fremdinitiierte Fremdreparatur
3.4.1.2 Selbstinitiierte Fremdreparatur
3.4.1.3 Fremdinitiierte Worterklärungen
3.4.1.4 Selbstinitiierte Sprachreflexion
3.4.2 Der Wechsel von der Lehr-Lern-Sequenz zum Alltagsgespräch
3.4.2.1 Initiierung des Wechsels durch den Lerner
3.4.2.2 Initiierung des Wechsels durch den Muttersprachler
3.5 Lehr-Lern-Sequenzen im Tandem vs. Unterrichtsinteraktionen
3.6 Tandem als eine besondere kommunikative Gattung
3.7 Zusammenfassung
4 Erzählkompetenzen und Erzähldefizite der chinesischen Lerner im Tandem. 4.1 Zum Begriff Erzählen
4.1.1 Die Struktur konversationeller Erzählungen
4.1.1.1 Produktorientierte Erzählanalyse
4.1.1.2 Prozessorientierte Erzählanalyse
4.2 Die Stellung der Erzählfähigkeit im Spracherwerb
4.2.1 Erwerb der Erzählfähigkeit in der Muttersprache
4.2.2 Erwerb der Erzählfähigkeit in der Fremdsprache
4.3 Modell zur Analyse konversationeller Erzählungen im Tandem
4.4 Analyse konversationeller Erzählungen am Beispiel einer Erzählung unter Deutschen
4.5 Analyse konversationeller Erzählungen im Tandem
4.5.1 Erzählanfänge
4.5.1.1 Lernersprachliche Gestaltung der Erzählanfänge
4.5.1.1.1 Fremdinitiierte Erzählanfänge
4.5.1.1.2 Selbstinitiierte Erzählanfänge
4.5.1.2 Kompetente Gestaltung der Erzählanfänge
4.5.2 Dramatisieren (Redewiedergabe)
4.5.2.1 Problematische Gestaltung der Redewiedergabe
4.5.2.1.1 Stimmlich undifferenzierte und sprachlich defizitäre direkte Rede
4.5.2.1.2 Stimmlich undifferenzierte direkte Rede
4.5.2.1.3 Stimmlich teilweise differenzierte direkte Rede
4.5.2.2 Kompetente Gestaltung der Redewiedergabe
4.5.2.2.1 Stimmlich differenzierte direkte Rede
4.5.2.2.2 Überlagerung der Stimmen in direkter Rede
4.5.2.2.3 Kompetente Gestaltung direkter Rede im Witz
4.5.3 Detaillierung
4.5.4 Erzählbeendigungen
4.5.4.1 Erzählbeendigungen durch zusammenfassende Bewertungen
4.5.4.2 Erzählbeendigungen durch Beiträge des Muttersprachlers
4.5.4.3 Erzählbeendigungen mit sprachlichen Bearbeitungen
4.5.4.4 Erzählbeendigungen mit landeskundlichen Diskussionen
4.5.4.5 Erzählbeendigungen durch Schweigen der beiden Tandempartner
4.6 Zusammenfassung
5 Scaffolding. 5.1 Das Scaffolding-Konzept
5.1.1 Bedeutung des Scaffoldings für Lehren und Lernen
5.1.2 Scaffolding in der Erstspracherwerbsforschung
5.1.3 Scaffolding in der Zweitspracherwerbsforschung
5.2 Scaffolding in Tandeminteraktionen
5.2.1 Typen von Scaffolding
5.2.1.1 Initiierung der Erzählung durch den Muttersprachler
5.2.1.2 Elizitierung einzelner Strukturteile
5.2.1.3 Übernahme einzelner Strukturteile
5.2.1.4 Wiedergabe der Erzählstruktur
5.2.1.5 Beteiligung an der Evaluation
5.2.1.6 Bearbeitung von Problemen bei der Durchführung der Erzählstruktur
5.2.2 Versuchtes Scaffolding
5.2.3 Kontext für potenzielles Scaffolding
5.3 Formen der Scaffolding-Verfahren
5.3.1 Fragen
5.3.1.1 Entscheidungsfragen
5.3.1.2 Ergänzungsfragen
5.3.1.3 Alternativfragen
5.3.2 Imperativ
5.3.3 Explikation
5.3.4 Affektive Mittel
5.3.4.1 Affektive Mittel in sprachlicher Form
5.3.4.2 Affektive Mittel durch nonverbales Verhalten
5.3.5 Übernahme
5.3.6 Wiedergabe
5.4 Zu Aktivitäten der chinesischen Lerner bei der konstruktiven Dialoghilfe im Tandem
5.4.1 Ratifizieren
5.4.2 Schweigen
5.4.3 Missverstehen
5.5 Anpassung des Muttersprachlers an den Sprachstand des Lerners
5.6 Zusammenfassung
6 Schlussbetrachtungen
6.1 Das Sprachenlernen im Tandem: zwischen Fiktionalität und Realität
6.2 Ausblick: Supervision für das Sprachenlernen im Tandem
Literatur
Fußnoten. 4.1 Zum Begriff Erzählen
4.4 Analyse konversationeller Erzählungen am Beispiel einer Erzählung unter Deutschen
Selbstinitiierte Erzählanfänge
4.5.2 Dramatisieren (Redewiedergabe)
Erzählbeendigungen mit landeskundlichen Diskussionen
5.1.1 Bedeutung des Scaffoldings für Lehren und Lernen
Отрывок из книги
Lingyan Qian
Sprachenlernen im Tandem
.....
Die Tandemgeschichte ist auf die deutsch-französischen Jugendbegegnungen in den 1960er Jahren zurückzuführen. Seit 1968 veranstaltete das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) binationale Sprachprogramme für die Jugendlichen aus den beiden Ländern. Anders als zuvor wurde der Unterricht nun sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag zweisprachig durchgeführt. Diese neue Unterrichtsidee war so erfolgreich, dass sie 1970 durch das DFJW immer bekannter wurde. In demselben Jahr beauftragte das DFJW die neu gegründete „Arbeitsgruppe Angewandte Linguistik Französisch“ (AALF), ein eigenes Sprachprogramm mit der Tandemidee zu entwickeln.
In Kenntnis der zahlreichen deutsch-französischen Ansätze übertrugen Klaus Liebe-Harkort und Nükhet Cimilli das Modell auf die Arbeit mit Immigranten im deutsch-türkischen Bereich. 1973 folgten deutsch-türkische Tandemkurse zwischen türkischen Migranten und deutschen Sozialarbeitern unter der Trägerschaft der „Volkshochschule München“ und des „anatolischen Solidaritätsvereins“. Ähnliche Kurse wurden auch im „Türkischen Volkshaus“ in Frankfurt a.M. (Faust/Schneider-Gürkan 1984) organisiert.
.....