Die Akzessorietät des Wirtschaftsstrafrechts
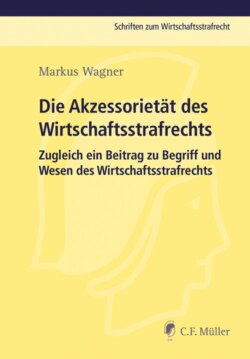
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Markus Wagner. Die Akzessorietät des Wirtschaftsstrafrechts
Die Akzessorietät des Wirtschaftsstrafrechts
Impressum
Vorwort
Inhaltsverzeichnis
Teil 1 Rechtstheoretische Grundlagen
Anmerkungen
A. Der Begriff der Akzessorietät
Anmerkungen
B. Zielsetzung und Gang der Untersuchung
C. Die Basis der Untersuchung: Das Akzessorietätsphänomen
Anmerkungen
I. Die Akzessorietät des Rechts im Allgemeinen
1. Die in Frage kommenden Bezugsgegenstände des Akzessorietätsverhältnisses
a) Annäherung an die Begriffe „Recht“ und „Wirklichkeit“
aa) Zum Rechtsbegriff
bb) Zum Wirklichkeitsbegriff
cc) Zur Notwendigkeit der Differenzierung zwischen Recht und Wirklichkeit
b) Die begriffliche Basis der weiteren Untersuchung
2. Die Akzessorietät des Rechts zur Wirklichkeit
a) Auseinandersetzung mit möglichen Einwänden
aa) Systemtheoretische Einwände gegen eine Akzessorietät des Rechts zur Wirklichkeit
(1) Recht als soziales System
(2) Recht als selbstreferentielles autopoietisches System
(3) Relativierungen der Autonomie des Rechtssystems
(a) Operative und strukturelle Koppelungen (Luhmann)
(b) Interferenzmodell (Teubner)
(4) Konsequenzen für die These einer Akzessorietät des Rechts zur Wirklichkeit
bb) Verfassungsrechtliche Einwände gegen eine Akzessorietät des Rechts zur Wirklichkeit
cc) Einwand der Kontrafaktizität des Rechts
dd) Zwischenergebnis
b) Akzessorische Wirklichkeitsbereiche
aa) Politik
bb) Wirtschaft
cc) Technische Entwicklung
dd) Kultur und Zeitgeist
ee) Moral
ff) Zeit
gg) Sprache
c) Zwischenergebnis
3. Die Akzessorietät des Rechts zum Recht
a) Gesetzliche Verweisungen (i.w.S.)
b) Weitergehende Rechtsakzessorietät kraft eines übergeordneten Prinzips der „Einheit“ bzw. „Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung“
aa) Die Figur der „Einheit der Rechtsordnung“ in Wissenschaft und Rechtsprechung
(1) Einordnung
(a) Einordnung (ausschließlich) als bestehender Zustand
(b) Einordnung (ausschließlich) als Postulat
(c) Kombinationsansätze
(d) Ablehnende Positionen
(2) Herleitung
(a) Herleitung aus der Rechtsidee bzw. dem Rechtsbegriff
(b) Herleitung aus dem Wissenschaftscharakter der Jurisprudenz
(c) Herleitung aus dem Geltungswillen der Normsetzer
(d) Herleitung aus Verfassungsprinzipien
(3) Adressierung
(a) Adressierung (nur) des Rechtssetzers
(b) Adressierung (nur) des Rechtsanwenders
(c) Adressierung sowohl des Rechtssetzers wie auch des Rechtsanwenders
(4) Zusammenfassung
bb) Kritik und eigener Ansatz
(1) Die Einheit der Rechtsordnung innerhalb einer Ebene
(2) Die Einheit der Rechtsordnungen im Mehrebenensystem
(3) Auseinandersetzung mit naheliegender Kritik
(a) Idealisierung des Gesetzgebers
(b) Verzerrung der Rolle des Bundesverfassungsgerichts
(c) Verstoß gegen Art. 97 GG
(d) Reduktion der Funktion des Richters auf einen „Subsumtionsautomaten“
(4) Folgerungen aus der Einheit der Rechtsordnung
(a) Einheitliches Rechtswidrigkeitsurteil
(b) Begriffseinheit
(c) Wertungseinheit
c) Zwischenergebnis zur Akzessorietät des Rechts zum Recht
Anmerkungen
II. Die Akzessorietät insbesondere des Strafrechts
1. Der Begriff des Strafrechts
2. Die Akzessorietät des Strafrechts zum außerstrafrechtlichen Recht
a) Vollständige Autonomie des Strafrechts
b) Vollständige Akzessorietät des Strafrechts
c) Teilweise Akzessorietät des Strafrechts
d) Wechselseitige Akzessorietät
e) Stellungnahme
aa) Akzessorietät und Einheit der Rechtsordnung
bb) Subsidiaritätsgrundsatz
(1) Allgemeines
(2) Reichweite des Subsidiaritätsgrundsatzes
(a) Grundsätzliche Möglichkeit der Erstreckung des Subsidiaritätsgrundsatzes auf die Rechtsanwendungsebene
(b) Notwendigkeit der Erstreckung des Subsidiaritätsgrundsatzes auf die Rechtsanwendungsebene
(3) Der eingeschränkt auslegungsbezogen-subsidiäre Charakter des Strafrechts
cc) Auslegungsbezogene Subsidiarität, sekundärer Charakter und Akzessorietät des Strafrechts
dd) Umfang der Akzessorietät
3. Die Akzessorietät des Strafrechts zur Wirklichkeit
4. Akzessorietät des Strafrechts zum Strafrecht?
5. Akzessorietät strafrechtlicher Begriffe?
a) Begriffsakzessorietät kraft gesetzlicher Anordnung
b) Strafrechtliche Begriffsbildung außerhalb gesetzlicher Anordnung
aa) Das semiotische Dreieck und seine Anwendung auf Normtexte
bb) Die Kontextabhängigkeit der Begriffsbildung
cc) Die Leistungsfähigkeit des Wortlauts als Auslegungsgrenze
(1) Kritische Stimmen
(2) Literarische „Rettungs“-Versuche
(a) Priester
(b) Schünemann
(c) Alexy
(d) Klatt
(3) Notwendigkeit einer Reformulierung des „Analogie“-Verbots
dd) Konsequenzen für die Möglichkeit strafrechtlicher Begriffsakzessorietät außerhalb gesetzlicher Anordnungen
6. Die Akzessorietät des (deutschen) Strafrechts zum ausländischen Recht
Anmerkungen
III. Die Akzessorietät des Wirtschaftsstrafrechts
1. Der Begriff des Wirtschaftsstrafrechts
a) Der historische Hintergrund der Frage nach dem Begriff des Wirtschaftsstrafrechts
b) Gesetzgeberische Definitionsansätze
c) Literarische Definitionsansätze
aa) Kriminologische Definitionsversuche
(1) Täterbezogene Begriffsbestimmung
(2) Opfer- bzw. schadensbezogene Begriffsbestimmung
(3) Tatbezogene Begriffsbestimmung
bb) Strafrechtsdogmatische Definitionsversuche
(1) Akzessorietätsbezogene Ansätze
(2) Rechtsgutsbezogene Ansätze
(3) Angriffsbezogene Ansätze
(4) Der differenzierende Ansatz Lampes
cc) Der wirtschaftswissenschaftliche Ansatz Mansdörfers
d) Entwicklung eines eigenen Wirtschaftsstrafrechtbegriffs
aa) Strafrecht unter dem Einfluss der wirtschaftsbezogenen Öffnungsklauseln
bb) Vergleich dieses Ansatzes mit den übrigen Auffassungen in der Literatur
cc) Nähere Konkretisierung des Wirtschaftsstrafrechtsbegriffs
(1) Unternehmensinterne Straftaten/Straftaten gegen das Unternehmen
(2) Einbeziehung des Verbraucherschutzstrafrechts?
2. Die Akzessorietät des Wirtschaftsstrafrechts zur Wirklichkeit
3. Die Akzessorietät des Wirtschaftsstrafrechts zum übrigen Recht
Anmerkungen
D. Zusammenfassung der Ergebnisse des ersten Teils
Anmerkungen
Teil 2 Die Begründung des Akzessorietätsverhältnisses
A. Der Gegenstand des Akzessorietätsverhältnisses
Anmerkungen
I. Tatbestand
Anmerkungen
II. Rechtswidrigkeit
Anmerkungen
III. Schuldhaftigkeit
Anmerkungen
IV. Schwierige Abgrenzungsfälle und die Relevanz der Differenzierung
1. Auswirkungen der Einordnung für das Akzessorietätsverhältnis
2. Grenzfälle zwischen Tatbestand und Rechtswidrigkeit
a) Behördliche Genehmigungen
aa) Die vertretenen Auffassungen bzgl. der deliktskategorischen Einordnung
(1) Generelle Einordnung als Tatbestandsausschließungsgrund
(2) Generelle Einordnung als objektive Bedingung der Strafbarkeit
(3) Generelle Einordnung als Rechtfertigungsgrund
(4) Differenzierung nach dem geschützten Rechtsgut
(5) Differenzierung nach dem verwaltungsrechtlichen Charakter der Genehmigung
(6) Differenzierung nach der Art der Formulierung im Normtext
bb) Kritik und Entwicklung einer eigenen Auffassung
b) Rechtliche Relevanz und Missbilligung der Gefahr im Rahmen der objektiven Zurechnung[25]
c) Sozialadäquanz
aa) Annäherung an den Begriff der Sozialadäquanz und Verhältnis zum erlaubten Risiko
bb) Die zur deliktssystematischen Verortung vertretenen Ansichten
(1) Verortung in der Schuldhaftigkeit
(2) Verortung in der Rechtswidrigkeit
(3) Verortung im subjektiven Tatbestand
(4) Verortung im objektiven Tatbestand
(5) Beschränkung auf den Bereich beruflicher Verhaltensweisen
cc) Entwicklung einer eigenen Auffassung
(1) Grundvoraussetzungen der Berücksichtigung der Sozialadäquanz tatbestandlichen Verhaltens
(2) Verortung im Deliktsaufbau
(3) Konsequenzen speziell für das Wirtschaftsstrafrecht
Anmerkungen
B. Das Objekt des Akzessorietätsverhältnisses
I. Außerrechtliche Sätze
Anmerkungen
II. Rechtliche Sätze
1. Differenzierung nach der Rechtsebene
a) Bundesrecht
b) Landesrecht
c) Kommunales Recht
d) Recht der Europäischen Union
e) Völkerrecht
2. Differenzierung nach der Rechtsform
a) Förmliches Gesetz
b) Rechtsverordnung
c) Satzungen
d) Unionsrechtliche Rechtsformen
aa) Verordnungen
bb) Richtlinien
cc) Rahmenbeschlüsse
e) Völkerrecht
f) Verwaltungshandeln
g) Rechtsprechung
h) Private Rechtssetzung
Anmerkungen
C. Die Art und Weise der Begründung des Akzessorietätsverhältnisses
I. Überblick über die gemeinhin unterschiedenen Formen der Akzessorietätsverhältnisse
1. Blanketttatbestände[1]
2. Normative Tatbestandsmerkmale
3. Gesamttatbewertende Merkmale und Komplexbegriffe
4. Generalklauseln
Anmerkungen
II. Revision der Differenzierungen im Lichte der bisherigen Untersuchungsergebnisse
1. Die Differenzierung zwischen deskriptiven und normativen Tatbestandsmerkmalen
a) Streitstand
aa) These der absoluten Trennbarkeit
(1) Differenzierung nach der Bestimmtheit des Merkmals
(2) Differenzierung nach dem Subsumtionsstoff
(3) Differenzierung nach der sinnlichen Wahrnehmbarkeit
(4) Differenzierung nach dem Verhältnis zur Rechtswidrigkeit
(5) Differenzierung nach der Wertungskomponente
(6) Differenzierung nach der logischen Voraussetzung einer anderen Norm
(7) Differenzierung nach dem Vorhandensein einer emotiven Komponente
(8) Differenzierung nach den in Bezug genommenen Eigenschaften
bb) These der normativen Elemente deskriptiver Tatbestandsmerkmale
cc) These der Ausschließlichkeit deskriptiver Tatbestandsmerkmale
dd) These der Ausschließlichkeit normativer Tatbestandsmerkmale
ee) These der wechselseitigen Überschneidung bzw. Ununterscheidbarkeit
ff) Differenzierung nach verschiedenen Bedeutungen des Begriffs „normativ“
b) Stellungnahme
2. Die Differenzierung zwischen normativen Tatbestandsmerkmalen und Blanketttatbeständen
a) Streitstand
aa) Formale Abgrenzungskriterien
(1) Ausfüllungsbedürftige Normen
(2) Kompetenzsprung durch die Verweisung
bb) Materielle Abgrenzungskriterien
(1) Rechtsprechung
(2) Lange
(3) Warda, Netzler, P. Backes
(4) von der Heide, J. Bachmann, Fissenewert
(5) Weidenbach
(6) Jakobs
(7) Puppe, Lauer
(8) Tiedemann, Enderle
(9) Schuster
cc) Keine Abgrenzbarkeit
b) Stellungnahme
3. Gesamttatbewertende Merkmale und Komplexbegriffe
Anmerkungen
D. Zusammenfassung der Ergebnisse des zweiten Teils
Anmerkungen
Teil 3 Die Begrenzung der Akzessorietät und ihre Folgen
A. Anknüpfungspunkte einer Akzessorietätsbegrenzung
I. Kompetenzbezogene Akzessorietätsbegrenzungen bei Verweis auf formelle Gesetze und EU-Rechtsakte
1. Fehlende Rechtssetzungskompetenz in Bezug auf die Primärnorm
aa) Ungeschriebene Primärnorm
bb) Landesrechtliche Verhaltensnorm
cc) Unionsrechtliche Verhaltensnorm
dd) Völkerrechtliche Primärnorm
b) Landesrechtliche Sanktionsnorm
2. Fehlende Rechtssetzungskompetenz in Bezug auf das Strafrecht
a) Strafnormen des Bundes
aa) Inbezugnahme von Regelungen in Landesgesetzen
bb) Verweisungen auf Recht der Europäischen Union
(1) Strafgesetzgebungskompetenz der Union?
(2) Konsequenzen für die Legitimation von Verweisungen auf EU-Verordnungen
cc) Verweisungen auf Völkerrecht
b) Strafnormen der Länder
Anmerkungen
II. Kompetenzbezogene Akzessorietätsbegrenzungen bei Verweis auf Rechtsakte der Exekutive und der Judikative
a) Verstoß gegen das Rechtsstaatsprinzip
b) Verstoß gegen Art. 103 Abs. 2 GG
aa) Reichweite des Anwendungsbereichs des Art. 103 Abs. 2 GG – die Bedeutung des Begriffs „Strafbarkeit“
bb) Reichweite der Anforderungen des Art. 103 Abs. 2 GG – die Bedeutung des Begriffs „gesetzlich“
cc) Konsequenzen für die Relevanz von Rechtsverordnungen
c) Verstoß gegen Art. 104 Abs. 1 S. 1 GG
d) Insbesondere: Rückverweisungsklauseln
2. Kommunale Satzungen
3. Verwaltungsakte
a) Nichtige Verwaltungsakte
b) Sonst rechtswidrige begünstigende Verwaltungsakte
aa) Meinungsstand vor dem 2. UKG
bb) Meinungsstand nach dem 2. UKG
cc) Stellungnahme
c) Sonst rechtswidrige belastende Verwaltungsakte
aa) Strenge Verwaltungsaktsakzessorietät
bb) Materielle Verwaltungsrechtsakzessorietät
cc) Deliktsspezifische Auslegung
dd) Stellungnahme
4. Verwaltungsvorschriften
a) Meinungsspektrum
b) Stellungnahme
5. Gerichtliche Entscheidungen
6. Verwaltungsverträge
Anmerkungen
III. Sanktionsnormbezogene Verweisungen auf Unionsrecht unter dem Gesichtspunkt des Parlamentsvorbehalts gem. Art. 103 Abs. 2 GG
Anmerkungen
IV. Kompetenzbezogene Akzessorietätsbegrenzungen bei Verweis auf Regelungen Privater
1. Bundesstaatsprinzip
2. Gewaltenteilung
3. Demokratieprinzip
4. Art. 92 GG
5. Stellungnahme
Anmerkungen
V. Bestimmtheitsgebot
1. Kettenverweisung
2. Verweis auf prinzipienorientierte Regelungen
3. Bestimmtheit bei EU-Rechtsakten
a) Quelle und Maßstab der Bestimmtheitsanforderungen
b) Konsequenzen für die einzelnen Problembereiche
aa) Auffindbarkeit des Verweisungsobjekts
bb) Berücksichtigung aller Sprachfassungen
cc) Übernahme des Gemeinschaftsrechts durch den Vertrag von Lissabon
dd) Kettenverweisungen auf EU-Recht und innerhalb des EU-Rechts
4. Auffindbarkeit bei Verweisung auf private Regelungen
a) Verträge und Satzungen
b) Tarifverträge
c) Technische Normen
aa) Verfassungsrechtlicher Maßstab
bb) Anwendung dieser Anforderungen auf technische Normen
(1) Deutsche Sprache
(2) Publikationsorgan
(3) Fundstellenangabe
(4) Kostenpflicht und Urheberrecht der Normerstellers
cc) Relativierung im Bereich des Wirtschafts(straf)rechts
5. Verschleifungsverbot
Anmerkungen
VI. Das sog. „Analogieverbot“
1. Direkte Normverweisungen
2. Offene Generalverweisungen
a) „Rechtsvorschriften“
b) „Recht der Europäischen Gemeinschaften“
3. Einzelbegriffe
a) Legaldefinitionen
b) Richtlinienkonforme Auslegung
Anmerkungen
VII. Rückwirkungsverbot und lex mitior-Grundsatz
1. Überblick über die allgemeinen Grundstrukturen der zeitlichen Geltung im Strafrecht
2. Bedeutung im Akzessorietätskontext
aa) Sanktionsnorm
bb) Verhaltensnorm
(1) Formelle Gesetze und Rechtsverordnungen
(2) Rückwirkende Aufhebung behördlicher Genehmigungen
(3) Anfechtung privat- und öffentlich-rechtlicher Verträge
b) Der lex mitior-Grundsatz
aa) Die Stellung des lex mitior-Grundsatzes in der Rechtsordnung
bb) Die Anwendung des lex mitior-Grundsatzes bei Änderungen der außerstrafrechtlichen Bezugsnorm
(1) Beschränkung des lex mitior-Grundsatzes auf die Strafnorm (RGSt)
(2) Generelle Geltung des späteren Rechts (Tiedemann)
(3) Differenzierung nach Absicherung von Gehorsam oder Regelungseffekt (Jakobs u.a.)
(4) Differenzierung zwischen normativen Tatbestandsmerkmalen und Blankettmerkmalen I (Hassemer, Kargl)
(5) Differenzierung zwischen normativen Tatbestandsmerkmalen und Blankettmerkmalen II (Schuster)
(6) Vorhandensein einer Ermächtigungsnorm (Dannecker)
(7) Stellungnahme
cc) Anwendung des lex mitior-Grundsatzes bei Änderung von untergesetzlichen Normen
(1) Spätere Aufhebung eines belastenden (rechtswidrigen) Verwaltungsakts
(2) Nachträgliche behördliche Genehmigung
(3) Privatrechtliche Rechtsänderungen
dd) Zwischengesetze
ee) Zeitgesetze
ff) Sonstige Ausnahmeregelungen zum lex mitior-Grundsatz
gg) Besonderheiten im Zusammenhang mit Unionsrecht
Anmerkungen
VIII. Verbot strafschärfenden und strafbegründenden Gewohnheitsrechts
1. Konsequenzen für den zugrunde gelegten Begriff des Wirtschaftsstrafrechts – Zur Berücksichtigungsfähigkeit von Handelsbräuchen im Strafrecht
2. Der Unterscheid zwischen faktischer Übung und privater Normierung – ein Widerspruch zu Lasten des Betroffenen?
Anmerkungen
IX. Unschuldsvermutung
Anmerkungen
X. Einfachgesetzliche Akzessorietätsbegrenzungen
1. Akzessorietätsbegrenzung durch unterlassene Akzessorietätsbegründung im Gesetzestext? – § 330a StGB
2. Einfachgesetzliche Beschränkung des Akzessorietätsumfangs
3. Rechtsmissbrauchsklauseln
a) Grundsätzliche Problematik
b) Die einzelnen Rechtsmissbrauchsklauseln
c) Zulässigkeit der Rechtsmissbrauchsklauseln
d) Abschließende Sonderregelungen oder deklaratorische Ausprägung eines allgemeinen Rechtsgrundsatzes?
e) Exkurs: Reichweite des § 330d Abs. 1 Nr. 5 StGB
Anmerkungen
XI. Strafrechtsdogmatische Akzessorietätsbegrenzungen
1. Schutzzweck der Norm
a) Rechtsgutsverschiebung beim Abrechnungsbetrug
b) Rechtsgüterschutz im Umweltstrafrecht
aa) Materielle Genehmigungsfähigkeit
bb) Nichtige Genehmigung
cc) Rechtswidriger, aber nicht nichtiger Verwaltungsakt
c) Kreis der tauglichen Anknüpfungspflichten bei § 258 StGB
2. Deliktstypus – Verletzungs- und Gefährdungsdelikte
a) Konkrete Gefährdungsdelikte
b) Abstrakte Gefährdungsdelikte
c) Zwischenergebnis
3. Unterlassungsdelikte – § 13 StGB
4. Verhältnismäßigkeitsprinzip/Ultima ratio-Grundsatz
Anmerkungen
B. Anwendungsbereich und Folgen einer Akzessorietätsbegrenzung
Anmerkungen
C. Zusammenfassung der Ergebnisse des dritten Teils
Anmerkungen
Teil 4 Prozessuale Aspekte der Akzessorietät
Anmerkungen
A. Präliminarien zum Verhältnis von materiellem Strafrecht und Strafprozessrecht
Anmerkungen
I. Akzessorietät des materiellen Strafrechts zum Strafprozessrecht?
Anmerkungen
II. Akzessorietät des Strafprozessrechts zum materiellen Strafrecht?
Anmerkungen
B. Die Befugnis des Strafrichters zur Klärung außerstrafrechtlicher Vorfragen
I. Grundsatz: Eigene Entscheidungsbefugnis des Strafrichters
Anmerkungen
II. Verwerfungskompetenz des Strafrichters bei Verwaltungsakten
Anmerkungen
III. Besonderheiten bei verfassungs- und unionsrechtswidrigen Gesetzen
Anmerkungen
IV. Revisibilität der Auslegung außerstrafrechtlichen Rechts
Anmerkungen
C. Die Feststellung außerrechtlicher Normen
I. Handhabung im Zivil- und Verwaltungsprozess
Anmerkungen
II. Übertragung dieser Grundsätze auf den Strafprozess
Anmerkungen
D. Die Wirtschaftsstrafkammern
I. Erster Reformvorschlag: Beiziehung von Fachschöffen
Anmerkungen
II. Zweiter Reformvorschlag: Anpassung des Zuständigkeitsbereichs der Wirtschaftsstrafkammer
Anmerkungen
III. Dritter Reformvorschlag: Verpflichtende Einrichtung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften und entsprechende personelle Ausstattung der Polizei
Anmerkungen
IV. Exkurs: Keine Notwendigkeit der Einrichtung eines speziellen Wirtschaftsstrafsenats beim BGH
Anmerkungen
E. Zusammenfassung der Ergebnisse des vierten Teils
Anmerkungen
Teil 5 Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse
Anmerkungen
A. Das Wesen und die Akzessorietät des Wirtschaftsstrafrechts
Anmerkungen
B. Beispielhafte Anwendung der entwickelten Grundsätze
1. Allgemeines zu DIN-Normen
2. Die Berücksichtigungsfähigkeit von DIN-Normen im Strafrecht
a) Dynamische Verweisungen auf DIN-Normen
b) Statische Verweisungen auf DIN-Normen
c) Einbeziehung über Technik-Klauseln
aa) Die allgemein anerkannten Regeln der Technik
bb) Der Stand der Technik
cc) Der Stand von Wissenschaft und Technik
3. Zusammenfassung
Anmerkungen
1. Allgemeines zum Deutschen Corporate Governance Kodex
2. Die Relevanz des Deutschen Corporate Governance Kodex im Rahmen des Untreuetatbestandes
a) Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex als taugliche Verhaltensnormen des § 266 StGB?
aa) Rechtliche Qualität des Deutschen Corporate Governance Kodex
bb) Verfassungsrechtliche Aspekte
(1) Verfassungsrecht als Prüfungsmaßstab
(2) Vereinbarkeit mit dem Demokratieprinzip
(3) Vereinbarkeit mit dem rechtsstaatlichen Bestimmtheitsgrundsatz – Publizitätserfordernis
(4) Zwischenergebnis
cc) Strafrechtsdogmatisches Erfordernis der Schutzzweckidentität
b) Begrenzungen durch die Sanktionsnorm
3. Zusammenfassung
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Отрывок из книги
Zugleich ein Beitrag zu Begriff und Wesen des Wirtschaftsstrafrechts
Markus Wagner
.....
2.Bedeutung im Akzessorietätskontext
a)Das Rückwirkungsverbot im engeren Sinne
.....