Skotom
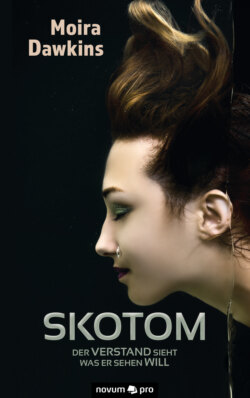
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Moira Dawkins. Skotom
Impressum
Einstieg in die Psychotherapie. Ich hatte mir das Ganze weitaus schlimmer vorgestellt – was bei mir an der Tagesordnung ist, um ehrlich zu sein. Ich fand meine Therapeutin von Anfang an sympathisch, woran auch ihre beiden Hunde nicht ganz unschuldig waren. Allerdings behielt ich die Sitzungen lange Zeit für mich. Nur meine Freundin, die mir die Empfehlung ausgesprochen hatte, wusste Bescheid. Auch bei dieser Therapeutin brauchte ich eine gewisse Anlaufzeit, doch irgendwann vertraute ich ihr genauso wie meinem Doc. Genauer gesagt, ich habe mir die Zeit genommen, um Vertrauen zu ihr zu fassen, und nicht aufgegeben. Ich genoss es sehr, mich mit ihr über alles Mögliche zu unterhalten. Anfangs erläuterte ich ihr meine momentane Situation und den Grund für mein Vorsprechen bei ihr. Natürlich kam auch meine Vergangenheit zur Sprache, womit ich auch gerechnet hatte. Wie schon Dutzende Male vor ihr gab ich auch ihr die Kurzfassung des Geschehenen und beantwortete all ihre Fragen wahrheitsgemäß. Schon nach wenigen Sitzungen eröffnete sie mir, dass sie eine Fortführung unserer Sitzungen für angebracht halte und sie daher alles Nötige beantragen werde. Was mir an ihr gefiel, war, dass sie mich wie einen normalen Menschen behandelte, eine lockere Umgangsweise hatte und auch sonst sehr entspannt und verständnisvoll war. Ich hatte mich inzwischen an die Sitzungen, die anfangs alle zwei Wochen stattfanden, gewöhnt und mir eigene Gedanken über die Ziele der Therapie gemacht. Ich wusste, dass sich meine Beschwerden durch die Therapie nicht bessern würden, da sie meiner Meinung nach nichts mit meiner Vergangenheit zu tun haben. Doch ich war neugierig auf die Meinung eines Profis bezüglich der damaligen Geschehnisse. Doch zwischendurch kam es trotz entwickelten Vertrauens und verlorener Skepsis an einen Punkt, an dem ich keinen Sinn mehr in der Therapie sah. Ich ging ungern zu ihr und spielte mit dem Gedanken, die Therapie abzubrechen.20 Schuld daran war, meines Erachtens, die mangelnde Nachfrage ihrerseits. Ich kann sehr ungeduldig sein und mir ging es einfach nicht schnell genug. Im Nachhinein ist mir klar geworden, dass sie wohl absichtlich etwas zurückhaltend war, da ich ihrer Ansicht nach einfach noch nicht so weit war. Da ich nun mal keine Gedanken lesen kann, wusste ich nicht, was sie gern von mir hören wollte, geschweige denn, in welche Richtung sie das Gespräch gerne lenken würde. Bevor ich meine Zweifel also zur Sprache brachte, probierte ich noch etwas anderes. Ich versuchte in meine Antworten auf ihre Fragen noch mehr Informationen einzubauen, die ihr zeigen würden, dass ich bereit war, über alles zu sprechen. Ich versuchte gezielt, die Richtung in meine Vergangenheit zu lenken, obwohl die Ausschweifungen manchmal gar nichts mit ihrer eigentlichen Frage zu tun hatten. So kam ich zu meinem nächsten Großprojekt, wobei das wohl eher ein Zufall war: 20 Und das nach wenigen Wochen. Eigentlich hatte ich ihr an diesem Tag sagen wollen, dass ich mit dem langsamen Fortschritt unzufrieden war und daher mit dem Gedanken spielen würde, die Therapie abzubrechen. Ich weiß leider nicht mehr, wie wir darauf kamen, doch ich baute absichtlich in meine Antwort die Feststellung ein, dass ich aufgrund fehlender telepathischer Kräfte nun mal nicht wisse, was Leute von mir hören wollten. Da ich keinerlei Probleme damit habe, über meine Vergangenheit zu sprechen, stört mich dieses Hindernis gewaltig. Ich sagte ihr, dass ich gern mehr von früher erzählen würde, ich aber viele Lücken zwischen meinen Erinnerungen hätte, für deren Füllung ich alles tun würde. So wäre ich auch zur Hypnose bereit. Da wurde meine Therapeutin auf einmal hellhörig und fragte mich, ob ich mir da sicher sei. Nachdem ich das bejaht hatte, erzählte sie mir von einer Therapieform, die erst vor Kurzem anerkannt wurde: Eye Movement Desensitization and Reprocessing, kurz EMDR. Bei dieser Traumatherapieform können Folgestörungen von Traumata behandelt werden (Hase). Meine Therapeutin war sich sicher, dass in meiner Kindheit genau so ein behandlungsbedürftiges Trauma vorgefallen sei. Ich war mir dabei jedoch nicht ganz sicher. Doch ich hatte ihr kurz vorher etwas erzählt, das ich bis dato jedem verschwiegen hatte: Jeden Abend höre ich noch etwas Musik, bevor ich schlafen gehe. Ich liege dann zwar schon im Bett, aber ich grüble dann noch etwas vor mich hin, lasse den Tag Revue passieren und werde dadurch auch müde. Allerdings gab es Abende, an denen das Nachdenken nicht so ganz klappen wollte. In diesen seltenen Momenten fiel mir irgendwann auf, dass meine Augen flackerten. Gleichzeitig änderte das Bild vor meinem inneren Auge rasend schnell seine Größe. Irgendeine Szene oder Ähnliches wurde rasant groß und dann wieder klein, sodass ich irgendwann dachte, dass dies das erste Anzeichen eines Wahns wäre. Während dieses Flackerns hatte ich weder meine Augen noch meine Gedanken unter Kontrolle. Und wenn ich etwas nicht leiden kann, dann ist es Kontrollverlust. Nach langem Überlegen erzählte ich meiner Therapeutin davon und fieberte ihrem Urteil entgegen. Tatsächlich hatte sie eine Erklärung parat, die mir große Erleichterung verschaffte. Laut ihrer Aussage passierte vermutlich Folgendes: Wenn es nachts Zeit fürs Bett wird, kommt man automatisch zur Ruhe. Das würde auch das Gehirn merken und versuchen, tiefer gelegene Gedanken an die Oberfläche zu bringen. Erinnerungen, wie z. B. ein Trauma, nutzen diesen ruhigen Moment, um ins Bewusstsein zu gelangen. Solche unkontrollierbaren Bilder seien dabei ganz typisch. Ein weiterer Punkt, der ihre Aussage unterstützte, war meine Feststellung, dass ich beim Nachdenken nie meine Augen zuhalten kann. Nach wenigen Sekunden gehen sie sofort wieder auf. Nun hatte ich eine Erklärung für meine „Macke“ und erzählte dann auch meinen Pflegeeltern und meinen Freunden davon. Anscheinend war ich somit geeignet für EMDR. Ich ging davon aus, dass sich meine Therapeutin durch die EMDR-Sitzungen auch eine Besserung meiner Beschwerden erhoffte, da evtl. verdrängte Erfahrungen durch diese Therapieform aufgearbeitet und verarbeitet werden könnten. Jedoch ging sie sehr behutsam vor und so konnte ich nur mutmaßen, wie es weiterging und was noch alles auf mich zukommen würde. Die Vorbereitungen für die eigentlichen EMDR-Sitzungen nahmen sehr viel Zeit in Anspruch. Dadurch, dass sie vor allem bei Patienten mit posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) angewendet werden, musste mit äußerster Vorsicht gearbeitet werden, weshalb auch nur ein speziell dafür ausgebildeter Therapeut für diese Therapieform infrage kommt. Durch das gezielte, kontrollierte und wiederholte Durchleben des Traumas lernen die Patienten langsam den Umgang mit diesem, ohne dabei in Panik zu verfallen oder weiter daran zu zerbrechen. Mit der richtigen Herangehensweise lernen die Patienten, dass das Geschehene zwar passiert ist, sie jedoch auch ohne enorme Einschränkung der eigenen Lebensqualität daran zurückdenken können. Mit der Zeit können sie so ohne körperliche oder psychische Symptome an das Erlebte denken. Dieser Weg erfordert allerdings von beiden Seiten, Therapeut und Patient, viel Zeit, Energie und Durchhaltevermögen. Der eigens für EMDR ausgebildete Therapeut benötigt das Wissen, die Erfahrung und die Menschlichkeit, die für diese Therapieform zwingend erforderlich sind. Durch äußere Stimulation, wie z. B. schnelles Hin- und Herbewegen der Finger vor den Augen des Patienten, wechselnde Musiktöne oder Tippen auf die Hand wird der Patient dann zurück in die Erinnerung begleitet. Durch die Verbindung zur Außenwelt kann sich der Patient in guten Händen wissen, da er jederzeit die Zügel in der Hand hält. Er kann jederzeit abbrechen, sollte es zu viel werden (Hase) So ganz passte ich zwar nicht in die Sparte „geeigneter Patient für die Therapie“, aber einen Versuch war es wert. Nun stand ich also, aufgeregt wie ein Kind vor dem ersten Schultag, vor dem Start der EMDR-Sitzungen. Meiner Ungeduld gefiel die Aussage meiner Therapeutin überhaupt nicht, dass die Vorbereitung viel Zeit in Anspruch nehmen würde und sie schon zu Anfang vorsichtig sein müsse und nichts überstürzen dürfe. Da ich ihr inzwischen vertraute, respektierte ich ihre Vorgehensweise. Nachdem sie mir etwas Infomaterial mitgegeben hatte, bekam ich auch schon die erste von vielen Hausaufgaben: Ich sollte mich über EMDR informieren und ggf. Fragen vorbereiten. Unter anderem recherchierte ich über die Entstehung, das Vorgehen, die Anwendungsgebiete und die Erfolgsaussichten. Mit den oben genannten Infos im Hinterkopf und ein paar Fragen fieberte ich also der nächsten Sitzung entgegen. Denn ein Punkt hatte mich etwas stutzig gemacht. Durch das wiederholte Durchleben der Erinnerung sollte eine minimale bis ausbleibende Belastung erreicht werden. Doch genau hier sah ich ein Problem. Ich empfand rein gar nichts bei meinen Erinnerungen. Wie sollte eine Belastung weggenommen werden, wo gar keine war? Ich wollte ja lediglich die Lücken füllen und so offene Fragen beantworten. Meine Zweifel tat ich meiner Therapeutin kund, doch sie versicherte mir, mit der Zusage zu EMDR die richtige Entscheidung getroffen zu haben. PTBS wäre schließlich nur eine Erkrankung, die mit EMDR erfolgreich behandelt werden konnte. So übergab ich meiner Therapeutin eine kleine Liste von Erinnerungen, die ich aus meiner Kindheit hatte und die alles andere als positiv sind. Es war zwar keine Hausaufgabe gewesen, doch mir war wichtig, dass sie alles, was ich ihr erzählt hatte, auch schriftlich vor sich hatte. Zu folgenden Erinnerungen habe ich Lücken und Fragen, die ich gern gefüllt bzw. beantwortet haben wollte und noch immer möchte: Erinnerungen – wahr oder ausgedacht?21. 21 Originalschrieb, den ich meiner Therapeutin so überreicht habe. Ich kann mich relativ weit in meine Kindheit zurückerinnern. Die Erinnerungen spielen etwa in einem Alter von drei bis fünf Jahren. Allerdings sind sie so unterschiedlich, manchmal verschwommen, manchmal glasklar, dass es mir schwerfällt zu unterscheiden, ob ich sie mir nur ausgedacht habe oder ob sie wirklich so passiert sind. Daher erhoffe ich mir durch die EMDR-Therapie Klarheit. Im Nachfolgenden beschreibe ich Ihnen ein paar Erinnerungen, die mir hin und wieder in den Kopf kommen und bei denen ich mich jedes Mal frage: Hat sich das wirklich so abgespielt oder ist da deine kindliche Fantasie mit dir durchgegangen? Noch ein kleiner Hinweis: Wenn ich mich an diese Situationen erinnere, fühle ich absolut gar nichts. Ich gerate weder in Panik noch bekomme ich Angst oder verspüre sonstige Reaktionen. Das Einzige, was ich an mir selbst beobachten kann, ist Neugierde. Ist das so passiert und was war davor bzw. danach? Erinnerung 1: Wie alt ich hier war, kann ich leider nicht sagen. Ich vermute mindestens vier Jahre. Wir waren zu Besuch bei einer Verwandten. Es kann eine Oma gewesen sein, da ich mich an eine alte Frau erinnere, die mit einem riesigen Messer vor meinem Gesicht herumwedelte und mir irgendwelche Horrorgeschichten erzählte. Typisch Omas eben … Zu dieser Zeit hatte ich, wie jedes Kind, eine Lieblingszeichentrickserie (Gargoyles: Auf den Schwingen der Gerechtigkeit – Erstausstrahlung Ende 1994). Schon damals war ich ein riesiger Fan von Fledermäusen, Monstern und Co. Ich saß auf dem Boden vor dem Fernseher und sah mir also diese Serie an. Auf einmal kam meine Mutter ins Zimmer gestürmt und machte, mitten in der Folge, den Fernseher aus. Sie begründete ihre Tat mit der Erklärung, dass wir jetzt gehen würden. Empört, wie man als kleines Kind, dem man eben die Lieblingssendung unterbrochen hat, eben sein kann, machte ich meinem Ärger Luft. Schlagartig genervt von meinen Beschwerden zog meine Mutter schnaubend ab. Sie hatte sich vor das Mehrfamilienhaus gestellt und qualmte eine Zigarette, um wieder herunterzukommen. Ihre soeben begangene Tat ließ ich nicht unbemerkt, stampfte ihr hinterher und beschwerte mich weiterhin. Ich wolle die Folge zu Ende sehen und danach könnten wir ja gehen. Ganz konnte ich meinem Ärger allerdings nicht freien Lauf lassen, da mich meine Mutter kurzerhand am Arm packte und mich wütend hinter sich herzog, zurück ins Haus. Ich wehrte mich weder verbal noch körperlich, da mich diese Aktion komplett überraschte. Sie schob mich unsanft in den einige Meter entfernten Aufzug, drückte irgendeinen Knopf und zog wutentbrannt wieder ab, um weiterrauchen zu können. Da stand ich nun, allein und völlig perplex im Aufzug, und sah den Türen zu, wie sie sich schlossen und meine Mutter dahinter verschwand. Sofort traten mir die Tränen in die Augen und ich fing an zu weinen. Nur wenige Sekunden später öffneten sich die Türen wieder und ein älteres Ehepaar stand vor dem Aufzug. Sie brachten mich sofort zurück zu meiner Mutter. Was sie allerdings zu ihr sagten und wie sie reagierte, als ich auf einmal wieder zurückgebracht wurde … keine Ahnung. Das wäre interessant zu erfahren. Zusatz: Über 15 Jahre später habe ich das Intro der Serie, das ich von damals noch im Kopf hatte, gegoogelt und sie tatsächlich gefunden. Als sie im Fernsehen lief, habe ich mir jede Folge angesehen. Großartig! Erinnerung 2: Diese Erinnerung spielt in meinem Geburtsort. Ich muss also noch sehr jung gewesen sein, da wir im Laufe der Jahre sehr viel umgezogen sind. Vielleicht war ich drei Jahre alt. Diese Erinnerung unterscheidet sich von allen anderen in dem Punkt, dass sie nur schwarz-weiß ist. Ich weiß nicht warum, aber diese Tatsache lässt mich ein wenig an ihrer tatsächlichen Begebenheit zweifeln. Meine Mutter spielt hier wieder die Hauptrolle. Es fängt abrupt an und hört genauso plötzlich wieder auf. Ich sehe mich selbst, wie ich panisch vor Angst und mit tränenüberströmtem Gesicht von der Küche ins Schlafzimmer renne und versuche, mich zu verstecken. Ich weiß, dass ich verfolgt werde, und wenn mich mein Verfolger erwischen sollte, würde ich mehr als nur Ärger bekommen. Den Part des Verfolgenden übernahm hier meine Mutter. Unsere Wohnung war nicht sonderlich groß und so waren auch die Versteckmöglichkeiten begrenzt. Verzweifelt versuchte ich mich zwischen einen Schrank und das Gitterbett zu quetschen und hoffte, dass mich dieses spärliche Versteck retten würde. Doch auf einmal sehe ich nur noch ein wutverzerrtes Gesicht vor mir … und damit endet auch die Erinnerung. Erinnerung 3: Ich befinde mich diesmal im Geburtsort meiner kleinen Schwester. Wir sind zu meinem Stiefvater gezogen, der diesmal eine zentrale Rolle spielt. Aus Erzählungen weiß ich, dass er sehr oft betrunken und gewalttätig gegenüber uns allen war. Doch daran kann ich mich nicht erinnern. Seltsamerweise habe ich nur gute Erinnerungen an ihn. Ich erinnere mich an ein Zimmer, in dem eine gewaltige Soundanlage stand. Es liefen lauter Songs von Michael Jackson. Die Tatsache, dass dort eine professionelle Anlage stand, lässt mich stutzen, da wir eigentlich gar nichts hatten. Wir lebten in einer Bruchbude und Luxus war ein absolutes Fremdwort. Trotzdem sitze ich bei meinem Stiefvater auf dem Schoß und sehe mir ein Musikvideo von Michael Jackson an (Song: „They don’t really care about us“). Als kleinen Snack hatte er mir zudem Gummibärchen gereicht, die ich genüsslich futterte. Erinnerung 4: In dieser Erinnerung bin ich mir sicher, dass das der Tag der Geburt meiner kleinen Schwester war (September 1995). Der Grund ist folgender: Wir waren in einer großen Wohnung. Es gab einen großen Fernseher, vor den mein Bruder und ich auch gleich gesetzt wurden. Wir saßen also auf dem Boden und futterten Rosinen (heute hasse ich Rosinen). Ich weiß nicht, bei wem wir waren. Ich erinnere mich an eine Frau und an einen Mann. Letzterer war evtl. mein Stiefvater. Auf einmal wurden wir eilig in ein leeres Zimmer mit einer Matratze geschoben und die Tür wurde hinter uns abgeschlossen. Uns wurde versichert, dass sie bald wiederkommen würden. Seltsamerweise waren wir an das Eingesperrtwerden gewohnt, da weder mein Bruder noch ich protestierten oder eine sonstige Regung zeigten. Wir wurden schon früh immer ins Schlafzimmer eingesperrt. Gnädigerweise ließ man uns dabei ein Töpfchen zurück, damit wir wenigstens unser Geschäft nicht in der Ecke erledigen mussten. Allerdings wurden wir nicht nur eine halbe Stunde eingesperrt, sondern über Stunden, da ich mich noch genau an den fast überlaufenden Topf erinnere. Jahre später erzählten mir meine Schwestern, dass ich in der ersten Zeit bei meinen Pflegeeltern immer eine Toilette in meiner Nähe wissen musste, da ich immer sofort aufs Klo musste, egal wo wir waren (ich weiß das noch, lüge aber und bestreite es, weil es mir sehr peinlich ist). Das ist inzwischen nicht mehr so … zum Glück. Erinnerung 5: Diese Erinnerung liegt mir sehr am Herzen, da sie die einzige ist, von der ich glaube, dass sie meinen Opa beinhaltet. Ich kann mich weder an ein Gesicht noch an weitere Begebenheiten erinnern. Ich weiß auch leider nicht, ob ich damals überhaupt einen Opa hatte. Ich bin wieder in meinem Geburtsort und stehe in der Tür zwischen Küche und Hausgang. Ein älterer Mann, zu dem ich bewundernd aufschaue und zu dem ich offensichtlich eine enge Bindung habe, reicht mir einen Kaugummi. Das war es leider schon. Doch das Gefühl, das ich dabei hatte, sagt mir, dass dort jemand gewesen sein muss, den ich wirklich geliebt habe. Meine Therapeutin nahm die Liste dankbar entgegen und wir fingen mit den Vorbereitungen an. Um eine größere Störung ausschließen zu können, sollte ich zuerst einen Fragebogen ausfüllen, der die Aufdeckung einer eventuellen dissoziativen Störung22 zum Ziel hatte. Zwar erahnte meine Therapeutin das Ergebnis bereits, doch da dies nun mal zum Prozedere gehört, füllte ich ihn aus. Ich mag Fragebögen und hatte auch mit diesem, bis auf ein paar Rückfragen, keine Probleme. Abgefragt wurden hierbei unterschiedliche alltägliche Situationen, wobei manche offensichtlich auf das Vorhandensein von mehreren Persönlichkeiten abzielten. Andere wiederum konnten von den meisten Menschen sicher als bereits erlebt bestätigt werden. Jede Frage musste auf einer Skala von 0 bis 100 beantwortet werden. Je höher der Wert, desto öfter hatte man die Situation bereits erlebt. Am Schluss wurde alles auf eine bestimmte Weise zusammengerechnet und ein spezieller Score ermittelte dann den Grad einer eventuellen dissoziativen Störung. Ab einem Score von 25 lag eine Störung vor. Mit einem Wert zwischen 21 und 22 lag ich darunter und somit war das Offensichtliche offiziell ausgeschlossen. 22 Multiple Persönlichkeitsstörung. Als Nächstes übergab mir meine Therapeutin eine Trauma-Landkarte. Auf diesem Diagramm sollte ich die Erinnerungen einzeichnen, wobei die y-Achse die Belastung und die x-Achse das Lebensalter darstellte. Wie ich bereits erwähnte, empfinde ich beim Zurückdenken an früher absolut nichts. Dies bemerkte meine Therapeutin ebenfalls, als sie mir die Karte übergab, da ich ihr dies auch kurz vorher erläutert hatte. Doch bei der nachfolgenden Besprechung musste auch meine Therapeutin feststellen, dass mich keine der beschriebenen Erinnerungen belastete. In dem Diagramm hatte ich jede einzelne dem Wert 0 zugeordnet. Nachdem wir also die negativen Erinnerungen abhaken konnten, wurde es Zeit, sich mit positiven zu befassen. Und genau da traf sie meinen Schwachpunkt. Schon während meiner Recherchen war ich auf dieses Hindernis gestoßen und seither grübelte ich über positive Erinnerungen aus meinem Leben. Eingefallen war mir jedoch nichts. Genau das sagte ich ihr auch und sie versuchte mir zu verdeutlichen, was damit gemeint war. Es musste kein Erlebnis im zeitlichen Rahmen der negativen Erfahrungen sein. Es reichte auch etwas Aktuelles, ein gutes Essen, ein spezieller Ort oder eine andere Kleinigkeit. Ich grübelte also ewig und sagte ihr schließlich, dass ich ihr nichts sagen konnte. In diesem Moment fiel mir schlichtweg nichts ein, an was ich mich hätte erinnern können. Ich sagte meiner Therapeutin, dass alles irgendwie gleich wäre und ich sowieso nur die schlechten Erinnerungen behalten und beschreiben konnte. Sie gab jedoch nicht auf und half mir mit Tipps und kleinen Hinweisen auf die Sprünge, bis ich tatsächlich etwas fand: Tiere! Tiere bringen in mir immer das Beste zum Vorschein. Ich liebe sie über alles und kann auch nur ihnen gegenüber offen Gefühle zeigen.23 Jeder, der tierlieb ist und ein eigenes Haustier hat, weiß, dass sie die Fähigkeit haben, einen die alltäglichen Sorgen wenigstens kurz vergessen zu lassen. Da ich jedoch noch nie ein Haustier gehabt habe, beließen wir es bei Tieren allgemein. Hauptsache es stand etwas auf der Liste. 23 Meine Therapeutin begründet diesen Umstand immer mit der Tatsache, dass Tiere einen nun mal nicht verurteilen. Der nächste Punkt auf der Liste war besonders wichtig für die Vorbereitung und die Durchführung der EMDR-Sitzungen. Sollte während dieser etwas Belastendes aufkommen, war es zwingend notwendig, mich sofort an einen schönen Ort versetzen zu können, an dem ich mich wohlfühlte. Damit dieser Vorgang rasch und ohne Anstrengung vonstattengehen konnte, musste der Wechsel an diesen „Wohlfühl-Ort“ trainiert und automatisiert werden. Bei der Wahl dieses Ortes musste ich zum Glück nicht lange überlegen. Er befand sich sogar unter den Beispielen meiner Therapeutin: mein Zimmer. Ich fühlte mich dort am wohlsten und sehnte es in unliebsamen Momenten herbei. Dabei sah ich immer folgendes Bild vor mir: Ich sitze, in eine Decke gehüllt, auf dem Sessel. Vor mir läuft der Fernseher (vorzugsweise läuft eine meiner DVDs) und neben mir steht eine Kanne Tee. Der Rollladen ist ganz unten, die Tür zu, es ist angenehm warm und die Deckenlampe spendet warmes Licht. Sollte ich mich also künftig in einer angespannten Situation wissen, wäre das der richtige Moment, um den Rückzug an meinen beschriebenen Wohlfühl-Ort zu trainieren. Dabei konnte ich mich als symbolische Hilfe selbst umarmen (Schmetterlingsgriff) oder, sollte ich nicht allein sein, eine Bewegung mit den Fingern einstudieren. Doch auch die entspannten Momente sollte ich zum Üben nutzen, damit der Rückzug so gut und schnell wie möglich in der entscheidenden Situation erfolgen konnte. Ich muss zugeben, dass ich gerade das Üben der „Selbstberuhigung“ ordentlich schleifen ließ, da ich mir dabei enorm lächerlich vorkam. Das Üben wurde mir zusätzlich erheblich erschwert, da ich zu diesem Zeitpunkt mitten im Umzug steckte. Der oben beschriebene Wohlfühl-Ort entsprach inzwischen meiner neuen Wohnung. Hin und wieder hatte ich ein paar Details geändert, wobei mein Lieblingsplatz wohl der zu Hause bei meinen Pflegeeltern blieb. Zwar hatte ich dort nicht meine Bilder und DVDs um mich herum, aber der Rest stimmte fast. Schlussendlich war es mir am wichtigsten, dass ich meine Sachen um mich herum hatte, dass es schön warm war und ich mich sicher fühlte. Passend zu den bevorstehenden EMDR-Sitzungen war das „Augenflackern“ wieder vermehrt aufgetreten. Ob das nun mit der Therapie zusammenhing oder einfach nur perfektes Timing war, kann jeder für sich selbst entscheiden. So ergab sich mir schon bald die Möglichkeit, die von meiner Therapeutin genannten Tipps24 in die Tat umzusetzen. Als nun also das Flackern wieder anfing, versuchte ich es anzuhalten, genauer zu betrachten und ggf. in einen vorgestellten Safe zu sperren. Doch jedes Mal, wenn ich versuchte, das zuckende Bild anzuhalten, wurde alles rabenschwarz. Nach vielen vergeblichen Versuchen gab ich es schließlich auf, hatte mich aber so auf das Bild konzentriert, dass ich mir zumindest gemerkt hatte, was da ständig seine Form geändert hatte. 24 Ich sollte die „Tresor-Übung“ durchführen, bei der das störende Bild eingefroren und kontrolliert in einen imaginären Tresor geschlossen wird. Hierbei kam mir mein Zeichentalent sehr gelegen, doch das Ergebnis ähnelte einer flachen, mit Rillen versehenen Perle. Ich weiß nicht mal, ob es überhaupt eine Perle sein sollte, doch das war das Erste, an das ich beim Zeichnen dachte. Auch meine Therapeutin konnte mit diesem Bild nichts anfangen, fragte mich aber, wo und wann ich mit solchen Perlen in Berührung gekommen war. Das Einzige, was ich ihr sagen konnte, war, dass ich durch meine Leidenschaft für Armbänder und Ketten auch eine Zeit lang Ketten aus Holzperlen um meinen Hals getragen hatte. Dass hier ein Zusammenhang bestand, ist wohl eher unwahrscheinlich, denn diese Holzperlen hatten kein Muster. Nur kurze Zeit später trat das Flackern erneut auf. Doch diesmal war etwas anders. Wieder zuckten meine Augen unkontrollierbar, auch wenn ich dies erst viel später bewusst wahrnahm. Auch das Bild behielt seine Größe und Position. Allerdings schob sich eine Art verzerrter Rahmen über die Szene. Ich konnte die Szene zwar willkürlich verändern, der Rahmen jedoch blieb an Ort und Stelle. Mit dem Flackern der Augen verschwand schlussendlich auch der Rahmen. Auch hier stieg ich noch einmal aus dem Bett, um diesen seltsamen Rahmen zeichnen zu können. Auch zu diesem Bild hatte meine Therapeutin keine Erklärung, da ihr so ein Phänomen noch nie untergekommen sei. Um ehrlich zu sein, kehrte in diesem Moment der Gedanke zurück, dass ich vielleicht doch verrückt würde. Doch das behielt ich für mich. Nichtsdestotrotz fand sie es spannend und fügte ihren Unterlagen eine Kopie meiner Skizze hinzu. Nach einem langen Gespräch über meine Gesundheit konnte ich meine Ungeduld nicht mehr verbergen und erkundigte mich vorsichtig nach dem weiteren Vorgehen in Sachen EMDR. Inzwischen hatten sich sogar meine Pflegeeltern nach dem Fortschritt erkundigt, was relativ selten vorkam. Das war für mich der ausschlaggebende Moment selbst einmal nachzuhaken. Um mich nicht weiter auf die Folter spannen zu müssen, begann meine Therapeutin mit einer Übung. Hierbei sollte sich zeigen, ob ich meinen Wohlfühl-Ort auch oft genug trainiert hatte. Gleichzeitig konnte ich so den Ablauf der EMDR-Sitzungen kennenlernen. Sie erklärte mir, dass ich mir eine Situation denken sollte, die kaum traumatisierend war. Wohl eher einen Moment, in dem ich mich über etwas oder jemanden geärgert hatte. Dabei würde sie langsam ihre Finger vor meinen Augen hin und her bewegen. Dann sollte ich zwischen dieser unangenehmen Situation und meinem Wohlfühl-Ort wechseln, und das mehrere Male. Sozusagen ein Nippen an der negativen Erfahrung und sofort danach das Eintauchen in den Wohlfühl-Ort. Dies war allerdings noch nicht Teil der ersten Übung. Zuvor fingen wir ganz klein an. Dazu positionierte sich meine Therapeutin schräg vor mir, um so bequem mit ihren aneinandergelegtem Zeige- und Mittelfinger vor meinen Augen hin und her pendeln zu können. Nachdem wir beide also eine gute Position gefunden hatten, erklärte sie mir, dass sie sich exakt an ein vorgegebenes Protokoll halten würde. Ich solle mich daher nicht wundern, wenn es zu Pausen oder Wiederholungen ihrerseits kommen würde. Und dann ging es los: Meine Therapeutin trug mir mit ruhiger Stimme auf, an meinen Wohlfühl-Ort zu denken, während sie langsam ihre Finger vor meinem Kopf hin und her bewegte. Wichtig war hierbei, dass ich ihnen lediglich mit den Augen und nicht mit dem ganzen Kopf folgen durfte. Nach wenigen Sekunden stoppte sie die Bewegung und erkundigte sich nach meinem Befinden. Zu meinem Erstaunen war da tatsächlich etwas. Während ich den Fingern gefolgt war und an mein Zimmer dachte, konnte ich spüren, wie sich langsam eine warme Schicht über meinen ganzen Körper zog. Nach ein paar weiteren Runden, die jedes Mal ein paar Sekunden andauerten, hatte sich diese „Schicht“ auf meinen Kopf konzentriert. Diese Veränderung teilte ich natürlich meiner Therapeutin mit, die sehr zufrieden mit diesem Phänomen war. Offensichtlich sprach dies dafür, dass ich auf EMDR ansprach. Nach weiteren Runden hatte die Schutzhülle, wie ich sie nannte, eine entsprechende Dicke und Wärme erreicht, von der sie dann auch nicht mehr abwich. Erst an diesem entscheidenden Punkt hörten wir auf. Zufrieden konnten wir beide feststellen, dass wir das soeben Erlebte als Erfolg verbuchen konnten, auf dem es sich wunderbar aufbauen ließ. Und genau das taten wir dann auch in der nächsten Sitzung. Zuvor hatte ich die Hausaufgabe erhalten, mir eine Erinnerung oder ein Erlebnis ins Gedächtnis zu rufen, das mich etwas belastet hatte. Sollte ich keinerlei Belastung ausmachen können, würde auch ein anderes Gefühl ausreichen, wie z. B. Ärger. Wieder fiel mir anfangs absolut nichts ein. Da ich mir schon als Kind angewöhnt hatte, alles zu verdrängen, was mich belastete, und so jegliche Gefühlsbindung abzuwehren, war es entsprechend schwer, der Liste auch nur einen Punkt hinzuzufügen. Nur wenige Tage vor der Sitzung war ich endlich auf eine Erinnerung gestoßen, die ich wohl niemals vergessen werde: der Tag, an dem ich meine Pflegeeltern enttäuscht hatte. Tatsächlich denke ich an diese Szene nur sehr ungern, da ich dadurch sehr wütend werde – und zwar auf mich selbst. Folgendes hat sich damals zugetragen: Ich war ca. elf Jahre alt. Wir waren noch nicht sehr lange bei unseren Pflegeeltern und waren daher immer noch irgendwie in der Kennenlernphase. Besonders meinen Pflegevater konnte ich damals noch nicht so richtig einschätzen. Ich war zu der Zeit noch immer ein ordentliches Weichei und brach regelmäßig in Tränen aus. Zwar war es nicht mehr so schlimm wie vor dem Heimaufenthalt, aber so ganz kam ich nicht aus meiner Haut. Und auch hier sollte es nicht anders verlaufen. Wie jeden Abend brachten uns unsere Pflegeeltern ins Bett. Mein Bruder und ich teilten uns ein Zimmer mit Stockbett und durften abends noch eine Kassette hören. Diese lief bereits und mein Pflegevater beugte sich zu mir herunter, um mir eine gute Nacht zu wünschen. Dabei kratzte er mich aus Versehen am Arm. Ganz meiner damaligen Natur entsprechend, fing ich sofort an zu weinen, ohne auf seine Nachfrage nach dem Grund für mein Weinen zu reagieren. Also ging er schweigend aus dem Zimmer und mein Bruder erkundigte sich neugierig nach der Ursache meiner Tränen. Aufgelöst und ohne nachzudenken, brachte ich schluchzend hervor: „Das Arschloch hat mich gekratzt!“ Kaum hatte ich diesen verhängnisvollen Satz ausgesprochen, wurde die Tür mit einem lauten Knall aufgerissen und mein Pflegevater stand mit wutverzerrtem Gesicht in der Tür. Zu Recht stinksauer, erkundigte er sich, ob er soeben richtig gehört habe. Der Verzweiflung nahe, schob ich der Kassette das soeben Gehörte zu, wobei jedem im Raum klar war, dass das eine glatte Lüge war. Dann beugte sich mein Pflegevater erneut zu mir herunter und erteilte mir eine Standpauke, die sich gewaschen hat. Allerdings habe ich nicht ein Wort von dem wahrgenommen, was er damals zu mir gesagt hat. Der Grund dafür waren meine eigenen Gedanken. Als ich nämlich das zornige Gesicht über mir sah, erwartete ich regelrecht eine Tracht Prügel, die er mir bestimmt gleich verpassen würde. Vor meinem inneren Auge schlug er mich grün und blau. Dass er niemals einer Fliege etwas zuleide tun würde, war mir damals noch nicht klar. Doch mir muss die nackte Panik im Gesicht gestanden haben, denn ich war absolut sicher, dass er mich für meine Worte bestrafen würde. Also sah ich mir die schreckliche Szene in meinem Kopf an, zitterte vor Angst und konnte so seinen Worten keine Beachtung schenken. Das war allerdings nicht das Belastende, an das ich so ungern zurückdenke.25 Dies geschah am Tag darauf. An diesem baten mich meine Pflegeeltern zum Gespräch. Ich wusste natürlich ganz genau, worum es darin gehen würde. Dementsprechend starrte ich nur voller Scham auf den Boden, unfähig, auch nur einen der beiden anzusehen. Lediglich als meine Pflegemutter dies streng verlangte, hob ich meinen Kopf und legte all die Reue, die ich empfand, in meinen Gesichtsausdruck. Zuerst machten mir beide in einem unheimlich ruhigen Ton klar, dass das, was ich am vorigen Abend getan hatte, falsch gewesen war. Dass mein Pflegevater dies nicht verdient hatte, war mir zwar inzwischen klar geworden, trotzdem legten sie Wert darauf, dass ich genau das verstanden hatte. Und dann kam der schlimmste Satz, den eine Mutter jemals zu ihrem Kind sagen kann: „Wir sind wirklich sehr enttäuscht von dir!“ 25 Wobei ich zugeben muss, dass ich danach nie wieder solch eine große Angst hatte wie damals. Da saß ich nun, hörte den soeben vernommenen Satz in meinem Kopf nachhallen, sah in die enttäuschten Gesichter der beiden und vernahm das langsame Brechen meines Herzens. Nie wieder habe ich mich so sehr geschämt wie an diesem Tag. Mein Gewissen erinnerte mich noch viele Jahre mit einem hämischen Grinsen an diesen Tag und ließ mich die Reue von damals in gleicher Intensität spüren. Somit hatte ich also die perfekte Erinnerung für die EMDR-Sitzung gefunden. Meiner Therapeutin gefiel dieses Erlebnis sehr gut, sie notierte sich die Geschichte und dann konnte es auch schon losgehen. Wieder wurden unter den verwunderten Blicken ihrer Hunde die Möbel umgeräumt und schon bald saßen wir in bekannter Position nebeneinander. Bevor es losging, erklärte mir meine Therapeutin, dass wir festlegen mussten, wie lange ich jeweils in das Erlebnis eintauchen sollte. Dabei lag die Zeitspanne bei null bis zehn Sekunden. Ganz tapfer entschied ich mich sofort für die vollen zehn Sekunden. Sie bremste meine Euphorie jedoch ein wenig und beschloss, dass acht Sekunden wohl zunächst ausreichend seien. Erst als ich als Belastungsgrad eine Drei angab, stimmte sie meiner Entscheidung zu und es blieb doch bei den zehn Sekunden. Ihr Skript als Stütze auf den Knien liegend, bat mich meine Therapeutin mit ruhiger Stimme, in die soeben beschriebene Erinnerung einzutreten. Während sie also langsam ihre Finger vor meinen Augen hin und her bewegte, versetzte ich mich in die vergangene Situation, als ich reumütig vor meinen Pflegeeltern saß. Dabei hörte ich meiner Therapeutin zu, wie sie langsam von zehn rückwärts zählte. Als sie bei null angekommen war, holte sie mich in die Gegenwart zurück. Um sicherzugehen, dass ich auch wirklich mit all meinen Sinnen wieder im Hier und Jetzt war, prüfte sie mich mit der Frage, woher ich denn wisse, dass ich komplett zurück sei. Leicht verwundert über diese seltsame Frage antwortete ich ihr wahrheitsgemäß, dass ich sie hören und sehen konnte. Des Weiteren würde ich eine Lampe surren hören und auch einen ihrer Hunde, der stets schnarchend auf seinem Platz lag. Zufrieden mit meinen Beweisen startete meine Therapeutin eine neue Runde. Nach dem erneuten Ablauf der zehn Sekunden holte sie mich zurück und baute meine zuvor erwähnten Anhaltspunkte der Gegenwart in ihre ruhigen Worte mit ein. Dann erkundigte sie sich nach dem Belastungsgrad der gerade erlebten Erinnerung. Ich war unsicher und teilte ihr genau das mit. Ihre Feststellung, dass der Belastungsgrad nicht gestiegen sei, konnte ich jedoch bestätigen, was sie sich zufrieden notierte. Am Ende jeder Sitzung nahmen wir uns immer Zeit, um über alltägliche Dinge zu sprechen. Da bei jeder EMDR-Sitzung langsam und vorsichtig vorgegangen werden muss, war dies eine hervorragende Möglichkeit, um zu entspannen. Ich war zwar durchgehend ruhig und gelassen und genoss die Gespräche jedes Mal. Wie so oft kam mein Hobby, das Zeichnen, zur Sprache. Nebenher erwähnte ich Leonardo da Vinci sowie meine Faszination für ihn. Ich erwähnte beiläufig, dass er Linkshänder war und deshalb in Spiegelschrift geschrieben hatte. Ich, als Rechtshänder, hatte mich schon oft in langweiligen Situationen (vor allem in der Schule) am Schreiben mit meiner schwachen Hand versucht, allerdings ohne das seitenverkehrte Schreiben. Ich erzählte meiner Therapeutin, dass ich dabei auch einen Hintergedanken hatte. Sollte nämlich aus irgendeinem Grund meine rechte Hand kurzzeitig ihren Dienst quittieren, z. B. durch einen Bruch, so könne ich ohne Probleme auf die linke Hand ausweichen. Natürlich war das eher als Spaß gedacht, da ich immer noch nicht richtig mit links schreiben kann. Trotzdem brachte diese Aussage meine Therapeutin auf eine Idee: Dieses Mal bestand meine Hausaufgabe darin, eine Struktur des menschlichen Körpers, vorzugsweise des Darms, mit links zu zeichnen. Passend zu meinem Beschwerdebild schlug ich sofort eine Dünndarmzotte vor. Das Ergebnis erstaunte mich selbst, doch gleichzeitig erleichterte es mich ungemein. Auf den ersten Blick sah es so aus, als hätte ich die Zeichnung mit meiner starken Hand angefertigt. Nun wusste ich, dass ich zur Not auf die linke Hand wechseln konnte. Mit ein wenig Übung würde dann auch der leicht verschwommene Eindruck verschwinden. Die Zeichnung war so sehr gegen die Erwartungen meiner Therapeutin, dass diese davon ausging, eine Skizze vor sich zu haben, die mit rechts gezeichnet worden war. Zugegebenermaßen war ich mächtig stolz auf mich, als ich sie aufklärte. Ihr Erstaunen hierüber war umwerfend. Und wieder bekam ich am Ende der Stunde keine Hausaufgabe auf. Auf mein Nachhaken antwortete sie, dass sie sich etwas überlegen würde und ich absolut nichts dafür tun müsse. Mein gespanntes Warten wurde belohnt. In der nächsten Therapiestunde führte meine Therapeutin nämlich eine echte EMDR-Sitzung durch. Bevor es losging, benötigte sie wieder eine weniger belastende Situation von mir. Mir fiel auch sofort etwas ein, auch wenn hierbei der Ärger größer war als eine evtl. bestehende Belastung: Einer der letzten Ärzte, den ich wegen meiner Beschwerden aufgesucht hatte, hatte es tatsächlich geschafft, dass ich mich für einen kurzen Moment wie ein Stück Dreck gefühlt habe. Dabei wurde mir dieser Mann als gutmütig und großherzig empfohlen. Entweder war damals nicht sein Tag oder er zeigt seine gute Seite nur vor Privatpatienten. Ich tendiere dabei stark zu der zweiten These. Ich saß damals vor seinem Sprechzimmer. Neben mir saß eine Frau, die offenbar auch zu ihm wollte, denn sie las gerade einen Artikel über ihn. Sie war vor mir dran und kam eine gute halbe Stunde später freudestrahlend wieder aus dem Zimmer. Ich wartete nun gespannt darauf, aufgerufen zu werden, da dieser Mann wohl tatsächlich seinem Ruf entsprach. Schließlich wurde die Tür geöffnet, der Arzt trat heraus und rief meinen Namen. Doch als er sah, wer auf diesen Namen reagierte, und ich lächelnd auf ihn zuging, entgleisten ihm förmlich die Gesichtszüge. Jegliche Freundlichkeit und Wärme, die ich noch vor wenigen Minuten beobachtet hatte, als er die Dame vor mir begrüßt hatte, waren schlagartig verschwunden. Die Enttäuschung in mir wuchs mit jedem Schritt, den ich auf ihn zumachte, doch ich zwang mich zum sympathischsten Lächeln, das ich in diesen Sekunden aufbringen konnte. Das Gespräch verlief dementsprechend kühl und ich verließ das Sprechzimmer genauso hilflos, wie ich es betreten hatte. Noch nie habe ich meine Zeit derart verschwendet. Beim Verlassen der Klinik schaffte ich es kaum, meine Tränen zurückzuhalten, was bei mir sehr selten vorkommt. Wieder war meine Therapeutin sehr zufrieden mit dieser Erinnerung. Nachdem sie sich wieder schräg vor mir postiert hatte, eröffnete sie mir, dass wir anhand der soeben beschriebenen Erinnerung eine echte EMDR-Sitzung durchführen würden. Doch zuvor brauchte sie noch ein paar Informationen. Dazu las sie die exakten Worte aus ihrem Protokoll vor, damit alles seinen rechten Gang gehen konnte. Zuerst sollte ich mich kurz in die Situation versetzen, als dem Arzt klar wurde, dass bei mir nichts zu holen war. Die „Entgleisung der Gesichtszüge“ war der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Erinnerung und somit auch der Mittelpunkt der Sitzung. Danach sollte ich mir eine negative Beschreibung zu meiner Person einfallen lassen, die am besten zu dem entscheidenden Moment passte. Anfangen sollte der Satz mit „Ich bin …“. Sofort schoss mir das Wort „wertlos“ durch den Kopf und so sagte ich etwas zögerlich: „Ich bin wertlos.“ Passend hierzu sollte ich nun eine positive Beschreibung angeben, die genauso aufgebaut war wie der negative Satz. Das war schon schwieriger für mich, da zu dieser Situation wohl nie etwas Positives passen würde. Nach langem Hin und Her einigten wir uns auf „wertvoll“, auch wenn es immer noch nicht ganz passte. Danach wandten wir uns wie jedes Mal dem Belastungsgrad der Erinnerung zu. Doch wie bereits erwähnt, belastete mich diese Erinnerung nicht wirklich. Daher gab ich ihr eine großzügige Eins.26 Ich betonte dabei noch einmal, dass hier der Ärger vorherrschte und ich mir ja schon als Kind antrainiert hatte, mich von solchen Situationen nicht vereinnahmen zu lassen. Dann sprach meine Therapeutin erneut den negativen Satz an und bat mich auf einer Skala von 1–727 anzugeben, wie sehr dieser zu dem Entgleisungsmoment passen würde. Hier gab ich eine Fünf an. Anhand dieser Skala sollte ich nun auch dem positiven Satz eine Bewertung zukommen lassen, wobei dieser eine Eins bekam. 26 0 = keine Belastung; 10 = größte Belastung. 27 1 = überhaupt nicht zutreffend; 7 = absolut zutreffend. Die Vorbereitungen waren somit abgeschlossen und es konnte losgehen. Meine Therapeutin warnte mich noch vor, dass die Bewegungen ihrer Hand nun deutlich schneller sein würden, was ich kurz darauf auch bemerkte. Ich hatte große Mühe, mit meinen Augen ihren Fingern zu folgen und mich gleichzeitig auf das Erlebte von damals zu konzentrieren. Nach der ersten Runde passierte nichts, doch beim zweiten Mal fielen mir ein paar Details ein. Kleinigkeiten, wie ein Bild an der Wand oder das Aussehen der Zeitschrift der Frau. Genau das wollte meine Therapeutin erreichen und startete sogleich die nächste Runde. Erst als ich mehrmals keine Veränderung feststellte, beendeten wir die EMDR-Sitzung. Ein letztes Mal sprach sie mich auf den positiven und negativen Satz an. Wieder sollte ich angeben, inwieweit die beiden Sätze auf die Situation zutrafen. Bei dem negativen Satz „Ich bin wertlos“ gab ich eine Drei an, somit eine Besserung. Lediglich der positive Satz „Ich bin wertvoll“ passte, rein logisch gedacht, immer noch nicht dazu und erhielt weiterhin eine Eins. Auch der Belastungsgrad war auf eine Null gesunken, da ich in diesem Moment keinen Ärger mehr wahrnehmen konnte. Zwar verlief diese Runde nicht exakt nach den Vorstellungen meiner Therapeutin, doch nun wussten wir beide, wie so eine EMDR-Sitzung abläuft, und konnten darauf aufbauen. Als wir wieder, wie gewohnt, einander gegenüber saßen, sprachen wir über das soeben Erlebte und wie es weitergehen konnte. Als Nächstes sollten meine Kindheitserinnerungen an der Reihe sein. Meine Therapeutin machte noch einmal deutlich, dass sie wisse, dass mich diese in keiner Weise belasten würden, sondern dass ich lediglich die Lücken füllen wollte. Ich war erleichtert, dass sie diesen Umstand nicht vergessen hatte. Und die soeben durchgeführte Sitzung hatte gezeigt, dass solche Lücken tatsächlich gefüllt werden konnten. Sie betonte auch, dass ich als Kind instinktiv alles richtig gemacht hätte, als ich begonnen hatte, die belastenden Erlebnisse nicht an mich heranzulassen. Ich wäre heute sicher ein anderer Mensch, wenn ich jedes Mal zugelassen hätte, dass eine negative Erfahrung die Kontrolle über meine Gedanken und Gefühle übernimmt. In der nachfolgenden Sitzung gab mir meine Therapeutin noch ein paar Übungen mit auf den Weg, die ich bei einer aufkommenden Belastung durchführen konnte. Zum einen die „Tresor-Übung“, die sie schon zum Thema Augenflackern angesprochen hatte; zum anderen die „Lichtstrom-Übung“. Hierbei sollte ich der Belastung eine Gestalt geben. Dieser Gestalt sollte ich dann einer Form, Farbe, Größe oder Temperatur zuweisen, damit daraus etwas Greifbares werden konnte. Wäre dies erreicht, sollte ich mir ein Licht in einer angenehmen Farbe (in meinem Fall Blau) denken. Dieses sollte ich über meinen Scheitel in meinen Körper strömen lassen. So würde beim Einatmen das mir angenehme Licht angezogen werden und sich in meinem Körper verteilen. Beim Ausatmen hingegen würden die Schmerzen oder eine anderweitige Belastung aus dem Körper hinausgeleitet werden. Als sie mir dieses Vorgehen erläuterte, konnte ich nicht umhin, nur eines zu denken: Wann soll ich diese Übung ausprobieren, wenn ich doch nie zulasse, dass mich ein Gefühl bzw. ein belastendes Erlebnis derart überwältigt und erdrückt? Gleichzeitig kam ich wieder nicht umhin, der offensichtlichen Schwachsinnigkeit dieses Vorgehens keine Aufmerksamkeit zu schenken. Inzwischen hatte ich meine Therapeutin ein Jahr lang regelmäßig aufgesucht. Durch die durch EMDR erforderlichen allwöchentlichen Sitzungen (davor war es ein 2-Wochen-Rhythmus) war die Anzahl der genehmigten Sitzungen rasch erreicht. Nun musste eine Weiterführung beantragt werden, die von uns beiden Einsatz verlangte, dessen Erfolg aber ziemlich sicher war. Um also weitere Sitzungen genehmigt zu bekommen, war es nötig, dass meine Therapeutin einen umfassenden Bericht über mich erstellte, den ein Gutachter bewerten sollte, um dann eine Zu- oder Absage erteilen zu können. Meine Therapeutin war sich allerdings sicher, dass unserer weiteren Zusammenarbeit nichts im Wege stehen würde. Sie übergab mir daher einen Anamnesefragebogen, der über mehrere Seiten Fragen zu meiner Person und meiner Familie beinhaltete. Bei diesen wurden mein bisheriger Lebensweg, Fähigkeiten, Hobbys und das soziale Umfeld abgefragt. Da ich großen Spaß am Ausfüllen von Fragebögen habe, machte ich mich am gleichen Abend motiviert an die Beantwortung der Fragen. Ich verfasste auf dem Laptop zehn Seiten und hoffte, meiner Therapeutin damit das Erstellen des Gutachtens etwas leichter machen zu können. Meinen „Roman“ nahm sie auch dankbar entgegen und schon in der nächsten Sitzung gab sie mir Rückmeldung dazu. Tatsächlich hatte ich mir dies auch erhofft, da ich sie schon lange fragen wollte, was ihr Eindruck von mir war. Mich interessierte brennend, was ein Experte zu meiner Person zu sagen hatte. Kaum saß ich ihr also gegenüber, eröffnete sie mir, dass sie meine Antworten mit großem Interesse gelesen habe und ich wirklich gut schreiben könne. Diese Feststellung führte sie zu einer Frage, die mich doch sehr überraschte. So sehr, dass ich in verlegenes Gelächter ausbrach. Meine Therapeutin fragte mich grinsend und mit großer Neugier: „Sind Sie schon einmal auf Hochbegabung getestet worden?“ Nachdem ich meinen Lachflash überwunden hatte, brachte ich glucksend ein stotterndes „Nein“ hervor. Ich gab ihr gegenüber zu, dass ich schon oft darüber nachgedacht hatte, da mir mein Anderssein natürlich nicht entgangen war. Doch ich war vorerst bei der Feststellung geblieben, dass ich zwar nicht dumm sei, aber wohl nicht so weit gehen konnte, von einer Hochbegabung zu sprechen. Auch wenn ich es als Lächerlichkeit abgetan hatte, so machte ich mir seitdem Gedanken über die Vermutung meiner Therapeutin. Ich fing an zu recherchieren, zuerst bei meiner Familie und dann im Internet. Dazu berücksichtigte ich meine eigenen Beobachtungen, die ich über die Jahre an mir selbst gemacht hatte, und führte alles zusammen. Ich kam irgendwann zu dem Schluss, dass ich zwar gerne Gewissheit hätte, ich mir aber neben den Kosten den Aufwand sparen konnte. Schließlich hielt meine Familie die Idee für absurd, und selbst wenn ich hochbegabt wäre, würde es mir für meine Zukunft kaum etwas bringen. In der nächsten Therapiesitzung sprach ich diese Gedanken auch an. Schlussendlich einigten wir uns darauf, dass ich zumindest überdurchschnittlich intelligent sei, was mir zwar bereits klar war, aber ich fand es trotzdem schmeichelhaft, es zumindest grob bestätigt zu bekommen. Nachdem dieses Thema also geklärt war, sprachen wir noch einmal über das Gutachten. Meine Therapeutin hatte sich zu meinen Antworten des Fragebogens noch ein paar Notizen gemacht und stellte mir dazu ein paar Fragen, um das Gutachten so präzise wie möglich formulieren zu können. Bevor die Stunde vorüber war, verdeutlichte sie mir, dass sie gern eine weitere EMDR-Sitzung durchführen würde. Diesmal wäre diese allerdings nicht als Übung gedacht, sondern sollte die erste richtig durchgeführte und hoffentlich erfolgreiche Sitzung darstellen. Sie würde hierbei mit einer „Affektbrücke“ arbeiten, die mir den Zugang zu verdrängten bzw. schwachen Erinnerungen erleichtern sollte. Allerdings müssten wir dafür die Ferien abwarten, da sie nach der Sitzung rund um die Uhr erreichbar sein wollte, sollte irgendetwas mit mir sein. Bei unserem letzten Wiedersehen vor ihrem Urlaub berichtete mir meine Therapeutin, dass sie mein Gutachten erstellt und ganze sechs Seiten an den Gutachter übermittelt hatte. Verwundert erkundigte ich mich, was sie denn so geschrieben habe. Zu meinem noch größeren Erstaunen bot sie mir an, mir eine Kopie des Gutachtens mitzugeben, was ich natürlich neugierig und dankbar annahm. Zu Hause las ich es mehrmals durch und fand viele Aspekte wieder, die ich auch selbst an mir beobachtet hatte. Ich war zwar etwas erschüttert, dass es wohl doch so offensichtlich war, gleichzeitig machte es mich stolz, dass ich nicht nur andere, sondern auch mich selbst sehr gut beobachten kann. Das sagte ich ihr auch nach ihrem Urlaub. Inzwischen hatte ich auch Post von meiner Krankenkasse bekommen, die eine Fortsetzung der Therapie bewilligt hatte. Nun sollte es also losgehen: die erste EMDR-Sitzung, die es mir ermöglichen könnte, mehr Details aus meiner Vergangenheit zu erhalten. Gespannt nahmen wir beide unsere Positionen ein und schon konnte es losgehen. Zuerst erklärte mir meine Therapeutin noch einmal in knappen Worten, dass die EMDR-Sitzung wie zuvor geübt ablaufen würde, nur dass wir diesmal mit einer Affektbrücke arbeiten würden. Bei der Affektbrücke wird über eine aktuell belastende Situation eine Brücke zu einer früheren belastenden Situation geschaffen. Für diesen ersten Versuch wollte sie daher meine Abscheu gegenüber Alkohol nutzen. Da ich schon bei dem bloßen Geruch dieser widerlichen Substanz jegliche gute Laune verliere, schien ihr dies als ein geeigneter Start. Das Prozedere unterschied sich trotzdem kaum von den vorherigen. Wieder sollte ich den Belastungsgrad angeben, wenn ich den Geruch von Alkohol im Atem einer Person wahrnahm (ich nannte eine Drei). Danach war es wieder Zeit für eine geeignete Beschreibung meiner selbst. Passend fand ich hierfür die negative Beschreibung: „Ich habe keine Kontrolle“, die ich mit einer Sieben als ziemlich zutreffend bezeichnete. Den positive Satz: „Ich habe die Kontrolle“ versah ich allerdings mit einer Drei. Wie immer spürte ich nichts im Körper und auch gefühlsmäßig zeigte sich keine Reaktion. Nachdem ich mich in eine Situation versetzt hatte, in der mir plötzlich dieser grauenvolle Geruch in die Nase stieg, erhob meine Therapeutin auf mein Signal ihre Hand und bewegte ihre Finger vor meinen Augen, die ihnen brav folgten. Auf die Nachfrage, ob ich irgendetwas Bestimmtes gesehen oder gefühlt hätte, konnte ich leider nur mit den Schultern zucken. Nach zwei weiteren Runden fiel mir allerdings auf, dass ich immer wieder in der gleichen Szene landete und auch nicht mehr aus dieser hinauswollte. Meine Gedanken hefteten sich zunehmend an eine Erinnerung, die eigentlich gar nichts mit dem Geruch von Alkohol zu tun hatten. Genau das sagte ich auch meiner Therapeutin, die mir sofort auftrug, bei dieser Erinnerung zu bleiben und mir zu erzählen, was genau ich dort sah: Als ich noch klein war, wurden mein Bruder und ich oft eingesperrt. In meinem Geburtsort gab es ein Schlafzimmer, das spärlich eingerichtet war und Platz für einen Schrank, ein Gitterbett und ein normales Bett bot. Ich saß auf dem Bett, während mein Bruder in dem Gitterbett stand und gerade noch so über den Rand schauen konnte. Mein Blick fiel sofort auf ein Nachttöpfchen, das randvoll gefüllt war mit meinen Hinterlassenschaften. Mein Bruder trug zu dieser Zeit noch Windeln, was bestätigte, dass nur ich für das Füllen des Töpfchens verantwortlich war. Ich schlussfolgerte weiter, dass wir vermutlich lange eingesperrt worden waren. Meine Therapeutin stellte mir Fragen zu der Einrichtung (lieblos und kahl), dem Geruch (nichts wahrnehmbar), der Temperatur (ebenfalls nichts wahrnehmbar) und sonstigen Eigenschaften der Möbel. Krampfhaft versuchte ich mich in dem Zimmer umzusehen und beobachtete mein Verhalten genauer. Ich vermutete, dass wir absichtlich in das Zimmer eingesperrt worden waren, damit mein Stiefvater mit meiner Mutter allein war und sie, vermutlich, verprügeln oder anderweitig bestrafen konnte, ohne dass wir dabei zusehen mussten. Da sich die Tür zu dem Zimmer genau vor meinem Bett befand, studierte ich meine Position auf dem Bett genauer. Ich saß auf der Matratze und wandte mich dem Töpfchen zu. Doch auf einmal hatte ich eine Vermutung für meinen abgewendeten Blick: Immer wenn ich ein Geräusch genauer analysieren möchte, unterbreche ich den visuellen Reiz, indem ich wegsehe und eines meiner Ohren automatisch der Geräuschquelle zuwende.28 Meine Vermutung sprach ich laut aus und meine Therapeutin bat mich, genau an dieser Szene festzuhalten und währenddessen noch einmal ihrem Finger zu folgen. Doch wieder geschah nichts. 28 Ein paar Tage später kam mir der Gedanke, dass ich sicher versucht hatte, etwas zu hören, da sich mein Bruder ebenfalls der Tür zugewandt hatte und weder mir noch seinem Spielzeug Aufmerksamkeit schenkte, was Babys eigentlich in der Regel machen. Wie immer fragte sie mich danach, wie gut die Sätze, welche eine Kontrolle im positiven und im negativen Sinn beinhalteten, passen würden. Der positive Satz „Ich habe die Kontrolle“ passte nun etwas besser zu dem wahrgenommenen Reiz der Alkoholfahne (von Drei auf Vier) Nachdem wir erneut unsere gewohnten Plätze eingenommen hatten, bemerkte ich mit einer leichten Enttäuschung, dass mein Beschützerinstinkt nicht so einfach nachgab. Ich verdeutlichte ihr grinsend, dass er mir gesagt hatte: „Nein, nein, Fräulein, so einfach kommst du nicht an die Erinnerung ran!“ Interessiert befragte ich mich meine Therapeutin, was bzw. wer mein Beschützer sei und ob es noch mehr Charaktere geben würde. Da ich tatsächlich gern Selbstgespräche führe, stellte ich ihr, mit Nachfragen ihrerseits, folgende Varianten von mir vor, von denen sich zwei jedoch als mein eigens geschaffenes Skotom herausstellen sollten:
Der Albtraum
Strukturelle Dissoziation. Als ich meiner Therapeutin erzählte, dass ich meine Gefühle individuell kontrollieren konnte, sagte sie mir, dass dieses Verhalten eine typische Folge eines frühkindlichen Traumas sei. Hierbei hätte ich Gefühle abgespalten, um mich so schützen zu können. Da wir in dem anfänglichen Fragebogen eine dissoziative Identitätsstörung ausgeschlossen hatten, nahm ich ihre Information zwar interessiert auf, beschäftigte mich vorerst aber nicht weiter damit. Erst als mir aufgefallen war, dass ich meine Gefühle besser steuern konnte, als ich dachte, begann ich genauer zu recherchieren. Es entwickelte sich eine Art Selbststudie daraus, in der die Gefühle Gestalt und Geschlecht annahmen sowie Namen zugewiesen bekamen. Jede(r) von ihnen hatte bestimmte Aufgaben und wurde mehr oder weniger von mir beachtet. Gleich zu Anfang muss ich allerdings erwähnen, dass diese „Personifizierungen“, wie bereits erwähnt, reine Skotome und daher nie existent waren. Es hat jedoch so gut zu der Diagnose „strukturelle Dissoziation“ gepasst, dass erst meine Therapeutin und dann auch ich nicht anders konnten, als genau das zu sehen, was wir sehen wollten. Dass wir einem gewaltigen Irrtum zum Opfer gefallen waren, erkannte ich zum Glück nur kurze Zeit später. Im Folgenden möchte ich Ihnen diese (Skotom-)Gefühlspersonen vorstellen und hin und wieder Abschnitte aus recherchierten naturwissenschaftlichen Ansichten beifügen. Hierbei bildet das Bild der „strukturellen Dissoziation“ den roten Faden: Unter dem Begriff „Dissoziation“ wird das Auseinandernehmen, das Distanzieren von etwas verstanden. In diesem Kontext versteht man hierbei eine Spaltung der Persönlichkeit, die durch traumatische Ereignisse hervorgerufen wurde. Der Schweregrad der Dissoziation hängt dabei, neben der Häufigkeit, Art und Schwere der Traumatisierung, vom Alter und dem psychischen Entwicklungsstand der betreffenden Person ab (Lüttichau, 2014) Werfen wir nun einen kurzen Blick auf die Strukturen des Gehirns. Bei einer traumatischen Situation trennt sich die Großhirnrinde von den anderen Strukturen des Gehirns, die, entwicklungsgeschichtlich betrachtet, älter als diese sind. Die Großhirnrinde ist als „jüngste“ aller Gehirnstrukturen unter anderem für die Steuerung der Wahrnehmung, Sprache, Gefühle und des Körpers zuständig. Mit ihr können wir bewusst denken, uns selbst reflektieren, Bewegungen koordinieren, Handlungen einschätzen und ausführen sowie unsere Sinne wahrnehmen. Die weitaus älteren „unteren“ Strukturen des Gehirns kann man auch als Säugetierzentrum bezeichnen, da hier die Vorgänge des limbischen Systems gesteuert werden, also alle Systeme, die bei anderen Säugetieren ebenfalls vorhanden sind. Darunter fallen Alarmfunktionen, Bewegungen und die Grundfunktionen des Körpers wie z. B. Atmung, Herzschlag, Verdauung und Schlaf. Kurz: Die Großhirnrinde steuert die Wahrnehmung, während die älteren Strukturen den Körper übernehmen. Schon im Laufe der ersten Lebensjahre bildet sich die Wahrnehmung aus. Für eine gute Entwicklung brauchen das Gehirn, der Körper und die Seele einen guten Nährboden. Durch Bindungen, Rhythmen, Wiederholungen und eine vernünftige Versorgung bekommt jeder Mensch durch viele kleine Erfahrungen sein eigenes Gefühl von Raum und Zeit. Als Säugling kann man sich selbst zwar noch nicht richtig wahrnehmen, trotzdem wird hier schon der Grundstein für eine individuelle Gestaltung des Erwachsenseins gelegt, wobei hier alle Möglichkeiten offen sind. Das Gehirn des Säuglings legt Verbindungen und Strukturen an, aus der sich dann eine Instanz entwickeln kann, die sich selbst beobachtet – also eine Zentrale, die sich selbst auf dem Laufenden hält. Ohne Pause werden dabei Verbindungen vom Körper geknüpft. Er stellt das Gleichgewicht her, sortiert Material aus, das noch nicht verarbeitet werden kann, und konzentriert sich so auf das Wesentliche. Die Dissoziation beschäftigt sich somit mit dem Material, das aussortiert, aber nicht verarbeitet wurde. Wird einem Erlebnis nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt, gerät es nicht ins Bewusstsein. So wird ein Geschehen zwar erlebt, jedoch nicht richtig wahrgenommen. Stellen Sie sich vor, Sie wollen die Straße überqueren. Plötzlich kommt ein Auto angerast. Ohne dass Sie über mögliche Konsequenzen nachdenken, reagieren sie blitzschnell und springen reflexartig zurück. Hier schützen Sie sich selbst und sorgen für Ihr Überleben. Oder Sie sind nachts unterwegs und kennen sich nicht in der Gegend aus. Plötzlich hören Sie ein Geräusch, das sie keiner logischen Quelle zuordnen können. Augenblicklich erstarren Sie, spannen sich an und richten Ihre vollste Aufmerksamkeit auf die Hörquelle. Beide sind Situationen, in denen die Verbindung zwischen der Großhirnrinde und den älteren Strukturen unterbrochen wird. Denn hier ist ein bestimmtes Verhalten notwendig, das dann nicht gesteuert bzw. beeinflusst werden kann (siehe Abbildung unten)
Symptome der. strukturellen Dissoziation. Die Symptome, die sich nach einer Traumatisierung ausbilden können, sind abhängig von dem Erlebten. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass keines der nachfolgenden Symptome lediglich nach Traumatisierungen auftritt. So kann es sein, dass jemand eines der Symptome zeigt, obwohl keine traumatische Situation in der Vergangenheit aufgetreten ist (Hantke, Görges) Durch die unzureichende Integration und Verarbeitung des erlebten Traumas wurde dieses ohne Zusammenhang in verschiedenen Regionen des Gehirns und des Körpers gespeichert. Wie schon erwähnt, wird das Großhirn während des traumatischen Erlebens von den älteren Hirnregionen getrennt und verbleibt in diesem Zustand der Dissoziation. Befand sich der Körper während der Traumatisierung in Hochspannung, werden diese Erinnerungen, gerade bei frühen Erlebnissen, vor allem als Körpererinnerung gespeichert. Wird man schon in den ersten Lebensjahren traumatisiert, fehlt oft eine bildhafte Erinnerung, die man sich wie eine Filmszene ins Gedächtnis rufen könnte. Vorrangig sind daher körperliche Symptome, wie
War der Körper allerdings in Unterspannung, schaltet er automatisch ab und geht in die unbewusste Vermeidung (siehe Abbildung oben). Erkennen kann man dies z. B. an
Häufig kann man sogar Wechsel zwischen der Hoch- und Unterspannung beobachten, wenn dies auch in der traumatischen Situation so ablief. Der Traumatisierte löste sich hier von seiner Aktivität, brach zusammen, rappelte sich wieder auf, nur um dann wieder zusammenzuklappen. Dieser Kreislauf wiederholt sich dann beliebig oft. Während all dieses Durcheinanders versucht der Körper trotzdem die Situation auszugleichen, um so wieder eine Einheit herstellen zu können. Steht so ein Organismus unter Hochspannung, versucht er die nötigen Bedingungen zum Herunterfahren zu schaffen. Er versucht, die Erfahrungen zu integrieren, um diesen Ausgleich schaffen zu können. Durch die Dissoziation zwischen Großhirnrinde und den älteren Hirnstrukturen entstehen Erinnerungen der Wahrnehmung, auf die der Körper sehr extrem reagiert. Diese Erinnerungen zeigen sich dann nach dem Erlebnis in Symptomen wie Amnesien, Empfindungslosigkeit des Körpers oder der Emotionen, Schmerzunempfindlichkeit, Konzentrationsstörungen oder einer verzerrten Wahrnehmung von Raum und Zeit. Ein weiterer Faktor der Art der Symptome ist die Entwicklungsstufe zur Zeit der Traumatisierung. Dabei sind die Fähigkeiten und Möglichkeiten der Wahrnehmung von Bedeutung. Bei der ersten Traumatisierung wird ein Schema festgelegt, wie der Mensch auf eine erneute Traumatisierung reagiert. Reagiert er z. B. bei der ersten Traumatisierung mit Unterspannung, so wird dieses Schema bei einer erneuten Traumatisierung oder einer Bedrohung abgerufen, da diese Reaktion gefestigt wurde und somit das Niveau der Notfallreaktion bestimmt. Dieser Notfallplan wird bei nachfolgenden Traumata, Triggern oder ähnlichen Bedrohungen immer aktiviert, auch wenn es sein kann, dass es keine Erinnerungen an die erste Traumatisierung gibt (wie das bei Kindern der Fall sein kann) (Hantke & Görges, 2012) Ereignet sich ein Trauma im Kindesalter und wird über längere Zeit wiederholt, bildet sich in diesem Moment eine Dissoziation, da das Kind noch nicht in der Lage ist, die Erlebnisse teilweise oder ganz zu integrieren, d. h., sie werden nicht Teil der einheitlichen Lebensgeschichte. Diese Fähigkeiten bilden sich erst im Laufe der Entwicklung. Das Kind muss sich aber in den entscheidenden Momenten anpassen und spaltet daher das Nicht-Integrierbare ab und lässt es so stehen. Dieses Vorgehen wird aber im späteren Leben zur generellen Konfliktlösung und daher weiterhin angewendet, was ein Problem in Form einer Behinderung der Anpassungsfähigkeit darstellt (Eickhoff-Fels, 2011; Lüttichau, 2014) Gerade wenn Kinder in jungen Jahren traumatisiert werden, kann die Art der Beziehungsgestaltung während dieser Zeit, als Erinnerungsfragment, zu einem Symptom werden. Zu der Erinnerung gehört z. B., dass das Kind Angst hat und ihm jemand Angst gemacht hat. Rückblickend kann man sagen, dass hier ein ungleiches Kräfteverhältnis und eine angespannte Stimmung bestanden haben. Der Körper erinnert sich an diese Situation und passt sein Verhalten in ähnlichen Situationen an das Vergangene an: Ist das Gegenüber der Stärkere, so reagiert er mit Angst. Ist man selbst allerdings der Stärkere, dominiert die Aggressivität. Wird dieses Trauma nicht verarbeitet, kann diese Reaktion zu einem Charakterzug werden. Erkennbar wird dies daran, dass jemand schnell laut wird, auf einmal verstummt und sich zurückzieht, sich in eine Traumwelt rettet, wenn der Lärm zu groß wird, oder sogar zuschlägt, wenn ihm jemand zu nahe kommt. Problematisch wird die Behandlung solcher Symptome vor allem in Versorgungskreisen wie Heimen, Therapien oder Gruppen, in denen jeder Einzelne sehr eng gesteckte Grenzen hat. Durch diesen Stress steigt auch die Anspannung. Wird dann auch noch die Grenze überschritten, kann durch den steigenden Stress eine traumabedingte Beziehungsreaktion bestehen, die nur mit viel Zeit und Hilfe verhindert werden kann (Hantke, Görges) Viele Traumatisierte versuchen ein weiteres Auftreten einer Traumatisierung zu verhindern, indem sie sich zurückziehen, soziale Kontakte und bestimmte Themen vermeiden und sich keine Gedanken über die Zukunft machen. Um besser mit ihrem inneren Erleben zurechtzukommen, suchen sie sich daher Dinge, die ihre Aufmerksamkeit stark beanspruchen und sie ablenken, gleichzeitig aber in einer Sucht enden können (z. B. durch Drogen, Alkohol, Arbeit, Spielen, Chatten, Fernsehen etc.). Manche entwickeln auch Zwangshandlungen, welche die Eindrücke und Symptome der Hoch-/Unterspannung regulieren sollen. Durch den gescheiterten Versuch der Großhirnrinde, das Geschehene einzuordnen und zu verarbeiten, versucht der Traumatisierte, selbst Zusammenhänge zu suchen und so seinem Verhalten einen Sinn zu geben. Dabei kommen oft Lebenseinstellungen zutage, die alles andere als optimistisch sind:
Es kann auch vorkommen, dass die Sätze, die man selbst oft genug hören musste, zur eigenen Lebenseinstellung werden:
Psychotherapie 2.0. Während ich also dem Start meines Aufenthaltes in einer Psychiatrie entgegenblickte und ihn bedrohlich näher kommen sah, vollführten meine Gedanken eine wahre Achterbahnfahrt. Ich wusste nämlich inzwischen, dass ich nicht auf eine Trauma-, sondern auf eine Depressionsstation sollte. Und hier sah ich mich nun wirklich fehl am Platz. Doch wieder legte ich mein vollstes Vertrauen auf den Doc – etwas anderes blieb mir sowieso nicht übrig. Dadurch dass endlich alles raus war, konnten der Doc und ich offen sprechen, und so fragte ich ihn nach der einen oder anderen Einschätzung. Seine ehrlichen Antworten überraschten mich wenig und ich war erstaunt, wie präzise er mich beschrieb. Ich hatte ihn kurz vor meiner stationären Aufnahme auch gefragt, was für Fragen ihm denn anfangs auf der Zunge gelegen hätten, die er bis dato aber niemals ausgesprochen hatte. Zu meiner Enttäuschung verweigerte er die Auskunft zu dieser Frage, da er befürchtete, dass ich durch die Beantwortung derer ihm gegenüber ggf. keine Notwendigkeit mehr darin sehen könnte, diese bzw. ähnliche in der Klinik zu beantworten. Doch auch als ich ihm versicherte, dass ich niemals so handeln würde, da ich mir dadurch selbst Steine in den Weg legen würde, blieb er verschwiegen. Das Vorhaben, ihn nach der Behandlung hinsichtlich dieser Fragen zu löchern, hatte sich aber in meine gedankliche To-do-Liste gebrannt.34. 34 Was für Fragen das waren, habe ich nie erfahren. In seinen ausführlichen Beschreibungen meiner inneren Gedankenwelt gab der Doc diese so bildlich wieder, dass er sofort in die Reihe meiner Musen aufgenommen wurde. Da ich davon ausgehe, dass ich zwar traumatisiert, aber nicht sonderlich beeinträchtigt bin, sagte er auch hierzu seine ehrliche Meinung. Ich würde das Trauma bagatellisieren und meine „Seelenwelt“ wäre so stark verletzt worden, dass sie definitiv nicht darüber hinweg sei, sondern noch immer grün und blau geprügelt in einem Eck liegen würde. Diese Ansicht bewog mein Gehirn sofort, sich ein passendes Bild dazu auszudenken. Ein paar Tage später war das Werk vollendet und ich konnte es meiner neuen Muse präsentieren. Der Doc fand mein Bild sehr treffend, was mich natürlich stolz machte. Ich erklärte ihm, dass die blauen Flecken auf dem Mädchen auch eine Bedeutung hätten. Das blaue Auge dürfte dabei wohl selbsterklärend sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich als Kind seitens meiner Mutter oder meines Stiefvaters kein blaues Auge verpasst bekommen habe, ist doch relativ gering. Der Handabdruck auf dem Arm bezieht sich auf meine Kindheitserinnerung mit dem Aufzug, in den mich meine Mutter so unsanft befördert hatte
Damit hatte ich also mein letztes Projekt in „Freiheit“ abgeschlossen und inzwischen hatte sich meine Meinung über den geplanten Aufenthalt grundlegend geändert. Durch die Worte des Docs war ich anfangs sehr offen gegenüber den Therapieansätzen. Doch zwischenzeitlich hatte ich schlichtweg keine Lust. Ich sah überall nur das Negative und nahm auch nur das Schlimmste an. Als mich meine Pflegemutter an dem „Tag X“ in die Klinik fuhr, war ich unglaublich nervös. Doch mir war klar, dass diese Nervosität, sobald ich die Räumlichkeiten betreten würde, der Vergangenheit angehören würde. Dem war auch so. Allerdings traten die meisten meiner Prophezeiungen tatsächlich ein. Wie erwartet hatte ich eine Zimmergenossin. Gegen meine Erwartungen sprach allerdings, dass sie bei Weitem älter war als ich. Dazu kam noch, dass die Toiletten sowie auch die Dusche auf dem Gang waren. Meine Bezugsperson hatte einen ordentlichen Hang zur Esoterik und nutzte jede Gelegenheit, um Werbung für ihre Anwendungen zu machen. Lächelnd hörte ich ihr zu, belächelte sie in Gedanken aber hämisch. In jeder Kleinigkeit sah sie den Grund für meine Beschwerden und ihrer Meinung nach legte sich immer alles direkt auf den Magen (obwohl mir mein Magen nie mehr Probleme gemacht hatte seit der Gastritis). Dafür könne sie mir allerdings eine Aromatherapie empfehlen, die sie natürlich selbst durchführte. Den restlichen Ausführungen hörte ich kaum zu, da ich mir in Gedanken schon einen Strick drehte (nicht falsch verstehen) An dem Tag hatte ich viele Erstgespräche. Ich musste mehrmals erzählen, warum ich da war und was genau meine Beschwerden waren. Meine Kindheit wurde beim ersten Gespräch thematisiert und die Psychotherapeutin war erstaunt, wie frei und locker ich darüber sprechen konnte. Ich nutzte weder die bereitgestellten Taschentücher noch die angebotene Pause. Warum auch? Doch so jemand wie ich wurde dort offenbar selten gesehen. Im Laufe des Tages hatte ich auch das Vergnügen, mit der Leiterin zu sprechen, mit der auch der Doc telefoniert hatte. Auch ich fand sie sehr sympathisch und mit ihr sprach ich am ausführlichsten über mein Gewicht. Ich schilderte ihr meine Bedenken und meine Sorge, da ich nicht wusste, was bei einem andauernden Gewichtsverlust zu tun sei. Auch sie stellte sich diese Frage und gab mir daher die Hausaufgabe, ein Schreiben aufzusetzen, in dem deutlich vernehmbar war, was in diesem Fall von mir zu tun gewünscht wäre. Da ab einem gewissen Gewicht eine „Manie“ eintreten kann, in der die Realität nur bedingt oder sogar gar nicht wahrgenommen wird, musste ich jetzt entscheiden, was das Beste war. Sie können sich vorstellen, dass ich mit dieser Hausaufgabe anfangs überfordert war. Meiner Meinung nach war ich in einer Psychiatrie sowieso fehl am Platz und gehörte eigentlich in eine auf Ernährung spezialisierte Klinik. Hilfe suchend rief ich meine Pflegeeltern an und schrieb auch dem Doc eine E-Mail. Ich wollte definitiv festhalten, dass ich mit ihm bei einem möglichen Abbruch Rücksprache halten wollte. Doch mir war einfach nicht klar, was ich noch in den Therapievertrag hineinschreiben sollte. Nach den Tipps meiner Pflegeeltern und des Docs raufte ich mich zusammen und schrieb über zwei Seiten: Der Therapievertrag. Ich, [Name] (geb. **.**.**) erkläre mich dazu bereit, alles mir Mögliche zu versuchen, um wieder eine angemessene Lebensqualität herstellen zu können. Mir ist bewusst, dass mein momentaner Zustand dringende Handlung erfordert – auch von meiner Seite. Dies beinhaltet die aktive Teilnahme an mir angebotenen Maßnahmen, sofern ich mit diesen einverstanden bin. Sollte ich daher kein Interesse bzw. keinen Sinn hinter einer Therapie sehen, werde ich dies offen ansprechen und begründen. Gerne stehe ich hierzu zu Gesprächen zur Verfügung, um bestehende Problematiken sachlich und diszipliniert lösen zu können und es somit beiden Seiten so angenehm wie möglich zu gestalten. Sollte es zudem zu einer Situation kommen, die Gespräche bzw. Diskussionen erforderlich macht, würde ich gerne auch mit meinen Pflegeeltern [Namen] sowie mit meinem Hausarzt [Name] und ggf. mit meiner Therapeutin [Name] Rücksprache halten. Unter solchen möglichen Situationen verstehe ich hierbei z. B. einen gewünschten Abbruch des stationären Aufenthaltes meinerseits oder eine massive Verschlechterung meiner gesundheitlichen Verfassung (wie etwa andauernder ungewollter Gewichtsverlust). Beim Thema Gewicht heißt das konkret: Sollte ich einen BMI von 16 erreichen, was bei mir einem Gewicht von 42 kg entspricht (1,62 m), bin ich bereit, mich in eine darauf spezialisierte Klinik einweisen zu lassen. Der Gewichtsverlust wird und wurde nie bewusst und absichtlich von mir herbeigeführt bzw. unterstützt. Ich nehme weder entsprechende Mittel, die dies unterstützen würden, noch verweigere ich konsequent die Nahrungsaufnahme. Lediglich die nötigen Einschränkungen, die bei Nichteinhaltung meinen Zustand unnötig verschlechtern, werden von mir befolgt (Laktose-, Fruktose-, Histaminintoleranz; fettarme Nahrung, da sonst Wirkungsverlust vom [Medikament]) Sollte ich mich doch irgendwann in der Situation vorfinden, in der ich den Gewichtsverlust bewusst beschleunige, bin ich zu allen nötigen Maßnahmen bereit, die dieses verantwortungslose Verhalten augenblicklich beenden. Um dies zu ermöglichen, werde ich umgehend von meinen Handlungen berichten. Das primäre Ziel ist, wie bereits erwähnt, eine Besserung meiner Gesundheit, sei es psychisch oder körperlich. Allerdings wünsche ich keine medikamentösen „Experimente“, die eine eventuelle Besserung erbringen könnten, da ich diese in der Vergangenheit zur Genüge hatte. Die Medikamente, die ich momentan nehme [Auflistung der Medikamente], helfen mir und ich würde diese auch ungern absetzen. Als Beispiel der „Experimente“ möchte ich Antidepressiva nennen, die ich bis vor Kurzem regelmäßig eingenommen habe, deren erwünschte Wirkung jedoch sehr kurz anhielt oder sich gar nicht erst einstellte (Zunahme von Appetit und demzufolge von Gewicht, Schmerzlinderung, Abnahme der Stuhlfrequenz …) Meiner Meinung nach besteht momentan keine handfeste Diagnose, die weitere Medikamente rechtfertigen würde. Sollte dies jedoch irgendwann der Fall sein, würde ich dies gern in einem ausführlichen Gespräch erörtern und mit den oben genannten Personen Rücksprache halten [gez.] Nachdem ich die Endfassung des Vertrages eingereicht hatte, sahen die Leiterin der Station und die Psychologin darüber und stellten vor allem eines fest: Ich wollte offenbar um jeden Preis die Kontrolle behalten und diese niemals abgeben. Damit hatten sie den Nagel auf den Kopf getroffen, doch genau das war auch meine Absicht gewesen. Im Nachhinein kann ich sagen, dass „das zwingende Kontrolle-Behalten“ einer der absoluten Lieblingskommentare von Psychotherapeuten und Co. ist. Ich wette, dass sich jeder, der sich in eine Therapie begeben hat, diesem Fakt von überragender Menschenkenntnis irgendwann stellen muss. Inzwischen waren einige Tage vergangen und ich war leicht unterbeschäftigt. Neben meinen mitgebrachten Hobbys spielte ich hin und wieder mit den anderen oder ging in die Stadt. Doch im therapeutischen Sinne gab es anfangs kaum Angebote für mich. Gestaltungstherapie. Von Anfang hatte ich an der Gestaltungstherapie teilgenommen. Mir war klar, dass ich hier nicht viel zu erwarten hatte, da die Therapeutin sicher Informationen aus Bildern lesen würde, wo gar keine waren. In diesem Punkt wurde ich auch nicht enttäuscht. Die Kunsttherapeutin machte mir mimisch und gestisch sofort klar, dass sie meine Kunstrichtung nicht mochte bzw. sie nicht sonderlich originell fand. Schon als sie die erste Seite meiner Mappe aufschlug (die alle meine anatomischen Skizzen beherbergt), stellte sie abwertend fest, dass ich mit Bleistift zeichnen würde. Da dies jedoch nicht in die Sparte „abstrakte Kunst“ passte, war sie nicht sehr erfreut darüber und presste daher lediglich ein erzwungenes Lob heraus. Aus Organen kann man schließlich keine seelischen Informationen sammeln. Lediglich das durch den Doc inspirierte Bild zog ein wenig ihre Aufmerksamkeit auf sich. Sofort ernannte sie sich spontan zu einer meiner Musen und trug mir auf, von diesem Bild das Gegenteil anzufertigen. Widerwillig machte ich mich also an die Aufgabe, damit ich mich endlich wichtigeren Dingen zuwenden konnte (ich hatte von anderen Patienten schon Aufträge erhalten). Nach langem Überlegen brauchte ich einige Tage, um die Hausaufgabe endlich erfüllen zu können. Sie war alles andere als meine Muse und daher strengte ich mich kaum an. Sie sehen selbst an den etwas schräg geratenen Büchern auf der Zeichnung (siehe Bild unten), dass ich mehr als halbherzig an die Sache herangegangen bin
Die große Reparatur. Nun war es also bald so weit. Mein Kiefer sollte in eine richtige Position gebracht werden. Während ich gebannt dem bevorstehenden OP-Termin entgegensah, schwirrten mir die vergangenen Jahre noch einmal durch den Kopf. Erst hatte niemand gewusst, woher meine Beschwerden kamen. Dann riet man mir von einer Zahnspange ab, weil dies sinnlos sei. Erst ein Zahnarzt stellte fest, dass man direkt an den Kiefer musste, um eine Besserung zu erzielen. Weit über meiner Volljährigkeit war es dann endlich so weit. Nachdem mein heutiger Kieferorthopäde (KFO) mit nur einem kurzen Blick sofort wusste, was Sache war, sollte es auch schon losgehen. Vorstellung in der Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgie (MKG-Chirurgie), Beantragen der Kostenübernahme und Sparen für die privaten Zuzahlungen. Und plötzlich hatte ich die Zahnspange und nach nur einem Jahr gab mein KFO das O. K. für die OP. Mir war zwar bewusst gewesen, dass ich die Spange keine drei Jahre tragen müsste, bevor es losging, doch dass meine Zähne bereits nach einem Jahr gut standen, überraschte mich dann doch. So konnte das teure Röntgenverfahren in die Wege geleitet werden, das ich mithilfe einer Steuerrückzahlung auch gut bezahlen konnte. Natürlich wäre es mir lieber gewesen, ich hätte das Geld behalten können, doch wenn dadurch das Risiko minimiert wurde, dass keine Nerven verletzt wurden, war das für mich in Ordnung. Zudem hätte ich ein Leben lang etwas von der Operation. Ich willigte auch ein, Bilder von mir zu veröffentlichen, die mich vor und nach der Operation zeigen würden. Ich sah darin auch die Chance, evtl. professionelle Bilder für mich selbst zu erhalten, was mir auch versprochen wurde. Ich wurde also fotografiert, vermessen, geröntgt und aufgeklärt. Da ich aber dem Chirurgen mein vollstes Vertrauen schenkte, sah ich allem relativ gelassen entgegen. Mir waren mögliche Folgen zwar bewusst, doch hatte ich keine Angst davor. Er zeigte mir auf den Röntgenbildern, dass meine Nerven nicht ungünstig lagen, was mich umso mehr entspannte. So musste ich nur noch zur OP-Vorbereitung und mir dann bei meinem KFO spezielle Knöpfe auf die Zähne kleben lassen, an denen dann ein Draht zur Stabilisierung des Kiefers befestigt werden würde. Eine Woche wäre ich dann nicht imstande, meinen Mund zu öffnen. Die Vorbereitung zur OP verlief wie erwartet. Ich musste kreuz und quer durch die Klinik rennen, Dokumente ausfüllen, Fragen beantworten und mir Blut abnehmen lassen. Bei dem Anästhesiegespräch bekam ich zum ersten Mal einen guten Eindruck von der Klinik. Zuvor hatte ich mich dort ziemlich unwohl gefühlt, da die Klinik sehr alt, eng und unsympathisch auf mich gewirkt hatte. Doch ich beruhigte mich mit dem Gedanken, dass der erste Eindruck täuschen kann und ich sowieso nur ein paar Tage stationär dort sein würde. Daher fuhr ich relativ entspannt zurück. Am nächsten Tag trat ich meinen letzten Termin vor dem großen Tag an. Mein KFO klebte mir Brackets auf fast alle Zähne, was zwar komisch aussah, aber nötig war. Zu meiner Verwunderung sprach er dauernd über Gummis und nicht über Drähte, die meinen Kiefer in Position halten sollten. Ich beschloss, mich überraschen zu lassen. Im Laufe des Tages musste ich mich telefonisch in der Klinik informieren, wann ich am nächsten Tag würde antreten müssen. Zu meinem Glück sollte ich erst um neun Uhr erscheinen, da ich erst um elf Uhr unter das Messer kam. Zwar musste ich trotzdem früh aufstehen, aber schließlich hätte ich danach genug Zeit, den verpassten Schlaf nachzuholen. Da ich nichts mehr essen durfte, vertrieb ich mir den Abend mit Kofferpacken. Schließlich war der Tag gekommen. Nach über 20 Jahren mit einem schiefen Kiefer und fast zehn Jahren stetig ansteigender Beschwerden damit war es nun so weit. Der große Versuch, mir eines meiner großen Probleme zu nehmen. Ich war etwas nervös, hatte aber vollstes Vertrauen in meinen Chirurgen. Als ich ankam, wurde ich gleich in ein Zimmer gebracht, in dem ich die OP-Klamotten anlegen sollte. Ich nutzte die Chance und sprach erneut das Thema Essen und meine Unverträglichkeiten an. Die Schwester organisierte die Ernährungsberaterin des Hauses, die tatsächlich etwas Zeit für mich erübrigen konnte. Wir besprachen, dass ich nach der OP Kräutersuppe, Brühe und hochkalorische Drinks erhalten sollte – dazu Milch und Tee. Nach dem Gespräch konnte ich mich erleichtert zurücklehnen und geduldig darauf warten, dass es losging. Ich wollte allerdings weder lesen noch mich mit dem Handy beschäftigen. Stattdessen machte ich es mir auf dem Bett bequem und starrte gedankenverloren in die Wolken. Zu dem versprochenen Zeitpunkt wurde ich dann auch abgeholt und zur Vorbereitung gebracht. Nach einer weiteren halben Stunde Warten schob man mich schließlich einen Raum weiter, in dem ich dann auch anästhesiert wurde. Als ich wieder zu mir kam, forderte mich eine harsche Stimme mehrmals auf, tief Luft zu holen. Der Schleier lichtete sich langsam und mir wurde bewusst, dass ich alles überstanden hatte. Mit halb offenen Augen sah ich mich um und schlussfolgerte, dass ich im Aufwachraum liegen musste. Überall piepte und summte es, während mehrere Pfleger dem einen oder anderen Patienten zuriefen, dass sie gefälligst tiefer atmen sollten. Auch neben mir stand eine Schwester und blaffte mir diese Worte entgegen. Langsam entsprach ich ihrem Wunsch. Die Maschine über mir gab schnell Ruhe und damit auch diese unverschämte Frau. Da ich schon immer flach geatmet habe, verwunderte mich die Reaktion der Maschine keineswegs. Sagen konnte ich das aber niemandem, denn ich merkte sofort, dass ich meinen Mund nicht öffnen konnte. Mir hingen zudem zwei Drainagebehälter aus dem Mund, die Flüssigkeit sammeln sollten. Ich war zwar müde, wollte aber den ganzen Raum im Blick behalten. Doch im Moment konnte ich nur ein bisschen erkennen, dafür aber alles hören. Sofort dröhnte mir das nervige Schnarchen eines Patienten ins Ohr. Hin und wieder piepte mein Monitor und ich versuchte, besser zu atmen. Doch irgendwie war mein Hals zugeschnürt und voller Schleim. Zumindest fühlte es sich für mich so an. Es fiel mir unglaublich schwer zu atmen und ich versuchte, durch Röcheln Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Die Schwester kam dann auch verstand aber nicht, worauf ich hinauswollte. Sie war weiterhin unfreundlich und bellte mir entgegen, dass ich genug Luft bekommen würde. Sie fragte mich, ob ich mein Spray brauche oder Sauerstoff wolle, doch ich konnte nur mit Weinen antworten. Ich war nicht panisch oder traurig, sondern unglaublich wütend und enttäuscht. Wie konnte man nur so mit einem frisch operierten und noch benebelten Patienten sprechen? Hatte sie denn kein Mitgefühl? Und sprach sie mit jedem so? Erst nach ein paar Sekunden konnte ich die Tränen stoppen und beschloss auf keinen der Pfleger mehr zu hören. Dann würde meine Maschine eben piepsen. Ich würde genauso atmen wie immer und wie ich es für mich brauchen würde. Kurz nach diesem Ereignis kam mein Chirurg zu mir und sah sofort, dass es mir nicht richtig gut ging. Ich sagte ihm zwischen den Zähnen hindurch nur ein Wort: „übel“. Ab diesem Moment bekam ich Sorge, dass ich mich übergeben könnte. Doch er versicherte mir, dass das Gefühl schnell verschwinden würde und dies mit der OP zu tun hätte. Er sagte mir zudem, dass alles gut gegangen sei und keine Nerven verletzt worden seien. Kurz danach kam noch ein Arzt, der offenbar für die Weiterverlegung zuständig war. Anfangs wollte er mich wohl auf die Intensivstation verlegen, überlegte es sich aber anders, als ich ihm auf einen Zettel schrieb, dass mein Hals zugeschnürt war. Auch dies war eine Nachwirkung der OP, die sich wieder geben sollte. Verwundert veranlasste er meine Verlegung auf die Normalstation, auf die ich dann auch gebracht wurde. Und hier sollte die Hölle weitergehen. Nach ein paar Stunden konnte ich bereits aufstehen und mich umziehen. Wieder erntete ich den Respekt der Schwestern, dass ich so fit war. Nach dem Umziehen wagte ich einen Blick in den Spiegel und sah einem Marshmallow entgegen. Meine Backen waren um das Dreifache angeschwollen und die Behälter machten den Anblick nicht besser. Daher ging ich schnell zurück ins Bett und bat um etwas zu essen. Meine Verständigung hatte sich auf Papier und Stift reduziert, was auch ganz gut funktionierte. Doch das Essen stellte sich als grauenvoll heraus. Es roch furchtbar und ich rührte es daher nie an. Ich wollte einfach nur nach Hause, da ich spürte, dass die Tage hier furchtbar werden würden. Doch zuerst schrieb ich meiner Familie und meinen Freunden und Bekannten, dass alles gut gegangen war. Insgesamt verbrachte ich vier Tage in der Klinik. In diesen Tagen aß ich überhaupt nichts. Ich beschränkte meine Nahrungsaufnahme auf etwas Milch, Wasser und ein paar Schlucke dieser widerwärtigen hochkalorischen Nahrung. Nicht eine Sekunde lang kam jemandem der Gedanke, mir eine Magensonde zu legen. Erstaunlicherweise wurde nicht einmal kontrolliert, ob ich überhaupt etwas esse. Offenbar war ich von einem Haufen gewissenloser Menschen umgeben. Anders kann ich es wirklich nicht ausdrücken. Doch ich hatte erwartet, dass der Patient hier nicht an erster Stelle stehen würde. Ich hatte also kaum gegessen, schlecht geschlafen, Schmerzen, war von Pfeifen umgeben und konnte nicht sprechen. Natürlich resultierte dies in Gereiztheit. Ich schrieb meiner Familie, dass ich rauswolle und nicht mehr könne. Zudem kam der Chirurg einfach nicht, der die Drainagen entfernen sollte. Als dann auch noch ein Kommentar eines lustlosen Pflegers hinzukam, dass der Arzt evtl. erst zwei Tage später kommen würde, war es mit meiner Geduld vorbei. Doch er tauchte noch am Abend auf und versprach mir, dass ich am nächsten Tag gehen dürfe. Ich müsste allerdings jemanden organisieren, der mich abhole. Würde ich nämlich kollabieren, müsste jemand da sein, der Bescheid wisse. Nicht jeder wisse, was los sei, nur weil ich eine Schere um den Hals tragen würde. Diese musste ich nämlich immer bei mir tragen, damit ein evtl. notwendiger Notarzt genau wisse, was er zu tun hatte. Die Nachricht meiner Entlassung erleichterte mich so sehr, dass ich nun endlich Lust hatte, mich mithilfe meines Laptops mit meiner Zimmergenossin zu unterhalten. Auch sie fühlte sich hier sehr unwohl. Man musste mindestens eine halbe Stunde auf eine Schwester warten, wenn man etwas brauchte. Hatte man den Knopf betätigt, kam erst mal eine Stimme aus dem Gerät, die sich erkundigte, was man brauchte. Nun konnte ich ja nicht antworten. Also hörte ich jedes Mal: „Hallo? Was brauchen Sie? Hallo?!“ Dass ich mir ordentlich verarscht vorkam, ist wohl nachvollziehbar. Die Pfleger sahen doch, aus welchem Raum der Notruf kam. Was sollte dann diese Aktion? Dazu dauerte es dann noch einmal ewig, bis der eigene Wunsch erfüllt wurde. Erst am vorletzten Tag sagte mir eine Schwester, dass ich selbst Kühlpads holen könnte bzw. vor zur Zentrale laufen könnte. Dort würde es dann schneller gehen. Hätte man mir das von Anfang an gesagt, hätte ich mir viel ungeduldiges Warten ersparen können. So bekam ich überdies Bewegung und konnte deutlich öfter kühlen. Ich sah trotzdem noch aus wie ein fetter Hamster. Zudem machte sich meine fehlende Nahrungsaufnahme bemerkbar. Mir war schwindelig und unwohl. Doch ich schaffte es bis zur meiner Entlassung durchzuhalten. Kurz bevor meine Pflegeeltern eintrafen, wurden wir zu dem Kollegen meines Chirurgen gerufen, der mir endlich die Behälter entfernte. Mit dem Verlauf meiner Heilung war er ebenfalls zufrieden und so konnte ich endlich gehen. Das Erste, was ich zu Hause machte, war Kochen. Da ich nur Flüssiges zu mir nehmen konnte, verdünnte ich Vanillepudding und konnte es danach Vanillesoße nennen. Am nächsten Morgen überraschte ich meine Pflegeeltern dann mit einem „Morgen …“. Mir war nach dem Aufstehen aufgefallen, dass ich etwas sprechen konnte. Das erleichterte natürlich alles ungemein. Und so schlürfte ich tagelang Pudding, kühlte fleißig und schonte mein Kiefer. Endlich war der siebte Tag nach meiner OP erreicht. Meine Pflegeeltern fuhren mich in die Praxis meines Chirurgen, wo mir hoffentlich endlich die Drähte entfernt würden. Erst auf der Fahrt fiel mir ein, dass ich wahrscheinlich Gummis bekommen würde, die den Biss noch etwas schließen sollten. Doch mir war wichtig, dass ich einfach endlich die Drähte losbekam. Inzwischen war die Schwellung deutlich zurückgegangen. Man sah zwar noch, dass irgendetwas mit meinem Kiefer war, doch es war kein Vergleich zur einer Woche zuvor. Die grünen Flecken sprachen ebenfalls für eine Heilung und auch die Tatsache, dass ich die Platten und Fäden nun deutlich spüren konnte. Doch ich konnte meinen Kopf heben sowie drehen und verzeichnete mit jedem Tag mehr Möglichkeiten und Besserungen. Ich durfte nun mal nicht vergessen, dass mein Kiefer gebrochen war. Ich kam pünktlich zu meinem Termin und sogar sehr schnell dran. Erst wurde ich aber geröntgt. Die Bilder faszinierten mich schon beim Warten auf meinen Chirurgen. Ich hoffte inständig, dass er sie mir noch genauer zeigen würde. Doch zuerst verpasste er mir nach seiner Ankunft im Zimmer einen ordentlichen Dämpfer. Denn er sagte zu mir: „Ich habe dir ja gesagt, dass der Draht länger drinbleiben muss als normal.“ Diesen Schlag musste ich erst mal verdauen. Er spiegelte meinen traurigen Blick sofort und sagte mir, dass er mir das nach der OP aber gesagt habe. Ich konnte mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern. Erst später fiel mir ein, warum ich von einer Woche ausgegangen war. Seine Kollegen hatten mir bei den stationären Kontrollen gesagt, dass der Draht nach einer Woche entfernt werden würde. Der Chirurg und seine Assistentinnen waren aber so einfühlsam und freundlich, dass ich meinen Ärger schnell vergaß. Die Tatsache, dass mich alle duzten und mich ordentlich ablenkten, half dabei. Die nachfolgende Erklärung, warum der Draht so lange drinbleiben musste, leuchtete mir natürlich ein. Es gab mehrere Gründe. Würde man den Draht entfernen, würden die Muskeln unterhalb des Mundes den Kiefer nach unten ziehen. Das würde zu einer Zerstörung der Arbeit des Chirurgen führen. Zudem hätte ich am Ende einen leichten Überbiss. Meine Fehlstellung ließ nur das zu. Da ich meine Spange innen trug, waren zudem andere Umstände für die Verdrahtung gegeben, die ebenfalls zwei Wochen in Anspruch nahmen. Und dann noch mein Problemkind, das kleine Kiefergelenk: Es war zu beweglich und daher während der OP ein paar Mal herausgesprungen, genau wie bei der Weisheitszahn-OP, was ich aber nicht anders erwartet hatte. Somit bestanden mehrere Faktoren, die das angekündigte Vorgehen nötig machten. Da niemand von uns eine weitere OP durchstehen wollte, akzeptierte ich natürlich sofort die Anmerkungen des Chirurgen. Glücklicherweise zeigte er mir dann die Röntgenbilder und versprach mir sogar Kopien für mich. Die Faszination der Bilder vertrieb nach einer Weile meinen leichten Ärger. Ich konnte sowieso nichts dagegen machen. Mein Chirurg inspirierte mich mit seinem Kommentar, das Röntgenbild als WhatsApp-Profilbild einzustellen, zu einer weiteren Zeichnung, mit der ich die OP verewigen wollte
Eine Selbstdiagnostik. Meine Ergebnisse habe ich bereits vorgestellt, doch nun möchte ich genau erklären, welche Symptome auf mich zutreffen und welche nicht (und warum). Sie sehen in der unteren Tabelle, dass ich die Symptome der strukturellen Dissoziation sowie auch der cPTBS zusammengeführt habe. Dahinter habe ich markiert, welcher Punkt der Liste auf mich zutrifft und welcher nicht. Von 29 grob aufgeführten Symptomen finden sich also wenige bei mir wieder. Ich muss zugeben, dass ich beim Erstellen dieser Liste nur zwei Übereinstimmungen gefunden habe. Erst im Rückblick nach einigen Jahren war ich ehrlich genug mir selbst gegenüber, um diese erhöhen zu können. Sicherheitshalber habe ich einen Spezialisten per Mail kontaktiert und nachgefragt, wie viele Symptome denn für eine sichere Diagnose erfüllt sein sollten. Wie ich erwartet hatte, antwortete er mir, dass es auf die Person ankomme und auf das allgemeine Bild. Zudem müssten nicht alle Symptome auftreten, was man allerdings bei jeder Krankheit sagen kann. Auch wenn es in meinem Fall zu einer groben Einigung kam, kann schlussendlich nur ein Profi die richtige Diagnose stellen
Endlich der richtige Weg? Da stand ich nun. Ich hatte zwar endlich einen Job gefunden, doch trotzdem ließen mich die vergangenen Erfahrungen und aktuellen Ereignisse nicht los. Ich fiel in ein Loch, von dem ich wusste, dass ich es allein nicht aus diesem herausschaffen sollte. Nachdem ich ein paar Wochen in Selbstmitleid und Verzweiflung gebadet hatte, wurde ich es irgendwann leid. Nicht nur die Reaktionen meines Umfeldes auf mein Verhalten, sondern auch mein eigenes Verhalten gefiel mir überhaupt nicht. Daher beschloss ich mich wieder selbst an den Haaren auf die Füße zu ziehen, alles zu begraben und nicht mehr nach außen zu zeigen, wie es mir innerlich ging. Ich wechselte also wieder in den Schauspielmodus und schaffte es dann sogar, mich wieder an Kleinigkeiten zu erfreuen. Zeitgleich hatte ich beschlossen, einen letzten Versuch zu wagen und noch ein paar Therapeuten zu kontaktieren. Der Doc hatte mir eine Liste mit verschiedenen Psychotherapeuten und Psychologen geschickt, in der auch die Sprechzeiten aufgeführt wurden. Seinem Tipp entsprechend suchte ich mir ein paar heraus, die auch späte Sprechstunde hatten oder sogar flexible Zeiten anboten. Ich fing mit zwei E-Mails an, die inhaltlich komplett identisch waren (mit Ausnahme des Ansprechpartners natürlich). Als ich diese verfasst hatte, befand ich mich noch in meinem „Sumpf“, was dem Inhalt meines Textes sehr verzweifelt klingen ließ. Den Inhalt dieser Mail möchte ich dabei nicht verbergen, wobei auch die Anrede identisch blieb. Denn eine weibliche Therapeutin kam für mich nicht mehr infrage: Sehr geehrter Herr …, ich habe Ihre Adresse online gefunden und hoffe inständig, dass Sie mir helfen können. Ich versuche, mich sehr kurz zu fassen: Seit ein paar Wochen distanziere ich mich immer mehr und habe Gedanken, die mich befürchten lassen, dass ich depressiv werde. Ich weine sehr viel und denke auch oft an Suizid. Mir wurde vor ein paar Jahren eine komplexe PTBS diagnostiziert, doch nach zweieinhalb Jahren hat mich meine Therapeutin plötzlich aus der Therapie geworfen (ich war auch in drei Kliniken – ohne Erfolg) Ich wurde als Kleinkind massiv misshandelt und bin dann bei Pflegeeltern aufgewachsen. Doch auch hier gibt es große Schwierigkeiten. Zudem kann ich nichts ohne enorme Beschwerden essen, wofür die Ärzte keine Erklärung haben. Das Fehlen von Freunden, einer fürsorglichen Familie und die schlichte Fähigkeit, problemlos zu essen, lassen mich verzweifeln. Zudem hat der letzte Vertrauensbruch meiner Therapeutin dafür gesorgt, dass ich nun noch schlechter Kontakte knüpfe. Ich vertraue nur zwei Menschen zu 100 % (Hausarzt und Physiotherapeut). Ohne die beiden hätte ich meinem Leben sicher schon längst ein Ende bereitet. Lediglich mein Job als Arzthelferin lenkt mich genug ab. Doch genau das hindert mich auch daran, einen Therapeuten zu finden. Ich arbeite im Schichtdienst (10 h/Tag) und habe einen wechselnden Tag in der Woche frei. Ich habe also bis 17:30 bzw. 18:30 Uhr Dienst. Ich kann meine Arbeitszeit nicht verkürzen, da ich auf das Geld angewiesen bin (und auch auf die Beschäftigung) Nun also zu meiner Frage: Haben Sie noch einen Platz frei? Und, wenn ja, könnte ich bei Ihnen ein Vorgespräch vereinbaren? Bitte sagen Sie nicht, dass meine Arbeit einer Besserung erneut im Wege steht. Es kann nicht sein, dass ich keine Chance auf Besserung habe, nur weil ich Geld verdienen muss … das ist nicht fair. Ich kann nicht mehr. Ich bin nun 27, aber ich habe auch schon meinem Hausarzt gesagt, dass ich in meinem momentanen Zustand niemals 30 werden möchte. Sollte es Ihnen […] nicht möglich sein, mir zu helfen, bitte ich Sie trotzdem um einen Tipp. Vielleicht kennen Sie einen Kollegen, der auch einmal flexibel sein kann. Ich bin extrem kompliziert und leicht wird es nicht werden. Glauben Sie mir, ich habe so viele Menschen gesehen, die sich von mir abgewendet haben. Es ist kaum zu glauben, dass es doch noch welche gibt, die mich mögen und etwas mit mir zu tun haben möchten. Ich bin zwar intelligent und habe kreative Hobbys (Zeichnen, Schreiben), aber ich bin anders. Und anders sein schreckt viele ab. Vier Ihrer Kollegen haben mich bereits im Stich gelassen. Dass ich es erneut versuche, liegt nur daran, dass ich mir eigentlich nichts antun möchte. Aber jeder hat eine Grenze, an der es heißt: „Bis hierhin und nicht weiter …“ Vielen Dank, dass Sie meine Mail gelesen haben. Ich hoffe auf eine Antwort und verbleibe mit freundlichen Grüßen. gez. Beide antworteten fast zeitgleich auf meinen Hilfeschrei, wobei mir einer von beiden aus verständlichen Gründen absagte. Der Zweite bot mir jedoch einen Termin für ein Gespräch an, den ich nur wenige Wochen später wahrnahm. Inzwischen hatte ich mich wieder ordentlich im Griff, aber allen meinen Vertrauten und Bekannten von meinem neuen Termin erzählt. Entsprechend bereitete ich mich kaum auf das bevorstehende Gespräch vor, da ich erneut eine Enttäuschung erwartete. Zwar waren die Räumlichkeiten (der Wartebereich vor allem) nicht gerade vielversprechend, doch ich versuchte dies erneut als Training meiner selbst zu werten. Schließlich musste auch ich lernen, ein Buch nicht gleich nach seinem Einband zu beurteilen. Schließlich bat mich der Therapeut in sein Zimmer, das mit dem Vorzimmer absolut nichts zu tun hatte. Hier war es schon viel einladender und gemütlicher als auf der anderen Seite der Tür. Dort hatten verwelkte Blumen, verstaubte Teppiche und antike, deplatzierte Gegenstände eine sowohl unbehagliche als auch frostige Stimmung verbreitet. Doch dem farblosen Ambiente wich ein bunter Raum mit warmen Farben, gemütlichen Möbeln und moderner Ausstattung. Der Mann, der mich zu sich gebeten hatte, war sogar noch jünger, als er auf einem Onlinefoto aussah. Ich begrüßte diesen Umstand allerdings sehr, da er trotzdem einen sehr seriösen Eindruck machte. Der erste Gedanke, der mir durch den Kopf schoss, als wir uns beide gesetzt hatten, war sein Alter. Ich vermutete, dass er etwa im gleichen Alter wie der Doc sein musste, was mich zuversichtlich stimmte. Schließlich sind jüngere Menschen eher offen für Neues und Ungewöhnliches – wie mich eben. Er fackelte nicht lange und sprach sofort meine E-Mail an, aus der er viel Verzweiflung gelesen hatte, was auch meine Intention gewesen war. Er blieb bei wenigen Worten und gab mir sogleich die Chance, in knappen Worten zu berichten, was mich zu den geschriebenen Worten getrieben hatte und was ich gern bei ihm erreichen würde. Zwischendurch stellte er mir einige Fragen, die ich auch erwartet hatte. Ich verheimlichte ihm nichts und blieb von Anfang an bei der Wahrheit. Der einzige Punkt, der ihn ein wenig stutzig machte, war die Tatsache, dass ich mich noch nie selbst verletzt hatte und auch nie mit dem Gedanken gespielt hatte, dies zu tun. Ansonsten schien ich genau die Antworten gegeben zu haben, die er erwartet hatte und die zu seiner vermuteten Diagnose zu passen schienen. Während des ganzen Gesprächs ließ ich ihn nicht aus den Augen, beobachtete aber auch mein eigenes Verhalten. Schnell fiel mir auf, dass ich mich in seiner Gegenwart nicht unwohl fühlte und ich daher ein gutes Gefühl ihm gegenüber hatte. Ich konnte mir also rasch eine Zusammenarbeit vorstellen. Auch seine Körpersprache verdeutlichte mir, dass ich ihm nicht ganz unsympathisch zu sein schien. Schlussendlich saßen wir uns beide entspannt und aufgelockert gegenüber, was für ein erstes Treffen nicht schlecht war. Anfangs schien er etwas verwundert über meine vergangenen Therapieversuche, wofür sich jedoch schnell eine Lösung fand. Denn offenbar hatte ich nicht, wie angenommen, in den vergangenen zweieinhalb Jahren eine analytische bzw. tiefenpsychologische Therapie genossen. Offenbar hatte es sich dabei um eine reine Verhaltenstherapie gehandelt, was auch während der ganzen Klinikaufenthalte der Fall gewesen war. Dass mir allerdings mit solchen Vorgehensweisen nicht geholfen war, bestätigte er mir innerhalb einer halben Stunde. Jetzt war ich mir noch sicherer, dass er in der Lage sein könnte, mir zu helfen. Zusätzlich sandte ich einen telepathischen Fluch zu meiner ehemaligen Therapeutin, die mich über so viele Jahre an der Nase herumgeführt hatte. Nun wurde mir auch klar, warum sie schlussendlich kapitulieren musste. Schließlich offenbarte er mir seinen Plan, der zu einem Erfolg führen könnte: Nach ein paar weiteren Vorgesprächen müsste ich zweimal in der Woche zu festen Terminen zu ihm kommen; und das für mindestens zweieinhalb Jahre. Während dieser Zeit würden wir auf eine sehr tiefe psychische Ebene gelangen. So tief, dass irgendwann der Punkt kommen würde, an dem ich aufgeben wollen würde. Doch genau hier wäre es wichtig, die Zähne zusammenzubeißen und weiterzumachen. Innerlich nahm ich mir vor, dem Doc und meinem Physiotherapeuten zu versprechen, dass ich niemals aufgeben würde. Schließlich hielt ich meine Versprechen immer! Die Tatsache, dass er mich jedoch zu festen Terminen sehen wollte, stellte mich vor ein kleines Problem, dem ich schon vorher gegenübergestanden war. Denn aufgrund meiner Arbeitszeiten war dieses Vorhaben eigentlich unmöglich. Doch entgegen meiner eigenen Erwartungen beratschlagte ich mit dem Therapeuten, wie ich dies am besten regeln könnte. Ich berichtete ihm von meinem großherzigen Chef, der mich sicher unterstützen würde und den ich gleich am nächsten Tag fragen könnte. Wir vereinbarten also einen neuen Termin und ich verließ die Praxis zuversichtlich, auch wenn ich die Befürchtung, dass doch nicht alles klappen könnte, in meinem Hinterkopf spüren konnte. Am nächsten Tag erklärte ich meinem Chef knapp mein Vorhaben, auch wenn ich die Gründe dafür vor ihm verschwieg. Dass er mich für absolut normal hielt, überraschte mich kein bisschen. Doch die Tatsache, dass er die Wirkung von Psychotherapie generell abstritt, ließ mich dann doch verwundert die Augenbrauen heben. Trotzdem sicherte er mir Unterstützung zu und versprach, mit der Kollegin zu sprechen, die die Dienstpläne machte. Schon kurze Zeit später hatte ich bereits die Kollegin am Telefon und erklärte ihr, welche Uhrzeiten bei dem Therapeuten möglich seien und was wir dabei alles beachten mussten. Kurz vor dem nächsten Termin bei dem Therapeuten schrieb ich mit ihm hin und her, um ihm die gute Nachricht bereits mitteilen zu können. Denn ich musste in Erfahrung bringen, wann er Zeit für mich hatte. Denn meinem Chef war es wichtig, dass ich nicht gerade zu den Stoßzeiten weg war. Und zu meinem Glück bot mir der Therapeut Uhrzeiten außerhalb der Stoßzeiten an. Vor dem nächsten Gespräch war ich zwar nicht nervös, aber doch gespannt. Und so wartete ich geduldig, bis er mich in sein Sprechzimmer bat. Wie schon beim ersten Mal saßen wir uns erst einmal schweigend gegenüber. Ich wartete darauf, dass er das Gespräch mit einem einleitenden Satz ins Rollen brachte. Doch ein „Wie geht es Ihnen?“ blieb aus. Er wiederum wartete darauf, dass ich einfach anfing zu erzählen. Nach einer Weile des Herumdrucksens und gegenseitigen Angrinsens erklärte er mir schließlich noch einmal, dass er nicht da wäre, um mir zu sagen, wo es langginge. Es wäre meine Aufgabe, alles zu erzählen, was mir so durch den Kopf ging. Mit der Zeit würden wir dann irgendwann an den Punkt kommen, der für einen Durchbruch wesentlich wäre. Daher würde so eine Therapie auch mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Dass dies für mich allerdings ungewohnt war, blieb ihm nicht lange verborgen. Ich erzählte ihm daher, dass ich nur selten von mir aus etwas erzählen würde, sondern auf Nachfragen bzw. Einleitungen meines Gegenübers warten würde. Denn ich stand nun mal nicht gerne im Mittelpunkt. Ich machte mir innerlich eine Notiz, dass ich das eigenständige Erzählen (von sehr Persönlichem) gerade für diese Sitzungen lernen musste. Doch gleichzeitig befanden wir uns nun doch im Gespräch. Im Laufe des Gesprächs kamen wir thematisch auf meine familiäre Situation in meiner Kindheit. Ich erzählte ihm von meinem Stiefvater und anderen Personen, die damals anwesend waren. Während ich ihm grob von damals erzählte, fiel mir auf, dass ich meine Arme vor meinem Körper verschränkte. Zuvor waren sie locker auf den Sessellehnen gelegen. Mir war klar, dass ich mich offenbar unbewusst verschloss und dass dem Therapeuten dies sicher auch nicht entgangen war. Ich erwartete, dass er mich darauf ansprach, und erzählte weiter, ohne meine Haltung willentlich zu ändern. Tatsächlich sprach der Therapeut meine geänderte Körperhaltung nach meinen Ausführungen an. Ich erklärte ihm lachend, dass ich genau das erwartet hatte. Innerlich war ich beeindruckt, da ich genau das von einem Therapeuten erwartete: dass er nicht nur den verbalen, sondern auch den nonverbalen Signalen Aufmerksamkeit schenkte. Auf seine Nachfrage, was ich hinter meinen verschränkten Armen vermutete, suchte ich die Erklärung in meinem Unterbewusstsein. Meiner Meinung nach wäre meine Kindheit ein Thema, von dem mich mein Unterbewusstsein würde fernhalten wollen. Da ich davon erzählt hatte, näherte ich mich einer Grenze, die ich nicht überschreiten durfte. Meine Arme verdeutlichten damit: „Stopp! Bis hierhin und nicht weiter!“ Doch genau das freute mich, da ich das Gefühl hatte, in die richtige Richtung zu gehen. Natürlich kamen wir auch auf meine Verhaltensweisen zu sprechen, die ihren Ursprung wahrscheinlich in meiner Kindheit hatten. Doch dann überraschte mich der Therapeut mit einer Frage zu einer Aussage, die ich bei unserem ersten Zusammentreffen gemacht hatte. Er wollte wissen, warum ich ihm schon nach ein paar Minuten gesagt hatte, dass ich asexuell sei. Dieses Thema sei doch sehr persönlich und trotzdem schien es mir wichtig zu sein, ihm meine Orientierung näherzubringen. Als er mich nach dem Grund dafür fragte, wusste ich darauf erst einmal keine Antwort. Also sagte ich ihm, dass ich wahrscheinlich vermeiden wollte, dass er mit mir über das Thema Beziehungen und Liebe sprach. Ich wollte ihm wohl mit dem Offenlegen meiner Orientierung klarmachen, dass er bei mir nicht über Partner etc. sprechen musste. Dass wir trotzdem darüber sprechen würden, machte er mir grinsend klar und stellte mir sofort weitere Fragen. Erst später fiel mir die passende Antwort auf seine Frage ein: Ich hatte ihm sofort von meiner Orientierung erzählt, da ich wollte, dass er während des Vorgesprächs so viele Informationen wie möglich über mich sammeln konnte. Mir war wichtig, dass er jeden Aspekt meiner Persönlichkeit, der mit den Erlebnissen in meiner Kindheit zu tun haben könnte, wahrnahm und evtl. Schlüsse daraus ziehen konnte. Zudem wollte ich ausprobieren, wie leicht es mir fiel, mich gegenüber einem völlig Fremden zu „outen“ Ich nahm mir vor, dem Therapeuten das in der nächsten Sitzung zu sagen, und schlug zugleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Nicht nur konnte ich meine Aussage berichtigen – nein, ich hatte einen guten Start für die Sitzung gefunden und musste daher nicht wieder stumm grinsend vor ihm sitzen, bevor ein Gespräch endlich ins Rollen kam. Allerdings kam ich nicht dazu, meinen Plan in die Tat umzusetzen. Denn nur kurze Zeit später bekam ich eine E-Mail von dem Therapeuten mit der Bitte, den beigefügten Fragebogen auszufüllen, da er vergessen hatte, mir diesen mitzugeben. Ganz erfüllt von meiner berufsbedingten Liebe zu Fragebögen füllte ich diesen aus und sendete ihn umgehend zurück. Hinzu kam das erste Kapitel dieses Buches, damit er sich ein Bild von meiner Vergangenheit machen konnte und ich nicht Zeit damit verschwenden musste, alles zu erzählen. Und so hatte ich einen neuen Anfang für das nächste Gespräch gefunden. Als ich es mir also ein paar Wochen später meinem Therapeuten gegenüber gemütlich gemacht hatte, erkundigte ich mich grinsend, ob er alle Unterlagen durchgegangen war. Zu meiner Überraschung hatte er sich sogar den vielen Seiten über meine Kindheit gewidmet und diese auch ausgedruckt. Und so überflog er diese und auch den Fragebogen und stellte mich gleichzeitig Fragen dazu. Seine Feststellung, dass meine Erfahrungen mehr als grauenvoll waren, war allerdings nichts Neues für mich. Und so war meine Reaktion darauf trocken und emotionslos. Wir sprachen etwas über meine Eltern und dass ich offenbar nicht von ihnen gewünscht gewesen war. Untermauert wurde dies natürlich durch die Tatsache, dass sie mich beide zur Adoption freigegeben hatten, was ich bereits mehrfach erwähnt hatte. Er befragte mich zu meiner Einstellung hierzu, was ich ihm auch ehrlich beantwortete: „Mir ist ‚Eltern haben‘ unbekannt und doch vermisse ich es. Ich bin zwar bei Pflegeeltern aufgewachsen, aber für eine richtige Mutter-Tochter- bzw. Vater-Tochter Beziehung war ich einfach schon zu alt damals. Und so ist es noch offensichtlicher, dass ich heute kaum so etwas wie eine Beziehung zu Elternfiguren oder sogar meinen richtigen Eltern aufbauen kann. Doch es gibt Momente, in denen ich andere Töchter beneide – vor allem, wenn ich sie mit ihren Eltern sehe. Diese Vertrautheit, Liebe und Geborgenheit sind mir selbst fremd und doch wünsche ich mir das ebenfalls. Denn ich möchte es kennenlernen und diese Momente auch für mich haben.“ Während ich ihm das erzählte, wurde mir innerlich klar, dass wir wohl nicht zum letzten Mal darüber gesprochen hatten. Doch dieses Mal lenkte ich das Thema selbst auf meine Mutter, was ich eigentlich nicht beabsichtigt hatte. Mir war klar, dass die Ansichten in dem ersten Kapitel nicht mehr meinen aktuellen entsprachen, was ich ihm auch verdeutlichte. Auf seine Nachfrage hin beschrieb ich den Hass auf meine Mutter, der sich wohl in meinen Worten widerspiegeln würde. Mir selbst war das damals nicht klar gewesen, doch mir war wichtig, ihn wissen zu lassen, dass sich dieser inzwischen in pure Gleichgültigkeit gewandelt hatte. Mir war allerdings wichtig, dass das Kapitel unverändert bliebe, damit meine Veränderungen besser sichtbar bleiben würden. Und so erzählte ich ihm von dem kurzen Kontakt, den ich mit meiner Mutter gehabt hatte, und auch dem Abbruch, der allerdings beiderseits bedingt war. Schließlich wollte ich eine Mutter und keine Freundin, was meinem Therapeuten sehr schnell klar wurde. Während wir so darüber sprachen, überflog er weiterhin meine Unterlagen und runzelte immer wieder die Stirn. Ich beobachtete ihn dabei und fragte mich ständig, warum er den Anschein erweckte, dass er mit sich hadern würde. Irgendetwas beschäftigte ihn und genau das machte mich etwas nervös. Denn ich hoffte inständig, dass er sich endlich dafür entscheiden würde, mich als Patientin anzunehmen und so den Start eines langen Weges zu meinen ersehnten Antworten einläuten würde. Doch zuerst jagte er mir einen ordentlichen Schreck ein, indem er mich fragte, warum ich ausgerechnet zu ihm wolle. Weiterhin durch die Unterlagen blätternd, verdeutlichte er mir, dass „man“ mir eine weibliche Therapeutin wünschen würde. In diesem Moment schlug mir das Herz für ein paar Sekunden bis zum Hals, während ich versuchte, ein selbstsicheres „Aber?“ herauszubringen. Bevor er mir diese Frage beantwortete, begründete er seine Feststellung damit, dass ich eine mütterliche Beziehung brauchen würde. Eine Person (hier natürlich weiblich), der ich Vertrauen schenken und die, mit der Zeit, eine mütterliche Bindung zu mir aufbauen und mir damit helfen konnte. Gleich darauf kommentierte er seine Bemerkung, deren Bedeutung meinen momentanen Gedanken entsprach: Dies sei jedoch leider nicht mehr möglich, da meine schlechten Erfahrungen mit der vorherigen Therapeutin es unmöglich gemacht hatten, dass ich jemals ein inniges Vertrauen zu einer weiblichen Person fassen konnte. Nun fiel mir ein enormer Stein vom Herzen und ich atmete erleichtert auf. Gleich darauf hörte ich von ihm erneut die Frage, warum ich zu ihm wolle. Er hatte den Eindruck, dass ich ihn um jeden Preis von mir überzeugen wolle. Diese Antwort hatte ich glücklicherweise sofort parat. Ich sagte ihm, dass ich auf meinen Instinkt gehört hatte. Dieser hatte mir verdeutlicht, dass ich ihm vertrauen konnte und ich nichts zu befürchten hatte. Das Vertrauen musste natürlich erst einmal aufgebaut werden, doch die Tatsache, dass ich von der ersten Sekunde an ehrlich und offen ihm gegenüber gewesen war, war für mich ein deutliches Zeichen. Zudem hatte mich die enorme Enttäuschung, dass ein Kollege von ihm mich Wochen davor doch nicht aufnehmen wollte, mehr getroffen, als ich erwartet hatte. Dies und meine sofortige Bereitschaft, alles auf der Arbeit umzustellen, sprachen für und nicht gegen ihn. Diese Worte hatten ihn offenbar überzeugt, denn er legte meine Unterlagen zur Seite und erklärte mir, was alles auf mich zukommen würde. Wie er schon mehrmals betont hatte, sahen wir uns dann öfter in der Woche. Doch zuerst müsse er die Therapie beantragen, wofür er meine Mithilfe brauchen würde. Und so gab er mir neue Unterlagen und ein paar „Hausaufgaben“, damit der Antrag und somit der Therapieanfang nahtlos vonstattengehen konnten. Ich willigte erleichtert in alles ein und versprach vollste Mitarbeit, da ich nicht fassen konnte, dass es nun bald endlich richtig losgehen würde (was für mich erneut ein Zeichen dafür war, dass ich es absolut ernst meinte) In den letzten verbleibenden Minuten wusste ich nicht, was ich sagen sollte. Schließlich war es nicht mehr nötig, ein Gespräch in Gang zu bringen, und Smalltalk war eher unpassend. Also gab ich erneut meiner Erleichterung Ausdruck, was dem Therapeuten ein Grinsen entlockte. Er warnte mich erneut davor, das Zukünftige nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ich konnte mir zwar wirklich nicht genau vorstellen, was auf mich zukam, doch ich war auf alles gefasst, was ich ihm auch sagte. Schließlich nutzte er die restliche Zeit, um mir noch einen Vorschlag zu machen. Es war mehr ein kleiner Blick in die Zukunft, doch ich sah diesen eher vage: Schon beim ersten Treffen mit meinem Therapeuten hatte ich mir sein Behandlungszimmer genau angesehen. Neben den Sesseln, seinem Schreibtisch und dem Schrank mit Unterlagen befand sich auch eine bunte Couch in dem Raum, an deren Kopf ein weiterer Stuhl war. Ich hatte bereits auf seiner Homepage gelesen, dass die Patienten wählen konnten, ob sie ihm gegenübersitzen wollten oder die Couch bevorzugten. Dass dies ein Klischee allererster Güte war, war auch ihm durchaus bewusst. Daher verwunderte ihn auch nicht meine belustigte Reaktion auf seine Bemerkung, dass ich nach dem Aufbau einer gewissen Vertrauensbasis auch auf der Couch liegen könne. Ihm wäre es sogar lieber, da ich meine Aufmerksamkeit dann nicht mehr auf ihn, sondern nur noch auf mich selbst richten könnte. Doch erst wenn ich genug Vertrauen zu ihm aufgebaut hätte, würde er mir diesen Schritt zutrauen. Dass ich nur langsam Vertrauen fassen konnte und meine Umgebung immer im Blick hatte (vor allem in einem neuen Umfeld), war ihm nicht entgangen. Tatsächlich kannte ich dieses Verhalten von mir nur zu gut und gab ihm daher auch gleich ein Beispiel: Als ich mit der Physiotherapie angefangen hatte, vertraute ich meinem Physiotherapeuten logischerweise noch nicht genug. Er war mir zwar sofort sympathisch und ich hatte auch sofort gespürt, was für ein guter Mensch er war, doch trotzdem ließ ich anfangs Vorsicht walten. Sehr gut war dies daran zu beobachten, dass er mir anfangs immer sagen musste, dass ich mich entspannen und locker lassen sollte. Sobald er aus meinem Blickfeld verschwand, suchte ich mit rasend schnellen Bewegungen nach ihm, was er mit beruhigenden Worten kommentieren musste. Inzwischen gehört er, wie mehrfach erwähnt, zu meinen engsten Vertrauten. Das erzählte ich auch meinem Therapeuten, der seine Vermutung dadurch bestätigt sah. Doch da ich bereits solche Erfahrungen gemacht hatte, sagte ich ihm, dass ich mir sicher sei, dass das Vertrauen zwischen uns rasch wachsen würde und ich nach der vorhergesagten Zeitspanne von ihm sicher kein Problem damit haben würde, mich auf die Couch zu legen. Doch wir hatten noch viel Zeit und Arbeit vor uns, bevor ich mich mit diesem Thema weiter beschäftigen müsste. Beim nächsten Termin gab ich ihm zuerst all meine Hausaufgaben ab. Danach fragte ich ihn, ob er sich die von mir zugesandten Berichte der vergangenen Klinikaufenthalte durchgelesen hatte. Als er dies bejahte, fragte ich ihn nach seinem Urteil, was er wiederum mit einer Gegenfrage beantwortete. Wie schon viele Male davor wollte er wissen, was ich nun von ihm erwartete. Ich hätte diese Frage eigentlich bereits vorhersehen müssen, antwortete jedoch darauf. Ich überraschte ihn mit der Tatsache, dass die Inhalte der Berichte mehr der Fantasie als der Wahrheit entsprungen seien. Wir sprachen etwas darüber, doch ich hatte den Eindruck, dass er dies erst einmal so stehen lassen wollte. Dies kam mir jedoch recht, da ich ihm unbedingt eine Frage stellen wollte, die mich seit der letzten Stunde beschäftigt hatte. Denn mir war nicht ganz klar, warum er sich für mich eine weibliche Therapeutin und somit mögliche Mutterfigur wünschte, wenn ich doch ohne Vater aufgewachsen war und es daher noch ein „Loch“ zu stopfen galt. Er gab mir recht, doch ich führte weitere Vermutungen aus und ließ ihn somit kaum zu Wort kommen. Denn ich vermutete hinter seinem Wunsch, dass ich natürlich väterlicherseits keine Enttäuschung und Ablehnung erleben musste, was ich hingegen von weiblicher Seite oft genug erlebt hatte. Denn schließlich war es mit meiner ehemaligen Therapeutin nicht anders gelaufen. Denn ich fragte meinen Therapeuten auch nach seiner Meinung über ihren Bericht. Erneut wollte er zuerst meine Einschätzung. Ich sagte ihm klar, dass ich der Meinung war, dass sie aufgegeben hatte. Und schon hatte er wieder eine Verbindung geknüpft, deren Wurzeln sich, wie bei meiner Mutter, in Enttäuschung, Missachtung und fehlender Anerkennung fanden. Nichtsdestotrotz sprachen wir auch über die männlichen Bezugspersonen in meinem Leben. Erneut erzählte ich ihm von dem Doc, meinem Physiotherapeuten und einer neu hinzugetretenen Person: meinem Chef. Als ich meinem Therapeuten erzählte, dass ich mich sehr gut mit meinem Chef verstand, wurde seine Miene nachdenklich und er stellte fest: „Sie haben eine ordentliche Männerschar um sich gebildet.“ Dass er auch sich hinzuzählte, erkannte ich an seinem Grinsen, das ich nur erwidern konnte. Denn er hatte ja recht. Denn alle waren intelligent, gutmütig und auf ihre Art Vaterfiguren für mich. Ich konnte zu diesem Zeitpunkt nicht abstreiten, dass auch mein neuer Therapeut eines Tages diesen Stand haben könnte. Wie sollte ich auch ahnen, dass es ganz anders kommen würde? Irgendwann landeten wir mit dem Gesprächsthema bei meinen Schwestern, zu denen ich kaum noch Kontakt hatte. Ich erzählte ihm, dass mein Stand in der Familie kaum von dem einer Tochter bzw. Schwester charakterisiert war. Ich fühlte mich selbst „untergebracht“, weniger zugehörig. Lediglich meine Pflegemutter vermittelte mir das Gefühl, dass ich weiterhin zur Familie gehörte. Als ich ihm davon erzählte und er immer wieder feststellte, dass ich Anerkennung wollte, mich dafür aber nicht verstellen wollte, wurde ich etwas unruhiger. Ich wurde sauer, da mir all die Szenarien durch den Kopf schossen, in denen ich zu spüren bekommen hatte, dass ich ein Außenseiter war und eigentlich nirgends dazugehörte. Hin und wieder beantwortete ich seine Fragen auf meine momentanen Gefühle – entweder mit einem Lachen oder aber mit einem Schulterzucken. Dass ihm beides nicht besonders gefiel, machte er mir wenige Minuten später in ernstem Tonfall deutlich. Ruhig, aber bestimmt beschrieb er mir seine Beobachtung, dass ich zwar lachen würde, trotzdem aber viel ernster sei als am Anfang. Und dass ich ihm keine aktuellen Gefühle beschreiben könne, bezweifle er, da ich glasige Augen hätte. Ich konnte das nicht ganz glauben, da ich ihm wahrheitsgemäß beschrieben hatte, dass ich nichts fühlen würde. Ich war vielleicht etwas sauer, aber mehr konnte ich wirklich nicht empfinden. Zwar versuchte ich ihm das klarzumachen, doch ich sah ihm an, dass er mir das nicht glauben wollte. Doch unsere Zeit war sowieso um und so zog er einen Schlussstrich und verabschiedete sich von mir. Trotzdem gingen mir die letzten Minuten der Sitzung nicht aus dem Kopf. Denn ich wollte nicht den Eindruck vermitteln, dass mir meine Gefühle peinlich waren und ich sie ihm daher verschweigen würde. Doch gleichzeitig wollte ich nicht einsehen, dass er davon ausging, ich hätte ihn belogen. Ich hatte nun oft genug zu ihm gesagt, dass ich stets die Wahrheit ihm gegenüber sagen würde und dies auch weiterhin vorhatte, da ich schließlich für das Fortschreiten und den Erfolg der Therapie war. Während die Tage vor dem offiziellen Start der Therapie verstrichen, beobachtete ich mich selbst und machte mir Gedanken über die zukünftigen Sitzungen. Aus irgendeinem Grund hatte ich das Gefühl, dass ich vorsichtiger und sensibler geworden war. Sensibel in der Hinsicht, dass sich meine Schutzmechanismen offenbar verstärkt hatten. Bei der Arbeit vermied ich den Kontakt zu Kolleginnen, die mir auf die Nerven gingen. Gleichzeitig reagierten diese auf meine Ablehnung und ließen mich daher ebenfalls in Ruhe. Auch wurde ich müder und energieloser. Meine Beschwerden wurden etwas schlimmer, doch ich schob beides auf beginnende Mangelerscheinungen. Wahrscheinlich beruhte auch mein Rückzug darauf, da ich meine Energie für Wichtigeres aufsparen wollte und nicht für die sinnlose Auseinandersetzung mit den Problemen von Menschen, die mir völlig egal waren. Je näher der erste Termin nach dem Urlaub meines Therapeuten rückte, desto größer wurde meine Befürchtung, dass ich die Termine vielleicht verpassen könnte. Schließlich fanden diese mitten an meinem Arbeitstag statt. Die Zeit verstrich kurz vor der Mittagspause plötzlich rasend schnell, sodass ich vielleicht zu spät oder gar nicht mehr zur Sitzung kommen könnte. Gleichzeitig beruhigte ich mich aber mit dem Gedanken, dass ich nach ein paar Wochen die Uhrzeit, in der ich mich umziehen musste, sicherlich verinnerlicht hatte und mir daher keine Gedanken machen musste. Es ist wie bei jeder Neuheit bzw. Veränderung: Anfangs fällt es mir schwer, mich daran zu gewöhnen, und ich verschwende oft zu viele Gedanken daran. Doch ehe ich mich versehe, habe ich mich bereits daran gewöhnt und kann mich kaum daran erinnern, wie es davor gewesen ist. Denn ich würde nicht nur zweimal in der Woche die Praxis für eine Stunde verlassen. Eine zweite Veränderung bestand darin, dass ich einmal in der Woche morgens in der Partnerpraxis arbeiten würde, die knapp besetzt war. Somit verkürzte sich meine Zeit in der „Stammpraxis“ enorm. Viel machte mir dies allerdings nicht aus. Ich war zwar nie gestresst, doch manchmal gingen mir meine Kolleginnen doch so enorm auf die Nerven, dass ich mich noch mehr auf die Veränderungen freute. Lediglich um meine Patienten tat es mir irgendwie leid. Denn diese mochten mich offenbar, da sie immer wieder nach mir fragten und sich sehr freuten, wenn ich wieder auftauchte. Zwar konnte ich mir nicht ganz erklären, warum ich so beliebt bei ihnen war, doch ich war froh darüber, dass ich trotzdem ich selbst bleiben konnte. Schon bald war der Tag der erwarteten Therapiesitzung da. Da ich sehr gespannt auf diese war, vergaß ich während der Arbeit nicht eine Sekunde, dass ich mich zeitig umziehen gehen musste. Schließlich saßen wir uns endlich wieder gegenüber und ich fing an, meinem Therapeuten zu erzählen, was ich die letzten Wochen an mir beobachtet hatte: Ob es wirklich mit der letzten Sitzung zu tun hatte, war mir nicht ganz klar, aber ich hatte doch bemerkt, dass ich mich etwas zurückgezogen hatte. Mein Rückzug bezog sich vor allem auf die Interaktion mit meinen Kolleginnen – genauer mit den Kolleginnen, die mir schon von Anfang an extrem auf die Nerven gegangen waren. Ich hatte aufgehört, mit ihnen zu sprechen, und beschränkte mich somit nur auf die nötigste Kommunikation. Da jeder wusste, dass ich meine Ruhe möchte, wenn ich nichts sage, wurde mir diese entsprechend gewährt. Somit konnte ich mich ganz meiner Arbeit mit den Patienten und Ärzten widmen und musste weniger nervlichen Stress aushalten. Mein Therapeut fand das interessant, auch wenn wir beide keinen wirklichen Auslöser dafür finden konnten. Ich erzählte ihm daher etwas über meinen Arbeitsalltag und was mich daran störte. Nach kurzer Zeit wusste ich nicht mehr, was ich sagen sollte. Bevor ich also minutenlang stumm dasitzen würde, fing ich an, meinem Therapeuten zu erzählen, was ich in der letzten Nacht geträumt hatte. Erstaunlicherweise zeigte er großes Interesse an dem Schwachsinn, der sich mir jede Nacht präsentierte. Ganz nach den Theorien von Freud deutete er alle möglichen Dinge in die Träume hinein, auf die ich wahrscheinlich nicht gekommen wäre. Ganz konnte ich mich mit dem Gedanken der Traumdeutung zwar nicht anfreunden, doch mir war durchaus bewusst, dass manche Ängste sich vor allem in Träumen auszudrücken vermochten. Wie etwa der stetig wiederkehrende Albtraum, dass mir die Zähne ausfielen, den ich nur durch das Aufschreiben endlich loswurde. Schließlich fanden wir uns über viele Ecken und Wendungen beim Thema meine Persönlichkeit wieder. Erneut erzählte ich von meinem Arbeitsalltag, an dem mich besonders das Gejammer mancher meiner Kolleginnen unglaublich störte. Ich erklärte, dass ich keinerlei Mitleid empfinden würde. Ich wäre lediglich zu Mitgefühl imstande, aber auch nur, wenn ich es zuließe. Als ich ihm sagte, dass ich nur mit Tieren Mitleid hätte, erwischte er mich eiskalt mit einem einfachen Beispiel: Ich sollte mir ein kleines Kaninchen vorstellen, das sich an einem Zaun an der Pfote verletzt hatte. Daraufhin sollte ich ihm sagen, was ich bei dessen Anblick empfinden würde. Dass ich ihm nur zögernd sagen konnte, dass ich wahrscheinlich traurig werden würde, warf mich ordentlich aus der Bahn. In meinem Kopf kreisten verschiedene Gedanken und Interpretationen der beschriebenen Szene, doch ich fand einfach nicht die richtige Antwort auf seine einfache Frage. Nun hatte ich das Interesse meines Therapeuten auf meine momentane Befindlichkeit gelenkt, die weder konzentriert noch ruhig war. Erst nach ein paar Minuten hatte ich mich wieder gefangen und musste zugeben, dass er mich hier kalt erwischt und mich durcheinandergebracht hatte. Denn nun sei ich mir unsicher, ob ich überhaupt Mitleid empfinden könne, sowie darüber, was kontrolliert und was automatisch ablaufen würde. Nur wenige Tage später hatte ich die Gelegenheit, das obige Rätsel zu lösen. Während ich zeichnete, sah ich mir eine Dokumentation über Tiere an. Schon bald kam eine Szene, in der Tiere brutal getötet wurden – sei es durch Menschenhand oder die Naturgewalten. Ich sah mir alles an und beobachtete mich dabei ganz genau. Meine Beobachtungen konnte ich dann bei der nächsten Sitzung vorlegen: Ich hatte nur Mitleid mit Tieren, wenn ich es zuließ. Also war ich überhaupt nicht imstande, Mitleid zu empfinden, wenn ich es nicht bewusst steuern würde. Während wir darüber sprachen, überlegte ich mir, woher das wohl kam. Sicher hatte mein Verhalten seinen Ursprung in meiner Vergangenheit. Schließlich wollte ich auch kein Mitleid von anderen, was meiner Meinung nach nur fair war. Diese Feststellung brachte mich zu einem Kommentar meines Chefs, der mich fast dazu gebracht hätte, die Fassung zu verlieren. In meinem Beisein unterhielt er sich mit einem Arzt über eine Kollegin von mir. Er schrieb die momentane Ruhe mir zu, während es bei der Kollegin im Vergleich eher hektisch und laut zuging. Mein Chef versuchte sie zu verteidigen, indem er ihm sagte, dass dies mit der Anamnese, d. h. mit der Vorgeschichte, zusammenhinge. Denn sie hatte Jahre zuvor eine Scheidung durchgemacht und ließ dieses Erlebnis noch lange Zeit später jeden wissen und unangenehm spüren. Als ich diesen Kommentar meines Chefs gehört hatte, biss ich mir auf die Zunge, während ich ihn gedanklich in bissigem Ton darauf hinwies, dass die Vergangenheit niemals rechtfertigen würde, wie jemand seine Mitmenschen behandeln dürfe. Während ich meinem Therapeuten von dieser Szene erzählte, wuchs die Wut in mir, was ihm nicht verborgen blieb. Mit seinem Kommentar: „Das scheint Sie ziemlich wütend zu machen!“ hatte er genau ins Schwarze getroffen. Tatsächlich ist das Entschuldigen von Taten mit der eigenen Vergangenheit ein rotes Tuch für mich. In meinen Augen suchen Menschen, die dies tun, lediglich Aufmerksamkeit und versuchen, diese so zu erhalten. Denn sie lassen es sich nicht nehmen, bei jeder Gelegenheit ungefragt das Gesprächsthema auf sich zu lenken und sich somit in den Mittelpunkt der Szenerie zu stellen. Auch das ist mir selbst unangenehm. Werde ich gefragt, antworte ich gern, doch ich würde niemals von selbst anfangen, von mir zu erzählen, wenn das Thema gerade ein ganz anderes ist (und ich somit nicht mitreden kann oder möchte) Nach meinen Ausführungen stellte mein Therapeut richtig fest, dass ich wohl keinerlei Bedürfnis nach Aufmerksamkeit hatte. Ich bejahte diese Vermutung sofort und fügte noch hinzu, dass ich nur über Banales sprechen und ich mich mit persönlichen Informationen eher zurückhalten würde. Denn ich befürchtete, dass ich aufgrund des Mitleids dauernd bevorzugt und anders behandelt werden könnte, als ich es eigentlich mochte. Auch ich würde Fehler machen und auch zu ihnen stehen. Es wäre daher unfair, nur aufgrund meiner Vergangenheit Nachsichtigkeit zu erfahren. Schließlich sei ich trotzdem erwachsen und daher verantwortlich für meine Taten. Ich erklärte meinem Therapeuten weiter, dass es mir zudem sehr unangenehm sei, wenn mir jemand einen Gefallen tue, obwohl ich doch gar nichts dafür getan hätte. Als Beispiel gab ich das scheinbar selbstlose Einsetzen meines Chefs an, der seine Kontakte für mich spielen ließ, um mir einen früheren Arzttermin zu organisieren. Ich war unglaublich dankbar dafür, doch trotzdem war mir das unangenehm. Daher kam es mir gerade recht, dass ich nur kurze Zeit später die Möglichkeit bekam, mich für seine Tat zu revanchieren, indem ich seine Familie porträtieren durfte – natürlich umsonst. Doch auch sonst hinterfrage ich Gefallen immer. Meiner Meinung nach verdiene ich sie nicht einfach so. Warum sollte mir jemand etwas Gutes tun, obwohl ich gar nichts dafür getan habe? Ich fühle mich dann schuldig und versuche diesen Gefallen auf jegliche Art zurückzugeben, sei es durch gutes Benehmen, Mithilfe oder irgendeinen Gefallen, der dies erwidert. Auf die Nachfrage meines Therapeuten, warum ich so denken würde, sagte ich ihm, dass ich mich selbst für keinen guten Menschen halten würde. Daher hätte ich solche Gefälligkeiten auch nicht verdient. Er bat mich, meine Ansicht zu erläutern: Ich halte nicht damit hinter dem Berg, dass ich nicht besonders sozial bin. Das heißt, ich mag Menschen nicht. Manch einer könnte jetzt vielleicht das Argument aufführen, dass ich dann aber den falschen Beruf gewählt habe. Nun ja, als Arzthelferin habe ich zwar mit Menschen zu tun, doch es gelingt mir erstaunlicherweise ganz gut, sympathisch und hilfsbereit zu agieren. Die Tatsache, dass ich sogar mit den „bösen“ Patienten hervorragend auskomme, beweist das Funktionieren meiner Methode. Denn ich verstelle mich nicht und lasse meinem Humor und dem Sarkasmus freien Lauf. Ich glaube, dass mir durch mein jung erscheinendes Äußeres und mein Lachen vieles nicht übel genommen wird. Fragten mich meine Kolleginnen jedoch, wie ich es schaffen würde, selbst die gemeinsten Patienten zum Lächeln zu bringen, sagte ich nur: „Sie spüren, dass ich ebenfalls böse bin.“ Was meine Kolleginnen zum Schmunzeln brachte, meinte ich absolut ernst. Schließlich halte ich mich, wie schon mehrfach erwähnt, für keinen guten Menschen. Diese „dunkle“ Seite zeigt sich vor allem nach der Arbeit. Sobald ich die Praxis verlasse, kann ich endlich wieder zum menschenfeindlichen Benehmen übergehen. Bin ich gut gelaunt und noch voll Energie, kann ich meine „Praxisfassade“ aufrechterhalten. Doch meistens möchte ich dann einfach nur nach Hause, was dazu führt, dass ich von allem genervt bin. Dazu gehören natürlich auch Menschen, die mich schon mit ihrer puren Anwesenheit gewaltig zur Weißglut treiben können. Während ich von meiner dunklen Seite erzählte, wurde mein Therapeut immer nachdenklicher. Schließlich schlug er mir völlig unerwartet vor, dass ich mir doch Gedanken über die Couch machen sollte. Er hätte mir zwar gesagt, dass diese womöglich erst in einem Jahr auf mich zukommen würde, doch er könnte sich vorstellen, dass es mir schon in wenigen Wochen etwas bringen könnte. Ich verglich die vorgeschlagene Situation mit der bei der Physiotherapie und sagte ihm, dass ich es eigentlich gewöhnt sei, mit jemandem zu sprechen, der sich an meinem Kopfende befinden würde und den ich nicht sehen konnte. Ich müsste zwar noch überlegen, ob ich ihm schon so weit vertrauen könnte, doch grundsätzlich hätte ich nichts gegen einen Positionswechsel. Mit diesen Gedanken beendeten wir die Sitzung. Schon nach ein paar Tagen war ich mir sicher, dass ich nichts gegen Sitzungen im Liegen einzuwenden hatte. Daher plante ich, dies als Nächstes vorzubringen, und wartete auf den nächsten Sitzungstag. Doch ein Traum warf mir meine Pläne etwas durcheinander und wurde Priorität. Und so saß ich meinem Therapeuten gegenüber und erzählte ihm, was mich beschäftigt hatte: In dem Traum stand meine kleine Schwester neben meiner Pflegemutter und händigte ihr eine Krankmeldung aus. Diese war für meine Pflegemutter Grund genug, sie wieder bei sich aufzunehmen. Ich sah mir das empört an und stellte sie sogleich vor die Wahl. Entweder würde sie meine Schwester in die Wüste schicken oder ich würde nie wieder zu ihnen kommen. Plötzlich tauchte die jüngste Tochter meiner Pflegemutter auf und baute sich vor den beiden auf. In bestimmtem Ton machte sie mir klar, dass ich das dann tun solle, und wenn ich meinte, dass ich nie wieder zu ihnen kommen würde, dann sei das so. Geschockt von dieser Reaktion – plus aufgrund fehlenden Einspruchs meiner Pflegemutter – brach ich in Tränen aus und wartete fassungslos auf irgendwelche Reaktionen. Doch schlussendlich wachte ich auf und musste feststellen, dass ich wohl nie von solchen Träumen verschont bleiben würde. Mein Therapeut hörte interessiert zu und fragte nach der Beziehung zwischen mir und meiner kleinen Schwester: Meine kleine Schwester hatte ihre „Karriere“ inzwischen so weit vorangebracht, dass sie auf der Straße lebend schwanger geworden war. Sie bekam erneut Unterstützung, eine Wohnung und viel Hilfe, auch seitens meiner Pflegemutter. Nur ich glaubte diesem Schauspiel nicht. Tatsächlich kam meine kleine Nichte auf die Welt und musste ein paar Wochen mit zwei großen Hunden und einem Kind als Mutter in einem winzigen, dreckigen Zimmer leben. Endlich konnte sich die Hebamme, die regelmäßig vorbeikam, das Ganze nicht mehr mit ansehen und alarmierte die Behörden. Die Kleine wurde sofort zu Pflegeeltern gebracht und meine kleine Schwester ließ ihre Wut an allen aus, stellte sich selbst jedoch, wie immer, als unschuldig dar. Nach langem Hin und Her, mit Planungen einer Familientherapie, landeten sie schließlich an folgendem Punkt: Der Vater wurde verhaftet und kam ins Gefängnis. Meine Schwester ging mit ihren Hunden zurück auf die Straße und scherte sich kein bisschen um ihre Tochter. Meine Pflegemutter hingegen verging fast vor Mitleid und versucht bis heute, sie dazu zu bringen, um ihre Tochter zu kämpfen. Dass dies jedoch ein vergebenes Unterfangen ist, wird sie wohl nie begreifen. Und doch erntet meine kleine Schwester stets Mitleid und kann sich stets auf die Hilfe meiner Pflegemutter verlassen. Dauernd gibt sie ihr Geld, übergab ihr auch alte Sachen und musste dann mit ansehen, wie beides zerstört, verschenkt oder aus dem Fenster geworfen wurde. Und trotzdem trieb das Mitleid meine Pflegemutter immer weiter zur Mithilfe, auch wenn sie gewisse Schritte glücklicherweise irgendwann verweigerte. So hatte sie sofort abgelehnt, als meine Schwester angefragt hatte, ob sie mit ihrer Tochter bei ihr einziehen könne. In diesem Fall bin ich froh darüber, dass die drei Töchter meiner Pflegemutter ein Auge auf sie haben und sie vor solchen Dummheiten bewahren. Trotzdem hatte mich der vergangene Traum beschäftigt. Aus meinen Erzählungen las mein Therapeut, dass mir wohl viel an meiner Pflegemutter liegen würde. Denn ich schien sie – neben meiner Aufregung darüber – vor dieser Last beschützen zu wollen. Mit seiner Beobachtung lag er völlig richtig. Ich sah in meiner Pflegemutter zwar keine Mutter, aber sie lag mir trotzdem irgendwie am Herzen. Ich hatte sie als meine Erzieherin kennengelernt und das ist sie bis heute für mich. Sie hat mir beigebracht, mit Geld umzugehen, mich selbst zu versorgen, und gab mir Tipps und Tricks für das alltägliche Leben. Daher könnte ich es auch nicht über mich bringen, sie zu verletzen. Als Beispiel nannte ich hier meine Orientierung. Dass ich in meinem Alter noch keinen Partner gefunden habe, machte ihr schwer zu schaffen. Zwar versuchte sie, dies etwas zu verbergen, doch ich sah es ihr jedes Mal an, wenn ein derartiges Thema aufkam. Doch ich brachte es einfach nicht übers Herz, ihr zu sagen, dass ich niemals einen Partner haben würde, da ich es schlichtweg nicht möchte. Doch wie sollte ich ihr meine Asexualität und Aromantik erklären? Verstehen würde sie es wahrscheinlich nicht und daher ließ ich es einfach sein. Zudem wollte ich ihr nicht verdeutlichen, dass ich zu einem einsamen Leben verdammt war, da ich auch nie viele Freunde haben würde – wenn überhaupt. Zurückkommend auf meinen Traum, führte ich weiter aus, dass ich die Aussicht auf komplette Einsamkeit beängstigend fand. Zudem beschäftigte mich auch die Befürchtung, dass meine Familie mich leichtfertig loslassen und mich so zur totalen Einsamkeit verdammen könnte. Ich schloss aus dem Traum, dass ich meiner Pflegemutter und ihren Kindern wohl völlig egal war, ich aber eigentlich nicht ohne sie sein wollte. Wenn ich nicht sie hatte, wen dann? Mein Therapeut schloss aus meinen Ausführungen, dass ich zwar Angst vor Einsamkeit hatte, aber trotzdem Nähe und eine Partnerschaft strikt ablehnen würde. Dies war zwar ein Widerspruch in sich, doch das ging nun mal in mir vor. Schließlich fühlte ich mich in der Familie nicht wirklich angenommen. Daher erzählte ich ihm von dem mangelnden Vertrauen mir gegenüber. Gerade meine Pflegeeltern und ihre Töchter zeigten nie Respekt mir und meinen Taten gegenüber. Anerkennung und Stolz sind mir vollkommen fremd. Ich gab als Beispiel meine schon thematisierte Intelligenz an. Auf die Nachfrage, ob die Mitglieder meiner Pflegefamilie mir eine hohe Intelligenz, ja sogar Hochbegabung zutrauen würden, erntete ich nur Belustigung und hämisches Gelächter. Während ich weitere Beispiele vorbrachte, sah ich in dem Gesicht meines Therapeuten immer mehr Verwunderung, Erstaunen und Nachdenklichkeit. Als ich weiter ausführte, dass ich nie gut genug für meine Pflegefamilie war und daher aus allem ausgeschlossen wurde, stellte er mir eine weitere Frage, die ich nur schwer beantworten konnte. Mein Therapeut wollte von mir wissen, ob ich ihm sagen konnte, wie ich mich in seiner Situation fühlen würde. Etwas verwundert fragte ich nach und er vertiefte seine Frage: „Stellen Sie sich vor, Sie sind an meiner Stelle und hören sich Ihre Erzählungen an. Wie Sie erzählen, dass Sie nichts wert seien, dass Sie keinerlei Anerkennung bekommen und im Grunde allein sind, ohne Rückhalt und Unterstützung.“ Mir fiel es etwas schwer, auf diese Frage zu antworten, da ich schon verschiedene Reaktionen auf diese Frage gehört hatte. Ich brachte zögernd verschiedene Gefühle hervor, wie Ärger, Verwunderung und Trauer. Er half mir darauf mit einem weiteren Beispiel auf die Sprünge: Ich sollte mir einen Welpen vorstellen. Ich würde sehen, wie dieser von seinem Herrchen getreten und missachtet würde. Er sei doch nur ein kleiner Welpe, völlig unschuldig, und wolle nichts anderes als Aufmerksamkeit und Zugehörigkeit. Und doch würde ihn sein Herrchen behandeln wie ein Stück Dreck. Dieses Beispiel half mir dabei, auf ein zentrales Gefühl aufmerksam zu werden: Wut. Ich wusste zwar, dass dieses Gefühl immer zugegen war, doch oft versuchte ich es in Schach zu halten. Nachdem ich meine Gedankengänge zu Ende geführt hatte, sprach mein Therapeut erneut die Couch an. Da ich, auch instinktiv, keine Bedenken äußerte, schlug er mir ein Probeliegen vor. Die Gemütlichkeit und bereits bekannte Position aus der Physiotherapie überzeugten mich und so einigten wir uns darauf, dass ich ab der nächsten Sitzung klassisch auf der Couch liegend sprechen würde. Und das tat ich beim nächsten Termin dann auch. Ich erzählte sogleich, anhand einer mitgebrachten Zeichnung, von dem vergangenen Wochenende und wie mich meine Pflegeeltern, speziell mein Pflegevater, zur Weißglut gebracht hatten. Je mehr ich mich in Rage sprach, desto mehr ignorierte ich das Bild. Irgendwann lag es nur auf meinen Beinen, während ich mich ordentlich „auskotzte“ und dabei Dinge sagte, die ich nicht eine Sekunde bereute. Mein Therapeut stellte etwas verwundert fest, dass ich sehr viel Wut in mir hatte (wahrscheinlich mehr als er erwartet hatte). Ich bejahte dies schulterzuckend und beendete meinen Monolog damit. Die letzten zehn Minuten lag ich einfach nur da und träumte vor mich hin. Schließlich wurde ich mit den leisen, obligatorischen Worten „O. k., mal bis hier?“ entlassen. In der nächsten Sitzung äußerte ich meinen Ärger darüber, dass ich schon wieder über dasselbe Thema gesprochen hatte (die Geschehnisse am vergangenen Wochenende). Ich sagte ihm, dass ich das schon in der letzten Therapie dauernd gemacht hatte und das mich kein bisschen weitergebracht hatte. Als er mir sagte, dass wir nun mal immer über das sprechen würden, was uns am meisten belastet, sagte ich ihm, dass ich aber an der eigentlichen Situation trotzdem nichts ändern würde. Daher wäre die Aussprache darüber komplett sinnlos. Während ich sprach, hob sich meine Stimme, was meinem Therapeuten nicht verborgen blieb. Erneut sprach er meine Wut an und erneut bestätigte ich diese. Während ich gedanklich auf die Wiederholung dieser Äußerung genervt reagierte, sprach er eine mögliche Enttäuschung an, die er bei mir gegenüber meinem Pflegevater erkennen würde. Ich verneinte diese Feststellung sofort und formte sie etwas um. Denn ich war nicht direkt von ihm enttäuscht, sondern vielmehr von meinem Leben, von meinem Schicksal – oder wie auch immer man es nennen mochte –, das für den bisherigen Verlauf verantwortlich war und ist. Denn ich finde es einfach nicht fair, dass meine eigene Geschichte so verkorkst ist, dass sie sich ständig wiederholt und ich immer noch darunter leide. Nach dieser Aussage verstummte ich erneut. Nach 15 Minuten sprach mich mein Therapeut auf meine Schweigsamkeit an. Ich sagte ihm, dass mir nun nichts mehr einfallen würde. Erneut musste ich mich verteidigen, als er seine Vermutung äußerte, dass mich seine Bemerkung zu der gefühlten Enttäuschung gegenüber meinem Pflegevater entrüstet hatte. Die restliche halbe Stunde lag ich gelangweilt auf der Couch. Mein Kopf schien komplett leer zu sein. Ich hatte das Gefühl, dass ich auf nichts Zugriff hatte, was ich meinem Therapeut auch sagte. Dieser gab hierzu einen knappen, interessierten Kommentar ab, bei dem es aber auch blieb. Bis er endlich das ersehnte „O. k., mal bis hier?“ aussprach, hatte ich träumend auf die Uhr gestarrt und dem Ticken des Zeigers zugehört. Gedanklich war ich bei der Arbeit und bereute zutiefst, dass ich bei der Therapie sinnlos herumgelegen hatte. Als ich mich wieder auf den Rückweg machte, kochte ich vor Wut. Ich hatte meine Pause erneut weit überschritten und sie mit nichts Sinnvollem verbracht. Mich ärgerte zutiefst, dass mir mein Therapeut nicht geglaubt hatte, dass ich nichts zu sagen hatte, weil ich schlicht nichts fand. Die nächsten Sitzungen verliefen ähnlich. Entweder ich hatte eine Kleinigkeit zu erzählen oder ich lag einfach nur stumm auf dem Sofa und suchte Muster in dem Baum, der genau vor dem Fenster in meinem Blickfeld wuchs. In den Stunden, in denen ich einfach vor mich hin plauderte, erzählte ich entweder ein wenig von früher, von der Arbeit oder wiederholte Themen der vergangenen Sitzungen. Irgendwann entschied, ich etwas auszuprobieren, und nutzte meine Freiheit, „einfach sagen zu können, was ich wollte“. Und so erzählte ich meinem Therapeuten von meinem Albtraum42, der mir gleichermaßen real und doch so irreal vorkam. Zu meinem großen Erstaunen erging es ihm nicht so wie meiner alten Therapeutin, die sich damals keinen Reim daraus machen konnte. Er fand diesen Traum sehr spannend und war sich sicher, dass sich mehr als ein Körnchen Wahrheit darin fand. Schließlich passten all meine Verhaltensweisen dazu: Ich schlafe immer mit dem Gesicht zur Tür. Schon seit Kindertagen muss ich mein Bett für mich allein haben, weshalb ich auch nie ein Kuscheltier besessen habe. Ich hasse es, wenn mir jemand auf den Rücken schlägt oder ihn auch nur berührt. 42 siehe Albtraum S. 91. Ich sagte meinem Therapeuten, dass ich mir einfach nicht sicher war, ob mein Stiefvater wirklich so weit gegangen war, sich an mir zu vergehen. Gleichzeitig war ich mir sehr wohl seiner Aggressivität und Willensstärke bewusst, was es wiederum wahrscheinlicher machen würde. Und doch bestand der Zweifel. Schließlich reicht eine solche Tat über das menschliche Vorstellungsvermögen hinaus – meiner Meinung nach. Ich sprach noch etwas über die damaligen Verhältnisse, was erneut in der Feststellung meines Therapeuten endete, dass ich enorm viel Wut in mir tragen würde. Doch woher diese kam, konnte ich ihm einfach nicht beantworten. Gegen Ende meiner Ausführungen schlug er mir erneut vor, dass wir die Sitzungen von zwei auf drei Mal die Woche erhöhen sollten. Ich versprach ihm, die Umstellung auf der Arbeit zu besprechen, was ich auch tat. Währenddessen war mein Pflegevater erneut ins Krankenhaus gekommen, was mich allerdings wenig interessierte. Nachteilig war natürlich der Umstand, dass meine Pflegemutter dauernd bei ihm war und ich daher am Wochenende immer allein war. Doch ich genoss die Ruhe trotzdem, da die störenden Faktoren dadurch nicht vorhanden waren. Die aktuellen Geschehnisse teilte ich auch eher halbherzig in der Therapie mit, sagte meinem Therapeuten aber wahrheitsgemäß, dass mein Pflegevater sich wahrscheinlich wieder erholen würde, was mir nicht so gelegen kam. Schließlich wünschte ich mir, dass er sterben würde. Doch da ich nicht mehr über ihn sprechen wollte, erwähnte ich ihn kaum noch. Ich fuhr zwar über das Wochenende noch nach Hause, doch nicht ein einziges Mal ging ich mit ins Krankenhaus, um meinen Pflegevater zu besuchen. Warum auch? Schließlich genoss ich die Ruhe ohne ihn. Doch plötzlich ging es Schlag auf Schlag: Bei einem routinemäßigen Anruf bekam ich die Nachricht von meiner Pflegemutter, dass ihr Mann im Sterben lag. Er hatte nachts einen schweren Schlaganfall erlitten und war nun nicht mehr ansprechbar. Sollte er also aufwachen, würde er ein Pflegefall sein. Doch er hatte eine Patientenverfügung und in dieser verfügt, dass in solchen Fällen lebenserhaltende Maßnahmen nicht erwünscht seien. Und so wurde dem entsprochen. Meine Pflegemutter blieb von morgens bis abends bei ihm, sodass mich ihre jüngste Tochter an meinem wöchentlichen Wochenendbesuch vom Bahnhof abholte. Als meine Pflegemutter spätabends nach Hause kam, hatte ich mir davor viele Gedanken gemacht, wie ich ihr am besten gegenübertreten sollte. Als ich schließlich vor ihr stand, folgte ich meinem Instinkt: Ich nahm sie in den Arm und drückte sie fest an mich. Nachdem sie ein paar Tränen vergossen hatte, fasste sie sich wieder und erzählte mir, wie es ihrem Mann ging. Nachdem ich gesehen hatte, wie sie litt, wünschte ich mir noch mehr, dass mein Pflegevater endlich sterben würde. Denn er tat ihr so viel Leid an, obwohl er eigentlich überhaupt nichts tat. Mein Wunsch erfüllte sich bereits am nächsten Tag. Ich hatte meiner Pflegemutter geholfen, ihr Abendessen zuzubereiten, und es mir vor einer DVD gemütlich gemacht. Nur eine halbe Stunde nach ihrer Rückkehr vom Krankenhause meldete sich dieses telefonisch, um ihr den Tod ihres Mannes mitzuteilen. Also machte sie sich wieder auf den Weg in die Klinik. Ich hingegen saß einfach nur stumm da und hörte ihr zu. Ich wusste nicht, wie ich darauf reagieren sollte, und insgeheim wollte ich meine DVD weiterschauen, auch wenn ich wusste, dass das in diesem Moment unangebracht war. Und so überließ ich die Trauer komplett meiner Pflegemutter, während ich mit meinem Alltag fortfuhr. Ich konnte einfach nicht verstehen, warum alle so traurig und überrascht waren. Schließlich war durch den stetigen Verfall meines Pflegevaters absehbar gewesen, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis es vorbei war. Ich hatte mich zwar mit dem Zeitraum verschätzt, doch ich war trotzdem froh, dass meine Pflegemutter nun endlich von dieser enormen Last befreit worden war, auch wenn das bedeutete, dass sie nun eine Trauerphase und (anderes) Leid ertragen musste. Trotzdem war ich doch etwas überrascht, dass mich sein Tod komplett kalt ließ. Mir war zwar bewusst, dass ich nicht eine Träne für ihn verschwenden würde, doch ich hatte mir das ein bisschen wie im Film vorgestellt: dass ich – im entscheidenden Moment – Erleichterung, Überraschung oder vielleicht sogar Reue empfinden würde. Doch da war absolut nichts. Daher verstand ich auch nicht, warum die Emotionen um mich herum geradezu explodierten. Warum jemandem nachtrauern, der es überhaupt nicht verdient hatte? Ich beschloss, die Reaktion meines Therapeuten abzuwarten. Zwischenzeitlich benachrichtigte ich den Doc, der ebenfalls der Meinung war, dass der Tod meines Pflegevaters nicht überraschend gekommen sei. Erstaunlicherweise hatten viele Faktoren eine Rolle gespielt, die den seltenen, aber doch möglichen Verlauf bis zum schnellen Tod möglich gemacht hatten. So hätte er „normalerweise“ viel länger vor sich hin vegetieren müssen. Als ich in der nächsten Therapiesitzung schließlich von dem neuesten Ereignis erzählte, wurde ich wieder überrascht. Denn mein Therapeut reagierte lediglich mit einem Räuspern, blieb ansonsten aber reserviert. Und so erzählte ich ihm wahrheitsgemäß, was mir die letzten Tage durch den Kopf gegangen war, und ließ auch meine „kalten“ Gedanken nicht aus. Doch erneut kam keine Reaktion, was mich dazu veranlasste, ebenfalls zu verstummen. Ich lag also erneut über eine halbe Stunde ruhig da und suchte erneut Muster in der Natur vor dem Fenster. In den letzten Minuten erzählte ich ihm dann doch noch, dass ich wegen des dritten Wochentermins alles geklärt hätte. Doch ich würde zweifeln, ob dieser überhaupt Sinn machen würde. Auf seine Nachfrage antwortete ich ihm, dass ich schließlich nichts zu sagen hatte und daher eigentlich nur stumm daliegen würde. Schließlich wisse er nun alles über mich und mir würde in letzter Zeit einfach nichts mehr durch den Kopf gehen. Seiner Feststellung, dass genau dieser Umstand so spannend wäre, konnte ich nicht zustimmen. Als ich die Sitzung verließ, übermannte mich erneut Ärger über die soeben verschwendete Zeit. Zeitgleich konnte ich nicht fassen, dass er nicht einmal auf die neue Nachricht reagiert hatte. Ich hatte erwartet, dass er meine Gleichgültigkeit ansprechen, aber nicht mit Distanz reagieren würde. Mein Ärger manifestierte sich zunehmend bei der Arbeit, verflog aber auch wieder. Denn auch dort hatte ich die Nachricht bekannt gegeben, auch wenn meine Arbeitsweise dadurch nicht beeinflusst wurde. Doch schon nach kurzer Zeit sollte ich ein Gesprächsthema für die nächste Sitzung erhalten. Einen Tag in der Woche kam der Chef einer unserer Partnerpraxen zu uns, um den ganzen Tag zu operieren. An dem gleichen Tag fanden auch Meetings statt, um aktuelle zu Probleme besprechen und zu lösen. Eines der angesprochenen Themen war an diesem Tag die herrschende Unruhe im Team, genauer unter den Helferinnen. Mittels Mitarbeiterbefragungen hatten die Chefs ausgewertet, dass wir Mädels offenbar unzufrieden mit der momentanen „Chemie“ zwischen uns waren. Überraschend war dieses Testergebnis sicherlich nicht für uns. Natürlich war mir anhand meiner stetigen Beobachtungen klar, wer für die Unruhen verantwortlich war. Doch ich hielt mich, wie alle anderen, zurück. Der Chef der Partnerpraxis sprach über die Akzeptanz von Persönlichkeiten und deren einzigartige Charaktere, was zwar lobenswert war, doch nicht wirklich half. Als das Meeting vorbei war und ich anfing, Arbeiten im OP zu erledigen, nahm mich derselbe Arzt plötzlich beiseite und bat mich um ein Gespräch unter vier Augen. Ich willigte sofort ein, schließlich hatte ich nichts zu verbergen. Er fing sogleich an, mich zu loben und mir zu versichern, dass sowohl er als auch der Professor sehr zufrieden mit mir seien. Und auch die ärztlichen Kollegen hätten an meiner Arbeit nichts zu beanstanden. Doch dann sprach er die erwähnten Unruhen im Team an und offenbarte mir seine Vermutung, dass diese mit mir zu tun haben könnten. Ich musste auf diese Äußerung mit einem sehr dummen Blick reagiert haben, da er mich sofort erneut lobte und verdeutlichte, dass er dies nur vermuten würde. Auf meine Nachfrage, wodurch genau ich diese Unruhen denn verursachen könnte, fand er nur schwer Worte. Mir war klar, dass er seine Beobachtungen nicht richtig erklären konnte, doch ich erinnerte mich an eine Frage, die er mir viele Wochen vorher schon gestellt hatte: ob es sein könnte, dass ein paar Mädels eifersüchtig auf mich seien. Verschiedene vergangene Situationen schossen mir durch den Kopf und bildeten ein passendes Bild, während der Arzt immer noch versuchte zu erklären, wie er zu seinem Schluss gekommen war. Mir war klar, dass er sich mit dem Professor unterhalten hatte, da er ein Verhalten meinerseits beschrieb, dass er unmöglich selbst beobachtet haben konnte. Und so erwähnte er, wie leicht mir das Lernen fiele, meine schnelle Auffassungsgabe und mein enormes Stresspotenzial. Offenbar versuchte er mir zu sagen, dass ein paar Mädels eifersüchtig waren und sich wohl daran stören würden, dass mir alles so leichtfiel und ich weder gestresst war noch mich inkorrekt verhielt. Wir einigten uns darauf, dass ich die Situation beobachten würde. Nach einem erneuten Lob entließ er mich schließlich aus dem Gespräch und wir gingen wieder unserer Arbeit nach. Nur wenige Stunden später bot sich ihm ein Beispiel, das zeigte, dass ich unmöglich der Unruhestifter sein konnte. Denn eine Kollegin von mir ließ erneut ihre schlechte Laune an mir aus, indem sie mich anschrie – ohne Grund, wohlgemerkt. Zu meinem Glück stand derselbe Arzt neben mir, mit dem ich soeben darüber gesprochen hatte. Nachdem ich ruhig auf die verbale Attacke geantwortet hatte, lächelte ich ihn an. Er wiederum erwiderte dies mit einem wissenden Grinsen, legte seinen Arm um meine Schulter und lachte. Auch im musste lachen, auch wenn es mehr Schadenfreude war. Schließlich hatte sich die Kollegin soeben ins eigene Bein geschossen. Trotzdem ging mir das Gespräch nicht aus dem Kopf. Ich sprach am darauffolgenden Wochenende mit meiner Pflegemutter darüber, die sich ebenfalls keinen Reim auf diese „Anschuldigungen“ machen konnte. Ich hatte zwischenzeitlich auch den Doc um Rat gefragt, der mich aber beruhigte und mir riet abzuwarten. Um diesem Problem entgegenzuwirken, beschloss ich, dem Professor zu schreiben und ihn um ein Gespräch zu bitten. Wie ich erwartet hatte, bekam ich sofort Rückmeldung von ihm, die die Bereitschaft für ein Gespräch beinhaltete. Zudem sicherte er mir sofort zu, dass die momentane Lage nichts mit mir zu tun hatte. Und so trat ich das bevorstehende Gespräch entspannt und optimistisch an. Wie sein Kollege zuvor lobte mich auch der Professor in der Einleitung seiner Ansprache. Danach erklärte er mir, dass sich die beiden überlegt hatten, meine Beobachtungen als „Neuling“ zu nutzen, da ich schließlich keine zu großen Bindungen im Team hatte und daher rationaler deuten könne, was das Problem sei. Und so teilte ich dem Professor meine Beobachtungen anhand von Namen und Beispielen mit. Ändern ließ sich dadurch zwar kaum etwas, doch ich war froh, dass ich mehr Informant als Angeklagter war. Nachdem ich dieses Problem aus der Welt geschafft hatte, stand die Beerdigung meines Pflegevaters an. Der Dienst war getauscht, die Therapie abgesagt und die Physiotherapie auf morgens verschoben. Nichts schien meinem Erscheinen zur Beerdigung im Wege zu stehen. Und so machte ich mich mittags auf den Weg nach Hause. Da ich doch relativ spät erscheinen würde, konnte mich niemand vom Bahnhof abholen. Ich beschloss zu laufen, was ich in der Stadt regelmäßig tat, weshalb ich keine Scheu vor mehreren Kilometern Fußmarsch hatte. Doch 15 Minuten vor meiner Ankunft sah ich plötzlich jemand allzu Bekanntes im Zug: meine kleine Schwester. Sofort wurde ich rasend vor Wut und schrieb mit zitternden Händen einer meiner Pflegeschwestern. Ich wusste, dass sie auf der Beerdigung nicht erwünscht war, da diese doppelte Belastung zu viel für meine Pflegemutter wäre. Doch offenbar hatten alle Bitten nichts genutzt. Meine Schwester bildete sich wohl ein, dass sie meiner Pflegemutter einen Gefallen tat, wenn sie überraschend auftauchte. Ich vermutete, dass sie für sie da sein wollte, womit sie ihre Respektlosigkeit auch bestimmt rechtfertigen würde. Kurz vor dem Ziel kam endlich eine Antwort von der ältesten Tochter meiner Pflegemutter. Wie ich es mir gedacht hatte, sollte meine Schwester nicht an der Beerdigung auftauchen. Sie hatte die Erlaubnis bekommen, in den nächsten Wochen auf Besuch zu kommen. Doch sie würden nichtsdestotrotz alle Vorkehrungen für den „Überraschungsbesuch“ treffen. Glücklicherweise schrieb ich zeitgleich mit einer Familienfreundin. Sie bat mich um einen Gefallen, woraufhin ich sogleich eine Erwiderung einforderte, wenn auch mit etwas schlechtem Gewissen. Meine Bekannte willigte sofort ein, mich am Bahnhof abzuholen, was mir Zeit gab, alle zu warnen, da ich wusste, dass meine Schwester den langen Weg laufen würde. Meine Wut hatte sich etwas beruhigt, war aber trotzdem noch präsent. Doch ich versuchte einen Vorteil aus der Situation zu schöpfen. Denn da alle Aufmerksamkeit auf meine Schwester gerichtet sein würde, läge der Fokus weniger auf mir. Tatsächlich war dem dann auch so. Während des Trauergottesdienstes und des Begräbnisses bauten meine Pflegeschwestern und ich eine Mauer um meine Pflegemutter, sodass meine Schwester nicht an sie herankam. Später beim Leichenschmaus wurde ich mehrmals auf meine Schwester und ihren momentanen Zustand angesprochen. Ich konnte zwar nicht verhindern, dass sie sich im Gasthof an meine Pflegemutter schmiegte und das Elend vorspielte, doch immerhin hatte ich meine Ruhe. Und so konnte ich die wenigen Stunden damit verbringen, die trauernden Menschen um mich herum zu studieren. Vor allem die Tränen der Enkel meiner Pflegeeltern waren für mich unbegreiflich. Ich verstand einfach nicht, wie sie ihrem Opa nachtrauern konnten, wenn er ihnen doch nicht als besonderer Mensch im Gedächtnis geblieben sein konnte. Schließlich hatte er nur dagesessen, geschlafen oder vor sich hin gedämmert. Er hatte ihnen weder etwas Brauchbares beigebracht noch in anderer Hinsicht Hilfreiches hinterlassen. Warum ihm also nachweinen? Natürlich konnte mir das niemand erklären und fragen konnte ich das erst recht nicht. Ich war froh, am Abend wieder zu Hause zu sein, auch wenn ich wusste, dass meine Pflegemutter noch lange traurig sein würde und ich schon bald genervt davon sein würde – vor allem da ich es jetzt schon war. Allerdings beschloss ich relativ schnell, dass das Kapitel „Pflegevater“ für mich endlich abgeschlossen war und ich nun eine große Belastung weniger hatte. Nun war die Konzentration auf die Therapie sicher leichter, da dieses Thema der Vergangenheit angehörte. Es konnte also weitergehen: Ich versuchte, am Anfang jeder neuen Therapiesitzung am Ende der vorangegangenen anzuknüpfen, doch mir gelang das nur selten. Meist hatte ich ein paar Fragen oder es war etwas passiert, das ich erst einmal loswerden wollte. Jedes Mal landeten wir dann über mehrere Ecken bei einem anderen Thema, bei dem ich mir dann wieder erneut vornahm, es beim nächsten Mal weiterzuführen. Irgendwann akzeptierte ich den Umstand, dass wir mehr zufällig auf wichtige Themen kamen, und so fing ich oft mit etwas Banalem an. So auch während einer Sitzung, in der ich meinem Therapeuten etwas erzählte, das ich noch nie jemandem erzählt hatte. Über seiner Praxis wohnte eine Familie mit zwei Kindern, die laut spielten und ordentlich trampelten. Ich sagte in den Raum hinein, dass sich der Lärm so anhören würde, als ob jemand umziehen würde. Doch er belehrte mich eines Besseren und beschrieb das tägliche Spiel der Kinder. Daraufhin erzählte ich ihm, dass ich auch einen lauten Nachbarn hatte, der streng genommen jedoch nichts dafür konnte, dass er mich so aufregte. Denn er lief auf den Fußhacken, was ein lautes Dröhnen auslöste und mir so das Gefühl gab, dass bei jedem seiner Schritte der Putz von der Decke bröckeln würde. Abgewöhnen konnte ich ihm das natürlich nicht, doch ich beschrieb diese „Geräuschempfindlichkeit“ als eine der Eigenschaften, die ich sehr an mir hasste. Während ich ihm das beschrieb, dachte ich weiter laut darüber nach, und dann fiel mir etwas auf, das ich ebenfalls sofort preisgab: Offenbar machten mir besonders tiefe Töne, die ich auch spüren konnte (z. B. Bass mit Vibrieren in den Ohren), enorm zu schaffen. Hohe Töne machten mich längst nicht so aggressiv. Hinzu kam, dass vor allem die Geräusche, mit denen ich nicht gerechnet hatte, Wut in mir auslösen konnten. So waren mir z. B. vorbeifahrende Autos oder Musik in Geschäften nicht so unangenehm. Mein Therapeut hörte mir aufmerksam zu und bezeichnete meine Beschreibungen als auffällig. Zudem kam ihm eine Idee, die mich nicht mehr loslassen sollte. Würde man es genau nehmen, dann galt ein solches Geräusch, das ich körperlich spüren würde, als Berührung. Hinzu kam eben die Tatsache, dass „überraschende“ Geräusche besonders belastend waren. Und schon waren wir wieder bei dem Thema, dass ich Berührungen, die ich nicht kommen sehe, verabscheue. Sollte ich tatsächlich so empfindlich sein, dass ich selbst auditive Berührungen schlecht vertrug? Und wie schlimm muss das Ereignis oder die Ereignisse gewesen sein, die das ausgelöst hatten? Eine Antwort konnte mir mein Therapeut nicht geben, lediglich die Annahme, dass das schon irgendwann aufkommen würde. Und so ließ ich es dann auch darauf beruhen. Das vergangene Thema nutzte ich lediglich als Einstieg bei der nächsten Sitzung. Ich hatte zwar keine große Motivation, darüber zu sprechen, kam darüber aber doch – wie erhofft – auf ein anderes Thema zu sprechen. Erneut über mehrere Wendungen lag das Thema plötzlich bei Kindern. Ich erzählte meinem Therapeuten, dass mein kleiner Neffe (Enkel meiner Pflegemutter) in letzter Zeit sehr oft bei ihr war, da seine Mutter krank war. Der Kleine war nun ein Jahr alt und ich hatte Freude daran, ihn zu beschäftigen. Allerdings hielt ich nicht damit hinter dem Berg, dass ich keinerlei Interesse daran hatte, genauso viel Zeit mit seiner großen Schwester (inzwischen vier Jahre alt) zu verbringen. Ich führte auf die Nachfrage meines Therapeuten weiter aus, dass ich Kinder zwischen zwei und sechs Jahren nicht ausstehen konnte. Ich meide sie wie der Teufel das Weihwasser. Als Grund für dieses Verhalten kann ich lediglich anführen, dass ich sowohl das aufkommende Grenzen-Ausprobieren als auch das ständige Jammern, Heulen und dumme Gerede mehr als nervig finde. Ich finde kleine Kinder weder witzig noch habe ich Interesse daran, ihnen etwas vorzulügen und so z. B. Begeisterung vorzuspielen. Als ich meinem Therapeuten erzählte, dass ich die Kleine regelrecht ignorierte und es mir völlig egal war, was sie dabei empfand, sah er dies wieder als sehr auffällig an. Zwar verlangte er von mir, mich in die Kleine hineinzuversetzen, doch schlussendlich war mir völlig egal, was mein Verhalten in ihr auslösen könnte. Ich möchte mich nun mal nicht mit Kindern in diesem Alter beschäftigen und habe daher keine Probleme mit, das offen zu zeigen. Ich betonte noch einmal, dass ich Babys sehr mag und mein regelrechter Hass gegen Kleinkinder erst etwas später einsetzt. Daraufhin fragte mich mein Therapeut, woran das liegen könnte, woraufhin ich allerdings eine klare Antwort parat hatte, da ich dies bereits mit meinem Physiotherapeuten erörtert hatte: Meiner Meinung nach war es kein Zufall, dass die Altersspanne exakt die gleiche war wie meine eigene, als ich unter meinem Stiefvater gelitten hatte. Ich führte weiter aus, dass ich mir das wohl irgendwie abgeschaut und verinnerlicht hatte. Ferner, überlegte ich laut weiter, könnte es doch sein, dass es sich bei diesem Hass gar nicht um meinen eigenen handelte. Genau diesen Gedanken fand mein Therapeut sehr interessant. Leider war in diesem Moment die Zeit um, was mir natürlich überhaupt nicht gelegen kam. Doch ich war stolz darauf, dass ich offenbar einen Pfad entdeckt hatte, dessen Erkundung sich sicher lohnen würde. Zu meinem Bedauern musste ich lange auf die Fortsetzung warten, da nun ein zweiwöchiger Urlaub meines Therapeuten anstand. Ich nutzte diese Zeit zum Nachdenken und für eine Antwort auf eine Frage, die mir schon sehr lange unter den Nägeln brannte. Da ich vermutete, dass mein Stiefvater eine gewissen Grenze überschritten hatte (auch wenn ich es mir nicht richtig vorstellen konnte), sah ich eine Möglichkeit, der Wahrheit einen Schritt näher zu kommen. Denn meine alljährliche Kontrolle beim Gynäkologen stand bevor. Nach der Untersuchung holte ich tief Luft und spuckte nach einigem Hin und Her meine eingeübte Frage aus: „Sagen Sie … bin ich eigentlich noch Jungfrau?“ Mein Gynäkologe war anfangs verwirrt, was ich aber nachvollziehen konnte. Doch er fand schnell die Verbindung und fragte, nun etwas niedergeschlagen, ob meine Frage denn auf ein Ereignis in der Vergangenheit anspielen würde. Ich nickte nur und bekam ein schlechtes Gewissen. Seine anfängliche gute Laune hatte sich schlagartig in Luft aufgelöst. Ich hatte zwar damit gerechnet, konnte mir aber nicht vorstellen, dass ich die erste Patientin war, die mit einem solchen Hintergrund zu ihm kam. Er druckste etwas mit seiner Antwort herum, indem er mir die Individualität jeder Frau erläuterte. Es sei nicht immer eindeutig, da viel von der Anatomie abhänge. Schließlich überwand er sich zu einer Antwort und brachte ein geknicktes „… tendenziell … nein“ heraus. Ich hatte nun also meine Antwort und er keinen schönen Tag mehr. Schon allein die Tatsache, dass er mir nicht sofort mit einem klaren „Ja!“ geantwortet hatte, bestätigte meine Vermutung. Zudem ergab es nun auch Sinn, dass vorherige Kollegen von ihm mir alle gesagt hatten, dass sie erstaunlicherweise keine „Schwierigkeiten“ bei der Untersuchung gehabt hatten, da bei bestehender Jungfräulichkeit etwas mehr Vorsicht geboten sein sollte. Für mich ergab somit alles Sinn. Meine Stimmung hatte sich jedoch, im Gegensatz zu der meines Gynäkologen, überhaupt nicht verändert. Ich verließ grinsend die Praxis und beschäftigte mich zufrieden in der Stadt. Hin und wieder meldete sich noch mein etwas schlechtes Gewissen. Schließlich hatte ich ihm eine Frage gestellt, die offenbar mit einem traumatischen Erlebnis meinerseits in Verbindung stand. Meinen Gynäkologen hatte dies mehr mitgenommen als ich erwartet hatte, doch ich dachte im Laufe des Tages nicht mehr darüber nach. Nun konnte ich es kaum erwarten, meinem Therapeuten die neue Information mitzuteilen, und war gespannt, was er dazu sagen würde. Als es endlich so weit war, sprach ich anfangs über andere Dinge. Doch schon nach kurzer Zeit konnte ich die Neuigkeiten nicht mehr zurückhalten. Wie ich erwartet hatte, erkundigte sich mein Therapeut nach den genauen Worten meines Gynäkologen, da er sich über die Wortwahl wunderte. Doch ich beschrieb ihm die abrupt geänderte Körpersprache und Sprechweise, was ihn dann ebenfalls überzeugte. Natürlich folgte sehr schnell die Frage, die er mir schon sehr oft gestellt hatte: „Was, glauben Sie, ging in ihm vor?“ Ich kann mich zwar in andere hineinversetzen und weiß daher, was in anderen vorgeht. Was mir jedoch Schwierigkeiten bereitet, sind die Entstehung und die Beweggründe der Emotionen. Auch hier tat ich mir erneut etwas schwer. Ich wusste, dass er bedrückt war, Mitgefühl gezeigt hatte und dass ihn meine Frage getroffen hatte. Doch die genauen Emotionen musste ich erraten. Schließlich erlöste mich mein Therapeut mit der interessanten Feststellung, dass hierbei ein psychologisches Phänomen aufgetreten war. Denn es sei auffällig, dass ich neutral geblieben war, während mein Gynäkologe von Emotionen überschwemmt worden war. Seine Empathie sei stark ausgeprägt, was ihn dazu bewog, die passenden Emotionen zu meiner Frage und deren Antwort zu empfinden. Im Grunde hatte er das empfunden, was ich hätte empfinden müssen. Natürlich überwog hier wieder die Faszination über die Vorgänge in der menschlichen Psyche in mir und das sagte ich meinem Therapeuten auch. Er erkundigte sich, wie gewohnt, nach meinem eigenen Befinden, doch mich beschäftigte dieses Thema überhaupt nicht. Ich vermute, dass ich es schon gewusst und nur noch eine Bestätigung gebraucht hatte. Daher wandten wir uns anderen Themen zu. Denn mich beschäftigten andere Dinge, die meine Verbitterung wachsen ließen. Ich hatte beschlossen, mir einen neuen Job zu suchen, da zu der Langeweile Aggression hinzugekommen war. Leider wusste ich immer noch nicht, was ich genau machen wollte. Ich hatte noch nie einen Traumberuf gehabt und auch momentan keine klare Vorstellung von einem Job, der mir so viel Spaß machen könnte, dass ich sozusagen nie wieder „arbeiten“ musste. Ich überlegte mir mehrere Richtungen wie Restauration, Psychologie und Tätowierer. So ganz sprang der Funke nie über, aber ich hielt die Augen trotzdem offen. Daher überlegte ich mir eine andere Strategie, um mir das Leben etwas zu erleichtern. Ich ging meine Langeweile auf der Arbeit von einer anderen Richtung an und dachte darüber nach, was mich am meisten störte. Es waren nicht nur die Interaktionen mit den Patienten, sondern auch die schwierige Beziehung zu meinen Kolleginnen. Hier kam ich relativ schnell auf den größten Störfaktor: Mir war durchaus bewusst, dass es die meisten meiner Kolleginnen bis ins Mark ärgerte, dass ich mehrmals die Woche die Arbeit verließ, um die Therapie aufzusuchen. Mir war außerdem klar, dass nach meinem Verschwinden gelästert wurde ohne Ende. Dieser Punkt störte mich nicht weiter, aber die Missgunst und der Ärger, die ich an diesen Tagen zu sehen und zu spüren bekam, gingen mir gehörig auf die Nerven. Dass ich mir mit meiner gewünschten Konzentration auf meine Gesundheit nicht gerade Freunde machte, war mir klar, aber ich verstand diesen sinnfreien Ärger einfach nicht. Für mich stand die Arbeit nun mal nicht im Mittelpunkt. Durch meine Selbstständigkeit hatte ich erst recht schlechte Karten und dass ich jegliche soziale (private) Interaktionen vermied, schoss mich komplett ins Aus. Trotzdem wollte ich mir das Leben etwas erleichtern und beschloss, meinen Dienstplan an die Therapie anzupassen. Diese Umstellung würde hoffentlich dafür sorgen, dass mich die Mädels in Ruhe ließen und endlich nach sich schauen würden, anstatt sich weiter an mir und meinem Privatleben zu stören.43. 43 Später fand ich heraus, dass die Vermutungen, wo ich dauernd hinging, in die richtige Richtung gingen: irgendwas mit „Psyche“. Deshalb beschloss ich aber noch lange nicht, meine Gesundheit einem Haufen Egoisten darzulegen. Die Praxis war nicht mein liebster Aufenthaltsort, was ich jedem zu spüren gab, sei es durch schlechte Laune, höhere Gereiztheit oder durch komplettes Verstummen. Ich hoffte, dass mein Chef meine Veränderung sehen und mich eines Tages darauf ansprechen würde. Dass ich hierfür Geduld brauchen würde, war mir bewusst, aber diese hatte ich zuhauf. Zwischenzeitlich konzentrierte ich mich komplett auf die Therapie. Zu meiner großen Freude konnte ich meinem Therapeuten mitteilen, dass ich ihm nun fast zu 100 % vertrauen würde und er damit nun offiziell zu meinen anderen beiden Vertrauten gehören würde. Er hatte auch sogleich einen Namen für die kleine Schar meiner Vertrauten: Elitenrat. Dieser gefiel mir sehr gut, denn mein Therapeut stellte etwas fest, was ich schon lange wusste. Alle meine Vertrauten waren intelligent, hatten anständige Berufe, die anderen halfen, und zeichneten sich durch ihre intellektuellen und charakteristischen Fähigkeiten aus. Während wir ins Gespräch kamen, bot sich ein Thema an, das uns beide für eine Weile beschäftigen sollte. Denn immer wieder hatte ich erwähnt, dass es mir seltsam vorkam, dass ich offenbar nicht besonders gut bei Frauen ankam (im Sinne von Persönlichkeit und Charakter). Ich konnte mir nicht erklären, was dahintersteckte, doch so ganz ließ mich dieses Thema einfach nicht los. Daher erzählte ich von den auffälligsten Zusammentreffen mit dem weiblichen Geschlecht und den damit verbundenen raschen Differenzen, vordergründig von den Therapeutinnen der vergangenen Jahre, sei es die Vorgängerin meines Therapeuten oder seine Kolleginnen aus den Kliniken. Immer wieder zeigte sich dasselbe Muster: Relativ schnell wandte ich mich mit allen Sinnen gegen sie und bekam eine entsprechende Rückmeldung. Während ich mich vorrangig fragte, warum Frauen so extrem auf mich reagierten, fand mein Therapeut die Frage nach dem Wie viel spannender. Und so erläuterte ich so gut wie möglich meine Vorgehensweise bei neuen Bekanntschaften im weiblichen Sektor. Dass ich nichts mit Frauen anfangen konnte und ihnen einfach nicht vertraute, war keine Überraschung. Doch ich war immer davon ausgegangen, dass ich so unvoreingenommen wie möglich an neue Bekanntschaften heranging. Scheinbar machte mir mein Unterbewusstsein hier einen Strich durch die Rechnung. Mir fiel irgendwann auf (auf die Nachfrage meines Therapeuten), dass ich schon von Anfang an davon ausging, dass die Beziehung zwischen meinem weiblichen Gegenüber und mir von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Ich ging immer davon aus, dass sie mir sowieso nicht helfen könne, und suchte regelrecht nach einem kleinen Anzeichen, dass meine Vorahnung bestätigen würde. Habe ich dies gefunden (z. B. in Form mangelnden Verständnisses), wende ich mich komplett gegen sie. Schließlich habe ich recht behalten und muss mich daher weder bemühen mitzuarbeiten noch eine Fassade aufrechtzuerhalten, die dies vortäuscht. Ich dachte über diesen Punkt in verschiedenen Versionen nach, landete aber immer wieder beim gleichen Ergebnis. Inzwischen war ich geübt genug und suchte eigenständig nach einem gemeinsamen Schnittpunkt, den mein Therapeut dann kommentieren konnte: meine Mutter. Dass ich kein besonders großer Fan von meiner Mutter bin, ist kein Geheimnis. Ich erzähle jedem, der es hören möchte, dass sie mir egal ist und ich mich dafür schäme, mit ihr verwandt zu sein. Es gab tatsächlich eine Zeit, in der ich eine Art Stolz auf sie empfunden habe. Doch hier wurde ich von der Tatsache geblendet, dass wir Interessen teilten und so eher als Freundinnen anstatt als Mutter und Tochter interagierten. Denn ich merkte rasch, dass ich ein Kind vor mir hatte, dem es sowohl an Verstand als auch an Intelligenz mangelte. Als sie dann schließlich gemerkt hatte, dass sie mich nicht mehr kontrollieren konnte, wandte sie sich gegen mich und verdeutlichte mir, dass wir zu verschieden seien und dies auch immer waren („Wir kamen sowieso nie gut miteinander aus“) Rückblickend muss ich sagen, dass ich damals mehr als dumm und naiv war. Ich könnte mich dafür ohrfeigen, dass ich auf dieses Spiel hereingefallen bin. Ich vermute, dass mir die Tatsache gefiel, eine echte Mutter zu haben, die einiges mit mir teilt, meine Hobbys mag und mich unterstützt. Doch ich war blind gegenüber der Tatsache, dass dies nur für ihre Interessen galt und dass meine eigentliche Person in ihren Augen nicht wichtig war. Sie wollte mich in etwas verwandeln, was ich nicht war. Eine Marionette, mit der sie machen konnte, was sie wollte. Eine Art Golem, dem sie nur einen Befehl in den Mund schieben musste – und schon tat er wie geheißen. Schon in jungen Jahren war ich ihr Verstand und diente als externes Gehirn, das auf Nachfragen eine Lösung ausspucken konnte. Andere würden es für unverantwortlich und falsch erachten, einem Kind eine solche Verantwortung aufzubürden. Doch denke ich noch weiter zurück, hat sie dies schon getan, als ich selbst noch ein Kleinkind war. Dass sie mir die Verantwortung für ihre beiden anderen Kinder überließ, ist wohl das beste Beispiel. Ich weiß nicht, wie lange ich mich um die beiden kümmern musste, doch kein Kind sollte dazu gezwungen sein, innerhalb kürzester Zeit erwachsen zu werden. Ich übernahm mit ca. fünf Jahren die Rolle der Mutter und großen Schwester. Mein junges Gehirn wurde also dazu genötigt, Programme abzurufen, die es nie oder erst in etwa 15 Jahren genutzt hätte. Alle Mechanismen, basierend auf Erfahrungen und Beobachtungen meiner bisherigen Lebensjahre, flossen in diesen Überlebenskampf mit ein. Wie genau ich das gemacht habe, bleibt ein Rätsel für mich. Denn all das Wissen, das für eine solche Leistung nötig gewesen wäre, sammelte ich erst im Laufe der nächsten Jahre bis heute. Ich musste also rein instinktiv gehandelt haben, um mein Überleben und meinen Selbstschutz zu sichern; und natürlich den Schutz meiner Geschwister. Hier steht für mich die Frage im Raum, ob ich auch versucht habe, meiner Mutter zu helfen. Ich glaube ja, denn nach unserer Trennung habe ich sie eine Weile sehr vermisst. Es hat viele Jahre gedauert, bis ich mich getraut habe, mein volles Potenzial zu entfalten, ohne negative Folgen befürchten zu müssen. Noch heute befinde ich mich auf diesem Weg. Es ist nicht mehr nötig, jemand zu sein, der ich nicht bin. Ich muss keine Mutter mehr sein, keine große Schwester und kein verängstigtes Wesen, das vorsichtshalber in geduckter Stellung bleibt, um ja keine Aufmerksamkeit zu erregen. Ich bin dazu in der Lage, meine erlernten Strategien zu nutzen und sie gegen Personen und Situationen anzuwenden, die mir sonst schaden könnten. Ich entdecke immer wieder Neues, das ich zu meinem Vorteil nutzen kann, und dabei gefällt mir vor allem eine Tatsache besonders: Ich übertreffe meine Mutter nicht nur im Punkt Intellekt und Vernunft um Längen. Jede Fähigkeit und jede neue Eigenschaft zeigt mir, dass sie es nicht geschafft hat, mich komplett zu zerstören. Sie hat recht mit der Aussage, dass wir uns nie verstanden haben. Ich möchte diesen Punkt umwandeln in: Wir hatten noch nie etwas gemeinsam. Und daher bin ich arrogant genug, um mit Stolz sagen zu können, dass ich in jeder Hinsicht besser bin als sie. Ich habe sie schon als Kind übertroffen und kann dies heute genießen. Trotzdem gibt es gewisse Kommentare zu der fehlenden Beziehung zwischen meiner Mutter und mir, die ich einfach nicht loswerden kann. Diese kommen vor allem von Personen, die auf dem Gebiet der Psychologie bzw. Psychoanalyse überhaupt keine Ahnung haben. So hält sich hartnäckig die Feststellung, dass ich, um eine signifikante Besserung erzielen zu können, meiner Mutter verzeihen müsse. Dass ich dies in keinerlei Hinsicht vorhabe, dürfte klar sein. Dann gibt es noch die absurde Theorie, dass ich meine Mutter insgeheim vermissen und mir nichts mehr wünschen würde, als sie wieder in meinem Leben zu haben. Nicht zu vergessen ist die fantasievolle Interpretation meiner Kunstwerke. Hier findet sich offenbar in jedem einzelnen Bild ein mehr oder weniger ausgeprägter Hinweis auf die „Beziehung“ zwischen meiner Mutter und mir. Solche und ähnliche Theorien lassen mich vermuten, dass der ein oder andere zu viel Fernsehen geschaut hat und sich nun als Hobbypsychologe in der Pflicht sieht, meine Probleme mit den altbewährten Tricks zu lösen. Lediglich ein schwindend kleiner Anteil glaubt mir, wenn ich sage, dass mir meine Mutter völlig egal ist. Ich habe vor vielen Jahren Hass für sie empfunden, ja sogar Abscheu. Doch nun ist sie für mich schlichtweg NICHTS. Sie hat keinen Wert und daher werde ich nicht auch nur einen kleinen Gedanken an sie verschwenden. Das wäre eine Beleidigung für mein Gehirn und daher undenkbar. Natürlich bin ich nun gezwungen, an sie zu denken, wenn ich das hier schreibe. Doch ich empfinde dabei überhaupt nichts. Mein Therapeut hat hierfür eine äußerst interessante und plausible Feststellung gemacht, die ich sehr mag: Ich habe meine Mutter innerlich „terminiert“. Die menschliche Psyche ist wohl dazu in der Lage, eine Person komplett aus sich selbst zu streichen. Das Objekt wurde zwar nicht wirklich getötet, hat aber in der Psyche den Status „nicht existent“. Für die jüngere Generation: „Search ‚Mutter‘ –> Error 404 not found“. Daher auch die fehlenden Emotionen und das ausbleibende Beschäftigen mit der betreffenden Person – in meinem Fall mit meiner Mutter. Eine weitere Theorie betraf meine Konfrontationen mit den anderen Frauen in meinem bisherigen Therapielauf. Hätte sich meine Meinung über ein solches „Weib“ drastisch und schlussendlich gedreht, würde ich über diese triumphieren wollen. Also stellt sich alles in mir auf stur, ich arbeite nicht mehr mit und mache alles, um dem „Weib“ zeigen zu können: Du kommst nicht an mich heran, da kannst du versuchen, was du willst! Ich bestätigte ihm diese Thesen mit Freuden, da sie nun mal wahr waren. Ich stand auch dazu und sagte meinem Therapeuten, dass ich nicht vorhatte, diese Taktiken abzulegen. Und dennoch bleibt die Frage offen, wie es dazu kommt, dass ich gegenüber dem weiblichen Geschlecht so schnell auf Konfrontation gehe und daher nur „Auserwählten“ jegliche triumphalen Machenschaften verwehre. Diese Frage ist für mich sehr schwer zu beantworten. Ich weiß, dass ich in einer gewissen Erwartungshaltung in eine beginnende Bekanntschaft gehe. Bei Männern erwarte ich etwas ganz anderes als bei Frauen. Wenn ich ehrlich bin, haben Frauen von Anfang an überhaupt keine Chance, da ich bereits ein vorgefertigtes universelles Bild habe. Finde ich auch nur die kleinste Übereinstimmung, braucht es mein Gegenüber gar nicht erst weiter zu versuchen. Ein vorzeitiges Ende? Auch wenn ich davon ausgegangen war, so blieben wir doch nicht so lange beim Thema Mutter. Wie ich es aus meinem Alltag gewohnt war, verlor ich rasch das Interesse und hatte schon bei der nächsten Sitzung keine Lust mehr, über das Vergangene zu sprechen. Die Wiederaufnahme des Fadens vom letzten Mal war somit ein seltenes Vorgehen, was meinem Therapeuten auch sicher nicht entgangen war. Viele Themen waren in seinen Augen spannend und hatten durchaus Potenzial für wochenlangen Gesprächsstoff. Ich jedoch war sehr schnell gelangweilt und mit dem verlorenen Interesse schwand auch meine Motivation, überhaupt den Mund aufzumachen. Aus dem Wortwechsel darüber versprach ich mir sowieso keine neuen Erkenntnisse, schon gar keine Besserung. Daher gehörten die meisten Themen für mich in die Sparte „irrelevant“ und verdienten es somit nicht, mehrere Sitzungen hintereinander zu füllen. So erging es mir mit verschiedenen alltäglichen Situationen. Mit den Wochen sprach ich weder über die Arbeit noch über mein Privatleben, meine Hobbys oder meine Vergangenheit. Alles war in meinen Augen bereits besprochen worden und endete in Wiederholungen und letztlich in Zeitverschwendung. So kam es, dass es mir immer schwerer fiel, etwas zu sagen und so ein Gespräch ins Rollen zu bringen. Natürlich war mir dieser Umstand aufgefallen und ich sprach dies auch beim Doc und meinem Physiotherapeuten an. Beide rieten mir, dranzubleiben und dies meinem Therapeuten auch zu sagen. Schließlich mussten wir miteinander kommunizieren. Doch ich sah weiterhin keinen Sinn dahinter und blieb daher wortkarg. Es gab trotzdem Sitzungen, die besser verliefen als andere. Manchmal fand ich doch etwas zum Erzählen, was dann wiederum zu Gesprächen führte. Doch schon beim nächsten Termin hatte ich das letzte Thema zwar nicht vergessen, es aber bereits als abgehakt markiert. Schließlich stellte ich eine weitere Veränderung fest, die mich anfangs etwas verwunderte, die ich aber zuließ: Ich fing an komplett zu verstummen. Mir war plötzlich alles egal und ich sah nicht den geringsten Sinn in der Therapie. Entsprechend fand ich keinen Grund, auch nur ein Wort zu sagen, außer zur Begrüßung und zum Abschied. Zuerst schaffte ich es noch in einer von drei Sitzungen, etwas zu sagen, doch schon bald sprach ich in keiner mehr. Mein Therapeut versuchte noch etwas aus mir herauszubekommen, doch die Motivation war in meinen Augen eher grenzwertig und daher blieb es ohne Erfolg. Nach ein paar Wochen musste ich bereits feststellen, warum ich verstummt und gleichzeitig komplett gleichgültig geworden war: Zu den wöchentlichen Terminen in meinem strengen Zeitplan gehörte weiterhin die Physiotherapie. Auch hier waren mir schon lange Dinge aufgefallen, die mich schlicht nervten. Normalerweise lag ich 30 Minuten im Fango (warmes Moor) und hatte danach 30 Minuten manuelle Therapie. Doch aus der halben Stunde Fango wurden immer häufiger 40 bis 45 Minuten, was mich immens ärgerte, da sich die manuelle Therapie entsprechend verkürzte und somit die Chance verringerte, schmerzfrei zu werden. Mir fiel auf, dass mein Physiotherapeut in meiner Zeit mit anderen Patienten sprach, Termine vereinbarte, verwaltungstechnische Aufgaben oder Sonstiges erledigte. Nur mit viel Glück kam ich auf knapp über 20 Minuten Behandlung. Und wenn es ihm einmal aufgefallen war, dann versprach er mir zwar, die Zeit anzuhängen, tat dies dann aber nicht, sondern hörte pünktlich mit der Behandlung auf. Irgendwann riss mir der Geduldsfaden und ich schrieb einen wütenden Brief an meine Krankenkasse, der sich über drei Seiten erstreckte. Mir war wichtig, dass ich niemanden persönlich angriff, aber ich wollte trotzdem, dass rüberkam, dass ich mehr als verärgert über die mangelnde Unterstützung war. Nur vier Tage später hatte ich bereits eine Zuständige am Telefon, die sich ausführlich mit mir über meine Unzufriedenheit unterhielt. Sie erklärte mir zuerst die gesetzlichen Änderungen und warum diese eingeführt worden waren. Erst gegen Ende stellten wir fest, dass wir anfangs aneinander vorbeigeredet hatten und ich somit tatsächlich eine Verbesserung in der Behandlung erzielen konnte: Seit Beginn der Physiotherapie hatte ich eine Doppelbehandlung bekommen, damit mein Physiotherapeut in Ruhe an meinem Kiefer arbeiten konnte. Diese fing an mit 60 Minuten (ohne Fango). Nach der gesetzlichen Kürzung hatte sich die Doppelbehandlung auf 30 Minuten verkürzt (Einzelbehandlung also 15 Minuten). Dass in dieser Spanne so gut wie nichts erreicht werden konnte, war auch der Mitarbeiterin der Kasse bewusst. Doch in Wirklichkeit war es so, dass die 15 Minuten lediglich die Mindestzeit waren. Ich hatte somit das Recht auf maximal 25 Minuten für eine einzelne Behandlung. Doppelt genommen wären das logischerweise 50 Minuten, was mir enorm helfen konnte. Zudem musste die Dame verärgert feststellen, dass die „Erledigungen“ meines Physiotherapeuten nicht in meine Therapiezeit gelegt werden durften. Das, was er da machen würde, wäre verboten und müsste von ihm eingestellt werden. Sinn ergab das auf jeden Fall und mit dem Argument: „Dann muss er seine Terminierung eben entsprechend anpassen!“ überzeugte sie mich vollends, da dies auch schon der Doc gesagt hatte. Am Ende des Gesprächs war ich nicht nur erleichtert, sondern auch froh, dass ich mir die Zeit für die wütende E-Mail genommen hatte. Entsprechend motiviert schrieb ich sofort meinem Physiotherapeuten und teilte ihm die guten Neuigkeiten mit. Natürlich ließ ich ihm die zeitliche Erweiterung offen, aber optimistisch war ich doch. Schließlich wollte er sicher auch, dass ich endlich beschwerdefrei würde und somit endlich gute Nachrichten für ihn hätte. Nämlich, dass ich seit der letzten Therapiestunde keine Schmerzen mehr gehabt hatte. Selten sollte ich mich so in der Erwartung einer Reaktion getäuscht haben … Entgegen meiner Erwartungen kam keine Antwort auf meine E-Mail. Bei meinem nächsten Termin sprach mich mein Physiotherapeut direkt auf diese an, doch ich merkte sofort, dass er weder erfreut noch erleichtert war. Er war das komplette Gegenteil: Es fiel ihm schwer, seinen Ärger unter Kontrolle zu halten. Ich wusste von der ersten Sekunde an, dass ich mir umsonst Hoffnungen gemacht hatte, und hörte deshalb mit versteinertem Blick seinen wütenden Ausführungen zu. Seiner Meinung nach hätte mir die Kasse nur Blödsinn erzählt. Er hätte sehr wohl das Recht, seine Verwaltung in meiner Zeit zu erledigen, da er sonst nie die Möglichkeit dazu haben würde. Zudem wäre es eine Unverschämtheit, dass mich die Kasse mit diesen Erklärungen angelogen hätte. Sie hätten offenbar keine Ahnung, wie es wirklich laufen würde. Während seines kontrollierten Wutausbruchs bestand er vehement darauf, dass ich ihm eine Vergleichsfrage beantworten würde. Nämlich ob ich dazu bereit wäre, 25 Stunden mehr in der Woche umsonst für meinen Chef zu arbeiten. Genau das würde ich nämlich von ihm verlangen. Ich hingegen lehnte mich nur enttäuscht weg und brachte ein zerknirschtes „Ich wusste, dass Sie das sagen würden“ heraus. Verdächtig machte er sich allerdings mit seinem sofortigen Angebot, mir einen neuen Physiotherapeuten zu suchen, der sich möglicherweise die nötige Zeit nehmen könnte, die ich mir erhofft hatte. Ihn persönlich würde ich damit nicht treffen, zudem mein Platz sofort wieder besetzt werden würde. Dass er damit acht Jahre einfach so wegwarf, in denen ich angenommen hatte, dass er sich für mein Wohlergehen interessieren würde, schien ihm gar nicht bewusst zu sein. Ich war anfangs entsetzt über diese leichtfertige Aussage, hatte es aber meinem aktuellen psychischen Zustand zu verdanken, dass ich ruhig blieb. Doch für mich war nun klar geworden: Ich war meinem Physiotherapeuten offenbar völlig egal. Es interessierte ihn überhaupt nicht, ob ich eines Tages beschwerdefrei werden könnte. All die Jahre, in denen ich ihm von meinen Problemen erzählt hatte, all die Jahre, in denen ich mich ihm geöffnet hatte, und all die Jahre, in denen ich ihn zu meinen engsten Vertrauten gezählt hatte, waren mit einem Mal unwichtig geworden. Hier stand ich also, gebrochen und in meinem Menschenbild erschüttert. Anfangs hatte seine leichtfertige Bereitschaft, mich gehen zu lassen, dafür gesorgt, dass ich an mir selbst zweifelte. Doch nur kurze Zeit später musste ich erfahren, dass das nicht alles gewesen sein sollte. Natürlich sprach ich mit dem Doc über die jüngsten Ereignisse. Er war ebenfalls erschüttert darüber. Jedoch nicht wegen des fehlenden Interesses an meinem Wohlbefinden seitens meines Physiotherapeuten, sondern wegen seines Vorgehens generell. Denn wie sich herausstellte, hatte die Kasse recht behalten und mein Physiotherapeut hatte somit seit der gesetzlichen Anpassung der Heilmittelverordnungen offenen Abrechnungsbetrug begangen. Der Doc machte mir klar, dass die Aufdeckung der Machenschaften meines Physiotherapeuten dazu führen konnte, dass dieser seine Zulassung verlieren würde. „Es sind schon Leute wegen weniger ins Gefängnis gekommen“, war sein klares Statement hierzu. Nun hatte ich endlich den Grund für mein Verstummen und meine Anpassung zur Gleichgültigkeit gefunden. Offenbar hatte ich instinktiv gemerkt, dass ich bald einen großen Vertrauensbruch würde durchleben müssen, und hatte mich daher darauf vorbereitet. Entsprechend blieb ich ruhig, auch wenn ich anfangs sehr wütend war. So wütend, dass ich erst nach langem Zureden meines Therapeuten darüber sprach. Er hatte gemerkt, dass etwas nicht stimmte, tat sich aber schwer, überhaupt etwas aus mir herauszubekommen. Nach meinen Erläuterungen wurde ihm einiges klar und auch bewusst, was das mit mir gemacht hatte. Trotzdem hatte ich nur zwecks dieser Erklärung gesprochen und verstummte danach erneut. Nun sah ich erst recht keinen Sinn mehr hinter der Therapie, da sich erneut gezeigt hatte, dass es falsch war, Menschen zu vertrauen. Das frisch gefasste Vertrauen zu meinem Therapeuten hatte ich zurückziehen müssen, was ich ihm auch sagte. Nur noch der Doc war übrig, dem ich allerdings nicht zumuten wollte, nun allein für mich da sein zu müssen. Doch für mich war klar: Alle Menschen waren falsch, egoistisch und interessierten sich nicht im Geringsten für das Wohl anderer. Genau wie ich das tat, sofern mir nicht wirklich jemand am Herzen lag. Warum sollte ich mich also bemühen, wenn es umgekehrt ebenfalls niemand tat? Nur ein einziges Mal hatte es den Anschein, als ob doch ein Neustart des erkalteten Motors gelingen könnte. Dabei half mir wieder das Zeichnen, als Art der Verarbeitung. Kurz nach dem Bruch mit meinem Physiotherapeuten setzte ich mich, laut Musik hörend, an den Block und hörte erst auf, als das Bild (siehe Abbildung nächste Seite) fertig war. Mein Therapeut war sehr interessiert an dem vollendeten Werk, das ich ihm nicht vorenthielt. Ich hatte das jüngste Ereignis einigermaßen überwunden, behielt Erklärungen trotzdem erst einmal für mich. Ganz seiner Selbstüberschätzung entsprechend, vertiefte sich mein Therapeut in das Bild und sagte minutenlang kein Wort. Erst auf meine Nachfrage hin beschrieb er mir seine offensichtliche Sprachlosigkeit, die er mir auch danach erklärte: Angeblich hatte er ein solch ähnliches Bild immer wieder vor seinem inneren Auge gehabt, als wir uns unterhalten hatten bzw. als ich verstummt war. Dass er dieses nun live und in Schwarz-Weiß in Händen hielt, war für ihn eine große Überraschung. Diese Offenbarung glaubte ich ihm nicht eine Sekunde, behielt meine Skepsis aber für mich. Inzwischen war ich an die Fantastereien gewöhnt und nahm sie einfach hin. Daher beschrieb ich ihm in knappen Worten, dass jeder der einzelnen Schattenmänner einen meiner Vertrauten darstellte. Der sich in Flammen und Rauch auflösende war logischerweise mein Physiotherapeut. Der verschwindende mein Therapeut und der unberührte der Doc. Wie bereits erwähnt, hatte ich das Vertrauen, das ich zu meinem Therapeuten gefasst hatte, mit dem letzten Bruch zurückgezogen. Somit löste er sich aus dem „Elitenrat“. Lediglich der Doc stand noch schützend vor mir, konnte jedoch auch nicht verhindern, dass mich die andauernden Vertrauensbrüche immer mehr zerstörten und dafür sorgten, dass ich mich auflöste – wenn auch nur innerlich. Meine Beschreibungen gefielen meinem Therapeuten zwar, doch die Faszination für seine „Vorhersage“ beherrschte diese Unterhaltung so sehr, dass ich relativ schnell wieder verstummte. Das Bild blieb in bei den nachfolgenden Terminen unerwähnt und die gewohnte unangenehme Ruhe kehrte wieder ein
Fazit. Als ich mich nach einer langen Pause wieder mit diesem Buch beschäftigt habe, kam ich natürlich nicht um das Korrekturlesen herum. Dabei ließ mich beim Lesen des wütenden Briefes an meinen letzten Therapeuten ein Gedanke nicht los: Die abschließende vernichtende Beurteilung der Psychotherapie würde sich ziemlich gut für das Schlusswort eignen. Also habe ich mir die Freiheit genommen und nehme mich selbst als „Paradebeispiel“: Viele erwarten sich vor einer Psychotherapie sehr viel, doch meistens ist das ein Trugschluss. Auch ich habe meiner Fantasie etwas zu viel Freiraum gelassen, auch wenn mich mein Instinkt, meine Rationalität und meine Kognition vor so manchen Tricks bewahrt haben. Ich habe jede ambulante Therapie in dem Glauben begonnen, interessante und Augen öffnende Gespräche führen zu können. Erkenntnisse sollten natürlich auch von mir kommen, doch alles unter der Führung des Therapeuten. Gezielte Fragen, Anmerkungen und Erklärungen sollten mir somit die Augen öffnen und so einigen Beobachtungen meinerseits Sinn verleihen. Die kleine Hoffnung, auch meine Amnesie lösen zu können, war zwar stets da, doch ich hatte nie die Komplexität dieses Problems außer Acht gelassen. Doch in Wahrheit musste ich mich selbst unterhalten. Ich führte in jeder Sitzung Selbstgespräche und hatte dabei die Möglichkeit, meinen stummen Zuhörer beobachten zu können. Kam es doch einmal zu richtigen Gesprächen, war deren Inhalt banal und absolut irrelevant für die Therapie selbst. Wurden doch Fragen gestellt und Anmerkungen gemacht, basierten diese auf Feststellungen, die ich zuvor selbst gemacht hatte. Dabei war es egal, ob ich dies in derselben Sitzung oder in einer davor ausgesprochen hatte. Offenbar basiert eine „erfolgreiche“ Therapie auf einem grauenvollen Gedächtnis des Patienten, da wohl vorausgesetzt wird, dass er sich an zurückliegende Sitzungen nicht mehr erinnern kann. Wie ein Mentalist sitzt der Therapeut dann vor dem Patienten und offenbart ihm eine bahnbrechende Erkenntnis bzw. Beobachtung, die der Patient selbst allerdings nur kurze Zeit vorher von selbst hervorgebracht hat. Die meisten fallen auf dieses „Augenöffnen“ herein und baden den Therapeuten damit in Respekt und Hochachtung. Wird der Therapeut aber erwischt und auf diesen offensichtlichen Trick und dessen Scheitern angesprochen, so reagiert er mit Wut und dem Vorwurf der Lüge – natürlich seitens des Patienten. Schlussendlich steht Aussage gegen Aussage und den Kürzeren zieht der Patient. Er ist schließlich der Kranke und bedarf der Heilung. Dieses „löchrige“ Gedächtnis ist dann nur der Beweis für die dringend benötigte professionelle Hilfe. Dieses Vorgehen findet sich übrigens auch bei Astrologen, Hellsehern und ähnlichen Betrügern. Lediglich ehrliche Mentalisten geben zu, wie sie sich ihr scheinbares Wissen aneignen: Astrologen, zum Beispiel, glauben fest an einen Zusammenhang zwischen den Sternen und jedem einzelnen Menschen. Sie messen Sternzeichen und den damit verbundenen individuellen Personenbeschreibungen eine große Rolle zu. In Wahrheit ist es jedem einzelnen Stern, Planeten und sonstigen Mitglied unserer Galaxie völlig egal, was auf unserem unbedeutenden blauen Planet passiert. Das Universum ist wahrlich zu groß, als dass sich so viele Gestirne um eine einzige Person kümmern, geschweige denn diese beeinflussen könnten. Experimente mit individuellen Beschreibungen zu den Sternbildern haben Erstaunliches, aber gleichzeitig wenig Verwunderliches zutage gebracht. Astrologen geben vor, anhand von Sternzeichen ein detailliertes Profil der betreffenden Person erstellen zu können. Der Leser, der an diese Charakterdarstellung mittels Sternzeichen glaubt, wird sich mit großem Erstaunen in dem Geschriebenen wiederfinden. Doch wird ihm heimlich ein Profil eines anderen Sternzeichens untergejubelt, wird die Begeisterung nicht geringer ausfallen. Doch wie können die Beschreibungen präzise sein, wenn diese nur für ein bestimmtes Sternzeichen gelten und nicht für ein anderes? Der Trick dahinter ist einfach, effektiv und wird von Betrügern gern genutzt: Es wird schlichtweg alles in den Text geworfen, was dem Kreierenden einfällt. Den Rest macht dann der Leser. Hierzu ein Beispiel: „Sie umgeben sich gern mit Menschen und genießen die Gemeinschaft. Doch sind Sie gegenüber Ruhe ebenfalls nicht abgeneigt und beschäftigen sich daher gern auch mal allein.“ Hier finden sich sowohl Intro- als auch Extrovertierte. Denn das Zutreffende versperrt durch den scheinbaren Treffer die Sicht auf das Unzutreffende. Dieses wird einfach ausgeblendet und ignoriert. Zurück bleibt pure Faszination und Begeisterung. Wie bereits erwähnt, ist das auch mit der Psychotherapie nicht anders, allerdings nicht so durchdacht. Bei den ersten Terminen macht sich der Therapeut durch die Berichte des Patienten ein grobes Bild der Situation. Was der Patient aber nicht weiß: Gedanklich hat sich der Therapeut bereits an einer Diagnose festgebissen und erstellt einen inneren Plan für die Behandlung, die streng nach Lehrbuch erfolgen soll. Dass diese immer gleich abläuft, weiß der „ungebildete, naive Patient“ natürlich nicht. Schließlich sollte er die Integrität der „letzten Rettung“ nicht untergraben und somit nicht ausbleibende Hilfe riskieren. Was der Therapeut bewusst ignoriert: Durch anfängliche Skepsis, fehlendes Vertrauen, Unsicherheit, Verzweiflung und/oder mangelndes Selbstvertrauen erzählt der Patient anfangs nur grob, worin sein Problem besteht. Doch das Bild ist dann sowieso schon geformt, die Einstellung gegenüber dem Patienten unveränderlich gefestigt und die Meinung des Therapeuten nicht mehr beeinflussbar. Was bedeutet das für den Patienten? Ist er tatsächlich so naiv, wie der Therapeut hofft, wird er sich widerstandslos gemäß dessen Leitfaden entlangführen lassen. Unter Ignoranz und Selbstüberschätzung kommentiert der Therapeut zu zufällig gewählten Zeitpunkten, dass Fortschritte zu verzeichnen seien und der Patient sich somit auf dem Weg der Besserung befinde. Um jedoch eine nicht allzu kurze Abhängigkeit zu riskieren, wird sogleich ein langer, steiniger Weg prognostiziert. Jedoch nicht ohne zu untermauern, dass der steinige trotzdem der richtige Weg ist. Dabei sind die bisherigen Erfolge natürlich nicht zu verachten, jedoch nur kleine Schritte im Vergleich zu dem noch bevorstehenden harten Aufstieg zur ersehnten Gesundheit. Schon bald entsteht tatsächlich eine Abhängigkeit, da der Patient sich schnell an die regelmäßigen Momente gewöhnt, in denen ihm ein offenes Ohr und Verständnis entgegengebracht werden – wenn auch vorgespielt. Jegliches Hinterfragen der einzelnen Situationen wird oft rasch abgeschaltet, denn die scheinbare „Geborgenheit“ hat die Oberhand gewonnen und wird daher gern akzeptiert. Währenddessen sollen platzierte Kommentare während des Erzählens seitens des Therapeuten, wie z. B. „Das ist so traurig“ oder „Ist Ihnen klar, dass Sie Schreckliches überlebt haben?“, für die nötige Anteilnahme sorgen und stellen gleichzeitig eine Einladung zu Gefühlsausbrüchen dar. Mit Glück führt Mitleid tatsächlich zu Tränen und schlussendlich zu dem lang ersehnten „Öffnen des Ventils“. Dieser Erfolg kann zufrieden verbucht werden, um dann später als „Schlüsselmoment“ verkauft werden zu können. In der Fantasie des Therapeuten soll diese Mischung aus Öffnen, Vertrauen, Emotionen und Zeit dafür sorgen, dass der Patient irgendwann jeglichen störenden Bezug zu dem zu behandelnden Teil seiner Geschichte verloren hat. Die psychische Belastung wird mithilfe von absurden Erklärungen, sinnfreien Tricks und kindischen Beschäftigungen verdrängt. Erstaunlich ist dabei, dass es trotzdem offensichtlich bleibt, wie wenig Interesse an den Belangen des Patienten besteht. Denn das eigene Ego soll schließlich gepusht werden. Daher wird kurz Mitgefühl und Sorge vorgespielt, damit sich die beginnende Skepsis des Patienten schnell wieder auflöst. Das heißt jedoch nicht, dass nun aktiv dabei geholfen wird, eine Genesung zu erreichen. Weiterhin wird nur den Selbstgesprächen gelauscht. Patienten, die offene Fragen haben, müssen damit leben, dass diese auch weiterhin nie beantwortet werden können. Wer hat denn gesagt, dass eine professionelle Meinung weiterhelfen könnte? Der Patient muss selbst auf alle Lösungen kommen und muss hoffen, dass diesen ein zufälliges Nicken oder Lächeln als Zustimmung geschenkt wird. Doch nicht nur die Probleme des Patienten werden überspielt und mit gespielter Anteilnahme kommentiert. Die Persönlichkeit des Patienten an sich ist wohl das Uninteressanteste an der ganzen Therapie. Was soll es dem Therapeuten auch bringen, sich in sein Gegenüber hineinzuversetzen, wenn er das auch durch Vermutungen tun kann? Schließlich wird doch immer er recht behalten, daher kann der erwähnte Umweg ruhig ignoriert werden. Patienten beginnen die Therapie jedoch mit der Hoffnung, dass sich endlich jemand die Zeit nehmen wird, ihn richtig kennenzulernen. Das mag bei kleineren psychischen Problemen wie Trauer, Beziehungsproblemen oder Ähnlichem durchaus funktionieren. Warum? Eine Therapie nimmt zu Anfang in der Regel 120 bis 160 Sitzungen in Anspruch, wobei die Diagnose natürlich eine Rolle spielt. Auch der Abstand zwischen den einzelnen Sitzungen ist ausschlaggebend. In den oben genannten akuten Problematiken ist vermutlich eine Frequenz von anfangs einer Sitzung pro Woche und schließlich eine Sitzung alle zwei Wochen angebracht. Hochgerechnet ergibt sich somit ein sehr langer Zeitraum, in dem der Patient sich auf einen Zuhörer verlassen kann. Dabei erzählt er von seinem Leben, von seinem Alltag und von seinem Umfeld. Während er also berichtet, wird ihm im Idealfall klar, wie viel Unterstützung er eigentlich hat. Der Therapeut muss nur noch dafür sorgen, dass der Patient seine Ausführungen wiederholt und sich somit öfter ins Gedächtnis ruft, was er hat und was ihm fehlt. So wird das Negative vom Positiven wettgemacht, was wiederum zu einer Besserung führt. Beim Lernen sollen wir auch den Stoff immer und immer wieder wiederholen. So gelangt das zu Lernende vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis. Rufen wir uns nun immer wieder ins Gedächtnis, dass wir eine Familie oder Freunde haben oder einen gut laufenden Job, vielleicht ein erfüllendes Hobby oder ein liebenswürdiges Haustier? Es findet sich bestimmt irgendetwas, wofür es sich lohnt, seine ständige Aufmerksamkeit darauf zu richten. Der Fokus wird somit gedreht, sodass sich der Patient irgendwann sagt: „Ich mag dieses verloren haben, doch jenes habe ich behalten und weiß es nun noch mehr zu schätzen.“ Doch was ist, wenn das eben nicht funktioniert? Was, wenn es keine Familie, keine Freunde, keine Haustiere, keine Hobbys oder keine Aufgaben gibt, die es hervorzuheben gilt? Dann wird die Sache schon schwieriger. Denn es gibt nun keine Möglichkeit mehr, den Blick auf etwas anderes zu lenken. Das funktioniert, wie gesagt, bei Trennungsschmerz oder ähnlichen Belangen. Und selbst wenn das Ziel nicht fehlt, wäre da noch das Problem der individuellen Persönlichkeit. Denn je komplexer, desto schwieriger. Doch auch hier hat der Therapeut Methoden, um die Unterordnung des Patienten zu gewährleisten: Angst. Diese Emotion wird sowohl als Drohung als auch als Ausrede sowie als Angriff genutzt – es kommt ganz auf die Situation an. Die Drohung erfolgt in manchen Therapieformen bereits am Anfang. Hierbei wird vorausgesagt, dass der Patient im Laufe der Therapie an einen Punkt kommen wird, an dem er aufgeben möchte. Die Last wird an diesem Punkt so enorm werden, dass er flüchten und somit alles Vorige wegwerfen möchte. Genau dieser Punkt wird als Wendepunkt und somit als wichtigster Moment der ganzen Therapie beworben. Genau hier wäre es wichtig, der Angst nicht nachzugeben, sondern Mut zu zeigen und mit zusammengebissenen Zähnen weiterzumachen. Erst dann wäre ein Erfolg ersichtlich. Mit der Androhung dieser Emotion wird schon zu Anfang getestet, ob es der Patient ernst meint. Die Angst als Ausrede ist eine der lächerlichsten Behandlungsmethoden, die es in der Psychotherapie überhaupt gibt – allerdings eröffnet sie einem aufmerksamen Patienten Einblicke in die Einstellung des Therapeuten ihm gegenüber. Genauer gesagt ist die „Ausreden-Angst“ ein gern genutztes Argument für alles Mögliche. Nicht nur Angehörige oder Bekannte, auch Ärzte nutzen dieses sehr gern. Ich selbst habe es mir sehr oft anhören müssen, wenn ich nach Hilfe gesucht habe. Immer wieder kam der Satz: „Sie sind eine junge Frau, die schnell zur Angst und Panik neigt. Da kommen solche Symptome schon einmal vor.“ Dass ihnen eine ruhige, skeptische Person gegenübersaß und eben keine in Tränen aufgelöste mit verängstigtem Blick, war ihnen dabei egal – Fall gelöst, der Nächste bitte. In der Psychotherapie wird die Angst immer dann als Ausrede genutzt, wenn der Patient keine Antwort parat oder er eine Aufgabenstellung nicht durchgeführt hat. Natürlich kann der Grund hierfür tatsächlich Angst sein, aber gewiss nicht jedes Mal. Manchmal findet er einfach keine Antwort. Oder er hat diese schon Dutzende Male gegeben und erwartet, dass der Therapeut diese bereits kennt. Daher ist er es leid, die Frage schon wieder beantworten zu müssen. Aufgaben können ebenfalls aus Angst nicht bewältigt werden, z. B. wenn es um Phobien geht. Aber auch hier kann es schlichtweg sein, dass der Patient einfach keine Lust hatte, die Aufgabe zu erfüllen. Vielleicht hat die Motivation gefehlt, der Sinn oder die Zeit. Wenn er mutig und selbstbewusst ist, wird er das dem Therapeuten sagen. Allerdings ist dann trotzdem nicht gewährleistet, ob ihm das geglaubt wird oder nicht. Denn mit dem Argument Angst lässt sich eine sehr gute Brücke bauen zu deren Ursachen. Diese wiederum führt zu einem Thema, über das der Patient aus verschiedenen Gründen nicht sprechen möchte, der Therapeut aber schon. Das hat den günstigen Effekt, dass der Patient auf dem geplanten Weg bleibt, sollte er etwas davon abgedriftet sein. Aber das bloße Fallenlassen des Wortes „Angst“ kontrolliert den Patienten natürlich nicht. Wird es falsch genutzt, kann es sogar zum Verstummen des Patienten führen. Doch in der ruhigen Phase kann sich der Patient dann vor Augen führen, wie schlecht ihn der Therapeut kennt, da ihm offenbar das Feingefühl fehlt bzw. nie vorhanden war. Die Methoden von Therapeuten sind sowieso enorm fragwürdig. Es fängt alles mit dem Vortäuschen von Sorge und tiefem Interesse an den Problemen des Patienten an. Hiermit möchte er eine Vertrauensbasis schaffen, die dann im Laufe der Therapie zu einem festen und beinahe unzerbrechlichen Vertrauensverhältnis führt – im Idealfall. Der Patient bekommt dann das warme Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit, was wiederum seine Abhängigkeit fördert. Da er nun einem engen Vertrauten gegenübersitzt, sprudeln die Informationen nur so aus dem Patienten heraus, was sich der Therapeut dann eifrig zunutze macht. Mit viel Glück redet sich der Patient fast schon in Rage, löst Knoten und schlittert ungewollt an seine Probleme heran, prallt mit ihnen zusammen und muss sich so mit ihnen auseinandersetzen. Der Therapeut sieht diesem Schauspiel stolz zu, während er sich selbst gedanklich auf die Schulter klopft. Aber was, wenn genau das nicht passiert? Was, wenn der Patient keinen Sinn hinter einer Therapie sieht, in der nur er spricht und sich lediglich die Umgebung, nicht aber die Situation geändert hat? Er führt fast schon Selbstgespräche, wird allerdings dabei beobachtet, was das Ganze eher unangenehm macht, statt befreiend zu wirken. Im Idealfall wird der Therapeut versuchen, sich dem stummen Patienten verbal zu nähern, indem er sein Wissen über ihn zu Hilfe nimmt. Er kann z. B. bereits diskutierte Themen nutzen und fragen, ob es daran liegt, dass der Patient so still ist. Vielleicht hat er auch gut aufgepasst und weiß, was der Patient mit der Stille sagen möchte. Möchte er in Ruhe gelassen werden? Möchte er zum Sprechen überredet werden? Möchte er einen kleinen Schubser bekommen? Belastet ihn vielleicht etwas, über das er ohne Hilfestellung nicht reden kann? Der Therapeut steckt durchaus in einer Zwickmühle, da jedes Verhalten Gefahren birgt. Doch hat er sich ernsthaft mit der Persönlichkeit des Patienten auseinandergesetzt, weiß er damit umzugehen. Besonders angriffslustige und von sich selbst überzeugte Therapeuten sehen eine plötzlich einsetzende Stille jedoch als Machtspiel an. Die verweigerte Kommunikation wird als Herausforderung angesehen, die natürlich angenommen wird. Die Prüfung der Geduld und Professionalität muss unbedingt gewonnen werden. Wenn dadurch der Patient und seine aktuellen Sorgen in den Hintergrund rücken müssen, dann ist das ein Opfer, das gern gebracht wird – Hauptsache das eigene Ego wird gestärkt. Doch wie kommt es zu dieser Entwicklung des Zweikampfes? Die Vorstellung, dass Therapeut und Patient mit der Zeit beste Freunde werden und sich alles erzählen können, ist reine Fantasie. Auch auf komplette Seriosität zu hoffen, ist mehr naiv als hilfreich. Therapeuten verkaufen gern eine Fähigkeit an den Patienten, die jedoch mehr dem Wunsch als der Realität entspricht: totale Abgrenzung von dem Patienten. Was heißt das genau? Im Grunde widersprechen sich die Therapeuten in ihren eigenen Ausführungen und ihrem Umgang mit den Patienten. So gaukeln sie in den Sitzungen Mitgefühl, Anteilnahme und Sorge vor, um dem Patienten das Gefühl zu geben, in seiner Situation nicht allein zu sein. Wenn die Stimmung doch etwas aufbrausender wird, geben sie sich wiederum ruhig, entspannt und unantastbar. Doch nur nach außen hin und unsichtbar – sofern der Patient zu sehr auf sich selbst fokussiert ist und es infolgedessen nicht mitbekommt. Allerdings wird irgendwann der Punkt kommen, an dem selbst die beste Fassade bröckelt und sich schließlich auflöst – und das nicht bei dem Patienten. Wenn man nicht gerade ein Psychopath ist, ist es unmöglich, nicht emotional involviert zu werden. Somit kann ein Therapeut keinerlei Emotionen empfinden, wenn er dem Patienten zuhört. Die für ihn bzw. die Behandlung wichtigen Emotionen werden sogar an den Patienten verkauft. Schon zu Anfang prahlt er mit seiner Fähigkeit, jeden an Empathie übertreffen zu können. Alle Mauern sind somit bedroht und sogar durchsichtig – zumindest für den mitfühlenden Röntgenblick des Therapeuten, der sich mit der Zeit sicher in eine Abrissbirne verwandeln wird. So etwas mag sich in der Theorie toll anhören, doch die Praxis sieht gewöhnlich anders aus. Natürlich profitiert der Patient von dem Verständnis und Mitgefühl des Therapeuten. Allerdings kommt es auf die Ausprägung, Dauer und Echtheit an. Dem Patienten bringt es nur temporäre Erleichterung, wenn der Therapeut die Ausführungen lediglich spiegelt, um Anteilnahme zu suggerieren. Sofort fühlt sich der Patient verstanden, atmet innerlich auf und öffnet sich – im Idealfall zugunsten des Therapeuten – noch mehr. Diese „Notlüge“ ist der Professionalität geschuldet, weswegen sie nicht unbedingt schlecht sein muss. Viele Berufe verlangen von dem Ausübenden, dass er eine emotionale Distanz wahrt. Sonst würde er Gefahr laufen, daran zu zerbrechen und selbst therapeutische Hilfe zu benötigen. Auch dem Patienten wäre es wohl früher oder später unangenehm, auf emotionaler Ebene den Spiegel oder noch Schlimmeres vorgehalten zu bekommen. Wobei der Gesichtsausdruck sicher unbezahlbar wäre, wenn der Therapeut plötzlich anfangen würde, bitterlich zu weinen, weil ihn das Gehörte zu sehr mitgenommen hat. Kurz: Professionalität wird in einer Therapie benötigt, aber keine Freundschaft. Der Patient mag hin und wieder in Watte gepackt werden, doch ehrliche Worte und Konfrontationen sind ebenso Inhalt einer Therapie. Aber was, wenn die Emotionen des Therapeuten doch die Oberhand gewinnen? Bei aller Professionalität kommt doch irgendwann der Punkt, an dem er seine wahren Gefühle nicht mehr verbergen kann. Das obligatorische „Die Arbeit wird nicht mit nach Hause genommen“ ist dabei eine gern genutzte Lüge, die zuerst auffliegt. Vielleicht ist der Patient ausfallend gegenüber dem Therapeuten geworden. Oder er verweigert jegliche Mitarbeit. Vielleicht gibt ein privates Ereignis den Ausschlag für eine plötzliche Verhaltensänderung des Therapeuten. Was es auch ist: Ohne Vorwarnung sieht sich der Therapeut selbst auf dem Prüfstand und liegt, metaphorisch gesprochen, „auf der Couch“ – und das gefällt ihm ganz und gar nicht. Nun gilt es richtig zu handeln und sich selbst zu analysieren und zu therapieren. Doch leider passiert mit großer Wahrscheinlichkeit genau das, was wohl schon jeder in irgendeiner Form beobachten musste: Jemand anderes ist an der eignen Misere schuld – in diesem Fall der Patient. Das Verlieren der Geduld und der Motivation, steigendes Desinteresse, Kränkung, Wut oder Enttäuschung lässt sich vor einem aufmerksamen Patienten nur selten verbergen. Ist dieser dann auch noch mutig genug, seine Beobachtung anzusprechen, sticht er in ein sprichwörtliches Wespennest. Denn nun fürchtet der Therapeut um seine Macht und einen Kontrollverlust. Auch die Erkenntnis der eigenen Fehlbarkeit lässt bei vielen die Sicherungen durchbrennen. Schließlich hat der Therapeut doch stolz Geduld, Empathie und Durchhaltevermögen als seine höchsten Tugenden gepriesen. In Wahrheit fürchtet der Patient lediglich um das erfolgreiche Fortschreiten der Therapie. Schließlich sollen seine Probleme und seine Person im Mittelpunkt stehen. Doch mit dem augenscheinlich drohenden Verlust der dringend benötigten Hilfe scheint diese in unerreichbare Ferne zu rücken. Im schlimmsten Fall wird der Patient ab dem Moment der vorsichtigen Nachfrage nach dem Grund für die vermuteten Schwankungen mit Vorwürfen bombardiert. Aus Rache vor dem Untergraben der therapeutischen Integrität muss diese nun noch deutlicher hervorgehoben werden: Am laufenden Band werden dem Patienten zusammenhanglose Erklärungen für sein Verhalten an den Kopf geworfen. Plötzlich gibt es für alles eine Erklärung, für die vor dem Gefühlsausbruch jahrelange Arbeit prognostiziert worden war. Jegliches Hinterfragen und Verweisen des Patienten auf die wachsenden Widersprüche werden als Lüge abgetan, gepaart mit dem Vorwurf der Angst und der Vermeidung. Man bedenke hierbei, dass laute Gegenwehr ein Indiz dafür ist, dass die Vorwürfe einen Nerv getroffen haben und somit die Schuld eben nicht beim Patienten zu suchen ist. Wie ein Raubtier, das in die Ecke getrieben wurde, wehrt sich der Therapeut gegen die vermeintlichen Angriffe. Er möchte nicht zum Patienten gemacht werden und opfert mit seiner Abwehr sogar das hart erarbeitete Vertrauen des Patienten zu ihm – solange er nur recht behält. In einer etwas milderen Form bleibt der rachsüchtige Angriff auf den Patienten aus. Beginnend mit der Nachfrage des Patienten, was denn der Grund für die vermeintlichen Missstände sein könnte, läuft es wie gewohnt. Der Patient muss selbst Vermutungen anstellen. Aus diesen sucht sich der Therapeut dann eine oder mehrere aus und bestätigt sie. Ob sie der Wahrheit entsprechen, obliegt ganz der Ehrlichkeit des Therapeuten. Vielleicht führt er sie weiter aus und versucht auf diesem Weg eine Lösung zu finden. Doch auch das würde das Eingestehen von Verletzlichkeit erfordern. Kein Therapeut stellt sich gern unter den Patienten. Und den schlimmsten Fehler, den ein Patient überhaupt machen kann, ist, den Therapeuten zu beobachten und zu lesen. Dass er mit seinen Anmerkungen aber beweist, dass er genau das gemacht hat, grenzt für den Therapeuten fast schon an ein Verbrechen. Besitzt der Patient dann auch noch das Selbstbewusstsein, sich nicht von Vorwürfen der Angst, der Vermeidung und der Lüge unterkriegen zu lassen, gibt es für den Therapeuten nur zwei Möglichkeiten:
Epilog. Für den ein oder anderen mag meine Sichtweise auf die Psychotherapie sehr negativ, ja geradezu vernichtend sein. Doch ich greife lediglich auf Erfahrungen zurück, die vielleicht anfangs positiv erschienen, sich jedoch mit der Zeit in negative gewandelt haben. Um es fair zu gestalten, wäre nun ein positives Statement nötig. Doch solch eine Beschreibung kann ich nicht liefern, ohne meiner Fantasie freien Lauf lassen zu müssen. Ich behaupte nicht, dass eine Therapie immer mehr Schaden verursacht, als sie eigentlich reparieren soll. Allerdings muss bei der Anpreisung der eigenen Unfehlbarkeit und der vergangenen Erfolge auch die Ehrlichkeit zu Wort kommen dürfen. Nicht jede psychische Erkrankung spricht auf dieselben Behandlungsmethoden an. Genauso wie eine Tablette nicht bei unterschiedlichen Beschwerden hilft. So wird ein Asthmatiker im Akutfall nicht besser Luft bekommen, indem er Schmerztabletten nimmt. In all den Jahren, in denen ich psychisch kranken Menschen begegnet bin, gab es nicht einen darunter, der „geheilt“ wurde. Und die, denen es signifikant besser ging, litten unter akuten Problemen, die in keiner Weise mit einer schweren chronischen Erkrankung vergleichbar waren. Dazu kamen viele nach kurzer Zeit gebrochen zurück in die Klinik oder in eine ähnliche Einrichtung. Der Grund hierfür ist simpel: Mit einem Aufenthalt in einer Klinik bietet sich eine temporäre Flucht vor dem belastenden Alltag. In der Regel wird diese „Pause“ auf vier Wochen beschränkt. Dieser Monat wird unbewusst als „Urlaub für die Seele“ wahrgenommen. Dabei ist es absolut irrelevant, was den Stress verursacht hat: die Familie, eine Beziehung, die Arbeit … Hauptsache eine Weile weg davon. Der Preis hierfür ist vergleichsweise gering. Gruppentherapien, Entspannungseinheiten und „Alltagstraining“ werden widerstandslos hingenommen. Die ganzen Programme dienen dabei lediglich, außer der Einzeltherapie, der Ablenkung, jedoch nicht Besserung. Ohne Übergang folgt nach dem Verlassen der schützenden Umgebung schließlich der freie Fall in den verdrängten und verhassten Alltag. Anfangs mag sich bei dem Patienten eine veränderte eine veränderte mentale Haltung bemerkbar machen. Doch die unveränderten Bedingungen machen die ganze Arbeit innerhalb kürzester Zeit zunichte und lassen die Last womöglich noch schwerer als zuvor erscheinen. Ohne eine komplette Gehirnwäsche, welche die Änderung der Persönlichkeit zur Folge hat, ist eine Besserung sogar noch weiter entfernt als vorher. Der Grund hierfür ist die Hoffnung, die im (teil-)stationären Setting geschaffen wird. In der Vorstellung wird dabei eine heile Welt kreiert, in der alle Probleme gelöst und alle Hürden überwunden sind. Dieses Bild bestand zwar schon vor der Therapie, doch die Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit des Patienten ließen den Glauben an die Verwirklichung dieser Wunschvorstellung gar nicht erst zu. Zwischen Therapieeinheiten und anderen Mitleidenden wächst der Mut, doch an eine mögliche Änderung glauben zu können. Mit jedem Gespräch wird das Bild heller, bunter, schöner. Schließlich wird der Blick auf die Realität verblendet, indem der lange Weg zum ersehnten Ziel schlichtweg ausgeblendet wird. Die Therapie wird somit mit der Einstellung verlassen, dass sich auch außerhalb davon alles zum Guten verändert hat. Daher ist auch der Schlag umso größer, wenn dies eben nicht der Fall ist. Nicht selten ist eine Rückkehr in die Zuflucht schenkende Klinik vorprogrammiert. Erstaunlicherweise wird den Patienten in Kliniken genau dieser Verlauf angekündigt. Doch die meisten sind so mit sich selbst beschäftigt, dass sie dies zwar vernehmen, aber nicht wirklich verstehen. Sie hören eben das, was sie hören möchten. Diese Prophezeiung wird vor allem in Gruppentherapien vom Therapeuten regelrecht hinausgeschrien: „Sie sind hier! Doch nicht Sie sollten hier sitzen, sondern die da draußen gehören hierher! Die, die ihre Sorgen verursachen, müssten hier sitzen, denn sie müssen behandelt werden. Mit Ihnen ist alles in Ordnung!“ Im ersten Moment mag diese Aussage beruhigend wirken, da es das unbeliebte „Verrücktsein“ aus dem Weg räumt. Niemand gesteht sich gern ein psychisches Problem ein. Befinden sich der Ursprung und die Lösung ganz woanders, schafft dies Erleichterung. Denn wenn andere Schuld haben, erzeugt das positive Gefühle. Im Laufe des Aufenthaltes werden natürlich trotzdem kleinere psychische Erkrankungen „kuriert“, der Patient wird durch verschiedene Aktivitäten abgelenkt und dazu animiert, sich Ziele zu stecken. Und doch wird der Kern des Eingangsmantras aufrechterhalten: Die klinische Therapie mag Urlaub für die Seele gewesen sein, doch die Rückkehr ist immer unvermeidbar. Der ein oder andere muss hinterher trotzdem Entscheidungen treffen, doch die Vorbereitung darauf blieb aus. Somit stürzt das Kartenhaus zusammen. Das „Heile-Welt-Bild“ wird schwächer, die Hoffnung sinkt und die Verzweiflung übernimmt wieder das Zepter – der Teufelskreis beginnt von vorn. Nun wäre durchaus das Argument angebracht, dass in der Klinik doch das Selbstvertrauen geschaffen worden sein sollte, das für das Tätigen der nötigen Schritte notwendig ist – ausgehend davon, dass es sich z. B. um eine Trennung, einen Jobwechsel oder Vergleichbares handelt. Doch ein fest verknotetes Geflecht aus Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und Angst kann nicht innerhalb von ein paar Wochen gelöst werden. Auch zusätzliche Zeit vermag bei einem monate-, wenn nicht gar jahrelangen Martyrium kaum Abhilfe zu schaffen. Das beworbene Eingehen auf die individuellen Bedürfnisse ist seitens des Klinikpersonals nicht nur unmöglich, sondern bildet mit dem Start der stationären Therapie den Beginn der ganzen Farce. Während des gesamten Aufenthaltes wird nur ein Bruchteil der versprochenen Aufmerksamkeit tatsächlich in die Tat umgesetzt. Mehr geben sowohl die Kapazität als auch die Organisation nicht her. Zusammengerechnet stehen die Bedürfnisse somit seltener im Mittelpunkt als während einer ambulanten Therapie. All die anderen Angebote dienen lediglich der Ablenkung und tragen in keiner Weise zur Besserung bei. Schließlich spricht nicht jeder auf ein und dieselbe Methode an. Doch hier wird die Individualität des Einzelnen bewusst ignoriert. Ein Nichtansprechen, Hinterfragen oder gar eine Verweigerung (aus Desinteresse) wird als Angst, Vermeidung und/oder fehlende Erfahrung kommentiert. Und diejenigen, die tatsächlich aus genannten Gründen „hinterherhinken“, bekommen mehr Aufmerksamkeit. Somit können die Therapeuten offenbar auseinanderhalten, aus welchen Gründen die Patienten handeln, wie sie handeln.55. 55 Die unterschiedlichen Reaktionen wurden bereits analysiert und dargelegt. Ich kann auch hier weder von positiven Verläufen berichten noch von Therapieansätzen, die sich auf schwere psychische Erkrankungen spezialisieren. In den Kliniken wurden verschiedene Ausprägungen von Depressionen behandelt, doch nicht einer Person wurde geholfen. Viele kamen jedes Jahr wieder, was in meinen Augen für das Scheitern der Ansätze spricht. Vor jedem Antreten einer Therapie wurde mir professionelle Hilfe zugesichert. Dass jeder Einzelne gnadenlos überfordert war, dürfte nun offensichtlich sein. Doch woran lag das? Außenstehende würden wahrscheinlich mir die Schuld geben – wie es auch all die Therapeuten getan haben. Schließlich stand und stehe ich noch immer alles und jedem skeptisch gegenüber. Ich hatte noch nie Probleme damit, Dinge zu hinterfragen und logische Erklärungen zu finden. Mit dem Selbstvertrauen das auch offenzulegen, damit habe ich mir sicher den einen oder anderen Ärger eingehandelt. Doch Gegenwehr, Selbstvertrauen und die Fähigkeit, zu beobachten und logische Schlüsse zu ziehen, sind Talente, die in einem psychotherapeutischen Umfeld nicht gern gesehen werden. Denn diese sollen erst durch die Therapie entstehen und nicht schon vorhanden sein – zumindest in der Vorstellung der Therapeuten. Wer steht denn sonst am Ende als Held da? Sicher nicht der aus wütender Verzweiflung aufgebende Behandelnde. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass ich vielleicht selbst einem Skotom erlegen sein könnte. Schließlich habe ich gewisse Erwartungen, die sich immer bewahrheiten. Daher musste ich mir auch schon oft die Floskel der „selbsterfüllenden Prophezeiung“ anhören. Unbewusst wird dabei angeblich eine Situation derart manipuliert, bis das erwartete Ergebnis tatsächlich eintritt. Charmant ist dieser Vorwurf nicht gerade und er bringt auch die negative Ansicht über den „Angeklagten“ zum Ausdruck. Mir selbst wurde das dauernd vorgeworfen. Versteckt von den Therapeuten und offen vom Doc. Doch ich glaube nicht an solch einen Humbug. Die Erklärung für mein Verhalten ist so einfach, dass sich jeder Therapeut in Grund und Boden schämen sollte, der zu schnell aufgibt, sobald er sich einem atypischen Patienten gegenübergestellt sieht – wie mir eben. Für jeden Normaldenkenden dürfte klar sein, dass mein psychischer Zustand und meine antrainierten Fähigkeiten für mein Handeln verantwortlich sind. Somit müsste es für einen Profi ein Klacks sein, damit umgehen zu können. Doch verschiedene Formen des Scheiterns meines Umfeldes bilden den roten Faden, der sich durch mein Leben zieht. Mit der Illusion der selbsterfüllenden Prophezeiung lässt sich gut die Fähigkeit erklären, eins und eins zusammenzählen zu können. Ich selbst bezeichne mich dadurch scherzhaft gegenüber meinen Kolleginnen als Hexe oder Hellseherin. Doch im Grunde ist es nichts anderes als eine Mischung aus Menschenkenntnis, Körpersprache lesen, Beobachtung, Wahrnehmung von Details und Erfahrung. Ich möchte gern eine weitere Fähigkeit meiner selbst nennen, um zu zeigen, dass es auch ohne Therapeut möglich ist, zu erkennen, was mit mir „nicht stimmt“ und warum. Das Zauberwort hierzu heißt: Selbstreflexion. Mein letzter Therapeut hat diese Fähigkeit sogar lobend hervorgehoben, bevor er mir kurz danach regelmäßig vorgeworfen hat, wie blind ich doch mir selbst gegenüber wäre. Ich werde also grob erläutern, was ich seit meiner Kindheit durch den angeblichen „Schleier der Verleumdung“ sehen kann. Zum Schluss werde ich aufzeigen, inwiefern mich die Therapie verändert hat. Mein fehlendes Vertrauen dürfte nicht überraschend sein, wie ich es auch bereits thematisiert habe. Schon als Kind wurde ich von Menschen, die mich eigentlich hätten beschützen sollen, betrogen. Dieses Buch ist ein Zeugnis dessen, dass ich auch im Laufe vieler Jahre in meiner Skepsis immer wieder bestätigt werden sollte. Meine Fähigkeit, Menschen lesen zu können, ist nichts, was ich mir bewusst angeeignet hätte, und wurde mir erst recht spät als „nützlich“ bewusst. Als Kleinkind aktivierte mein Gehirn die entsprechenden Überlebensprogramme, die ich heute besser wahrzunehmen lerne („Hellsehen“). Ich war gezwungen, meinen Stiefvater und meine Mutter lesen zu lernen, um abschätzen zu können, wann Gefahr bestand und was zu tun war, um diese zu meiden. Die Wahrnehmung von Details gehört zur Körpersprache. Diese zu lesen, bedeutet, schon kleinste Veränderungen in Mimik und Gestik ausmachen zu können. Erst mit dem Eintritt ins Erwachsenenalter habe ich angefangen, mich bewusster mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich wollte genauer erklären können, was ich sah und warum ich darauf auf eine spezielle Art reagierte. Trotzdem funktioniert diese Detailverliebtheit nicht immer, denn meine Sensoren sind spezialisiert. Ich erkenne nicht unbedingt, ob eine meiner Kolleginnen neue Ohrringe hat oder ob sie darauf wartet, dass ich ihre neue Hose kommentiere. Der Grund hierfür ist simpel: Schmuck und Klamotten sind absolut irrelevant für mein Überleben, da von beiden keine Gefahr ausgeht. Mir mag diese Veränderung vielleicht auffallen, doch sie wird innerhalb von Millisekunden als unwichtig bewertet und somit ignoriert. Nicht nur meine Augen scannen ununterbrochen mein Umfeld. Auch meine Ohren tragen ihren Teil dazu bei, mich immer auf dem Laufenden zu halten. Dies führt jedoch zu einer Geräuschempfindlichkeit, die mich bei Überlastung sehr schnell die Fassung verlieren lässt. Dabei ist die Hemmschwelle, zu meinem Leidwesen, sehr gering. Das Leben in einem Mehrfamilienhaus mag für andere kein Problem sein, doch ich werde tagtäglich mit dem Alltag meiner Nachbarn konfrontiert. Das obligatorische Trampeltier, viele Familienmitglieder, Handwerker und Musikliebhaber gehen ihrem Leben nach und erschweren dabei meines. Auch wenn ich aus Erfahrung weiß, dass es schlimmer sein könnte, reicht mir der momentane Lärmpegel trotzdem. Andere würden mein Umfeld als angenehm ruhig bezeichnen, doch ich empfinde es als quälend laut. Daher musste ich mir etwas einfallen lassen und beschloss, mein Gehör abzulenken bzw. zu dämpfen. Tagsüber trage ich deshalb durchgehend Kopfhörer, die meine Ohren mit Musik oder dem Ton des Fernsehers beschallen. Alles, was trotzdem durchkommt, ist weiterhin nervig und beinahe unerträglich, aber besser als vorher. Nachts hilft mir ein individuell angepasster Gehörschutz, der einen Großteil der Geräusche dämpft, mich aber trotzdem den Wecker nicht überhören lässt. Immerhin kann ich mit meinen Ohren feinste Nuancen wahrnehmen, was mich zu einem audiophilen Menschen gemacht hat. Ich höre sehr gern klassische Musik in unterschiedlichen Formen, bin ein großer Fan von Synchronsprechern und nutze mein Gehör natürlich auch zur Vermeidung von Gefahr (z. B. auf dem Fahrrad auf nahende Autos horchend) Auch meine feinen Ohren stehen mit meiner Kindheit in Verbindung. Medizinisch gesehen höre ich nicht besser als andere. Doch die Differenzierung unterscheidet sich, da auch hier mögliche Gefahren im Mittelpunkt stehen. Auch in meinem Schlaf arbeitet mein Gehör brav weiter und sorgt als „Bodyguard“ dafür, dass ich sehr schnell aufwache. Der Gehörschutz mag vieles abblocken, doch für mich Relevantes bleibt weiterhin gut hörbar. So wache ich bei der Aktivierung meines Radioweckers oft nicht erst beim Geräusch der Musik/Nachrichten auf, sondern bei dem Knacken, das erzeugt wird, wenn sich das Radio einschaltet. Mein Schlaf selbst wird aber nicht nur von meinen Ohren überwacht. Schon als Kind habe ich erkannt, dass meine Schlafgewohnheiten sich immens von denen anderer unterscheiden. Ich habe bereits erwähnt, dass ich früher nie ein Kuscheltier oder Ähnliches in meinem Bett ertragen habe. Auch die fast schon zwanghafte Wendung meines Gesichtes zur Tür ist enorm ungewöhnlich, aber instinktiv für mich notwendig. Erst mein bereits beschriebener Albtraum hat mich erkennen lassen, warum ich das mache. In mir schlummert immer noch die Ansicht, dass jederzeit jemand mein Schlafzimmer betreten könnte. Ich darf somit nicht komplett ungeschützt im Bett liegen. Also muss ich dafür sorgen, dass ich in diesem wehrlosen Zustand nicht überrascht werden kann. Leider hat meine Reaktion in dem Traum bewiesen, dass all die Vorsichtsmaßnahmen wahrscheinlich umsonst sind. Trotzdem kann ich dieses Verhalten nicht abstellen. Bewusst kann ich es natürlich manipulieren und mich drehen, doch oft wird mir erst später bewusst, dass mein Körper mir wieder zuvorgekommen ist. Drehe ich mich im Schlaf also mit dem Gesicht zur Wand, wird mein Schlaf noch leichter. Geräusche werden plötzlich lauter und ich wende mich daher sofort. Auf dem Rücken liegend habe ich automatisch mehr „im Blick“ und kann meinen Kopf ggf. drehen. Nicht selten wache ich auf und finde mich verdreht wieder. So weist mein Oberkörper zur Tür, doch ab der Hüfte wende ich mich der Wand zu. Eine kleine Änderung veranschaulichte mir schließlich, wie schnell diese Anpassung wirklich vonstattengeht. Bis dato war ich immer davon ausgegangen, dass ich mich an das Neigen des Kopfes nach rechts gewöhnt hatte und dies somit meine Lieblingsposition war. Irgendwann beschloss ich, das Fuß- und Kopfende meines Bettes zu tauschen. Damit wurde auch jeweils die Position der Tür und der Wand getauscht. In meiner ersten Nacht mit diesem neuen Blickwinkel kam mir die gewohnte Wendung des Kopfes nach rechts enorm falsch und ungemütlich vor. Automatisch zog mich die linke Seite an. Wie es sich also gehört, wandte sich mein Gesicht der Tür zu. Als jemandem, dem die Unfähigkeit diagnostiziert worden ist, die Wahrheit zu erkennen, bezeugen meine Beschreibungen genau das Gegenteil. Was die Therapie für mich getan bzw. was sie angerichtet hat, soll die nachfolgende Tabelle zeigen
Отрывок из книги
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
.....
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
.....