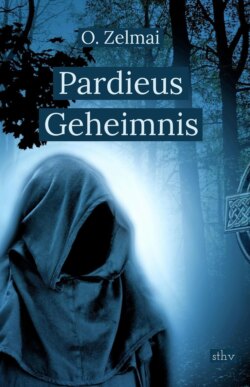Читать книгу Pardieus Geheimnis - O. Zelmai - Страница 1
ОглавлениеPardieus Geheimnis.
Roman von
O. Zelmai.
Sternthaler-Verlag Basel
Originalausgabe 2019.
Copyright © 2019 by O. Zelmai.
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck verboten.
Erstes Kapitel.
Auf der Wanderschaft.
Es ging bereits auf den Abend zu. Die Schatten wurden länger. Ebenso zog sich auch die staubige Landstraße in die Länge. Noch war es angenehm warm, doch schon bald, wenn die Sonne hinter den bewaldeten Hügeln verschwand, würde es empfindlich kühl werden. Höchste Zeit also, daß Guntrol sich ein Nachtlager suchte. Er war müde, die Füße taten ihm weh, und der allergrößte Teil seiner Abenteuerlust hatte sich auf den staubigen Landstraßen und steinigen Feldwegen rascher abgenützt, als seine Schuhsohlen.
Vor kaum einer Woche erst war er frisch und munter und strotzend vor Tatendrang auf seine Wanderschaft aufgebrochen. Zum ersten Male hatte er die vertrauten Gefilde seines Heimatortes, wo er geboren und aufgewachsen war, verlassen, um sich dem uralten Brauche folgend für drei Jahre auf Wanderschaft zu begeben. Ein bestimmtes Ziel hatte er ursprünglich nicht gehabt, doch war ihm unterwegs zu Ohren gekommen, daß in der Hauptstadt eine neue große Steinbrücke über den Fluß geschlagen werden sollte und daß für diese Arbeit Zimmerleute gesucht würden. Um eine Steinbrücke zu errichten, mußte schließlich zuerst eine hölzerne Hilfsbrücke errichtet werden. Das war zwar kein dauerhaftes Bauwerk, auf das man noch viele Jahre später mit Stolz blicken konnte, aber dennoch eine interessante und ungewöhnliche Herausforderung für einen jungen Zimmermannsgesellen aus der Provinz. Also hatte Guntrol sein Bündel geschnürt, sein Handbeil geschärft und sich die Wanderstiefel angezogen, um nach Westen gen Narbon zu ziehen. Zu Fuß würde er ungefähr vierzehn Tage brauchen. Das hatte er am Anfang geschätzt. Doch nun war er bereits seit einer Woche unterwegs und noch lag weit mehr als die Hälfte des Weges vor ihm. Wenn er nur ein Pferd besäße oder Geld für die Fahrt auf dem Postwagen hätte. Aber beides lag weit jenseits seiner bescheidenen finanziellen Mittel. Darüber hinaus verstieß es eigentlich auch gegen die Tradition, welche streng vorschrieb, daß ein Geselle auf Wanderschaft sich ausschließlich zu Fuß fortzubewegen hatte.
So kam es also, daß er an jenem späten Nachmittag Anfang Mai durch eine Gegend stapfte, die er nur vom Hörensagen kannte. Hier gab es so gut wie nichts. Die wenigen Dörfer waren klein und lagen weit von einander entfernt. Dichte, finstere Wälder bestimmten die Gegend. Das Klima war hier kühl, die Winter lang und rauh und die Böden nicht besonders fruchtbar. Kurz gesagt, die Landwirtschaft war in diesem Teil des Landes wenig ersprießlich. Auf den Straßen begegnete einem den ganzen Tag kaum eine Menschenseele.
Guntrol seufzte und setzte sich am Wegesrand unter einen Baum. Er lehnte seinen Rücken gegen die rauhe Borke des Stammes. Wieso, fragte er sich, war er bloß so geizig gewesen, sich nicht eine gute Landkarte zu kaufen? Aber er war der irrigen Annahme verfallen, daß, wenn er immer auf der Hauptstraße bleibe, er nicht in die Irre gehen könne. Welch ein Irrtum! Tatsächlich hatte er schon seit zwei Tagen keine Ahnung, wo er sich genau befand. Traf er, was selten der Fall war, mal einen Menschen auf der Straße, so erhielt er, je nachdem, wen er fragte, eine andere Auskunft. Es schien ihm fast, als kennten sich nicht einmal die Einheimischen hier aus. Zuletzt hatte er eine ‚Abkürzung’ genommen, die ihm einer wärmstens empfohlen hatte, um dem gefürchteten Monsterwald auszuweichen. Natürlich hatte Guntrol keine Angst vor Ungeheuern – er glaubte nicht einmal wirklich an deren Existenz – und für Notfälle hing sein Handbeil stets griffbereit an seinem Gürtel, doch wozu ein Risiko eingehen? Die Einheimischen hatten bestimmt einen triftigen Grund, jenen Wald zu meiden. Allein im finsteren Wald konnte ein einsamer Wanderer sich leicht verlaufen oder Opfer einer Räuberbande werden. Zwar gab es bei ihm nichts zu rauben. Doch was half ihm das, wenn er zuerst ermordet und erst danach beraubt würde?
Guntrol nahm einen Schluck Wasser aus seiner Feldflasche. Es war lauwarm und schmeckte schal. Betrübt betrachtete er die kümmerlichen Reste seines Proviants: ein Stück Brot, ein Zipfel Rauchwurst und zwei Äpfel waren alles, was er noch in seinem Brotbeutel vorfand. Er nahm einen Apfel heraus und biß hinein. Er schmeckte süß und saftig und erinnerte ihn an Zuhause. Der Apfel stammte von dem großen alten Apfelbaum, der hinter seinem Elternhaus wuchs.
Während er aß, betrachtete er die Umgebung. Die Landstraße führte mitten durch eine trockene, ebene Heidelandschaft, welche nur durch vereinzelte Gruppen von Buschwerk und kleineren Bäumen unterbrochen wurde. In der Ferne erhoben sich einige Hügel; der Horizont wurde von dunklen bewaldeten Berghängen begrenzt. Eigentlich sollte er nicht in Richtung der Berge gehen, sondern sich am Fluß orientieren, aber dieser war leider nirgends auszumachen. Guntrol fürchtete, daß er mindestens eine Tagesreise von seinem Weg abgekommen war. Er warf den Apfelstiel weg und trank noch einen Schluck Wasser. Dann machte er sich wieder auf den Weg.
Nach ungefähr zwei Stunden – es mochte inzwischen gegen sieben Uhr sein – gelangte er in ein winziges Dorf. Es war nicht mehr, als ein Dutzend Häuser und Bauernhöfe, welche entlang der Straße lagen. Der Ort machte einen öden und beinahe verwaisten Eindruck. Doch der Anschein täuschte, denn beim Herannahen gewahrte er einige alte Leute, die vor ihren Häusern auf Bänken oder Stühlen saßen und die letzten wärmenden Strahlen der Abendsonne genossen. Ein paar Köter fingen laut zu kläffen an und kündigten die Ankunft des Wanderers an.
Guntrol sprach den ersten an, den er traf: »Grüß Euch wohl! Wißt Ihr vielleicht eine Herberge für einen Handwerksburschen auf Wanderschaft?«
Der Alte sah ihn verwundert an und rieb sich die rote Nase mit dem Stiel seiner Pfeife. »Eh nun", sagte er. "Das ist ungewöhnlich, daß sich ein Fremder zu uns verirrt. Am Ende des Dorfes, ein Stück weit die Straße runter findet Ihr eine Schenke. Dort werdet ihr ein wohlfeiles Quartier für die Nacht finden. Aber wo wollt Ihr hin? Hier gibt es weit und breit keine Zimmerei.«
»Ich glaube, ich bin vom Weg abgekommen. Eigentlich wollte ich auf die Straße nach Narbon.«
»Da seid Ihr aber in die verkehrte Richtung gegangen. Diese Straße führt Euch geradewegs in den Monsterwald. Den solltet Ihr unbedingt meiden, wenn Euch Euer Leben lieb ist. Erst recht zur Nacht und ganz allein. Schon manche sind am hellichten Tage hinein gegangen und nimmermehr heraus gekommen. Kehrt lieber um und geht zurück nach Brünnau. Dort zweigt die Straße nach Westen ab.«
Guntrol bedankte sich höflich, für die Auskunft und ging weiter in Richtung der Dorfschenke. Aus den Augenwinkel konnte er sehen, daß seine Ankunft nicht unbemerkt geblieben war. Eine Schar Kinder beäugte ihn durch die Gartenhecke und hinter mehr als einem Fenster konnte er einen neugierigen Schatten ausmachen. Es hatte den Anschein als verirrte sich tatsächlich so gut wie nie ein Fremder in dieses Dorf.
Die Dorfschenke lag etwas abseits an einem Bach. Es war ein zweigeschossiges Fachwerkhaus, das schon bessere Zeiten gesehen hatte. Vom Wind und dem Alter ein wenig gebeugt, stand es schief und verwittert in der Landschaft. Das Fachwerk war von solider alter Handwerksarbeit; das erkannte Guntrol auf den ersten Blick. Doch viele Jahre der Vernachlässigung hatten ihre deutlichen Spuren hinterlassen. Die Balken waren rissig und von der Sonne grau gebleicht. Der Verputz hatte Furchen und die Tünche war schon seit längerem nicht mehr erneuert worden. Trotz dieser offensichtlichen Mängel war das Gebäude aber noch immer solide und bot seinen Bewohnern guten Schutz vor Wind und Wetter.
Als Guntrol durch das offene Gatter des ebenfalls in die Jahre gekommenen Gartenzaunes trat, erkannte er die über dem Türstock eingeritzte Jahreszahl. Das Haus war mehr als hundertzwanzig Jahre alt. Auf dieses Alter hätte er es auch ungefähr geschätzt. Die Art, wie die Querstreben mit den Längsträgern verbunden waren, wurde heute nur noch selten angewendet.
Über dem Eingang hing ein bunt bemaltes Holzschild, das in der Luft sachte hin und her schwang. Zum Lustigen Waldschrat stand in roten Buchstaben darauf. Guntrol betrat die Gaststube durch eine dicke, schwere, von Sonne und Regen ausgebleichte Eichentür. In der niedrigen Stube standen ein paar einfache Tische und Holzbänke. An den Wänden hingen Hirschgeweihe, Auf einem langen schmalen Brett standen Zinnkrüge und anderer Zierrat, wie man ihn in Dorfschenken allenthalben vorzufinden pflegte. Viel Kundschaft war nicht da. In einer Ecke saßen drei Bauern beim Bier und unterhielten sich leise. Ihre Unterhaltung verstummte jedoch abrupt, als sie den Neuankömmling bemerkten. Sie drehten sich um und musterten ihn unverhohlen von oben bis unten.
»Grüß Gott!« sagte Guntrol laut. Die Männer erwiderten den Gruß und wandten sich wieder ihrem Gespräch zu. Aus einem Nebenraum erschien eine Frau mittleren Alters. Sie trug ein einfaches braunes Kleid und eine weiße, etwas fleckige Schürze. Ihr ergrautes Haar trug sie zu einem Knoten hochgesteckt.
»Guten Tag, Fremder!« sagte sie. »Was darf es sein?«
»Ich suche ein Nachtlager und eine Kleinigkeit zum Essen.«
»Das sollt Ihr bekommen. Setzt Euch dort hin. Ich will euch gleich die Kammer richten. Ein besonderes Mahl kann ich Euch leider nicht bieten. Aber wenn Ihr eine gute Fleischbrühe, Wurst und Käse nicht verachtet, will ich Euch gleich auftischen.«
»Ja, das soll mir recht sein. Aber zuerst bringt mir bitte ein kühles Bier. Meine Kehle ist ganz ausgedörrt vom Staub der Landstraße«, sagte Guntrol und ließ sich auf die Bank fallen. Er legte seinen Rucksack und den Brotbeutel auf den Boden neben die Bank.
»Das kann ich gut verstehen«, meinte die Wirtin. Sie zapfte einen irdenen Maßkrug frischen Bieres aus dem großen Faß, das hinter dem Schanktisch in der Ecke stand und brachte es Guntrol an den Tisch. »Ich bringe Euch gleich Euer Essen.«
»Ist recht. Ihr braucht Euch nicht zu beeilen. Fürs erste will ich mich daran laben«, sagte Guntrol und schlürfte den Schaum von seinem Bier. Es war frisch und kühl und schmeckte ausgezeichnet. Nach dem langen Fußmarsch war es eine wahre Labsal, seine Kehle damit zu befeuchten. Mit einem tiefen Seufzer stellte Guntrol den Krug ab, wischte sich den Schaum vom Mund und streckte seine müden Beine aus.
»Ihr kommt wohl von weit her?« fragte einer der Bauern am Nebentisch.
»Jawohl, aus dem Apfelland, unten am Sternsee.«
»Das ist ein weiter Weg«, meinte der andere. »Ihr seid sicher auf der Wanderschaft, das sieht man gleich an Eurer Tracht. Aber was führt Euch in unsere einsame Gegend. Hier findet Ihr bestimmt keine Arbeit. Doch wollt Ihr Euch nicht ein wenig zu uns setzen?«
Guntrol nahm das freundliche Angebot dankend an und setzte sich mit seinem Krug zu den dreien an den Tisch. Es währte nicht lange und sie waren in ein Gespräch vertieft. Guntrol berichtete von seinen Plänen. Die Bauern waren begierig, Neuigkeiten aus dem Apfelland zu erfahren. Da so selten Fremde in ihr Dorf kamen und sie außer an Markttagen oder wenn ein Volksfest in der nächsten Stadt abgehalten wurde, nicht von ihren Höfen fortgingen, waren sie an Nachrichten und Neuigkeiten aus dem Rest der Welt sehr interessiert. Guntrol berichtete bereitwillig alles, was er wußte und was er auf seiner Wanderschaft erfahren hatte. Derweil brachte die Wirtin das Essen. Guntrol mußte seine Erzählung unterbrechen. Er war schon den ganzen Tag mit leerem Magen herumgelaufen, doch jetzt, da ihm der Duft der heißen Fleischsuppe in die Nase stieg, merkte er erst, wie hungrig er wirklich war.
Nachdem er sich gesättigt hatte, lehnte er sich müde und zufrieden zurück. Die Wirtin war inzwischen nach oben gegangen, um die Schlafkammer zu richten. »Ich habe Euch die kleine Kammer hinten links am Ende des Ganges gemacht«, sagte sie, als sie zurückkehrte.
Die drei Bauern bezahlten ihre Zeche und verabschiedeten sich. Draußen wurde es schon dämmrig. »Ja, der Tag ist nun auch vorüber«, sagte die Wirtin erleichtert während sie die leeren Bierkrüge einsammelte. »Bald muß mein Mann nach Hause kommen. Er war heute in der Stadt und hat Braugerste gekauft. Hoffentlich schafft er es noch vor Einbruch der Nacht nach Hause. Ich habe immer ein ungutes Gefühl, wenn er Nachts auf der Straße ist. Die Zeiten sind nicht mehr wie früher.« Mit ‚Stadt’ meinte sie einen ungefähr zwanzig Kilometer entfernten Marktflecken, an dem Guntrol am Vormittag vorbeigekommen war.
»Wollt Ihr noch ein Bier?« fragte die Wirtin.
»Nein, danke. Ich denke, ich gehe gleich schlafen.«
»Ja, Ihr seht wirklich müde aus. Ihr könnt Euch hinter dem Haus am Brunnen waschen. Wir haben eine eigene Quelle. Ich kann Euch auch etwas Wasser heiß machen.«
»Habt Dank, das ist sehr freundlich«, sagte Guntrol und packte seine Sachen zusammen. Kaum hatte er sich von der Bank erhoben, war draußen auf der Straße ein Lärmen zu vernehmen. Es war das Geräusch eines schweren Wagens und das Klappern von Pferdehufen.
»Das wird mein Mann sein«, sagte die Wirtin erleichtert. »Aber wen bringt er da mit?« Kurz darauf wurde die Tür aufgestoßen. Herein trat ein Mann von ungefähr fünfzig Jahren. Seiner Kleidung nach zu schließen, handelte es sich um den Herrn des Hauses. "Grüß dich, Hemmo!" sagte die Wirtin.
»Guten Abend, Risa! Schau, ich bringe hohe Gäste mit! Hol die Magd und den Knecht. Laß den Herd anfeuern und hole den besten Wein aus dem Keller.« Er sprach laut und sichtlich aufgeregt. »Bitte, Herren! Tretet ein. Ich will Euch mit allem, was mein bescheidenes Haus zu bieten hat, zu Diensten sein. – Risa, sag der Magd, sie soll die Kammern für die Nacht richten.«
Von draußen hörte man mehrere Stimmen. Eine davon gehörte der Magd, die anderen konnte man kaum verstehen. Guntrol reckte den Kopf nach der Tür, um zu sehen, was für edle Herren zu dieser Stunde hier einzukehren beabsichtigten.
»Los, Bursche! Führe die Pferde in den Stall. Und reibe sie mir ja gründlich trocken«, rief der Wirt durch die weit offen stehende Tür. Er trat zur Seite, denn im Türrahmen erschien eine groß gewachsene Gestalt. Es war ein Ritter des Königs. Auf seinem blank polierten Brustharnisch trug er das königliche Adler-Wappen von Zerwan. Gleich nach ihm betraten zwei weitere Ritter, ebenfalls mit prächtigem Brustharnisch und dunkelgrünem Wams bekleidet, die Gaststube. In ihrem Gefolge befanden sich zwei weitere Männer: ein größerer stattlicher und ein kleinerer eher etwas schmächtigerer. Beide waren sie mit langen grauen Reisemänteln angetan. Sie hatten die Kapuzen ihrer Mäntel übergezogen, so daß Guntrol ihre Gesichter nicht erkennen konnte. Der kleinere trug einen langen, mannshohen Stab, an dessen oberen Ende ein silberner Ring angebracht war. An dem Ring waren wiederum drei weitere, etwas kleinere Ringe eingefädelt, welche in der Mitte jeweils mit einer kleinen Kugel besetzt waren. Das untere Ende des Stabes war mit Eisen beschlagen. Der Stab selbst bestand aus schwarzem Holz. Das konnte nur ein Schamane oder Magier sein, dachte Guntrol verwundert. Was hatte ein heiliger Mann mit Rittern des Königs in einer abgelegenen Dorfschenke zu schaffen? Der andere Kapuzenmann war kein Schamane. Er sah mehr wie ein hoher Beamter aus. Unter dem Arm trug er eine abgewetzte Ledertasche, welche mit dem Wappen der königlichen Reichskanzlei, einem schwarzen gekrönten Adler auf goldenem Grund, sowie drei roten Sternen, verziert war. An der rechten Hand blitzte ein goldener Siegelring auf. Ohne Zweifel handelte es sich hierbei um einen königlichen Herold. Guntrol staunte nicht schlecht beim Anblick dieser hochkarätigen Reisegesellschaft. Ein Herold, ein Magier und gleich drei Ritter als Eskorte.
Die Ritter schauten sich prüfend in der Gaststube um. Guntrol sah sich von scharfen Blicken gemustert. Der erste Ritter begab sich sogleich zum Hinterausgang, der andere warf einen Blick in die Küche und der dritte stieg die Treppe zum Obergeschoß hinauf. Hemmo, der Wirt war ganz aufgeregt. Er lief hin und her, brachte Lampen, trug Weinkelche herbei, wischte Tisch und Stühle ab. Dabei gab er unablässig Anweisungen an seine Frau und die Magd.
»Bitte sehr, Edle Herrschaften! Nehmt Platz.« Ich will Euch gleich einschenken. Meine Frau wird Euch etwas zu essen bringen. Leider sind wir auf so hohe Gäste nicht eingerichtet, und noch dazu zu solch später Stunde. Aber eine gute heiße Suppe und Schinken und Käse sollt Ihr haben. Oder möchtet Ihr lieber einen Eierkuchen?«
»Bemüht Euch nicht weiter, Herr Wirt!« sagte der Herold. Er hatte eine leise Stimme, doch seine Aussprache war klar und präzise. »Wir brauchen nur ein Lager für die Nacht und ein einfaches Mahl. Morgen werden wir in aller Frühe weiter reisen.«
Die drei Ritter kehrten fast gleichzeitig von ihrer Inspektion zurück. »Alles in Ordnung«, sagte der Anführer leise. »Wie viele Personen gehören zu Eurer Wirtschaft?« fragte er den Wirt. Dieser machte ein leicht verlegenes Gesicht und antwortete: »Wir haben nicht viele Gäste hier. Zur Zeit sind meine Frau und ich allein, außerdem haben wir noch die Magd und einen Knecht, der den Stall versorgt und die grobe Arbeit verrichtet. Wir haben auch einen Sohn, aber der ist mit unserem Vieh auf den Markt in die Stadt gefahren. Wir erwarten ihn erst in ein oder zwei Tagen zurück.«
»Das ist gut so. Schlafen der Knecht und die Magd auch hier im Haus?«
»Ja, sie haben ihre Kammern ganz oben unter dem Dach.«
»Gut. Heute Nacht soll keiner das Haus verlassen. Und niemand soll etwas von unserer Anwesenheit hier erfahren. Wir sind im Auftrag der Regierung unterwegs. Habt ihr verstanden?« Der Wirt nickte ehrfürchtig. Der Ritter setzte sich auf einen Schemel und sah zu Guntrol herüber. »Wer ist das?«
»Nur ein reisender Handwerksgeselle.« Die Wirtin, die gerade die Treppe herunter kam, unterbrach ihn: »Was soll ich machen? Wir haben doch nur drei Kammern. Und in der dritten schläft bereits der junge Mann.« Der Wirt machte ein säuerliches Gesicht und kratzte sich am Kopf. »Ei, was machen wir da?«
»Das ist kein Problem. Es macht mir nichts aus, das Zimmer mit dem Burschen zu teilen«, sagte der Schamane, der bislang schweigend neben der Tür im Schatten gestanden war. Guntrol konnte sein Gesicht nicht erkennen, da er den Kopf zur Seite gewandt hielt und das Gesicht obendrein durch die Kapuze des Mantels verhüllt wurde. Unter dem offenen Mantel trug der Mann ein langes blaues Gewand und darüber eine gelbe Weste, die mit allerlei magischen Symbolen und Schriftzeichen bestickt war. Außer dem Stab trug er einen Beutel und eine Reisetasche an einem ledernen Schulterriemen. Ein kleines Ledersäckchen, ähnlich einem Geldbeutel, hing an seinem Gürtel, ebenso wie ein kleines Messer mit Hirschhorngriff in einer Lederscheide.
Irgendwie kam ihm der Mann bekannt vor, was eigentlich nicht sein konnte. Vielleicht war es seine Stimme, die ihn unbewußt an jemanden aus seiner Heimat erinnerte. Doch im Augenblick konnte er sie keiner ihm bekannten Person zuordnen.
Der Wirt warf stumm einen fragenden Blick auf Guntrol. Dieser nickte und sagte: »Mir soll es recht sein. Mit einem Heiligen Mann im Zimmer und königlichen Rittern unter einem Dach fühle ich mich sicher und geborgen, wie sonst nicht.«
Der erste Ritter – er war ein wenig älter als die anderen beiden und schien der Anführer der Truppe zu sein – trat zu dem Schamanen und sprach ihm flüsternd einige Worte ins Ohr. Der andere nickte schweigend.
»Nun, Ihr seid bestimmt müde von eurer Reise und wollt Euch zur Ruhe begeben«, sagte der erste Ritter; und das war nicht als Frage ausgesprochen. Guntrol nickte stumm. Was hätte er auch einem Ritter des Königs entgegnen sollen? Er nahm seine Sachen und ging zur Treppe. Bevor er die Schankstube verließ, verbeugte er sich ehrerbietig vor dem Herold.
In der kleinen Schlafkammer, die ganz am Ende des Ganges lag, brannte bereits eine kleine Öllampe. Sie stand auf einem niedrigen Tisch vor dem Fenster und tauchte den Raum in ein mildes gelbliches Licht. Außer dem kleinen Tisch befanden sich zwei einfache schmale Betten, nebst Nachtkästlein, sowie zwei schlichte Stühle mit gerader Rückenlehne als einzige Möblierung in dem Raum. Die Betten waren frisch bezogen und aufgedeckt. Sie sahen sauber und einladend aus.
Guntrol setzte sich auf das Bett, das in der Nähe des Fensters stand. Es war angenehm weich, viel weicher, als er es erwartet hatte und es für einen billigen Dorfgasthof wie diesen üblich war. Er schnürte seinen Rucksack auf und holte sein Waschzeug hervor. Von dem versprochenen warmen Wasser war nichts zu sehen. Wahrscheinlich hatte die Wirtin es in dem Trubel vergessen. So würde er sich eben im Hof mit kaltem Wasser aus der Quelle waschen müssen. Doch das war er gewöhnt.
Die Sonne war inzwischen ganz untergegangen, aber es war noch nicht ganz dunkel geworden; noch glühte ein blasser Schimmer am Himmel. Guntrol nahm die schmale Holzstiege, die am Ende des Ganges hinunter führte. Sie endete in einem kleinen Gang zwischen Küche und Gaststube. Gegenüber der Küche lag die Wohnstube der Wirtsleute, daneben befand sich die Hintertür zum Hof. Die Tür zur Gaststube war nur angelehnt. Durch den Spalt fiel ein Streifen Licht auf den Gang. Guntrol blieb einen Augenblick davor stehen. Er vernahm einige gedämpfte Stimmen, konnte aber nicht verstehen, was drinnen gesprochen wurde. Das leise Klappern von Besteck und Geschirr verriet ihm jedoch, daß die Herrschaften gerade ihr Abendbrot einnahmen.
Auf einmal wurde unversehens die Küchentür aufgestoßen. Guntrol sprang erschrocken zur Seite. Beinahe wäre die Wirtin in ihn hinein gelaufen. Sie trug ein großes Tablett, auf dem dicke Scheiben von saftigem Schinken, Speck und verschiedenen Sorten Käse angerichtet waren. »Wah! Ihr habt mich vielleicht erschreckt!« rief sie.
»Entschuldigt, ich wollte mich gerade auf dem Hof waschen gehen.«
»Ach so. Ich habe auf dem Herd einen großen Kessel mit kochendem Wasser stehen. Ihr könnt Euch gerne davon nehmen, wenn es Euch nichts ausmacht, Euch selbst zu behelfen. Aber ich habe gerade mit den Herrschaften zu tun.«
»Kümmert Euch nicht um mich. Ich komme schon zurecht«, meinte Guntrol. Er nahm sich einen Eimer und betrat die Küche. Auf einem großen gußeisernen Herd, größer als er je einen gesehen hatte – was nichts heißen mochte, denn in viele Küchen hatte er zuvor nicht hinein geschaut – stand ein großer Topf. Guntrol schöpfte etwas von dem brodelnden Wasser in seinen Eimer. Dann ging er hinaus auf den Hof, wo er Brunnenwasser hinzu fügte, bis sich eine angenehme Temperatur einstellte. Mit dem warmen Wasser wusch er sich und putzte die Zähne.
Während er sich abtrocknete, durchzuckte ihn auf einmal ein Gedanke. »Lagrange!« sagte er halblaut zu sich.
»Du hast mich also erkannt«, sagte eine Stimme hinter ihm. Erschrocken fuhr er herum. In der Tür stand der Schamane, der kein anderer war, als Lagrange, Guntrols Freund und Spielgefährte aus Kindertagen.
»Mensch, dich hätte ich wirklich nicht erkannt. Schon gar nicht in dieser Verkleidung«, rief Guntrol.
»Das ist keine Verkleidung«, erwiderte Lagrange sanft.
»Du… du bist also wirklich ein Zauberer geworden?« Guntrol runzelte die Stirn. »Erinnerst du dich noch, wie wir damals gewerweißt haben, ob du vielleicht ein Lehrer oder ein Magier werden würdest?«
»Ja, das ist so lange her. Und du wolltest entweder ein Ritter oder ein Seefahrer werden. Und wie ich sehe, bist du keines von beiden, sondern ein biederer, ehrlicher Zimmermann geworden. »Komm, laß uns reingehen und zusammen etwas trinken. Wir haben so viel zu bereden«, schlug Guntrol vor. Lagrange aber schüttelte den Kopf. »Nein, gehen wir lieber hinauf. Da sind wir ungestört.«
»Das soll mir recht sein. Ich mag diese finster dreinschauenden Kerle dort in der Gaststube eh nicht besonders leiden. Wie kommst du überhaupt zu denen?«
»Das ist eine lange Geschichte«, sagte Lagrange. »Geh schon mal voraus. Ich will uns einen Schlummertrunk besorgen.«
Wenig später saßen sie im Schein der Ölfunzel und Lagranges Kerze, die er mit einem Krug Wein und zwei Bechern herauf gebracht hatte, auf ihrem Zimmer. »Laß uns auf die guten alten Zeiten anstoßen«, schlug Guntrol vor und erhob seinen Becher.
»Auf die alten Zeiten und die Zukunft«, sagte Lagrange und stieß seinen Becher gegen Guntrols. Das Steingut erzeugte keinen schönen Klang, doch die wenigen guten Zinnbecher waren den vornehmeren Gästen vorbehalten.
»Ja, das sind jetzt gute fünf Jahre, daß du unser schönes Apfelland verlassen hast«, sagte Guntrol. »Wohin hat es dich verschlagen?«
»Ich zog mit den Eltern nach Lorstadt. Dort habe ich die Schule besucht. Dann traf ich Meister Pardieu. Er hielt ein paar Vorträge an der Schule, die er einst selbst besucht hatte. Da wurde mir klar, was meine Bestimmung sei. Es gelang mir, sein Schüler zu werden. Es vergingen drei harte, aber wunderbare Lehrjahre. Vor sieben Monaten habe ich schließlich die erste Weihe erhalten. Eigentlich sollte ich in diesem Sommer die zweite empfangen, aber dann…« er brach ab.
»Was ist passiert?«
»Der Meister ist verschwunden.«
»Was heißt verschwunden?«
»Er begab sich, wie es seine Angewohnheit ist, zur Meditation auf den Krawang. Das ist ein kleiner Berg, eigentlich mehr ein Hügel, ganz in der Nähe des Klosters. Doch von dort kehrte er nicht wieder. Wir machten uns alle große Sorgen. Trotz einer groß angelegten Suche, an der sich sämtliche Schüler und Brüder seines Ordens beteiligten, gelang es nicht, auch nur die kleinste Spur von ihm zu finden. Die Gegend ist ziemlich übersichtlich. Es gibt keine wilden Tiere, keine Räuberbanden oder andere Gefahren. Abgesehen davon würde sich doch keiner an einem Magier vergreifen. Wir haben alle Leute, alle Bauern auf den umliegenden Höfen, überhaupt jeden in der Umgebung gefragt, doch keiner hat den Meister gesehen, oder irgend eine verdächtige Beobachtung gemacht.«
»Das ist ja schrecklich!«
»Es ist, als habe der Erdboden den Meister verschluckt. Und das brachte mich zu der Erkenntnis, daß er absichtlich verschwunden sein muß. Er mußte einen triftigen Grund haben, plötzlich und ohne Vorwarnung von der Bildfläche zu verschwinden. Ich blieb noch rund drei Monate im Kloster, weil ich hoffte, der Meister würde heimkehren und alles aufklären, sobald er seine Geschäfte besorgt hätte. Doch bis zum heutigen Tage habe ich ihn nimmermehr gesehen, noch eine Nachricht von ihm erhalten. Also beschloß ich, mich selbst auf die Suche zu machen.« Lagrange machte ein bekümmertes Gesicht und nahm einen großen Schluck aus seinem Becher.
»Das ist vielleicht eine rätselhafte Geschichte«, sagte Guntrol. »Ist Pardieu nicht einer der legendären Magier, die zum Rat der Weisen gehören?«
»Woher weißt du das?« staunte Lagrange. »Du hast recht. Doch auch auf Seiten der Regierung weiß keiner etwas über seinen Verbleib. Selbst der König ist in großer Sorge. Jedoch… Ich weiß nicht, wie es sagen soll. Ich kann mich des Eindruckes nicht erwehren, als wüßten sie dort etwas, daß sie uns nicht sagen wollten.«
»Und die Regierungsleute dort unten?« Guntrol deutete mit dem Kopf in Richtung Tür.
»Die haben mich vor fünf Tagen engagiert, sie auf einer Reise in die Hauptstadt zu begleiten.« Lagrange wog seinen Kopf bedächtig hin und her. »Ich darf eigentlich nicht darüber sprechen. Doch ich will dir das Geheimnis anvertrauen: Die haben etwas in ihrem Besitz, das sehr kostbar sein muß, und vor dem sie zugleich eine Wahnsinnsangst haben.«
»Was denn?«
»Das haben sie mir nicht gesagt. Man sollte doch eigentlich annehmen, daß ein königlicher Herold und drei erfahrene Ritter der Leibgarde vor gar nichts Angst hätten, schon gar nicht in einer so friedlichen Gegend wie dieser. Aber ich kann die Sorge in ihren Gesichtern lesen.«
»So sicher scheint mir die Gegend hier aber nicht zu sein«, sagte Guntrol. »Hast du nichts von dem berüchtigten Monsterwald gehört, der sich nur wenige Meilen von hier erstreckt?«
»Mein lieber Guntrol, es gibt Gefahren, die sind viel schrecklicher als jedes Ungeheuer«, sagte Lagrange und runzelte die Stirn. »Aber sag mal, was führt dich in dieses Dorf?«
»Ich bin ebenfalls auf dem Weg in die Hauptstadt. Ich suche dort eine Anstellung beim Brückenbau. Aber leider habe ich mich ein wenig… äh… verlaufen«, sagte er leise. Lagrange lachte und sprach: »Du bist also Zimmermann geworden, wie dein Großvater. Geschickt im Basteln warst du schon immer gewesen. Ich weiß noch, wie du deinem Vater geholfen hast, ein Baumhaus für die Jungs vom Mühlenbach zu bauen. Am Ende hast du es fast ganz allein gebaut. Wie geht es deinem Vater?«
»Er ist vor zwei Jahren gestorben. Beim Holzfällen, brach ein Ast ab und hat ihn erschlagen«, sagte Guntrol leise.
»Das tut mir leid, Guntrol«, sagte Lagrange betroffen.
»Ich wollte eigentlich zu Hause bei der Mutter bleiben, aber sie bestand darauf, daß ich ein Handwerk erlerne und in die Welt hinaus gehe. Der Onkel kümmert sich ein bißchen um sie und den Hof. Außerdem hat sie noch Gunni. Der ist inzwischen ziemlich groß geworden.«
»Dein kleiner Bruder, der immer so blaß und schmächtig war? Und der dir immer hinterher gelaufen ist? Das ging dir gewaltig auf die Nerven.«
Guntrol seufzte leise. »Heute tut es mir leid, daß ich nicht netter zu ihm gewesen war. Aber inzwischen ist er fast größer als ich. Am Ende wird er mich bestimmt um mindestens zwei Zoll überrunden.«
»Du vermißt ihn und dein Zuhause, nicht?«
»Ach was! Ich bin doch erst ein paar Tage weg«, brummte Guntrol verdrießlich. Doch Lagrage hatte natürlich voll ins Schwarze getroffen. Ja, er vermißte sein Zuhause schon nach nur einer Woche. Ausgerechnet er, der immer von Abenteuern in der Ferne geträumt hatte, der die Enge und Beschaulichkeit des Apfellandes gegen die Weite Welt hatte tauschen wollen. Er wollte dorthin, wo die Geschichten spielten, denen er schon als kleiner Junge am Feuer gelauscht hatte, wenn die Erwachsenen sich unterhielten oder wenn fahrende Händler von den Wundern ferner Länder berichteten.
»Laß uns jetzt schlafen gehen«, schlug Lagrange vor. Die anderen kommen auch gerade herauf. Auf der Treppe und im Gang waren Schritte von schweren Stiefeln zu vernehmen. Ein paar Worte wurden gewechselt, dann hörte man das Knarren der Zimmertüren auf dem schmalen Gang. Allmählich wurde es still in dem alten Wirtshaus. Lagranges Kerzenstummel war fast ganz herabgebrannt. Guntrol zog sich aus und legte sich ins Bett. Das Gefühl der weichen, kühlen Laken war herrlich angenehm. Lagrange blies das Licht aus und legte sich ebenfalls in sein Bett.
»Weißt du Lagrange, es tut gut, wenn man so weit von Zuhause einen alten Freund trifft. Das ist fast wie in alten Zeiten.«
»Gute Nacht, Guntrol!« sagte Lagrange und gähnte. Er drehte sich auf die Seite. Ach, Guntrol! dachte er. Wie ich dich beneide. Wo immer du hingehen magst, erwartet dich dein glückliches Apfelland zu Hause. Er schloß die Augen, und obgleich er manch schweren Gedanken in seinem Herzen bewegte, war auch er so müde, daß er schon bald darauf fest einschlief.
Im Gegensatz zu Lagrange hatte Guntrol keinen leichten Schlaf. Er wälzte sich noch lange hin und her, obwohl er hundemüde war. Dabei hatte er doch gar keinen Grund, nervös zu sein. Er hatte seinen besten Freund aus alten Zeiten wieder gefunden. Vielleicht könnten sie ihre Reise gemeinsam bis in die Hauptstadt unternehmen. Und auch dieser unheimliche Monsterwald ging ihm nicht aus dem Sinn. Diese und andere Gedanken wälzte er noch bis nach Mitternacht. Dann endlich schlief auch Guntrol ein.
Als er aufwachte, schien die Sonne bereits zum Fenster hinein. Eine frische, kühle, würzige Morgenluft zog durch die Stube. Lagrange war schon aufgestanden und hatte das Fenster aufgemacht.
»Habe ich dich geweckt? fragte er. Guntrol grunzte etwas unverständliches und rieb sich den Schlaf aus den Augen.
»Wir reisen gleich ab«, sagte Lagrange.
»Kann ich vielleicht mit euch mitkommen?«
Lagrange schüttelte den Kopf. »Ich fürchte, das wird den Herren nicht recht sein. Außerdem hast du gar kein Pferd.« Das stimmte. Daran hatte Guntrol gar nicht gedacht.
»Mach nicht so ein Gesicht! Ich gebe dir meine Karte, damit du dich nicht wieder verläufst.« Guntrol verzog mißmutig das Gesicht.
»Weißt du was? Wir treffen uns in Narbon. Auf dem Großen Platz vor dem Haupttor des Königspalastes. Ich werde jeden Tag zu Mittagsstunde dort sein.«
»Ist gut, Lagrange. Ich wünsche dir eine gute Reise. Kommt heil durch den Monsterwald.«
»Danke! Ich lasse dir auch ein bißchen geweihtes Salz da. Damit kannst du die Monster und Dämonen vertreiben, wenn sie zudringlich werden sollten.«
»Wenigstens können sie mich damit gut würzen, bevor sie mich auffressen«, brummte Guntrol schmunzelnd und zog die Wolldecke bis zum Kinn hoch.
Zweites Kapitel.
Der Monsterwald.
Als Guntrol endlich aufstand, war es schon nach acht Uhr. Auf dem Tisch in der Schlafkammer lag ein kleiner Beutel. Er enthielt eine Handvoll Salz und einen Talisman. Daneben lag ein zusammengerolltes Papier. Es war eine einfache, aber hinreichend genaue Landkarte der nördlichen Hälfte von Zerwan. Alle wichtigen Wege und Straßen waren verzeichnet und der kürzeste Weg nach Narbon, der Hauptstadt des Landes, war unverkennbar mit roter Tinte markiert. »So blöde bin ich auch wieder nicht«, murmelte Guntrol und faltete die Karte zusammen. Er nahm den Beutel mit dem Salz und dem Talisman aus Jade und mußte dabei unwillkürlich lächeln. Er glaubte nicht an diesen Hokuspokus. Trotzdem steckte er den Talisman in seine Hosentasche und verstaute den Beutel in seinem Rucksack.
Da er Hunger hatte, begab er sich nach unten, in der Hoffnung auf ein herzhaftes Bauernfrühstück zu treffen. Jedoch fand er die Gaststube verwaist vor. Nachdem er eine Zeitlang vergeblich gewartet hatte, machte er sich auf die Suche nach den Wirtsleuten. Er fand die Wirtin schließlich in der kleinen Stube gegenüber der Küche. Sie brachte ihm ein Frühstück in die Gaststube. Auch einen halben Laib Brot und eine Wurst packte sie ihm als Wegzehrung ein.
»Ich danke Euch sehr, werte Frau! Was bin ich Euch schuldig«, fragte Guntrol, nachdem er sein ausgiebiges Frühstück beendet hatte.
»Nichts. Euer Freund hat Eure Zeche bereits heute Morgen beglichen.«
»Dann habt vielen Dank für die gute Bewirtung«, sagte Guntrol und wollte soeben sein Bündel umschnallen, als die Wirtsfrau ihn zurück hielt: »Einen Augenblick! Ich hätte es fast vergessen. Euer Freund bat mich noch, Euch etwas auszurichten. Er sagte, Ihr solltet auf keinen Fall den Weg durch den Wald nehmen, sondern lieber auf der nördlichen Straße über Zerob gehen.«
»Dieser Monsterwald, ist er so gefährlich?«
»Ich war noch nie dort und die Leute aus der Gegend, die ich kenne, auch nicht. Alle meiden ihn schon seit je her.«
»Dann gibt es da tatsächlich menschenfressende Ungeheuer?«
»Ich weiß es nicht. Ob Monster oder Verbrecher, geheuer ist es dort alleweil nicht. Vor ein paar Jahren flüchtete sich eine gefürchtete Räuberbande in den Monsterwald. Sie wurde nie wieder gesehen. Man fand später nur noch zwei herrenlose, völlig zerschundene Pferde. Wer weiß, vielleicht haben sie sich im Schutze der Nacht davon gemacht. Die Leute erzählen viel an langen Winterabenden. Ich kenne zwei Burschen aus dem Nachbarort. Die haben sich mal ein kleines Stück in den Wald hinein gewagt. Aber lange haben sie es da nicht ausgehalten. Selbst am hellen Tag dringt kaum ein Sonnenstrahl auf den Boden. Es herrscht eine unheimliche Stille. Die Bäume stehen so dicht, daß man nicht weit sehen kann. Wenn man den Weg verläßt, verirrt man sich, und in der Nacht fallen dann die Monster und Dömonen über die Wanderer her." Bei den letzten Worten senkte sie die Stimme. Guntrol spürte, ein leises Kribbeln im Bauch.
»Ist der Weg durch den Wald weit?« fragte er.
»Wenn Ihr morgens losgeht, und nicht säumt, könnt ihr am Nachmittag bereits wieder draußen sein. Der Weg auf der Straße über Zerob ist fast doppelt so lang. Doch ich würde auf jeden Fall den weiteren, aber sichereren Weg wählen.«
»Ja, das werde ich auch«, sagte Guntrol. Er verabschiedete sich von der freundlichen Wirtin und trat hinaus in die helle Morgensonne. Noch war es ziemlich frisch, aber der Himmel war klar und der Tag versprach angenehm warm und sonnig zu werden. Die frische Luft, das lustige Zwitschern der Vögel und der Duft nach frischem Gras und Frühlingsblumen vertrieben bald alle düsteren Gedanken an Monster, Teufel und Räuberbanden. Guntrol schritt zügig voran. Die Aussicht, bald nach Narbon zu gelangen und seinen Freund Lagrange zu treffen, ließ ihn unwillkürlich schneller gehen. Er war so wohlgemut, daß er eine Melodie vor sich hin pfiff. Bald hatte er das Dorf und die letzten verstreut liegenden Höfe hinter sich gelassen. Der Weg führte über grüne Wiesen und Weideflächen, vorbei an sanft geschwungenen Hügeln und fröhlich murmelnden Bächen voller glitzernder Fische.
Nach einer guten Stunde konnte er zum ersten Male den Monsterwald in der Ferne erblicken. Dieser Wald schien viel grüner und finsterer, als die Wälder auf den anderen Hügeln in der Umgebung. Von Guntrols Standort aus wirkte er freilich noch nicht sonderlich geheimnisvoll oder bedrohlich. Es war ein Wald wie jeder andere auch, nur daß er eine etwas ungewöhnliche Färbung besaß.
Bald darauf gelangte Guntrol an eine Weggabelung. Geradeaus führte der Weg nach Pfeilburg, mitten durch den Monsterwald. Links bog die Straße nach Zerob ab. Über Pfeilburg könnte er gute zwei Tage sparen. Außerdem könnte er dort vielleicht eine kleine Arbeit finden, um seine Reisekasse wieder aufzufüllen. Über Zerob wußte er nichts, außer daß es eine kleine Stadt war, die gern von Händlern auf der Durchreise besucht wurde. Dort gab es zahlreiche Herbergen und Gasthäuser.
Die Straße nach Zerob war dementsprechend gut ausgebaut. Tiefe Fahrrinnen zeugten von den vielen schweren Wagen und Karren der Händler und Bauern, die ihre Erzeugnisse in Zerob auf den Markt brachten. Der Weg nach Pfeilburg, der durch den Monsterwald führte, war nur ein etwas breiterer Feldweg, schon halb von Gras und Unkraut überwuchert. Wenn er nicht einmal im Jahr instandgesetzt würde, wäre er schon längst zugewachsen. Die Kaufleute von Pfeilburg ließen sich diese Arbeit gerne eine hübsche Summe Geldes kosten, welches sie bei den Bauen der umliegenden Dörfer und den Handwerkern in der Region wieder eintrieben, da diese ihre Erzeugnisse auch nach Pfeilburg auf den Markt brachten. Insbesondere frische, leicht verderbliche Ware konnte nur in Pfeilburg verkauft werden. Außerdem waren dort höhere Preise zu erzielen, da die Konkurrenz der Händler nicht so groß wie in Zerob war. Die Ländereien in dieser Gegend gehörten der Stadt Pfeilburg, welche als Lehensherrin auch die Steuerhoheit besaß.
Guntrol zögerte. Die Aussicht, ganz allein durch den berüchtigten Monsterwald zu marschieren, hatte wenig verlockendes an sich. Auf der anderen Seite müßte er nach Zerob einen großen Umweg machen, hätte kaum eine Möglichkeit, Geld zu verdienen und müßte unterwegs noch irgendwo übernachten. Aber der Monsterwald… Auch Lagrange hatte ihn ausdrücklich davor gewarnt.
»Guntrol, du Hasenfuß! Wolltest doch hinaus in die Welt und Abenteuer erleben. Und jetzt kneiffst du bei der ersten Gelegenheit!« sprach er ärgerlich zu sich selbst. Er schüttelte den Kopf. Die Sonne stach vom Himmel. Heute würde es ziemlich heiß werden. Im Wald wäre es dagegen angenehm kühl. Und wenn er zügig marschierte, könnte er schon am Nachmittag wieder heraus sein, und am Abend in Pfeilburg Quartier beziehen.
»Auf geht’s! Ich fürchte mich nicht!« sprach er mit frischen Mute und schlug den grasbewachsenen Weg ein.
Keine halbe Stunde darauf befand er sich im Monsterwald. Es war, als wäre er durch eine Tür hindurch getreten. Eben noch hatte er sich auf einem heißen sonnenbeschienenen Feldweg befunden, und mit einem Male stand er im finstersten Wald. Schon wenige Schritte nachdem er die ersten Büsche und Bäume am Waldrand hinter sich gelassen hatte, herrschte trübes, gräuliches Dämmerlicht. Guntrol holte tief Luft. Hier war es nicht angenehm kühl, hier begann er regelrecht zu frösteln. Er knöpfte seine Jacke zu und schüttelte unwillig den Kopf. So leicht wollte er sich nicht von seiner Einbildung an der Nase herumführen lassen. Wenigstens war es nicht totenstill, wie die Wirtin es erzählt hatte. Im Gegenteil, die Vögel machten einen richtigen Lärm. Fast klang es, als beschwerten sie sich über den Eindringling. Irgendwo klopfte ein unsichtbarer Specht, und im Unterholz huschte ein Eichhörnchen vorbei.
Alles in Ordnung, dachte Guntrol erleichtert. Hier gab es nichts, wovor er sich fürchten mußte. Der Weg war im Wald nicht mehr so breit, wie vorher, aber immer noch gut zu erkennen. Ab und zu konnte Guntrol sogar einen frischen Hufabdruck auf dem weichen Boden ausmachen. Ob er von Lagrange und seinen Gefährten stammte? Da der Trupp beritten war, mußte er mindestens zwei, vielleicht sogar drei Stunden Vorsprung haben. Guntrol ging weiter. Es schien ihm, als würde der Wald allmählich dichter und auch etwas finsterer. Er schaute nach oben. Die Baumkronen waren so dicht, daß er kaum die hoch stehende Sonne ausmachen konnte. Links und rechts des Weges sah er nur eine Wand aus Baumstämmen. Es gab kaum Unterholz, was bei den schlechten Lichtverhältnissen am Boden nicht weiter verwunderlich war. Hin und wieder lagen halb verrottete Stämme am Boden, aus denen riesige tellergroße Pilze wuchsen. Ein bißchen gruselig wurde es Guntrol schon zumute, doch er zwang sich, an etwas anderes zu denken.
Nach einer Weile blieb er stehen und lauschte. Das Vogelgezwitscher war verstummt. Außer dem leisen Rauschen des Blattwerks konnte Guntrol nur ein lautes und heftiges Pochen vernehmen. Und dieses Pochen war sein eigenes Herz. »Jetzt reiß dich zusammen!« schalt er sich. Doch seine Stimme hatte einen sonderbaren Klang. Er begann zu laufen. Aber je schneller er lief, desto enger wurde der Wald. Die Bäume schienen näher zu rücken. Guntrol lief noch geschwinder. Der Weg stieg allmählich an und Guntrol ging langsam die Puste aus. Er wurde etwas langsamer. Bei einem großen Felsen, um den der Pfad einen Bogen machte, blieb er endlich stehen. Schnaufend lehnte er sich gegen den kalten, von dichten, feuchten Moospolstern überwachsenen Stein. Er sah sich um. Niemand war zu sehen; kein Mensch, kein Tier, auch kein Ungeheuer. Das Laufen hatte ihn ziemlich ausgelaugt, was ihn sehr wunderte, da er im Allgemeinen über eine ausgezeichnete Kondition verfügte.
Guntrol ließ sich auf den Boden nieder und lehnte sich mit dem Rücken gegen den Felsen. Es mußte inzwischen Mittagszeit sein. Er beschloß daher, eine kurze Rast einzulegen und sich ein wenig zu stärken. Das dumpfe Gefühl der Beklemmung war wieder verflogen; fast so schnell, wie es ihn übermannt hatte. Gleichwohl trachtete sein Sinn nur danach, diesen finsteren Ort so rasch wie möglich hinter sich zu lassen. Er war erst kurze Zeit in dem Wald und schon hatte er das Gefühl, als hätte er seit Tagen keinen Sonnenstrahl mehr auf seiner Haut gespürt. Richtigen Hunger hatte er zwar nicht, doch brauchte er eine Stärkung. Er schnitt sich eine Scheibe Brot ab und ein Stück Wurst. Hastig und ohne Appetit verschlang er sein Essen. Ab und zu nahm er einen Schluck aus der Feldflasche. Nach und nach ließ seine Anspannung nach, und als er sein Mahl beendet hatte, merkte er auf einmal, daß er von dem Wandern, der Hitze und der Rennerei im Wald ziemlich erschöpft war. Es könnte wohl nicht schaden, wenn er sich eine halbe Stunde Ruhe gönnte, dachte er. Der Platz, an dem er sich lagerte, schien für eine Rast perfekt geeignet. Der große Felsen bot Schutz. Von dem Weg aus konnte er nicht gesehen werden. Er lehnte sich zurück und streckte die Beine weit von sich. Er schloß für einen Augenblick seine Augen und atmete tief durch.
Ein Geräusch ließ ihn die Augen wieder öffnen. War da nicht gerade ein Schatten gewesen, der sich in Blitzesschnelle in das graue Zwielicht des Waldes zurückgezogen hatte? Was war das überhaupt für ein Geräusch, das ihn aufgeschreckt hatte? Guntrol konnte sich nicht erinnern. War es nicht auf einmal viel dunkler als vorhin? Und spürte er nicht einen eisigen Lufthauch, der noch viel kälter und durchdringender war, als bei seinem Eintreten in den Wald?
Gruntrol sprang auf die Füße, als er feststellte, daß aus seinem Rucksack der Beutel mit Lagranges Bannsalz herausgefallen war. Eine kleine Menge des Salzes lag verschüttet auf dem Boden. Ein schrecklicher Gedanke durchzuckte ihn. War er vielleicht eingeschlafen und hatte den Beutel ohne es zu merken umgeworfen? Wie lange mochte er geschlafen haben? Wie spät war es überhaupt? Könnte er es noch vor Einbruch der Nacht schaffen, aus diesem verwünschten Wald zu entkommen? Hastig raffte er seine Habseligkeiten zusammen. Er versuchte, so viel von dem verschütteten Salz wie möglich aufzuklauben. Sicherheitshalber warf er eine Prise über die Schulter und nach vorne. Es gab ein feines Zischen, als das Salz durch die Luft rieselte und am Boden aufkam.
Guntrol wandte sich um und beinahe wäre ihm das Herz stehen geblieben. Auf dem Felsen, genau an der Stelle, wo er gesessen hatte, liefen mehrere tiefe Schrammen über den Stein. Sie waren tief in das Moos und sogar in den darunterliegenden Stein selbst eingegraben. Und die Kratzspuren waren ganz frisch. Als er sich hingesetzt hatte, waren sie ganz bestimmt noch nicht da gewesen. Das wäre ihm sofort aufgefallen.
Im Nu machte sich Guntrol wieder auf den Weg. Er lief los. Während er vorwärts lief, schaute er sich nach allen Seiten und ganz besonders nach hinten um. Etliche Male wäre er dabei fast vom Weg abgekommen, gegen einen Baum gelaufen, oder über eine Wurzel gestolpert. Und bei jedem seiner eiligen Schritte verfluchte er seine Entscheidung, die Abkürzung durch den Wald genommen zu haben.
Es herrschte eine teuflische Stille in dem verwunschenen Wald. Außer seinen Schritten, dem Keuchen seines Atems und dem schier ohrenbetäubenden Pochen seines Herzens, war kein anderes Geräusch zu vernehmen. Die Stille war gespenstisch. Wahrscheinlich würde hier nicht einmal ein umstürzender Baum Lärm machen.
Ohne Uhr konnte Guntrol nicht feststellen, wie spät es inzwischen war, noch wie lange er sich schon im Walde aufhielt. Die Sonne stand aber bereits ziemlich tief. Es mußte also bereits Nachmittag sein, vielleicht gegen vier Uhr. Selbst wenn er weiter in dieser Geschwindigkeit lief, was er nicht mehr lange durchhalten konnte, würde er frühestens gegen acht oder neun Uhr abends, das heißt, lange nach Sonnenuntergang, den Wald verlassen. Ihm gruselte bei diesem Gedanken und er spürte, wie sich seine Haare sträubten. Hinter jedem Baum lauerten namenlose Gefahren, starrten ihn tausend unsichtbare Augen an. Was war Einbildung, was Realität? Guntrol hatte das Gefühl, als würde er langsam durchdrehen. Wenn er wenigstens jemandem begegnete, einem Reisenden, einem Reiter, einem Räuber, irgend einem menschlichen Wesen. Alles wäre ihm recht, Hauptsache, er wäre hier nicht mehr allein. War er überhaupt allein?
Ihm ging allmählich die Luft aus. Er hatte Seitenstechen und seine Lungen brannten bei jedem Atemzug. Keuchend und schnaufend blieb er stehen. Er beugte sich nach vorn und stützte die Hände auf die Knie. Er schaute zurück auf den Weg. Jetzt erst erkannte er, daß er die ganze Zeit bergauf gelaufen war. Die Steigung war nicht steil, aber stetig. Inzwischen dürfte er wahrscheinlich einen der Hügel erklommen haben, die er am Morgen von weitem gesehen hatte. Das bedeutete aber, daß er erst ein Drittel des Waldes durchquert hatte. Nun gut, dachte, er, es ließ sich also nicht vermeiden, daß er ein Nachtlager im Wald aufschlagen mußte. Im Finsteren könnte er nicht einen Schritt wagen, selbst wenn er eine helle Laterne besäße, was leider nicht der Fall war, denn es war unmöglich den schmalen Pfad, der sich schon bei Tageslicht an manchen Stellen kaum vom übrigen Waldboden unterscheiden ließ, in der Nacht zu erkennen.
»Das hast du jetzt davon; Dummkopf!« sprach er laut zu sich. »Wo bleiben diese verflixten Räuber, wenn man sie mal braucht?«
Es geschah beinahe wie aufs Stichwort, daß Guntrol ein leises Geräusch vernahm. In der fast absoluten Stille des Waldes, kam ihm das gedämpfte Geräusch beinahe wie ein lautes Poltern vor. Tatsächlich aber handelte es sich um galoppierende Pferde, die sich rasch näherten. Das konnte nur ein Trupp Reiter sein. Sollte Guntrol sich nun freuen oder fürchten? Der Gedanke, daß er sich vielleicht bald einer Gruppe von Reisenden anschließen könnte, gab ihm neuen Mut. Doch wenn es sich dabei um eine Bande mordgieriger Verbrecher handelte, käme er vom Regen in die Traufe. Zwar kannte er Räuber nur aus Erzählungen, denn in seiner Heimat gab es so etwas seit Menschengedenken nicht, doch hier in der Fremde sah das anders aus. Was hinderte diese Gesellen daran, ihm kurzerhand den Garaus zu machen und sich an seinen Habseligkeiten zu vergreifen? Er besaß zwar keine Reichtümer, doch wurden in diesen Zeiten nicht schon Menschen wegen einer Flasche Branntwein und einem Paar Stiefel erschlagen?
Guntrol blieb nicht viel Zeit zum Überlegen, denn die Reiter kamen rasch näher. Dem Lärm nach zu urteilen, handelte es sich um einen größeren Trupp. Guntrol sah sich um. Es gab hier vereinzelt kleinere Felsbrocken, doch waren die kaum größer als ein Kürbis. Er lief ein Stück weit vom Pfad in den Wald hinein und versteckte sich hinter einem umgestürzten Baumstamm. Er legte sich flach auf den Bauch. Es schien ihm besser, die unbekannten Reiter erst einmal aus sicherer Entfernung in Augenschein zu nehmen, bevor er sich zu erkennen gab.
Kaum hatte er sein Versteck eingenommen, da kamen die ersten Reiter auf dem Weg, der eine leichte Biegung machte, zum Vorschein. Es war ein gutes Dutzend. So genau konnte Guntrol sie nicht zählen, denn sie trieben ihre Pferde im Galopp durch den Wald. Es waren große schwarze und schwarzbraune Pferde. Die Reiter waren ebenfalls schwarz gekleidet. Sie trugen Waffen, waren aber keine Jäger oder Landsknechte. Wie Räuber sahen sie aber auch nicht aus, dafür wirkten sie zu sauber und diszipliniert. Dennoch machten sie keinen vertrauenerweckenden Eindruck. Ihre Gesichter waren finster, ihr Haar pechschwarz wie die Mähnen ihrer Pferde. Das waren keine Leute aus der Gegend, wahrscheinlich nicht einmal aus Zerwan. Sie sahen aus wie Ausländer aus dem Süden. Ihre Kleidung und die Zäume und Sättel der Pferde wirkten exotisch. Guntrol, der noch nie einen Ausländer gesehen hatte, fragte sich, wo diese Männer herkamen und vor allem, was sie hier suchten. Was sollte er tun? Er war unschlüssig. Wenn das Salvianer oder gar Karpaschen waren, würde er besser in seinem Versteck bleiben. Über diese Länder und ihre Bewohner hatte er nichts gutes gehört. Die fremden Reiter sprachen kein Wort. Noch bevor Guntrol einen Entschluß fassen konnte, waren sie an seinem Versteck vorbei gerauscht. Schon wenig später wurde das Geräusch der Pferdehufe vom Wald verschluckt und es kehrte wieder die gewohnte Totenstille ein. Zurück von dem Spuk blieb nur ein bißchen aufgewirbelter Staub in der Luft und ein paar Hufabdrücke im Boden.
Guntrol seufzte leise. Von diesen finsteren Gesellen wäre ohnehin kein Beistand zu erwarten gewesen, dachte er enttäuscht. Vielleicht vertrieben sie wenigstens die Monster, oder zogen zumindest deren Aufmerksamkeit auf sich.
Tapfer marschierte er weiter. Die nächsten Stunden vergingen wie im Fluge, so erschien es ihm zumindest. Da es in diesem Wald keine Wegmarken gab, war es unmöglich, festzustellen, welche Strecke er bereits zurückgelegt hatte. Also trottete er einfach weiter. Müde und fast mechanisch bewegten sich seine Beine Schritt für Schritt vorwärts. »Warum stellen die nicht wenigstens ein paar Wegweiser auf?« maulte er verdrießlich.
Tatsächlich wurden die Wegweiser jährlich erneuert, aber mit einer mysteriösen Regelmäßigkeit verschwanden diese Zeichen nach kurzer Zeit wieder. Sogar Steine, die tief neben dem Weg eingegraben wurden, waren nach einiger Zeit verschwunden, als hätten sie sich im Boden aufgelöst. Nicht einmal Löcher blieben davon zurück. Also beschränkte man sich darauf, Zeichen an den Bäumen anzubringen, die zwar auch mit der Zeit unsichtbar wurden, aber weniger Kosten verursachten und leichter zu erneuern waren. Es schien, als duldete der Wald keinerlei Veränderungen durch den Menschen mit Ausnahme des schmalen Pfades, der auf wundersame Weise erhalten blieb. In einem anderen Land hätte man einen derart widerspenstigen Wald vielleicht kurzerhand gerodet. Doch so etwas kam in Zerwan nicht in Frage. Das Roden von Wäldern galt als ein schweres Verbrechen und eine Sünde wider die Götter. Die Menschen beließen es dabei, an den Rändern verwunschener Wälder – von denen es außer dem Monsterwald bei Pfeilburg im ganzen Lande nur etwa eine Handvoll gab – kleine steinerne Schreine aufzustellen und sich ansonsten von diesen Wäldern tunlichst fern zu halten. Es gab eine unausgesprochene Vereinbarung zwischen den Menschen und den Geschöpfen des Waldes, die besagte, daß der Tag den Menschen und die Nacht den Tieren, Geistern und Dämonen gehörte. So lange alle sich daran hielten – was meistens der Fall war – gab es keine Probleme.
Guntrol griff nach dem kleinen Talisman in seiner Hosentasche. Doch statt ihn zu beruhigen und ihm neuen Mut zu schenken, verstärkte sich das mulmige Gefühl in seiner Magengegend. Eigentlich mußten Lagrange und die Ritter des Königs längst aus dem Wald heraus und in Sicherheit sein, aber warum fühlte er sich dann so schlecht, wenn er an seinen Freund dachte?
Die Sonne stand inzwischen so tief, daß es langsam Zeit wurde, sich Gedanken über ein geeignetes Nachtlager zu machen. Eine schützende Höhle wäre natürlich perfekt, aber so etwas gab es hier nicht. Und selbst wenn es irgendwo im Wald eine Höhle gäbe, wie sollte er sie finden und wen würde er dort allenfalls antreffen? Guntrol wußte, daß er den schmalen Pfad unter keinen Umständen verlassen durfte. Er sah sich um, doch nirgends konnte er eine auch nur halbwegs geschützte Stelle entdecken. Auf alle Fälle sollte er ein Feuer anzünden. Damit wäre er zwar weithin sichtbar, doch hielte es wenigstens die Tiere ab und immerhin könnte er dann ein bißchen etwas sehen. Zumindest könnte er sehen, wer oder was ihn anfiele und auffräße.
»Wenn ich nur ein Pferd hätte!« stöhnte er. Ein leises Wiehern schreckte ihn aus seinen Gedanken auf. Das wurde langsam unheimlich. Immer, wenn er sich etwas wünschte, passierte es gleich darauf. Er sprang hinter einen Baum und wartete. Tatsächlich näherte sich ein Pferd im Trab. Es kam genau aus der entgegengesetzten Richtung, und es war ganz allein. Kein Reiter saß im Sattel. Die Steigbügel hingen lose herab. Guntrol trat auf den Pfad hinaus und stellte sich mit ausgestreckten Armen dem Tier in den Weg. Das Pferd verlangsamte seinen Gang und blieb zuletzt schnaubend vor Guntrol stehen. Es war ganz naß vor Schweiß, die Vorderbeine waren schmutzig und zerschrammt, als wäre es gestürzt.
»Ruhig, Brauner!« sprach Guntrol mit sanfter Stimme zu dem sichtlich aufgeregten Tier, das mit hoch erhobenem Kopf und angelegten Ohren, ängstlich zurückwich.
»Hab keine Angst. Ich tue dir nichts«, sagte Guntrol Er griff nach dem Zaum und hob die Zügel auf, die am Boden schleiften. Vorsichtig strich er mit der flachen Hand über den Hals des Pferdes. Das Tier beruhigte sich und begann an ihm zu schnuppern. Es stubste ihn mit der Nase an und stöberte an seinen Hosentaschen. Guntrol mußte lächeln. »Nein, ich hab da nichts für dich. Aber wo kommst du her und was ist mit deinem Herrn geschehen?« Er betrachtete Sattel und Zaum. Als er die ziemlich schmutzige Satteldecke sah, erschrak er. Er erkannte sogleich das königliche Wappen von Zerwan. Dieses Pferd mußte einem der Ritter oder dem Herold gehören.
»Tut mir leid, mein Junge, aber du kannst dich jetzt noch nicht ausruhen«, sagte er, während er die Satteldecke und die verrutschten Gurte in Ordnung brachte. Guntrol war zwar kein besonders guter Reiter, doch vermochte er sich einigermaßen sicher im Sattel halten. Er schwang sich in den Sattel und trieb das Pferd in leichtem Galopp den Weg entlang. Das Pferd war ziemlich erschöpft, doch konnte Guntrol, so leid es ihm tat, darauf keine Rücksicht nehmen. Irgend etwas schlimmes mußte geschehen sein. Wäre das Pferd bei einer Rast ausgerissen, wären die Steigbügel hochgezogen und der Sattelgurt gelockert gewesen. Wäre der Reiter unterwegs abgeworfen worden, hätten seine Gefährten das Pferd bestimmt rasch wieder eingefangen.
Es dauerte eine Weile, bis er zu dem Ort des Geschehens vorgedrungen war. An einer Stelle, wo der Pfad sich zu einer etwas größeren baumlosen Fläche verbreiterte, die man aber noch lange nicht als Lichtung bezeichnen konnte, bot sich Guntrol ein entsetzliches Bild. Als erstes fand er einen leblosen, zerschundenen Körper auf der Erde liegen. Er hielt an und sprang vom Pferd um nach dem Unglücklichen zu sehen. Es handelte sich um einen der fremden schwarzen Reiter. Sein Schädel war eingeschlagen und blutüberströmt. Allem Anschein nach war der Mann tot. Guntrol konnte nichts mehr für ihn tun. Er stieg wieder auf und ritt weiter. Doch schon nach kaum zwanzig Metern fand er ein weiteres Opfer. An dieser Stelle mußte ein heftiger Kampf stattgefunden haben. Pfeile steckten im Bäumen und Menschenleibern. Guntrol zählte mindestens fünf Gefallene. Er stieg ab und band das Pferd an einen Baumstamm. Hinter einem Baumstrunk fand er einen der drei Ritter, die er am vergangenen Abend in der Herberge hatte kennen lernen. Auch er war tot. In seiner Hand hielt er ein blutiges Schwert. In seiner Brust steckte ein Pfeil, ein anderer hatte seinen Hals durchschlagen. Der Mann war offensichtlich verblutet. Guntrol schluckte schwer. Beim Anblick des vielen Blutes wurde ihm übel.
Was war hier geschehen? Wo war Lagrange? Lebte sein Freund noch? Über der grausigen Szenerie lag eine bleierne Stille. Das Schnauben des Pferdes und Guntrols keuchender Atem waren die einzigen Geräusche. Guntrol lief weiter. »Lagrange!« rief er laut. Seine Stimme klang, als hätte er ein Kissen vor dem Gesicht. Kein Echo, kein Widerhall war zu vernehmen. Alles wurde von den Bäumen verschluckt. »Lebt hier noch jemand?« Keiner antwortete auf sein Rufen. Er ging weiter und fand den zweiten Ritter, sowie zwei der Schwarzen. Alle waren tot. Ihre Körper wiesen Schnittwunden wie nach einem Schwertkampf auf. Atemlos lief Guntrol weiter. Vor einem großen, mannshohen Felsen lagen der Anführer der Ritter und drei erschlagene Schwarze. Die Ritter mußten sich tapfer gewehrt haben, denn sie hatten eine Vielzahl an Gegnern erledigt.
Ein leises Stöhnen ließ Guntrol aufhorchen. Es kam von der anderen Seite des Felsens. Er zog sein Handbeil aus der Gürtelschlaufe. Mit dem Beil in der Rechten und seinem Messer in der Linken umrundete er den Felsbrocken. Es war schon fast dunkel und er konnte kaum etwas sehen. Daher gewahrte er den Schatten, der ihn schräg von oben ansprang, erst als es schon zu spät war, um auszuweichen. Instinktiv hob er den Arm. Etwas schweres schlug ihm das Beil aus der Hand und traf ihn seitlich am Schädel. Vor seinen Augen explodierte eine Kugel aus tausend bunten Funken, dann raste der Erdboden auf ihn zu. Ihm wurde schwarz vor Augen.
Als Guntrol wieder zu sich kam, fühlte er ein Summen im Kopf und vor seinen Augen drehte sich alles. Er hatte das Gefühl als würde er sich im Kreise drehen, doch seine Hand berührte den feuchten, kühlen Waldboden. Auf seiner Stirn lag etwas feuchtes, von dem es in seine Augen tropfte, so daß er ständig blinzeln mußte. Ein heller Fleck erschien in seinem Gesichtsfeld und bewegte sich hin und her. Guntrol kniff die Augen zusammen. Der Fleck verdichtete sich zu einem Gesicht. Doch es war zu verschwommen, um es erkennen zu können. Aber die Stimme, die ihn ansprach erkannte er sogleich.
»Guntrol! Gott sei Dank! Da bist du wieder!«
»Lagrange?« Guntrols Stimme war heiser. Sein Mund fühlte sich trocken an und seine Zunge war wie aus Leder. Er hob die Hände zum Gesicht, zog den nassen Lappen von der Stirn und rieb sich die Augen. Er versuchte, sich aufzurichten, doch Lagrange, der neben ihm am Boden kniete, drückte ihn sanft nieder.
»Bleib noch ein bißchen liegen. Du hast eine dicke Beule am Schädel.« Lagrange klang sehr erleichtert.
»Was ist passiert?« fragte Guntrol matt. Lagrange schwieg betreten. Er seufzte. Dann sagte er: »Es tut mir so leid, mein Freund. Ich habe dich mit meinem Stab niedergeschlagen. Ich dachte, du wärest einer von denen.«
»Schon gut. Nach allem, was ich gesehen habe, kann ich das verstehen.«
»Nein!« entgegnete Lagrange heftig. »Es ist nicht gut. Ich habe einen Menschen angegriffen. Ich war erfüllt von Zorn und Haß. Ich wollte töten… Ich bin nicht würdig, diesen Rock zu tragen.«
Guntrol richtete sich auf. Ein dumpfer, pochender Schmerz in seinem Kopf nahm ihm für einen Augenblick den Atem. Er griff sich an den Schädel, wo er einen feuchten, schmierigen Verband fühlte. Das feuchte, schmierige, war sein Blut, wie er mit einem Blick auf seine Finger feststellte.
»Lagrange, mach dir keine Vorwürfe. Du bist auch nur ein Mensch, und mir ist nichts weiter geschehen.« Lagrange saß mit hängendem Kopf da. Guntrol schaute sich um. Ein kleines Lagerfeuer spendete ein wenig Licht und Wärme. Neben dem Feuer lag eine leblose Gestalt am Boden. Sie war mit einer Wolldecke zugedeckt, so daß Guntrol nicht erkennen konnte, um wen es sich handelte. Lagrange folgte seinem Blick und sagte: »Das ist der Herold.«
»Ist er…«
»Er lebt gerade noch, aber er ist besinnungslos. Seine Verletzungen sind so schwer, daß ich fürchte, er wird die Nacht nicht überleben. Ich kann leider kaum etwas für ihn tun. Ich bin kein Heiler und ich habe keine Arznei oder Heilkräuter dabei. Und hier im Wald wachsen auch keine.«
Guntrol setzte sich auf. Lagrange stützte ihn. Er holte eine kleine Flasche aus seinem Beutel hervor und reichte sie Guntrol. »Hier trink einen Schluck! Dann geht es dir besser.« Guntrol entkorkte die Flasche und nahm einen Schluck daraus. Es schmeckte scharf und bitter. Er verzog das Gesicht und unterdrückte einen aufkommenden Hustenreiz. »Das Zeug muß sehr gesund sein, so scheußlich wie das schmeckt«, sagte er. Nachdem der bittere Geschmack verflogen war, merkte er, wie ihn ein wohliges Wärmegefühl durchströmte. »Was ist das für ein Zeug?« Er nahm noch einen Schluck und gab die Flasche Lagrange zurück.
»Das ist ein Extrakt aus verschiedenen Heilkräutern. Es ist ein ausgezeichnetes Stärkungsmittel; es hilft bei Magenschmerzen, Fieber und äußerlich angewendet gegen Verstauchungen und Geschwulste.«
»Der Hauptbestandteil scheint mir Weingeist zu sein«, meinte Guntrol.
»Ja, hauptsächlich«, sagte Lagrange ein wenig abwesend. Er stand auf und ging zu dem verwundeten Herold, der noch immer regungslos da lag.
Guntrol zog sich an dem Felsen hoch, bis er, noch sehr wackelig, auf den Beinen stand.
»Paß auf! Ich habe einen Bannkreis errichtet. Tritt nicht über die Linien«, sagte Lagrange. Guntrol kniff die Augen zusammen. Er mußte schon genau hinschauen, dann konnte er aber am Boden eine dünne weiße Linie erkennen, die einen Kreis von ungefähr zehn Metern um ihr Lager beschrieb. In regelmäßigen Abständen waren Symbole, deren Bedeutung Guntrol gänzlich unbekannt war, in die Erde geritzt
»Wofür soll das denn gut sein?« fragte er. Bevor Lagrange ihm antworten konnte, erscholl aus der Tiefe des Waldes ein unheimlicher Schrei, der nichts menschliches an sich hatte. Guntrol konnte dieses Geräusch keinem ihm bekannten Tiere zuordnen. Und die Tatsache, daß der Schrei in ebenso unheimlicher Weise erwidert wurde, war ebenfalls nicht gerade dazu angetan, seine Zuversicht zu steigern.
»Ich hoffe, das funktioniert auch«.
»Das hoffe ich auch«, sagte Lagrange und warf einen prüfenden Blick auf den Kreis.
»Was ist mit euch geschehen? Wer sind diese schwarzen Reiter, die euch angegriffen haben?«
»Ich weiß es nicht«, sagte Lagrange. »Wir waren in der Frühe von der Herberge aufgebrochen. Zunächst ging alles gut. Wir kamen rasch voran. Der Monsterwald war kein Hindernis für uns. Ich setzte meine spirituellen Kräfte ein, so gut ich konnte, um uns gegen die Chimären und Trugbilder zu schützen. Bei Tag ist die Aura des Waldes nicht so stark. Wir kamen ein gutes Stück voran. Doch dann begingen wir einen Fehler. Wir wollten die Pferde schonen, und da wir gut in der Zeit lagen, machten wir eine Rast. Eines der Pferde war gestrauchelt und hatte sich am Bein verletzt. Also beschlossen wir, uns zu lagern, derweil ich nach dem Pferde sah. Die Verletzung war schlimmer, als es zunächst aussah. Da es noch früh war, und wir schon fast zwei Drittel des Weges hinter uns gebracht hatten, beschlossen wir, dem Tier ein paar Stunden Ruhe zu gönnen. Auf einmal waren dann diese schwarzen Teufel da. Sie tauchten wie aus dem Nichts auf und griffen uns ohne Vorwarnung an. Die Ritter kämpften tapfer und heldenhaft. Leider war ich ihnen keine große Hilfe.« Lagrange senkte den Kopf und preßte die Lippen aufeinander. Dann fuhr er fort: »Ich beherrsche keine Angriffsmagie und gegen Pfeile und Schwerter vermag ich nicht viel auszurichten. Zunächst stand die Sache für uns nicht schlecht. Doch dann fielen die tapferen Ritter einer nach dem anderen. Zuletzt griff auch der Herold nach seinem Schwert, nachdem wir unsere Pfeile alle verschossen hatten. Er drückte mir seine Tasche in die Hand und ich mußte ihm versprechen, sie an seiner statt in die Hauptstatdt zum Königspalast zu bringen. Dann stieß er mich hinter den Felsen und nahm den Kampf gegen die letzten drei Angreifer auf. Zwei von ihnen muß er noch erledigt haben, bevor er zu Boden ging. Der letzte ist geflohen. Die Pferde gingen im Kampfgetümmel durch. Sie sind entweder in den Wald gelaufen oder dem Pfad gefolgt.«
»Das heißt, daß sich einer von der Mörderbande noch hier irgendwo im Dunkeln herumtreibt?« fragte Guntrol und sah sich erschrocken nach allen Seiten um. Lagrange schüttelte den Kopf. »Nein, ich glaube nicht. Ich habe einen wegreiten sehen. Er hatte es sehr eilig. Ich denke nicht, daß er allein noch mal zurückkehrt. Die Leute sind nicht von hier.«
»Salvianer, so wie die aussahen.«
»Oder Karpaschen. Ich habe ein paar Wörter auf Karpasch aufgeschnappt. Aber das muß nichts heißen. Ich vermute, daß es eine Truppe von angeheuerten Söldnern war, die für Geld jede Schandtat begehen. So lange wir nicht wissen, in wessen Sold sie standen…«
»Vielleicht sollten wir mal nachschauen, was in der Tasche ist«, schlug Guntrol vor. »Es ist doch offensichtlich, daß die Kerle nicht einfach so auf Mord aus waren, sondern hinter irgend einer Sache her waren. Und zwar einer sehr wertvollen Sache.«
Lagrange schüttelte den Kopf. »Geht nicht. Die Tasche ist fest verschlossen und ich habe keinen Schlüssel.«
Der Herold gab ein leises Stöhnen von sich. Sogleich eilte Lagrange an sein Lager. Der Mann schlug die Augen auf. Er schaute Lagrange und Guntrol mit leerem Blick an, dann erkannte er Guntrol wieder. »Der junge Mann aus der Herberge…« sprach er mit brüchiger Stimme. Guntrol verbeugte sich.
»Meister Lagrange! Ich bitte Euch! Und Euch auch, junger Freund!« Er holte rasselnd Atem. Es dauerte eine Weile, bis er wieder genug Kraft zum Sprechen fand.
»Bitte, Herr! Ihr dürft Euch nicht anstrengen«, sagte Lagrange. Doch der Herold entgegnete: »Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ihr wißt, daß ich bald sterben muß. Deshalb hört mir bitte gut zu: In der braunen Ledertasche, die ich Euch… wo ist sie? Habt Ihr sie?«
»Ja, ich habe sie hier. Sie liegt gleich dort drüben, rechts von Euch.« Der Herold drehte den Kopf. Beim Anblick seiner Tasche beruhigte er sich wieder. Das Atmen fiel ihm sichtlich schwer und das Sprechen mußte eine große Anstrengung sein.
»Das ist gut. In dieser Tasche befindet sich die Zukunft unseres Landes. Sie muß auf dem schnellsten Weg zum König gebracht werden. Viele fremde Mächte haben es darauf abgesehen. Wenn es in die falschen Hände fällt, könnte es das Ende unseres Königreiches bedeuten, vielleicht sogar das Ende für alle Länder auf dem Erdteil. Versprecht mir, daß ihr das Geheimnis bewahren werdet.« Er richtete sich auf und griff nach Lagranges Hand. Sein Atem ging keuchend und stoßweise. »Euch wird eine reiche Belohnung zuteil werden. Bringt die Tasche nach Narbon zum König.«
»Das wollen wir gern tun«, versprach Lagrange. »Wenn es so wichtig ist.«
»Dann schwört es bei allem, was Euch heilig ist. Und schwört, daß Ihr die Tasche nicht öffnen werdet. Ich habe Vertrauen in Euch, doch bei einer Sache dieser Größenordnung sind schon viele schwach geworden.«
»Ich verspreche, daß ich die Tasche nicht aufmachen werde und daß ich alles dran setzen werde, daß sie unversehrt zum König gelangt« sprach Lagrange feierlich.
»Und Ihr, junger Mann, steht Eurem Freund bei. Ich bitte Euch im Namen des Königs.«
»Ich will dem König und meinem Land immer treu dienen«, versprach Guntrol.
»Dann ernenne ich Euch hiermit Kraft meines Amtes zum königlichen Boten. Nehmt mein Schwert, und was immer Euch von meinem Besitz nützlich…« er konnte nicht mehr weitersprechen. Seine letzten Worte gingen in einem Röcheln unter. Sein Kopf fiel zur Seite und seine Hand, welche die ganze Zeit die Lagranges fest umklammert hatte, wurde kraftlos und sank schlaff herab.
Lagrange legte seinen Kopf auf die Brust des Heroldes und horchte.
»Sein Herz schlägt nicht mehr«, sagte er leise. Er legte die Hände des Toten auf dessen Brust und zog die Wolldecke bis über sein Gesicht.
»Was sollen wir jetzt tun?« fragte Guntrol. Er merkte, wie ihm die Beine zitterten, ohne daß er etwas dagegen tun konnte.
»Wir werden eine Andacht für die Seele des Verstorbenen halten«, sagte Lagrange und nahm die Perlenkette mit den einhundertacht Holzperlen, die er am Gürtel trug, in die Hand. Er murmelte eine Beschwörung und warf eine Handvoll Salz
ins Feuer und in jede Himmelsrichtung.
»Komm!« spach er zu Guntrol. »Mach auch mit!«
»Ich kenne die Worte nicht so genau.«
»Sprich mir einfach nach.« Guntrol kniete neben Lagrange und faltete die Hände. Gemeinsam beteten sie die Litanei der einhundertacht Anrufungen.
Als sie damit fertig waren, legte Lagrange seine Hand auf Guntrols Schulter. »Leg dich ein bißchen hin und versuche zu schlafen.« Guntrol wollte protestieren, aber nach der Aufregung und den Anstregungen der vergangenen Stunden, fühlte er sich schwach und ausgelaugt. Jetzt, wo die Anspannung von ihm wich, fühlte er die Erschöpfung um so stärker. Er legte sich neben dem Feuer hin und hüllte sich in die Decke. Sein Rucksack diente als Kopfkissen. Kaum hatte er die Augen geschlossen, fiel er sogleich in einen tiefen, traumlosen Schlummer.
Als er aufwachte, war die Sonne eben aufgegangen. Ein hellroter Schimmer funkelte zwischen den silbrig grauen Baumstämmen hervor. Lagrange lehnte an dem Felsen. Seinen Stab hielt er mit beiden Händen umklammert. Seine Augen waren geschlossen. Guntrol ging zu ihm hinüber und stubste ihn sachte an. Lagrange zuckte zusammen und riß die Augen auf.
»Oh, Gott! Ich bin eingeschlafen!« rief er erschrocken. Er faßte mit der Hand unter sich. Erleichtert fühlte er die Tasche des Herold, auf der er die ganze Zeit gesessen hatte.
»Alles in Ordnung, Lagrange«, sagte Guntrol. »Auch du brauchst deinen Schlaf.«
Lagrange stand auf. Er untersuchte als erstes den Bannkreis und fand ihn zu seiner Befriedigung unversehrt. »Er hat die ganze Nacht gehalten«, sagte er. »Das hätte ich nicht gedacht.« Guntrol, der ihm auf den Felsen gefolgt war, stieß einen leisen Schrei aus.
»Was ist? Du hast mich erschreckt«, rief Lagrange und rieb sich ein Ohr. Guntrol deutete mit der ausgestreckten Hand auf den Schauplatz des Kampfes. »Sie sind alle weg«, stieß er keuchend hervor. Lagrange nickte und sagte: »Ja, so etwas habe ich erwartet. Deshalb auch der Bannkreis. Wenigstens haben wir das Pferd noch.«
Tatsächlich war das Pferd, welches Lagrange innerhalb des Bannkreises angebunden hatte, unversehrt, wenngleich es keinen entspannten Eindruck machte.
»Was machen wir mit ihm?« fragte Guntrol und deutete auf die Leiche des Herolds.
»Wir können ihn nicht an einem Platz wie diesem lassen. Wir nehmen ihn mit bis in den nächsten Ort. Dort sorgen wir dafür, daß er ein schickliches Begräbnis erhält. Immerhin war er ein Herold des Königs.«
Sie wickelten den toten Körper in die Decke und banden ihn auf dem Rücken des Pferdes fest. Schweigend suchten sie ihre Sachen zusammen. Lagrange reichte Guntrol das Schwert und die blaue Schärpe des Herolds. »Nimm! Es gehört dir«, sagte er.
»Aber…«
»Du bist jetzt ein königlicher Bote und das sind deine Insignien.«
Zögernd nahm Guntrol die Schärpe und band sie sich um. Er steckte das Schwert in seinen Gürtel. Es fühlte sich merkwürdig an. »Ich kann doch gar nicht damit umgehen.«
»Dann ist jetzt vielleicht gerade die richtige Zeit, es zu lernen«, meinte Lagrange nachdenklich.
Drittes Kapitel.
Pfeilburg.
Sie erreichten den Waldrand nach einer guten Stunde. Nicht weit davon entfernt lag ein Dorf, ein Vorort von Pfeilburg. Sie gaben die Leiche des Herolds in die Obhut des Dorfvorstehers und berichteten wahrheitsgetreu von dem Überfall durch die fremden Reiter. Von der geheimen Mission erzählten sie freilich nichts. Lagrange als Schamane und Guntrol als königlicher Bote galten als vertrauenswürdige Zeugen; und so dauerten die Formalitäten nicht sehr lange. Der Dorfvorsteher nahm die persönlichen Habseligkeiten des Herolds in Empfang und versprach, für ein schickliches Begräbnis zu sorgen.
Nachdem Guntrol und Lagrange sich im Hause des Ortsvorstehers hatten verpflegen lassen, brachen sie gegen Mittag gemeinsam in Richtung Pfeilburg auf. Da sie nicht genug Geld besaßen, um sich ein zweites Pferd zu kaufen, verkauften sie das Pferd und machten sich zu Fuß auf die Weiterreise.
»Immerhin haben wir jetzt genug Geld, daß wir uns etwas ordentliches zu essen und ein Nachtquartier in einem guten Gasthof leisten können«, sagte Guntrol. »Vielleicht hätte ich das Schwert auch verkaufen sollen. Das hätte bestimmt eine Menge Geld eingebracht; wahrscheinlich mehr als das Pferd.« Lagrange lachte kopfschüttelnd. »Wenn du es wirklich verkaufen willst, dann mach das in der Stadt. Dort wirst du eher jemanden finden, der daran Interesse hat, als in so einem Bauernkaff. Doch an deiner Stelle würde ich es lieber behalten.«
»Daß ausgerechnet du so etwas sagst…«
»Ja, ich weiß auch nicht. Eigentlich verabscheue ich Waffen und Gewalt.«
»Dürfen königliche Boten überhaupt Schwerter tragen?« fragte Guntrol während er zum wiederholten Male das Schwert zurecht rückte. »Das sieht zwar fesch aus, aber angenehm ist es nicht. Bis heute Abend habe ich bestimmt schon jede Menge blauer Flecken am Bein.«
»Da bin ich überfragt. Vielleicht solltest du es einpacken.«
»Es paßt weder in meinen Rucksack noch in den Beutel und in der Hand mag ich es auch nicht die ganze Zeit tragen.«
Sie gingen schweigend weiter. Ihr Weg führte sie über eine schöne neue Landstraße. Gelegentlich begegneten ihnen Wagen und Bauernkarren. Manch einer der Bauern war so freundlich, sie ein Stück Weges auf seinem Karren mitfahren zu lassen. So kamen sie bereits am frühen Nachmittag in der Handelsstadt Pfeilburg an.
Pfeilburg lag am Fuße eines bewaldeten Hügels, auf dem sich die namengebende Burg erhob. Es handelte sich um ein großes altmodisches Gebäude mit vier runden Spitztürmen und einem viereckigen Bergfried. Ursprünglich als Trutz- und Fluchtburg errichtet, beherbergte sie heute den Stammsitz der Fürstenfamilie von Pfeilburg.
Die Stadt selbst war von einer nicht besonders stark befestigten Ringmauer umgeben. Seit Generationen lebte das Land in Frieden, und so hatte nie eine besondere Notwendigkeit bestanden, die Festungswerke zu erneuern oder auszubauen. Der Ringgraben war halb trocken gefallen und von undurchdringlichem Gestrüpp überwuchert. Die Kinder fingen dort Frösche und spielten in dem verwachsenen Grund. An einigen Stellen gediehen mächtige Brombeerhecken, deren Blütenreichtum bereits die reiche Ernte des Sommers erahnen ließ. Vor den Stadttoren, welche nur nachts geschlossen wurden, tagsüber aber unbewacht offen standen, erstreckten sich Felder, Bauerngehöfte und vereinzelte Landhäuser wohlhabender Stadtbewohner. Abgesehen von den halb verfallenen Befestigungswerken machte die Stadt aber einen schmucken, sauberen und durchaus wohlhabenden Eindruck. Die Fachwerkhäuser waren frisch getüncht und strahlten in einem reinen Weiß. Vor den Fenstern standen Blumentröge. Die Straßen waren sämtlich gepflastert. Die Stadt zählte gut fünfundzwanzigtausend Einwohner und gehörte damit zu den fünf größten des Königreiches.
Im Süden lag der Allwei, ein mächtiger Fluß, der gen Osten nach Ruritanien floß, wo er südlich der Hauptstadt Rubasch in den großen Nall-Strom mündete, welcher seinerseits weit im Süden die Grenze zwischen den Ländern Pallandien und Salvia bildete, bevor er in die Balwasee mündete. Der Fluß war über weite Strecken schiffbar und stellte so eine wichtige Transportroute für Handelsgüter aller Art dar. Praktisch alle Städte an seinen Ufern lebten vom Handel und der Schiffahrt.
Pfeilburg freilich profitierte nur eingeschränkt von diesem Handelsweg. Das lag zum einen daran, daß die Stadt über nur einen kleinen Schiffsanleger und keinen richtigen Hafen verfügte; zum anderen war der Fluß hier an seinem Oberlauf recht flachgründig und für große Handelsschiffe somit nicht befahrbar. Dafür konnte man in der wasserreichen Jahreszeit unzählige Flöße sehen, die Bauholz, aber auch Wolle und andere Güter aus dem Osten Zerwans nach Ruritanien beförderten.
Guntrol, der noch nie in einer so großen Stadt gewesen war, staunte nicht schlecht, als er an Lagranges Seite durch das große Sandsteintor im Osten in die Stadt einzog. Hoch oben an dem spitzen Turm, der mit glänzenden, bunt glasierten Ziegeln gedeckt war, wies ein goldener Wetterhahn die Windrichtung, und auf der weiß gekalkten Mauer zeigte eine große Sonnenuhr den Bewohnern die Uhrzeit an.
»Wenn du schon darüber staunst, dann warte erst, bis wir nach Narbon kommen. Dort gibt es sogar eine mechanische Uhr«, sagte Lagrange.
»So viele Leute. Das ist mir fast schon unheimlich«, meinte Guntrol während er seine Blicke in die Runde schweifen ließ.
»Gestern waren es für dich zu wenige, und heute zu viele Leute«, sagte Lagrange schmunzelnd.
»In diesem Gewimmel weiß man nicht, wo der Feind lauert. Was wenn sie uns hier angreifen? Sie schnappen sich die Tasche und verschwinden zwischen den Häusern. Hier finden wir sie nie wieder«, sagte Guntrol. Lagrange schüttelte den Kopf. »Mach die keine Gedanken. Ich glaube nicht, daß sie uns hier mitten in der Stadt angreifen werden.«
»Wenn du es sagst. Aber der Weg in die Hauptstadt ist noch so weit. Wie sollen wir das ganz allein und ohne Schutz schaffen? Vielleicht sollten wir uns an die Behörden wenden. Der Fürst könnte uns einen Trupp Bewaffneter zum Geleit zu Verfügung stellen.«
»Vergiß nicht, Guntrol, du bist nur ein Bote, kein Herold. Der Fürst hat keine Verpflichtung, außer dein sicheres Geleit durch sein Land zu gewährleisten. Außerdem sollten wir lieber niemanden einweihen. Wir wissen nicht, was für ein Geheimnis wir bewahren. Jemand falsches einzuweihen, könnte sich als großer Fehler erweisen. Vor allem, wenn es sich um einen mächtigen Mann wie den Fürsten handelt. Außerdem bin ich der Ansicht, daß wir zu zweit, ohne großen Geleitschutz, geschwinder und viel unauffälliger reisen können. Dich kennen sie nicht, mich haben sie auch nur von weitem gesehen. Für die Leute in der Stadt sind wir nur zwei harmlose Wanderer.«
»Ich verstehe«, antwortete Guntrol. Er zog seine Jacke aus und nahm die Schärpe mit dem königlichen Wappen ab. Er faltete sie sorgfältig zusammen und verstaute sie in seinem Rucksack.
»Das ist eine gute Idee«, so sind wir zwei einfache Reisende. Nur dein Schwert paßt nicht zu deiner Aufmachung.«
»Da wird mir schon etwas einfallen.« Guntrol rückte es zurecht. »Das kann beim Gehen ganz schön hinderlich sein. Ich frage mich, was die Ritter machen, daß sie nicht ständig darüber stolpern.«
»Sie gehen wenig zu Fuß«, sagte Lagrange und lachte.
Sie gingen weiter die Hauptstraße entlang, welche in den großen Marktplatz mündete. Da an diesem Tag kein Markttag war, gab es wenig Leute auf dem Platz und die beiden konnten ungehindert die prächtigen Fassaden der herrschaftlichen Steinhäuser bewundern. »Wir sollten uns als erstes eine Unterkunft suchen«, schlug Lagrange vor. »Dann können wir uns etwas ausruhen und ein paar Einkäufe erledigen.«
»Da drüben gibt es ein Gasthaus«, sagte Guntrol und deutete auf die andere Seite des Platzes. Lagrange zog die Augenbrauen hoch und schüttelte den Kopf. »Leider habe ich meinen Goldesel zu Hause gelassen. Ich dachte eher an eine etwas preiswertere Unterkunft. Unser Geld muß schließlich noch eine Weile reichen. Ich erinnere mich, daß wir vorhin an einer Herberge vorbei kamen. Aber sicherheitshalber fragen wir am besten einen der Einheimischen.«
»Wenn du meinst.« Guntrol sah sich etwas unbeholfen auf dem großen Platz um. Derweil trat Lagrange forsch auf eine ältere Dame zu und frage sie ungeniert, ob sie nicht eine saubere aber nicht zu teure Herberge wüßte. Die Frau schaute die beiden musternd an, als wolle sie ihre Kreditwürdigkeit taxieren. Schließlich sagte sie: »Am besten geht Ihr runter in die Fischerstube. Das ist unten am Berg, kurz vor dem Südtor. Sie haben da eine gute Küche, und die Unterkunft soll sauber sein. Und teuer ist es auch nicht. Natürlich gibt es auch billigere Absteigen, aber an so einen Ort kann ich einen Mann wie Euch nicht verweisen.«
Lagrange bedankte sich höflich bei der Frau für die Auskunft. Sie gingen in die angegebene Richtung. »Da drüben geht es runter«, sagte Lagrange und deutete mit seinem Stab in die Richtung. Es dauerte eine Weile, bis sie in dem Gewirr von engen und verwinkelten Gassen den richtigen Weg fanden. Bald aber langten sie in der Unterstadt, wie der dem Fluß zugewandte, tiefer gelegene, südliche Teil der Stadt genannt wurde, an.
Die Fischerstube war ein mittelgroßes, schmuckloses neueres Gebäude mit drei Stockwerken. Im Erdgeschoß lag die Wirtschaft, oben die Gästezimmer. Zu den Gästen dieses Hauses gehörten vornehmlich Flußschiffer, einfache Reisende und Handwerksgesellen.
Guntrol überließ Lagrange die Verhandlungen mit dem Wirt, der sich in dieser Beziehung als geschickter und redseliger erwies, als er es ihm zugetraut hatte.
»Komm«, sagte er schließlich. »Wir haben eine Kammer oben unterm Dach. Ab sechs Uhr gibt es Abendessen. Der Fischeintopf soll nicht schlecht sein.«
»Fisch!« Guntrol rümpfte die Nase und rollte die Augen. »Ein richtiges Stück Fleisch wäre mir lieber. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das aussieht oder schmeckt.«
»Du hattest heute Mittag Fleischpastete«, sagte Lagrange, während er seinen Geldbeutel in der Hand wog.
»Ob das für den ganzen Weg bis in die Hauptstadt reicht?« fragte Guntrol. »Bei mir sieht es noch schlechter aus. Ich hatte ursprünglich vorgehabt, hier ein oder zwei Wochen zu bleiben und etwas zu arbeiten.«
»Dafür ist jetzt keine Zeit mehr. Andererseits können wir auch nicht mit leerem Magen bis in die Hauptstadt wandern.«
»Morgen ist Markt. Vielleicht finde ich da einen Käufer für das Schwert. Obwohl ich mich langsam daran gewöhne« Guntrol fühlte das kühle Metall des Griffes in seiner Hand. Es wäre schön, wenn er es behalten könnte, dachte er. Natürlich konnte er nicht damit fechten. Und als gewöhnlicher Bursche vom Lande durfte er eigentlich gar kein Schwert in der Öffentlichkeit tragen. Also könnte er es eigentlich nur zu Hause neben dem Ofen an die Wand hängen, als Erinnerungsstück an seine Abenteuer in der Fremde. Seine Freunde und die Leute im Dorf wären bestimmt sehr beeindruckt.
»Hör auf zu träumen und komm mit!« sagte Lagrange und zog ihn am Ärmel hinter sich her.
Sie nahmen in der Gastwirtschaft ein einfaches Mahl zu sich. Lagrange bestellte den Fischeintopf, Guntrol zog es vor, eine große Portion Rührei mit Speck zu verputzen. Lange hielten sie sich nicht unten in der lärmigen und verrauchten Gaststube auf. Lagrange wollte seine Übungen machen und Guntrol ging der Lärm und das Geschwätz der Leute auf die Nerven. Unter anderen Umständen hätte er gerne den Erzählungen und dem Klatsch der Leute im Wirtshaus gelauscht, hier aber zog er es vor, sich bald zurückzuziehen.
Das Zimmer, das der Wirt ihnen zugewiesen hatte, war klein aber sauber. Es besaß ein winziges Fenster zum Hof hin. Während Lagrange sich für seine geistigen Übungen vorbereitete, ging Guntrol auf und ab. Lagrange seufzte und sprach: »Wenn du keine Ruhe findest, geh halt draußen spazieren, aber nicht hier im Zimmer. Ich kann mich so nicht konzentrieren. Ich habe meine Übungen in den letzten Tagen ohnehin schon zu oft vernachlässigt.«
Guntrol zögerte. »Ich weiß nicht. Soll ich dich wirklich hier ganz allein lassen?«
»Ja, hier ist es sicher. Ich werde den Riegel vorschieben, wenn es dich beruhigt.«
»Na gut. Ich bin in einer Stunde wieder zurück«, sagte Guntrol und ließ sich von Lagrange widerwillig zur Tür hinaus schieben. Er wartete bis er hörte, wie der Riegel vorgeschoben wurde. Sein Schwert hatte er auf dem Bett liegen gelassen. Beinahe vermißte er bereits das Gewicht an seiner linken Seite.
Er verließ das Gasthaus und ging die Straße entlang, die zum Hafentor führte. Das Tor stand noch weit offen. Üblicherweise wurden die Tore bei Sonnenuntergang geschlossen, doch konnte man auch danach noch aus der Stadt hinaus, und wenn man Bürger derselben war, auch hinein gelangen, sofern man eine entsprechende Gebühr an den Torwächter bezahlte. Diese Regelung war von der Gilde der Kaufleute erstritten worden; denn früher als es noch keine Ausnahmeregelung gab, war es nicht selten vorgekommen, daß Händler, die zu spät kamen, weil sie unterwegs aufgehalten worden waren, buchstäblich vor verschlossenen Toren standen und die Nacht vor der Stadt verbringen mußten. Dies geschah sehr zur Freude und zum Frommen der Gasthofbesitzer in den Vororten, sowie einiger Räuberbanden, welche damals nicht schlecht davon lebten, indem sie die vor der Stadt stehenden Wagen ausraubten.
Räuber gab es inzwischen keine mehr, jedenfalls nicht in der unmittelbaren Umgebung von Pfeilburg. Das Hafentor war etwas kleiner als und nicht annähernd so prächtig, wie die beiden großen Stadttore, welche an der Hauptstraße standen. Draußen in der Vorstadt lag der Stadthafen, der diesen Namen nicht wirklich verdiente, bestand er doch nur aus einem langen befestigten Anleger, an dem die Schiffer und Flößer ihre Gefährte festmachten. Eine breite Steintreppe und eine flache Rampe, die fast so lang war wie der Schiffsanleger selbst, führten nach oben zur Hafenstraße. Hier befanden sich große Lagerhäuser aus rotem Backstein; und hier lag auch der Fischmarkt. Zu dieser Abendstunde war der Markt längst geschlossen. Fische wurden nur am Vormittag gehandelt.
Jetzt lag nur ein einziges kleines Handelsschiff am Steg. Die Ladung war bereits zum größten Teil gelöscht. Viele Menschen waren nicht zu sehen. Eine Handvoll Arbeiter trugen Körbe und Säcke aus dem Schiffsleib und rollten Fässer und Tonnen über eine Planke und stapelten sie auf dem Steg, wo sie gezählt und in Listen eingetragen wurden. Von da ging es auf Handkarren, oder bei schwereren Dingen, wie Fässern per Flaschenzug nach oben auf die Hafenmauer und in die Lagerhäuser. Ein paar zerlumpte Kinder spielten oben am Hafenquai. Einige Spaziergänger schlenderten vorüber, blieben zuweilen stehen, um einen Blick auf den Fluß zu werfen, der im orangenen Licht der Abendsonne glitzernd träge dahinfloß. Darüber hinaus konnte man die üblichen Gestalten sehen, die sich an solchen Orten herumzutreiben pflegten: Gammler, Trunkenbolde, arbeitslose Matrosen und Tagelöhner, die mit frischem Geld in der Tasche zielstrebig die nächste Taverne ansteuerten.
Guntrol lehnte sich gegen ein großes Ölfaß und beobachtete mit Interesse das Treiben. Er hatte schon oft die Lastkähne und größeren Flöße aus der Ferne auf dem Fluß vorüber ziehen sehen, doch aus der Nähe hatte er noch nicht die Gelegenheit gehabt, ein großes Flußschiff zu besichtigen. Als Zimmermann interessierte ihn natürlich besonders die Bauweise eines solchen Schiffes. Das mußte eine großartige Arbeit sein, ein Schiff zu bauen, dachte er, während er die hölzerne Konstruktion studierte.
Derweil er so da stand und sann und schaute, erschien ein älterer Mann in Arbeitskleidung auf dem Schiffsdeck. Er streckte sich und reckte seine Glieder, als hätte er längere Zeit in gebückter Haltung gearbeitet. Als er Guntrol sah, rief er ihn an: »He, junger Mann! Bist du so gut und reichst mir den Werkzeugkasten!« Guntrol sah sich um.
»Er steht vor deinen Füßen.« Guntrol entdeckte neben dem Faß einen großen Holzkasten, der über und über mit den unterschiedlichsten Werkzeugen gefüllt war. Hämmer in verschiedenen Größen, Hobel, Sägen, Zugmesser, Dechsel, Bohrer, Winkeleisen und viele andere Utensilien zu Holzbearbeitung lagen darinnen. Er erkannte darin sogleich das Handwerkszeug eines Zimmermanns. Die Werkzeuge waren sauber, gut geschliffen und machten obgleich man ihnen ein gewisses Alter deutlich ansah, einen gepflegten Eindruck. Er hob den Kasten, der viel schwerer war, als er aussah, hoch. Anscheinend gab es noch eine zweite Lage Werkzeug unter der oberen. Guntrol trug den Werkzeugkasten die Treppe hinab und gab ihn dem Mann auf dem Schiff. »Hier, Meister!«
»Vielen Dank! Du bist auch Zimmermann, wie ich sehe«, sagte er.
»Ja, ich bin auf der Durchreise. Ich komme aus dem Apfelland. Mein Name ist Guntrol.«
»Grüß dich, Guntrol. Ich bin Meister Pirmon, Schiffszimmermann. Eigentlich arbeite ich auf der Werft draußen vor der Stadt.« Er deutete in die Richtung flußaufwärts. »Aber wenn es etwas zu richten gibt, schicken die Schiffer nach mir. Es gibt heutzutage nicht mehr so viele, die in dieser Gegend etwas vom Schiffsbau und der Reparatur verstehen.«
»Das ist bestimmt eine sehr abwechslungsreiche Arbeit«, sagte Guntrol.
»Ich nehme an, im Apfelland bekommt man nicht oft ein Schiff zu sehen. Wenn du magst, komm an Bord und schau dich ruhig um. Dieses Schiff habe ich selbst vor über fünfzehn Jahren gebaut.«
Guntrol kletterte über den Steg an Bord. Das Schiff war ziemlich flach, dafür aber breit gebaut und hatte wenig Tiefgang, damit es auch auf den oberen, flachgründigeren Abschnitten des Flusses verkehren konnte. Seine Länge betrug gute fünfundfünfzig Fuß. Es war sehr einfach gebaut; trotzdem wirkte es sehr stabil. Guntrols besonderes Interesse galt der Art der Verbindung der Spannten mit dem Kiel und der Befestigung des Mastes, der beweglich gelagert war, so daß man ihn bei Bedarf umlegen konnte. Er strich mit der Hand über das glatte Holz. Es fühlte sich fest und trocken an. »Kupfernägel«, stellte er fest. »Damit nichts rostet.«
»Ja«, antwortete der alte Zimmermann. »Aber das ist eine neue Erfindung. Früher haben wir nur Holzdübel verwendet. Doch der Auftraggeber wollte Kupfernägel haben. Und der Kunde ist nun mal König.«
»Die Arbeit geht damit zwar geschwinder, als wenn man erst die Dübel schnitzen und passende Löcher bohren muß, aber dafür ist die Verbindung nicht so dauerhaft«, meinte Guntrol. Der Zimmermann wechselte eine morsche Spante aus. Guntrol ging ihm dabei zur Hand.
»Sag mal, du bist doch auf der Wanderschaft? Hättest du nicht Lust, ein paar Wochen auf meiner Werft zu arbeiten? Ich könnte dir eine Menge über Schiffsreparaturen beibringen.« Guntrol seufzte und sagte: »Das würde ich sehr gerne machen, aber leider bin ich mit einem Freund zusammen auf der Reise nach der Hauptstadt. Und wir müssen uns sehr beeilen.«
»Für deinen Freund hätte ich auch Arbeit. Zu dieser Jahreszeit gibt es viele Reparaturen. Das Hochwasser hat in diesem Frühling eine Menge Schäden angerichtet.«
»Mein Freund ist kein Zimmermann. Und unsere Reise duldet keinen Aufschub. Doch wenn Euer Angebot noch gilt, will ich gern auf meiner Heimreise bei Euch vorbei schauen. Vielleicht im Herbst. Ich kann leider nicht sagen, wie lange es dauern wird.«
»Ich kann fleißige junge Leute immer gebrauchen. – So, aber jetzt will ich Feierabend machen.« Guntrol bedankte sich bei dem freundlichen Meister.
Als sie auf das Deck traten, wurde auf dem Hafenquai ein Geschrei laut: »Haltet den Dieb!« Ein kleine Gestalt, mehr ein Schatten, als ein Mensch, huschte über den Quai, sprang mit katzengleicher Geschicklichkeit über Kisten, Körbe und andere Hindernisse, lief die Rampe hinab und weiter über den Anleger. Guntrol schwang sich über die Bordkante und setzte dem flüchtenden Schatten nach. Der Steg hatte eine Länge von gut hundert Metern und endete im Nichts – genauer gesagt im Wasser. Nach dieser Seite war der Fluchtweg abgeschnitten. Das erkannte auch der Flüchtling, denn er bleib kurz stehen und sah sich nach allen Seiten um, ob es nicht einen anderen Ausweg gäbe, als den Sprung in den kalten Fluß.
Guntrol kam rasch näher, als die Gestalt auf einmal verschwunden war. Da er keinen Aufschlag hörte und kein Wasser aufspritzen sah, mußte der Dieb irgendwie von dem Steg gelang sein, ohne sich naß zu machen. Guntrol erreichte das Ende des Steges und entdeckte dort eine große, fast mannshohe Öffnung in der Hafenmauer, aus der ein Rinnsal trüben Wassers quoll. Anscheinend handelte es sich um die Mündung eines kanalisierten Baches. Die Farbe des Wassers und der üble Geruch, den es verströmte, ließen darauf schließen, daß es sich um die Abwässer einer oder mehrerer Gerbereien handelte. Tatsächlich diente dieser Bach am anderen Ende der Stadt nicht nur dem Antrieb eines Mühlrades, sondern versorgte auch etliche Gewerbebetriebe mit Wasser und Antriebskraft.
Guntrol zauderte einen Augenblick und überlegte, ob er sich in das stinkende, glitschige und düstere Loch hinein wagen sollte. Er nahm seinen Mut zusammen und sein Handbeil aus dem Gürtel. Der Kanal war schmutzig und der Boden glitschig. Beinahe wäre er ausgeglitten, doch gelang es ihm glücklicherweise, sich auf den Füßen zu halten. Er watete durch das knöcheltiefe Wasser bis er im Dämmerlicht vor sich eine zusammengekauerte Gestalt ausmachen konnte. Beim Näherkommen erkannte er auch, warum der Dieb sich nicht aus dem Staub gemacht hatte: Nach knapp zehn Metern nämlich versperrte ein schweres eingemauertes Eisengitter den Durchgang. Direkt davor kauerte der Dieb, welcher, aus der Nähe betrachtet, sich als Diebin herausstellte.
Beim Anblick von Guntrols erhobenem Beil zuckte sie zusammen und hob schützend die Arme vor den Kopf. Guntrol ließ das Beil sinken und betrachtete die Gestalt. Es handelte sich um ein junges Mädchen, ungefähr in seinem Alter, eher noch jünger. Es trug eng anliegende Kleidung, Hosen und eine Art Umhang. Auf dem Kopf saß eine grüne Kappe.
»Hab keine Angst! Ich tu dir nichts«, sagte er während er das Beil wieder in die Gürtelschlaufe steckte. Mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit sprang das Mädchen auf und versuchte zwischen Guntrol und der Wand vorbei zu huschen. Doch Guntrol hatte damit gerechnet und konnte sie rechtzeitig am Arm packen und festhalten.
»Na, na! So nicht! Du kommst schön mit. Was hast du überhaupt geklaut?« Das Mädchen warf ihm böse Blicke aus seinen großen leuchtend grünen Augen zu und machte eine ziemlich verstockte Miene. »Ich habe nichts gestohlen«, entgegnete sie trotzig. Ihre Stimme klang hell und leise.
»Na, um so besser für dich. Dann brauchst du keine Angst vor der Untersuchung zu haben. Deine Unschuld wird sich leicht feststellen lassen.« Er zerrte sie ein paar Schritte in Richtung Ausgang.
»Nein, bitte laß mich gehen! Ich gebe dir die Hälfte ab.«
»Die Hälfte wovon?« fragte Guntrol streng. Das Mädchen griff mit der freien Hand unter seinen Mantel und brachte eine riesige getrocknete Wurst von der Länge eines Armes, zum Vorschein. Guntrol mochte seinen Augen nicht trauen. Wie hatte sie diese Riesenwurst unter ihrem Mantel verstecken können?
»Da schau her!« Du bist also kein Dieb, was? Warum hast du die Wurst gestohlen?« Eigentlich hätte er sich die Frage sparen können, denn bei näherer Betrachtung erkannte er, daß das Mädchen ziemlich mager war. Die kleine Diebin seufzte. »Gut, du kannst die ganze Wurst haben. Aber wenn du mich den Stadtknechten auslieferst, werden sie mich…« Sie schwieg. In ihren Augen glitzerte es feucht. Guntrol gab ein undefinierbares Brummen von sich und ließ sie los. Obwohl es hier drinnen ziemlich finster war, fand er, daß das Mädchen auf eine unbestimmbare Weise ziemlich niedlich aussah.
»Ach, was geht mich die Sache überhaupt an? Ich bin nicht von hier. Sollen sich doch die Einheimischen darum kümmern. Ich werde dich nicht ausliefern. Aber warte hier, bis die Luft rein ist.« Mit diesen Worten drehte er sich um lief nach draußen.
Endlich wieder an der frischen Luft streckte er sich und atmete tief durch. Er lief zurück zur Anlegestelle des Frachtschiffes. Meister Pirmon hatte auf ihn gewartet. Auf dessen fragenden Blick sagte er nur: »Entwischt.« Pirmon schüttelte den Kopf. »Hier treibt sich in letzter Zeit eine Menge Gesindel herum. Bei Nacht sollte man lieber nicht in dieser Gegend verweilen.«
Guntrol verabschiedete sich höflich von dem Meister und machte sich auf den Weg zurück zum Gasthof. Es begann schon zu dämmern und jeden Augenblick konnten die Stadttore geschlossen werden. Pirmon stieg in ein kleines Boot, ähnlich eine Zille und stakste am Ufer entlang flußaufwärts davon.
Guntrol konnte gerade noch rechtzeitig das Hafentor passieren. Der eine Torflügel war bereits geschlossen, als er hindurchschlüpfte. Dafür kassierte er von dem Torwächter einen mißbilligenden Blick, den er gelassen ertrug. Er beeilte sich, in die Herberge zurück zu kehren. Er war ziemlich schmutzig, seine Schuhe waren naß und müde war er auch. Und ganz fein roch er auch nicht.
Lagrange machte hingegen eine sehr entspannten Eindruck. »Was ist den mit dir passiert?« fragte er, als er auf Guntrols Klopfen und Rufen die Tür öffnete. »Bist du in den Fluß gefallen?« Guntrol grunzte und setzte sich auf einen Stuhl. Während er seine feuchten und dreckigen Kleider auszog, berichtete er von seinem Abenteuer am Hafen. Lagrange mußte lachen, als er von der Diebesjagd hörte. »Die Wurst bald größer als das Mädel? Das ist gut. Ich nehme an, das war eine professionelle Diebin. Ich habe gehört, daß die sogar richtige Gilden haben mit eigenen Gesetzen und Regeln.«
»Das glaube ich nicht. Auf mich hat sie eher einen schüchternen, traurigen Eindruck gemacht. Vielleicht ist sie ganz allein und hat ein paar hungrige Geschwister durchzufüttern. Eigentlich sah sie sogar recht hüb…« Er verstummte abrupt. Sein Gesicht lief rot an. Er stieß einen heftigen Fluch aus, der Lagrange nach Luft schnappen ließ. Seine Hände ballten sich zu Fäusten, während er vom Stuhl aufsprang.
»Dieses verdammte, gerissene Miststück!« rief er, während sein Gesicht noch röter wurde.
»Was ist denn?«
»Mein Geldbeutel. Die Mistkröte hat mir den Geldbeutel geklaut.«
Lagrange brach in schallendes Gelächter aus. »Vielleicht brauchen, ihre hungrigen Geschwisterchen ein paar neue Schuhe«, gluckste er und hielt sich die Hand vor den Mund.
»Jaja, ich weiß schon. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen« zischte Guntrol. »Kannst du mein Geld nicht irgendwie aufspüren?«
Lagrange verzog das Gesicht. »Ich bin doch kein Spürhund.«
»Ich dachte, du hättest vielleicht eine Kristallkugel oder so etwas dabei.«
»Tut mir leid, mein Freund. Mit solchen Tricks kann ich leider nicht dienen.«
»Dann verwünsche sie wenigstens. Kannst du ihr nicht irgend etwas anhexen?«
»Nein, solche Zauber beherrsche ich nicht. Und wenn, dann würde ich keinen Gebrauch davon machen. Ich bin Schamane und kein schwarzer Hexenmeister«, sagte Lagrange scharf.
»Ich weiß. Das war nicht ernst gemeint«, beschwichtigte ihn Guntrol. »Ich habe mich nur maßlos geärgert. Erst tue ich der Göre einen Gefallen und zum Dank beklaut sie mich.«
»Allzu groß wird dein Verlust nicht gewesen sein«, sagte Lagrange, wofür er von Guntrol ein Kissen an den Kopf geworfen bekam. »Gute Nacht!« brummte er verdrießlich und ließ sich ins Bett fallen. Er wickelte sich in seine Decke und gab nur noch ein dumpfes Grummeln und Brummeln von sich.
»Ach Guntrol! Wenn der Verlust eines Geldbeutels das schlimmste wäre, was dir auf dieser Reise zustößt, dann kannst du dich wirklich glücklich schätzen«, sagte Lagrange so leise, daß Guntrol es nicht hören konnte. Er hob das Kissen auf und legte sich ebenfalls nieder.
Trotz des Ärgers schlief Guntrol in dieser Nacht ausgezeichnet. Er war viel zu müde, um sich noch irgendwelchen verdrießlichen Gedanken hinzugeben.
Am andern Morgen war seine Laune jedoch nicht viel besser als am Abend davor. Er hatte sich vorgenommen, in der Stadt Ausschau nach der frechen Diebin zu halten, wenngleich dieses Unterfangen wenig Aussicht auf Erfolg versprach. Dennoch begann er sich bereits lebhaft auszumalen, welche Abreibung er ihr zuteil werden ließe, wenn er sie erst in die Finger bekäme.
»Jetzt mach mal wieder ein normales Gesicht, Guntrol. Es hat keinen Sinn, verlorenem Gut hinterher zu trauern. Tand ist alles Gebilde von Menschenhand…«
»Du solltest Kalender drucken lassen und verkaufen«, brummte Guntrol während er sein Frühstück in sich hinein löffelte. »Was machen wir heute?«
»Ich schlage vor, wir gehen auf den Markt, schauen uns ein wenig um, kaufen ein paar Sachen für die Reise und etwas Proviant. Dann können wir uns morgen früh auf den Weg nach Narbon machen.«
Frisch gestärkt und mit etwas weniger Wut dafür einer ordentlichen Portion Haferbrei im Bauch machte Guntrol sich an der Seite seines Freundes auf den Weg in die Stadt. Lagrange trug die geheimnisvolle Tasche des Herolds zusammengerollt in seinem Schulterbeutel. Kein Mensch konnte ihnen ansehen, was für einen besonderen Schatz sie bei sich trugen. Trotz der frühen Morgenstunde fanden sie den großen Marktplatz voller Leben. Wo am vorherigen Tage noch gähnende Leere geherrscht hatte, quoll nun der Platz vor lauter Menschen beinahe über. Markthändler aus der Stadt, aber auch Bauern aus der Umgebung und fahrende Händler aus allen Teilen des Landes hatten ihre Stände aufgebaut und boten alle erdenklichen Waren feil, die man nur irgend brauchen konnte.
Die Marktstände waren in mehreren langen Reihen angeordnet, so daß sie regelrechte Gassen bildeten. Es gab eine Gasse für Gemüse, Obst, Fleisch und andere Lebensmittel, außer Fisch, der nur am Fischmarkt gehandelt wurde. Auch lebende Hühner, Enten, Gänse und Kaninchen warteten in Körben und Verschlägen auf Käufer. Es gab Stände mit eingelegtem Gemüse, Dörrbohnen und getrockneten Früchten. Eine andere Gasse war für Händler reserviert, die alle Arten von Hausrat anboten: Kästen, Körbe, Töpfe, irdene Häfen und Geschirr, feine importierte Gläser aus Ruritanien fanden sich ebenso, wie einfache geschnitzte Holzlöffel und –Schalen. Leuchter, Kienspanhalter und Öllampen, Kerzen und Dochte, Feuerzeuge, Zunder und sogar echte Schwefelhölzer aus Golwen warteten auf Käufer. Daneben wurden sogar kleinere Möbel, Handkarren, Spinnräder, auch Bilder und allerlei Zierrat für den Haushalt vorrätig gehalten. Die dritte Gasse war den Tuch- und Kleiderhändlern, Sattlern und Schustern, den Kürschnern und Pelzhändlern vorbehalten. In der letzten Gasse schließlich befanden sich die Verkaufsstände der Händler von Gewürzen, Spezereien, Arzneien, Wein und Weingeist. Auch Messer-, Waffen- und Goldschmiede waren hier vertreten, sowie alle anderen Händler, die mit besonderen Waren handelten, wie die Verkäufer von Büchern, Kalendern, Amuletten und Talismanen. Am Rande des Platzes befanden sich allerlei Verpflegungsstände und Garküchen, deren mannigfaltige Düfte über den Platz schwebten und sich zu einem einzigartigen Aroma verbanden. Suppen, gebratene Würste, Pfannkuchen und Süßigkeiten, Lebkuchen und Rosinenbrot wetteiferten um die Aufmerksamkeit der Hungrigen. Daneben gab es Stände, wo man sich die Haare schneiden oder den Bart scheren lassen konnte. Und nicht zuletzt gaben Gaukler und Unterhaltungskünstler aller Sparten ihre Darbietungen zum Besten. Bänkelsänger, Musikanten und Spielleute, Jongleure, Akrobaten und Tierbändiger konkurrierten um die Aufmerksamkeit und das Kleingeld der Schaulustigen. Das war eigentlich schon kein gewöhnlicher Markt mehr, sondern eher ein Jahrmarkt, der aber in Pfeilburg jeden Monat stattfand.
Guntrol und Lagrange hatten Glück, daß sie gerade zur Zeit des großen Marktes vorbeikamen, denn an gewöhnlichen Markttagen gab es vielleicht zwei Dutzend Marktstände, hier aber waren es gut zehn mal so viele.
»Na, hab ich dir zu viel versprochen?« fragte Lagrange, für den das Spektakel anscheinend nichts ungewöhnliches war. Im Gegensatz zu Guntrol war er in den letzten Jahren schon ein bißchen in der Welt, genauer gesagt im Lande Zerwan, herumgekommen und hatte dabei schon so manche größere Stadt kennen lernen. Für Guntrol jedoch war dies der erste Besuch in einer großen Stadt. Mit fast kindlicher Begeisterung lief er von einer Attraktion zur nächsten. Lagrange beobachtete seinen Freund mit einer Mischung aus Verwunderung und Belustigung. Obwohl sie beide fast gleich alt waren, kam Guntrol ihm noch immer wie der kleine Junge von damals vor, als sie sich das erste Mal kennen lernten.
»Lagrange, schau mal!« Dieser Affe ist doch zu drollig!«
»Ich schlage vor, wir trennen uns für eine Weile. Du kannst dir alles anschauen, und ich kann in Ruhe die Sachen einkaufen, die wir brauchen. Wir treffen uns zur Mittagsstunde beim Nudelstand.«
»Ich weiß nicht. Das ist nicht sicher.«
»Ich denke, ich kann ganz gut drei Stunden auf mich selbst aufpassen, ohne dabei verloren zu gehen. Und da es hier keinen Abwasserkanal gibt und du deinen Geldbeutel bereits los bist, kann dir eigentlich auch nichts schlimmes mehr geschehen.«
Guntrol überlegte, ob es statthaft sei, einem Magier eine Kopfnuß zu verpassen, besann sich aber anders, da ihm gerade der Duft von frischen Honigkuchen in die Nase stieg.«
»Lagrange, du kannst manchmal so was von fies sein, aber ich will noch mal Gnade vor Recht ergehen lassen. Wo du schon meinen Geldbeutel ansprichst, kannst du mir was pumpen?«
Lagrange machte ein saures Gesicht. »Das war doch nur Spaß«, sagte er. Doch er wußte, daß er diesmal für seine freche Bemerkung buchstäblich würde zahlen müssen. Er drückte Guntrol ein paar Silbermünzen in die Hand, und sah zu, daß er weg kam.
Guntrol ließ seine Augen über den Markt schweifen. Wenn er erst sein Schwert verkauft hätte und einen dicken Batzen Geld mit brachte, würde Lagrange ganz schön dumm aus der Wäsche schauen, dachte er. Doch wo könnte er hier wohl ein Schwert verkaufen? Vielleicht bei einem Messerschmied. Er versuchte sich zu erinnern, wo er einen solchen Stand gesehen hatte.
Nach einigem Suchen – Guntrols Orientierungssinn war leider nicht der beste – fand er den Stand endlich am Rande des Platzes. Der Verkaufsstand war nicht groß, doch die Auswahl an Waren war durchaus beachtlich. Es gab hier alle Arten von Messern für Küche und Haushalt, Messer für Gärtner, Metzger, zum Holzschnitzen, Fisch- und Filettiermesser mit langer schmaler Klinge, Jagdmesser mit breiter Klinge, Rasiermesser mit dünner scharf geschliffener Klinge, winzige, feine, leicht gebogene Federmesser zum Anspitzen der Schreibfedern, Taschenmesser zum Zusammenklappen, Hackmesser, sowie Äxte, Beile und andere Werkzeuge zur Holzbearbeitung. Ebenso fanden sich Sägen, Scheren und andere Schneidwerkzeuge. Auch Zubehör, wie Wetzsteine, Abziehriemen und Ledertaschen, Scheiden und Werkzeuggürtel. Es gab einfache, billige Messer mit einfachen Holzgriffen für die tägliche Arbeit und edle, auf Hochglanz polierte mit Damastklingen und Griffen aus Hirschhorn und Perlmutter.
»Guten Tag! Was darf es sein?« fragte der Händler.
»Habt Ihr auch Schwerter?« fragte Guntrol.
»Schwerter?« Der Mann lachte und sah ihn an, als hätte er nach Erdbeertörtchen gefragt.
»Schwerter bekommt Ihr hier in der Stadt nur in einem einzigen Geschäft. Und die verkaufen auch nicht an jeden. Für solche Waren braucht man eine besondere Bewilligung. Aber ich glaube, Ihr seid eher der Typ, der ein schönes Schnitzmesser zu schätzen wüßte«, antwortete der Verkäufer befließen.
»Ja, die sind sehr schön, aber eigentlich wollte ich…«
»Sie sind gar nicht teuer und aus erstklassigem Stahl. Robust und langlebig.«
»Ein andermal vielleicht. Wegen des Schwertladens…«
»In der Eisengasse, links hinter dem Fischmarkt die Treppe runter«, brummte der Verkäufer, der einsehen mußte, daß an diesem Kunden nichts zu verdienen war.
»Wenn ich noch wüßte, wo der Fischmarkt war«, murmelte Guntrol. Vermutlich in der Nähe des Flusses. Diese Gegend war für ihn nicht mit angenehmen Erinnerungen verbunden.
Nachdem er eine ganze Weile zwischen Hafentor und verschiedenen Lagerhäusern hin und her gegangen war, ohne daß er die Eisengasse entdecken konnte, beschloß er, daß es vielleicht doch nicht verkehrt sein könne, jemanden nach dem Weg zu fragen. Doch war dies leichter gesagt, als getan, denn die Straßen waren wie ausgestorben. Anscheinend war zu dieser Zeit alles, was Beine hatte, auf dem großen Markt.
Endlich fand er doch einen Passanten, der ihm Auskunft geben konnte. Auf dem Fischmarkt, der nur aus einem halben Dutzend Marktständen bestand, hatten die Händler ihre Ware bereits zum größten Teil abgesetzt. Einige waren schon am Zusammenpacken, andere priesen ihre verderbliche Ware noch lautstark an. Guntrol, der Fisch nicht ausstehen konnte, machte einen weiten Bogen um die intensiv duftende Auslage und schlug statt dessen den Weg in Richtung einer schmalen Seitengasse ein.
Schon von weitem stach ihm der Geruch von Rauch und Kohlenfeuer in die Nase. Und den charakteristische Klang von Hämmern auf Metall verriet ihm, daß hier Schmiede und andere metallverarbeitende Betriebe beheimatet waren. Durch offen stehende Tore und Werkstatttüren konnte er in Schmieden und Werkstätten schauen. Hier wurden Pferde beschlagen, dort Töpfe und Pfannen getrieben und geflickt, Ketten und Ringe geschmiedet, Hacken, Spaten und Werkzeug repariert.
Endlich, fast am Ende der Gasse erblickte er einen großen roten Schild, der über einer Haustür hing und auf dem zwei gekreuzte Schwerter abgebildet waren. Dies mußte das Firmenzeichen des Schwertschmiedes sein. Das Haus war größer, höher und prachtvoller als die anderen in der Nachbarschaft. Ein Torbogen führte in einen Hinterhof. Von da drang ein regelmäßiges Hämmern an sein Ohr. Anscheinend befand sich dort die Werkstatt, während im Vorderhaus das Ladengeschäft untergebracht war.
Guntrol betrat den Laden, der sich als kleiner herausstellte, als die Größe des Hauses vermuten ließ. Darinnen befand sich gerade ein Kunde, der die ausgestellten Waffen musterte. Der kleine Laden war vollgestopft mit Blankwaffen. An den Wänden hingen Schwerter und Säbel in allen Größen und Varianten. Da waren Prunkwaffen mit vergoldeten Griffen und Schwertscheiden aus feinstem Leder mit Steinen besetzt, ebenso wie einfache billige Schwerter für den täglichen Gebrauch. Scharf ausgeschliffene Waffen zum Fechten und stumpfe Übungsschwerter in allen Längen warteten auf Käufer. In einer Vitrine lagen kostbare Dolche mit Damastklingen, deren holzartige Maserung bläulich schimmerte. In einem Ständer neben der Tür standen Hellebarden und Spieße. An einer Wand neben einer schmalen Tür, die in ein Hinterzimmer führte, hingen allerlei exotische Waffen aus fernen Ländern: Krummdolche, gebogene Schwerter, Schwerter mit langen Quasten am Griff. Klingen mit Widerhaken und Schwerter, deren Klingen wie eine Schlange aussahen. Dieser Laden mußte ein echtes Paradies für jeden Waffensammler sein, dachte Guntrol, der noch nie so viele Hieb- und Stichwaffen auf einem Haufen gesehen hatte.
Der Verkäufer, ein kleiner dünner Mann um die vierzig mit Halbglatze, der eine blaue verwaschene Schürze trug, war damit beschäftigt, einige Schwerter an der Wand zu befestigen. Er begrüßte Guntrol und fragte nach seinen Wünschen.
»Ich habe hier ein Schwert. Es ist gebraucht, aber in einem gutem Zustand. Seid Ihr vielleicht daran interessiert?« sagte Guntrol und fing an, das längliche Bündel, das er bei sich trug, aufzuschnüren. Der Verkäufer kam hinter dem Ladentisch hervor. »Üblicherweise kaufen wir keine alten Schwerter, aber wenn es noch brauchbar ist, könnte ich Euch für das Eisen…«
»Es ist sehr schön gearbeitet«, sagte Guntrol während er das Schwert aus dem Leintuch wickelte. Er zog es aus der Scheide und hielt es dem Verkäufer unter die Nase. Dieser zog die Augenbrauen hoch. Er nahm das Schwert mit beiden Händen und betrachtete es ganz genau. Seine Augen fuhren über beide Seiten der Klinge. Er prüfte die Schneide mit dem Daumen und drehte das Schwert nach allen Seiten.
»Nun… ja… sehr schön… ein bißchen altmodisch…«
»Es ist gut gepflegt. Kein bißchen Rost«, sagte Guntrol. Er hatte das Gefühl, als könne er ein gutes Geschäft machen.
»Wie viel wollt Ihr dafür haben?« fragte der Verkäufer. Guntrol machte ein etwas ratloses Gesicht, was dem aufmerksamen Verkäufer nicht verborgen blieb. »Naja, ich weiß nicht…«
»Ich gebe Euch… sagen wir, hundert Taler«, sagte der Schwertverkäufer und sah Guntrol tief in die Augen.
»Hundert!« Das war eine Menge Geldes. Doch irgendwie hatte er das Gefühl, als könne er noch mehr herausschlagen.
»Eigentlich hätte ich doch eher…«
»Das war nur ein Spaß«, sagte der Verkäufer schnell. »Ich will Euch etwas sagen: Ich gebe Euch zweihundert Taler. Das ist doch ein Angebot.« Bevor Guntrol zusagen konnte, mischte der Kunde, der die ganze Zeit über schweigend im Hintergrund gestanden hatte, sich in das Gespräch ein: »Darf ich mal sehen?« Er nahm dem verdutzt dreinblickenden Verkäufer das Schwert aus der Hand. Er betrachtete es eingehend, prüfte Griff und Klinge, wog es in der Hand und testete die Balance, bevor er es Guntrol in die Hand drückte. Dieser schaute den Mann fragend an. Was war das für ein Kerl, fragte er sich.
Der Mann war noch ziemlich jung, höchstens Mitte zwanzig, von schlanker, drahtiger Figur. Sein pechschwarzes Haar trug er kurz geschoren. An seinem Gürtel hing ein langes, gekrümmtes Schwert mit einem langen Griff, der mit Lederbändern kreuzweise beflochten war. Ein solches Schwert hatte Guntrol noch nie gesehen. Es mußte, wie sein Besitzer, wohl aus dem Ausland stammen. Er hatte einmal gehört, daß in Salvia die Krieger krumme Schwerter trugen. Dieser Mann aber war bestimmt kein Salvianer, dafür war er zu hellhäutig. Er sprach zwar mit einem leichten fremdländischen Akzent, doch vermochte Guntrol diesen nicht einzuordnen. Vielleicht hatte der Mann es auf einer Reise im Ausland gekauft oder er war ein Sammler. Auf jeden Fall schien er etwas von Schwertern zu verstehen.
»Ich weiß zwar nicht, wo du dieses Schwert her hast, mein Junge. Aber ich würde es an deiner Stelle nicht für lächerliche zweihundert Kröten verscherbeln.« Der Händler machte bei diesen Worten ein verdrießliches Gesicht.
»Laßt mich doch ausreden. Ich wollte sagen, fünfhundert Taler. Das ist ein fairer Preis.«
»Selbst wenn Ihr fünftausend bötet, würde ich Euch noch einen Schelm heißen«, entgegnete der junge Mann ungerührt. »Das ist das Schwert eines Edelmannes. Ich schätze, es dürfte gute einhundert Jahre alt sein. In der Hauptstadt könntest du vielleicht zehntausend Taler oder fünfhundert Gulden bekommen«, sagte er zu Guntrol.
Ob dieser geradezu phantastischen Summe, vergaß dieser sogar sich über die Anrede ‘mein Junge’ zu ärgern. Der Händler dafür geriet jetzt richtig in Rage. »Was geht Euch das an? Mischt Euch gefälligst nicht in meine Geschäfte ein. Wenn Ihr nichts kaufen wollt, dann schert Euch hinaus!« schrie er außer sich vor Zorn. Sein Gesicht war hochrot angelaufen.
»Und du, was bist du überhaupt für einer?« fuhr er Guntrol an. »Wie kommt ein Kerl wie du zu so einem kostbaren Schwert?«
»Ich habe es geschenkt bekommen…« stotterte Guntrol.
»Lüge!« schrie der Verkäufer. »Gestohlen wirst du es haben.« Seine Stimme überschlug sich. »Das Schwert trägt das königliche Wappen. Es stammt aus der Waffenkammer des Königs. Nur Ritter und Adelige besitzen solche Schwerter und nur ganz wenige dürfen das königliche Wappen verwenden.«
»Ich bin kein Dieb, und ein Lügner auch nicht!«
»Erzähl das, wem du willst. Ich werde das lieber erst mal in Verwahrung nehmen.« Er versuchte Guntrol das Schwert aus der Hand zu reißen, doch der stieß ihn brüsk zurück. Der Verkäufer strauchelte und fiel rücklings gegen den Tisch.
»Hilfe! Zu Hülfe! Diebe, Räuber!« schrie er nun außer sich. Guntrol raffte Scheide und Hülle zusammen und stürzte zur Tür. Der Schwerthändler rappelte sich wieder auf und lief hinter ihm her. »Zu Hilfe! Haltet den Dieb!«
Noch im Laufen versuchte Guntrol das Schwert zurück in die Scheide zu stecken und wieder ordentlich mit dem Stoff zu umwickeln. Er wollte auf keinen Fall, daß es schmutzig oder zerkratzt würde; erst recht nicht, da er jetzt seinen außerordentlichen Wert kannte. Dies erwies sich aber als schwieriger, als es aussah. Daher wickelte er das Tuch nur lose darum und lief so schnell er konnte.
Ab und zu warf er einen Blick über die Schulter. Dabei gewahrte er, daß inzwischen einige Leute, durch das Geschrei des Schwerthändlers aufgeschreckt, seine Verfolgung aufgenommen hatten. Wenn die ihn erwischten, säße er ganz tief in der Tinte. Also lief er weiter, durch Gassen, Straßen und Höfe. Er kannte sich in der Stadt nicht aus und landete daher mehr als einmal in einer Sackgasse. Immer wenn er glaubte, einen sicheren Vorsprung erlaufen zu haben, fand er sich unversehens vor einer Wand, einem verschlossenen Tor oder Gatter stehen.
So gelangte er allmählich, dem Gefälle der Straßen folgend, in die Unterstadt, dort hin, wo die großen Lagerhäuser standen. Hier waren zwar kaum Leute, doch fand er alle Türen verschlossen. Schließlich rannte er in eine schmale Gasse zwischen zwei Lagerhäusern. Die Gasse war sehr schmal, kaum zwei Meter breit und stank erbärmlich nach Unrat und vergammeltem Fisch. Auf beiden Seiten erhoben sich geschwärzte, fensterlose Backsteinwände. Die Gasse war ziemlich düster, der Boden mit Abfall bedeckt. Guntrol mußte aufpassen, daß er nicht stolperte oder ausglitt. Gelegentlich huschte irgend ein kleines Tier vor seinen Füßen zur Seite. Ob es sich um eine Katze, oder eine wohlgenährte Riesenratte handelte, konnte er nicht erkennen; und so genau wollte er es auch gar nicht wissen.
Seine atemlose Flucht wurde jäh von einer steil aufragenden Mauer beendet. Die Mauer war wohl die Rückseite eines Hauses, denn sie ragte drei Stockwerke hoch und war damit fast so hoch wie die Lagerhäuser. Außer einem kleinen vergitterten Fenster im zweiten Stock, gab es keine Öffnung.
»Verdammt!« rief Guntrol. Jetzt saß er in der Falle. Noch ehe er einen Entschluß fassen konnte, ließ sich auf einmal eine Stimme vernehmen. Sie klang dumpf und hohl und kam irgendwo von unten. Guntrol schaute sich nach allen Seiten um, konnte aber keinen Menschen entdecken.
»Hier unten!« sagte die Stimme. Guntrol sah hinab und bemerkte, daß er auf einem Eisengitter stand. Er trat zur Seite. Das Gitter wurde von unten hochgedrückt. In der kleinen viereckigen Öffnung im Boden erschien eine grüne Mütze und darunter ein vertrautes Gesicht.
»Hallo, Herr Kollege!« sagte das Mädchen. »Mach den Mund wieder zu und beeil dich, bevor sie hier sind!«. Sie verschwand wieder im Boden und Guntrol sprang hinunter. Er ließ das Gitter zurück fallen und sah sich um. Sehen konnte freilich nicht viel, denn in dem Loch war es stockfinster und das einzige Licht schien aus den geradezu unheimlich glühenden grünen Augen des Mädchens zu kommen.
»Was heißt hier ‘Herr Kollege’?« Statt einer Antwort wandte das Mädchen den Kopf in Richtung der Gitteröffnung. Von dort ließen sich atemlose Stimmen vernehmen: »Hier ist der Dieb nicht. Das ist eine Sackgasse. Er muß vorher abgebogen sein. Vielleicht versteckt er sich in einem der Lagerhäuser. – Laßt uns drüben nachsehen!« Die Stimmen entfernten sich und verstummten schließlich.
»Wie kommt es, daß ich jedes Mal, wenn ich dir begegne, in einem dunklen, stinkenden Loch stehe?« fragte Guntrol. Das Mädchen zuckte mit den Schultern.
»Das könnte ich dich auch fragen. Und? Hat es sich gelohnt?« Sie warf einen Blick auf das Bündel, welches er unter dem Arm trug.
»Das gehört mir. Ich bin kein Dieb. Das war ein Mißverständnis. Aber ich wüßte gerne…«
»Ich glaube, die Luft ist jetzt rein«, unterbrach sie ihn und zwängte sich an ihm vorbei. Sie stieß das Gitter auf und zog sich behende hoch.
»He! Warte!« Guntrol kletterte hinterher, was nicht so einfach war, da er das Schwert festhalten mußte.
»Gestern hast du mir geholfen, heute ich dir. Wir sind damit quitt!«
»Wie bitte? Und was ist mit meinem Geld? Ist das deine Art, dich für meine Hilfe zu bedanken?«
»Damals wußte ich ja noch nicht, daß du mich würdest gehen lassen. Und dann warst du so schnell verschwunden.« Sie zog aus den unergründlichen Falten ihrer Kleidung einen kleinen Lederbeutel hervor und warf ihn Guntrol zu.
»Da hast du es zurück!«
»Danke!« Guntrol wog den Beutel in der Hand. Er fühlte sich ungefähr so schwer an, wie in seiner Erinnerung. Schon wollte er ihn aufschnüren, um den Inhalt nachzuzählen, als er sich eines anderen besann und ihn statt dessen wortlos in die Tasche steckte.
»Was haste da?« fragte das Mädchen, während es sich den Schmutz und die Spinnweben von der Kleidung wischte.
»Nur ein Schwert.«
»Ein Schwert? Wozu klaut man ein Schwert?«
»Ich habe es nicht geklaut!« rief Guntrol zornig.
»Psst! Nicht so laut!«
Guntrol lehnte sich gegen die Wand. »Wir sollten noch eine Weile warten«, meinte er.
»Wieso? Mich suchen die nicht.«
»Ich wollte nur… ich… äh… möchte mich für deine Hilfe bedanken«, stammelte Guntrol. Er spürte deutlich, wie ihm das Blut in den Kopf schoß.
»Keine Ursache. Wir Dieb… ich meine, das war doch selbstverständlich.«
»Kann ich dich etwas fragen?«
»Was?«
»Machst du das schon lange?«
»Wieso willst du das wissen?«
»Naja…« Guntrol spürte, wie er noch röter wurde. »Ich meine, du bist noch ziemlich jung und…das ist nicht gerade ein Beruf mit Zukunft.«
»Jeder muß das tun, was er am besten kann«, sagte das Mädchen spitz. Doch dann fügte es nachdenklich hinzu: »Es ist ja nicht so, daß ich das gern mache, aber…« Sie sprach nicht weiter, sondern wandte sich zum Gehen.
»Werden wir uns noch mal wiedersehen?« fragte Guntrol, dessen gefühlte Gesichtsfarbe irgendwo zwischen karmesin und burgunderrot einzuordnen war.
»Ich hoffe nicht. Ich werde die Stadt noch heute Abend mit dem Schiff verlassen. Hier wird es mir langsam zu heiß. Leb wohl!« Sie rannte die Gasse entlang, ohne sich noch einmal nach Guntrol umzusehen. Dieser blieb einigermaßen verdutzt und wie blöde in die Luft starrend zurück.
Er hatte seine Verfolger erfolgreich abschütteln können. Inzwischen war es Mittag geworden und die Straßen wurden belebter. Er versuchte, sich so unauffällig wie möglich zu bewegen. Doch konnte er nicht umhin, sich öfters umzudrehen und zu schauen, ob nicht doch irgend jemand hinter ihm her ging. So erreichte er endlich den Marktplatz.
Lagrange erwartete ihn bereits, wie vereinbart am Nudelstand. »Du kommst reichlich spät«, sagte er zur Begrüßung. »Ach du meine Güte! Was ist mit dir passiert? Jedes Mal, wenn ich dich allein lasse, gerätst du in irgendwelche Schwierigkeiten.«
»Es ist nichts. Ich wollte bloß das Schwert verkaufen, wurde als Dieb beschuldigt, mußte fliehen, wurde verfolgt, konnte entkommen, hab mich in einem Loch versteckt, dort die kleine Diebin von gestern getroffen, bekam meinen Geldbeutel zurück und schiebe einen mächtigen Kohldampf. Das ist eigentlich alles.«
»Dann wundert es mich allerdings nicht, daß du fast eine Stunde zu spät kommst. Lust auf eine Nudelsuppe?«
»Da sag ich nicht nein.«
Am Nudelsuppenstand herrschte ein ziemlicher Andrang, so daß sie eine ganze Weile warten mußten, bis sie einen freien Platz fanden. Während Lagrange wartete, daß seine Nudeln auf eine bekömmliche Temperatur abkühlten, konnte er belustigt beobachten, wie Guntrol die heißen Nudeln gierig verschlang.
»Wie kannst du das kochend heiße Zeug so verschlingen?« Guntrol zuckte mit den Schultern. »Isch nisch heisch«, grunzte er kauend. Lagrange warf lachend den Kopf in den Nacken. Als er endlich seine Portion in Angriff nahm, war Guntrol längst fertig. »Ich denke, ich nehme noch eine Schale voll.«
»Unglaublich!« brummte Lagrange. Seine Schüssel war noch zu zwei Dritteln voll. Guntrol zog indes seinen Geldbeutel hervor und knotete die Bänder auf. »Mal sehen ob noch alles drin ist«, meinte er.
»Das hätte ich als erstes getan.«
»Was ist das?« Er zog ein kleines, mehrfach gefaltetes Stück braunen Einwickelpapiers aus dem Beutel. »Eine Nachricht für mich?« Er faltete das Papier auseinander und strich es auf dem Tisch glatt.
»Was steht da?« fragte Lagrange und beugte sich vor.
»Werter Herr Kollege – so eine Unverschämtheit! – Hab Dank für deine Hilfe! Ich schulde dir 14 Taler. L.«
Guntrol starrte entgeistert auf den Zettel. Dann leerte er hastig den Beutel aus und fing an, sein Geld zu zählen.
»Neunundfünfzig Taler und achtundsiebzig Kreuzer. Gestern waren es noch vierundsiebzig Taler.« Lagrange versuchte vergeblich ein Lachen zu unterdrücken und versteckte sein Gesicht hinter der Suppenschale.
»Diese Ratte! Wenn ich die in die Finger kriege!«
»Vergiß es!« gluckste Lagrange, der kaum sprechen konnte. »Ich glaube nicht, daß du noch mal Gelegenheit bekommen wirst, diesen Schuldschein einzulösen. Und wenn doch, dann bezahlt sie dich bestimmt mit Geld, das sie vorher anderen Leuten geklaut hat.«
»Ich finde das nicht halb so lustig. Wie sollen wir die Reise in die Hauptstadt finanzieren? Das Schwert hab ich auch nicht verkaufen können, und jetzt fehlen uns auch noch vierzehn Taler. Davon hätten wir eine halbe Woche essen können.«
»Ist schon gut, ich spendiere dir noch eine Nudelsuppe«, sagte Lagrange und langte nach seiner Tasche. »He! Momente mal!« Seine Miene verdunkelte sich schlagartig. Hastig nestelte er an der Schnalle und riß die große Umhängetasche auf. Zuerst wühlte er darin herum, dann fing er an, Sachen heraus zu ziehen, schließlich kippte er die Tasche um und schüttelte ihren gesamten Inhalt auf dem Boden. In seinem Gesicht begann sich blanke Panik abzuzeichnen.
»Was ist denn? Sag doch was!« Guntrol durchzuckte eine böse Ahnung. »Sag, daß es nicht das ist!« Lagrange war kreidebleich und sank kraftlos in sich zusammen. »Sie ist weg… einfach weg«, stammelte er.
Guntrol sprang auf, nahm die Tasche, sah hinein und kniete am Boden und durchwühlte Lagranges verstreut herumliegende Habseligkeiten. Es bleib dabei: die kleine braune Ledertasche mit dem königlichen Wappen und dem kleinen Messingschloß, war nicht mehr da.
»Es ist alles aus…« stöhnte Lagrange.
»Wie konnte das geschehen? Was ist passiert?« fragte Guntrol. Er schüttelte Lagrange heftig an der Schulter, damit dieser wieder zu sich komme.
»Ich weiß es nicht.«
»Heute morgen, als wir das Gasthaus verlassen haben, war sie doch noch da, oder?« Lagrange nickte.
»Dann muß sie jemand im Gedränge auf dem Markt genommen haben, oder als du beim Einkaufen warst.«
Lagrange schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte er. »Das wäre mir aufgefallen. Ich habe doch meinen Geldbeutel auch in der Tasche… hatte ihn in der Tasche«, stellte er mit halb erstickter Stimme fest.
»Keine Panik! Das werden wir schon irgendwie wieder hinbekommen.«
»Hinbekommen? Wie willst du das hinbekommen?« Lagrange sprang auf und raffte seine Sachen zusammen. »Es ist alles aus! Meine Ehre…die Mission…«
»Beruhige dich! Dich trifft keine Schuld. Das waren bestimmt ganz raffinierte Taschendiebe. Wenn wir nur wüßten… Ist dir heute nichts aufgefallen? Irgend etwas ungewöhnliches? Seltsame Leute auf der Straße? Hat dich jemand angerempelt oder in ein Gespräch verwickelt?«
Lagrange überlegte und knetete dabei, wie es seine Angewohnheit war, die Unterlippe. »Es war ein ziemliches Gedränge auf dem Markt. Da merkt man nicht, wenn man im Vorbeigehen jemanden touchiert. Ich hatte aber mein Geld noch. Ich weiß, wie ich…« Er hielt inne und fing an, die zahlreichen Taschen seines Gewandes abzutasten.
»Oh! So ein Glück! Ich hatte den Geldbeutel nicht zurück in die Umhängetasche gesteckt, sondern in die Innentasche meines Gewandes.« Er zog seinen kleinen Geldbeutel hervor und strich fast zärtlich mit der Hand darüber.
»Und die andere Tasche hast du nicht zufällig auch?«
»Nein, warum sollte ich? Dafür war sie zu dick und zu groß.« Er überlegte, dann fiel es ihm ein: »Ich erinnere mich, daß mich jemand nach dem Weg gefragt hat. Es war eine junge Frau…«
Guntrol spitzte die Ohren. Ihm schwante etwas. »Wie sah sie aus?« fragte er.
»Sie war mittelgroß, für eine Frau sogar eher groß. Dunkelbraunes, sehr langes Haar, ein blaues Stirnband. Ein Kleid aus einem Stoff, den ich nicht beschreiben kann. Insgesamt eine sehr vornehme Erscheinung und ziemlich gut aussehend. Vielleicht eine Ausländerin.«
»Dann war sie es nicht«, sagte Guntrol erleichtert. »Ich hatte schon befürchtet… Aber die, die ich meine, ist klein und trägt eine grüne Filzkappe.«
»Da war eine mit einer grünen Mütze. Sie begleitete die Frau. Es war ein junges Mädchen mit einer grünen Mütze oder Kappe, fast wie ein Helm. Ich habe ihr keine weitere Beachtung geschenkt, da ich sie für die Dienerin der Frau gehalten habe. Außerdem sah sie ziemlich unscheinbar aus.«
»Das war sie. Das war ganz bestimmt sie! Sie muß noch eine Komplizin haben. Natürlich, die eine lenkt das Opfer ab und die andere greift zu. – Aber das ist gut.«
»Was bitte soll daran gut sein?«
»Wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und ich weiß, daß die Kleine vor hat, heute Abend mit einem Schiff die Stadt zu verlassen.«
»Ach ja? Und wohin?«
»Das ist doch egal. So viele Schiffe werden heute Abend nicht losfahren. Wir brauchen sie nur am Hafen abzufangen.«
»Du hast recht, Guntrol. Noch ist nicht alles verloren. Auf zum Hafen!« Lagrange sprang auf. Er war wie ausgewechselt. Hatte er noch vor einem Augenblick wie ein alter gebrochener Mann gewirkt, so war er auf einen Schlag wieder in Guntrols Alter und voller Energie.
»Wir dürfen nichts überstürzen. Sie wissen nicht, daß wir zusammen gehören. Diesen Vorteil müssen wir ausnützen. Vor mir wird sich die Kleine nicht verstecken.«
»Was schlägst du vor?«
»Wir gehen zurück in die Herberge, packen unsere Sachen zusammen und gehen nunter zum Hafen. Vorher müssen wir noch herausfinden, was für Schiffe heute noch ablegen. Wir müssen die beiden erwischen, bevor sie auf dem Schiff sind.«
»Ich frage mich, was passiert, wenn sie die Tasche aufmachen.« Lagrange knetete schon wieder seine Unterlippe. »Was, wenn etwas wertvolles drin ist, das sich gut verkaufen läßt? Vielleicht verschieben sie ihre Reise und verkaufen die Sachen vorher in der Stadt.«
»Das glaube ich nicht. Sie müssen damit rechnen, daß sie gesucht werden. Ich denke, sie werden versuchen, es aus der Stadt zu schmuggeln und es in der nächsten Stadt zu verkaufen, wo keiner sie kennt.«
»Die nächste größere Stadt flußaufwärts ist Stenzach. Flußab liegen Zaulen und Pferch. Pferch ist die letzte Stadt vor der Grenze. Hoffentlich fahren sie nicht weiter bis nach Ruritanien.« Lagrange zog die Karte hervor und setzte sich wieder hin. »Die erste größere Stadt in Ruritanien ist Narbusch. Danach gibt es noch viele Städte.«
»Wie weit können sie mit dem Schiff kommen?« fragte Guntrol.
»Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, wie weit der Fluß schiffbar ist. Aber bis Rura bestimmt. Dann mündet der Allwei in den Nall und der wiederum mündet weit im Süden in den Ozean. Das muß entweder in Salvia oder in Pallandien sein, keine Ahnung. Ich habe noch nie eine Karte von diesen Ländern gesehen.«
»Aber das wären ja über tausend Meilen.«
»Ungefähr siebenhundertfünfzig. Doch das ist immer noch viel. Aber ich kann mir nicht vorstellen, daß sie so weit fahren. Ich will es nicht hoffen. Ruritanien wäre schon schlimm, nach allem, was man über die Regierung dort so hört. – Also gut, laß uns aufbrechen!« Er stand auf, doch Guntrol hielt ihn zurück.
»Nicht so eilig, mein Freund. Wir haben noch viel Zeit. Und außerdem wolltest du mir nicht noch eine Nudelsuppe spendieren? Von so einem bißchen wird doch keiner satt.«
Lagrange sank mit offenem Mund wieder auf die Bank zurück, und mit einem Male sah er wieder um viele Jahre älter aus.
Viertes Kapitel.
Die Flußschiffahrt.
Lagrange hatte sich allein zum Gasthaus aufgemacht, um das Gepäck abzuholen. Viel war es nicht: Guntrols Rucksack und sein Kleiderbündel und Lagranges Reisetasche. Guntrol begab sich inzwischen zur Schiffsanlegestelle. Sie hatten vereinbart, sich später dort zu treffen. Guntrol fand den Hafen wie immer fast menschenleer vor. Doch dieses Mal lagen gleich zwei Schiffe am Steg. Das eine war ein Lastkahn, der gerade mit verschiedenen Waren beladen wurde. Ein riesiger Haufen roter Backsteine stand am Hafenquai und wartete darauf verladen zu werden. Zwei Arbeiter waren im Begriff, die Steine auf ein Fuhrwerk zu verladen. Anscheinend waren sie am Morgen von einer flußaufwärts gelegenen Ziegelei angeliefert worden. Am Fluß gab es einige sehr ergiebige Tongruben, weshalb die Herstellung von Ziegeln und Backsteinen ein nicht unbedeutender Wirtschaftszweig der Region war. Da es in der Nähe keine Steinbrüche gab, waren sie das einzige bezahlbare Baumaterial.
Das andere Schiff war größer. Es handelte sich um ein Passagierschiff. Es war einfach gebaut und ähnelte in seinem Aufbau den Lastkähnen auf dem Fluß, verfügte aber im Gegensatz zu diesen über eine Reling und einen offenen Decksaufbau, der zumindest einen gewissen Schutz vor den Elementen gewährte. Eine Art Markise aus hellem starkem Leinenstoff schützte die Fahrgäste vor Regen und Sonnenlicht. Da die Witterung aber freundlich und trocken war, wurde der Schutz nicht benötigt, und die Markisen waren eingerollt und an den Holmen festgezurrt. Viel Komfort bot das einfache Schiff freilich nicht. Es gab keine Kabinen, nur Bänke und für die vornehmeren Passagiere auf dem Achterdeck gepolsterte Sessel.
Guntrol fragte einen der Schiffer, die auf dem Deck standen nach der Abfahrtszeit. Von ihnen erfuhr er, daß das Schiff noch am selben Abend pünktlich um sechs Uhr in Richtung Zaulen ablegen würde. Die Fahrt dauere einen ganzen Tag und sie kostete zehn Taler pro Person auf dem Vorschiff, fünfzehn auf dem Mittelschiff, und fünfundzwanzig auf dem Achterdeck. Die Fahrt wäre gut ausgebucht, doch gäbe es noch ein paar freie Plätze.
Guntrol sah sich um. Doch er konnte weder auf dem Schiff noch an Land das diebische Mädchen mit der grünen Mütze oder seine schöne Begleiterin ausmachen. Da er nichts weiter zu tun hatte, als auf seinen Freund zu warten, schlenderte er ein wenig in der Gegend umher, besuchte die Hafenstraße, sah in die Lagerhäuser, ging über den leeren Fischmarkt. Er stattete sogar der schmalen Gasse zwischen den Lagerhäusern einen Besuch ab, wo er am Vormittag das Mädchen getroffen hatte. Alles vergeblich. Weder von der kleinen Diebin noch der eleganten Frau fand er die geringste Spur. Er ging bis zum Hafentor und schaute auf die Sonnenuhr. Noch gute zweieinhalb Stunden bis zur Abfahrt des Schiffes. Da es das einzige Fahrgastschiff war, das im Hafen lag und es keine andere Anlegestelle gab, konnte das Mädchen nur dieses Schiff gemeint haben.
Doch was, wenn es nicht die Wahrheit gesagt hatte? Guntrol wurde immer nervöser. Er kehrte zum Schiff zurück. Von weitem sah er Lagrange die Straße entlang kommen. Er wirkte sehr bedrückt, und das lag nicht daran, daß er das ganze Gepäck tragen mußte. Obgleich er nicht wußte, was sich in der verschwundenen Tasche befunden hatte, nahm er sich deren Verlust sehr zu Herzen.
Armer Lagrange! dachte Guntrol. Er war schon als kleiner Junge immer so ernst, gewissenhaft und korrekt gewesen. Als Schüler hatte Lagrange noch nie die Hausaufgaben vergessen, war in der ganzen Zeit nur ein einziges Mal zu spät gekommen; und das auch nur, weil ein Schneesturm das halbe Land meterhoch zugeschneit hatte. Gefehlt hatte er auch nur an jenen Tagen, an denen er mit hohem Fieber im Bette gelegen hatte. Und selbst dann war er nicht davon abzubringen gewesen, das Versäumte zu Hause nachzuholen.
Guntrol war diesbezüglich aus einem ganz anderen Holze geschnitzt. Er war sich nie für einen Spaß zu schade gewesen, hatte keine Gelegenheit für einen Lausbubenstreich ausgelassen. Statt seine Hausaufgaben zu machen, hatte er sich lieber vom Lehrer mit dem Rohstock den Hintern versohlen lassen. Und trotz aller Unterschiede in Charakter, Temperament und Interessen, waren die beiden Freunde geworden. Vielleicht ergänzten sie einander einfach zu gut.
Guntrol lief Lagrange entgegen. Er nahm ihm einen Teil des Gepäcks ab und berichtete ihm, was er über das Schiff hatte in Erfahrung bringen können.
»Wir müssen geduldig sein. Wir werden uns unten am Hafen auf die Lauer legen, und wenn sie auftauchen, müssen wir rasch und entschlossen handeln«, sagte Lagrange. »Wir müssen unbedingt dafür sorgen, daß sie nicht fliehen können. Am besten schleichen wir uns auf das Schiff und schlagen zu, wenn wir mitten auf dem Fluß sind.«
»Was meinst du mit ‘zuschlagen’?«
»Du packst sie und hältst sie fest und ich werde sie zur Rede stellen.«
»Wieso ich?«
»Du bist nun mal der kräftigere von uns beiden. Außerdem hast du das Schwert und die Schärpe eines königlichen Boten. Damit kannst du den Kapitän zur Mitarbeit zwingen.«
»Ich weiß nicht…«
»Flußschiffer sind einfache Leute. Sie haben Respekt vor der Obrigkeit. Und sie können sich keinen Ärger mit den Behörden leisten.«
»Wenn du es sagst. Die Fahrt kostet zwischen zehn und fünfundzwanzig Talern.«
»Ich denke mal, daß die billigsten Plätze für uns ausreichen.« Sie gingen zum Quai runter. »Laß uns hier warten«, sagte Lagrange.
»Dieser Haufen Steine ist ideal. So können wir den Steg und das Schiff beobachten, ohne selbst von der Straße aus gesehen zu werden. Sobald sie eingestiegen sind, schleichen wir uns an Bord.« Guntrol nickte und versuchte, auf dem Backsteinhaufen eine einigermaßen erträgliche Sitzposition einzunehmen. Lagrange hingegen saß wie auf glühenden Kohlen. Er rutschte hin und her, stand auf und setzte sich wieder hin. Seine Geduld sollte noch auf eine harte Probe gestellt werden.
Vom Turm des Hafentores schlug die Glocke fünf Mal. Allmählich fanden sich die ersten Fahrgäste des Schiffes ein. Es waren mehrheitlich Händler und Kaufleute, mit Körben und Kisten, Arbeiter vom Land, die in der Stadt ein paar Monate gearbeitet hatten und nun zurück in ihre Heimatdörfer fuhren. Lagrange stieß Guntrol an, der gerade im Begriff war, einen kleinen Imbiß zu sich zu nehmen.
»Wie kann man nur so verfressen sein?« schimpfte er. »Paß gefälligst auf, und sag mir, wenn du sie siehst.« Guntrol nickte kauend und sah auf die Treppe, die zum Steg führte.
»Wie spät ist es?« fragte Lagrange. Guntrol zuckte mit den Schultern. »Weiß nicht. Kurz nach fünf, schätze ich.«
»Die müssen doch mal kommen. Ich hätte schon längst meinen Platz eingenommen.«
»Die kommen schon noch.« Guntrol gähnte herzhaft. Er fühlte sich schon wieder müde. Lagrange wippte mit dem Fuß; sein Takt wurde immer schneller.
»Mensch! Wo ist deine Gelassenheit geblieben? Sonst redest du immer so viel vom Schicksal und der Vorsehung und dem unergründlichen Ratschluß der Götter.«
»Du hast recht, Guntrol«, erwiderte Lagrange mit veränderter Stimme. »Weißt du, ich habe viel nachgedacht, in letzter Zeit. Vielleicht eigne ich mich nicht für diesen Beruf. Ich habe mich schon immer zu Büchern und den geheimen Künsten hingezogen gefühlt. Ich wollte wissen, woher die Dinge kommen und wie sie funktionieren. Also schien es mir das logischste zu sein, die Laufbahn eines Priesters oder Magiers einzuschlagen. Ich wollte so werden, wie Meister Pardieu. Aber wenn es Schwierigkeiten gibt, dann verliere ich den Kopf. Das hier war mein erster selbständiger Auftrag, und ich habe ihn gründlich vermasselt. Vielleicht sollte ich Schulmeister werden, oder Schreiber, oder Beamter im fürstlichen Vogtamt.«
»Red keinen Unsinn, Lagrange! Es ist nicht deine Schuld, daß es so gekommen ist. Gib nicht so schnell auf!«
»Möglicherweise hast du recht. Ich lasse mich zu rasch entmutigen. Ich sollte in mich gehen und darüber meditieren.« Sie schwiegen und warteten weiter. Das Schiff begann sich allmählich zu füllen. Die Besatzung traf letzte Vorbereitungen zur Abfahrt. Ein fliegender Händler mit zwei großen Henkelkörben ging soeben an Bord, um die Reisenden mit Proviant zu versorgen.
»Ich frage mich, was der wohl in den Körben hat. Vielleicht Wurstbrötchen, oder gebratenes Hühnchen«, sagte Guntrol. Lagrange erwiderte nichts. Seine Blicke sprachen dafür um so deutlicher, was er dachte.
»Lagrange, wenn sie nicht kommen, können wir immer noch…«
»Da schau her!« Er packte Guntrol am Arm. »Die Frau dort. Das ist die, die mich auf dem Markt angesprochen hat.« Guntrol beugte sich vor. Er konnte nicht viel erkennen, denn die Frau, auf die Lagrange deutete, trug einen weiten Kapuzenumhang.
»Bist du sicher?« fragte er. »Man kann kaum etwas erkennen. Ihr Gesicht ist verdeckt.«
»Ja, ich bin ganz sicher. Jetzt sieht man sie von der Seite, aber vorhin hat sie in unsere Richtung geschaut. Und da habe ich ihr Gesicht genau erkannt. Doch wo ist die andere? Die Kleine mit der Kappe? Es sieht so aus, als wollten die gleich ablegen.« Jetzt wurde auch Guntrol von der Spannung angesteckt. Hatte das Mädchen sich aus dem Staub gemacht? Vielleicht hatten sie die Beute bereits geteilt und jede ging ihrer Wege. Oder die eine hatte ihre Komplizin hintergangen und sich allein mit der Beute aus dem Staub gemacht. Nein, daran mochte Guntrol nicht glauben. Er mußte an den Zettel in seinem Geldbeutel denken. Ein skrupelloser Dieb würde sich nicht bedanken.«
»Da! Sie machen schon die Haltetaue los!« rief Lagrange.
»Na also. Wer kommt denn da?« sagte Guntrol erleichtert. Er deutete auf eine kleine Gestalt, die flink wie ein Reh über den Quai huschte, die Treppe hinab und auf das Schiff sprang.
»Jetzt aber los!« rief Lagrange. Er kletterte über den Steinhaufen und lief zum Schiff hinunter. Guntrol hatte richtig Mühe, mit ihm Schritt zu halten. Eine derartige Hurtigkeit hätte er seinem Freund nicht zugetraut. Schon gar nicht in dem langen Gewand und mit zwei Taschen unter den Armen und einem sperrigen Stab in der Hand.
Keuchend langten sie am Schiff an und konnten gerade noch verhindern, daß der Laufsteg, der das Schiff mit dem Anleger verband, eingezogen wurde.
»Halt! Wir wollen auch mit!« Sie sprangen an Bord. Kaum waren sie auf dem Schiffsdeck gelandet, zog Lagrange die Kapuze seines Reisemantels über den Kopf. Er wollte nicht, daß man ihn vielleicht erkannte, bevor das Schiff abgelegt hatte. Guntrol sah sich um. Die elegante Dame in dem blauen Umhang hatte mittschiffs Platz genommen. Das Mädchen mit der grünen Mütze stand am Bug des Schiffes und beobachtet aufmerksam, wie die Besatzung die letzten Taue einholte und das Schiff mit langen Holzstangen von dem Steg abstieß.
Träge und mit einem leisen Knirschen bewegte sich das Schiff vom Ufer weg. Je weiter sie auf den Fluß vorstießen, desto stärker wurde die Strömung. Das Schiff nahm langsam Fahrt auf. Es trieb mit der Strömung, die auf diesem Flußabschnitt und bei dem gegenwärtigen Wasserstand nicht besonders stark war. Daher war es auch möglich, den Fluß während der Nacht zu befahren. Es gab auf diesem Abschnitt keine gefährlichen Sandbänke oder Felsen, der Mond schien hell und der Fluß war ausreichend breit.
»Na, dann wollen wir mal!« Guntrol legte seine Schärpe an und rückte sein Schwert zurecht. Lagrange ergriff seinen Stab. Der Gang zwischen den Sitzbänken war schmal, so daß sie hinter einander gehen mußten. Das hatte aber den Vorteil, daß so die Fluchtmöglichkeiten eingeschränkt waren. Lagrange ging voraus, Guntrol folgte ihm auf den Fersen.
Das Mädchen mit der Mütze bemerkte Lagrange erst, als er dicht vor ihm stand. Es zuckte leicht zusammen, verzog aber keine Miene und versuchte möglichst gleichgültig drein zu schauen.
»Kennen wir uns nicht?« fragte er, wobei er sich bemühte, seinen Zorn zu unterdrücken. Das Mädchen schüttelte den Kopf. Die große dunkelhaarige Frau, die neben ihr auf der Bank saß, hob den Kopf und sprach: »Oh! Was für ein Zufall! Ihr seid auch hier an Bord? – Sieh doch genau hin!« sagte sie zu dem Mädchen gewandt. »Das ist der Herr, der uns heute Morgen so freundlich den Weg erklärt hat.«
»Leider vermisse ich seit der Begegnung etwas aus meinem Besitz. Und das möchte ich unverzüglich zurück haben.«
Die Dame erhob sich und sagte scharf: »Ich weiß nicht, worauf Ihr hinaus wollt.«
»Darauf, daß mindestens eine von Euch eine ganz gemeine Diebin ist«, sagte Guntrol. Als das Mädchen ihn erkannte, versuchte es, zurückzuweichen, doch Lagrange packte sie am Arm und hielt sie fest.
»Was hat das zu bedeuten? Was fällt Euch ein?«
»Gestern hat sie mir den Geldbeutel geklaut. Und heute Morgen meinem Freund eine kleine Ledertasche.«
»Ist das war?« fragte die Frau und sah das Mädchen streng an. Ihr Blick war scharf und durchdringend. Guntrol lief es kalt über den Rücken. Das Mädchen schüttelte trotzig den Kopf und schwieg.
»Dann werden wir sie eben durchsuchen müssen«, sagte Lagrange.
»Laß mich mal!« meinte Guntrol. Er zwängte sich neben Lagrange.
»Hör zu!« sagte er zu dem Mädchen, das sich vergeblich aus Lagranges Griff zu entwinden suchte. »Diese Sachen sind für uns sehr wichtig. Wir müssen sie unter allen Umständen zurück haben. Wenn du vernünftig bist, wollen wir die Angelegenheit unter uns regeln. Aber wenn du dich verstockt zeigst, müssen wir dich den Behörden übergeben. Und du weißt, was das bedeutet.« Das Mädchen schluckte und preßte die Lippen aufeinander.
»Ich will auch das mit den vierzehn Talern vergessen.«
»Vierzehn Taler?« sagte die Frau. »Gestern hattest du noch nicht genug Geld für die Schiffahrt und heute morgen fanden sich zufällig noch vierzehn Taler in deiner Tasche? Wenn ich geahnt hätte, daß du ein gemeiner Dieb bist, hätte ich mich nie mit dir abgegeben.« Zu Lagrange sagte sie: »Ehrwürdiger Herr! Es tut mir unendlich leid, daß Ihr durch meine Gefährtin solche Ungelegenheiten hattet. Ich will Euch selbstverständlich den Schaden ersetzen.«
»Was ist hier los?« Der Kapitän des Schiffes war durch den Lärm aufmerksam geworden. »Ihr habt noch nicht für die Fahrt bezahlt.«
»Das werden wir sogleich nachholen. Aber vorher müssen wir eine dringende Angelegenheit klären«, sagte Lagrange gereizt.
»Wenn Ihr hier die Damen belästigt…«
»Herr Kapitän!« rief Guntrol und ließ seine blaue Schärpe aufblitzen. »Ihr erkennt das Wappen?« Der Kapitän sah sich die Schärpe an und kratzte sich am Kopf.
»Ich bin ein Gesandter des Königs in einer offiziellen Mission. Ihr werdet mir doch wohl jede geforderte Unterstützung gewähren?«
»Ja, Herr!« sagte der Kapitän. »Ich bin ein gesetzestreuer Untertan unseres ehrwürdigen Königs.«
»Gut. Das freut mich. Wir werden vielleicht eure Hilfe benötigen. Haltet euch bitte zur Verfügung.« Der Kapitän nahm seine Mütze ab und verbeugte sich, dann zog er sich zu seinen Männern aufs Achterdeck zurück. Er wechselte ein paar Worte mit dem Steuermann am Ruder.
»Du – du bist Bote des Königs«, stammelte das Mädchen. »Ich hab doch nicht gewußt, daß der da zu dir gehört. Ich hätte sonst nie…«
»Wo ist die Tasche?« fragte Guntrol etwas freundlicher.
»Ich hab sie nicht mehr.«
»Was?« Lagranges Gesicht fing an, sich zu entfärben.
»Ich habe sie weggeworfen. Es war ja nichts besonderes drin, was ich hätte gebrauchen können. Außer dem hier.« Sie steckte die Hand in ihre Manteltasche und zog einen golden schimmernden Ring hervor.
»Das ist noch nicht alles.« Sie wühlte in ihrer Tasche und förderte einen flachen Stein, auf dem einige Zeichen und ein Muster eingraviert waren, zu Tage. In der Mitte der Steinscheibe befand sich eine kleine runde Vertiefung.
»Da gehört noch eine Kugel dazu…« Sie steckte ihre Hand tief in die Tasche und fischte schließlich eine milchig schimmernde Kugel aus Glas oder Stein hervor. Sie hatte ungefähr die Größe einer Murmel.
»Das ist nicht alles«, sagte Lagrange.
»Die anderen Sachen hab ich weggeworfen. Aber da war nichts wertvolles dabei. Nur eine alte Schriftrolle und ein Stück Papier.«
»Wo hast du die Sachen gelassen?«
»In dem Loch…«
»Sprichst du von…«
»Da, wo wir uns versteckt hatten«, sagte sie.
»Heißt das, daß ich heute morgen praktisch auf den Sachen gestanden habe?« Guntrol wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn.
»Wir müssen sofort umkehren«, rief Lagrange. »Herr Kapitän! Haltet das Schiff an. Wir müssen sofort zurück nach Pfeilburg.« Unter den Passagieren begann sich Unmut zu regen.
Das Mädchen aber nutzte die Gelegenheit, als Lagrange abgelenkt war. Sie stieß ihn zur Seite. Er wollte sie noch packen, doch sie duckte sich und er bekam statt dessen nur ihre Mütze zu fassen. Das Mädchen stieß einen leisen Schrei aus und hielt sich die Hände über den Kopf. Aber da war es schon zu spät. Alle hatten es bereits gesehen.
»Ein Monster!« rief Guntrol erschrocken.
»Ich bin kein Monster, du Arsch!« schrie das Mädchen und gab ihm eine schallende Ohrfeige. »Es tut mir leid, ich erkläre Euch alles später«, sagte sie zu ihrer Begleiterin. Dann sprang sie auf eine leere Sitzbank und hechtete mit einem Kopfsprung über die Reling in das schwarze Wasser. Guntrol war perplex. Es dauert einen Augenblick, bis er sich wieder so weit gefaßt hatte, daß er reagieren konnte. Er legte seinen Rucksack und seine Tasche ab und war schon im Begriffe, hinterher zu springen, als Lagrange ihn zurückhielt. Die Passagiere wurden nervös. Einige erhoben sich von ihren Sitzen und schauten nach der Seite, wo das Mädchen verschwunden war. Der Kapitän und die Besatzung hatten alle Hände voll zu tun, um zu verhindern, daß das Schiff in Schräglage geriet. Auch Guntrol starrte auf den Fluß. Doch von dem Mädchen im Wasser war nichts mehr zu sehen.
»Hast du gesehen, was ich gesehen hab?« fragte Guntrol. Lagrange nickte.
»Sie hat Katzenohren.«
»Was hat das zu bedeuten? Ist sie ein Dämon, oder ein Monster?« Lagrange schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte er. Sie verfügt über keine Dämonen-Aura. Ich glaube, sie gehört zu einem Volk aus dem hohen Norden. In den undurchdringlichen Wäldern und Steppen Nolands soll der Sage nach vor Urzeiten ein Volk von Katzenmenschen gelebt haben. Ich hielt das immer für ein Märchen, aber anscheinend ist da etwas wahres dran.«
»Wir müssen sofort zurück«, sagte Guntrol.
»Ich bedauere, Herr«, meldete der Kapitän sich zu Worte. »Aber wir sind nicht dafür eingerichtet, flußaufwärts zu fahren. Dafür bräuchten wir doppelt so viele Männer und Ruder.«
»Könnt Ihr uns dann wenigstens an Land setzen?«
»Ich will es versuchen. Aber das Ufer ist hier sehr sumpfig. Wir könnten stecken bleiben. Es gibt erst ein Stück weiter unten eine geeignete Stelle. Da will ich gerne anhalten lassen. Verratet Ihr mir auch, was das alles zu bedeuten hat?«
»Es ist nichts weiter. Nur eine kleine Diebin, die wir seit gestern verfolgt haben.«
»Sie ist gewiß ertrunken. Hier gibt es tückische Strudel, die einen Schwimmer rasch nach unten ziehen können.«
»Das will ich nicht hoffen«, sagte Guntrol leise. Er sah hinaus auf den Fluß, dessen Wasser schwarz und vom orangen Licht der untergehenden Sonne mit kupfernen Fäden durchwirkt aussah.
Sie mußten sich noch eine ganze Weile gedulden, bis der Kapitän endlich eine geeignete Stelle zum Anlanden fand. Mit vereinten Kräften brachte die Mannschaft das Schiff in Ufernähe zum stehen. Guntrol, Lagrange und die dunkelhaarige junge Frau machten sich bereit, von Bord zu gehen.
»Verzeiht meine Unhöflichkeit. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Shanora.«
»Ich heiße Lagrange und das hier ist mein alter Freund Guntrol.«
»Wieso wollt Ihr mit uns nach Pfeilburg zurückkehren?« fragte Guntrol, während er seine Schuhe auszog.
»Ich fühle mich ein wenig für die Untaten des Mädchens verantwortlich«, sagte sie und fügte sogleich hinzu: »Selbstverständlich hatte ich keine Ahnung von ihrem Treiben; das müßt Ihr mir glauben. Aber ich hätte vielleicht aufmerksamer sein sollen.«
Das Schiff konnte in dem flachen Wasser am Ufer nicht so dicht auffahren, daß sie trockenen Fußes an Land gelangen konnten. Daher mußten sie ein Stück durch das oberschenkeltiefe Wasser waten.
»Wie müssen uns ein bißchen beeilen, wenn wir es noch vor Torschluß in die Stadt schaffen wollen«, sagte Lagrange.
Sie brachten ihre Kleidung wieder in Ordnung. Guntrol beäugte Shanora argwöhnisch. Ihm war die Anwesenheit dieser Frau alles andere als genehm. Zu gerne hätte er die geheimnisvollen Gegenstände, die sie dem Mädchen abgenommen hatten, näher untersucht. Aber vor den Augen dieser Fremden, welche mit der kleinen Diebin in einer undurchsichtigen Verbindung stand, war es undenkbar, die Angelegenheit zu erörtern.
»Ich bin froh, daß Ihr Euer Eigentum wieder zurück erlangt habt, wenigstens zu einem Teil«, sagte Shanora. »Die Sachen scheinen Euch sehr teuer zu sein.«
»Wohl!« brummte Lagrange. Sie gingen schweigend nebeneinander am Fluß entlang. Es gab einen schmalen Pfad, der gelegentlich von Treidlern genutzt wurde. Sie marschierten zügig, denn sie mußten noch vor Sonnenuntergang wieder in der Stadt sein, wenn sie nicht horrende Gebühren für eine Sonder-Toröffnung bezahlen wollten. Nach einer guten Dreiviertelstunde kamen in der Ferne die ersten Zinnen der Stadtmauer und das spitze Turmdach des Osttores in Sicht.
»So ein Glück. Wir schaffen es noch rechtzeitig«, sagte Lagrange. »Guntrol, du mußt mir gleich die Gasse zeigen.«
»Ja, ist gut, aber…« Er sprach nicht weiter, sondern warf einen verstohlenen Blick auf Shanora. Sie bemerkte dies wohl, zeigte aber keine Reaktion.
Kaum hatten sie das Stadttor passiert, führte Guntrol sie zielstrebig nach der Unterstadt. Bald darauf standen sie vor der schmutzigen Gasse bei den Lagerhäusern. Shanora rümpfte die Nase, als sie einen Blick hinein warf. »Ich warte hier auf Euch, wenn es recht ist«, sagte sie.
Die anderen beiden liefen zum Ende der Gasse. Der Schacht war mit dem Gitter bedeckt. Nichts deutete darauf hin, daß seit dem Vormittag noch einmal jemand sich daran hatte zu schaffen machen. Guntrol hob den Gitterrost hoch und kletterte hinab.
»Und?« fragte Lagrange.
»Hier ist es stockfinster. Ich kann gar nichts erkennen. – Nein, halt! Da ist etwas. Ich brauche ein Licht.«
»Woher soll ich ein Licht nehmen?« brummte Lagrange. Er fischte in seiner Tasche herum, bis er schließlich einen Kerzenstummel fand. Er konzentrierte seine Kraft und nach mehreren vergeblichen Versuchen gelang es ihm endlich, den Docht zu entzünden. Er reichte die Kerze in das Loch hinab.
»Was ist denn das? – Igitt!«
»Alles in Ordnung, Guntrol?«
»Ja, ja. Ah! Da ist es.« Es erschien Guntrols blonder Haarschopf in der Öffnung. Er war über und über mit Staub, Spinnweben und Dreck bedeckt. In der Hand hielt er die kleine Ledertasche. Das Messingschloß war offen aber unbeschädigt. Anscheinend war es mit einem Dietrich oder ähnlichen Werkzeug geöffnet worden. Lagrange nahm die Tasche an sich und untersuchte ihren Inhalt, während Guntrol aus dem Loch kletterte.
Die Tasche enthielt eine Schriftrolle, die dem Aussehen nach ziemlich alt war, sowie ein zusammengerolltes steifes Papier. Guntrol blies die Kerze aus. Mit einem lauten Poltern ließ er das Eisengitter zufallen.
»Bist du sicher, daß du nichts übersehen hast?« fragte Lagrange. Guntrol nickte und klopfte sich den Staub ab. »Da ist nichts weiter. So groß ist der Schacht auch nicht.«
»Dann laß uns gehen!«
»Warte noch einen Augenblick. Was machen wir mit ihr?« Er deutete mit dem Kopf auf den Ausgang der Gasse, wo Shanora wartete. »Ich frage mich, was sie von uns will. Wieso hat sie sich uns angeschlossen?«
»Sie sagte, sie wolle den Schaden, den das Katzenmädchen…«
»Unsinn! Das glaubst du doch nicht wirklich. Wer ist sie? Wir kennen sie nicht. Sie könnte eine Spionin sein. Immerhin weiß sie, was in der Tasche war. Vielleicht haben sie noch andere Dinge darin gefunden, die sie vor uns verschwiegen. Das muß man alles bedenken. Vielleicht will sie die Arbeit, die das Katzenmädchen angefangen hat, vollenden. Vielleicht hat sie auch wirklich nichts damit zu tun. Aber so lange wir es nicht wissen, sollten wir kein Risiko eingehen.«
»Du hast recht. Wir müssen auf der Hut sein. Hier! Nimm du die Sachen an dich, ich nehme die Tasche mit den Schriften. Es ist besser, wenn nicht einer alles bei sich allein trägt. Und jetzt sollten wir gehen. Wir sind schon lange genug hier verweilt.«
»Ich hoffe, ihr habt Euer Eigentum nun wieder vollständig beisammen«, sagte Shanora, als die beiden aus der Gasse zurückkehrten. »Ihr habt bestimmt einige Fragen an mich, und auch ich würde gern etwas mit Euch besprechen. Es ist schon spät. Ich würde euch beide gern als kleine Entschädigung zum Essen einladen. Ich kenne ein ganz gutes Gasthaus hier in der Stadt, wo man gut speisen kann.«
»Ein bißchen Hunger hätte ich schon«, meinte Guntrol zögernd, während er den goldenen Ring und den Stein in seiner Hosentasche umklammert hielt.
»Gut, gehen wir!« entschied Lagrange. Shanora führte sie zur Hauptstraße. Kurz bevor, diese in den Marktplatz mündete, befand sich an der Ecke ein großer Gasthof, dessen prächtige, mit Malereien verzierte Fassade vier Stockwerke empor ragte. Vor dem Eingang leuchteten zwei eindrucksvolle Laternen. Aus dem Inneren drang leise Musik. Die Fenster waren groß und mit Wappenscheiben aus buntem Glas geschmückt. Das helle Licht zahlreicher Kerzen brach sich in den bunten Scheiben. Dies war kein gewöhnliches Wirtshaus, dies war der beste und wahrscheinlich auch teuerste Gasthof in der ganzen Stadt. Guntrol war es recht. Er kannte derart edle Tavernen nur von außen, und die Aussicht, sie auch mal von innen kennen zu lernen, erschien ihm höchst verlockend, sintemal dies obendrein noch auf fremde Kosten geschah.
Sie traten ein. Die Gaststube war mit dunkel gebeizten Hölzern getäfelt. Es gab keine Sitzbänke, sondern hohe Stühle, deren Sitzflächen und Lehnen mit gepolstertem Leder bezogen waren. Auf den Tischen lagen saubere frische Tischdecken aus weißem Leinen.
»Seid gegrüßt, Herrschaften!« Mit diesen Worten empfing sie ein adrett gekleideter Herr, der eine weiße Schürze trug. Shanora nickte zur Begrüßung und bestellte einen Tisch für drei Personen. Anscheinend war sie hier bekannt, denn der Kellner führte sie in ein Hinterzimmer, wo ein einzelner gedeckter Tisch auf sie wartete. Ein anderer Kellner lief herbei und brachte zwei große fünfarmige Leuchter, deren frische weiße Kerzen er sogleich anzündete und auf den Tisch stellte. Die überzähligen Gedecke wurden abgeräumt. Dafür kamen zusätzliche Bestecke aus Silber und ein Krug mit frischem Wasser hinzu. Kaum hatten die drei an dem Tisch Platz genommen, wurde eine Karaffe aus grünlichem Glas mit einem golden schimmernden Wein aufgetragen. Brot und frische Butter, gebackene Eier und eingelegtes Gemüse wurden als Vorspeise gereicht.
Während Guntrol und Lagrange mit offenem Mund auf die Tafel starrten, gab Shanora dem Kellner leise weitere Anweisungen.
»Ich will mich nicht beklagen, keineswegs. Aber wird das alles nicht ein bißchen teuer? Ich meine…«
»Macht Euch keine Gedanken, Herr Lagrange«, entgegnete Shanora. »Ich kann es verschmerzen.«
»Ja, wenn das so ist, dann danke ich der edlen Spenderin«, sagte Guntrol und nahm einen Schluck von dem Wein. Er schmeckte vorzüglich. Guntrol mußte sich zurückhalten, damit er nicht zu viel davon trank.
Nachdem sie sich ein wenig gestärkt, und die Kellner den Raum verlassen hatten, fing Shanora an zu sprechen: »Ich will mich euch zuerst richtig vorstellen. Ich bin Shanora von Riehburg.«
»Riehburg?« wiederholte Lagrange sichtlich verblüfft.
»Was ist damit?« fragte Guntrol.
»Weißt du überhaupt, was das ist?«
»Irgend eine Stadt, nehme ich an.«
»Heilige Einfalt!« Lagrange rollte die Augen. »Riehburg ist die legendäre Hauptstadt des Landes Werfal.« Shanora nickte. »Ja, das ist wahr. Ich stamme aus Werfal und ich befinde mich auf einer besonderen Mission, über die ich leider nicht sprechen darf.«
»Aber das kann nicht sein«, warf Lagrange ein. »Nach allem, was ich über Werfal weiß, leben in Riehburg keine Menschen.«
»Wie, keine Menschen? Was meinst du damit? Ist die Stadt verlassen?« Shanora lachte. Dabei entblößte sie eine Reihe ebenmäßiger, weißer Zähne. »Nein, Riehburg ist wahrhaftig alles andere als verlassen. Was Meister Lagrange damit sagen wollte…«
»Nicht Meister. Nur Lagrange, bitte.«
»Nun, was Lagrange meinte, ist, daß Riehburg die Hauptstadt des Elbenreiches ist.«
»Elben? Sind das diese kleinen geflügelten Wesen, die unter Kleeblättern leben und einem Wünsche erfüllen können?« Lagrange verzog das Gesicht, während Shanora laut auflachte. Sie brauchte eine Weile, bis sie sich so weit beruhigt hatte, um weiter sprechen zu können.
»Du hast also noch nie einen vom Elbenvolk gesehen?«
»Er ist zum ersten Mal außerhalb seines Heimatdorfes und hat noch nichts von der Welt gesehen.«
»Tu nicht so gescheit. Du kennst die Welt auch nur aus deinen Büchern«, brummte Guntrol und machte ein finsteres Gesicht. Shanora indessen griff sich an den Kopf und fing an, den Knoten ihres dunkelblauen Stirnbandes zu lösen.
Während Lagrange voller Faszination auf die charakteristischen langen, spitz zulaufenden Elbenohren starrte, konnte Guntrol ein überraschtes Glucksen nicht unterdrücken.
»Unglaublich!« keuchte er. »Erst ein Katzen-Mädchen und jetzt eine Esel-Frau… wenn ich das den Leuten zu Hause berichte…« Lagrange trat ihn unter dem Tisch heftig mit dem Fuß gegen das Schienbein.
»Du darfst dich nicht über ihre Ohren lustig machen. Da sind sie sehr empfindlich«, zischte er leise.
»Entschuldigung!« stammelte Guntrol und lief rot an.
»Ist gut. Du hast es ja nicht böse gemeint«, sagte Shanora, doch konnte man ihr leicht ansehen, daß sie diesen Scherz gar nicht lustig fand. Sie legte ihr Stirnband wieder an, so daß es ihre Ohren verdeckte.
»Ich möchte lieber nicht erkannt werden«, sagte sie. »Nicht, daß ich mich genierte«, fügte sie zu Guntrol gewandt hinzu. »Wir Elben verlassen eigentlich nie unser Land und wir dulden sonst auch keine Fremden bei uns.«
»Was das Katzenmädchen betrifft…« fing Lagrange an, der es vorzog, das Thema zu wechseln.
»Ach ja, die Kleine. Ich habe sie vor ein paar Wochen in der Nähe von Llonwir getroffen. Sie war in einer schlechten Verfassung. Anscheinend hat sie sich ganz allein von Norden her durch die Wildnis durchgeschlagen. Sie war verwundet und halb verhungert. Es schien, als habe jemand Jagd auf sie gemacht. Sie hat nicht viel über sich erzählt, nur daß sie auf dem Weg nach den südlichen Ländern sei. Als Dank und Entgelt für meine Hilfe, bot sie an, mich als Dienerin zu begleiten. Ich sagte ihr, daß ich keine Dienerin benötigte, doch sie wollte sich unbedingt revanchieren. Vielleicht fühlte sie sich auch allein nicht sicher. Jedenfalls tat sie mir ein bißchen leid. Und so habe ich sie dann mitgenommen. Ich kann eigentlich nichts schlechtes über sie berichten. Ganz gleich, wie weit wir laufen mußten, oder wie kalt oder naß es war, sie hat sich nie beklagt. Und sie hat nie auch nur einen einzigen Kreuzer von mir angenommen. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie überrascht ich war, von euch zu hören, daß sie eine Diebin sei. Auf unserer Reise hätte sie etliche Male Gelegenheit gehabt, mich zu bestehlen, doch sie hat nichts genommen. Ein seltsames Mädchen.«
»Eine Diebin mit Moral. Sachen gibt’s«, sagte Lagrange.
»In Werfal leben Katzenmenschen und Elben. Was für ein wunderliches Land. Da würde ich gerne mal hinfahren«, sagte Guntrol.
»Ob es in Werfal Katzenmenschen gibt, kann ich nicht sagen. Ich glaube es aber nicht, denn ich habe noch nie zuvor welche gesehen. Der Sage nach sollen sie aus dem kalten Norden kommen, wahrscheinlich aus Noland. Ich habe die Kleine nach ihrer Herkunft gefragt, doch sie gab mir nur ausweichende Antwort.«
Bevor sie weiter sprechen konnten, traten die Kellner ein und brachten das Essen. Es gab Schweinebraten mit Kartoffeln, Bohnen und Kraut. Guntrol lief schon beim Anblick des Essens das Wasser im Munde zusammen. Auch Lagrange merkte, wie hungrig er war und griff tüchtig zu. Ein Leben in Mäßigung hatte ihn unempfindlich gegenüber fleischlichen Gelüsten gemacht, doch beim Anblick der köstlichen Speisen, fühlte er seine Mäßigung schwinden wie Schnee in der Sonne.
»Ein Stück Fleisch kann ausnahmsweise nicht schaden«, meinte er, während er sich eine dicke Scheibe des saftigen Bratens abschnitt. »Nehmt ihr nichts davon?« fragte er, als Shanora keine Anstalten machte, von dem Fleisch zu essen.
»Nein danke, ich esse kein Fleisch.« Sie nahm sich nur von dem Gemüse und den Kartoffeln, schien aber kein Problem damit zu haben, den anderen beim Verzehr des Bratens zuzuschauen.
Während des Essens sprachen sie nicht viel. Lagrange, der solche Speisen schon sehr lange nicht mehr gekostet hatte und Guntrol, der Dauerhungrige, waren zu sehr mit Kauen und Schlucken beschäftigt, als daß eine mehr als einsilbige Unterhaltung hätte aufkeimen können. Shanora beobachtete die beiden mit einer Mischung aus Staunen und Belustigung.
»Laßt noch etwas Platz für den Kuchen und das Obst«, sagte sie lächelnd.
»Für Kuchen ist immer Platz«, meinte Guntrol und lockerte seinen Gürtel.
Derweil lehnte Lagrange sich zurück und wischte sich die Schweißperlen von der Stirn.
»Was? Machst du schon schlapp?« fragte Guntrol lachend.
»Nicht jeder ist ein Magen auf zwei Beinen«, stöhnte er.
»Es freut mich, wenn es euch so gut schmeckt«, sagte Shanora. »Aber wollt ihr nicht ein bißchen von euch erzählen?«
»Was soll ich sagen? Ich bin ein Schüler von Meister Pardieu. Ich war auf einer Reise nach der Hauptstadt, als ich unterwegs meinen alten Freund Guntrol getroffen habe. Wir kennen uns seit unserer Kindheit. Unsere Eltern lebten auf benachbarten Höfen. Vor fünf Jahren bin ich weggezogen, um meine Ausbildung in der Stadt zu beginnen. Ich legte die Aufnahme-Prüfung an der Magierschule in Narbon ab und trat wenig später in den Orden des Goldenen Sterns von Meister Pardieu ein. Guntrol blieb im Apfelland und erlernte das ehrbare Handwerk des Zimmermanns.
»Du bist Zimmermann? Ich dachte du stehst in Diensten des Königs?« sagte Shanora.
»Nun… das ist so eine Sache. Ich bin eigentlich schon Zimmermann, aber andererseits sind wir auch im Auftrage der Regierung unterwegs. Wir müssen in einer wichtigen Angelegenheit in die Hauptstadt reisen.«
»Dann hast du Schwert und Schärpe also nicht gestohlen. – Nichts für ungut, aber wie ein Ritter des Königs schaust du wirklich nicht aus. Und Kuriere tragen normalerweise keine Schwerter.«
Guntrol senkte den Blick. »Ich weiß, daß das ein bißchen verdächtig ausschaut, aber ich kann Euch versichern, daß wir ehrliche, anständige Leute sind. Doch über unsere Mission darf ich nicht sprechen.«
»Ich vermute, daß eure Mission etwas mit der Tasche, die das Katzenmädchen euch gestohlen hat, zu tun hat; genauer gesagt mit ihrem Inhalt.«
»Tja…« Lagrange machte ein höchst verlegenes Gesicht. Er wußte nicht, was er antworten sollte. Eine Lüge wäre für seinen Stand höchst unehrenhaft.
»Ich verstehe«, sagte Shanora. »Habt ihr schon einmal etwas von dem Horn von Teduan gehört?« Die beiden sahen einander an und schüttelten die Köpfe. »Oder von dem Ring von Luanhir?« Guntrol zuckte mit den Schultern. »Was soll das sein?«
»Der Ring von Luanhir wurde aus dem Palast des Elbenkönigs in Riehburg gestohlen, ebenso wie das Horn von Teduan.«
»Sind das irgendwelche besonders wertvolle Dinge?« fragte Guntrol.
»Haben sie besondere Kräfte?« fragte Lagrange.
»Ja und nein. Für gewöhnliche Menschen haben sie keinen Wert, außer dem ihres Materials. Was Zauberkräfte anbelangt, so bin ich mir nicht sicher. Es gibt alte Legenden… aber ich kenne solche Sachen nur vom Hörensagen. Im Königspalast habe ich sie nur einmal in der Schatzkammer sehen können. Sie werden nicht verwendet, nur verwahrt. Seit unzähligen Generationen gehören sie zu dem Thronschatz von Riehburg.«
»Du hast Zugang zur Schatzkammer des Königs?« Lagrange hob erstaunt die Augenbrauen. Shanora machte ein erschrockenes Gesicht, als wäre ihr da etwas herausgerutscht, was sie lieber für sich behalten hätte.
»Könnt ihr ein Geheimnis bewahren? Ich bitte euch sehr, verratet es keinem.«
»Das ist selbstverständlich«, sagte Lagrange, auch Guntrol nickte heftig.
»Ich gehöre zur königlichen Familie«, sagte Shanora.
»Wow!« entfuhr es Guntrol.
»So etwas habe ich bereits vermutet«, sagte Lagrange. »Ich hatte von Anfang an das Gefühl, Ihr wärt keine Diebin, oder irgend eine dunkle Gestalt. Ich kann Eure Aura spüren. Sie ist rein und edel. Doch ich bin darin noch nicht so erfahren und meine spirituellen Kräfte sind noch schwach.«
»Ihr habt recht. In diesen Zeiten kann man nicht vorsichtig genug sein.«
Lagrange beugte sich zu Guntrol hinüber und flüsterte ihm einige Worte ins Ohr. »Ich denke, wir können ihr vertrauen. Erzähl ihr unsere Geschichte«, flüsterte Guntrol.
Lagrange berichtete Shanora ausführlich, was sie im Monsterwald erlebt hatten. Nachdem er damit fertig war, zog er die Tasche des Herolds hervor, öffnete sie und legte die Schriftrolle und das Papier auf den Tisch. Er nickte Guntrol zu. Dieser brachte den goldenen Ring, die kleine Kugel und den flachen Stein zum Vorschein.
Shanora riß die Augen auf. »Das ist der Ring von Luanhir!« rief sie und streckte die Hand danach aus. Dann hielt sie einen Augenblick mitten in der Bewegung inne.
»Was ist?« fragte Guntrol.
»Ach, nichts«, erwiderte Shanora und nahm den Ring in die Hand. Sie hielt ihn ans Licht und betrachtete ihn eingehend. Schließlich sagte sie: »Nein, ich habe mich getäuscht. Das ist nicht der Ring von Luanhir. Die Inschrift auf dem Ring stimmt nicht überein. Aber es handelt sich eindeutig um einen Elbenring. Der Sage nach soll es mehrere Ringe gegeben haben. Ich kann nicht sagen, wie viele und ob dieser hier einer von ihnen ist. Meines Wissens ist lediglich der Ring von Luanhir erhalten geblieben.« Sie legte ihn wieder auf den Tisch zurück. Anschließend betrachtete sie die anderen Gegenstände.
»Gehören die vielleicht auch zu dem gestohlenen Elbenschatz?« fragte Lagrange. Shanora schüttelte den Kopf. »Nein, solche Dinge habe ich noch nie gesehen. Die Zeichen auf dem Stein kann ich nicht lesen. Das ist eindeutig keine Elbensprache. Auch nicht die unserer Vorfahren, wie auf dem Ring.«
»Was steht denn auf dem Ring geschrieben?« wollte Guntrol wissen.
»Thorin Ubál ree akronon phlac«, las sie.
»Und was bedeutet das?«
»Da hab ich keine Ahnung. Das ist die alte Elbensprache. Ich kann nur die Worte lesen, weil die Buchstaben die selben sind, die wir heute verwenden, aber die Bedeutung der Worte kenne ich nicht. Ich glaube Thorin ist ein Name. Es gibt nur wenige Gelehrte, welche die Alte Sprache noch verstehen. Es gibt auch nicht viele Aufzeichnungen aus der alten Zeit.«
»Vielleicht eine Anweisung, wie man den Ring benutzt«, mutmaßte Guntrol. Er nahm den Ring, und bevor die anderen ihn daran hindern konnten, streifte er ihn über seinen rechten Ringfinger.
»Nicht! Du weißt nicht, was geschehen könnte. Manche Ringe sind durch einen Zauber geschützt«, rief Lagrange. »Oder besitzen böse Kräfte.«
»Vielleicht macht er unsichtbar… Ach, nein, anscheinend nicht«, stellte er enttäuscht fest.
»Möglicherweise ist es auch ein Wunschring. – Ich wünsche mir…hm… einen Riesenhaufen Gold«, sprach er und drehte dabei an dem Ring. Gebannt starrten Lagrange und Shanora ihn an. Nichts geschah.
»Ich glaube, daß ist nur ein ganz gewöhnlicher Ring. Vielleicht hat er nur eine symbolische Bedeutung. Vielleicht hat er mal irgend einem alten König gehört, oder so.« Guntrol nahm den Ring wieder ab und gab ihn Lagrange. Dieser legte ihn auf seine Handfläche. Er schnappte nach Luft und ließ den Ring auf den Tisch fallen.
»Kalt, eiskalt. Dieser Ring hat eine ganz seltsame Aura, die ich nicht ertragen kann.«
»Ist sie böse?« fraget Guntrol.
»Nein, nicht böse. Ich kann es schwer beschreiben. Es ist eher eine Nicht-Aura. Wie soll ich das erklären? Jede Materie hat eine eigene Aura. Bei Lebewesen ist sie stark und warm, bei Gegenständen ist sie nur sehr schwach ausgeprägt, es sei denn, es handelt sich um magische Gegenstände. Doch dieser Ring fühlt sich an, als sauge er die Energie aus mir heraus, als versuchte er, meine eigene Aura auszulöschen. Habt ihr beiden denn gar nichts gemerkt?«
Shanora schüttelte den Kopf. Guntrol sagte indes: »Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe ein bißchen etwas gespürt. Nur ganz schwach. Vielleicht bilde ich es mir auch bloß ein. Aber es war auf jeden Fall kein unangenehmes Gefühl.«
»Vielleicht solltet ihr mal lesen, was in den Papieren steht«, schlug Shanora vor.
»Ja, das will ich tun.« Er nahm die Schriftrolle, löste den Verschluß und rollte ein Stück davon ab. Er hob die Augenbrauen und schüttelte langsam den Kopf. »Das kann ich überhaupt nicht entziffern. Das ist nicht unsere Sprache. Ich habe solche Schriftzeichen noch nie gesehen. Sie gleichen auch weder den Zeichen auf dem Elbenring noch den Symbolen auf dem Stein. Diese Rolle stammt garantiert aus dem Ausland; möglicherweise aus Salvia, Golwen oder vielleicht sogar Noland.
»Nicht aus Karpasch?« fragte Shanora.
»Wie kommt Ihr auf Karpasch? Nein, ich weiß, daß die Karpaschen das selbe Alphabet benutzen wie wir; fast das selbe. Sie haben ein paar Extrazeichen, aber darauf kommt es nicht an. Diese Schrift hier ist ganz anders. Ich glaube, das sind nicht einmal richtige Buchstaben. Sehr ihr? Es gibt eine Vielzahl von unterschiedlichen Zeichen. Einige wiederholen sich häufig, andere sehe ich nur ein einziges Mal. Ein Schriftgelehrter von der Akademie könnte das vielleicht entziffern.« Er rollte die Rolle weiter ab.
»Ah! Hier ist eine Zeichnung; und das könnte eine Art Karte sein. Was mag das für ein Land sein? Sieht mir eher nach einer Insel aus. Könnt Ihr etwas damit anfangen, Shanora?«
Er reichte ihr die Rolle, doch auch sie konnte sich keinen Reim aus den Zeichen und Linien machen.
»Dann bleibt nur noch das Papier, sonst sind wir so schlau wie zuvor.«, sagte Lagrange und griff nach dem zusammengerollten pergamentähnlichen, ziemlich steifen Papier.
»So, das kann ich lesen. Das ist unsere Sprache.
»Dann lies vor!« sagte Guntrol.
»Seltsam. Das Papier hat einen ungewöhnlichen Geruch.«
»Das kommt davon, weil es in einem modrigen Schacht voller Rattendreck gelegen hat«, sagte Guntrol.
»Nein, das ist es nicht. Der Geruch erinnert mich an etwas. Aber ich kann nicht sagen, woran. Vielleicht fällt es mir ja wieder ein. Also da steht:
Bericht der Sonder-Beauftragten Birdal und Nallwig.
Zu Handen seiner Majestät König Priwann IV., Herrscher zu Narbon, etc…
Unsere Agenten bestätigen vermehrt Tätigkeiten von Kräften aus Karpasch und Ruritanien. Die Spur der entwendeten Kostbarkeiten konnte bis Ruritanien verfolgt werden. Aus Werfal wird ein Vorfall im Königspalast berichtet. Es hat den Anschein, als versuche eine fremde Macht, sich in den Besitz der legendären sieben Kleinode zu bringen. Die Warnung von Großmeister Pardieu kam zu spät. Es gelang dennoch, zwei ausländische Agenten abzufangen und in den Besitz der Schriftrolle von Gerduan zu gelangen, außerdem konnten wir einen Elben-Ring und einen Gegenstand unbekannten Ursprungs sicherstellen. Wir haben einen königlichen Herold zur Übermittlung der Gegenstände angefordert. Wir glauben, daß eine Verschwörung von Karpasch ausgehend besteht. Aber noch haben wir keine eindeutigen Beweise. Meister Pardieu wurde in Rura unterrichtet. Doch wird er nicht lange dort bleiben können. Wir empfehlen daher…
Hier endet der Beicht. Es sieht aus, als ob eine oder mehrere Seiten fehlen. Vielleicht sind sie auch noch nicht fertig geworden, denn das Schriftstück sieht aus, als wäre es in großer Eile verfaßt worden. Außerdem kann ich keine Spuren eines Siegels entdecken.«
»Was sind die ‘sieben legendären Kleinode’?« fragte Guntrol.
»Ich habe keine Ahnung«, meinte Lagrange.
»Ich habe gehört, daß es in jedem Land einen ganz besonderen Schatz geben soll. Der Ring von Luanhir war dann wohl der Schatz von Werfal. Mehr weiß ich aber auch nicht«, sagte Shanora.
»Was hat Meister Pardieu mit der Angelegenheit zu tun? Und warum ist er verschwunden und heimlich nach Ruritanien abgereist. Ausgerechnet nach Ruritanien.«
»Glaubst du, er hat mit der Verschwörung zu tun?«
»So ein Unsinn, Guntrol! Meister Pardieu hat ganz bestimmt nichts damit zu tun. Da steht ja, daß er sie gewarnt hatte. Pardieu ist ein edler, rechtschaffener, ja ein wahrhaft heiliger Mann. Er würde nie und nimmer etwas böses tun, oder sich gegen unseren König verschwören.« Lagrange duldete kein böses Wort wider seinen Meister.
»Wenn du es sagst… Doch was sollen wir jetzt tun?«
»Wir müssen in die Hauptstadt und die Dinge dem König übergeben. Zugleich drängt es mich aber nach Rura zu Meister Pardieu zu gehen. Er weiß bestimmt, was hinter alledem steckt. Doch unsere Mission hat Vorrang.«
»Hättet ihr etwas dagegen, wenn ich mich euch anschließe?« fragte Shanora. »Ich muß unbedingt mehr über diese Verschwörung erfahren. Und vor allem muß ich die gestohlenen Kostbarkeiten wieder beschaffen.«
»Nehmt es mit bitte nicht übel, Shanora, aber eines kommt mir doch ein bißchen merkwürdig vor«, sagte Guntrol. »Wieso seid Ihr ganz allein, ohne Begleitung als Frau auf der Suche nach gestohlenen Schätzen? Wieso schickt Euer König keine Ritter oder Spione, oder gibt Euch eine Eskorte mit?«
Shanora seufzte und machte ein betretenes Gesicht. »Traust du mir etwa nicht zu, die Sachen zu finden?« Ich kann auch kämpfen. Und mit dem Langbogen und der Sichellanze kann ich umgehen wie ein Krieger und…« sie verstummte.
»Daran hege ich keinen Zweifel, aber das beantwortet meine Frage nicht.«
»Also gut, ich will euch die Wahrheit sagen. Es geht um meinen Vater. Er ist der Schatzmeister von Riehburg. Ihm obliegt die Verwaltung der Kronschatzes und der alten Kleinode. Der Verlust dieser Dinge, ja allein die Tatsache, daß jemand ungehindert in die königliche Schatzkammer eindringen konnte, sind eine gewaltige Schmach. Mein Vater ist schon alt und die Schande würde ihn umbringen. Der Diebstahl wurde nicht gemeldet. Wahrscheinlich würde er nie bemerkt werden, denn es sind außer dem Ring von Luanhir und dem Horn von Teduan keine wertvollen Gegenstände verschwunden. Das Horn ist eigentlich nicht wirklich wertvoll. Es ist nur ziemlich alt. Das Fehlen dieser Dinge würde kaum auffallen; jedenfalls nicht so bald. Daher beschloß ich, die Diebe selbst zu fangen und die Sachen wieder zu beschaffen.«
»Ihr seid sehr mutig«, sagte Lagrange anerkennend.
Aber nicht besonders gescheit, dachte Guntrol. Doch das behielt er für sich. Er gähnte. »Es ist schon spät. Wenn wir morgen aufbrechen wollen, sollten wir uns um ein Nachtquartier bemühen.«
»Ja, du hast recht. Es sicher schon nach zehn Uhr. Ob sie uns so spät noch im Fischerhaus aufnehmen?«
»Macht euch darüber keine Gedanken. Ich kann uns hier im Hause Zimmer bestellen«, sagte Shanora. Sie stand auf und ging hinaus, um den Wirt zu suchen. Lagrange und Guntrol sahen einander an.
»Eine mysteriöse Angelegenheit«, meinte Lagrange.
»Sie scheint ziemlichen Eindruck auf dich zu machen.« Lagrange errötete sichtbar.
»Rede nicht so einen Unsinn! Ich bin…«
»Ein Heiliger Mann, ich weiß«, lachte Guntrol. »Und warum wirst du jetzt rot?«
»Aus dem gleichen Grund, weshalb du bei dem Katzenmädchen Stielaugen bekommen hast«, entgegnete er spitz. Jetzt war es an Guntrol seine Gesichtsfarbe zu wechseln. Doch bevor sie ihren Disput fortsetzen konnte, kehrte Shanora zurück.
»Ich habe euch ein schönes Zimmer richten lassen. Wir brauchen uns um nichts weiter zu kümmern. Das hier ist wirklich ein erstklassiges Gasthaus. Sie haben sogar ein Bad mit heißem Wasser. Das hätte ich diesem Land gar nicht zugetraut.«
»Bitte? So primitiv sind wir hier auch nicht. Wir sind doch keine Pallandier«, protestierte Guntrol.
»In Karpasch soll es in jedem Haus eine Wasserleitung geben und riesige Maschinen, die den Menschen alle Arbeit abnehmen.«
»Man erzählt sich viele Märchen und Geschichten von Karpasch«, sagte Lagrange. »Doch ich kenne keinen, der je dort gewesen ist und alle diese Wunder mit eigenen Augen gesehen hat.«
»Bevor wir uns zum Schlafen zurückziehen, möchte ich einen Vorschlag machen«, sagte Lagrange. »Ich denke, jeder von uns sollte einen der Gegenstände zu sich nehmen und dazu Sorge tragen. Das wird es den Feinden erschweren, alle zugleich in die Hände zu bekommen.«
»Das ist ein guter Vorschlag, Lagrange«, sagte Shanora.
»Gut, dann nehmt Ihr doch den Elbenring an Euch. Du, Guntrol nimmst den Stein und die Kugel und ich will die Schriftrolle zu mir nehmen.« Alle nickten.
»Ich wüßte ja zu gerne, wozu diese Dinge gut sind, wenn sie derart begehrt sind.«
»Vielleicht steht es in der Schriftrolle. Meister Pardieu könnte sie bestimmt entziffern.«
»Dann wollen wir mal nach oben gehen. Ich freue mich schon auf ein heißes Bad«, sagte Shanora, und zu Guntrol gewandt fügte sie hinzu: »Das könnte dir auch ganz gut tun.«
»Mal sehen«, brummte dieser. »Zuerst wollen wir aber den guten Wein alle machen. Es wäre doch schlimm, so etwas gutes verkommen zu lassen. Will noch jemand ein Stück Apfelkuchen? Nein, dann nehme ich den Rest mit, falls ich später noch Hunger bekommen sollte.«
Ein Angestellter des Hauses führte sie nach oben zu den Gästezimmern. Die Zimmer waren groß und edel ausgestattet. In jedem Zimmer fanden sich große Betten mit hübsch gedrechselten Pfosten und geschnitzten Kopf- und Fußteilen, gepolsterte Stühle und ein großer Tisch. Auf den Holzdielen lagen dicke geflochtene Teppiche, an den Wänden hingen Stiche und vor den Fenstern hingen dunkle Vorhänge. In der Ecke stand ein reich verzierter Kachelofen, der zu dieser Jahreszeit freilich nicht benötigt wurde.
»Hier ließe sich gut leben«, sagte Guntrol, der von der Ausstattung sichtlich beeindruckt war.
»Geh du lieber baden. Du hast es nötig.«
»Unverschämtheit!« Guntrol versuchte unauffällig an sich zu schnuppern. »Ich warte bis Shanora fertig ist.« In der Tat roch er ein bißchen streng. Doch das war kein Wunder, war er doch schon zwei Mal an diesem Tag in einem modrigen Abwasser-Schacht herum gekrochen. Er setzte sich auf einen Stuhl und wühlte in seinem Kleidersack nach frischer Wäsche. Lagrange setzte sich derweil an den Tisch und studierte den Bericht der Agenten.
Guntrol stand auf und ließ sich auf das sehr weiche Bett fallen. Er nahm die kleine Kristallkugel und die Steinscheibe hervor und fing an, damit herum zu spielen. Die Kugel paßte genau in die kleine Vertiefung in der Mitte der Scheibe. Wozu mochte das gut sein? Vielleicht mußte man sie drehen oder einen Zauberspruch aufsagen. Er wollte gerade etwas ausprobieren, als Lagrange sich zu ihm setzte und sagte: »Laß das Ding in Ruhe. Wenn du nicht weißt, was du tust, laß es lieber sein. Am Ende verwandelt es dich noch in eine warzige Kröte.«
»Oder in einen hübschen Prinzen.«
»Das fehlte mir gerade noch«, brummte Lagrange leise.
»Wie bitte?«
»Ach, nichts! Ich mußte gerade an etwas denken.«
»Was denn?«
»An Rura. Meister Pardieu soll sich in Rura aufhalten. Und weißt du, was sich in Rura befindet?« Guntrol schüttelte den Kopf. »Aber du wirst es mir gleich sagen.«
»In Rura befindet sich die größte Bibliothek der Welt.«
»Vielleicht will er etwas lesen…«
»Quatschkopf! Bestimmt gibt es in Rura ein Buch, mit dessen Hilfe ich die Schriftrolle übersetzen könnte.«
»Dann laß uns halt nach Rura gehen. Das ist auch nicht viel weiter als nach Narbon.«
»Das dürfen wir nicht. Wir haben ein Versprechen abgegeben.«
»Mir ist es egal, wo wir hingehen. Hauptsache, wir erleben etwas spannendes.« Am liebsten hätte Lagrange ihn gefragt, ob er immer noch nicht genug Abenteuer erlebt hätte, doch statt dessen besann er sich und sagte nur: »Geh lieber baden und laß mich mit meinen Schriften in Ruhe. Ich höre gerade, daß Shanora fertig ist.«
Lagrange verfügte über ein ausgezeichnetes Gehör, denn kurz darauf klopfte Shanora an die Tür und meldete, daß das Bad nun frei sei. Guntrol nahm seine Sachen und ging ins Bad.
Die große steinerne Wanne war mit heißem Wasser gefüllt. Im Vorraum standen mehrere Eimer mit heißem und kaltem Wasser bereit, auch Seife und Handtücher lagen bereit. Guntrol wusch sich gründlich und schrubbte sich den Schmutz der vergangenen Tage vom Leib. Anschließend stieg er in die große Wanne, die so tief war, daß ihm das Wasser bis zum Kinn reichte. Es war so herrlich entspannend, daß er die Augen schloß und sich ganz dem wohligen Wärmegefühl, dem leisen Plätschern des Wassers und dem Knistern des Feuers, das die Wanne erwärmte, hingab. Es hätte nicht viel gefehlt und er wäre glatt eingeschlafen, was in seiner Lage nicht sehr gesund wäre.
Er konnte nicht sagen, wie lange er schon in der Wanne lag, doch nachdem seine Hände bereits ganz schrumpelig waren, entschied er sich, seine Müdigkeit lieber im Bett auszuschlafen. Wenn er daran dachte, wie unerquicklich der Tag begonnen hatte und wie sich an seinem Ende alles zum Guten gewendet hatte, fühlte er sich höchst befriedigt und war zuversichtlich, daß ihr Abenteuer ebenso einen guten Ausgang nehmen würde. Was immer ihnen die Zukunft bescherte, fürs erste war er vollauf glücklich. Nach einem guten und reichlichen Essen, einem entspannenden Bade, wartete nun ein flauschig weiches, sauberes Bett und hoffentlich auch ein paar schöne Träume auf ihn.
Mit schweren Gliedern stieg er aus der Wanne und rubbelte sich mit dem bereit liegenden Handtuch trocken. Er zog Hemd und Hose an und kehrte zu Lagrange ins Zimmer zurück. Dieser hatte seine Papiere inzwischen weg gelegt.
»Ich hatte schon Sorge, du wärest da drin eingeschlafen«, begrüßte er ihn. »Gut, dann will ich mich auch mal waschen gehen.«
»Laß dir ruhig Zeit. So ein schönes Bad habe ich noch nie in einem Haus gesehen.«
»Man merkt, daß du noch nie in einer richtigen Stadt warst. Wenn wir in Narbon ankommen, zeige ich dir mal die große Therme. Da wirst du staunen. Dort gibt es Wasserbecken, die sind so groß, daß du richtig von einem Ende zum anderen schwimmen kannst. Ich würde sagen, mindestens so groß, wie der Mühlenteich in unserem Dorf. Und das alles mit heißem Wasser gefüllt. Es dampft richtig.«
Guntrol warf ihm einen ungläubigen Blick zu, der ihn lachen ließ. »Das klingt für dich vielleicht unglaublich, aber das beste ist, in Narbon gibt es heiße Quellen, die direkt aus der Erde sprudeln. An manchen Stellen kommt das Wasser kochend heiß heraus. Du könntest ein Ei oder ein Stück Fleisch hineinlegen und es darin gar kochen. Leider stinkt das Wasser übel nach Schwefel, so daß man es hinterher wahrscheinlich nicht mehr essen kann.«
»Jetzt hör aber auf mit deinen Geschichten. Kochendes Wasser direkt aus der Erde. Verkohlen kann ich mich selber«, lachte Guntrol.
Lagrange verließ schmunzelnd den Raum, während Guntrol sich auf das Bett legte. Er war ziemlich müde, aber bevor Lagrange nicht zurück war, konnte er das Licht nicht löschen. Also nahm er die Steinscheibe und die kleine Kugel zur Hand. Er hielt die Kugel gegen das Licht. Sie war undurchsichtig und hatte eine ganz leichte rosa Färbung. Die Steinscheibe besaß bei näherer Betrachtung nicht nur eine runde Vertiefung auf der Oberseite, sondern eine entsprechende Ausbeulung auf der Unterseite. Beide lagen einander genau gegenüber und befanden sich exakt in der Mitte der Scheibe.
Er ging zum Tisch und legte die Scheibe auf die Tischplatte. Wegen dem kleinen Buckel auf der Unterseite lag sie nicht flach auf. Irgendwie erinnerte ihn das Ding an einen Kreisel, einen sehr flachen und großen Kreisel freilich. Er versuchte, die Scheibe in Drehung zu versetzen, was nicht einfach war, da sie genau in der Wagerechten rotieren mußte und nicht ins Taumeln geraten durfte, da sie sonst mit der Kante auf der Tischplatte aufkam und abgebremst wurde. Nach einigen Versuchen gelang es ihm immerhin, die Scheibe in eine stabile und ausreichend geschwinde Drehung zu versetzen. Da der Stein verhältnismäßig schwer war, behielt er aufgrund seiner Massenträgheit die Drehbewegung ziemlich lange bei.
»So, und jetzt noch die Kugel«, sagte Guntrol und legte die Kugel in die Vertiefung. Die Kugel fing an sich ebenfalls leicht zu drehen. Dabei beobachtete er etwas eigentümliches: Die Kugel begann allmählich ihre Farbe zu ändern. Aus dem Rosa wurde ein Orange, dann Gelb. Als die Scheibe zum Stehen kam, erlosch das Farbenspiel.
»Das muß ich Lagrange zeigen. Vielleicht kann ich noch mehr Farben erzeugen.« Er drehte die Scheibe erneut. Diesmal, einer plötzlichen Eingebung folgend, versetzte er die Kugel mit Daumen und Zeigefinger in eine Drehung, die jener der Scheibe entgegengesetzt war.
Statt eines schwachen Glühens erstrahlte die Kugel in einem hellen, fast schon gleißenden bläulich-weißen Lichte. Gleichzeitig glaubte Guntrol in seinem Kopf eine Stimme zu vernehmen: »Dein Wunsch?« fragte die Stimme.
»Wer bist du?« fragte er erschrocken. Doch er bekam keine Antwort. Das Leuchten wurde schwächer, in dem selben Maße, wie die Drehung der Scheibe, beziehungsweise der Kugel nachließ, und erlosch zuletzt.
Guntrol wiederholte die Prozedur mit kribbelnden Fingern und klopfendem Herzen. Er war so aufgeregt, daß er zwei Versuche benötigte, bis er die richtige Drehung eingestellt hatte. Erneut vernahm er jene körperlose Stimme, die nicht Mann noch Frau war und die irgendwo mitten in seinem Schädel erklang.
»Dein Wunsch?«
»Ich wünsche mir… äh…« Was sollte er sich wünschen? Viel Zeit zum Überlegen blieb ihm nicht, denn das Leuchten wurde schon wieder schwächer. »Ich wünsche mir, daß ich die Schriftrolle von Gerduan lesen kann.«
»Das Zauberwort?«
»Das kenne ich nicht. Simsalabim, vielleicht…«
»Unwürdiger! Empfange deine Strafe!«
Die Kugel verfärbte sich violett und ein langer heller, schmaler, sich windender Blitz quoll daraus hervor und zuckte in Guntrols Richtung. Zum Ausweichen war es zu spät. Er konnte nur noch schützend die Arme vor das Gesicht halten, als er einen heftigen, unerträglichen Schmerz empfand, der sich in seinen linken Arm und von dort durch seinen ganzen Körper bis in sein Innerstes bohrte.