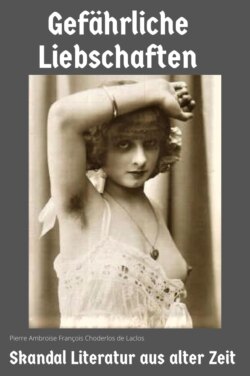Читать книгу Gefährliche Liebschaften - Pierre Ambroise François Choderlos de Laclos - Страница 1
ОглавлениеGefährliche Liebschaften
Skandal Literatur
aus alter Zeit
IMPRESSUM
Autor: Pierre Ambroise François Choderlos de Laclos
Herausgeber:
Jürgenl Prommersberger
Händelstr 17
93128 Regenstauf
delsalvs160571@web.de
Vorbemerkung des Herausgebers
Wir glauben den Leser aufmerksam machen zu müssen, daß wir ungeachtet des Titels des Buches und dem, was der Sammler dieser Briefe in seiner Vorrede darüber versichert, für die Echtheit dieser Sammlung nicht gut stehen, und daß wir selbst gewichtige Gründe haben, anzunehmen, daß das Ganze nur ein Roman ist.
Überdies kommt uns vor, als ob der Verfasser, der doch nach Wahrscheinlichkeit gesucht zu haben scheint, diese recht ungeschickt durch die Zeit zerstört hat, in die er die erzählten Ereignisse setzt. Einige der handelnden Personen sind in der Tat so sittenlos und verderbt, daß sie unmöglich in unserm Jahrhundert gelebt haben können, in diesem unsern Jahrhundert der Philosophie und Aufklärung, die alle Männer, wie man weiß, so ehrenhaft und alle Frauen so bescheiden und sittsam gemacht hat. Beruhen die in diesem Buche erzählten Begebenheiten wirklich auf Wahrheit, so ist es unsere Meinung, daß sie nur anderswo oder anderswann sich begeben haben können, und wir tadeln sehr den Autor, der sichtlich von der Hoffnung, mehr zu interessieren, verlockt, sie in seine Zeit und sein Land zu verlegen, und unter unserer Tracht und in unsern Gebräuchen Sittenbilder zu zeichnen wagte, die uns durchaus fremd sind.
Wenigstens wollen wir, soweit es in unserer Macht liegt, den allzu leichtgläubigen Leser vor jeder Überraschung bewahren und werden uns dabei auf eine Logik stützen, die wir dem Leser als sehr überzeugend und einwandfrei vortragen, denn zweifellos würden gleiche Ursachen gleiche Wirkungen hervorzubringen nicht verfehlen: wir sehen nämlich in unsern Tagen kein Fräulein mit 60000 Francs Rente Nonne werden, und erleben es in unserer Zeit nicht, daß eine junge und schöne Frau sich zu Tode grämt.
C. D. L.
Vorwort des Sammlers dieser Briefe
Dieses Werk oder vielmehr diese Zusammenstellung, die der Leser vielleicht noch zu umfangreich finden wird, enthält doch nur die kleinere Anzahl der Briefe, welche die gesamte Korrespondenz bilden.
Von den Personen, an die diese Briefe gerichtet waren, mit deren Ordnung beauftragt, habe ich als Lohn für meine Mühe nur die Erlaubnis verlangt, alles, was mir unwichtig erschien, weglassen zu dürfen, und ich habe mich bemüht, nur jene Briefe zu geben, die mir zum Verständnis der Handlung oder der Charaktere wichtig erschienen. Dazu noch einige Daten und einige kurze Anmerkungen, die zumeist keinen andern Zweck haben, als die Quellen einiger Zitate anzugeben oder einige Kürzungen zu motivieren, die ich mir vorzunehmen erlaubt habe – dies ist mein ganzer Anteil an dieser Arbeit. Alle Namen der Personen, von denen in den Briefen die Rede ist, habe ich unterdrückt oder geändert.
Ich hatte größere Änderungen beabsichtigt, die sich meist auf Sprache oder Stil bezogen hätten, in welch beiden man manche Fehler finden wird. Ich hätte auch gewünscht, die Vollmacht zu haben, einige allzu lange Briefe zu kürzen, von denen mehrere weder unter sich noch mit dem Ganzen in rechtem Zusammenhange stehen. Diese Arbeit wurde mir jedoch nicht gestattet; sie hätte gewiß dem Buche keinen neuen Wert hinzugefügt, aber sie hätte zum mindesten einige seiner Mängel beseitigt.
Es wurde mir erklärt, die Beteiligten wollten die Briefe, wie sie sind, veröffentlicht haben, nicht aber ein Werk, das auf Grund dieser Briefe verfaßt sei; daß es ebenso gegen die Wahrscheinlichkeit wie gegen die Wahrheit selbst verstoßen würde, daß die acht bis zehn Personen, die diese Briefe schrieben, den gleichen korrekten Stil hätten. Und auf den Einwand, daß unter den Briefen kein einziger sei, der nicht grobe Fehler enthalte, und daß die Kritik nicht ausbleiben würde, bekam ich die Antwort, daß jeder verständige und wohlgesinnte Leser erwarten werde, Fehler in einer Sammlung von Briefen zu finden, die Privatpersonen einander schrieben, und daß sämtliche bisher veröffentlichten Briefe – selbst jene geschätzter Autoren und Mitglieder der Akademie nicht ausgenommen – in dieser Beziehung nicht einwandfrei wären. Diese Gründe haben mich nun keineswegs überzeugt; ich finde sie leichter vorgebracht, als sie gebilligt werden können; aber ich war nicht Herr dieser Angelegenheit und gab nach. Ich habe mir nur vorbehalten, dagegen Einspruch zu tun und zu erklären, daß ich die Ansicht meiner Auftraggeber nicht teile, was hiermit geschieht.
Was den Wert betrifft, den dieses Buch haben kann, so kommt es mir vielleicht nicht zu, mit meiner Ansicht die anderer zu beeinflussen. Die vor Beginn einer Lektüre wissen wollen, was sie von ihr erwarten können, mögen hier weiterlesen; die andern tun besser, an die Briefe selbst zu gehen, von denen sie nun ja genug wissen.
Dies muß ich noch sagen: Wenn ich auch diese Briefe herausgab, so bin ich doch weit entfernt, ihren Erfolg zu hoffen, und ist diese meine Aufrichtigkeit keine falsche Bescheidenheit des Autors; denn ebenso aufrichtig erkläre ich: hielte ich diese Arbeit nicht der Veröffentlichung wert, hätte ich mich nicht mit ihr abgegeben. Das scheint ein Widerspruch; ich will ihn zu lösen versuchen.
Ein Brief ist nützlich oder unterhaltend oder er vereint beides. Aber der Erfolg, der nicht immer den Wert beweist, ist oft mehr abhängig vom Gegenständlichen als von dessen Gestaltung, mehr vom Inhalt als von dessen Form. Diese Sammlung enthält Briefe verschiedener Personen mit verschiedenen Interessen, welche Verschiedenheit vielleicht das eine Interesse des Lesers nicht erhöht. Dann sind auch die Gefühle und Empfindungen, die diese Briefe aussprechen, gefälscht, geheuchelt oder verstellt, und können sie so wohl die Neugier reizen, aber das Herz nicht fesseln und rühren. Und das Bedürfnis des Herzens steht über der Neugierde, und das Herz ist ein nachsichtigerer Richter als die Neugierde, die leichter die Fehler bemerkt, die sie in ihrer Befriedigung stören.
Die Fehler werden vielleicht von einer Eigenschaft des Buches aufgewogen, die in seiner Natur liegt: ich meine die Wahrheit seines Ausdrucks, ein Verdienst, das sich hier von selbst einstellte und das die Langweile der Einförmigkeit nicht aufkommen lassen wird. Der eine und andere Leser wird auch durch die neuen oder wenig bekannten Beobachtungen, die dort und da in den Briefen sind, auf seine Kosten kommen, – das ist aber auch alles Vergnügen, das man von dem Buch erwarten darf, auch dann, wenn man es mit größter Gunst hinnimmt.
Den Nutzen des Buches wird man vielleicht noch stärker in Zweifel ziehen als dessen Annehmlichkeit, aber er scheint mir doch leichter zu beweisen.
Mich dünkt, man erweist der Sittlichkeit einen Dienst, wenn man die Mittel bekannt gibt, deren sich die Sittenlosen bedienen, um die Sittlichen zu verderben; diese Briefe können sich Wohl in diesen Dienst stellen. Man wird in ihnen auch den Beweis zweier wichtiger Wahrheiten finden, die man verkannt glauben möchte, so wenig werden sie geübt: die eine ist, daß jede Frau, die einen schlechten Menschen in ihrer Gesellschaft duldet, sicher früher oder später dessen Opfer wird. Die andere ist: daß es zum mindesten eine Unvorsichtigkeit der Mutter bedeutet, wenn sie duldet, daß eine andere als sie selber das Vertrauen ihrer Tochter besitzt. Auch können die jungen Männer und Mädchen hier lernen, daß die Freundschaft, die ihnen schlechte Individuen gern und reichlich zu schenken scheinen, immer nur eine gefährliche Falle ist, gleich verhängnisvoll für ihr Glück wie für ihre Tugend.
Jedoch: der Mißbrauch des Guten ist dem Guten sehr nahe und er scheint mir hier zu befürchten. Weit davon, dieses Buch der Jugend zu empfehlen, scheint, es mir vielmehr nötig, es von ihr fernzuhalten. Der Zeitpunkt, da dieses und ähnliche Bücher aufhören, gefährlich zu sein und nützlich werden, scheint mir von einer vortrefflichen Mutter, die Geist und rechten Geist hatte, sehr richtig bestimmt worden zu sein. Sie hatte das Manuskript dieses Buches gelesen und sagte: »Ich würde meiner Tochter einen großen Dienst damit zu erweisen glauben, daß ich ihr dieses Buch an ihrem Hochzeitstag gebe.« Dächten alle Mütter so, würde ich mich immer glücklich schätzen, diese Briefe veröffentlicht zu haben.
Doch alle diese günstigen Voraussetzungen angenommen, dürfte das Buch doch wenigen gefallen. Die depravierte Gesellschaft wird ein Interesse daran haben, ein Buch zu verlästern, das ihr schaden kann; und da es ihnen in diesem Stücke an Geschicklichkeit nicht fehlt, so bekommen sie am Ende auch die rigorosen Leute in ihr Lager, deren Eifer darüber aufgebracht ist, daß man solche Dinge darzustellen sich nicht scheute.
Was aber die angeblichen starken Geister betrifft, so werden sie sich kaum für eine fromme Frau interessieren, die ihnen eben deshalb höchst albern vorkommen wird, während die Frommen sich daran stoßen werden, die Tugend unterliegen zu sehen; und sie werden sich auch darüber aufhalten, daß die Religion sich mit zu wenig Macht zeige.
Die Leute von feinem Geschmack werden den Stil mancher Briefe zu simpel und fehlerhaft finden, und die Mehrzahl der Leser wird, von dem Gedanken verführt, daß alles Gedruckte Erfindung sei, in andern Briefen wieder eine Maniriertheit des Verfassers zu erkennen meinen, der sich hinter den Personen, die er sprechen läßt, verberge.
Schließlich ist es vielleicht das allgemeine Urteil, jede Sache gelte nur an ihrer rechten Stelle was; und wenn auch der allzu gefeilte Stil der Autoren privaten Briefen ihren Reiz raube, dieser Briefe Nachlässigkeiten doch zu wirklichen Fehlern würden, die sie im Drucke unerträglich machten.
Ich gebe ehrlich zu, daß alle diese Vorwürfe ihr Recht haben mögen, wenn ich auch glaube, ihnen antworten zu können, auch ohne die gewöhnliche Länge eines Vorwortes zu überschreiten. Aber man wird meine Meinung teilen, daß ein Buch, das allen gerecht würde, keinem taugen könne. Hätte ich allen nach Gefallen schreiben wollen, hätte ich so Buch als Vorrede nicht geschrieben.
Übersetzt von Franz Blei:
Geboren am 18.01.1871 in Wien; gestorben am 10.07.1942 in Westbury/Long Island.
Franz Blei studierte von 1890 - 1894 in Zürich und Genf Nationalökonomie, Geschichte und Literaturgeschichte. Nach seiner Promotion lebte er als Literat und Bohemien abwechselnd in München und Berlin. 1931 zog er nach Mallorca und flüchtete als Gegner des Nationalsozialismus in die U.S.A.
Franz Blei übersetzte Werke von Baudelaire, Hawthorne, Laclos, Stendhal, Wilde und Balzac.
Erster Teil
Erster Brief
Cécile Volanges an Sophie Carnay, bei den Ursulinerinnen zu ...
Du siehst, liebe Freundin, daß ich Wort halte und daß der Toilettentisch mir nicht meine ganze Zeit raubt, – er wird mir immer welche für Dich übrig lassen. Ich habe an diesem einzigen Tag mehr Schmuck gesehen, als in den vier Jahren, die wir zusammen verlebt haben, und ich hoffe, daß die eingebildete Tanville, meine Mitpensionärin, sich bei meinem nächsten ersten Besuche mehr ärgern wird als sie annahm, daß wir uns ärgern, jedesmal wenn sie uns in ihrem vollen Staat besuchte. Mama spricht jetzt über alles mit mir: ich werde gar nicht mehr wie ein Schulmädchen behandelt. Ich habe meine eigene Kammerzofe, meine zwei eigenen Räume und einen sehr hübschen Schreibtisch, an dem ich Dir schreibe, und dessen Schlüssel ich habe, und alles darin einsperren kann, was mir beliebt. Mama sagt mir, daß ich sie jeden Tag am Morgen sehen werde, daß es genügt, wenn ich bis zum Diner frisiert bin, weil wir beide immer allein sein werden, und dann wird sie mir die Stunde jedesmal angeben, zu der ich am Nachmittag mit ihr ausgehe. Die übrige Zeit gehört mir allein. Ich habe meine Harfe, meine Zeichensachen und die Bücher ganz wie im Kloster, nur ist Mutter Perpetua nicht hier, um mich auszuzanken, und ich kann faulenzen so viel ich will: aber da meine Sophie nicht bei mir ist, um mit mir zu lachen und zu schwatzen, so ist's mir lieber, mich zu beschäftigen.
Es ist noch nicht fünf Uhr und ich soll erst um sieben Uhr mit Mama zusammensein, hab also Zeit genug, wenn ich Dir etwas zu erzählen hätte. Aber man hat noch über gar nichts mit mir gesprochen; und wenn ich nicht all die Vorbereitungen sehen würde und das Massenaufgebot von Schneiderinnen, die meinetwegen bestellt sind, ich würde nicht glauben, daß man mich verheiraten will, sondern daß das ganze nur so ein Geschwätz von unserer guten Pförtnerin Josephine war. Aber meine Mama sagte oft, daß ein junges Mädchen bis zu ihrer Verheiratung im Kloster bleiben soll; da sie mich herausgenommen hat, so muß doch Schwester Josephine Recht gehabt haben.
Soeben hält ein Wagen unten am Tor, und Mama läßt mich bitten zu ihr zu kommen. Ich bin nicht angezogen, – wenn es dieser Herr wäre!? Mein Herz klopft stark, und meine Hand zittert! Als ich meine Zofe fragte, wer bei Mama wäre, lachte sie und sagte: Herr G ...
O! ganz bestimmt, er ist es. Ich werde Dir dann alles erzählen, – jetzt kennst Du immerhin schon seinen Namen, und ich will nicht länger auf mich warten lassen. Adieu, bis nachher!
Wie wirst Du Dich über die arme Cécile lustig machen! O wie war ich auch dumm! Aber sicher wäre es Dir genau so gegangen. Also wie ich bei Mama eintrat, stand dicht neben ihr ein Herr ganz in Schwarz. Ich begrüßte ihn so artig wie ich konnte und blieb, ohne mich vom Platz zu rühren, stehen. Du kannst Dir denken, wie ich ihn mir anschaute! »Gnädige Frau«, sagte er zu meiner Mutter und grüßte mich, »sie ist entzückend, und ich fühle vollauf den Wert Ihrer Güte.« Das klang so bestimmt, und ich begann zu zittern, daß ich mich nicht mehr aufrecht halten konnte; ich fand einen Stuhl in meiner Nähe, auf den ich mich verwirrt und ganz rot geworden niederließ. Kaum saß ich, so lag dieser Mann auch schon zu meinen Füßen. Ich verlor nun völlig den Kopf und war, wie Mama behauptete, ganz verwirrt. Ich stand auf mit einem Schrei, ganz so einem Schrei, wie damals, weißt Du, als das starke Donnerwetter anhub. Mama lachte laut und sagte: »Was hast du denn? setz dich nieder und reiche dem Herrn deinen Fuß.« Und wirklich, meine liebe Freundin, – der Herr war ein Schuster! Es ist mir nicht möglich, Dir zu beschreiben, wie beschämt ich mich fühlte, – glücklicherweise war nur Mama anwesend. Wenn ich verheiratet bin, werde ich gewiß nicht mehr bei diesem Schuster arbeiten lassen.
Jetzt sind wir, ich und Du, nicht klüger als zuvor! Lebe wohl, – meine Kammerzofe sagt, ich müsse mich jetzt anziehen, es ist bald sechs Uhr. Adieu, ich liebe Dich noch gleich stark wie im Kloster, meine liebe, liebe Sophie.
P. S. Da ich nicht weiß, durch wen ich meinen Brief schicken soll, werde ich warten bis Josephine kommt.
Paris, den 3. August 17..
Zweiter Brief
Die Marquise von Merteuil an den Vicomte von Valmont im Schlosse zu ...
Kommen Sie, mein lieber Vicomte, kommen Sie zurück! Was machen Sie, was können Sie denn bei einer alten Tante machen, deren Vermögen Ihnen doch schon sicher ist? Ich brauche Sie, reisen Sie also unverzüglich. Ich habe eine vortreffliche Idee, mit deren Ausführung ich Sie betrauen will. Diese wenigen Worte sollten Ihnen genügen, und Sie sollten sich von meiner Wahl so sehr geehrt fühlen, daß Sie herbeieilen müßten und kniend meine Befehle entgegen nehmen. Aber Sie mißbrauchen meine Güte, selbst seitdem Sie sie nicht mehr brauchen. Zwischen einem ewigen Haß und einer übergroßen Güte trägt zu Ihrem Glücke doch wieder meine Güte den Sieg davon. Ich will Sie nun von meinem Projekte unterrichten. Aber schwören Sie mir zum voraus, daß Sie als mein treuer Kavalier sich in kein anderes Abenteuer einlassen, ehe dieses nicht zu Ende geführt ist, – es ist eines Helden würdig: Sie werden dabei der Liebe und der Rache dienen, und Sie werden sich seiner in Ihren Memoiren rühmen können, in diesen Memoiren, von denen ich möchte, daß sie einst gedruckt werden – ich will es auf mich nehmen, sie zu schreiben. Aber zu unserer Sache!
Frau von Volanges verheiratet ihre Tochter: es ist noch ein Geheimnis, das ich aber gestern von ihr selbst erfuhr. Wen glauben Sie wohl, daß sie sich zum Schwiegersohne aussuchte? Den Grafen Gercourt! Wer hätte mir gesagt, daß ich die Cousine von Gercourt werden würde! Ich bin wütend darüber – und – aber erraten Sie denn immer noch nicht? Was sind Sie schwerfällig! Haben Sie ihm das Abenteuer mit der Intendantin verziehen? Und vergessen, wie ich mich über ihn zu beklagen habe? Ich muß sagen, die Hoffnung, mich nun endlich rächen zu können, beruhigt und erheitert mich sehr.
Wie oft hat uns Gercourt mit der Wichtigtuerei gelangweilt, mit der er von der Wahl seiner künftigen Frau sprach, und mit seiner lächerlichen Einbildung, er würde dem unvermeidlichen Schicksal, düpiert zu werden, entgehen. Erinnern Sie sich seiner albernen Vorliebe für die klösterliche Erziehung der Mädchen und seines lächerlichen Vorurteils, daß die Blondinen sittsamer wären? Ich wette, er würde die Ehe mit Fräulein Volanges niemals eingehen, trotz ihrer sechzigtausend Francs Rente, wenn sie nicht blond und nicht im Kloster erzogen worden wäre. Beweisen wir ihm, daß er nur ein Idiot ist, und daß er es sicher eines Tages sein wird, dafür stehe ich. Aber ich möchte, daß er als Idiot debütiert.
Wie würde er am Tage nach der Hochzeit prahlen, und wie würden wir lachen! Denn prahlen wird er! Und es müßte wunderbar zugehen, sollte Gercourt nicht Tagesgespräch in Paris werden, nachdem die Kleine erst einmal in Ihrer Schule war.
Die Heldin dieses Romanes verdient übrigens Ihre größte Aufmerksamkeit, denn sie ist wirklich hübsch; erst fünfzehn Jahre alt und wie eine Rosenknospe; gar nicht geziert, aber dumm und lächerlich naiv, wovor ihr Männer ja keine Angst habt. Im übrigen noch einen vielversprechenden Ausdruck in den Augen. Kurz und gut: ich empfehle sie Ihnen, und so brauchen Sie sich nur noch bei mir zu bedanken und zu gehorchen.
Dieser Brief ist morgen früh in Ihren Händen. Ich erwarte, daß Sie morgen Abend um sieben Uhr bei mir sind. Bis acht Uhr empfange ich niemand, nicht einmal den zur Zeit regierenden Chevalier – er hat nicht genug Verstand für eine so wichtige und große Sache.
Wie Sie sehen, macht mich die Liebe nicht blind. Um acht Uhr haben Sie Ihre Freiheit – um zehn Uhr kommen Sie wieder, um zusammen mit der Schönen bei mir zu soupieren, denn Mama und Tochter werden bei mir zu Tisch sein.
Adieu, es ist über zwölf Uhr: bald werde ich mich nicht mehr mit Ihnen beschäftigen.
Paris, den 4. August 17..
Dritter Brief
Cécile Volanges an Sophie Carnay.
Ich kann Dir immer noch nichts mitteilen. Bei Mama waren gestern viele Gäste zum Abendessen. Trotzdem ich mit großem Interesse die anwesenden Herren beobachtete, so habe ich mich doch gelangweilt. Herren und Damen, alle schauten mich an, dann sprachen sie sich leise in die Ohren, und ich merkte, daß von mir die Rede war: gegen meinen Willen wurde ich ganz rot. Ich wollte es nicht, denn ich bemerkte, daß die andern Frauen, wenn man sie ansah, nicht rot wurden. Vielleicht auch sieht man es unter der Schminke nicht; denn es muß doch sehr schwer sein, nicht zu erröten, wenn einen ein Mann so fest ansieht.
Was mich am meisten beunruhigte, war, was man wohl über mich dachte. Mir war, als wenn ich zwei- oder dreimal das Wort »hübsch« verstanden hätte; das Wort »ungeschickt« hörte ich ganz deutlich, und es muß wahr sein, denn die Frau, die das sagte, war eine Verwandte und Freundin meiner Mutter; sie schien sogar sofort Freundschaft für mich zu empfinden. Das war auch die einzige Person, die am ganzen Abend ein wenig mit mir sprach. Morgen werden wir bei ihr zu Abend essen.
Außerdem hörte ich noch nach dem Diner einen Herrn zu einem andern sagen – und ich bin überzeugt, es ging auf mich: »Das muß man erst reif werden lassen, wir werden ja in diesem Winter sehen.« Vielleicht war es sogar der, der mich heiraten soll, das wäre aber dann ja erst in vier Monaten! Ach, ich möchte so gerne wissen, was wahres an all dem ist!
Gerade kommt Josephine und sie sagt, daß sie sehr in Eile wäre. Ich will Dir aber doch noch eine große Ungeschicklichkeit von mir erzählen. Die Dame, die das sagte, hat doch wohl recht, glaub ich. Also nach Tisch wurde gespielt. Ich setzte mich neben Mama und war sofort eingeschlafen, ohne daß ich merkte, wie das geschah. Eine Lachsalve weckte mich auf. Gewiß hat man über mich gelacht, aber ich bin dessen nicht ganz sicher. Mama erlaubte mir, mich zurückzuziehen, was mir sehr recht war. Denke, es war schon nach elf Uhr! Adieu, meine liebe Sophie, und hab Deine Cécile immer recht lieb. Ich versichere Dir, daß die große Welt nicht halb so amüsant ist, wie wir uns das immer vorstellten.
Paris, den 4. August 17..
Vierter Brief
Der Vicomte von Valmont an die Marquise von Merteuil in Paris.
Ihre Befehle entzücken mich, die Art und Weise, wie Sie sie geben, noch mehr: Sie machen einen das unbedingte Gehorchen lieben. Sie wissen, es ist nicht das erstemal, daß ich bedaure, nicht mehr Ihr Sklave zu sein. Und wenn Sie mich auch ein Ungeheuer nennen, so erinnere ich mich doch immer mit großem Vergnügen der Zeiten, da Sie mich mit süßeren Kosenamen bedachten. Oft wünsche ich mir, ich könnte sie wieder verdienen und der Welt mit Ihnen zusammen ein Beispiel ewiger Treue geben.
Aber größere Dinge erwarten uns. Erobern, das ist unsere Bestimmung, und man muß ihr folgen: vielleicht treffen wir uns am Ende dieser Carriere wieder. Denn, ohne Sie kränken zu wollen, meine schöne Marquise, muß man zugeben, daß Sie mit mir Schritt halten. Seitdem wir uns für das Glück der Mitmenschen trennten, predigen wir jeder seinerseits die Treue und den Glauben, und mir scheint, daß Sie in dieser Liebesmission mehr Proselyten machten als ich. Ich kenne ja Ihren Eifer, Ihre hingebende Inbrunst; und wenn jener Gott uns nach unsern Werken beurteilen würde, müßten Sie die Schutzpatronin einer großen Stadt werden, während Ihr Freund nur der Heilige eines Dorfes würde. Diese Sprache erstaunt Sie, nicht wahr? Aber seit acht Tagen höre und spreche ich keine andere; nur um mich darin noch zu vervollkommnen, muß ich Ihnen ungehorsam sein.
Aber werden Sie nicht böse und hören Sie mich an. Als Mitwisserin meiner Herzensgeheimnisse will ich Ihnen den größten Plan anvertrauen, den ich je gehabt habe. Was schlagen Sie mir vor? Ein junges Mädchen zu verführen, das weder was kennt, noch irgend etwas gesehen hat, das mir gewissermaßen ohne Gegenwehr preisgegeben ist, das einem ersten verliebten Sturm erliegen wird und das dabei mehr von der Neugierde geleitet ist als von der Liebe. Zwanzig andere können dasselbe ausrichten. Nein – mein Plan ist ein andrer: sein Erfolg wird mir ebensoviel Ruhm wie Vergnügen bereiten. Die Liebe, die mir meinen Kranz windet, schwankt noch zwischen Myrte und Lorbeer, oder sie wird vielmehr beides vereinigen. Sie werden, meine schöne Freundin, von heiligem Respekt vor mir erfüllt werden und mit Enthusiasmus ausrufen: »Das ist der Mann meines Herzens.«
Sie kennen doch die Präsidentin von Tourvel, ihre Frömmigkeit, ihre eheliche Treue und ihre strengen Grundsätze. Das ist mein Gegner und ein Feind meiner würdig, und das ist das Ziel, das ich erreichen will.
»Bleibt auch in diesem Kampf der Siegespreis nicht mein,
Daß ich den Kampf gewagt, wird Ruhm genug mir sein.«
Man darf schlechte Verse zitieren, sie müssen nur von einem großen Dichter sein.
Sie müssen also wissen, daß sich der Präsident in Burgund aufhält, eines Prozesses wegen – ich hoffe ihn aber einen wichtigeren verlieren zu lassen – seine untröstliche andere Hälfte aber soll ihre betrübende Zeit der Witwenschaft hier verbringen. Jeden Tag eine Messe, einige Besuche bei den Bezirkskranken, Gebete des Morgens und des Abends, fromme Unterhaltungen mit meiner alten Tante, und manchesmal einen trübseligen Whist, das sollen ihre einzigen Zerstreuungen sein. Mein guter Genius hat mich hierher geführt, zu ihrem und zu meinem Glück. Vierundzwanzig Stunden habe ich zu bereuen, die ich konventionellem Gerede opferte. Welche Strafe, zwänge man mich nach Paris zurückzukehren! Glücklicherweise spielt man Whist zu viert, und weil hier nur ein Dorfgeistlicher existiert, so hat meine gottesfürchtige Tante in mich gedrängt, ihr einige Tage zu opfern. Sie können sich denken, wie ich bereit war! Aber Sie können sich keinen Begriff davon machen, wie meine Tante mich seitdem verhätschelt, wie sie darüber erbaut ist, mich so regelmäßig beim Beten und in der Messe zu sehen! Sie hat keine Ahnung von der Gottheit, die ich in der Kirche anbete.
Seit vier Tagen bin ich also an eine heftige Leidenschaft gebunden. Sie kennen mein Temperament und wie ich Hindernisse nehme, aber Sie wissen nicht, wie köstlich die Einsamkeit meine Begierde steigert. Ich kenne nur noch dieses eine, ich denke daran am Tage und träume davon des Nachts: Ich muß diese Frau haben, um nicht der Lächerlichkeit zu verfallen, verliebt zu sein. Verliebt – wohin führt uns nicht ein ungestilltes Verlangen! Köstliches Verlangen – ich beschwöre dich um meines Glückes und besonders um meiner Ruhe willen! Wie glücklich sind wir, daß sich die Frauen so schlecht verteidigen, – wir wären sonst schüchterne Sklaven neben ihnen. Ich verspüre jetzt eine Art Dankbarkeit für die gefälligen, leichten Frauen, ein Gefühl, das mich natürlich vor Ihre Füße führt. Da knie ich nieder, bitte um Verzeihung und endige dort meinen allzu langen Brief. Adieu, meine sehr schöne Freundin und – keinen Groll.
Auf Schloß . . ., den 5. August 17..
Fünfter Brief
Die Marquise von Merteuil an den Vicomte von Valmont.
Wissen Sie, Vicomte, daß Ihr Brief unverschämt ist, und daß ich ihn Ihnen sehr übel nehmen könnte, gäbe er mir nicht zugleich den Beweis, daß Sie ganz und gar den Kopf verloren haben? Und das bewahrt Sie vor meiner Ungnade. Als Ihre gefühlvolle und großmütige Freundin vergesse ich Ihre Beleidigung und kümmere mich um die Gefahr, in der Sie schweben; mag es auch dumm sein, darüber zu räsonieren, so will ich Ihnen doch in diesem Augenblick beistehen. Sie wollen die Präsidentin von Tourvel haben? Was für eine lächerliche Laune! Ich erkenne daran ganz Ihren Eigensinn, der nur das wünscht, was er glaubt, nicht erreichen zu können. Was hat denn diese Frau? Vielleicht sehr regelmäßige Züge, aber sie sind ohne Ausdruck; sie ist recht gut gebaut, aber ohne Grazie, und angezogen ist sie, zum Lachen! Ganze Pakete Stoff hat sie bis zum Hals hinauf, daß ihr der Leib bis zum Kinn reicht. Als Freundin sage ich Ihnen: zwei solche Frauen genügen, Sie um Ihr ganzes Ansehen zu bringen. Erinnern Sie sich noch des Tages in Saint-Roche, wo sie für die Armen sammelte, was Sie veranlaßte, mir für das Schauspiel zu danken, das ich Ihnen damit bereitete? Ich sehe sie noch, wie sie diesem einer Hopfenstange ähnlichen Herrn mit den langen Haaren die Hand gab, der bei jedem Schritte umzufallen drohte, und wie sie ihren vier Ellen langen Reifrock immer jemandem an den Kopf schwang bei jeder Verbeugung und errötete. Wenn man Ihnen damals gesagt hätte, daß Sie diese Frau verlangten! Nun, Vicomte, erröten Sie Ihrerseits und besinnen Sie sich auf sich selber. Ich verspreche Ihnen Diskretion.
Bedenken Sie doch auch alle die Unannehmlichkeiten, die Sie dabei erwarten. Und was für Rivalen haben Sie? Einen Gatten! Sind Sie bei diesem einen Wort nicht schon ganz klein? Welche Schande, wenn es mißlingt! Und wie wenig Ruhm beim Erfolg! Ich sage noch mehr: versprechen Sie sich kein Vergnügen. Gibt es denn eines mit prüden Frauen? Ich meine mit den ehrlichen Prüden, die selbst auf dem Höhepunkt des Vergnügens noch zurückhaltend sind und so nur halben Genuß geben. Dieses völlige Sichselbstvergessen, diesen Rausch der Wollust, der das Vergnügen durch sein Übermaß läutert, diese Wohltaten der Liebe kennen sie nicht. Ich prophezeie Ihnen, daß im günstigsten Fall Ihre Präsidentin glauben wird, alles für Sie getan zu haben, indem sie Sie wie ihren Ehegemahl behandelt, und im engsten und zärtlichsten ehelichen Zusammensein bleibt man immer – zu zweit. In Ihrem Falle steht es noch schlimmer.
Ihre keusche Dame ist fromm und von jener Frömmigkeit, welche die gute Frau zu einer ewigen Kindlichkeit verurteilt. Vielleicht überwinden Sie dieses Hindernis, schmeicheln Sie sich aber nicht, es zu zerstören; wenn auch Sieger, über die Liebe Gottes, so sind Sie es doch nicht über die Furcht vor dem Teufel; wenn Sie Ihre Geliebte in Ihren Armen erschauern fühlen, so ist das nicht Liebe, sondern Angst. Wenn Sie diese Frau früher gekannt hätten, vielleicht hätten Sie etwas aus ihr machen können; aber sie ist jetzt zweiundzwanzig Jahre alt und bald zwei Jahre verheiratet. Glauben Sie mir, Vicomte, wenn eine Frau schon so in diese tugendsamen Vorurteile hineingewachsen ist, soll man sie ihrem Schicksale überlassen, – sie wird immer nur ein Gattungswesen sein.
Und um dieses schönen Gegenstandes willen wollen Sie mir nicht folgen, wollen Sie sich in das Grab Ihrer Tante vergraben und dem schönsten und köstlichsten Abenteuer entsagen, das Ihnen Ehre gebracht hätte. Durch welches Schicksal muß denn Gercourt immer und überall vor Ihnen etwas voraus haben? Ich spreche ganz ohne Ironie, aber jetzt glaube ich wirklich, daß Sie Ihren Ruf nicht verdienen; und daß ich mich versucht fühle, Ihnen mein Vertrauen zu entziehen. Ich würde mich nie dazu verstehen, meine Geheimnisse dem Geliebten einer Frau von Tourvel anzuvertrauen.
Ich will Ihnen dennoch erzählen, daß die kleine Volanges schon einen Kopf verdreht hat. Der junge Danceny liebt sie. Er hat mit ihr gesungen, und sie singt wirklich besser, als man von einem Pensionskind erwartet. Sie werden Duette miteinander üben, und ich glaube, sie würde nichts gegen ein Unisono haben. Aber dieser Danceny ist noch ein Kind, der seine Zeit mit Hofmachen verliert und zu keinem Ende kommt. Die kleine Person ist ihrerseits auch sehr kindisch. Aber wie es auch kommen mag, Sie hätten die Sache jedenfalls viel lustiger gestaltet. Ich bin übler Laune und werde mich mit dem Chevalier zanken, wenn er kommt. Ich werde ihm raten recht artig zu sein, denn es würde mich momentan nichts kosten, mit ihm zu brechen. Ich bin überzeugt, er würde verzweifeln, wenn ich vernünftig genug wäre, ihn jetzt aufzugeben, und nichts amüsiert mich so sehr, wie ein verzweifelter Liebhaber. Er würde mich perfid nennen, und dieses Wort hat mir immer Spaß gemacht; nach dem Worte »Grausame« ist es das süßeste Wort für das Ohr einer Frau, und weniger schwierig, es sich zu verdienen. Ich will mich ganz ernsthaft mit diesem Bruche beschäftigen; und daran werden Sie Schuld sein; ich lege es ihrem Gewissen zur Last. Adieu. Empfehlen Sie mich dem Gebete Ihrer Präsidentin.
Paris, den 7. August 17..
Sechster Brief
Der Vicomte von Valmont an die Marquise von Merteuil.
Gibt es also wirklich keine Frau, welche die Macht nicht mißbraucht, die sie über uns hat? Selbst Sie, die ich so oft meine nachsichtige Freundin nannte, sind es nicht mehr, denn Sie scheuen sich nicht, mich in dem Gegenstand meiner Zuneigung anzugreifen! Mit welchen Zügen wagen Sie es, Frau von Tourvel zu zeichnen! Welcher Mann hätte eine solche Vermessenheit nicht mit dem Leben büßen müssen! Keine andere Frau außer Ihnen hätte sich das ungestraft erlauben dürfen. Setzen Sie mich, ich bitte, nicht wieder einer so harten Probe aus; ich könnte nicht mehr dafür gut stehen. Im Namen der Freundschaft: warten Sie, bis ich diese Frau besessen habe, wenn Sie sie schmähen wollen. Wissen Sie denn nicht, daß bloß die Wollust das Recht hat, die Liebe sehend zu machen?
Aber was rede ich da. Hat denn Frau von Tourvel nötig, daß man sich um sie Illusionen macht? Ihr genügt es, sie selbst zu sein, daß man sie anbetet. Sie werfen ihr vor, daß sie sich schlecht kleidet und mit Recht, denn die Pracht steht ihr nicht; alles, was sie verhüllt, verunstaltet sie. Nur in der Ungebundenheit des Hauskleides ist sie wirklich entzückend. Dank der jetzt herrschenden schwülen Hitze läßt ein einfaches Leinennegligé die runde und weiche Linie ihres Körpers erkennen. Ein dünner Musseline bedeckt den Hals, und meine heimlichen aber durchdringenden Blicke sahen schon die entzückendsten Formen. Sie sagen, ihr Gesicht habe keinen Ausdruck. Was soll es ausdrücken in Momenten, wo nichts zu ihrem Herzen spricht? Nein, ohne Zweifel hat sie nicht jenen lügenhaften Blick unserer koketten Frauen, der uns manchmal verführt, aber immer betrügt. Sie versteht es nicht, die Leere einer Phrase durch ein einstudiertes Lächeln zu verbergen, und gleichviel sie die schönsten Zähne von der Welt hat, so lacht sie doch nur, wenn sie etwas darüber zu lachen findet. Sie sollten sehen, wie sie in mutwilligen Spielen offen und naiv heiter ist! Wie ihr Blick reine Freude und teilnehmende Güte ausdrückt, wenn sie einem Unglücklichen hilft! Ja, man muß sehen, wie beim kleinsten Wort des Lobes oder der Schmeichelei sich auf ihrem himmlischen Gesicht eine rührende Verlegenheit der Bescheidenheit malt, die so ganz echt ist! ... Sie ist spröde und fromm, und deshalb Ihr Urteil, sie wäre kalt und seelenlos und ohne Liebe. Ich denke ganz anders. Welch erstaunliche Sensibilität muß sie doch haben, daß sie sich bis auf ihren Mann erstreckt, und den zu lieben, der immer abwesend ist? Was für stärkere Beweise verlangen Sie noch? Ich wußte mir aber auch noch einen andern zu verschaffen.
Ich richtete es auf einem Spaziergang so ein, daß wir einen Graben zu überspringen hatten, und obschon sie sehr flink ist, so ist sie doch noch schüchterner. Sie können sich denken, daß eine prüde Frau sich scheut, über einen Graben zu springen. Sie mußte sich mir anvertrauen, und ich hielt diese bescheidene Frau in meinen Armen. Die Vorbereitungen und das Hinüberbefördern meiner alten Tante hatten die mutwillige fromme Tourvel laut lachen machen; nun hielt ich sie, und infolge einer absichtlichen Ungeschicklichkeit mußten wir uns umarmen.
Ich preßte ihre Brust an die meine, und ich fühlte ihr Herz schneller schlagen. Eine süße Röte färbte ihr Gesicht, und ihre bescheidene Verlegenheit lehrte mich, daß ihr Herz aus Liebe zitterte und nicht aus Furcht. Meine Tante irrte sich natürlich – so wie Sie, – als sie sagte: »Das Kind hat Angst bekommen.« Aber die reizende Offenheit des »Kindes« erlaubte ihr nicht die Lüge, und sie antwortete ganz naiv: »O nein, aber . . .« Dies eine Wort machte mir alles klar. In dem Augenblick hat die süße Hoffnung die grausame Ungewißheit verdrängt. Ich werde diese Frau besitzen. Ich werde sie dem Manne wegnehmen, der sie profaniert, ja selbst dem Gotte, den sie anbetet, werde ich sie rauben. Welche Lust, abwechselnd Gegenstand und Besieger ihrer Gewissensbisse zu sein! Es sei fern von mir, ihre Vorurteile zu zerstören; sie werden mein Glück und meinen Ruhm erhöhen. Sie soll nur und an nichts als an die Tugend glauben, sie mir aber opfern; ihr Fehltritt soll sie entsetzen, aber sie soll ihm auch keinen Einhalt gebieten können, und von tausend Ängsten geplagt soll sie ihn nur in meinen Armen vergessen und unterdrücken. Dann muß sie mir sagen: »Ich bete dich an,« und sie allein unter allen Frauen wird würdig sein, dies Wort auszusprechen. Ich werde der Gott sein, den sie dem andern vorgezogen hat.
Seien wir aufrichtig: in unseren Arrangements, die ebenso kalt wie frivol sind, ist das was wir Glück nennen kaum ein Vergnügen. Soll ich es Ihnen sagen? Ich glaubte mein Herz wäre abgewelkt; und da ich nur noch meine Sinnlichkeit fühlte, beklagte ich mich über ein vorzeitiges Alter. Frau von Tourvel hat mir die schönen Illusionen der Jugend wiedergegeben. Neben dieser Frau habe ich nicht den Genuß nötig, um glücklich zu sein. Das einzige, was mich dabei etwas erschreckt, ist die Zeit, die mich dieses Abenteuer kosten wird; denn ich wage nichts dem Zufall zu überlassen. Ich mag mich immer all meiner glückgefolgten Frechheiten erinnern, – ich kann mich nicht entschließen, sie hier zu brauchen. Damit ich wahrhaft glücklich bin, muß sie sich mir geben; und das ist keine Kleinigkeit.
Sie würden meine Vorsicht bewundern. Ich habe das Wort Liebe noch nicht ausgesprochen, aber wir sind schon bei jenen gewissen Worten des Vertrauens und Interesses. Um sie so wenig als möglich zu betrügen, und um dem Gerede zuvorzukommen, das ihr zugebracht werden könnte, habe ich selbst, und wie in Reue, ihr meine bekanntesten Geschichten erzählt. Sie würden darüber lachen, wenn Sie sähen, mit welcher Unschuld sie mir Besserung predigt. Sie sagte, sie wollte mich bekehren. Noch weiß sie nicht, wieviel sie diese versuchte Bekehrung kosten wird. Sie denkt nicht daran, daß sie, während sie »für die Unglücklichen, die ich zu Fall brachte«, redet, im voraus ihre eigene Angelegenheit plaidiert. Das fiel mir gestern inmitten einer ihrer Predigten ein, und ich konnte mir das Vergnügen nicht entsagen, sie zu unterbrechen, um ihr zu versichern, daß sie wie ein Prophet spräche. Adieu, meine sehr schöne Freundin. Sie sehen, ich bin noch nicht rettungslos verloren.
P. S. Hat sich übrigens der arme Chevalier aus Verzweiflung schon umgebracht? Sie sind doch tausendmal schlechter als ich, und Sie würden mich ganz klein machen, wenn ich eigensüchtig wäre.
Auf Schloß . . ., den 9. August 17..
Siebenter Brief
Cécile Volanges an Sophie Carnay.
Ich konnte Dir über meine Heirat nichts schreiben, denn ich bin noch immer nicht klüger als am ersten Tag. Ich gewöhne mich daran, nicht mehr daran zu denken und befinde mich, wie ich jetzt lebe, sehr wohl dabei. Ich treibe viel Gesang und Harfe, und mir scheint, daß ich beides mehr liebe, seitdem ich keinen Lehrer mehr habe oder vielmehr seitdem ich einen bessern gefunden.
Der Chevalier Danceny, dieser Herr, weißt Du, von dem ich Dir erzählte, daß ich mit ihm bei Frau von Merteuil gesungen habe, hat die Güte, jeden Tag zu mir zu kommen und stundenlang mit mir zu singen. Er ist sehr nett. Er singt wie ein Engel und komponiert Lieder, zu denen er die Worte selbst macht. Es ist wirklich schade, daß er Malteserritter ist! Es scheint mir, seine Frau könnte sehr glücklich sein, wenn er heiratete ... Er ist von einer entzückenden Aufmerksamkeit. Es sieht nie aus, als ob er Komplimente machte und trotzdem schmeichelt alles was er sagt. Er korrigiert mich immer, sei es über die Musik oder über andere Dinge; seine Kritik ist aber so interessant und lustig, daß man ihm unmöglich böse sein kann. Wenn er einen ansieht, scheint er immer etwas Hübsches zu sagen. Und dabei ist er so gefällig. Gestern abend zum Beispiel war er zu einem großen Konzert eingeladen; aber er hat es vorgezogen, den ganzen Abend bei Mama zu bleiben. Das hat mir viel Freude gemacht; denn wenn er nicht da ist, spricht niemand mit mir und ich langweile mich; wenn er aber da ist, plaudern und singen wir zusammen. Und er weiß mir immer etwas zu erzählen. Er und Frau von Merteuil sind die einzigen Personen, die ich lieb und nett finde. Nun adieu, meine liebe Freundin. Ich versprach, daß ich heute eine Arie geläufig können würde, deren Begleitung sehr schwer ist, und ich will mein Wort halten. Ich will mich ans Lernen machen, bis er kommt.
Paris, den 7. August 17..
Achter Brief
Die Präsidentin von Tourvel an Frau von Volanges.
Ich danke Ihnen, gnädige Frau, sehr für das Vertrauen, das Sie mir bewiesen haben; niemand kann mehr Interesse an der Verheiratung von Fräulein von Volanges nehmen als ich. Von ganzer Seele wünsche ich ihr ein Glück, dessen sie einzig und zweifellos würdig ist, und ich vertraue dabei ganz Ihrer Klugheit. Ich kenne den Grafen Gercourt nicht, da Sie ihn jedoch mit Ihrer Wahl beehren, kann ich nicht anders als eine vorteilhafte Meinung von ihm haben. Ich beschränke mich darauf, gnädige Frau, dieser Ehe ebensoviel Erfolg zu wünschen wie ihn die meine hat, die ja ebenfalls Ihr Werk ist, für das ich Ihnen täglich dankbarer bin. Das Glück Ihrer Tochter möge die Belohnung für das Glück sein, das Sie mir gegeben haben, und möge die beste der Freundinnen auch die glücklichste Mutter werden!
Es tut mir wirklich leid, Ihnen nicht mündlich meine aufrichtigsten Wünsche darbringen zu können und so auch, wie ich es wünschte, Fräulein von Volanges persönlich kennen zu lernen. Wie ich Ihre wahrhaft mütterliche Liebe erfuhr, glaube ich berechtigt zu sein, von Cécile die zärtliche Freundschaft einer Schwester zu erhoffen. Ich bitte, gnädige Frau, diese Freundschaft gütigst für mich verlangen zu wollen, in der Erwartung, sie zu verdienen.
Ich gedenke die ganze Zeit, da Herr von Tourvel abwesend ist, auf dem Lande zu bleiben. Ich benütze die Zeit, mir die Gesellschaft der vortrefflichen Frau von Rosemonde zunutze zu machen. Diese Frau ist immer noch gleich liebenswürdig und verliert nichts durch ihr hohes Alter; sie hat ihr volles Gedächtnis und ihre jugendliche Heiterkeit bewahrt. Nur ihr Körper ist vierundachtzig Jahre alt.
Unsere Einsamkeit erheitert ihr Neffe, der Vicomte von Valmont, der uns einige Tage opfern wollte. Ich kannte ihn nur dem Rufe nach, und dieser ließ nicht den Wunsch aufkommen, den Herrn persönlich kennen zu wollen; aber mir scheint, er ist besser als sein Ruf. Hier, wo ihn der Welttrubel nicht mit fortreißt, spricht er erstaunlich vernünftig und klagt sich selbst seiner Verirrungen mit einer seltenen Aufrichtigkeit an. Er spricht voller Vertrauen mit mir, und ich predige ihm mit viel Strenge. Sie, die Sie ihn kennen, werden zugeben, daß das wirklich eine schöne Bekehrung wäre; aber ich zweifle doch nicht daran, daß acht Tage Paris genügten, ihn trotz all seiner Versprechungen alle meine Predigten vergessen zu lassen.
Sein Aufenthalt hier wird ihm wohl einige Änderungen seiner gewöhnlichen Lebensweise bedeuten, aber ich glaube, daß das Beste, was er tun kann, ist, zu leben wie er gewohnt ist: Nichts tun. Er weiß, daß ich Ihnen schreibe und beauftragte mich, Ihnen seine ergebensten Empfehlungen zu vermitteln. Nehmen Sie auch die meinen entgegen mit jener Güte, die ich an Ihnen kenne, und bezweifeln Sie niemals meine aufrichtigsten Gefühle, mit denen ich die Ehre habe zu sein usw.
Schloß . . ., den 9. August 17..
Neunter Brief
Frau von Volanges an die Präsidentin von Tourvel.
Ich habe nie an der Freundschaft gezweifelt, die Sie für mich haben, meine junge und schöne Freundin, ebensowenig an dem Interesse, das Sie an allem nehmen, was mich betrifft. Nicht um feststehende Tatsachen unter uns zu diskutieren, antworte ich auf Ihren Brief; aber ich glaube, mich nicht enthalten zu können, mit Ihnen in der Angelegenheit des Vicomte von Valmont zu plaudern.
Ich gestehe offen, ich hatte nie erwartet, jemals diesen Namen in Ihren Briefen zu lesen. Was kann es auch Gemeinsames geben zwischen ihm und Ihnen? Sie kennen diesen Mann nicht, und wo hätten Sie sich je die Seele eines Wüstlings vorstellen können? Sie erzählen mir von seiner merkwürdigen Aufrichtigkeit; allerdings, die Aufrichtigkeit eines Valmont muß in Wirklichkeit merkwürdig sein. Er ist noch falscher und gefährlicher als liebenswürdig und verführerisch – seit seiner frühesten Kindheit tat er weder einen Schritt noch sprach er ein Wort ohne ganz bestimmte Absichten, und niemals hatte er eine Absicht, die nicht unanständig oder verbrecherisch gewesen wäre. Liebe Freundin, Sie kennen mich, und Sie wissen, wie gerade die Nachsicht unter den Tugenden, die ich mir aneignen möchte, jene ist, die ich am meisten schätze. Ja, wenn Valmont von ungestümer Leidenschaft mit fortgerissen würde! Wenn er wie tausend andere durch die Irrungen seines Alters verleitet würde, ich würde sein Betragen bedauern und ein gutes Wort für ihn einlegen und stillschweigend die Zeit erwarten, wo die glückliche Umkehr ihm die Achtung der ehrlichen Leute wieder einbrächte. Aber Valmont ist nicht so; sein Betragen ist das Resultat seiner Prinzipien. Er versteht genau auszurechnen, was sich ein Mensch erlauben darf, ohne sich zu kompromittieren; und um ohne Gefahr grausam und böse zu sein, suchte er sich die Frauen zum Opfer. Ich halte mich nicht damit auf, diejenigen zu zählen, die er verführte; aber wie viele sind es, die er verdorben hat!
In das zurückgezogene und beschauliche Leben, das Sie führen, sind seine skandalösen Abenteuer nicht gedrungen. Ich könnte Ihnen welche erzählen, die Sie erschauern machten, aber Ihr Blick, so rein wie Ihre Seele, würde durch solche Bilder besudelt. Gewiß wird Valmont niemals gefährlich für Sie werden und Sie brauchen keine Waffen seiner Art zu Ihrer Verteidigung. Das einzige, was ich Ihnen zu sagen habe, ist, daß unter allen Frauen, um die er sich gekümmert hat, sei es mit oder ohne Erfolg, daß keine darunter ist, die sich nicht um ihn zu beklagen hätte.
Die Marquise von Merteuil ist die einzige Ausnahme von dieser Regel: sie allein verstand es, ihm und seiner Schlechtigkeit zu widerstehen. Ich muß bekennen, daß ihr dies in meinen Augen zur größten Ehre gereicht; und es genügte, sie in den Augen aller von einigen zweifelhaften Geschichten zu reinigen, die man im Anfang ihrer Witwenschaft ihr vorwarf.
Wie dem auch sei, meine schöne Freundin, es ermächtigt mich mein Alter, die Erfahrung und besonders die Freundschaft dazu, Ihnen vorzustellen, daß man in der Gesellschaft Valmonts Abwesenheit bemerkt; und sobald man erfahren haben wird, daß er einige Zeit in Gesellschaft seiner Tante und der Ihren verbrachte, ist Ihr Ruf in seinen Händen, und das ist das größte Unglück, das einer Frau begegnen kann. Ich rate Ihnen deshalb, seine Tante zu veranlassen, ihn nicht länger bei sich zu behalten; wenn er sich darauf kapriziert, zu bleiben, so glaube ich, dürfen Sie nicht länger zögern, ihm den Platz zu räumen. Aber warum sollte er denn bleiben? Was macht er denn auf dem Lande? Wenn Sie seine Schritte verfolgen ließen, so bin ich überzeugt, Sie würden entdecken, daß er nur ein bequemes Versteck gesucht hat für irgendeine tolle Sache, die er in der Umgebung vorhat. Aber in der Unmöglichkeit, dem Übel abzuhelfen, begnügen wir uns, uns selber davor zu schützen. Adieu, meine schöne Freundin. Nun hat sich die Heirat meiner Tochter doch etwas hinausgeschoben. Graf Gercourt, den wir jeden Tag erwarteten, schickt mir Nachricht, daß sein Regiment nach Korsika geht, weil noch Kriegsunruhen dort unten sind, und daß es ihm unmöglich wäre, da vor dem Winter wegzukommen. Das ist mir nicht recht; aber gleichzeitig hege ich die Hoffnung, daß wir Sie so sicher zur Hochzeit hier sehen werden, denn es wäre mir leid gewesen, wenn sie ohne Sie hätte stattfinden müssen. Adieu, und ehrlich und aufrichtig ganz die Ihre.
P. S. Bitte mich Frau von Rosemonde in Erinnerung zu bringen, die ich liebe, wie sie es verdient.
Paris, II, August 17..
Zehnter Brief
Die Marquise von Merteuil an den Vicomte von Valmont.
Sind Sie mir böse, Vicomte? Oder gar gestorben? Oder – was beinah dasselbe ist – leben Sie nur noch für Ihre Präsidentin? Diese Frau, die Ihnen die Illusionen Ihrer Jugend wiedergegeben hat, wird Ihnen auch bald deren lächerliche Vorurteile geben. Schüchtern und unterwürfig sind Sie bereits – gerade so gut könnten Sie verliebt sein. Sie verzichten auf Ihre glücklichen Frechheiten, das heißt, Sie handeln ohne Prinzipien, überlassen alles dem Zufall oder vielmehr der Laune. Haben Sie vergessen, daß die Liebe, wie die Medizin, nichts als eine Kunst ist, die der Natur nachhilft? Sie sehen, ich schlage Sie mit Ihren eigenen Waffen. Das macht mich aber nicht eitel, denn ich schlage einen Wehrlosen. Sie sagen mir: »sie muß sich mir geben« – aber gewiß muß sie das, gerade so wie die andern, nur mit dem Unterschied, daß sie es nicht gern tun wird. Aber damit sie sich endlich ergibt, wäre doch das beste Mittel dieses, damit anzufangen, sie zu nehmen. Diese lächerliche Unterscheidung ist doch nichts als Unverstand der Liebe. Ich sage Liebe; denn Sie sind verliebt. Anders mit Ihnen zu reden wäre lügen und Ihnen Ihre Krankheit verheimlichen.
Sagen Sie mir doch, Sie schmachtender Liebhaber, glauben Sie denn, jene Frauen, die Sie besaßen, genotzüchtigt zu haben? Wie groß die Lust sich hinzugeben auch immer sein mag, so sehr es uns auch damit eilt, – man muß doch immer noch einen Vorwand haben, und gibt es denn einen bequemeren für uns als den, so zu tun, als ob man der Gewalt wiche? Ich bekenne, daß ein schnell und geschickt ausgeführter Angriff das ist, was mir am meisten schmeichelt; ein Angriff, wo alles der Reihe nach kommt, aber auch mit jener Schnelligkeit, die uns nie in diese peinliche Verlegenheit setzt, eine Ungeschicklichkeit wieder gut machen zu müssen, von der wir im Gegenteil profitieren sollen; ein Angriff, der auch bis in die Dinge hinein, die wir gewähren, den Anschein der brutalen Überwältigung behält und so geschickt unsern zwei Hauptpassionen schmeichelt –: dem Ruhm der Verteidigung und dem Vergnügen des Unterliegens. Ich gebe zu, daß dieses Talent der Attacke bei den Männern seltener ist, als man denken sollte, und daß es mir immer Freude machte, auch da, wo es mich nicht verführt hat; es ist mir passiert, daß ich mich ergab nur aus dem Gefühl der Belohnung heraus. So gab bei unsern alten Turnieren die Schönheit der Tapferkeit und Geschicklichkeit den Preis.
Sie sind nicht mehr derselbe. Sie benehmen sich, als ob Sie Angst hätten vor dem Erfolg. Seit wann reisen Sie mit der Schneckenpost? Aber lassen wir diese Sache, die mich in ebenso schlechte Laune bringt, als sie mir das Vergnügen raubt, Sie zu sehen. Schreiben Sie mir wenigstens öfter als bisher und halten Sie mich mit Ihren Fortschritten auf dem Laufenden. Wissen
Sie, daß es jetzt schon über vierzehn Tage her ist, seitdem Sie dieses lächerliche Abenteuer beschäftigt, und daß Sie darüber jedermann vernachlässigen?
Übrigens: Vernachlässigung. Sie kommen mir vor wie Leute, welche regelmäßig Nachrichten über ihre kranken Freunde einholen, aber nie auf die Antwort warten. Sie schließen Ihren letzten Brief mit der Frage, ob der Chevalier tot wäre. Haben Sie vergessen, daß mein Geliebter Ihr intimster Freund ist? Seien Sie unbesorgt, er ist nicht tot; und wenn er es wäre, so durch allzuviel des Glückes. Dieser arme Chevalier ist so lieb und so geschaffen für die Liebe! Und wie lebhaft seine Zärtlichkeit ist – es verdreht mir ganz den Kopf. Aber im Ernst: das unerhörte Glück, das er empfindet, von mir geliebt zu sein, bindet mich an ihn.
Denselben Tag, an dem ich Ihnen schrieb, daß ich mich mit dem Gedanken an unsern Bruch trage, habe ich ihn doch so ganz glücklich gemacht! Und ich hatte mir schon alle Mittel zurechtgelegt, ihn zur Verzweiflung zu bringen, als er mir gemeldet wurde. War es nur Laune oder war es Wahrheit, nie war er mir so schön vorgekommen, und trotzdem habe ich ihn doch recht launenhaft empfangen. Er dachte, zwei Stunden mit mir allein zu verbringen, ehe sich die Türen für jedermann öffneten. Aber ich sagte ihm, daß ich ausgehen würde; er wollte wissen wohin, und ich wollte es ihm nicht sagen. Als er darauf drang, sagte ich etwas scharf: »Dahin, wo Sie nicht sein werden.« Zum Glück für ihn machte ihn diese Antwort stumm; hätte er nur ein Wort darauf gesagt, wäre es unabweislich zu einer Auseinandersetzung gekommen und zum beabsichtigten Bruch. Erstaunt über sein Schweigen schaute ich nach ihm, aus keinem anderen Grunde, als um das Gesicht zu sehen, das er machte. Und ich sah auf diesem hübschen Gesichte jene zärtliche und tiefe Traurigkeit, von der Sie selbst sagten, daß sie unwiderstehlich wäre. Gleiche Ursache, gleiche Wirkung: ich war ein zweitesmal entwaffnet. Und so tat ich denn alles, um ihn nichts Schlechtes von mir glauben zu lassen. Ich gehe in Geschäften aus, sagte ich ihm schon etwas sanfter, und diese Geschäfte gehen Sie an; fragen Sie aber nichts weiter. Ich werde zu Hause zu Abend essen; kommen Sie zurück, und ich werde Ihnen alles erklären.
Dann erst fand er wieder Worte. Ich erlaubte ihm aber nicht, daß er Gebrauch davon machte und sagte schnell: »Ich habe große Eile.« Und: »Bis heute Abend.« Er küßte meine Hand und ging.
Gleich darauf, um ihn – und vielleicht auch mich – zu entschädigen, kam mir der Einfall, ihm mein kleines Haus zu zeigen, von dessen Existenz er keine Ahnung hat. Ich rufe also meine treue Viktoria.
Ich habe meine Migräne und lege mich – für meine Leute – zu Bett; und allein mit meiner Vertrauten, ziehe ich mich als Kammerzofe an, während sie sich als Lakai verkleidet. Darauf läßt sie einen Wagen an die hintere Gartentür kommen und fort geht es. Nach der Ankunft in meinem heimlichen Liebestempel zog ich das galanteste Negligé an, das man sich denken kann, und das wirklich entzückend ist und ganz meine Erfindung: es läßt nichts sehen und doch alles erraten. Ich verspreche Ihnen das Modell für Ihre Präsidentin, sobald Sie sie würdig gefunden haben werden, es zu tragen.
Nach all diesen Vorbereitungen und während Viktoria sich um die andern Details kümmert, lese ich ein Kapitel aus dem »Sopha« unseres Crébillon, einen Brief der Heloise und zwei Erzählungen von La Fontaine, um mich in Stimmung zu bringen. Da erscheint auch schon der Chevalier mit der ihm gewohnten Zuvorkommenheit. Mein Schweizer sagt ihm, ich wäre krank, läßt ihn nicht ein und übergibt ihm gleichzeitig ein Billett von mir, aber nicht mit meiner Handschrift. Er öffnet es und findet von der Hand Viktorias geschrieben: »Punkt 9 Uhr auf dem Boulevard vor den Cafés.« Er begibt sich dorthin und findet da einen kleinen Lakai, den er nicht zu kennen scheint, – natürlich wieder Viktoria, die ihm sagte, er möge nur seinen Wagen fortschicken und ihr folgen. Die ganze romantische Geschichte macht ihm einen heißen Kopf, und ein heißer Kopf ist immer gut. Endlich kommt er an: Liebe und Überraschung machen ihn ganz trunken, und er ist entzückend. Die Zeit, die ihn wieder ein wenig restaurieren soll, gehen wir im Garten spazieren, und dann bringe ich ihn ins Haus zurück, wo er zwei Gedecke und das offene Bett sieht. Im Boudoir, das in all seinem Glanze strahlte, schlinge ich halb bedacht und halb gedrängt meine Arme um seinen Hals und lasse mich zu seinen Füßen niedersinken: »Um dir, mein Lieber, die Überraschung dieses Augenblickes zu bereiten, habe ich die schlechte Laune geheuchelt und dich damit betrübt; verzeih mir, ich will alles durch die Macht meiner Liebe wieder gut machen.« Sie können sich die Wirkung dieser zärtlichen Rede wohl vorstellen. Der glückliche Chevalier hob mich auf, und wir besiegelten unsere Versöhnung auf derselben Ottomane, auf der wir beide, Sie und ich, in der gleichen Weise unsere ewige Trennung beschlossen haben.
Sechs Stunden hatten wir vor uns; ich hatte mir vorgenommen, daß diese Zeit ihm immer gleich entzückend bleiben sollte, und mäßigte daher seine Stürme mit liebenswürdiger Koketterie. Niemals, glaube ich, habe ich so viel Sorge darauf verwandt, zu gefallen, und ich war wirklich sehr zufrieden mit mir. Nach dem Souper spielte ich abwechselnd das Kind und die vernünftige Frau, war bald übermütig, bald empfindsam, manchmal sogar ausschweifend – es machte mir Spaß, ihn wie einen Sultan in seinem Harem zu nehmen, in dem ich die verschiedenen Favoritinnen spielte. Alles kam von einer und derselben Frau und mußte ihm doch scheinen, als käme jedes Vergnügen von einer neuen Geliebten. Der Tag brach an und wir mußten uns trennen; und was er auch tat und sagte, um mich vom Gegenteil zu überzeugen, er bedurfte doch der Ruhe ebenso stark, als ihm die Lust dazu fehlte. Wir gingen, und zum Abschied übergab ich ihm den Schlüssel zu diesem glücklichen Ort der Liebe und sagte ihm noch: »Ich hatte ihn allein für Sie, und es ist nur gerecht, daß Sie Herr darüber sind: der Opferpriester gebietet über den Tempel.« Dadurch kam ich geschickt seinen Nachgedanken zuvor, wie ich wohl in den verdächtigen Besitz eines solchen kleinen Hauses komme. Ich kenne ihn zur Genüge, um dessen sicher zu sein, daß er nur für mich von dem Schlüssel Gebrauch macht; und wenn meine Laune mir gebieten sollte, ohne den Chevalier hinzugehen, habe ich immer noch einen zweiten Schlüssel. Er wollte gleich wieder einen bestimmten Tag für das nächste mal haben, aber ich liebe ihn noch zu sehr, um ihn so rasch abzunützen. Man soll sich ein Übermaß nur mit jenen Männern erlauben, die man rasch wieder aufgeben will. Er weiß das nicht, aber zum Glück für ihn weiß ich das für uns beide.
Eben bemerke ich, daß es drei Uhr in der Früh ist, und ich einen Band schreibe, wo ich nur ein paar Worte schreiben wollte. Das ist der Reiz der mitteilsamen Freundschaft; und die macht es, daß Sie immer derjenige sind, den ich am meisten liebe; in Wirklichkeit aber ist es der Chevalier, der mir besser gefällt.
Paris, den 12. August 17..
Elfter Brief
Die Präsidentin von Tourvel an Frau von Volanges.
Ihr ernster mahnender Brief hätte mich erschreckt, gnädige Frau, wenn ich nicht zum Glück hier mehr Gründe für meine Sicherheit fände, als Sie mir für die Angst gaben. Dieser gefürchtete Herr von Valmont, der der Schrecken der ganzen Frauenwelt sein soll, scheint seine mörderischen Waffen abgelegt zu haben, ehe er dieses Schloß betrat. Weit entfernt davon, mit Pretensionen hierher gekommen zu sein, hat er nicht einmal die Absicht dazu mitgebracht; und selbst seine Eigenschaft, ein liebenswürdiger Mann zu sein, was ihm selbst seine Feinde zugestehen, verschwindet hier fast, um ihn nur als einen guten Jungen zu zeigen. Vielleicht hat die Landluft dieses Wunder an ihm bewirkt. Wessen ich Sie versichern kann, – und er ist fast immer mit mir zusammen, und es scheint ihm meine Gesellschaft zu gefallen – ist, daß ihm niemals ein Wort entschlüpft ist, das auch nur entfernt der Liebe ähnlich sähe, nicht eine jener Phrasen, die sich doch alle Männer erlauben, und Männer, die nicht, wie er, das besitzen, was sie dazu berechtigen könnte. Niemals fühlte ich mich bei ihm zu jener Zurückhaltung genötigt, zu der jede Frau sich gezwungen fühlt, die sich respektiert, um die Männer, die sie umgeben, in den gebührenden Schranken zu halten. Er mißbraucht auch die Lustigkeit nicht, die er zu erwecken versteht. Er ist vielleicht ein bißchen Schmeichler, aber er sagt das mit so viel Delikatesse, daß sich sogar die Bescheidenheit selber an sein Lob gewöhnen kann. Hätte ich einen Bruder, ich wünschte ihn mir so, wie Herr von Valmont sich hier zeigt. Vielleicht würden sich viele Frauen eine deutlichere Galanterie von ihm wünschen, ich gestehe, daß ich ihm dafür sehr dankbar bin, daß er mich so gut beurteilen lernte, mich mit jenen Frauen nicht zu verwechseln.
Dieses Bild weicht sichtlich sehr von jenem ab, das Sie mir von Valmont entwarfen, und trotzdem können beide richtig sein, jedes für seine Zeit. Er selbst gibt zu, sehr viel Schlechtigkeiten begangen zu haben, einige wird man ihm auch noch andichten, aber ich bin wenigen Männern begegnet, die mit solchem Respekt, fast möchte ich sagen Begeisterung von den anständigen Frauen sprachen wie er. Sie sagen mir, daß er wenigstens in diesem einen Punkte nicht betrügt. Sein Verhältnis zu Madame von Merteuil ist ein Beweis dafür. Er erzählt viel von ihr, und in so hohen Ausdrücken des Lobes und treuer Anhänglichkeit, daß ich, bevor Ihr Brief ankam, glaubte, was er Freundschaft zwischen ihnen nannte, in Wirklichkeit Liebe wäre. Ich muß mich dieser verwegenen Meinung anklagen, die um so unrechter von mir war, als er sie selbst oft zu widerlegen suchte. Ich gestehe, lange glaubte ich, es geschähe das nur aus Klugheit, was, wie ich nun weiß, ehrlichste Aufrichtigkeit seinerseits war. Ich weiß es ja nicht genau, aber mir scheint, daß, wenn ein Mann einer andauernden Freundschaft für eine schätzenswerte Frau fähig ist, dieser Mann kein unverbesserlicher Wüstling sein kann. Im übrigen weiß ich nicht, ob er seinen Aufenthalt hier einer Liebesgeschichte in der Umgebung wegen genommen hat, wie Sie glauben. Es gibt wohl einige liebenswürdige Frauen in der Nachbarschaft, aber er geht wenig aus, höchstens des Morgens in der Früh', und da sagt er, daß er auf die Jagd geht. Es ist wahr, er bringt selten Wild heim; aber er versichert, daß er ein ungeschickter Jäger sei. Im übrigen kümmert mich wenig, was er außerhalb des Schlosses macht; und wenn ich es wissen möchte, so wäre es nur, um einen Grund mehr zu haben, mich entweder Ihrer Meinung zu nähern oder Sie zu der meinen zu bekehren.
Dieser Vorschlag, den Sie mir machen, darauf hinzuarbeiten, daß Herr von Valmont seinen Aufenthalt hier abkürzt, das scheint mir etwas schwierig bei seiner Tante durchzusetzen, die ihren Neffen sehr liebt. Ich verspreche Ihnen aber, es zu versuchen, nicht aus meinem Bedürfnis heraus, sondern um Ihnen zu dienen; ich werde also die Gelegenheit wahrnehmen, sei es bei der Tante, oder bei ihm selbst. Was mich betrifft, so nimmt Herr von Tourvel an, daß ich bis zu seiner Rückkunft hier bleibe, und er würde, und mit Recht, anders sehr erstaunt darüber sein, wie leicht ich meine Pläne ändere.
Das sind lange Auseinandersetzungen, gnädige Frau, aber ich glaubte um der Wahrheit wegen, Herrn von Valmont ein besseres Zeugnis geben zu müssen, dessen er, wie mir scheint, bei Ihnen sehr bedarf. Ich schätze darum die Freundschaft nicht geringer, die Sie ja allein veranlaßte, mir die guten Ratschläge zu geben. Ihrer Freundschaft verdanke ich ja auch alles Verbindliche, das Sie mir betreffs des Aufschubes der Hochzeit sagen, und ich danke Ihnen aufrichtig dafür. So groß auch das Vergnügen, diese festliche Zeit mit Ihnen zu verbringen, sein wird, ich würde es gerne dem Wunsche von Fräulein von Volanges opfern, schon früher glücklich zu sein, – wenn Sie es je mehr sein kann als in der Nähe einer Mutter, die wie Sie ihrer Zärtlichkeit und ihrer Achtung so würdig ist.
Ich teile mit ihr diese beiden Empfindungen, die mich an Sie fesseln, und bitte diese Versicherung mit Güte entgegenzunehmen. Ich bin in Ehrfurcht . . .
Schloß . . ., den 13. August 17..
Zwölfter Brief
Cécile Volanges an die Marquise von Merteuil.
Mama ist unwohl, gnädige Frau, sie kann nicht ausgehen und ich muß ihr Gesellschaft leisten, weshalb ich nicht die Ehre haben kann, Sie in die Oper zu begleiten. Ich versichere Ihnen, ich bedaure es mehr, nicht bei Ihnen sein zu können, als die Vorstellung zu versäumen, und ich bitte Sie, davon überzeugt zu sein. Ich liebe Sie sehr. Wollen Sie gefälligst dem Herrn Chevalier von Danceny sagen, daß ich diese Lieder nicht habe, von denen er mit mir sprach, und wenn er sie mir morgen bringen könnte, würde es mich sehr freuen. Käme er heute, so würde man ihm sagen, daß wir nicht zu Hause sind, weil Mama niemanden empfangen will. Ich hoffe, sie wird sich morgen wieder wohl fühlen.
Paris, den 13. August 17..
Dreizehnter Brief
Die Marquise von Merteuil an Cécile Volanges.
Ich bin sehr betrübt, mein schönes Fräulein, des Vergnügens beraubt zu sein, Sie zu sehen, und um dessen Ursache wegen. Ich hoffe, diese Gelegenheit wird sich sehr bald wiederfinden. Ich werde dem Chevalier Danceny Ihren Auftrag bestimmt ausrichten; er wird gewiß über die Erkrankung Ihrer Mama sehr betrübt sein. Wenn sie mich morgen empfangen will, werde ich ihr gern Gesellschaft leisten. Wir wollen dann zusammen den Chevalier von Belleroche im Piquet attakieren, und wir würden außer dem Vergnügen, ihm sein Geld abzugewinnen, auch noch dieses haben, Sie mit Ihrem liebenswürdigen Meister singen zu hören, dem ich das vorschlagen werde. Wenn das Ihrer Mama und Ihnen paßt, so stehe ich für mich und meine beiden Chevaliers. Adieu, meine Schöne, und meine Empfehlungen der lieben Frau von Volanges. Ich küsse Sie zärtlichst.
Paris, 13. August 17..
Vierzehnter Brief
Cécile Volanges an Sophie Carnay.
Ich habe Dir gestern nicht geschrieben, meine liebe Sophie, aber ich versichere Dir, das Vergnügen war nicht Schuld daran. Mama war krank, und ich verließ sie den ganzen Tag über nicht. Als ich mich abends zurückzog, hatte ich zu nichts mehr Lust und ich legte mich sehr schnell zu Bett, um die Überzeugung zu bekommen, daß der Tag wirklich zu Ende sei; niemals erschien mir ein Tag so lang. Nicht daß ich Mama nicht liebte, aber ich weiß nicht was es war. Ich sollte mit Frau von Merteuil in die Oper gehen und der Chevalier Danceny sollte mit dabei sein. Du weißt wohl, daß die beiden meine liebsten Menschen sind. Als die Stunde kam, zu der ich da sein sollte, zog sich mir das Herz zusammen, ganz wider Willen. Da ärgerte ich mich über alles und weinte und weinte ohne Aufhören. Glücklicherweise lag Mama zu Bett und konnte mich nicht hören. Ich bin sicher, der Chevalier Danceny war auch traurig; aber er wird sich im Theater und an den vielen Leuten da zerstreut haben, und das ist schon etwas anderes.
Zum Glück geht es Mama heute wieder besser, und Frau von Merteuil wird kommen mit einem Herrn und dem Chevalier Danceny; aber sie kommt immer erst so spät, und es ist so langweilig, wenn man allein ist und wartet.
Es ist erst elf Uhr. Es ist wahr, ich muß noch etwas Harfe spielen und meine Toilette wird mich noch etwas Zeit kosten, denn ich will heute schön sein. Ich glaube, Mutter Perpetua hat Recht, daß man kokett wird, sobald man in die Welt tritt. Ich habe noch niemals solche Lust gehabt, hübsch auszusehen, als seit einigen Tagen, und ich finde, daß ich nicht so hübsch bin, wie ich zu sein glaubte; dann verliert man auch an Farbe neben allen den Frauen, die sich schminken. Bei Frau von Merteuil zum Beispiel bemerke ich ganz gut, daß sie sie alle schöner finden als mich, aber das betrübt mich nicht sehr, denn sie hat mich sehr gern. Auch versichert sie mir, daß der Chevalier von Danceny mich schöner findet als sie. Das ist doch ehrlich von ihr, mir das zu sagen, nicht? Es schien ihr sogar Vergnügen zu machen. Das zum Beispiel verstehe ich aber nicht. Sie muß mich doch sehr lieb haben! Und er! . . . o! Du ahnst nicht, wie mir das Freude macht! Dann scheint es mir immer, daß ihn anzusehen schon allein genügt, um schöner zu werden. Ich würde ihn immer ansehen, wenn ich nicht fürchtete, seinen Blicken zu begegnen; denn jedesmal, wenn mir das passiert, verliere ich ganz meine Fassung und das tut mir weh; aber das macht nichts. Adieu, meine liebe Freundin; ich will Toilette machen. Ich liebe Dich wie immer.
Paris, den 14. August 17..
Fünfzehnter Brief
Der Vicomte von Valmont an die Marquise von Merteuil.
Das ist wirklich hübsch von Ihnen, daß Sie mich in meinem traurigen Schicksal nicht verlassen. Das Leben, das ich hier führe, ist wirklich ermüdend, – nichts als stille Ruhe und eine tödliche Einförmigkeit. Während ich in Ihrem Briefe die Details Ihres reizenden Tages las, war ich zwanzigmal versucht, irgendein Geschäft vorzugeben und vor Ihre Füße zu fliegen, um da die Gunst der Untreue an Ihrem Chevalier zu erbitten, der trotz allem und allem soviel Glück nicht verdient. Wissen Sie, daß Sie mich eifersüchtig auf ihn machten? Was erzählen Sie mir da von einer ewigen Trennung! Ich verleugne diesen Schwur, den ich in Sinnlosigkeit tat; wir wären ja nicht würdig gewesen ihn zu schwören, wenn wir ihn hätten halten müssen. Ach, daß ich mich eines Tages in Ihren Armen an dem unbehaglichen Gefühl, das mir das Glück des Chevaliers bereitet, rächen könnte! Ich gestehe, ich bin wütend, wenn ich an diesen Menschen denke, der ohne zu denken und mühelos, nur blöd und dumm dem Instinkt seines Herzens folgend, ein Glück findet, das ich nicht erreichen kann. Aber ich werde es ihm nehmen. Versprechen Sie mir, daß ich es ihm nehmen werde. Und Sie selbst, fühlen Sie sich gar nicht erniedrigt?
Sie geben sich die Mühe ihn zu betrügen und er ist glücklicher als Sie. Sie glauben ihn in Ihren Ketten zu haben, und Sie sind es, die in den seinen liegt. Er schläft ruhig, während Sie über sein Vergnügen wachen. Was mehr würde sein letzter, Bedienter für ihn tun? Sehen Sie, meine schöne Freundin, wenn Sie sich unter viele teilen, bin ich nicht eine Spur eifersüchtig; denn da sehe ich in Ihren Liebhabern nur die Nachfolger Alexanders, denen es allen nicht möglich ist, das Reich zu halten, das ich allein regierte. Aber daß Sie sich einem von ihnen vollständig ergeben, daß noch ein Mann existieren soll so glücklich wie ich, – das dulde ich nicht, und glauben Sie nicht, daß ich es dulden werde. Entweder nehmen Sie mich wieder, oder Sie nehmen einen anderen und verraten nicht wegen einer Laune die unwandelbare Freundschaft, die wir uns geschworen haben.
Bei Gott, ich habe mich gerade genug über die Liebe zu beklagen: woraus Sie sehen, daß ich mich Ihren Anordnungen füge und meinen Irrtum bekenne. Ja, wenn das wirklich verliebt sein heißt: nicht ohne den Besitz dessen, was man wünscht, leben können, seine Zeit dafür opfert, sein Vergnügen, sein Leben, ja, dann bin ich wirklich und wahrhaftig verliebt. Ich bin nicht um einen Schritt weiter gekommen. Ich hätte Ihnen in dieser Hinsicht gar nichts Neues mitzuteilen, wäre nicht etwas eingetreten, das mir viel zu denken gibt und von dem ich noch nicht weiß, ob ich etwas befürchten oder etwas hoffen soll.
Sie kennen meinen Jäger, ein Juwel der Intrigue, ein wahrhafter Kammerdiener der Komödie. Sie können sich denken, daß seine Aufgabe diese war, sich in die Kammerjungfer zu verlieben und die Dienerschaft betrunken zu machen. Der Spitzbube ist glücklicher als ich, denn ihm gelang es. Und er hat herausgebracht, daß Frau von Tourvel einen ihrer Leute damit beauftragte, Erkundigungen über mein Leben hier einzuziehen und mir sogar auf meinen morgendlichen Spaziergängen, soweit wie möglich, unmerklich zu folgen. Welches Recht nimmt sich diese Frau? Sie, die Bescheidenste unter allen, wagt Dinge, die wir uns kaum erlauben! . . . Was sagen Sie dazu? . . . Bevor ich aber die Rache an dieser Weibeslist bedenke, suche ich nach dem Mittel, mir diese List nützlich zu machen. Bisher hatten diese meine verdächtigen Spaziergänge keine besonderen Ursachen, geben wir ihnen also welche. Das verlangt jetzt meine ganze Aufmerksamkeit und ich verlasse Sie, um darüber nachzudenken. Adieu, meine schöne Freundin,
Immer noch Schloß . . ., den 15. August 17..
Sechzehnter Brief
Cécile Volanges an Sophie Carnay.
Ach, meine Sophie, ich habe Neuigkeiten! Eigentlich darf ich sie nicht sagen, aber ich muß mit jemandem darüber sprechen, es ist stärker als ich. Dieser Danceny . .. ich bin so aufgeregt, daß ich gar nicht schreiben kann. Ich weiß nicht womit beginnen. Also seitdem ich Dir von jenem reizenden Abend erzählte, den ich bei Mama mit ihm und Frau von Merteuil verbrachte, habe ich Dir nichts mehr von ihm erzählt; ich wollte mit niemand mehr darüber sprechen, aber gedacht hab ich immer daran. Seit der Zeit also ist er so traurig geworden, so traurig, aber so traurig, daß es mir sehr weh tat. Als ich ihn fragte warum, antwortete er immer, nein, er sei nicht; aber ich sah es doch ganz deutlich. Endlich gestern war es noch schlimmer als sonst; und jedesmal, wenn er mich ansah, schnürte es mir die Kehle zusammen; er hatte aber trotzdem die Gefälligkeit, mit mir zu singen ganz wie gewöhnlich. Wir hatten gesungen, er schloß meine Harfe in ihr Etui, und indem er mir den Schlüssel gab, bat er mich, sobald ich allein wäre den Abend, noch einmal zu spielen. Ich dachte an nichts weiter und hatte auch gar nicht einmal Lust dazu; er bat mich aber so lange, bis ich ja sagte. Er mußte aber seinen Grund dafür haben. Und wirklich, als ich am Abend allein und mein Kammermädchen hinausgegangen war, holte ich meine Harfe hervor, und – fand in den Saiten einen unversiegelten, nur zusammengelegten Brief von ihm! Ach! wenn Du wüßtest was er mir alles schreibt! Seitdem ich diesen Brief gelesen habe, bin ich so... so voller Freude, daß ich an nichts anderes mehr denken kann. Viermal habe ich ihn immer wieder durchgelesen, und dann habe ich ihn in meinen Schreibtisch gesperrt. Ich kann ihn auswendig. Und im Bett wiederholte ich mir ihn Wort für Wort, so daß ich nicht einschlafen konnte. Sobald ich die Augen schloß, stand er vor mir und sagte mir selber alles, was ich soeben gelesen hatte. Ich schlief so erst sehr spät ein. Wie ich aufwachte – es war ganz früh am Morgen – holte ich gleich den Brief hervor, um ihn nochmals nach Herzenslust zu lesen. Ich nahm ihn mit ins Bett und küßte ihn, als wenn... Es ist vielleicht unrecht von mir, einen Brief so zu küssen, aber ich konnte nicht anders.
Jetzt, meine liebe Freundin, so sehr glücklich ich mich auch fühle, so sehr bin ich auch in Verlegenheit. Soll ich auf diesen Brief antworten? Ich weiß, daß sich das nicht schickt, und doch verlangt er es von mir; und wenn ich es nicht tue, so weiß ich, wird er traurig sein. Es ist ja auch so betrübend für ihn! Was rätst Du mir? Aber Du wirst auch nicht mehr wissen als ich. Ich habe Lust, Frau von Merteuil darüber zu fragen, ich weiß, wie sehr sie mich liebt. Ich möchte ihn trösten und doch auch nichts tun, was Unrecht wäre.
Man sagt uns immer, wir sollen ein gutes Herz haben, und dann verbietet man uns wieder, dem guten Herzen zu folgen, sowie es einen Mann betrifft – das ist doch nicht ganz gerecht. Ist denn ein Mann nicht auch unser Mitmensch ganz so wie eine Frau und vielleicht noch mehr? Denn man hat doch einen Vater und eine Mutter, einen Bruder und eine Schwester. Und dann ist doch auch noch der Gatte. Und doch, wenn ich etwas tun würde, was nicht ganz recht wäre, vielleicht würde Herr von Danceny selbst seine gute Meinung von mir verlieren? Da wäre es mir doch noch lieber, daß er traurig bleibt; und vielleicht bringt es die Zeit. Wenn er gestern geschrieben hat, deshalb brauche ich doch heute nicht gleich antworten. Dann sehe ich Frau von Merteuil noch heute abend, und wenn ich dann den Mut dazu habe, so werde ich ihr alles erzählen. Wenn ich das tue, was sie mir rät, so werde ich mir nichts vorzuwerfen haben. Vielleicht rät sie mir, ihm etwas zu schreiben, damit er nicht mehr gar so traurig ist! Ich bin recht unglücklich.
Adieu, meine liebe Freundin. Sage mir jedenfalls, wie Du darüber denkst.
Paris, den 19. August 17..
Siebzehnter Brief
Der Chevalier Danceny an Cécile Volanges.
Mein Fräulein! Ehe ich dem Vergnügen oder dem Bedürfnisse, Ihnen zu schreiben, nachgebe, bitte ich Sie, mich gnädig anhören zu wollen. Ich fühle, ich bedarf der Nachsicht, wenn ich es wage, Ihnen meine Gefühle auszudrücken – der Brief wäre unnötig, wenn ich sie nur rechtfertigen wollte. Was kann ich Ihnen anderes zeigen als das, was Sie aus mir gemacht haben? Was habe ich Ihnen noch zu sagen, als das, was meine Blicke, meine Erregung, mein Benehmen und selbst mein Stillschweigen Ihnen noch nicht gesagt hätten? Warum sollten Sie sich über ein Gefühl betrüben, das Sie selbst heraufbeschworen haben? Von Ihnen ist es ausgegangen, und würdig, Ihnen dargebracht zu werden; und wenn es brennend ist wie meine Seele, so ist es auch ebenso rein wie die Ihre. Ist es ein Verbrechen, Ihre entzückende Gestalt zu lieben, Ihre verführerischen Talente, Ihre bezaubernde Anmut, und jene rührende Unschuld, die allen diesen schon so wertvollen Eigenschaften noch das Wertvollste gibt? Nein, sicher nicht. Aber ohne schuldig zu sein, kann man doch unglücklich sein, und dieses ist mein Los, wenn Sie sich meine Huldigung verbieten. Sie sind die erste, der mein Herz sie darbringt. Ohne Sie wäre ich, wenn auch nicht glücklich, so doch ruhig. Ich sah Sie, und von der Stunde floh die Ruhe von mir und schwankt mein Geschick. Und doch wundern Sie sich über meine Traurigkeit und fragen nach der Ursache, ja manchmal glaubte ich, daß Sie sich darüber betrübten. Ach! sagen Sie ein Wort, und meine Seligkeit wird Ihr Werk sein. Aber, bevor Sie es aussprechen, bedenken Sie, daß ein Wort mich unglücklich machen kann. Sie halten mein Schicksal. Durch Sie werde ich auf ewig glücklich oder ewig unglücklich sein, und – in welch liebere Hände könnte ich diese große Entscheidung legen?
Ich schließe den Brief, wie ich ihn angefangen habe: Ich bat um Nachsicht, und daß Sie mich anhören möchten; ich wage noch mehr: ich bitte Sie, mir zu antworten. Wenn Sie das nicht tun, so nehme ich an, daß Sie sich beleidigt fühlen, mein Herz aber bürgt mir dafür, daß meine Achtung meiner Liebe gleichkommt.
P. S. Sie können mir auf dieselbe Art antworten, derer ich mich bediene, Ihnen den Brief zukommen zu lassen; sie scheint mir ebenso sicher wie bequem.
den 18. August 17..
Achtzehnter Brief
Cécile Volanges an Sophie Carnay.
Wie, Sophie, Du mißbilligst schon im voraus was ich tun werde? Ich hatte mir schon so genug Sorgen gemacht und nun vermehrst Du sie noch. Du sagst, es wäre ganz klar, daß ich nicht antworten dürfe. Du hast leicht reden, denn Du weißt nicht genau, worum es sich handelt; Du bist nicht da, um das alles zu sehen. Ich bin überzeugt, daß Du es genau so machen würdest wie ich, wenn Du an meiner Stelle wärst. Gewiß, für gewöhnlich soll man nicht antworten, und Du siehst aus meinem gestrigen Brief, daß ich es auch nicht wollte; aber ich glaube nicht, daß sich je irgend jemand in einer solchen Lage befunden hat wie ich.
Dazu noch verurteilt zu sein, ganz allein einen Entschluß zu fassen! Frau von Merteuil sollte gestern abend kommen und kam nicht. Alles kehrt sich gegen mich. Sie ist die Ursache, daß ich ihn kennen lernte, ich habe ihn beinahe immer mit ihr gesehen, und in ihrer Gegenwart habe ich mit ihm gesprochen. Ich nehme ihr das ja nicht übel; aber daß sie mich jetzt in meiner Verlegenheit im Stiche läßt ... O! wie bin ich zu bedauern! Stelle Dir vor, er kam gestern wie gewöhnlich. Ich traute mich kaum ihn anzusehen, so sehr verwirrt war ich. Er konnte nicht mit mir sprechen, weil Mama dabei war. Ich bezweifelte nicht, daß er sehr böse sein würde, wenn er die Entdeckung machen wird, daß ich nicht geschrieben hatte. Ich wußte gar nicht, wie ich mich benehmen sollte. Bald nachher fragte er mich, ob er mir meine Harfe bringen dürfte. Mein Herz klopfte so heftig, daß ich nichts anderes sagen konnte als ja. Als er zurückkam, war es noch schlimmer. Ich sah nur ganz schnell zu ihm hinüber. Er sah mich nicht an, aber er sah aus, als wenn er krank wäre. Das tat mir furchtbar leid. Jetzt stimmte er meine Harfe, und als er sie mir brachte, sagte er: O, mein Fräulein... – Nur diese zwei Worte, aber mit einem Ton, daß ich ganz weg war. Ich spielte ohne zu wissen was ich tat. Mama fragte, ob wir denn nicht singen würden. Er entschuldigte sich mit etwas Unwohlsein, und ich, mir fiel keine Ausrede ein, und ich mußte singen. Lieber hätte ich keine Stimme gehabt! Ich suchte ein Lied aus das ich nicht konnte; denn ich war überzeugt, daß ich nicht singen könnte, und bei einem andern Lied hätte man etwas gemerkt. Glücklicherweise kam ein Besuch; sobald ich hörte, daß ein Wagen vorgefahren war, hörte ich auf und bat den Chevalier, die Harfe wieder zurückzutragen. Ich hatte Angst, daß er bei der Gelegenheit fortgehen würde, aber er kam wieder zurück.
Während Mama sich mit dieser Dame unterhielt, wollte ich ihn ein wenig ansehen. Ich begegnete seinem Blick, und ich konnte die meinen nicht davon wegbringen. Bald darauf sah ich, daß er Tränen in den Augen hatte, und er mußte sich umdrehen, damit man es nicht sah.
Da konnte ich nicht mehr an mir halten, ich fühlte, daß ich auch zu weinen anfing. Ich ging hinaus und schrieb schnell mit Bleistift auf ein Stück Papier: »Seien Sie doch nicht so traurig, ich bitte darum; ich verspreche zu antworten.« Da kannst Du doch nicht sagen, daß da ein Unrecht dabei ist; es war eben stärker als ich. Ich steckte mein Papier in die Saiten meiner Harfe, genau so, wie sein Brief gesteckt hat und kam in den Salon zurück. Ich fühlte mich ruhiger. Ich wünschte, daß die Dame schon fortginge – glücklicherweise war sie nur so eine Visite, und sie ging auch bald. Kaum war sie fort, sagte ich, daß ich meine Harfe wieder haben möchte und bat ihn, sie wieder zu holen. Ich sah ihm wohl an, daß er an nichts dachte. Aber als er zurückkam, – wie war er froh! Indem er die Harfe vor mich hinsetzte, stellte er sich so, daß Mama ihn nicht sehen konnte, und drückte meine Hand... aber wie er sie drückte!... Es war nur ein Augenblick, doch was ich dabei empfand, kann ich Dir nicht beschreiben. Ich zog aber meine Hand zurück und habe mir so nichts vorzuwerfen.
Jetzt siehst Du, meine liebe Freundin, daß ich doch nicht anders kann, als ihm schreiben, da ich es ja versprochen habe; und ich will ihm auch keinen Kummer mehr machen, weil ich mehr darunter leide als er. Wenn es etwas Schlimmes wäre, würde ich es gewiß nicht tun. Worin kann das Unrecht bestehen, zu schreiben, wenn es jemanden verhindert unglücklich zu sein? Was mich etwas in Verlegenheit bringt ist nur, daß ich nicht recht weiß, wie den Brief schreiben; aber er wird schon fühlen, daß das nicht meine Schuld ist; dann glaube ich auch sicher, daß es genügt, daß er von mir kommt, und es wird ihm Freude machen.
Adieu, meine liebe Freundin. Wenn Du findest, daß ich im Unrecht bin, so sage es mir; aber ich glaube es nicht. Mit jeder Minute meinem Brief an ihn näher, schlägt mein Herz stärker. Aber ich muß es; denn ich habe es versprochen. Adieu.
Paris, den 20. August 17..
Neunzehnter Brief
Cécile Volanges an den Chevalier Danceny.
Sie waren gestern so traurig, und das tut mir so leid, daß ich mich hinreißen ließ, Ihnen zu versprechen, den Brief zu beantworten, den Sie mir geschrieben haben. Ich fühle heute nicht weniger, daß ich es eigentlich nicht tun sollte. Da ich es jedoch versprochen habe, so will ich mein Wort halten, und das soll Ihnen die Freundschaft beweisen, die ich für Sie empfinde. Jetzt, da Sie dies wissen, hoffe ich, daß Sie von mir nicht verlangen werden, daß ich mehr schreibe. Auch hoffe ich, daß Sie niemandem sagen werden, daß ich Ihnen geschrieben habe, denn das würde man mir sicher übelnehmen, was mir viel Kummer bereiten könnte. Besonders hoffe ich, daß Sie selbst deshalb nicht schlecht über mich denken werden, was mir von allem das Ärgste wäre. Ich will Ihnen noch versichern, daß ich keinem andern als Ihnen diese Gefälligkeit erwiesen hätte. Ich wollte, Sie erwiesen mir jene, nicht mehr traurig zu sein, so wie Sie es die Zeit über waren, was mir jede Freude Sie zu sehen nimmt. Sie sehen, daß ich aufrichtig mit Ihnen bin. Ich wünsche nichts sehnlichster, als daß unsere Freundschaft ewig wäre; aber ich bitte Sie, schreiben Sie mir nicht mehr. Cécile Volanges.
den 20. August 17..
Zwanzigster Brief
Die Marquise von Merteuil an den Vicomte von Valmont.
Sie Schelm! Sie schmeicheln mir aus Angst, daß ich Sie auslache! Nun – ich will gnädig sein. Sie schreiben mir so viel Verrücktes, daß ich Ihnen um der Sittsamkeit willen verzeihen muß, in der Sie Ihre Präsidentin erzieht. Ich glaube nicht, daß mein Chevalier so viel Rücksicht nehmen würde wie ich; er wäre Mannes genug, unsern erneuerten Vertrag nicht zu billigen und auch nicht viel Spaßhaftes in Ihrer verrückten Idee zu finden. Ich habe aber doch sehr darüber gelacht, und es tat mir leid, daß ich allein darüber lachen mußte. Wenn Sie dagewesen wären, weiß ich nicht, wohin diese Lustigkeit geführt hätte; aber so habe ich Zeit zum Überlegen gehabt und habe mich mit Strenge gepanzert. Nicht daß ich mich für immer verweigere, aber ich mache Schwierigkeiten und habe Recht. Vielleicht ist das Eitelkeit, und man weiß, einmal an das Spiel gewohnt, nicht mehr, wo man damit aufhören soll. Ich traue mir zu, Sie wieder in meine Fesseln zu schlagen, und Sie Ihre Präsidentin vergessen zu machen; wenn ich Unwürdige Sie aber vom Weg der Tugend ablenkte, was wäre das für ein Skandal! Um also diese Gefahr zu vermeiden, hören Sie meine Bedingungen.
Sobald Sie Ihre schöne Betschwester gehabt haben werden, und Sie mir einen Beweis dafür erbringen können, dann kommen Sie, und ich gehöre Ihnen. Vergessen Sie aber nicht, daß in wichtigen Dingen nur schriftliche Beweise wirkliche Beweise sind. Auf diese Art werde ich statt Trostmittel Belohnung, was mir sehr gefällt, und auf der andern Seite wird Ihr Erfolg um so pikanter sein, da er selbst das Mittel zur Untreue wird. Kommen Sie also so schnell als möglich und mit allen Zeichen Ihres Triumphes, unseren fahrenden Rittern von ehemals ähnlich, die ihren Damen die glänzenden Früchte ihrer Siege zu Füßen legten. Ganz ernsthaft: ich bin wirklich neugierig zu erfahren, was eine so fromme Frau nach einem solchen Augenblick schreiben kann, und was für Schleier sie über ihre Rede legt, nachdem sie keinen mehr auf ihrem Körper gelassen hat. Bei Ihnen steht die Entscheidung, ob ich mich zu hoch einschätze, aber das sage ich Ihnen gleich, daß es nichts daran zu handeln gibt. Bis dahin werden Sie, mein lieber Vicomte, sich damit abfinden müssen, daß ich dem Chevalier treu bleibe und daß ich ihn glücklich mache, trotz des kleinen Kummers, den Ihnen das bereitet.
Hätte ich jedoch weniger Moral, so glaubte ich, er hätte jetzt einen gefährlichen Rivalen in der kleinen Volanges. Ich bin ganz vernarrt in das Kind; es ist eine wirkliche Leidenschaft. Ich kann mich ja irren, aber ich glaube, sie wird eine unserer gesuchtesten Frauen werden. Ich sehe, wie ihr kleines Herz sich entwickelt, und das ist ein entzückendes Schauspiel. Schon liebt sie ihren Danceny höchst ungestüm, aber sie weiß noch nichts davon. Und er, obschon sehr verliebt, besitzt noch ganz die Schüchternheit seines Alters, und wagt noch nichts. Alle beide beten mich an, und besonders die Kleine hat große Lust, mir alles anzuvertrauen; seit einigen Tagen ist sie ganz davon bedrückt, und ich hätte ihr einen großen Dienst erwiesen, wenn ich ihr dabei geholfen hätte; aber ich vergesse nicht, daß sie ein Kind ist, und ich will mich nicht kompromittieren. Danceny dagegen hat etwas klarer mit mir gesprochen, aber für ihn bin ich fest: ich will ihn nicht anhören. Was die Kleine betrifft, so fühle ich mich oft versucht, meine Schülerin aus ihr zu machen, – ein Dienst, den ich Gercourt gern erweisen möchte. Er läßt mir, ja auch Zeit dazu, denn er bleibt auf Korsika bis Oktober, und ich will diese Zeit ausnutzen und hoffe, ihm eine fertige Frau geben zu können, statt seines erträumten unschuldigen Mädchens aus der Pension. Es ist doch wirklich eine unverschämte Sicherheit, mit der dieser Mensch ruhig zu schlafen wagt, während sich eine Frau noch nicht gerächt hat, die allen Grund hat, sich über ihn zu beklagen. Sehen Sie, wäre die Kleine jetzt im Augenblick bei mir, ich weiß nicht, was ich ihr nicht alles sagen würde.
Adieu, Vicomte. Gute Nacht und guten Erfolg; aber um Gottes willen kommen Sie endlich vorwärts. Bedenken Sie, wenn Sie diese Frau nicht erobern, müßten alle andern erröten, die Sie besessen haben.
Paris, den 20. August 17..
Einundzwanzigster Brief
Der Vicomte von Valmont an die Marquise von Merteuil.
Endlich, meine schöne Freundin, komme ich einen Schritt vorwärts, und einen großen Schritt, der, wenn er mich auch nicht ans Ziel, so doch auf den richtigen Weg führte, und die Angst zerstörte, daß ich mich auf einem falschen verirrt hätte. Ich habe endlich meine Liebe gestanden, und obschon man das eigensinnigste Stillschweigen bewahrte, so bekam ich doch die unerwartetste und schmeichelhafteste Antwort. Aber ich will den Ereignissen nicht vorgreifen, und beim Anfang anfangen.
Sie erinnern sich, daß man alle meine Schritte überwachte. Nun, ich wollte, daß sich dieses skandalöse Mittel in eine allgemeine öffentliche Erbauung wende und habe das so angestellt. Ich beauftragte meinen Vertrauten, daß er mir in der Nachbarschaft irgendeinen Unglücklichen ausfindig machte, der der Hilfe bedürftig ist. Der Auftrag war nicht schwer auszuführen. Gestern nachmittag teilte er mir mit, daß heute Morgen der Hausrat einer ganzen Familie beschlagnahmt werden soll, weil sie die Steuern nicht bezahlen könnte. Ich erkundigte mich erst, ob in diesem Hause keine Frau oder junges Mädchen wäre, dessen Alter oder Gesicht meine Tat verdächtig machen konnte, und als ich darüber wohl unterrichtet war, sprach ich beim Abendessen von meiner Absicht, den nächsten Morgen auf die Jagd zu gehen. Hier muß ich gerecht gegen meine Präsidentin sein: Zweifellos empfand sie einige Gewissensbisse über die Spionage-Aufträge, die sie gegeben hatte, und da sie nicht die Kraft hatte, ihre Neugierde zu bezähmen, so hatte sie mindestens die, sich gegen meine Absicht zu wenden. Es würde eine entsetzliche Hitze sein, meinte sie, und ich würde dabei meine Gesundheit riskieren, und ich würde doch nichts schießen und mich deshalb nur umsonst ermüden und so weiter. Und während dem sprachen ihre Augen besser als sie selbst es wollte, und ließen mich erkennen, daß sie wünschte, ich sollte ihre schlechten Gründe gut finden. Ich hütete mich wohl, darauf einzugehen, wie Sie sich wohl denken können, und hielt selbst einem kleinen Angriff auf die Jagd und die Jäger überhaupt stand, und gab selbst dann nicht nach, als ich auf diesem himmlischen Gesicht den ganzen Abend über eine kleine Wolke schlechter Laune liegen sah. Ich fürchtete sogar einen Augenblick, daß sie ihre Anordnungen widerrufen hätte, und mich dieser Anfall von Ehrgefühl um meinen Plan bringen könnte. Ich rechnete nicht mit der Neugierde der Frauen, und ich irrte mich auch. Mein Jäger beruhigte mich noch am selben Abend, und ich legte mich zufrieden schlafen.
Mit Tagesanbruch stehe ich auf und gehe. Kaum fünfzig Schritte vom Schlosse entfernt sehe ich auch schon meinen Spion, der mir folgt. Ich gehe querfeldein, auf das Dorf zu, zu dem ich wollte, ohne anderes Vergnügen auf dem Wege, als den armen Kerl, der mir folgte, zum Laufen zu veranlassen, der, da er die Straße nicht verlassen durfte, oft springend einen Weg dreimal so lang wie der meine machen mußte. Wie ich so den Burschen trieb, wurde mir selber so warm, daß ich mich unter einen Baum setzte. Hatte der Kerl nicht die Frechheit, sich keine zwanzig Schritte von mir unter ein Gebüsch zu legen? Einen Augenblick hatte ich Lust, ihm einen Schuß aus meiner Flinte zu schicken, der, wenn es auch nur eine Schrotladung war, ihm doch eine Lektion über die Gefahren der Spionage erteilt hätte. Zum Glück für ihn fiel mir ein, daß er für meinen Plan nötig, ja höchst nötig sei, und das hat den Burschen gerettet.
Ich komme ins Dorf und bemerke einen Aufruhr, trete näher, und man erzählt mir den Vorfall. Ich lasse den Steuereinnehmer kommen und zahle mit meinem großmütigsten Mitleid und nobel fünfundsechzig Livres, um deretwillen man fünf Personen auf Stroh und Verzweiflung legen wollte. Nach dieser so einfachen Sache hätten Sie den Chor von Segenswünschen hören sollen, den alle Umstehenden anstimmten! Tränen der Dankbarkeit liefen dem alten Familienoberhaupte aus den Augen, und machten das Gesicht dieses Patriarchen schön, das vorher in der Verzweiflung fast häßlich war. Ich betrachtete noch das Schauspiel, als ein anderer etwas jüngerer Bauer mit einer Frau und zwei Kindern hervortrat, zu denen der Alte sagte: »Fallen wir vor diesem Ebenbild Gottes zu Füßen,« und im selben Augenblick lag diese Familie anbetend zu meinen Füßen. Ich wurde wirklich schwach, und meine Augen wurden naß: ich fühlte eine unwillkürliche aber angenehme Rührung. Ich war ganz erstaunt über das hübsche Gefühl, das man empfindet, wenn man wohltut, und ich möchte glauben, daß diese Leute, die wir nächstenliebende Leute nennen, nicht halb so viel Verdienst bei ihrer Tugend haben, als man uns glauben machen will. Sei das wie immer, ich fand es nur recht und billig, diesen Leuten das Vergnügen zu zahlen, das sie mir soeben bereitet hatten. Ich hatte gerade noch zehn Louis bei mir und gab sie ihnen. Jetzt fingen die Dankeshymnen von neuem an, aber sie hatten schon nicht mehr die gleiche pathetische Höhe: das Nötige hatte den starken echten Effekt verursacht, das übrige war nur einfacher Ausdruck der Dankbarkeit und des Erstaunens über ein Geschenk, das aus dem Überfluß kam.
Ich sah inmitten dieser Segnungen der redseligen Familie wohl recht einem Theaterhelden ähnlich in der entscheidenden Szene. Natürlich war der treue Spion auch inmitten der Menge, und mein Zweck war erfüllt. Ich riß mich los und ging aufs Schloß zurück. Alles in allem gratuliere ich mir zu meinem Einfall.
Und die Frau ist die viele Mühe wirklich wert, die ich mir ihretwegen mache –diese Mühe wird einmal mein Anspruch sein. Und indem ich sie auf diese Weise sozusagen im voraus bezahlt habe, werde ich das Recht haben, nach meiner Laune über diese Frau zu verfügen, ohne mir Vorwürfe machen zu müssen.
Ich vergaß Ihnen zu sagen, daß ich, um allen Vorteil daraus zu ziehen, die guten Leute noch bat, Gott um den Erfolg meines Vorhabens zu bitten. Sie werden gleich sehen, wie ihre Gebete schon zum Teil erhört wurden ... Ich werde soeben zum Abendessen gerufen, und es würde zu spät für die Post werden, wenn ich den Schluß bis nachher aufheben wollte. Also den Rest am nächsten Posttag. Es tut mir leid, denn dieser Rest ist das Beste: Adieu, meine schöne Freundin. Sie stahlen mir eine Minute »ihres« Anblicks!
Schloß . . ., den 20. August 17..
Zweiundzwanzigster Brief
Die Präsidentin von Tourvel an Frau von Volanges.
Sie werden sich gewiß freuen, gnädige Frau, von einem Zug des Herrn von Valmont zu hören, der, wie mir scheint, um vieles verschieden von der Art ist, wie man ihn Ihnen dargestellt hat. Es ist so unangenehm, unvorteilhaft von irgend jemandem zu denken, so betrübend, nur Laster bei jenen zu finden, die alle nötigen Eigenschaften besitzen, die Tugend zu lieben. Sie üben doch so gerne Nachsicht, und Ihnen Grund zu geben, von einem zu strengen Urteil zurückzukommen, heißt doch Sie verbinden. Herr von Valmont scheint mir wie geschaffen dazu, diese Gunst, – ich möchte fast sagen diese Gerechtigkeit – von Ihnen zu erhoffen, und worauf ich das gründe, ist dies:
Er machte heute früh einen jener Spaziergänge, die bestimmte Pläne seinerseits in der Umgebung vermuten ließen, so wie Sie einmal voraussetzten, und ich muß mich anklagen, diese Ihre Vermutung mit allzu vieler Lebhaftigkeit geteilt zu haben. Zum Glück für ihn und auch für uns, –weil es uns davor bewahrt, ungerecht zu sein, –mußte einer meiner Leute denselben Weg wie er gehen, und auf diese Weise wurde meine sträfliche aber glückliche Neugierde befriedigt. Er brachte uns die Nachricht, daß Herr von Valmont im Dorfe S. eine unglückliche Familie angetroffen habe, deren Möbel verkauft werden sollten, weil sie die Steuer nicht bezahlen konnte; und daß er den Leuten nicht nur den Betrag der Steuern, sondern auch noch eine ansehnliche Summe geschenkt hatte. Mein Diener war Zeuge dieser tugendhaften Handlungsweise und erzählte weiter, daß die Bauern unter sich und zu ihm davon sprachen, daß gestern ein Diener ins Dorf gekommen wäre, um Erkundigungen über jene Bauern einzuziehen, ein Diener, den sie näher beschrieben, und den der meinige als den des Herrn von Valmont erkannte. Wenn dem so ist, so ist das kein gewöhnliches, durch die zufällige Gelegenheit veranlaßtes und vorübergehendes Mitleid, und ist vielmehr die vorgefaßte Absicht, Gutes zu tun; und das ist die schönste Tugend der schönsten Seelen. Aber, sei es nun Zufall oder Absicht, es bleibt immer eine lobenswerte und ehrliche Tat, deren Beschreibung mich schon zu Tränen rührte. Ich füge noch hinzu, und das immer noch aus dem Gefühl der Gerechtigkeit, daß, als ich mit ihm darüber sprach, er selbst kein Wort davon erwähnte, anfangs sogar leugnete und dann, als er es eingestand, so wenig Wert darauf legte, daß seine Bescheidenheit sein Verdienst verdoppelte. Jetzt sagen Sie mir, meine ehrwürdige Freundin, ob Herr von Valmont wirklich ein unverbesserlicher Wüstling ist, und wenn er das ist und sich so benimmt, was für die anständigen Menschen noch zu tun bliebe? Können denn die Bösen mit den Guten die heilige Freude des Wohltuns teilen? Gott würde erlauben, daß eine tugendhafte Familie die Hilfe, deren Dank sie der ewigen Vorsehung schuldet, aus den Händen eines Verbrechers empfängt? Und könnte es ihm gefallen, aus reinem Munde die Segnungen eines Verworfenen zu hören? Ich glaube nein. Ich will lieber glauben, daß seine Verirrungen langdauernde, aber nicht ewige sind, und ich kann mir nicht denken, daß derjenige, der Gutes tut, ein Feind der Tugend ist. Herr von Valmont ist vielleicht nur ein Beispiel mehr für die Gefahren, die in diesen verwerflichen Liaisons liegen. Ich bleibe bei diesem Gedanken, der mir gefällt, und wenn er dazu beitragen kann, Herrn von Valmont in Ihren Augen zu rechtfertigen, so dient er mir auch anderseits dazu, die Freundschaft mehr und mehr kostbar machen, die mich fürs Leben an Sie bindet.
In Ehrerbietung Ihre usw.
P.S. Frau von Rosemonde geht jetzt mit mir diese ehrliche und unglückliche Familie besuchen, um etwas verspätet unsere Hilfe derjenigen des Herrn von Valmont beizufügen. Wir nehmen ihn mit uns und werden den guten Leuten wenigstens die Freude machen, ihren Wohltäter wiederzusehen, was, glaube ich, alles ist, das er uns zu tun übrig ließ.
Schloß . . ., den 20. August 17..
Dreiundzwanzigster Brief
Der Vicomte von Valmont an die Marquise von Merteuil.
Wir blieben bei meiner Rückkehr ins Schloß unterwegs stehen; ich nehme meinen Bericht wieder auf.
Ich hatte gerade noch Zeit, Toilette zu machen und begab mich in den Salon, wo meine Schöne an einer Stickerei saß, während der Pfarrer des Ortes meiner alten Tante die Zeitung vorlas. Ich setzte mich neben den Stickrahmen. Noch sanftere Blicke als gewöhnlich, ja fast zärtliche Blicke ließen mich bald erraten, daß der Diener schon seinen Bericht erstattet hatte. Und wirklich konnte meine süße Neugier nicht länger das Geheimnis halten; und unbekümmert, einen ehrwürdigen Priester zu unterbrechen, dessen Vorlesen mehr eine Predigt war, sagte sie: »Ich habe auch meine Neuigkeit,« und erzählte mein Abenteuer, und mit einer Genauigkeit, die der Intelligenz ihres Berichterstatters alle Ehre macht. Sie können sich denken, wie ich alle meine Bescheidenheit paradieren ließ, – aber kann man eine Frau hindern, die ohne es zu wissen, das Lob dessen singt, den sie liebt? Ich ließ sie also erzählen. Man hätte meinen können, sie trüge das Loblied eines Kirchenheiligen vor. Währenddem beobachtete ich nicht ohne Hoffnung alles, was ihr beredter Blick, ihre bereits freiere Bewegung der Liebe versprachen, und besonders den Tonfall der Stimme, deren leichtes Zittern die Bewegung ihrer Seele verriet. Kaum war sie zu Ende, als Frau von Rosemonde zu mir sagte: »Kommen Sie, mein lieber Neffe, kommen Sie, daß ich Sie umarme.« Ich fühlte gleich, daß die schöne Lobpreiserin sich nicht würde erwehren können, ebenfalls umarmt zu werden. Sie wollte entfliehen, aber bald hatte ich sie in meinen Armen, und sie nicht die Kraft zu widerstehen, – kaum konnte sie sich aufrecht halten. Je mehr ich diese Frau beobachte, desto begehrenswerter erscheint sie mir. Sie beeilte sich wieder an ihren Rahmen zu kommen, und es schien für jedermann, daß sie wieder sticke; ich merkte aber wohl, daß ihre zitternde Hand ihr es nicht möglich machte, die Nadel zu führen.
Nach dem Essen wollten die Damen die Unglücklichen aufsuchen, denen ich in so höchst tugendhafter Weise beigestanden hatte, und ich begleitete sie. Ich erspare Ihnen die Langeweile der Schilderung dieser neuen Szene des Dankes und des Lobes. Ich beschleunigte die Rückkehr ins Schloß, denn mein Herz war von einer entzückenden Erinnerung voll. Unterwegs war meine schöne Präsidentin träumerischer als gewöhnlich und sprach kein Wort. Ganz damit beschäftigt, den Nutzen der Wirkungen aus diesem Ereignis des Tages zu finden, war ich ebenso schweigsam. Nur Frau von Rosemonde sprach und bekam von uns nur seltene und kurze Antworten. Wir dürften sie gelangweilt haben, ich hatte wenigstens diese Absicht, und sie gelang. Denn als wir vom Wagen stiegen, ging sie gleich in ihre Zimmer und ließ uns miteinander allein, meine Schöne und mich, im schwach erleuchteten Salon, einem süßen Dämmerlicht, das schüchterne Liebe kühner macht.
Es wurde mir nicht schwer, das Gespräch dahin zu lenken, wo ich es haben wollte. Der Eifer der liebenswürdigen Tugendreichen half mehr dabei als es meine Geschicklichkeit hätte tun können.
»Wenn man so bereit ist, Gutes zu tun,« sagte sie mit einem sanften Blick auf mich, »wie kommt es, daß man sein Leben in Schlechtigkeit verbringt?« »Ich verdiene,« antwortete ich, »weder dieses Lob noch diesen Tadel, und ich begreife nicht, daß Sie mit all ihrem Geist mich immer noch nicht erkannt haben. Sollte mein Vertrauen zu Ihnen mir auch schaden, Sie sind dessen zu würdig, als daß es mir möglich wäre, es Ihnen zu entziehen. Sie finden den Schlüssel zu meinem Benehmen in meinem unglücklicherweise zu leichtfertigen Charakter. Von sittenlosen Menschen umgeben, habe ich deren Lasterleben nachgeahmt, vielleicht noch mit dem Ehrgeiz, sie darin zu übertreffen. Hier aber verleitete mich wieder das Beispiel der Tugend, und ich habe ohne Hoffnung wenigstens versucht, Ihnen zu folgen. Aber vielleicht würde die Tat, deren Sie mich loben, in Ihren Augen allen Wert verlieren, wenn Sie deren wirkliche Motive kennten. (Sie sehen, meine schöne Freundin, wie nahe ich der Wahrheit war!) Nicht mir verdanken diese Unglücklichen die Hilfe. Wo Sie eine lobenswerte Tat sehen, suchte ich nichts sonst als ein Mittel zu gefallen. Ich war, da ich es schon sagen muß, nur das schwache Werkzeug einer Göttin, die ich anbete. (Hier wollte sie mich unterbrechen, aber ich ließ ihr keine Zeit dazu.) In diesem selben Augenblick sogar entkommt mir mein Geheimnis – aus Schwäche. Ich hatte mir vorgenommen es vor Ihnen zu verschweigen, und ich machte mir mein Glück daraus Ihrer Tugend wie Ihrer Schönheit eine reine Huldigung darzubringen, von der Sie niemals erfahren sollten. Aber, unfähig zu betrügen, wenn ich unter meinen Augen das Beispiel der Unschuld habe, will ich mir auch keine sträfliche Verheimlichung vorzuwerfen haben. Glauben Sie ja nicht, daß ich Sie durch eine sträfliche Hoffnung beleidige. Ich weiß, ich werde unglücklich sein, aber meine Leiden werden mir teuer sein und mir die Stärke meiner Liebe zeigen; vor Ihre Füße, in Ihre Brust werde ich meine Qual legen und werde da neue Kraft zu neuem Leiden schöpfen. Da werde ich barmherzige Güte finden und werde mich getröstet fühlen, weil Sie mich bedauern. Angebetete! Hören Sie mich an, bedauern Sie mich und helfen Sie mir.« Und da lag ich ihr schon zu Füßen und drückte ihre Hände, aber sie riß sich los und rief verzweifelt und in Tränen: Ach, ich Unglückliche! . . . Glücklicherweise hatte auch ich mich so weit fortreißen lassen, daß ich ebenfalls weinte und ihre Hände, die ich wieder hielt, mit meinen Tränen netzte – eine sehr nötige Sache; denn sie war so sehr mit ihrem eigenen Schmerz beschäftigt, daß sie den meinen ohne dieses Mittel meiner Tränen nicht bemerkt hätte. Die Tränen standen ihrem Gesichte herrlich, was mich so mehr noch erregte, daß ich kaum mehr Herr meiner selbst und versucht war, den Augenblick zu nützen.
Ach über unsere Schwäche! Und wie groß die Macht der Umstände, wenn selbst ich meine Pläne vergessend, in die Gefahr komme, durch einen verfrühten Sieg den Reiz eines langen Kampfes und die Details einer mühsamen Eroberung zu verlieren, wenn ich wie ein von der Sehnsucht genarrter Jüngling dem Sieger über Frau von Tourvel als Preis seiner Arbeit nichts sonst als diese Banalität gegeben hätte, eine Frau mehr besessen zu haben! Ja, sie soll sich ergeben, aber sie soll dagegen kämpfen; ohne die Kraft des Siegens zu besitzen, muß sie doch die des Widerstandes haben; sie soll reichlich das Gefühl ihrer Schwäche genießen und selbst ihre Niederlage gestehen. Der gemeine Wilddieb soll den überraschten Hirsch aus der Sicherheit des Hinterhaltes töten, aber der wahre Jäger muß ihn forcieren. Der Plan ist groß gedacht, nicht wahr? Aber ich würde jetzt vielleicht bedauern können, ihm nicht gefolgt zu sein, ohne den Zufall, der meiner Vorsicht zu Hilfe kam. Wir hörten ein Geräusch. Jemand trat in den Salon. Erschreckt erhob sich Frau von Tourvel, nahm einen Leuchter und ging hinaus. Ich mußte es geschehen lassen. Es war nur ein Diener gewesen. Sobald ich dessen gewiß war, folgte ich ihr. Kaum hatte ich einige Schritte gemacht, als sie, weil sie mich erkannte oder aus einem unbestimmten Gefühl des Schreckens, ihre Schritte beschleunigte und mehr laufend als gehend in ihr Zimmer stürzte, dessen Türe sie ins Schloß fallen ließ. Der Schlüssel steckte von innen. Ich hütete mich wohl zu klopfen, womit ich ihr die Gelegenheit eines allzu leichten Widerstandes gegeben hätte. Es kam mir die ebenso einfache als glückliche Idee, durchs Schlüsselloch zu schauen, und ich sah tatsächlich diese entzückende Frau auf den Knien liegen, in Tränen aufgelöst inbrünstig beten. Zu welchem Gott wohl? Gibt es einen stark genug gegen die Liebe? Umsonst suchte sie fremde Hilfe; denn ich bin es jetzt, der ihr Schicksal bestimmt.
Ich glaubte, es sei genug für einen Tag und zog mich in meine Zimmer zurück, um Ihnen zu schreiben. Ich hoffte, Frau von Tourvel beim Abendessen zu treffen, aber sie ließ sagen, daß sie sich nicht wohl fühle und daß sie zu Bett gegangen sei.
Frau von Rosemonde wollte zu ihr hinauf, aber die maliziöse Kranke schützte Kopfschmerzen vor, die ihr nicht erlaubten, jemanden zu sehen. Sie können sich denken, daß der Abend kurz war, und daß ich auch meine Kopfschmerzen vorgab.
Ich schrieb ihr einen langen Brief, in dem ich mich über ihre Grausamkeit beklagte, und legte mich schlafen mit dem Vorsatz, ihr den Brief morgen früh zu geben. Ich habe schlecht geschlafen, wie Sie aus dem Datum des Briefes sehen. Früh las ich den Brief noch einmal durch und fand ihn schlecht: mehr Leidenschaft darin als Liebe, mehr üble Laune als Traurigkeit. Ich werde ihn noch einmal schreiben müssen, aber mit mehr Ruhe.
Ich merke, daß es Tag wird, ich hoffe von der Frische des Morgens den Schlaf. Ich will wieder zu Bett gehen, und wie groß auch immer die Macht, die diese Frau über mich hat, sein möge, ich verspreche Ihnen, mich nicht so ganz mit ihr zu beschäftigen, als daß mir nicht Zeit übrig bliebe, viel an Sie zu denken.
Adieu, meine schöne Freundin.
Schloß . . ., den 21. August 17.., 4 Uhr früh.
Vierundzwanzigster Brief
Der Vicomte von Valmont an die Frau von Tourvel.
Ach, gnädige Frau, aus Barmherzigkeit besänftigen Sie den Aufruhr meines Herzens; seien Sie gnädig, und sagen Sie mir, was ich zu hoffen oder zu fürchten habe. Die Ungewißheit ist ein grausames Los, so zwischen Glück und Unglück gestellt. Warum habe ich es Ihnen auch gesagt! Warum konnte ich dem zwingenden Zauber nicht widerstehen, der Ihnen meine Gedanken preisgab! Zufrieden damit, Sie schweigend anzubeten, freute ich mich wenigstens an meiner Liebe, und dieses glücklich reine Gefühl, das noch nicht das Bild Ihres Schmerzes verwirrte, war Glücks genug. Aber nun ist diese Quelle des Glückes eine der Verzweiflung geworden, seitdem ich Ihre Tränen fließen sah, seit ich dieses grausame »Ach! ich Unglückliche« gehört habe. Gnädige Frau, diese Worte werden noch lange in meinem Herzen sein! Durch welches Verhängnis kann Ihnen das zarteste aller Gefühle nur Entsetzen einflößen? Und worin besteht denn diese Furcht? Ach, es ist nicht jene, die man teilt, denn Ihr Herz, das ich schlecht kannte, ist nicht für die Liebe geschaffen, und nur das meine, das Sie immer verleumdeten, ist es allein, das empfinden kann – das Ihre kennt selbst das Mitleid nicht.
Wäre das nicht so, Sie hätten dem Unglücklichen, der Ihnen sein Leid klagte, nicht das Wort des Trostes versagt, sich nicht seinen Blicken entzogen, der keine andere Freude kennt als die, Sie zu sehen. Sie hätten nicht ein so grausames Spiel mit seinem Kummer gespielt, indem Sie ihm sagen ließen, Sie wären krank, ohne ihm zu erlauben, sich über Ihr Befinden zu erkundigen. Sie hätten in derselben Nacht, die für Sie nur zwölf Ruhestunden bedeuteten, gefühlt, daß sie für mich eine Ewigkeit der Schmerzen sein müßte. Wodurch, sagen Sie, habe ich diese trostlose Strenge verdient? Ich fürchte mich nicht davor, Sie zum Richter anzurufen – was habe ich getan? Was anderes als dem stärkeren Gefühle nachgegeben, das Ihre Schönheit entflammt hat und das Ihre Tugend rechtfertigt, das immer die Hochachtung zurückgehalten hat, und dessen unschuldiges Geständnis aus dem Vertrauen und nicht aus der Hoffnung kam? Werden Sie nun dieses Vertrauen mißbrauchen, das Sie selbst zu erlauben schienen und dem ich mich ohne Rückhalt hingab? Nein, ich kann es nicht glauben; denn das hieße Unrechtes an Ihnen entdecken, und der bloße Gedanke, an Ihnen Unrechtes zu suchen, widerstrebt meinem Herzen – ich nehme alle meine Vorwürfe zurück, die ich wohl schreiben, aber nicht denken konnte. Lassen Sie mich daran glauben, daß Sie vollkommen sind – es ist die einzige Freude, die mir bleibt. Und beweisen Sie es mir, indem Sie mir Ihre großmütige Gnade schenken.
Welchem Unglücklichen haben Sie je geholfen, der Ihrer Hilfe bedürftiger gewesen wäre als ich? Verlassen Sie mich nicht in dieser Verzweiflung, in die Sie mich gebracht haben. Leihen Sie mir Ihre Vernunft, da Sie mich um die meine gebracht haben. Sie haben mich besser gemacht, nun vollenden Sie Ihr Werk, indem Sie mir Klarheit geben in meiner Verwirrung.
Ich will Sie nicht täuschen. Es wird Ihnen nicht gelingen, mich von meiner Liebe abzubringen. Aber Sie werden mich lehren, sie zu mäßigen, indem Sie meine Schritte lenken, meine Worte leiten, und mich damit wenigstens vor diesem Unglück bewahren sollen, Ihnen zu mißfallen. Nehmen Sie mir wenigstens diese verzweifelte Angst, sagen Sie mir, daß Sie mir verzeihen, daß Sie mich bedauern, versichern Sie mich Ihrer Nachsicht. Sie werden ja nie diese Nachsicht haben, die ich ersehne, aber ich verlange die, derer ich bedarf – werden Sie sie mir versagen?
Adieu, gnädige Frau, empfangen Sie mit Güte die Huldigung meiner Gefühle, die denen meiner Hochachtung nicht im Wege sind.
den 20. August 17..
Fünfundzwanzigster Brief
Der Vicomte von Valmont an die Marquise von Merteuil.
Hier der Kriegsbericht von gestern.
Um elf Uhr trat ich bei Frau von Rosemonde ein, und in ihrer Begleitung wurde ich bei der Scheinkranken eingelassen, die noch zu Bette lag. Sie hatte blaue Ränder unter den Augen, – ich hoffe, daß sie ebenso schlecht geschlafen hat wie ich. Ich benutzte einen Augenblick, da sich Frau von Rosemonde entfernt hatte, um meinen Brief zu übergeben; sie weigerte sich ihn anzunehmen, ich ließ ihn aber auf dem Bette liegen und rückte ganz artig den Fauteuil meiner alten Tante heran, die so nah wie möglich bei ihrem lieben Kinde sein wollte. Der Brief mußte wohl oder übel versteckt werden, um einen Skandal zu vermeiden. Die Kranke sagte sehr ungeschickt, daß sie glaube, etwas Fieber zu haben. Frau von Rosemonde veranlaßte mich, den Puls zu fühlen, indem sie meine medizinischen Kenntnisse sehr lobte. Meine Schöne hatte nun den doppelten Verdruß: sie mußte mir ihren Arm überlassen und dabei fühlen, daß ich ihre kleine Lüge entdecken würde. Und ich nahm also ihre Hand und drückte sie heftig in die meine, während ich mit der andern ihren frischen, vollen Arm befühlte; die schlechte Person antwortete auf nichts, weshalb ich, als ich mich zurückzog, sagte: es sei nicht die leiseste Spur auch nur der geringsten Erregung vorhanden. Ich war ihres strafenden Blickes so sicher, daß ich ihn, um sie zu strafen, gar nicht suchte. Einen Augenblick später sagte sie, sie wolle aufstehen, und wir ließen sie allein. Sie erschien beim Diner, das recht traurig war; sie kündete uns an, daß sie keinen Spaziergang machen werde, was mir zu verstehen geben sollte, daß ich keine Gelegenheit zur Aussprache haben würde. Ich fühlte, daß hier ein ganz leiser Seufzer und schmerzvoller Blick am Platze war, worauf sie zweifellos wartete; denn das war der einzige Moment am ganzen Tage, wo es mir gelang, ihren Augen zu begegnen. So klug sie auch ist, so hat sie doch ihre kleinen Schwächen wie jede andere. Ich fand einen günstigen Augenblick, in dem ich sie fragte, ob sie wohl die Güte gehabt hätte, mich über mein Schicksal zu beruhigen, und ich war etwas erstaunt über die Antwort: »Ja, ich habe Ihnen geschrieben.« Ich brannte danach, diesen Brief zu haben; aber aus Absicht oder Ungeschicklichkeit oder Schüchternheit – sie gab ihn mir erst am Abend, gerade als sie sich zurückzog. Ich schicke ihn Ihnen mit dem Konzept des meinen: Lesen und urteilen Sie. Beachten Sie, mit welcher vortrefflich gemachten Falschheit sie erklärt, daß sie keine Liebe fühlt, während ich doch das Gegenteil genau weiß, – und dann wird sie sich später beklagen, daß ich sie betrüge, während sie mich schon jetzt betrügt! Meine schöne Freundin, der geschickteste Mann kann sich kaum auf der Höhe der aufrichtigsten Frau halten. Man wird wohl noch so tun müssen, als ob man an all diese Worte glaubte, und sich in Verzweiflung ermüden, weil es der Gnädigen gefällt, die Spröde zu spielen! Das Mittel, sich an all dieser Bosheit zu rächen . . . Aber Geduld . . . Und Adieu, ich habe noch viel zu schreiben.
Ja, noch etwas: Sie müssen mir den Brief der grausamen Dame zurückschicken, es könnte sein, daß sie später auf diese Kleinigkeiten Wert legte, und man muß immer korrekt sein.
Ich spreche heute nicht über die kleine Volanges, aber nächstens davon.
Schloß . . ., den 21. August 17..
Sechsundzwanzigster Brief
Die Frau von Tourvel an den Vicomte von Valmont.
Sie hätten nie einen Brief von mir bekommen, wenn mich mein dummes Benehmen von gestern abend nicht zu einer Erklärung zwänge. Ja, ich habe geweint, ich gestehe es und vielleicht sind mir auch jene zwei Worte entschlüpft, die Sie mir mit so vieler Sorgfalt zitieren. Tränen und Worte – Sie haben alles bemerkt, so muß ich Ihnen alles erklären.
Gewöhnt, nur ehrbare Gefühle zu erwecken und nur Gespräche zu hören, die ich ohne zu erröten auch anhören kann, gebe ich mich einer Sicherheit hin, die ich wohl verdiene, und verstehe ich die Eindrücke, die ich empfange, weder zu verbergen noch zu bekämpfen. Die Überraschung, Verwirrung und ich weiß nicht welche Furcht, die die Situation in mir hervorrief, in die ich nie hätte geraten sollen, und dann dieser empörende Gedanke, mich mit den Frauen verwechselt zu sehen, die Sie verachten, und mich ebenso leichtfertig wie diese behandelt zu sehen – alles das verursachte meine Tränen und ließ mich mit Recht, wie ich glaube, sagen, daß ich unglücklich bin. Sie finden dieses Wort stark – es wäre noch viel zu schwach, wenn meine Tränen und Worte einen anderen Grund gehabt hätten, wenn ich, statt Gefühle, die mich beleidigen mußten, zu mißbilligen, sie zu teilen hätte befürchten müssen.
Nein, mein Herr, ich habe diese Furcht nicht, denn wenn ich sie hätte, würde ich hundert Meilen weit von Ihnen gehen, würde ich in einer Wüste das Unglück beweinen, Sie jemals gekannt zu haben. Vielleicht hätte ich, trotz der Gewißheit, daß ich Sie nicht liebe, daß ich Sie nie lieben werde, besser daran getan, die Ratschläge meiner Freunde zu befolgen, Sie nicht in meine Nähe zu lassen.
Ich glaubte, und das ist mein einziger Fehler, ich glaubte, Sie würden eine anständige Frau respektieren, die nichts sehnlicher verlangte, als auch Sie so zu finden, um Ihnen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, eine Frau, die Sie bereits verteidigte, während Sie sie mit Ihren verbrecherischen Wünschen beschimpften. Sie kennen mich nicht, nein, Sie kennen mich nicht. Sonst hätten Sie nicht geglaubt, ein Recht auf Ihr Unrecht zu haben, weil Sie mit mir von Dingen sprachen, die ich nicht hätte anhören sollen; hätten Sie sich nicht für berechtigt gehalten, mir einen Brief zu schreiben, den ich nicht hätte lesen sollen. Und Sie verlangen von mir, daß ich Ihre Schritte lenken, Ihre Gespräche leiten soll! Nun gut: Stillschweigen und Vergessen, das sind die Ratschläge, die mir Ihnen zu geben geziemt, so wie Ihnen, dieselben zu befolgen; dann werden Sie allein das Recht auf meine Nachsicht haben, und es steht nur bei Ihnen, sogar das der Dankbarkeit zu gewinnen. Aber nein, ich richte an den keine Bitte, der mir die Achtung verweigerte, ich will dem kein Zeichen des Vertrauens geben, der meine Sorglosigkeit mißbraucht hat. Sie zwingen mich, Sie zu fürchten, vielleicht sogar Sie zu hassen, und das war nicht meine Absicht, denn ich wollte in Ihnen nichts sonst sehen, als den Neffen meiner besten Freundin, und ich widersprach mit der Stimme der Freundschaft der Stimme der öffentlichen Meinung, die Sie anklagte. Sie haben alles zerstört, und ich sehe voraus, Sie werden nichts wieder gut machen wollen.
Ich erkläre Ihnen daher, daß Ihre Gefühle mich beleidigen, daß deren Geständnis mich beschimpft, und daß, weit entfernt davon sie jemals zu teilen, Sie mich zwingen werden, Sie nie wiederzusehen, wenn Sie sich über diese Sache nicht das Stillschweigen auferlegen, das ich von Ihnen zu erwarten, ja selbst zu fordern das Recht habe.
Ich lege diesem Briefe denjenigen bei, den Sie mir geschrieben haben und hoffe, daß Sie mir den meinen wiedergeben werden; ich wäre betrübt, bliebe auch nur eine Spur dieses Vorfalles zurück, der nie hätte stattfinden sollen.
den 21. August 17..
Siebenundzwanzigster Brief
Cécile Volanges an die Marquise von Merteuil.
Mein Gott, wie Sie gut sind, gnädige Frau! Wie richtig haben Sie gefühlt, daß es mir leichter werden wird, Ihnen zu schreiben, als mit Ihnen zu sprechen! Auch ist das, was ich Ihnen zu sagen habe, sehr schwer zu sagen; aber Sie sind meine Freundin, nicht wahr, meine sehr gute Freundin, und ich will versuchen, keine Angst zu haben, und dann habe ich Sie und Ihre Ratschläge so nötig! Ich habe viel Kummer; es scheint mir, als ob jedermann erraten würde, was ich denke, und ganz besonders wenn er da ist, werde ich immer rot sobald man mich ansieht. Gestern, als Sie mich weinen sahen, wollte ich mit Ihnen sprechen und ich weiß nicht, was mich davon zurückhielt; und als Sie mich dann fragten, was mir fehle, kamen mir die Tranen ohne daß ich's wollte. Ich hätte kein Wort herausgebracht. Ohne Sie hätte es Mama bemerkt, und ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre. Sehen Sie, so verbringe ich seit vier Tagen mein Leben.
An jenem Tag, gnädige Frau, ja ich will es Ihnen sagen, gerade an jenem Tage hat mir der Chevalier von Danceny geschrieben. O! ich schwöre Ihnen, als ich den Brief fand, wußte ich gar nicht was das war; aber ich will nicht lügen und muß sagen, daß ich viel Vergnügen empfand als ich ihn las. Sehen Sie, ich möchte lieber mein ganzes Leben lang leiden, als daß er mir den Brief nicht geschrieben hätte. Ich wußte wohl, ich dürfe ihm das nicht sagen, und ich kann Ihnen versichern, daß ich erklärte, ich zürne ihm darüber, er aber sagte, es wäre stärker als er gewesen, und ich glaube es auch, denn ich hatte mir vorgenommen, ihm nicht zu antworten, und doch konnte ich mich nicht enthalten, es doch zu tun.
Ich habe ihm nur ein allereinzigesmal geschrieben, und das eigentlich nur, um ihm zu sagen, er dürfe mir nicht mehr wieder schreiben – und trotzdem schreibt er mir wieder und wieder; und da ich ihm nicht antworte, sehe ich, daß er traurig ist, und das betrübt mich immer mehr; so daß ich gar nicht mehr weiß, was tun, und ich bin sehr zu bedauern.
Sagen Sie mir bitte, gnädige Frau, wäre es wirklich schlecht, wenn ich ihm von Zeit zu Zeit antwortete? Nur so lange, bis er es über sich bringt, mir nicht mehr zu schreiben und mit mir zu verkehren wie früher, denn wenn das so fort geht, weiß ich nicht, was aus mir werden soll. Sehen Sie, als ich seinen letzten Brief las, mußte ich ohne Aufhören weinen, und wenn ich ihm jetzt wieder nicht antworte, wird es uns viele Schmerzen machen.
Ich will Ihnen auch seinen Brief schicken, oder besser eine Abschrift davon und Sie können selbst urteilen. Sie werden gleich sehen, daß er nichts Unrechtes verlangt. Wenn Sie aber finden sollten, daß sich das nicht schickt, so verspreche ich Ihnen, nicht zu antworten; aber ich glaube, Sie denken wie ich und werden nichts Schlechtes darin finden.
Weil ich doch schon schreibe, erlauben Sie mir, gnädige Frau, noch eine Frage an Sie zu stellen. Man hat mir gesagt, daß es schlecht sei, jemanden zu lieben, aber warum denn? Was mir die Frage aufdrängt, ist, daß der Chevalier von Danceny gesagt hat, daß es gar nicht schlecht wäre, und daß fast alle Menschen lieben. Wenn das so ist, so sehe ich gar nicht ein, warum ich die einzige Ausnahme machen sollte. Oder ist das nur etwas Schlechtes für die Fräuleins? Denn ich hörte Mama selbst einmal sagen, daß Frau von D... Herrn M... liebe, und sie sprach darüber nicht, als ob das etwas Schlechtes wäre und doch bin ich überzeugt, daß sie über mich böse würde, wenn sie nur ahnte, daß ich für Herrn Danceny Freundschaft empfinde. Mama behandelt mich noch immer wie ein Kind und sagt mir gar nichts. Ich glaubte, sie wolle mich verheiraten, als sie mich aus dem Kloster nahm, jetzt scheint mir aber das nicht; doch ich versichere Ihnen, daß mich das gar nicht bekümmert. Aber Sie, die Sie Mamas Freundin sind, Sie wissen gewiß, was daran ist, und wenn Sie es wissen, hoffe ich, werden Sie es mir sagen, nicht wahr? Jetzt habe ich einen sehr langen Brief geschrieben; aber da Sie mir erlaubten, Ihnen zu schreiben, benutzte ich die Gelegenheit, Ihnen alles zu sagen und rechne dabei auf Ihre Freundschaft.
Paris, den 23. August 17..
Achtundzwanzigster Brief
Der Chevalier Danceny an Cécile Volanges.
Wie, mein Fräulein, Sie wollen mir immer noch nicht antworten? Kann Sie denn gar nichts milder stimmen? Und jeder Tag nimmt die Hoffnung, die er brachte, wieder mit sich fort. Was für eine Freundschaft, die Sie zugeben, besteht denn zwischen uns, wenn die Ihre nicht einmal stark genug ist, sich meiner Leiden zu erbarmen? Wenn Sie kalt und ruhig zusehen, wie in mir ein Feuer brennt, das ich nicht zu löschen vermag? Wenn diese Freundschaft, weit davon Ihnen Vertrauen einzuflößen, nicht einmal so groß ist, Ihr Mitleid zu wecken? Ihr Freund leidet und Sie tun nichts, um ihm zu helfen. Er verlangt bloß ein Wort von Ihnen und Sie versagen es ihm und wollen, daß er sich mit einem so schwachen Gefühle begnügt, dessen Versicherung Sie sich zu wiederholen fürchten!
Sie wollen nicht undankbar sein, sagten Sie gestern. Glauben Sie mir, mein Fräulein, mit Freundschaft die Liebe erwidern wollen, das heißt nicht die Undankbarkeit fürchten, das heißt nur Angst haben, undankbar zu scheinen. Doch nichts mehr von meinen Gefühlen, die Ihnen ja nur lästig sind, weil sie Sie nicht interessieren; ich muß sie in mich verschließen, bis ich sie unterdrücken lerne. Ich weiß, wie schwer mir das werden wird, und ich täusche mich darüber nicht, daß ich alle meine Kräfte dazu brauchen werde; aber ich will alle Mittel versuchen, von denen mir eines ganz besonders schwer wird, und das ist, Ihnen immer wieder zu sagen, wie fühllos Ihr Herz ist. Ich will sogar versuchen, Sie seltener zu sehen, und ich beschäftige mich schon damit, einen plausiblen Grund dafür zu finden.
Ach, ich soll die süße Gewöhnung aufgeben, Sie jeden Tag zu sehen! Ein ewiges Unglücklichsein wird meine zärtliche Liebe lohnen und Sie werden es so gewollt haben, und es wird Ihr Werk sein! Niemals, das fühle ich, werde ich das Glück wiederfinden, das ich heute verliere. Sie allein waren für mich geschaffen, und wie gerne würde ich das Gelübde tun, nur für Sie zu leben! Sie aber wollen es nicht annehmen, und Ihr Stillschweigen lehrt mich zur Genüge, daß Ihr Herz nichts für mich empfindet. Das ist der sicherste Beweis Ihrer Gleichgültigkeit, und die grausamste Art, es mich wissen zu lassen. Leben Sie wohl, mein Fräulein.
Ich darf nicht mehr auf eine Antwort hoffen; die Liebe hätte sie eilig geschrieben, die Freundschaft mit Vergnügen und selbst das Mitleid mit Gefälligkeit. Aber Mitleid, Freundschaft und Liebe sind Ihrem Herzen gleich fremd.
Paris, den 23. August 17..
Neunundzwanzigster Brief
Cécile Volanges an Sophie Carnay.
Ich habe Dir zwar selbst gesagt, Sophie, daß es Fälle gibt, in denen man schreiben darf, und doch versichere ich Dir, daß ich mir Vorwürfe mache, Deinem Rat gefolgt zu sein, der dem Chevalier Danceny und mir viel Kummer bereitet hat. Die Probe, daß ich recht hatte, ist, daß Frau von Merteuil, die das gewiß gut versteht, schließlich auch gedacht hat wie ich. Ich habe ihr alles gestanden. Erst sprach sie gerade so wie Du, aber nachdem ich ihr alles erzählt hatte, gab sie zu, daß da doch ein Unterschied wäre; sie verlangt nur, daß sie alle meine Briefe zu sehen bekommt, ebenso diejenigen des Chevaliers, um sicher zu sein, daß ich nichts als das Notwendigste sage. Jetzt fühle ich mich ruhig. Gott, wie ich diese Frau von Merteuil liebe! Sie ist so gut und eine so achtbare Dame. Und so ist alles in Ordnung.
Nun will ich gleich an Herrn Danceny schreiben, und wie froh wird er sein! Mehr noch als er erwartet; denn bis jetzt sprach ich nur von meiner Freundschaft für ihn, und er wollte immer, ich sollte von meiner Liebe sprechen. Ich glaubte eben, das wäre dasselbe, aber ich traute mich nicht, er aber wollte es. Ich sagte es Frau von Merteuil und sie sagte, ich hätte recht getan, und daß man nur von Liebe sprechen soll, wenn man nicht mehr anders könne. Jetzt bin ich aber überzeugt, daß ich es nicht mehr länger verbergen kann, und im übrigen ist es ja dasselbe und es wird ihm um so mehr Freude machen. Frau von Merteuil sagte mir, sie würde mir auch Bücher leihen, die von all dem handeln und die mich lehren würden, mich richtig darin zu betragen, und auch besser zu schreiben als ich es tue. Denn siehst Du, sie macht mich auf alle meine Fehler aufmerksam, und das ist doch ein Beweis, daß sie mich sehr liebt. Sie hat mir nur empfohlen, Mama nichts von den Büchern zu sagen, weil das aussehen könnte, als hätte Mama meine Erziehung vernachlässigt und das könnte sie ärgern. Ich werde ihr auch nichts davon sagen.
Es ist doch eigentlich sonderbar, daß eine Frau, die kaum mit mir verwandt ist, sich mehr um mich kümmert als meine Mutter. Es ist wirklich ein Glück für mich, mit ihr bekannt zu sein. Sie hat Mama gebeten, daß sie mich übermorgen in die Oper mitnehmen dürfe in ihre Loge und sie sagte mir, daß wir ganz allein sein werden und daß wir uns die ganze Zeit dabei unterhalten können ohne zu fürchten, daß man uns dort hört. Und das ist mir noch lieber als die Oper. Wir werden uns auch über meine Heirat unterhalten; denn sie sagte mir auch, daß das wahr wäre mit dem Verheiraten, aber mehr wüßte sie auch nicht darüber. Ist das nicht sehr wunderlich, daß Mama mir nichts darüber sagt?
Adieu, meine Sophie, ich schreibe jetzt an den Chevalier Danceny. O, ich bin so glücklich!
Paris, den 24. August 17..
Dreissigster Brief
Cécile Volanges an den Chevalier Danceny.
Endlich, mein Herr, willige ich darein, Ihnen zu schreiben, um Sie meiner Freundschaft zu versichern, meiner Liebe, weil Sie ohne die unglücklich wären. Sie sagen, ich hätte kein gutes Herz, aber ich versichere Ihnen, daß Sie sich irren und hoffe, daß Sie jetzt nicht mehr daran zweifeln werden. Wenn Sie Kummer darüber hatten, daß ich Ihnen nicht schrieb, so glauben Sie mir, daß es auch mir leid tat. Aber ich möchte um alles nichts tun, was unrecht wäre, und ich hätte ganz sicher meine Liebe nicht zugegeben, wenn ich es hätte anders machen können, aber Ihre Traurigkeit tat mir so leid. Ich hoffe, daß sie jetzt vorüber ist, und daß wir sehr glücklich sein werden.
Ich rechne bestimmt darauf, Sie heute abend zu sehen und daß Sie früh kommen werden – es wird doch nie so früh sein als ich es mir wünsche. Mama wird zu Hause speisen und ich glaube, sie wird Ihnen vorschlagen zu bleiben – ich hoffe, Sie sind nicht vergeben wie vorgestern abend. War es denn so amüsant, das Souper, zu dem Sie gingen? Denn Sie sind schon sehr früh hingegangen. Aber, sprechen wir nicht davon. Jetzt, da Sie wissen, daß ich Sie liebe, hoffe ich, daß Sie so lange bleiben wie Sie können, denn ich bin nur zufrieden, wenn ich mit Ihnen bin und möchte, daß es bei Ihnen auch so ist.
Es ärgert mich, daß Sie jetzt noch traurig sind, aber es ist nicht meine Schuld. Ich werde um meine Harfe bitten, sobald Sie da sind, damit Sie den Brief gleich haben. Ich weiß es nicht besser einzurichten.
Adieu! Ich liebe Sie sehr und von ganzem Herzen – je mehr ich Ihnen das sage, desto zufriedener bin ich und hoffe, daß Sie es auch werden.
Paris, den 24. August 17..
Einunddreißigster Brief
Der Chevalier Danceny an Cécile Volanges.
Ja, ja, wir werden glücklich sein! Mein Glück ist gesichert, weil ich von Ihnen geliebt bin und das Ihre wird kein Ende nehmen, wenn es so lange dauern wird, als die Liebe, die Sie in mir erweckten. Sie lieben mich! Sie fürchten sich nicht mehr, mir Ihre Liebe zu gestehen! Und je öfter Sie es mir sagen, desto zufriedener sind Sie! Als ich dieses entzückende »Ich liebe Sie« las, glaubte ich das Geständnis aus Ihrem süßen Munde zu hören. Ich sah diese Augen auf mich gerichtet, die die Zärtlichkeit noch schöner macht. Ich bekam Ihr Wort, immer für mich leben zu wollen. Ach! mein ganzes Leben will ich Ihrem Glücke weihen! Nehmen Sie es hin und seien Sie versichert, daß ich es nie verraten werde.
Was für einen glücklichen Tag hatten wir gestern! Warum hat Frau von Merteuil nicht immer wichtige Dinge mit Ihrer Mama allein zu besprechen, und warum muß sich der Gedanke an den Zwang, der uns erwartet, in meine süßen Erinnerungen mischen? Warum kann ich nicht immer diese reizende kleine Hand, die mir das »Ich liebe Sie« geschrieben hat, zwischen meinen Fingern halten und sie mit Küssen bedecken, um mich so dafür zu rächen, daß Sie mir eine größere Gunst verweigert haben!
Sagen Sie mir, süße Cécile, als Ihre Mama eintrat und wir durch ihre Gegenwart gezwungen waren, füreinander bloß gleichgültige Blicke zu haben, als Sie mich nicht mehr mit der Versicherung Ihrer Liebe trösten konnten – haben Sie es da nicht bedauert, mir die Beweise verweigert zu haben? Haben Sie sich nicht gesagt: Ein Kuß hätte ihn glücklicher gemacht, und ich habe ihm dieses Glück versagt? Versprechen Sie es mir, daß Sie bei der nächsten Gelegenheit weniger streng mit mir sein werden, und mit der Hilfe dieses Versprechens werde ich den Mut finden, all das Unannehmliche zu ertragen, das die Umstände mit sich bringen, und die grausamen Entbehrungen wird mir die Gewißheit mildern, daß Sie das Bedauern mit mir teilen. Adieu, meine reizende Cécile, die Stunde ist da, wo ich zu Ihnen darf. Ich könnte Sie nicht verlassen, wäre es nicht, um Sie wiederzusehen. Adieu, Geliebte, die ich immer mehr liebe!
Paris, den 25. August 17..
Zweiunddreißigster Brief
Frau von Volanges an Frau von Tourvel.
Sie wollen also durchaus, gnädige Frau, daß ich an die Tugendhaftigkeit des Herrn von Valmont glaube. Ich muß sagen, daß ich mich nicht dazu entschließen kann, und daß ich ebensoviel Mühe hätte, nach der einzigen guten Tat, die Sie mir von Valmont erzählen, ihn für anständig zu halten und einen durchaus guten Menschen deshalb für lasterhaft, weil man mir von ihm einen Fehler hinterbringt. Die Menschen sind nach keiner Richtung hin vollkommen, nicht nach dem Guten hin und nicht nach dem Bösen. Der Verbrecher hat seine guten Seiten wie der Anständige seine Schwächen. Diese Wahrheit scheint mir um so glaubensnötiger, weil aus ihr die Notwendigkeit der Nachsicht für die Bösen wie für die Guten kommt und die einen vor Stolz bewahrt, wie sie die anderen vor der Verzweiflung rettet. Sie werden in diesem Augenblick sicher denken, daß ich von der Nachsicht, die ich predige, für mich selber einen schlechten Gebrauch mache; ich sehe aber darin nichts als eine gefährliche Schwäche, wenn sie uns dazu bringt, den Schlechten wie den Guten gleich zu behandeln.
Ich will mir die Motive der Handlungsweise des Herrn von Valmont zu untersuchen nicht erlauben und will glauben, daß sie ebenso lobenswert sind wie die Tat selber. Aber hat er deshalb weniger sein Leben damit hingebracht, Unehre, Zwietracht und Skandal in die Familien zu bringen? Hören Sie, wenn Sie wollen, die Stimme des Unglücklichen, dem er geholfen hat, aber es soll Sie das nicht hindern, die Stimmen der hundert Opfer, die er betrogen hat, zu hören. Wenn er auch, wie Sie meinen, nur ein Beispiel für die Gefahren der leichten Liaisons wäre, ist er selbst deshalb weniger eine gefährliche Liaison? Sie halten ihn einer Umkehr zum Besseren für fähig, ja, sagen wir mehr, nehmen wir dieses Wunder als wirklich geschehen an – würde nicht gegen ihn die öffentliche Meinung bestehen bleiben und müßte das nicht genügen, Ihr Verhältnis zu ihm danach einzurichten? Gott allein kann im Augenblick der Reue verzeihen, denn er liest in den Herzen – die Menschen aber können die Gedanken nur nach den Worten beurteilen, und keiner, der einmal die Achtung der anderen verloren hat, hat ein Recht, sich über das natürliche Mißtrauen zu beklagen, das es diesem Verlust der Achtung so schwer macht, wieder zum Guten zu kommen. Bedenken Sie, meine junge Freundin, daß es oft genügt, diese Achtung dadurch zu verlieren, daß man so tut als mache man sich nichts aus ihr, und nennen Sie diese Strenge nicht Ungerechtigkeit. Wer da glaubt, daß man auf dieses kostbare Gut, auf das man alles Anrecht hat, verzichten kann, der ist in Wirklichkeit sehr nahe daran, Unrechtes zu tun, da er sich durch dieses mächtige Band nicht mehr gehalten fühlt. So würde man es ansehen, wenn Sie eine intime Verbindung mit Herrn von Valmont zeigten, so unschuldig diese auch immer sein möchte.
Die Wärme, mit der Sie ihn verteidigen, erschreckt mich und ich beeile mich, den Einwänden, die ich voraussehe, zuvorzukommen. Sie werden mir Frau von Merteuil nennen, der man diese Liaison verziehen hat; Sie werden mich fragen, weshalb ich ihn bei mir empfange; Sie werden sagen, daß er, weit davon entfernt, von anständigen Leuten abgewiesen zu werden, er in dem was man die gute Gesellschaft nennt empfangen, ja sogar gesucht ist. Ich kann, glaube ich, auf alles das erwidern.
Was Frau von Merteuil betrifft, die wirklich eine durchaus achtenswerte Frau ist, so hat sie vielleicht keinen andern Fehler als zu viel Vertrauen in ihre eigene Kraft. Sie ist ein geschickter Lenker, der sich darin gefällt, einen Wagen zwischen Felsen und Abgrund zu lenken, und den der Erfolg allein rechtfertigt: es ist recht und billig, sie zu loben, aber töricht, ihr zu folgen, und sie selbst gibt das zu und klagt sich dessen an. Je mehr sie gesehen hat, desto strenger wurden ihre Grundsätze, und ich glaube Ihnen versichern zu können, daß sie wie ich denken würde.
Was mich betrifft, werde ich mich nicht mehr rechtfertigen als die andern. Gewiß empfange ich Herrn von Valmont, und er wird überall empfangen, das ist nur eine der tausend Inkonsequenzen, welche die Gesellschaft regieren: Sie wissen so gut wie ich, daß man sein Leben damit verbringt, sie zu bemerken, sich darüber zu beklagen und sich ihnen zu unterwerfen. Herr von Valmont mit seinem guten Namen, seinem großen Vermögen, seinen vielen liebenswürdigen Eigenschaften hat bald erkannt, daß es, um die Herrschaft in der Gesellschaft zu behaupten, genüge, mit gleicher Geschicklichkeit das ernste Lob wie den Spott der Lächerlichkeit zu handhaben. Keiner besitzt wie er dieses zweifache Talent: er bezaubert mit dem einen und macht sich mit dem anderen gefürchtet. Man achtet ihn nicht, aber man schmeichelt ihm. Das ist seine Existenz inmitten einer Welt, die mehr vorsichtig als mutig es vorzieht, ihn behutsam zu umgehen als zu bekämpfen.
Aber weder Frau von Merteuil noch irgendeine andere Frau dürfte es wagen, sich auf dem Lande mit einem solchen Mann, fast im tête à tête einzuschließen. Es war der Vernünftigsten, der Bescheidensten unter allen vorbehalten geblieben, dieses Beispiel der Inkonsequenz zu geben – verzeihen Sie mir dieses Wort, es entspringt der Freundschaft.
Meine schöne Freundin, Ihre Ehrenhaftigkeit selbst betrügt Sie durch die Sicherheit, die sie Ihnen einflößt. Bedenken Sie, wen Sie zum Richter haben werden: auf der einen Seite frivole Leute, die an keine Tugend glauben, weil sie davon bei sich kein Beispiel finden, auf der andern aber böse Menschen, die so tun werden, als ob sie nicht an Ihre Tugend glaubten, um Sie dafür zu strafen, Tugend gehabt zu haben. Bedenken Sie, daß Sie in diesem Augenblick etwas tun, was selbst manche Männer zu tun nicht wagen würden. Es gibt tatsächlich unter den jungen Leuten, für die Herr von Valmont nur zu sehr zum Muster wurde, einige ganz Vorsichtige, die es befürchten, zu eng mit ihm befreundet zu scheinen – und Sie, Sie fürchten das nicht! Kommen Sie zurück, kommen Sie zurück, ich beschwöre Sie... Genügen meine Gründe nicht, Sie zu überzeugen, so geben Sie meiner Freundschaft Gehör; sie läßt mich meine dringende Bitte erneuern, sie muß mich rechtfertigen. Sie werden meine Freundschaft streng finden und ich wünschte, die Strenge wäre überflüssig. Aber ich will lieber, daß Sie sich über meine zu große Fürsorge als über Vernachlässigung zu beklagen haben mögen.
Paris, den 24. August 17..
Dreiunddreißigster Brief
Die Marquise von Merteuil an den Vicomte von Valmont.
Seitdem Sie sich vor dem Erfolg fürchten, mein lieber Vicomte, seitdem Ihr Plan darin besteht, Waffen gegen sich selbst zu schmieden und Sie weniger zu siegen als zu kämpfen wünschen, habe ich Ihnen nichts mehr zu sagen. Ihr Manöver ist ein Meisterwerk kluger Vorsicht – anders wäre es eins der Dummheit, ich meine, wenn man den gegenteiligen Standpunkt einnimmt – und um Ihnen die Wahrheit zu sagen, ich fürchte, Sie machen sich Illusionen.
Was ich Ihnen vorwerfe, ist nicht, daß Sie den rechten Moment nicht ausgenutzt haben, denn einmal sehe ich nicht ganz deutlich, ob er da war, und dann weiß ich ganz gut, daß eine einmal verfehlte Gelegenheit wiederkommt, während man einen übereilten Schritt niemals gutmachen kann.
Aber die wahre gute Schule war es, daß Sie sich zum Schreiben entschlossen haben. Ich kann mir denken, daß Sie jetzt nicht wissen, wohin Sie das führen wird. Glauben Sie vielleicht, dieser Frau zu beweisen, daß sie sich ergeben muß? Mir scheint, daß das nur eine Gefühlswahrheit ist, die nicht bewiesen werden kann, und um mit ihr etwas auszurichten, muß man rühren und nicht nur räsonnieren. Aber was nützt es Ihnen, mit Briefen zu rühren und weich zu machen, wenn Sie nicht dabei sind, um von dieser Wirkung zu profitieren? Wenn Ihre schönen Sätze die verliebte Ekstase wirklich hervorbringen sollten, glauben Sie, daß diese Ekstase so lange anhalten wird, um der Überlegung nicht Zeit zu geben und das Geständnis zu verhindern? Denken Sie doch an die Zeit, die es braucht, einen Brief zu schreiben, ihn zuzustellen und bedenken Sie, ob eine Frau mit Prinzipien, Ihre Nonne, so lange das wollen kann, was sie nie zu wollen sich bemüht! Mit Kindern geht das, die wenn sie schreiben: »ich liebe Sie« nicht wissen, daß sie sagen: »ich gebe mich hin«. Aber die wohlbedachte Tugend der Frau von Tourvel scheint mir Wert und Sinn der Worte genau zu kennen. So schlägt sie Sie trotz des Vorteils, den Sie im Gespräche über sie gewannen, schlägt sie Sie doch mit ihrem Briefe. Und dann – wissen Sie, was dann geschieht? Durch Reden allein will man sich nicht überwältigen lassen. Wenn man mit Gewalt nach guten Gründen sucht, findet man sie auch und spielt sie aus; und hält daran fest, nicht weil sie so gut sind, sondern um sich nicht zu widersprechen.
Noch etwas! Eine Beobachtung haben Sie merkwürdigerweise nicht gemacht: in der Liebe gibt es nichts, das schwieriger wäre, als Unempfundenes zu schreiben. Nicht daß man sich nicht der richtigen Worte bedient, aber man ordnet sie nicht in der rechten Weise, oder man ordnet sie eben, und das genügt. Lesen Sie doch Ihren Brief noch einmal: es ist ein Arrangement darin, das sich bei jedem Satz verrät. Ich will hoffen, daß Ihre keusche Dame nicht geübt genug ist, das zu bemerken, aber darauf kommt es gar nicht an: der Effekt bleibt derselbe und deshalb nicht weniger verfehlt. Das ist der Fehler in den Romanen: der Autor schlägt sich krumm und klein, um sich warm zu machen, und der Leser bleibt kalt. »Héloise« ist die einzige Ausnahme, und trotz allem Talent des Autors hat mich diese Beobachtung immer glauben lassen, daß das Buch aus dem Leben ist. Schreiben und Sprechen ist nicht dasselbe. Die Gewohnheit, an der Modulation seiner Stimme zu arbeiten, gibt ihr den Gefühlston; und dazu kommt noch die Leichtigkeit der Tränen; und der Ausdruck des Verlangens mischt sich in den Augen leicht und wirksam mit jenen der Zärtlichkeit; und dann macht das ungeordnete Reden leicht den guten Eindruck des Betäubt- und Verwirrtseins – was die wahre Eloquenz der Liebe ist. Schließlich und endlich hindert die Gegenwart der geliebten Person die Überlegung und läßt uns danach verlangen, besiegt zu werden.
Glauben Sie mir, Vicomte: man wird von Ihnen verlangen, daß Sie nicht mehr schreiben. Nützen Sie das, um Ihren Fehler wieder gut zu machen, und warten Sie auf eine Gelegenheit zu sprechen. Wissen Sie, daß diese Frau mehr Kraft hat, als ich ihr zutraute? Sie verteidigt sich geschickt. Und ohne die verdächtige Länge ihres Briefes und ohne diesen Vorwand der Dankbarkeit – um Ihnen zu schreiben – hätte sie sich gar nicht verraten.
Was mich noch veranlassen könnte, Sie über Ihren Sieg zu beruhigen, ist, daß sie zu viel Kraft auf einmal aufwendet: sie wird sich in der Verteidigung des Wortes ausgeben, so daß ihr für die Verteidigung der Sache selbst nichts mehr bleibt.
Ich schicke Ihnen Ihre beiden Briefe zurück, die wohl, wenn Sie klug sind, die letzten bleiben werden bis zum kritischen Moment. Wenn es nicht so spät wäre, erzählte ich Ihnen noch von der kleinen Volanges, die prächtige Fortschritte macht und mit der ich sehr zufrieden bin. Ich glaube, ich werde vor Ihnen fertig sein und Sie sollten sich dessen schämen. Adieu für heute.
Paris, den 24. August 17..
Vierunddreißigster Brief
Der Vicomte von Valmont an die Marquise von Merteuil.
Sie sagen ja ganz entzückende Sachen, meine schöne Freundin, aber warum geben Sie sich so viel Mühe, etwas zu beweisen, was niemandem unbekannt ist? Ich glaube, Ihr ganzer Brief lautet: um rascher in der Liebe vorwärts zu kommen, ist es besser zu reden als zu schreiben. Aber das ist ja das ABC der Verführungskunst! Ich möchte jedoch bemerken, daß Sie nur eine Ausnahme von dieser Regel machen und daß es deren zwei gibt. Zu den Kindern, die den Weg aus Schüchternheit gehen und sich aus Unwissenheit hingeben, muß man noch die schöngeistigen Frauen rechnen, die aus Eitelkeit darauf eingehen und die die Eitelkeit in die Falle führt. Zum Beispiel bin ich fest davon überzeugt, daß die Gräfin B..., die damals ohne Umstände auf meinen Brief antwortete, mich ebenso wenig liebte wie ich sie, und daß sie da nichts weiter als eine Gelegenheit sah, ein Opfer zu haben, das ihr Ehre machen sollte – ein Renommierverhältnis.
Sei das wie es sei, ein Jurist würde Ihnen sagen, daß sich das Prinzip nicht auf meinen Fall anwenden läßt. Sie glauben tatsächlich, ich hätte die Wahl zwischen Schreiben und Sprechen, was aber nicht der Fall ist. Seit der Geschichte vom 19. letzten Monats hat meine Keusche, die sich in der Defensive hält, mit einer solchen Geschicklichkeit jede Begegnung mit mir zu vermeiden verstanden, daß meine Geschicklichkeit daran zuschanden wurde. Wenn das so weiter geht, wird sie mich zwingen, daß ich mich ganz ernstlich mit den Mitteln beschäftige, wieder meinen Vorteil zu erlangen denn ich will durch sie auf keine Weise besiegt sein. Selbst meine Briefe sind die Ursache eines kleinen Krieges: nicht genug daran, daß sie sie nicht beantwortet, refüsiert sie sie sogar. Jeder Brief verlangt eine neue List und die gelingt nicht immer.
Sie erinnern sich, durch welches einfache Mittel ich ihr den ersten Brief zustellte und auch der zweite machte keine Schwierigkeiten. Sie hatte verlangt, daß ich ihr ihren Brief zurückgebe, und ich gab ihr statt dessen den meinen, ohne daß sie den geringsten Verdacht hatte. Sei es nun Ärger, von mir überlistet worden zu sein, oder Eigensinn, oder endlich diese Tugend – sie bringt es noch so weit, daß ich daran glaube –, den dritten Brief nahm sie nicht an. Ich hoffe aber, daß die Verlegenheit, in die sie sich infolge der Nichtannahme des Briefes brachte, ihr in Zukunft eine Warnung sein wird.
Ich war gar nicht sehr erstaunt, daß sie diesen Brief nicht annehmen wollte, den ich ihr ganz einfach hinhielt; denn das wäre schon ein Entgegenkommenn gewesen, und ich mache mich auf einen längeren Widerstand gefaßt. Nach diesem Versuch, der nichts als eine Probe war, legte ich meinen Brief in ein Kuvert und benutzte die Zeit ihrer Toilette, da Frau von Rosemonde und ihre Kammerjungfer anwesend waren, ihn ihr durch meinen Jäger zuzuschicken mit dem Auftrag: es sei das jenes Papier, das sie von mir verlangt hätte. Ich riet ganz richtig, daß sie die etwas skandalöse Auseinandersetzung fürchten mußte, die ein Refus mit sich bringen würde: – sie nahm also den Brief, und mein Bote, der ihr Gesicht genau zu beobachten hatte – und er sieht nicht schlecht – bemerkte nur eine leichte Röte und mehr Verlegenheit als Zorn.
Ich war meiner Sache nun sicher. Denn entweder mußte sie den Brief behalten oder wenn sie ihn mir zurückgeben wollte, mußte sie einen Moment des Alleinseins mit mir wählen, was eine Gelegenheit mit ihr zu sprechen war. Nach ungefähr einer Stunde kommt einer ihrer Leute zu mir und überreicht mir ein Kuvert ganz anderer Form als jenes, das meinen Brief enthielt, und ich erkenne darauf die ersehnte Handschrift. Ich öffne schnell... es war mein eigener Brief, der gar nicht geöffnet, sondern nur gefaltet worden war – ein diabolischer Streich.
Sie kennen mich. Ich brauche Ihnen meine Wut nicht zu beschreiben. Aber kaltes Blut war nötig und ein neues Mittel. Ich fand dieses einzige.
Man holt von hier jeden Morgen die Briefe von der Post, die ungefähr dreiviertel Stunden von hier entfernt ist, und braucht dazu eine Art Büchse, zu der der Postmeister einen Schlüssel hat und Frau von Rosemonde den anderen. Jeder tut tagsüber seine Briefe da hinein, abends werden sie auf die Post getragen und des Morgens holt man die angekommenen. Die Leute besorgen abwechselnd den Dienst. Es war nicht die Reihe an meinem Diener, aber er übernahm ihn, da er ohnedies in der Gegend zu tun hätte.
Ich schrieb also meinen Brief, verstellte auch die Adresse, verstellte meine Handschrift und machte ziemlich geschickt den Stempel von Dijon nach. Ich wählte Dijon, weil es mir Spaß machte, aus derselben Stadt zu schreiben wie ihr Mann, da ich dieselben Rechte bei ihr beanspruchte wie er, und weil meine Schöne den ganzen Tag von dem Wunsch gesprochen hatte, Nachrichten aus Dijon zu bekommen. Es war doch nur recht, daß ich ihr diese Freude verschaffte.
Nun war es leicht, diesen Brief zu den anderen zu geben. Ich gewann bei diesem Arrangement noch, daß ich Zeuge des Empfanges sein konnte, denn es ist hier der Brauch, daß alle zum Frühstück beisammen sind und die Ankunft der Post erwarten, ehe jedes seine Wege geht. Die Post kam endlich.
Frau von Rosemonde öffnet die Büchse. – »Von Dijon!« und sie gab Frau von Tourvel den Brief. »Das ist nicht die Handschrift meines Mannes,« sagte sie in etwas besorgtem Tone und brach schnell das Siegel auf. Der erste Blick sagte ihr alles und gleichzeitig kam eine solche Veränderung über ihr Gesicht, daß Frau von Rosemonde es bemerkte und sagte: »Was haben Sie denn?« Ich trat ebenfalls näher und meinte: »Dieser Brief ist wohl sehr schlimm?« Die schüchterne Nonne wagte nicht die Augen aufzuschlagen, sprach kein Wort und suchte sich damit über ihre Verlegenheit zu helfen, daß sie so tat, als durchflöge sie den Brief, den sie zu lesen nicht fähig war. Ich genoß ihre Verlegenheit und sagte nicht ohne Vergnügen: »Ihr etwas ruhigeres Aussehen läßt mich hoffen, daß der Brief Ihnen doch nur mehr Erstaunen als Schmerz bereitet hat.« Der Zorn beriet sie in diesem Moment besser als es die Klugheit hätte tun können. »Er enthält Dinge,« antwortete sie, »die mich beleidigen und über die ich erstaunt bin, daß man sie mir zu schreiben gewagt hat.« »Ja, wer denn?« fragte Frau von Rosemonde. »Er ist nicht unterzeichnet,« antwortete die schöne Stolze, »aber der Brief verursacht mir die gleiche Verachtung wie sein Schreiber. Sie würden mich verbinden, wenn Sie nicht weiter davon sprächen.« Und da zerriß sie das verwegene Schriftstück, steckte die Fetzchen in die Tasche, stand auf und ging.
Bei allem Zorn – sie hat doch meinen Brief gehabt, und ich halte etwas auf diese Neugierde, die ihr riet, den ganzen Brief zu lesen.
Die Einzelheiten des Tages zu schildern, würde mich zu weit führen. Ich füge diesem die Konzepte meiner beiden anderen Briefe bei, die Sie genau von allem unterrichten werden. Wenn Sie in dieser Korrespondenz auf dem Laufenden bleiben wollen, müssen Sie sich schon die Mühe geben, meine Minuten zu entziffern, denn um nichts in der Welt könnte ich die Langeweile hinunterwürgen, sie abzuschreiben. Adieu, meine schöne Freundin.
Schloß . . ., den 25. August 17..
Fünfunddreißigster Brief
Der Vicomte von Valmont an die Frau von Tourvel.
Man muß Ihnen gehorchen, gnädige Frau. Man muß Ihnen beweisen, daß bei allem Üblen, das Sie in mir zu glauben sich gefallen, mir doch genug Zartgefühl übrig bleibt, daß ich mir keinen Vorwurf erlaube, und genug Mut, daß ich mir die schmerzlichsten Opfer auferlege. Sie befehlen mir Schweigen und Vergessen – gut. Ich werde meine Liebe zum Schweigen zwingen, und werde, wenn es möglich ist, die grausame Art, mit der Sie meine Liebe aufnahmen, vergessen. Ohne Zweifel gab mir das Verlangen, Ihnen zu gefallen, nicht auch das Recht dazu, und ich bekenne auch, daß meine bedürftige Bitte um Ihre Nachsicht kein Recht bedeutete, diese Nachsicht zu beanspruchen. Aber Sie betrachten meine Liebe als eine Beleidigung und vergessen, daß, wenn meine Liebe ein Unrecht wäre, Sie zugleich ihre Ursache und Entschuldigung sind. Sie vergessen auch, daß ich, gewöhnt, Ihnen mein Inneres zu vertrauen, auch da, wo mir dieses Vertrauen hätte schaden können, Ihnen die Gefühle, von denen ich voll war, nicht verbergen konnte – und was das Werk meines guten ehrlichen Glaubens war, betrachten Sie als ein Werk der Verwegenheit. Zum Lohn für meine aufrichtigste, zärtlichste und ehrerbietigste Liebe halten Sie mich von sich fern. Und sprechen sogar von Ihrem Haß... Wer würde sich über eine solche Behandlung nicht beklagen? Aber ich unterwerfe mich; ich leide und beklage mich nicht; Sie schlagen und ich bete an. Durch eine unbegreifliche Macht, die Sie über mich haben, sind Sie die unumschränkte Herrin meiner Gefühle; und wenn Ihnen meine Liebe allen Widerstand leistet, wenn Sie sie nicht zerstören können, so ist es, weil sie Ihr Werk ist und nicht das meine.
Ich verlange keine Gegenliebe, mit der ich mir nie schmeichelte. Ich erwarte nicht einmal dieses Mitleid, das mich das Interesse, das Sie mir manchesmal zeigten, hoffen ließ. Aber Ihre Gerechtigkeit darf ich fordern.
Ich erfahre von Ihnen, gnädige Frau, daß man versucht hat, mir in Ihrer Meinung über mich zu schaden. Wenn Sie den Ratschlägen Ihrer Freunde gefolgt wären, hätten Sie mich nicht einmal in Ihre Nähe kommen lassen, – das sind Ihre eigenen Worte. Wer sind denn diese geschäftigen Freunde? Ohne Zweifel haben diese strengen und unbeugsamen und so tugendhaften Menschen nichts dagegen, genannt zu werden und werden sich nicht in ein Dunkel verstecken, das sie mit den gewöhnlichen Verleumdern zusammenbrächte; dann blieben mir allerdings ihre Namen wie ihre Vorwürfe unbekannt. Bedenken Sie aber, gnädige Frau, daß ich ein Recht darauf habe, sowohl das eine wie das andere zu wissen, da Sie mich danach beurteilen. Man verurteilt nie einen Beschuldigten, ohne ihm sein Verbrechen zu nennen, ohne ihm seine Ankläger zu bezeichnen. Ich verlange keine andere Gnade und verpflichte mich zum voraus, mich zu rechtfertigen und meine Verleumder zu zwingen, zu widerrufen.
Wenn ich vielleicht aus dem nichtigen Klatsch der Menge, an der mir wenig liegt, mir zu wenig gemacht habe, so halte ich das nicht auch so mit Ihrer Achtung; und wenn ich mein Leben daran setze, sie zu verdienen, so werde ich sie mir nicht ungestraft rauben lassen. Und diese Achtung wird mir um so wertvoller, als ich ihr ohne Zweifel diese Bitte, die Sie an mich zu stellen fürchten, verdanken werde, und die mir, wie Sie sagen, ein »Recht auf Ihre Dankbarkeit« gäbe. Ah! weit davon entfernt, Dank zu verlangen, werde ich glauben, Ihnen welchen schuldig zu sein, wenn Sie mir Gelegenheit geben, Ihnen zu dienen. Beginnen Sie doch damit, mir Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, indem Sie mir sagen, was Sie von mir wünschen. Wenn ich es erraten könnte, würde ich Ihnen die Mühe ersparen, es mir zu sagen. Fügen Sie doch dem Vergnügen, Sie zu sehen, noch dieses Glück hinzu, Ihnen dienen zu dürfen, und ich würde stolz auf Ihre Nachsicht sein. Wer kann Sie daran hindern? Ich hoffe, nicht die Furcht vor meinem Nein? Das könnte ich Ihnen nie verzeihen. Und das ist's doch nicht, daß ich Ihnen Ihren Brief nicht wiedergebe? Ich wünschte mehr als Sie, daß ich seiner nicht mehr bedürfte. Aber daran gewöhnt, Sie sanft und gütig zu glauben, finde ich Sie nur in diesem Briefe so wie Sie scheinen wollen. Wenn ich den Wunsch aussprach, Sie nachgiebig zu stimmen, so sehe ich aus dem Brief, daß Sie eher hundert Meilen zwischen sich und mich legen wollten; und wenn alles an Ihnen meine Liebe rechtfertigt und steigert, so sagt mir Ihr Brief wieder, daß Sie sich dadurch beleidigt fühlen; und wenn ich Sie sehe, scheint mir diese meine Liebe das Höchste, und ich muß Ihren Brief lesen, um zu fühlen, daß sie nur eine schreckliche Qual ist. Sie verstehen jetzt, daß es mein größtes Glück wäre, Ihnen diesen Brief zurückzugeben, aber ihn von mir zurückverlangen, hieße mich berechtigen, das nicht mehr zu glauben, was darin steht. So hoffe ich, Sie zweifeln nicht an meiner Bereitwilligkeit, ihn Ihnen zurückzuschicken.
Auf Schloß . . ., den 21. August 17..
Sechsunddreissigster Brief
Der Vicomte von Valmont an die Frau von Tourvel. (Von Dijon datiert.)
Jeden Tag nimmt Ihre Strenge zu, gnädige Frau, und wenn ich es sagen darf, so scheinen Sie weniger das Unrecht als die Nachsicht zu fürchten. Nachdem Sie mich verurteilten, ohne mich zu hören, fühlten Sie wohl, daß es Ihnen leichter sein dürfte, meine Gründe nicht zu lesen, als darauf zu antworten. Sie nehmen meine Briefe mit Hartnäckigkeit nicht an, Sie schicken sie mir voll Verachtung zurück, Sie zwingen mich, schließlich zur List meine Zuflucht zu nehmen, und das in einem Augenblick, wo ich kein anderes Ziel kenne, als Sie von meiner ehrliehen Aufrichtigkeit zu überzeugen. Die Notwendigkeit meiner Verteidigung muß aber wohl genügen, mein Mittel zu entschuldigen; von der Aufrichtigkeit meiner Gefühle überzeugt, glaubte ich mir diese kleine List erlauben zu dürfen. Ich wage auch zu glauben, daß Sie mir das verzeihen und nicht darüber erstaunt sein werden, daß die Liebe erfinderischer ist, sich zu zeigen, als die Gleichgültigkeit, sich zu verbergen. Erlauben Sie mir also, gnädige Frau, daß ich Ihnen mein Herz völlig enthülle. Es gehört Ihnen, und es ist nur billig, daß Sie es kennen.
Als ich hier ankam, war ich weit davon, das Schicksal zu ahnen, das mich erwartete. Ich wußte nicht, daß Sie hier wären, und aufrichtig, wie ich bin, bemerke ich noch, daß, wenn ich es auch gewußt hätte, davon meine Ruhe nicht verwirrt worden wäre. Nicht, daß ich mich nicht vor Ihrer Schönheit wie natürlich gebeugt hätte; aber gewohnt, nur Begierden zu empfinden und mich denjenigen nur zu überlassen, die die Hoffnung ermutigt, kannte ich die Qualen der Liebe nicht.
Sie waren Zeuge, wie Frau von Rosemonde mich bat, zu bleiben. Ich hatte schon einen Tag mit Ihnen verbracht, und gab mich – oder glaubte es wenigstens – nur diesem doch so natürlichen und so legitimen Vergnügen hin, aufmerksam zu einer liebenswürdigen und verehrten Verwandten zu sein. Die Art, wie man hier lebt, weicht sehr von der mir gewohnten ab, aber es kostete mich keine Mühe, mich hineinzufinden, und ohne mich viel um die Ursache zu kümmern, die diese Veränderung in mir hervorrief, meinte ich, es läge das nur in der leichten Beweglichkeit meines Charakters, von der ich, wie ich glaube, schon einmal mit Ihnen sprach. – Als ich Sie unglücklicherweise – und warum muß es denn ein Unglück sein? – besser kennen lernte, sah ich bald, daß dieses entzückende Gesicht, das mir zuerst auffiel, der geringste Ihrer Vorzüge ist. Ihre himmlische Seele überraschte und bezauberte die meine. Ich bewunderte die Schönheit, und ich betete die Tugend an. Ohne den Gedanken, Sie zu besitzen, beschäftigte ich mich damit, Sie zu verdienen. Ich bat um Ihre Nachsicht für meine Vergangenheit und bemühte mich um Ihren Beifall für meine Zukunft. Ich suchte ihn in Ihren Worten, spähte nach ihm in Ihren Blicken, in denen ein so schlimmes Gift ist und ein um so schlimmeres Gift, als es sich ohne Absicht mitteilte und ohne Argwohn aufgenommen wurde. Da erkannte ich die Liebe. Aber wie war ich weit davon, mich darüber zu beklagen! Entschlossen, sie in einem ewigen Schweigen zu begraben, gab ich mich ohne Angst und ohne Zurückhaltung diesem köstlichen Gefühle hin. Jeder Tag vergrößerte ihr Reich. Bald wurde das Vergnügen, Sie zu sehen, zum Bedürfnis. Gingen Sie einen Augenblick fort, so wurde mein Herz traurig, hörte ich Sie kommen, so zitterte es vor Freude. Ich lebte nur noch durch Sie und für Sie. Aber ich rufe Sie zum Zeugen: entkam mir je im Scherz oder im ernsthaften Gespräch ein Wort, das das Geheimnis meines Herzens verraten hätte?
Da kam ein Tag, der mein Unglück beginnen sollte, und durch einen unbegreiflichen Zufall gab eine nichts als anständige Handlung dazu den Anlaß. Ja, gnädige Frau, bei jenen armen Leuten, denen ich geholfen hatte, gaben Sie sich diesem edlen Mitgefühle hin, das selbst die Schönheit noch verschönert und die Tugend noch erhöht, und verwirrten Sie mein Herz, das scbon zu viel Liebe berauschte. Sie erinnern sich vielleicht, wie mit mir selbst beschäftigt ich auf unserem Rückweg war. Ah, ich versuchte ein Gefühl zu unterdrücken, das schon stärker war als ich selbst!
Nachdem ich in diesem ungleichen Kampfe meine Kräfte erschöpft hatte, war es ein Zufall, den ich nicht voraussehen konnte, der mich mit Ihnen allein ließ. Und da unterlag ich... Mein allzu volles Herz konnte weder seine Worte noch seine Tränen zurückhalten. Aber ist das denn ein Verbrechen? Und wenn es eines ist, bin ich nicht schon bestraft genug durch die Qualen, die ich leide?
Von einer hoffnungslosen Liebe verzehrt, rufe ich Ihr Mitleid an und finde nur Ihren Haß. Ohne anderes Glück, als das, Sie zu sehen, suchen Sie meine Augen gegen meinen Willen, und ich zittere davor, Ihren Blicken zu begegnen. In dem schrecklichen Zustand, in den Sie mich gebracht haben, lebe ich die Tage damit hin, meinen Schmerz zu verbergen, und die Nächte, mich ihm hinzugeben – während Sie ruhig und friedlich von diesen Qualen nur wissen, um ihnen die Ursache zu sein und sich darüber zu freuen. Und doch sind Sie es, die sich beklagt, und ich bin der, der sich entschuldigt.
Hier ist, gnädige Frau, der getreue Bericht von dem, was Sie mein Unrecht nennen, und den Sie besser den Bericht meines Unglückes nennen sollten. Eine reine und aufrichtige Liebe, eine Ehrerbietung, die sich nie verleugnete, eine vollständige Ergebenheit – das sind die Gefühle, die Sie mir gaben. Ich hätte mich nicht gescheut, sie der Gottheit selbst darzubringen. Sie, die Sie ihr schönstes Ebenbild sind, folgen Sie ihrem Beispiel der gütigen Nachsicht. Denken Sie an meine Leiden und denken Sie, daß ich zwischen Verzweiflung und höchster Glückseligkeit stehe und daß das erste Wort, das Sie sprechen werden, mein Schicksal auf ewig entscheiden wird.
Auf Schloß . . ., den 23. August 17..
Siebenunddreissigster Brief
Frau von Tourvel an Frau von Volanges.
Ich füge mich den Ratschlägen Ihrer Freundschaft, gnädige Frau, weil ich gewohnt in allem Ihre Meinungen zu billigen glaube, daß sie immer der besten Überlegung entspringen. Ich gebe selbst zu, daß Herr von Valmont wirklich sehr gefährlich sein muß, wenn er gleichzeitig das scheinen kann, was er hier ist und das sein, als was Sie ihn schildern. Aber sei das wie immer, ich werde ihn von mir fernhalten, weil Sie es wünschen, oder ich werde wenigstens mein möglichstes dazu tun, denn oft werden die im Grunde einfachsten Dinge verfänglich durch die Form.
Seine Tante um die Beschleunigung seiner Abreise zu bitten, scheint mir immer noch untunlich; es wäre das für sie wie für ihn in gleicher Weise unhöflich.
Ich könnte mich auch nicht ohne Widerstreben zur Abreise entschließen, denn abgesehen von den Gründen, die meinen Mann betreffen und die ich Ihnen schon mitgeteilt habe, würde ich voraussichtlich mit meiner Abreise Herrn von Valmont nur die Möglichkeit geben, mir nach Paris zu folgen; und seine plötzliche Rückkehr nach Paris, für die man den Grund doch sicher bei mir suchte, wäre mir doch noch unangenehmer als dieses zufällige Zusammentreffen auf dem Lande und bei einer Dame, von der man weiß, daß sie seine Verwandte und meine Freundin ist.
Es bleibt mir so kein anderer Ausweg, als von ihm selbst zu verlangen, daß er abreist. Ich fühle, daß das schwer zu machen ist; da ihm aber, wie mir scheint, etwas daran liegt, mir zu beweisen, daß er in Wirklichkeit mehr Ehrenhaftigkeit besitzt, als man in ihm vermutet, so gebe ich die Hoffnung nicht auf, daß es mir gelingt. Es ist mir sogar ganz recht, ihm das selbst zu sagen und so eine Gelegenheit zu haben, zu sehen, ob die anständigen Frauen, wie er immer behauptete, sich wirklich nie über ihn zu beklagen Grund hatten und haben werden.
Wenn er, wie ich es wünsche, geht, so wird das auch wirklich nur Rücksicht für mich sein; denn ich weiß, daß er die bestimmte Absicht hatte, den größten Teil des Herbstes hier zu verbringen. Lehnt er ab und bleibt er, so ist es für mich immer noch Zeit, selbst abzureisen, und ich verspreche Ihnen das.
Das ist, glaube ich, alles, gnädige Frau, was Ihre Freundschaft von mir verlangt hat, und ich beeile mich, dem zu entsprechen und Ihnen zu beweisen, daß ich trotz der »Wärme«, mit der ich Herrn von Valmont verteidigt habe, doch nicht weniger geneigt bin, die Ratschläge meiner Freundin nicht nur anzuhören, sondern auch zu befolgen.
Auf Schloß . . ., den 25. August 17..
Achtunddreissigster Brief
Die Marquise von Merteuil an den Vicomte von Valmont.
Gerade bekomme ich Ihr großes Briefpaket, mein lieber Vicomte. Wenn das Datum stimmt, hätte ich es vierundzwanzig Stunden früher erhalten müssen, aber so oder so – nähme ich mir die Zeit, es zu lesen, so bliebe mir keine, darauf zu antworten. Ich bestätige Ihnen daher bloß den Empfang und sprechen wir von was anderem. Nicht als ob ich Ihnen von mir nichts zu erzählen hätte. Der schöne Herbst läßt fast keine Menschenseele in Paris, und so bin ich seit einem Monate von einer Solidität – zum Umkommen: jeder andere als mein Chevalier wäre meiner Beständigkeit schon müde. Da ich also untätig sein muß, amüsiere ich mich mit der kleinen Volanges – und von ihr will ich Ihnen erzählen.
Sie haben mehr verloren als Sie ahnen, daß Sie sich dieses Kindes nicht annehmen wollen! Die Kleine ist nämlich wirklich entzückend, hat weder Charakter noch »Grundsätze« – danach können Sie sich denken, wie angenehm und nett ihre Gesellschaft ist. Gefühl? Nein, das wird nie ihr Fall sein, aber Sinne, ja, die hat sie und wie lebhafte! Ohne Geist und ohne Raffinement hat sie doch so eine Art natürlicher Falschheit, wenn man so sagen kann, die mich manchmal erstaunt, und mit der sie um so mehr Erfolg haben wird, als ihr Gesicht das Bild der Unerfahrenheit und Naivität ist. Sie ist sehr verliebter Natur, und ich amüsiere mich manches Mal darüber; ihr kleines Köpfchen erhitzt sich mit einer unglaublichen Leichtigkeit und sie ist dann um so reizender, weil sie nichts, aber gar nichts von all dem weiß, was sie so gern wissen möchte. Es überkommt sie da eine Ungeduld, die sehr amüsant ist; sie lacht, sie ärgert sich, sie weint und dann bittet sie mich mit einer wirklich verführerischen Aufrichtigkeit um meine Belehrung. Ich bin wirklich beinahe eifersüchtig auf den, dem dieses Vergnügen aufbehalten ist.
Habe ich Ihnen schon gesagt, daß ich seit vier oder fünf Tagen die Ehre ihres Vertrauens genieße? Sie erraten wohl, daß ich zuerst die strenge Frau markierte, aber als ich bemerkte, daß sie mich mit ihren unvernünftigen Gründen überzeugt zu haben glaubte, tat ich, als nähme ich sie für vernünftige, und sie ist natürlich überzeugt, daß sie diesen Erfolg ihrer Beredsamkeit verdankt. – Diese Vorsicht war nötig, um mich nicht zu kompromittieren. Ich erlaubte ihr also zu schreiben und zu sagen »ich liebe«, und verschaffte ihr am selben Tage ein natürlich »zufälliges« Tête-à-Tête mit ihrem Danceny. Aber der ist noch so blöde, daß er nicht einmal einen Kuß bekam. Doch macht er schöne Verse! Mein Gott, wie sind doch die geistreichen Leute dumm! Und der da ist es in einer Weise, die mich noch in Verlegenheit bringen wird; denn ihn kann ich doch nicht führen, schon seinetwegen nicht!
Jetzt wären Sie mir sehr von Nutzen. Sie sind mit Danceny gut genug befreundet, um sein Vertrauen zu gewinnen, und wenn Sie dieses einmal haben, könnten Sie ihn etwas auf die Beine bringen. Treiben Sie doch Ihre Nonne ein bißchen zur Eile; denn ich will nicht, daß Gercourt davon verschont bleibt; übrigens sprach ich gestern von ihm zu der Kleinen, und habe ihn ihr so gut beschrieben, daß sie ihn nicht mehr hassen könnte, wenn sie schon zehn Jahre seine Frau wäre. Ich habe ihr aber doch auch sehr viel von der ehelichen Treue gepredigt; nichts kommt meiner Strenge in diesem Punkte gleich. So sorge ich auf einer Seite um den guten Ruf meiner Tugend, den ein zu viel Eingehen auf die Liebesangelegenheiten der Kleinen zerstören könnte, und mehre auf der anderen Seite den Haß, mit dem ich ihren künftigen Mann beglücken will. Und dann hoffe ich ihr damit begreiflich zu machen, daß es ihr nur während ihrer kurzen Mädchenzeit erlaubt ist, von der Liebe Gebrauch zu machen, und so wird sie sich schneller entschließen, nichts von dieser kostbaren Zeit zu verlieren.
Adieu, Vicomte. Ich will jetzt Toilette machen und dabei Ihren Briefband lesen.
Paris, den 27. August 17..
Neununddreissigster Brief
Cécile Volanges an Sophie Carnay.
Ich bin traurig und unruhig, meine liebe Sophie. Und ich habe fast die ganze Nacht geweint. Nicht als ob ich im Augenblick nicht sehr glücklich wäre, aber ich seh' es voraus, es wird nicht dauern.
Gestern war ich mit Frau von Merteuil in der Oper. Wir sprachen viel von meiner Heirat, und ich hörte nichts Gutes darüber. Es ist der Graf von Gercourt, den ich heiraten soll, und zwar im Oktober. Er ist reich, vornehm und Oberst in einem Husarenregiment. – Bis dahin ist alles ganz gut. Aber zuerst einmal ist er alt. Denk Dir, er ist mindestens sechsunddreißig! Und dann, sagt Frau von Merteuil, ist er ein Sauertopf und streng, und daß sie fürchtet, ich würde nicht glücklich mit ihm sein. Ich habe es ganz deutlich gemerkt, daß sie das ganz sicher weiß und daß sie es mir nur nicht sagen wollte, um mich nicht zu betrüben. Sie hat mich fast den ganzen Abend darüber unterhalten, was für Pflichten die Frauen gegenüber ihren Männern hätten, und dann gibt sie zu, daß Herr von Gercourt gar nicht liebenswürdig ist und sagt, ich müßte ihn dennoch lieben. Hat sie mir aber nicht auch gesagt, daß ich, einmal verheiratet, den Chevalier von Danceny nicht mehr lieben dürfte? Als ob das möglich wäre! Aber ich versichere Dir, ich werde ihn immer lieben. Siehst Du, eher würde ich mich gar nicht verheiraten. Soll sich dieser Herr von Gercourt einrichten wie er will, ich habe ihn nicht gerufen. Er ist jetzt in Korsika, und das ist sehr weit weg von hier, und ich möchte, er soll zehn Jahre dort bleiben. Wenn ich nicht Angst hätte, ins Kloster zurück zu müssen, so würde ich Mama sagen, daß ich diesen Mann nicht mag; aber das Kloster wäre doch noch schlimmer. Du siehst, ich bin in einer schrecklichen Verlegenheit. Ich fühle, daß ich Herrn von Danceny noch nie so geliebt habe wie jetzt, und wenn ich bedenke, daß mir nur noch ein Monat bleibt, das zu sein, was ich jetzt bin, so kommen mir immer gleich die Tränen in die Augen. Mein einziger Trost ist die Freundschaft mit Frau von Merteuil. Sie hat so ein gutes Herz, und sie fühlt all meinen Kummer mit mir, und sie ist so lieb, daß, wenn ich bei ihr bin, ich fast gar nicht mehr an die schreckliche Sache denke. Dann ist sie mir auch sehr nützlich, denn das wenige, das ich weiß, verdanke ich nur ihr und sie ist so gut, daß ich ihr alles sage, was ich denke, ohne mich zu schämen. Wenn sie findet, daß etwas nicht recht ist, zankt sie mich auch mal, aber das tut sie so lieb, und dann küsse ich sie so von Herzen, bis sie nicht mehr bös ist. Sie kann ich wenigstens lieben soviel ich Lust habe, ohne daß dabei was Schlimmes ist und das macht mir viel Freude. Wir sind jedoch übereingekommen, daß wir vor den Leuten uns nicht so zeigen, wie wir uns lieben, besonders nicht vor Mama, damit sie wegen Danceny nichts denkt. Ich versichere Dir, wenn ich immer so leben könnte wie jetzt, würde ich sehr glücklich sein. Nur dieser ekelhafte Herr von Gercourt ...
Aber ich mag Dir nicht mehr darüber schreiben, denn ich würde wieder traurig werden. Statt dessen werde ich lieber an den Chevalier Danceny schreiben und ihm nur von meiner Liebe erzählen und nichts von meinem Kummer sagen, denn ich will ihn nicht traurig machen.
Adieu, meine liebe Freundin. Du siehst wohl, daß Du Unrecht hattest, Dich zu beklagen, und daß ich, auch noch so beschäftigt, wie Du sagst, doch immer so viel Zeit übrig habe, Dich zu lieben und Dir zu schreiben.
Paris, den 27. August 17..
[Wir unterdrücken in der Folge Briefe von Cécile Volanges und Danceny, da sie weder interessant sind noch Begebenheiten mitteilen. C. D. L.]
Vierzigster Brief
Der Vicomte von Valmont an die Marquise von Merteuil.
Das ist für meine grausame Schöne noch zu wenig, nicht auf meine Briefe zu antworten und sie nicht anzunehmen – sie will mir ihren Anblick entziehen, sie verlangt, daß ich abreise. Worüber Sie aber staunen werden: ich unterwerfe mich und reise. Sie werden mir Unrecht geben. Doch ich habe geglaubt, die Gelegenheit, mir etwas befehlen zu lassen, nicht besser nützen zu können, denn ich bin davon überzeugt, daß der, der befiehlt, sich verpflichtet; und dann ist diese scheinbare Macht, die wir den Frauen so gerne geben, eine der Fallen, denen sie am schwersten entgehen. Und noch eins: die Geschicklichkeit, mit der sie ein Alleinsein mit mir vermied, brachte mich in eine ganz gefährliche Situation, aus der ich um jeden Preis herausmußte: ich war immer um sie ohne die Möglichkeit, sie mit meiner Liebe zu beschäftigen, und so war die Gefahr nahe, daß sie sich schließlich daran gewöhnte, mich zu sehen und ohne Erregung zu sehen. Und das ist, wie Sie gut wissen, eine Situation, aus der herauszukommen sehr schwer ist.
Übrigens können Sie sich denken, daß ich mich nicht bedingungslos gefügt habe. Ich hatte sogar die Vorsicht, eine Bedingung zu stellen, die unmöglich zu erfüllen ist, um einerseits immer Herr zu bleiben, mein Wort zu halten oder zu brechen, und dann auch, um einen Verkehr – mündlich oder schriftlich – in dem Augenblick einleiten zu können, wo meine Schöne zufriedener mit mir ist und das Bedürfnis hat, daß ich zufriedener mit ihr wäre. Zu all dem noch dies, daß ich sehr ungeschickt wäre, wenn ich keine Mittel fände, eine Entschädigung für das Aufgeben dieser meiner Bedingung zu bekommen, so unhaltbar sie auch ist.
Nachdem ich Ihnen in dieser langen Einleitung meine Gründe auseinandergesetzt habe, erzähle ich Ihnen die Geschichte dieser zwei letzten Tage. Als Belege dienen die Briefe meiner Dame und meine Antwort darauf. Es wird wenige Historiker geben, die so exakt sind wie ich, nicht wahr?
Sie erinnern sich der Wirkung meines Briefes aus Dijon. Der Rest des Tages war recht bewegt. Die schöne Frau erschien erst zum Diner wieder und kündigte eine schwere Migräne an, – ein Vorwand, um eine dieser heftigen Stimmungskrisen zu maskieren, die Frauen haben können. Ihr Gesicht war wirklich merkwürdig verändert; der sanfte Ausdruck, den Sie an ihr kennen, bekam eine Nuance Trotz, was eine ganz neue Schönheit aus ihr machte. Ich will mir diese Entdeckung für den späteren Gebrauch merken und manchmal die sanfte Geliebte von dieser seltsam trotzigen ablösen lassen.
Ich sah einen trüben Nachmittag voraus, vor dessen Langeweile ich mich damit rettete, daß ich Briefe schreiben zu müssen vorgab und mich auf mein Zimmer zurückzog. Ich kam gegen sechs Uhr in den Salon zurück. Frau von Rosemonde schlug eine Spazierfahrt vor, was angenommen wurde. Aber gerade da wir in den Wagen steigen wollten, bekam meine angebliche Kranke höchst boshaft einen neuen Kopfschmerzanfall – vielleicht auch um sich an meinem »Briefschreiben« zu rächen – und ließ mich erbarmungslos ein Tête-à-Tête mit meiner alten Tante genießen. Ich weiß nicht, ob die Verwünschungen, die ich gegen diesen weiblichen Satan ausstieß, erhört wurden, aber bei unserer Rückkehr fanden wir ihn zu Bett.
Am nächsten Tage war ihre natürliche Sanftmut wieder da, und ich glaubte, mir wäre verziehen. Das Frühstück war kaum zu Ende, als diese nun wieder so sanfte Frau sich ruhig-gleichgültig erhob und in den Park ging; ich folgte natürlich, wie Sie sich denken können. »Woher diese Lust spazieren zu gehen?« fragte ich. – »Ich habe heute morgen viel geschrieben.« sagte sie, »und mein Kopf ist etwas müde.« – »Bin ich nicht so glücklich,« erwiderte ich, »mir die Ursache dieser Müdigkeit geben zu dürfen?« – »Ich habe Ihnen wohl geschrieben, aber ich weiß noch nicht, ob ich Ihnen den Brief geben soll. Er enthält eine Bitte, und Sie haben mich nicht daran gewöhnt, von einer Bitte Erfüllung zu hoffen.« – »Ich schwöre, wenn es mir möglich ist ...« – »Nichts ist leichter« – unterbricht sie mich – »und trotzdem Sie sie aus Gerechtigkeit erfüllen sollten, werde ich es als eine Gnade ansehen.« Sie gab mir ihren Brief; ich nahm ihn, und nahm auch ihre Hand, die sie ohne Unwillen und mit mehr Verlegenheit als Eile zurückzog. »Die Hitze ist doch stärker als ich dachte,« sagte sie, »wir müssen ins Haus zurück.« – Und sie nahm den Weg zum Schloß. Umsonst waren alle Versuche, sie zur Verlängerung des Spazierganges zu bewegen, und ich mußte mich daran erinnern, daß man uns sehen könnte, um nicht mehr als Worte aufzuwenden. Sie kehrte um und sprach kein Wort; und mir war klar, daß sie mit diesem Spaziergang keinen anderen Zweck hatte, als mir ihren Brief zu geben. Sie ging in ihre Zimmer und ich in die meinen, um die Epistel zu lesen, die ich Ihnen ebenfalls zu lesen rate, wie auch meine Antwort, bevor ich weiter erzähle.
Einundvierzigster Brief
Frau von Tourvel an den Vicomte von Valmont.
Es kommt mir vor, Vicomte, als ob Sie mit Ihrem Benehmen Tag für Tag nur die Gründe meiner Klagen über Sie vermehren wollten. Hartnäckig sind Sie darauf aus, mir von Ihrer Liebe zu sprechen, was ich weder hören will noch darf. Sie treiben Mißbrauch mit meinem Vertrauen oder meiner Schüchternheit und scheuen sich nicht, mir Ihre Briefe zukommen zu lassen und das auf eine wenig delikate Weise, wie ich wohl sagen kann. Den letzten Brief schickten Sie mir, ohne im mindesten die Wirkung einer Überraschung zu befürchten, die mich hätte arg bloßstellen können. Alles das gäbe mir wohl Anlaß genug, Ihnen die stärksten und verdientesten Vorwürfe zu machen. Doch ich will statt all dem nur eine Bitte an Sie stellen, und wenn Sie mir ihre Erfüllung zusagen, dann soll alles vergessen sein.
Sie selbst haben mir gesagt, daß ich für alles, was ich Sie bitte, keinen abschlägigen Bescheid zu fürchten brauche, und trotzdem dieser Zusage mit der Ihnen eigenen Inkonsequenz die einzige Ablehnung folgte, die Sie mir geben konnten, so will ich doch glauben, daß Sie heute ebenso formell Ihr Wort halten werden, wie Sie es mir vor einigen Tagen gegeben haben.
Ich wünsche also, daß Sie die Güte haben, abzureisen, den Ort zu verlassen, wo Ihr längeres Verweilen mich nur noch mehr dem Gerede der Welt aussetzen könnte, die ja immer schnell dabei ist, von anderen schlecht zu denken, und die Sie nur allzu sehr daran gewöhnt haben, sich jene Frauen ganz besonders anzusehen, die Sie mit Ihrer Gesellschaft auszeichnen.
Meine Freunde haben mich schon lange vor der Gefahr gewarnt, aber ich habe diese Warnung ignoriert, ja sogar die schlimme Meinung bekämpft, solange Ihr Betragen mir gegenüber mich in dem Glauben ließ, daß Sie mich nicht in die große Zahl jener Frauen einschließen, die alle Ursache hatten, sich über Sie zu beklagen. Heute, wo Sie mich so wie jene behandeln und wo ich das nicht länger ignorieren kann, heute bin ich es der Welt, meinen Freunden und mir selbst schuldig, einem notwendigen Entschluß zu folgen. Ich könnte noch dies bemerken, daß Sie durch eine Weigerung nichts gewinnen würden, da ich entschlossen bin, selbst zu reisen, wenn Sie darauf bestehen, zu bleiben. Aber ich will die Verpflichtung, die ich Ihnen für Ihre Gefälligkeit schuldig sein werde, nicht verkleinern, und so sage ich Ihnen, daß es mir momentan nicht angenehm wäre, abzureisen. Beweisen Sie mir also, wessen Sie mich so oft versicherten: daß anständige Frauen sich nie über Sie zu beklagen haben, oder beweisen Sie mir wenigstens, daß Sie es wieder gut zu machen wissen, wenn Sie ihnen Unrecht getan haben.
Habe ich es noch nötig, meine Bitte zu rechtfertigen? Es würde dazu genügen, Ihnen zu sagen, daß Sie eben Ihr Leben so verbrachten, daß diese meine Bitte nötig ist, und daß es nicht meine Schuld ist, wenn ich sie stelle. Aber wir wollen uns nicht an Dinge erinnern, die ich vergessen will und die mich zur Strenge zwingen würden und dies in einem Augenblick, wo ich Ihnen Gelegenheit gebe, sich meine Dankbarkeit zu verdienen. Adieu. Und was Sie tun, wird mir sagen, mit welchen Gefühlen ich für das Leben sein werde Ihre ergebene von T.
Schloß . . .,25. August 17..
Zweiundvierzigster Brief
Vicomte von Valmont an die Frau von Tourvel.
So schwer auch Ihre Bedingungen sind, gnädige Frau, – ich will sie erfüllen. Ich fühle, daß es mir unmöglich wäre, irgendeinem Ihrer Wünsche entgegen zu sein. Nun, da wir darüber einig sind, darf ich wohl hoffen, daß Sie auch mir um etwas zu bitten erlauben, das leichter zu gewähren ist, als um was Sie mich baten, und das ich doch nur durch meine völlige Unterwerfung unter Ihren Willen erlangen will.
Das eine, das mir hoffentlich Ihr Gerechtigkeitssinn zugestehen wird, ist, daß Sie mir die Namen jener meiner Ankläger nennen; sie tun mir doch, scheint es, Schlimmes genug, als daß ich nicht das Recht beanspruchen könnte, zu wissen, wer sie sind. Das andere, um das ich Sie bitte, ist, daß Sie mir auch in Zukunft erlauben, Ihnen manchmal die Huldigung einer Liebe zu Füßen zu legen, die mehr denn je Ihres Mitleids bedarf.
Bedenken Sie, gnädige Frau, daß ich mich beeile, Ihnen zu gehorchen – selbst auf Kosten meines Glückes, ja trotz meiner festen Überzeugung, daß Sie meine Abreise nur wünschen, um nicht mehr das Opfer Ihrer Herzlosigkeit zu sehen, was immer ein peinlicher Anblick ist.
Gestehen Sie doch, gnädige Frau, daß Sie das Gerede der Gesellschaft nicht fürchten, die, daran gewöhnt, Sie zu respektieren, nie eine schlechte Meinung über Sie haben wird, – daß Sie doch nur die Gegenwart eines Mannes lästig empfinden, den Sie wohl leicht bestrafen, aber schwer verurteilen können. Sie verbannen mich, – wie man den Blick von einem Unglücklichen abwendet, dem man nicht helfen will. Aber wenn nun die Trennung meine Qualen, verdoppelt, an wen anders als an Sie kann ich meine Klagen richten? Von wem sonst kann ich den Trost erwarten, der mir so nötig sein wird? Werden Sie ihn mir verweigern, wo Sie doch allein meiner Leiden Ursache sind?
So werden Sie wohl auch nicht darüber erstaunt sein, daß mir viel und alles daran liegt, vor meiner Abreise die Gefühle zu rechtfertigen, die Sie mir einflößten, so wie ich auch den Mut zu reisen nicht fände, bevor ich nicht den Befehl aus Ihrem Munde habe.
Das beides läßt mich um einen Augenblick der Aussprache bitten. Vergeblich würden wir uns darüber Briefe schreiben – man schreibt Bände und sagt schlecht, wozu eine Viertelstunde miteinander Sprechens genügt, um sich zu verstehen. Sie werden leicht eine Zeit für diese Unterredung finden. Ich will mich ja beeilen, Ihnen zu gehorchen, aber Sie wissen, daß Frau von Rosemonde meine Absicht kennt, den Herbst bei ihr zu verbringen, und ich müßte wenigstens einen Brief von Paris abwarten, der mir den Vorwand zu einer plötzlichen Abreise gäbe.
Leben Sie wohl, gnädige Frau. Nie noch ist mir dieses Wort so schwer geworden als hier, wo es mich an unsere Trennung erinnert. Wenn Sie ahnten, was ich davon leide, wüßten Sie mir wohl einen Dank für meine Folgsamkeit.
Empfangen Sie wenigstens mit einiger Nachsicht die Versicherung meiner zärtlichsten und ehrfurchtsvollsten Liebe. V.
Schloß . . ., 26. August 17..
Dreiundvierzigster Brief
Frau von Tourvel an den Vicomte von Valmont.
Weshalb wollen Sie meine Erkenntlichkeit kleiner machen, Vicomte? Warum wollen Sie nur halb folgen und bei einem doch so ehrlichen Handel feilschen? Ist es Ihnen nicht genug, daß ich den Preis voll schätze? Sie verlangen von mir nicht nur viel, Sie verlangen Unmögliches! Wenn mir wirklich meine Freunde von Ihnen erzählt haben, so haben sie das doch nur aus Freundschaft für mich getan, und selbst wenn sie sich irrten, so wäre ihre Absicht deshalb nicht weniger gut gewesen. Und nun verlangen Sie, daß ich diese Beweise guter Freundschaft damit belohne, daß ich Ihnen meine Freunde preisgebe!
Es war schon nicht recht, daß ich Ihnen davon etwas sagte, und Sie lassen mich das jetzt genug fühlen. Was für jeden andern bloß Aufrichtigkeit gewesen wäre, wird Ihnen gegenüber zum Leichtsinn, und würde gemeine Verleumdung, wenn ich Ihrem Verlangen nachgäbe. Ich appelliere an Sie selbst, an Ihre Ehrenhaftigkeit – halten Sie mich wirklich einer solchen Handlung für fähig? Durften Sie mir das zumuten? Doch sicher nicht; und ich bin fest davon überzeugt, Sie werden nicht mehr darauf zurückkommen, wenn Sie darüber nachdenken.
Der andere Wunsch, daß Sie mir schreiben wollen, ist kaum leichter zu gewähren. Ich will Sie nicht beleidigen – aber welche Frau könnte bei dem schlimmen Ruf, den Sie haben und den Sie nach Ihrem eigenen Geständnis wenigstens zum Teil verdienen, welche Frau könnte da ruhig sagen, daß sie mit Ihnen Briefe wechsle, und welche anständige Frau könnte etwas tun, was sie zu verheimlichen genötigt wäre? Ja, wenn Ihre Briefe so wären, daß ich niemals mich darüber zu beklagen Ursache hätte und ich es immer vor mir selber rechtfertigen könnte, sie empfangen zu haben, dann würde mich vielleicht der Wunsch, Ihnen zu beweisen, daß mich Vernunft und nicht Haß leitet, über die starken Bedenken wegkommen und mich mehr tun lassen als ich dürfte, indem ich Ihnen erlaube, mir manchmal zu schreiben. Wenn Sie das wirklich so sehr wünschen, wie Sie sagen, werden Sie sich gern der einzigen Bedingung fügen, unter der ich darein willige. Und wenn Sie nur etwas Dankbarkeit für das haben, was ich jetzt für Sie tue, werden Sie Ihre Abreise sofort ins Werk setzen. Sie bekamen doch heute morgen einen Brief und haben diese Gelegenheit doch nicht, wie Sie mir versprachen, benutzt, Frau von Rosemonde Ihre dringend nötige Abreise mitzuteilen. Hoffentlich hält Sie nun nichts mehr davon ab, Ihr Wort zu halten, und ich erwarte bestimmt, daß Sie nicht erst auf die von Ihnen verlangte mündliche Unterredung warten, zu der ich mich unter keiner Bedingung bestimmen lassen werde. Statt des Befehles, den Sie angeblich nötig haben, werden Sie sich wohl nun mit der wiederholten Bitte zufrieden geben. Und so Adieu. von T.
Schloß . . ., den 27. August 17..
Vierundvierzigster Brief
Der Vicomte von Valmont an die Marquise von Merteuil.
Nun wollen wir überlegen, meine schöne Freundin. Sie wissen wie ich, daß die höchst gewissenhafte und sehr anständige Frau von Tourvel die erste meiner zwei Forderungen einfach nicht gewähren kann – sie wird das Vertrauen ihrer Freunde nicht verraten, indem sie mir die Namen meiner guten Feinde nennt. Da ich aber alles nur auf die Erfüllung dieser Bedingung hin verspreche, verspreche ich gar nichts. Nun wird aber die abschlägige Antwort, die sie mir sicher geben wird, für mich ein Anrecht auf alles übrige, wobei ich nur gewinne: ich reise ab und korrespondiere mit ihr. Denn auf das verlangte Rendezvous lege ich keinen Wert und hatte das keinen andern Zweck, als sie so allmählich daran hinzuführen, mir spätere wichtigere und nötigere Zusammenkünfte nicht abzuschlagen.
Eines bleibt mir vor meiner Abreise noch zu tun: ich muß herausbekommen, wer die Leute sind, die sich bei ihr mit meiner Person so liebenswürdig beschäftigen. Vielleicht ihr Idiot von Mann, und das wäre mir nicht unangenehm. Abgesehen davon, daß die eheliche Notwehr dem Verlangen eine Lust mehr ist, bin ich sicher, daß ich von dem Augenblick an, da mein Schatz in die Korrespondenz einwilligt, nichts mehr von ihrem Manne zu fürchten habe, denn da betrügt sie ihn schon.
Sollte es aber eine intime Freundin von ihr sein, die bei ihr gegen mich hetzt, so muß ich die beiden natürlich auseinanderbringen, und das werde ich schon fertig bekommen. Aber wissen muß ich es vor allem. Gestern dachte ich schon, daß mir die nötige Aufklärung würde, aber diese sonderbare Frau tut alles anders als andere Frauen. Wir waren bei ihr, als man zum Diner ruft. Sie war gerade mit der Toilette fertig, beeilt sich, entschuldigt sich und läßt darüber, wie ich bemerkte, den Schlüssel zu ihrem Schreibtisch stecken; den zu ihren Räumen zieht sie nie ab. Während der Mahlzeit höre ich ihre Kammerjungfer herunterkommen, ich schütze Nasenbluten vor und gehe hinaus. Stürme an den Schreibtisch, dessen Schubladen alle offen sind – und finde nicht ein einziges beschriebenes Blatt. Und jetzt heizt man doch nicht! Aber was macht sie denn mit den vielen Briefen, die sie bekommt? Ich habe alles durchsucht und nichts dabei gewonnen als die Überzeugung, daß die kostbaren Briefe in ihrer Tasche bleiben. Aber wie sie da herausbekommen? Seit gestern denke ich über ein Mittel nach, und ich muß die Briefe haben! Man kann so viel und hat kein Talent zum Taschendieb. Die Liebe und ihre Künste sollten wirklich in den Erziehungsplan des Menschen aufgenommen werden. Aber unsere Eltern und Lehrer denken an gar nichts, und ich muß es tun und komme nur darauf, daß ich ungeschickt bin und das nicht ändern kann.