PLATON - Gesammelte Werke
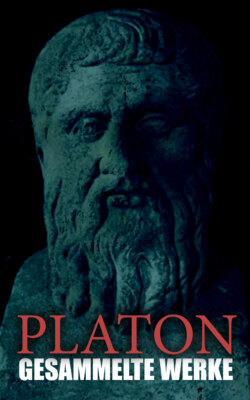
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Платон. PLATON - Gesammelte Werke
PLATON - Gesammelte Werke
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Platons Leben und Werk
Werke
Tetralogie I
Euthyphron (Über die Frömmigkeit)
Einleitung
EUTHYPHRON. EUTHYPHRON • SOKRATES
Apologie des Sokrates
Einleitung
DES SOKRATES VERTEIDIGUNG
NACH DER VERURTEILUNG
Kriton
Einleitung
KRITON. SOKRATES • KRITON
Phaidon (Über die Unsterblichkeit der Seele)
Einleitung
PHAIDON. ECHEKRATES • PHAIDON
Tetralogie II
Kratylos (Über die Sprachkunde)
Einleitung
KRATYLOS. HERMOGENES • KRATYLOS • SOKRATES
Theaitetos (Die Erkenntnistheorie)
Einleitung
THEAITETOS (142) EUKLEIDES • TERPSION
Sokrates • Theodoros • Theaitetos
Der Sophist
Einleitung
DER SOPHIST. THEODOROS • SOKRATES • FREMDER AUS ELEA • THEAITETOS
Der Staatsmann (Politikos)
Einleitung
DER STAATSMANN. SOKRATES • THEODOROS • DER FREMD • SOKRATES DER JÜNGERE
Tetralogie III
Parmenides
Einleitung
(126) PARMENIDES. KEPHALOS ERZÄHLT
Philebos (Verhältnis von Lust, Intelligenz und Gut)
Einleitung
PHILEBOS. SOKRATES • PROTARCHOS • PHILEBOS
Symposion (Das Gastmahl)
Tetralogie IV
Phaidros (Vom Schönen)
Einleitung
Phaidros. Sokrates • Phaidros
Alkibiades (Der sogenannte Erste)
Einleitung
ALKIBIADES. SOKRATES • ALKIBIADES
Alkibiades (Der sogenannte Zweite oder Kleiner Alkibiades)
Einleitung
ALKIBIADES. SOKRATES • ALKIBIADES
Hipparchos
Einleitung
HIPPARCHOS. SOKRATES • EIN FREUND
Die Nebenbuhler (Anterastai)
Einleitung
DIE NEBENBUHLER. SOKRATES ERZÄHLT
Tetralogie V
Theages
Einleitung
THEAGES. DEMODOKOS • SOKRATES • THEAGES
Charmides (Die Bedeutung der Besonnenheit)
Einleitung
CHARMIDES (153) SOKRATES ERZÄHLT
Laches (Über die Tapferkeit)
Einleitung
LACHES. LYSIMACHOS • MELESIAS • NIKIAS • LACHES • DIE SÖHNE DES LYSIMACHOS UND MELESIAS • SOKRATES
Lysis (die Natur der Philia)
Einleitung
LYSIS (203) SOKRATES ERZÄHLT
Tetralogie VI
Euthydemos
Einleitung
EUTHYDEMOS. KRITON • SOKRATES
Protagoras (Über die Lehrbarkeit der Tugend)
Einleitung
PROTAGORAS. EIN FREUND • SOKRATES
Gorgias (Rhetorik als Propagandamittel)
Einleitung
GORGIAS. KALLIKLES • SOKRATES • CHAIREPHON • GORGIAS • POLOS
Menon
Einleitung
Menon. Menon • Sokrates • Ein Knabe des Menon • Anytos
Tetralogie VII
Hippias maior (Das größere Gespräch dieses Namens)
Einleitung
HIPPIAS. SOKRATES • HIPPIAS
Hippias minor (Das kleinere Gespräch dieses Namens)
Einleitung
HIPPIAS. EUDIKOS • SOKRATES • HIPPIAS
Ion
Einleitung
ION. SOKRATES • ION
Menexenos (Die Rhetorik der Parodie)
Einleitung
MENEXENOS. SOKRATES • MENEXENOS
Tetralogie VIII
Kleitophon
Einleitung
KLEITOPHON. SOKRATES • KLEITOPHON
Politeia (Der Staat)
Einleitung
Erstes Buch
Zweites Buch
Drittes Buch
Viertes Buch
Fünftes Buch
Sechstes Buch
Siebentes Buch
Achtes Buch
Neuntes Buch
Zehntes Buch
Timaios (Über die Natur, Kosmologie und Weltseele)
01. Wiederholung der Hauptpunkte einer von Sokrates durchgeführten Rede über den besten Staat
02. Wunsch des Sokrates, den von ihm entworfenen Staat auch in Bewegung und Kampf zu sehen. Kritias über eine Kunde von alten Taten Athens
03. Der Bericht des Solon über sein Bekanntwerden mit alter ägyptischer Überlieferung
04. Bereitschaft des Kritias, die Erzählung im Einzelnen zu berichten. Voranstellung einer Rede des Timaios über das Entstehen der Welt
05. Unterscheidung zwischen dem Seienden und dem Werdenden. Die Welt als geworden und als nach einem Vorbild geschaffenes Abbild
06. Grund der Schöpfung und Vorbild der Welt. Ihre Einzigkeit
07. Der Leib der Welt. Grund seines Bestehens aus vier Bestandteilen und seiner Kugelgestalt
08. Die Zusammenfügung der Weltseele
09. Das Erkennen der Seele
10. Erschaffung der Zeit als bewegliches Abbild der Unvergänglichkeit
11. Die Planeten als Erzeuger der Zeit. Ihre Bahnen
12. Die vier Gattungen des Lebenden. Bewegung und Wesen der sichtbaren Götter
13. Die übrigen Götter. Der Auftrag des Weltschöpfers an sie
14. Erschaffung der menschlichen Seelen. Ihre Belehrung über die Gesetze des Schicksals
15. Durch die Einkörperung bedingte Verwirrung der Seelenumläufe
16. Bildung des Kopfes und der Glieder. Das Auge: Erklärung des Sehens und seines eigentlichen Nutzens. Stimme und Gehör
17. Übergang zu einem neuen Anfang: Das Entstehen durch Notwendigkeit
18. Die dritte Gattung: Das Worin des Werdens. Bestimmung seiner Art und des Verhältnisses des Seienden und Werdenden zu ihm
19. Zustand des Raumes und der Grundstoffe vor Erschaffung der Welt
20. Die Entstehung der vier ursprünglichen Körper aus dem Zusammentreten der zwei schönsten Dreiecke
21. Möglichkeit von fünf Welten? Verteilung der ursprünglichen Körper an die vier Grundstoffe
22. Der Übergang der Grundstoffe ineinander
23. Erklärung der immerwährenden Bewegung der Körper
24. Arten des Feuers und des Wassers: Das Flüssige und das Geschmolzene. Erklärung des Schmelzens und Erstarrens
25. Arten der Erde. Aus Erde und Wasser bestehende Stoffe
26. Erklärung der Beschaffenheiten warm und kalt, hart und weich, schwer und leicht, rauh und glatt
27. Wahrnehmbare und nicht wahrnehmbare Eindrücke. Die Lust- und Schmerzgefühle
28. Die Entstehung der Geschmacksempfindungen: scharf und herb, ätzend und salzig, sauer und süß
29. Geruchswahrnehmung und Gehör
30. Die Gesichtswahrnehmung. Erklärung der Farben
31. Erschaffung des sterblichen Teils der Seele und sein Sitz im Leibe. Herz und Lungen
32. Ansiedlung des begierigen Teils der Seele im Bauch. Beschaffenheit und Aufgabe von Leber und Milz
33. Unterleib und Gedärme. Mark, Knochen, Fleisch und Sehnen. Verteilung des Fleisches, Haut, Haare und Nägel
34. Die Natur der Pflanzen
35. Die zwei Hauptadern und das Bewässerungssystem des Körpers
36. Die Ursachen und der Vorgang des Atmens
37. Den Vorgängen beim Atmen verwandte Erscheinungen
38. Bildung des Bluts. Wachstum, Alter und natürlicher Tod
39. Die Entstehung der zwei ersten Arten körperlicher Krankheiten
40. Die durch Luft, Schleim und Galle entstehende dritte Art von Krankheiten des Körpers
41. Krankheiten der Seele: Der Unverstand und seine zwei Arten
42. Mittel zur Heilung und Erhaltung des Körpers und der Seele
43. Die Pflege der Seele
44. Entstehung der Frauen und Bildung der Geschlechtsorgane. Die übrigen Lebewesen. Schlusswort
Kritias (Über Atlantis)
(Atlanticus)
Tetralogie IX
Minos
Einleitung
MINOS. SOKRATES • EIN FREUND
Nomoi (Gesetze)
Erstes Buch
Zweites Buch
Drittes Buch
Viertes Buch
Fünftes Buch
Sechstes Buch
Siebentes Buch
Achtes Buch
Neuntes Buch
Zehntes Buch
Elftes Buch
Zwölftes Buch
Epinomis
oder: dreizehntes Buch der Gesetze (Philosophos)
Briefe
Erster Brief
Platon Wünscht Dem Dionysios Heil Und Segen Der Vernunft In Allen Seinen Handlungen
Zweiter Brief
Platon Wünscht Dem Dionysios Heil Und Segen Der Vernunft In Allen Seinen Handlungen
Dritter Brief
Platon An Dionysios
Vierter Brief
Platon Wünscht Dem Syracusaner Dion Heil Und Segen Der Vernunft In Allen Handlungen
Fünfter Brief
Platon Wünscht Dem Perdikkas Heil Und Segen Der Vernunft In Allen Seinen Handlungen
Sechster Brief
Platon Wünscht Dem Hermeias, Erastos Und Koriskos Heil Und Segen Der Vernunft In Allen Ihren Handlungen
Siebenter Brief
Platon Wünscht Dions Verwandten Und Einheimischen Freunden Sowie Den Politischen Brüdern Desselben Heil Und Segen Der Vernunft In Allen Ihren Handlungen
Achter Brief
Platon Wünscht Den Verwandten, Einheimischen Wie Auswärtigen Politischen Freunden Des Dion Segen Der Vernunft In Allen Handlungen Ihres Lebens
Neunter Brief
Platon Wünscht Dem Tarentiner Archytas Heil Und Segen Der Vernunft In Allen Seinen Handlungen
Zehnter Brief
Platon Wünscht Dem Aristodoros Den Segen In Allen Seinen Handlungen
Elfter Brief
Platon Wünscht Dem Laodamas Segen In Allen Seinen Handlungen
Zwölfter Brief
Platon Wünscht Dem Tarentiner Archytas Heil Und Segen Der Vernunft In Allen Seinen Handlungen
Dreizehnter Brief
Platon Wünscht Dem Herrn Von Syrakus, Dionysius, Segen Und Heil Der Vernunft In Seinen Handlungen
Отрывок из книги
Platon
Apologie des Sokrates + Der Staat - Politeia + Das Gastmahl + Alkibiades + Phaidros + Timaios + Kritias + Menon + Kriton + Hippias + Theages + Der Sophist + Protagoras + Die Briefe und viel mehr
.....
Hermogenes: Das will ich tun; sprich du nur dreist.
Sokrates: Zuerst scheint mir das R gleichsam das Organ jeder Bewegung zu sein, welche wir ja selbst auch noch nicht erklärt haben, woher sie diesen Namen führt. Aber es ist wohl offenbar, daß er auch ein Gehen bedeuten will, und er kommt von Weg her; nur daß wir kein einfaches Zeitwort wegen mehr haben. Sich bewegen heißt aber soviel als sich auf den Weg machen, und Bewegung also drückt das auf dem Wege sein aus; indes könnte man auch das Gehn dazu nehmen, und Weggehung sagen oder Weggang. Das Stehen aber will nur ein Stillen des Gehens ausdrücken, der Verschönerung wegen aber ist es Stehen genannt worden. Der Buchstabe R also, wie ich sage, schien dem, welcher die Benennungen festsetzte, ein schönes Organ für die Bewegung, indem er sie durch seine Rührigkeit selbst abbildet; daher bedient er sich desselben hiezu auch gar häufig. Zuerst schon in Strömen und Strom stellt er durch diesen Buchstaben die Bewegung dar; eben so in Trotz und in rauh, und in allen solchen Zeitwörtern wie rasseln, reiben, reißen, zertrümmern, krümeln, drehen, alle dergleichen bildet er größtenteils ab durch das R. Denn er sah, daß die Zunge hiebei am wenigsten still bleibt, sondern vorzüglich erschüttert wird, daher gewiß hat er sich dessen hiezu bedient. Das G hingegen zu allem dünnen und zarten, was am leichtesten durch alles hindurchgeht; (427) daher stellt er das Gehen und das Gießen durch das G dar. Wie im Gegenteil durch W, S, Sch und Z, weil die Buchstaben sausend sind, stellt er alles dergleichen dar und benennt es damit, schaudern, sieden, zischen, schwingen, schweben; auch wenn er das schwellende nachahmt, scheint der Wortbildner meistenteils dergleichen Buchstaben anzuwenden. Dagegen scheint er das Zusammendrücken und Anstemmen der Zunge bei d und t und der Lippen bei b, und p, für eine nützliche Eigenschaft zu halten zur Nachahmung des bindenden dauernden so wie des Pech und Teer. Eben so hat er bemerkt, daß bei dem l die Zunge am behendesten schlüpft, und hat sich dieser Ähnlichkeit bedient um das lose, lockere und schlüpfrige selbst, und das leckere und leimige und viel anderes dergleichen zu benennen. Wo nun aber der entschlüpfenden Zunge die Kraft des G oder K zu Hülfe kommt, dadurch bezeichnet er das glatte, gleitende, gelinde, klebrige. Von dem n bemerkte er, daß es die Stimme ganz nach innen zurückhält, und benannte daher damit das innere und innige um durch den Buchstaben die Sache abzubilden. Das a widmete er dem ganzen, langen, das e dem gedehnten ebenen, weil die Buchstaben groß und vollständig tönen. Für das runde brauchte er das u als Zeichen, und drängte daher in den Namen des kugelrunden besonders soviel davon zusammen als möglich. Und so scheint auch im übrigen der Wortbildner sowohl durch Buchstaben als Silben jeglichem Dinge seine eigene Bezeichnung und Benennung angewiesen und hieraus denn das übrige ebenfalls nachahmend zusammengesetzt zu haben. Dieses nun, o Hermogenes, scheint mir die Richtigkeit der Benennungen sein zu wollen, wenn nicht unser Kratylos etwas anderes meint.
.....