Zurück auf Null
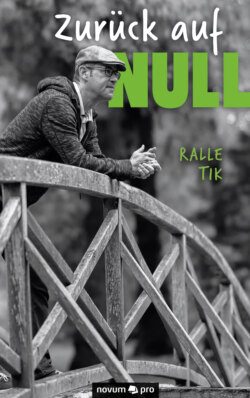
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Ralle Tik. Zurück auf Null
Impressum
Kapitel 6. An diesem Nachmittag bin ich ziemlich geplättet. Der junge Arzt besucht mich auf meinem neuen Zimmer auf Station. Er überreicht mir eine erste Informationsbroschüre, erklärt mir nochmal mit etwas mehr Ruhe den Therapieplan und gibt noch einiges an weiteren Informationen. Meine spezielle Therapie wird an meinen körperlichen Zustand in Kombination von Größe, Gewicht und seelischer Stabilität angepasst. Die Station wirkt auf mich höchst beruhigend, zuvorkommend und sehr freundlich. Egal wen man hier antrifft, jeder ist sehr bedacht auf seine Äußerungen oder sein Handeln. Es ist zu spüren, dass das Personal exakt weiß, welche Art von Patienten, welche Art von Krankheiten mit eventuell negativem Ausgang hier gepflegt werden. Noch während ich mir Sorgen mache, wie denn meine Frau meine neue Station an einem ganz anderen Platz im Klinikum finden wird, da kommt sie auch schon strahlend herein und sieht sich kurz um. „Na mein Schatz, du hast ja ein neues Zimmer. Schön.“ „Ja Wahnsinn. Und ich habe mir gerade noch Sorgen gemacht, wie du hierher finden solltest. Wer hat dir denn gesagt, dass ich hier bin?“ „Ja, da staunst du? Mich hat die Frau Dr. Stiegel angerufen. Die ist ja lieb. Ich war total überrascht, als mich jemand vom Krankenhaus anrief. ‚Ja Hallo. Hier spricht Frau Dr. Stiegel. Machen Sie sich keine Sorgen. Ihr Mann wurde soeben verlegt.‘ So in etwa war das Telefonat.“ „Echt? Du bist angerufen worden?“, hake ich fragend nach. „Ja. Und sie hat mir erklärt, dass wir jetzt endlich genau wissen, was für einen Krebs du hast und dass es ein Glück ist, dass du das alles so früh bemerken konntest. Jetzt steht dir zwar eine längere Krebstherapie bevor, aber das ist gegenüber den anderen Diagnosen die beste Variante. Sie sagte auch, dass du sehr gute Heilungschancen hättest. So ähnlich drückte sich Dr. Sarino auch aus oder? Aber nun erzähle mal, wie dein Tag heute war. Ich bin auf jeden Fall schon einmal beruhigter.“ Also erzähle ich meiner Frau vom Freitag, von den Torturen und dem wirklich nicht angenehmen Tag für mich. Sie staunt nicht schlecht. „Och mein armer Schatz. Das ist aber nicht toll.“ „Nein, wirklich nicht. Mir tut noch alles weh. Und jetzt liege ich auf diesem Zimmer.“ Dann gehen wir auf den Flur und setzen uns in die kleine Etagen-Küche. Es ist ein kleiner Raum mit einer Sitzgelegenheit für maximal 4 Personen. An einer Wand ist eine Küchenzeile von 2 m Länge aufgebaut. Hier steht ein Heißwassergerät bereit, falls man zwischendurch einen Tee trinken möchte. Auch stehen verschiedene Tüten von Anbietern für Fertigsuppen bereit, frisches Obst, ein Kühlschrank für Patienten. An der Seite ist ein Regal aufgebaut, das für 3 Kisten Platz bietet. Wasser, Saft und ja, sogar alkoholfreies Bier sind in diesem Regal enthalten. Wir staunen nicht schlecht. Das ist ja verrückt hier, wir wundern uns etwas über diesen Service. Doch es dauert nicht lange, da wird uns beiden klar: Wer hier ist, soll sich wohlfühlen. Nicht alle werden diese Abteilung lebend verlassen, auch das wird uns auf dieser Station bewusst. Dann erzähle ich Wendy, dass der eine Patient auf meinem neuen Zimmer ständig Schmerzen im Magen hat. Er klingelt ungefähr jede 5 Minuten nach der Schwester, es ist ein Wahnsinn für die Mitarbeiter. Deshalb wollte ich auch lieber in die Küche. Dr. Witzel, ein gebürtiger Thüringer, kommt zu mir in die Küche. „So Herr Peter, da sind Sie ja. Ah und Sie sind dann wohl Frau Peter?“ „Ja“, antwortet meine Frau wahrheitsgetreu. Er fragt kurz nach dem Geburtsdatum bevor ich meine erste Infusion bekommen soll. Doch er sucht noch etwas. „Haben Sie denn noch keinen Port?“, möchte er noch wissen. „Nein, so weit waren wir noch nicht. Ist das denn schlimm?“ „Nein, jetzt geht das noch. Diese ersten Infusionen sind noch eine nicht so aggressive Vor-Chemotherapie. Aber sie benötigen auf jeden Fall einen Zugang. Allerdings, wie ich sehe, ist bei Ihnen die Narbe ja noch so frisch und groß. Hoffentlich geht das überhaupt im Brustbereich. Aber wenn ich mir Ihre Venen am Arm anschaue, das sollte auch funktionieren.“ Prüfend schaute er beim Anbringen der ersten Infusion durch meinen Zugang am Arm sich die Venen an. „Wozu brauche ich denn überhaupt einen Port? Ist das nicht zu aufwendig?“ „Oh nein. Sie müssen wissen, dass die Chemotherapien, die Sie bekommen werden, sehr aggressiv sind. Die Venen würden das nicht auf Dauer aushalten und kaputtgehen. Beim Port haben Sie einen sicheren Zugang. Deshalb ist ein Portzugang medizinisch unabdingbar. Ich kümmere mich darum.“ Er erklärt das sehr anschaulich und ich bin doch froh, auch einen Portzugang zu bekommen. Die Infusion beginnt zu laufen. Unbewusst höre ich in meinen Körper hinein. Ich möchte wissen, wie sich das anfühlt. Viel habe ich über Chemotherapien gehört. Meine Schwester war an Krebs erkrankt und hatte eine lange Leidenszeit hinter sich bringen müssen. In 1991 erhielt sie ihre letzten Gaben. Leider hatte sie es nicht geschafft und ist viel zu früh verstorben. Ich denke viel und gern an sie zurück, aktuell noch mehr. Sie fehlt mir sehr. Dann ist auch schon Essenszeit. Das Abendbrot wird ausgeteilt und ein Pfleger kommt in die Küche und bringt mir das Tablett mit einer guten Auswahl an Brot, Salat und Beilagen. Der nette Dr. Witzel hat ihm die Information gegeben, dass ich mit meiner Frau in der Küche sitze, und ließ mir das Essen hierherbringen. Mit auf dem Tablett liegen Karten für das Essen des nächsten Tages. Der Pfleger heißt Mario, kommt aus der Gegend von Erfurt. „Noch einer aus Thüringen wie du. Schatz, hier sind wir richtig“, frotzele ich meiner Frau zu. Sie ist ja auch eine echte Thüringerin. Und gleich darauf kommt eine Schwester in die Küche. Eine große, kräftige Schwester, die kurz angebunden direkt auf den Punkt kommt. Aber das ist nur der äußere Schein, das erfahre ich später. Sie arbeitet schon sehr viele Jahre in dieser Abteilung. „Aha, hier sind Sie also Herr Peter.“ Das hörte sich beinahe an, als wäre es etwas unanständig. Wir können uns kaum einen Blick zuwerfen, als sie bereits weiterspricht. Sie fragt meine Frau, ob sie nicht auch ein wenig Hunger hätte. „Sie müssen doch auch etwas essen. Uns ist wichtig, dass auch der Besuch der Patienten sich wohl fühlt. Wollen Sie etwas? Wir haben noch Brot und Beilagen übrig.“ „Ja, wenn es nichts ausmacht? Dann würde ich eine Scheibe mit meinem Mann essen. Danke, das ist aber lieb.“ Mehr kann meine Wendy in diesem Moment auch nicht sagen. Zu verwundert sind wir nach wie vor. Die Schwester bringt 5 Minuten später unter einem leichten, ihrem Auftritt geschuldeten Vibrieren des Bodens einen Teller voll mit Brot, Beilagen, einem Salat. Sie lächelt dabei in sich hinein: „Bitte“, sagt sie nur noch, sowie: „Und Handtücher oder solche Dinge lassen Sie gleich zu Hause. Sie kümmern sich um Ihren Mann und nicht um die Wäsche!“ Die resolute, aber im Kern liebevolle Schwester geht ohne einen Dank oder eine andere Antwort abzuwarten wieder ihrer Arbeit nach. Nachdem wir beide gegessen und geredet haben, ich krächze immer noch auf dem gleichen Level wie nach der OP, gehen wir ein paar Schritte auf dem Flur. Das mache ich immer, allein um zu gehen. Bewegung ist wichtig und mein Drang nach Bewegung ist sehr hoch. Ich habe meinen Therapieplan in der Tasche der Jogginghose. Der beschäftigt mich schon seit der ersten Durchsprache mit Dr. Witzel. „Schatz“, fing ich an, nachdem wir uns auf zwei der vier Metallstühle hinten in der letzten Ecke der Station gesetzt haben. „Wir müssen nochmal meinen Therapieplan durchsprechen. Da kann etwas nicht stimmen?“ „Was meinst du denn, was soll an deinem Plan nicht stimmen?“ „Na schau mal“, ich öffne die drei zusammengefalteten Blätter. Auf der Oberseite steht noch in Handschrift Das Burkitt Lymphom. „Schau. G-Mall-Protokoll, aus dem Jahr 2002! Ob das noch aktuell ist? Wenn ich richtig rechne, dann sind es weit über 130 Tage stationäre Behandlung plus Nachsorge. Dann wäre ich ja bis April nächstes Jahr in Behandlung? Und auch nur, wenn alles klargeht!“ Es will einfach nicht in meinen Kopf, dass ich über ein halbes Jahr nicht mehr arbeiten durfte? Nicht mehr arbeiten konnte? Unmöglich. In diesem Moment bin ich so geschockt, so fertig, so unter großer Last, dass mir bei dieser Vorstellung zum ersten Mal wieder Tränen kommen. Ich kann es nur schwer beantworten. Warum bin ich so extrem gern an meiner Arbeit? Ob es im Großhandel war, der Außendienst, den ich über alles liebe. Oder meine letzte Station der LOK AG, die ich aufopferungsvoll und mit enormen Belastungen gelebt habe. Auch jetzt, wo ich bei Bosch ein Zuhause gefunden habe mit meinen tollen Arbeitskollegen, meinen Vorgesetzten, alles das lebe ich mit Herzen. Oder liebe ich mein Arbeitsleben, weil ich wie viele Männer auch eine Art Erfüllung spüre? Ich kann es nicht hundertprozentig genau erklären. Aber ich weiß, dass mich die Vorstellung fertigmacht, über ein halbes Jahr oder länger nicht arbeiten zu können. „Wie soll das denn gehen? Und dann diese extrem vielen Chemotherapien? Das sind ja Unmengen? Ich habe sie mal gezählt, ich komme auf 99 Stück. 99!“, füge ich mit feuchten Augen hinzu. „Was soll das denn heißen?“, fragt Wendy. Und ich erkenne, wie sie überlegt, einen Augenblick nicht weiß, was sie darauf antworten soll. „Dann musst du halt sterben! Willst du das?“ Puh, das hat gesessen. Hart, brutal und völlig ohne Verständnis für meine inneren Kämpfe. Auch die Begleiterscheinungen der Therapien meiner Schwester habe ich noch im Kopf. Wendy reagierte allerdings nur. Sie ist mit dieser Situation mindestens so überfordert, so belastet, wie ich es bin, das ist offensichtlich. Und nun kam diese, ja ich würde sagen, Panikreaktion. Aber mich rüttelt ihre Reaktion nur wach. Sofort spüre ich, dass ich eingreifen müsste, es geht ja nicht ums Sterben. Keiner will das wirklich und vor allem ich nicht, nachdem, was ich hinter mir habe. Nein, keine Chance. „Schatz“, nehme ich das Gespräch wieder auf. „Es geht doch nicht ums Sterben. Das steht überhaupt nicht zur Debatte. Ich habe dir bereits im August versprochen, dass ich das schaffen werde. Ich weiß nur nicht, wie ich das mit der Arbeit machen soll? Ich bekomme das nicht in meinen Kopf. Verstehst du das? Wie soll ich denn über ein halbes Jahr von der Arbeit fortbleiben?“ „Klar, Entschuldigung, so habe ich es ja auch nicht gemeint. Du hast so viel um die Ohren und musst so viel Leid ertragen. Aber ich wusste auch nicht, was ich sagen soll. Aber glaube mir, Alex ruft mich fast täglich an und erkundigt sich nach dir. Alle stehen hinter dir und du sollst erstmal wieder gesundwerden.“ Sie hat Recht und Alex ist ein echt toller und fürsorglicher Chef. Etwa eine Stunde später am Abend verabschiede ich meine Frau an der Eingangspforte. Wir drücken uns ganz fest. Ich weiß, dass sie mich am liebsten mit nach Hause genommen hätte. Vermutlich werden ihr in der U-Bahn noch einige Gedanken durch den Kopf gehen. Sie hat ihre eigene Belastung mit meiner Krankheit, sie hat alle Telefonate zu führen. Jeder will wissen, wie es mir geht. Auch das ist eine große Belastung. Dann hält sie den Kontakt zu unseren Kindern. Alle sind weit weg von uns und doch immer da. Meine Tochter war mit ihrem neuen Arbeitgeber auf einer Messe und nun ist die Arme krank und darf mich nicht besuchen. Da sie in München wohnt, ist das noch unglücklicher. Aber sie möchte mich auf keine Fall anstecken. Das wäre unverantwortlich, macht es für sie aber auch nicht einfacher. Mit all diesen Sorgen lass ich meine Frau in unsere Wohnung zurückfahren. Zum Glück kommt am Wochenende unser Sohn Sebastian mit Freundin zu Besuch. Und zu guter Letzt wird uns parallel zu meinem Aufenthalt im Krankenhaus noch eine neue Küche in der neuen Wohnung eingebaut. Auch das hängt an meiner Frau. Sebastian darf in meiner Vertretung die Küche gleich mal einweihen. Das passt, er kocht eh sehr gerne. Beim Zurücklaufen auf Station mache ich einen Weg durch die Gänge. Mit an meiner Seite ist mein neuer Begleiter. Ich nenne ihn meinen Bruder, auch wenn er auf vier Rädern daherkommt. Er trägt meine Infusionen. Etwas Zeit habe ich ja nun. In einem unteren Gang sehe ich, wie ein in Weiß gekleideter Mann in den Armen seiner Frau liegt und weint. Wir sind mit unserem Schicksal nicht die Einzigen auf der Welt, denke ich bei mir. Dann erkenne ich meinen Freund Phan. Wer weiß, welche Nachrichten sein Schicksal gerade beschäftigen? Hoffentlich nichts Schlimmeres? Immer positiv, immer positiv, denke ich bei mir, doch ihm zurufen möchte ich das in diesem Moment nicht. Die beiden brauchen jetzt ihre Zweisamkeit. Nach einer guten Viertelstunde bin ich wieder auf meinem Zimmer. So langsam bin ich müde. Mein Zimmernachbar war ja schon den Nachmittag über sehr mit seiner Klingel beschäftigt. Aber diese Nacht entpuppt er sich als „Klingelmännchen“. In dieser ersten Nacht klingelt er gefühlt hundert Mal nach der Schwester. Schmerzen, Bauchweh, Übelkeit. Dann klingelt er, da er eine Wärmflasche benötigt, jetzt ist ihm zu warm, er klingelt. Dann muss er auf die Toilette, er klingelt. Er kommandiert, fordert und klingelt und klingelt. Es entwickelt sich eine sehr, sehr kurze Nacht im Hinblick auf Schlaf und ich bin echt froh, dass es endlich Samstagmorgen ist. Die Nachtschwester hat heute Nacht mindestens die doppelte Vergütung verdient. Da bin ich mir aber zu 100 % sicher. Respekt, was diese Mitarbeiterin allein in unserem Zimmer ableisten durfte. Und es waren mit Sicherheit noch einige Zimmer mehr. Von nun an nenne ich meinen Kollegen nur noch das „Klingelmännchen“. Als Kind war das ein schönes Spiel, wenn man nicht erwischt wurde. Einfach mal an jeder Haustür zu klingeln. Dabei erinnere ich mich an einen Dorfbewohner, der ist letztendlich mit einer Mistgabel hinter uns her. Gut dass er keinen erwischt hatte. Bei meinem Klingelmännchen hier auf dem Zimmer spitzt sich die Lage noch vor dem Frühstück zu. Ob nun die Nerven beim Personal blank lagen oder ob das medizinisch notwendig war, möchte ich nicht final beurteilen. Der Patient bekommt noch einen Katheter gesetzt. Der Pfleger Axel hat Dienst und übernimmt das Regiment. Das Glied des Patienten wird mit einer Spritze leicht betäubt und der Katheter, nicht ganz nett anzusehen, wird unter Schmerzen gesetzt. Irgendwie tut mir das Klingelmännchen leid. Ich entscheide mich jetzt mein Zimmer zu verlassen und versuche meine Aufgaben abzuarbeiten. In Folge meiner Krebserkrankung und der begonnenen Behandlung wurde mir erklärt, dass grundsätzlich das Gewicht überprüft und der Mund ständig desinfiziert werden soll. Die Desinfektion ist aufgrund des schwächelnden Immunsystems wichtig. Es dürfen keinerlei unnötigen Keime oder Bakterien im Mundbereich auftreten. Zu groß ist eine Infektionsgefahr. Das Gewicht ist wenigstens zweimal am Tag wegen der extrem vielen intravenösen Spülungen zu kontrollieren. Hätte ich zu viel Wasser, wäre das auf Dauer kritisch. Bei zu hohem Gewicht durch die Kochsalzspülungen, die ich erhalte, sind schnell 3 bis 5 Kilo mehr auf der Waage. Dann kann meist nur noch ein wasserabführendes Mittel, beispielsweise Lasix, helfen. Also gehe ich zuerst ins Bad und mache mich so weit frisch. Mittlerweile darf ich mit einem Wasserpflaster am Hals wieder duschen. Das ist schon eine wahre Wohltat, ich fühle mich wieder mehr als Mensch. Selbst Rasieren klappt nun reibungsloser, außer im Halsbereich, da wo die Wunde ist. Sie sieht echt krass aus. So ein riesiger Schnitt und dann die angeblich selbstauflösenden Fäden. Sie arbeiten sich teils nach außen, sodass es aussieht wie im Horrorfilm. Nur dass ich mich deutlich im Spiegel erkenne. Ich wiege 74 Kilogramm, Normalgewicht, das passt noch ganz gut. Ich gehe wieder zurück auf mein Zimmer und warte, bis jemand meine Daten aufnimmt. Noch vor dem Frühstück beginnt die Visite. Ein weiterer Zimmerkollege bekommt nun die Nachricht, dass sein Tumor bereits in Leber und Lunge gestreut hat. Metastasen, das, was sie bei mir ebenfalls erwartet hatten. Es ist wie ein Todesurteil für ihn. Ich bin mir nicht sicher, ob er es so registriert hat. Er macht auf mich ein Bild, als wäre er in einer anderen Welt. Vielleicht muss er das auch, als Selbstschutz?
Kapitel 7. Am nächsten Morgen erwache ich nach einer sehr unruhigen Nacht. Die Absicht, wieder pünktlich im Krankenhaus zu sein, ließ mich nicht zur Ruhe kommen. Es ist der 28. September, heute wird der Port implementiert und die Chemotherapie wird eine Stufe weiter zünden, mit richtig harten Dingern. Meine Therapie ist in Blöcke eingeteilt, der aktuelle heißt Block A1. Insgesamt kommen nun 6 Blöcke, von A1 bis C2. Es ist 06.25 Uhr und ich sitze in der S-Bahn von Hohenbrunn nach Neu-Perlach und weiter mit der U-Bahn zum Max-Weber-Platz. So langsam gewöhne ich mich an diese Route, ich werde diese die nächsten Monate noch häufiger fahren dürfen. Es ist für mich nach wie vor erstaunlich, wie viel Bewegung in den öffentlichen Verkehrsmitteln so früh herrscht. Ich setze mich meist an den Rand, damit ich mich nicht von zu vielen Seiten einer Ansteckungsgefahr aussetze. Das gilt es tunlichst zu vermeiden, so wird mir ständig erklärt. Natürlich hätte ich sogar die Erlaubnis der Krankenkasse mit dem Taxi ins Klinikum zu fahren. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie möchte ich das nicht. Ich komme mir dabei vor, als würde ich das System unnötig ausnutzen. Die Leute starren mich an, verdenken kann ich es ihnen nicht. Sieht wohl schrecklich aus so eine lange Narbe am Hals und dann trage ich ja noch den Mundschutz. Manche können kaum ihre Augen von mir lassen. Als ich das Klinikum pünktlich gegen 07.00 Uhr erreiche, gehe ich direkt auf Station. Schwester Marie kommt mir schon entgegen und nimmt mich mit ihrem sympathischen Lächeln in Empfang. Sie hat eine frohe Botschaft für mich, sie hat mir ein 2-Bett-Zimmer gesichert. Nach meinem ersten Zimmer mit dem Klingelmännchen und dem zweiten, in dem ich ein Erdbeben vermutete, weil der Raum durch eine vorbeifahrende Tram alle 10 Minuten wackelte, so ist die Nachricht des 2-Bett-Zimmers in Bezug auf die 3-Bett-Zimmer eine gute Nachricht. Ich soll noch etwas warten, am besten in der Küche. Bereits hier wird mir ein Zugang gelegt. „Das ist wie in der Matrix“, sage ich zu Dr. Witzel. „Erst anschließen, sonst ist man nicht online, stimmt’s?“ Er lacht und nickt nach kurzem Überlegen. „Übrigens“, sagt er noch. „Noch heute oder spätestens morgen wird bei Ihnen gleich zu Beginn des Blocks A ein komplettes Bild von Ihrem Tumor gemacht. Zusätzlich wird im Restkörper nach Metastasen gesucht. Nur dass Sie sich nicht wundern. Das alles wird dann zu Beginn des 3. Blocks und des 5. Blocks überprüft, um den Fortschritt zu erkennen.“ Ich finde es toll, wie er mir das alles erklärt und versucht mich mitzunehmen. Doch ich antworte: „Herr Doktor, Sie können jetzt lachen oder nicht. Im Januar werden Sie noch vor den letzten beiden Blöcken nichts mehr finden. Ich fühle das, da bin ich total überzeugt und vertraue auf meinen Körper.“ Und er lacht tatsächlich. „Ja, ja Herr Peter. Sie sind mir schon einer. Aber das glaube ich nach dem 4. Block noch nicht, das wäre ja beinahe ein Wunder. Wir wären froh, wenn wir nach allen 6 Blöcken durch sind.“ „Doch, doch. Glauben Sie mir!“ Dann passiert von kurz nach sieben bis zum Mittag nichts mehr. Gedacht hatte ich mir das schon, aber damit rechnen konnte ich ja nicht. Die Müdigkeit macht sich nach einer so kurzen Nacht schnell breit und auch der Gedanke, ob ich nicht doch hätte etwas länger schlafen können? Zum Glück liegt der Münchner Merkur in der Küche, der kommt mir gerade recht. Endlich komme ich kurz vor Mittag auf mein Zimmer und beinahe zur gleichen Zeit wird das Mittagessen serviert. Es ist ein schönes Glücksgefühl für mich, ich habe zum ersten Mal nach einer Woche mittags wieder richtig Appetit. Just im Moment der Freude, hungrig und mit Appetit, muss ich auch ganz dringend, sofort, in die Radiologie. Der Portzugang wird genau jetzt gelegt. Was soll es?, denke ich so bei mir. Immer nach vorne schauen, immer positiv. Das Portsystem wird in eine größere Vene im Brustbereich oder wie bei mir im Arm angelegt. Dabei wird ein Kanal bis kurz vor das Herz in eine Hohlvene gelegt. Der Grund liegt auf der Hand. In der Hohlvene ist das Risiko einer Venenverletzung minimiert, da die Mittel direkt am Herz schnell und gleichmäßig verteilt werden. Würden Venen im Armbereich geschädigt werden oder platzen, wären die Zellschädigungen zu groß. Denn das ist ja eines der Hauptaufgaben der Chemotherapeutika – Zellen töten. Den Unterschied zwischen guten und bösen Zellen erkennt eine Chemotherapie noch nicht. Meine bevorstehende Behandlung wird zwar durch eine neuartige Antikörperbehandlung auf mein Krankheitsbild und meinen Körper abgestimmt, um die Wirkung hoch und die Nebenwirkungen so niedrig wie möglich zu halten. Dennoch ist immer höchste Vorsicht geboten, um Schaden vom Patienten fernzuhalten. Ich liege mittlerweile auf dem OP-Tisch der Radiologie. Das Ärzteteam hat noch so einiges zu besprechen, während mich ein Praktikant am Arm rasiert. Aber jetzt geht es los. Ich werde abgedeckt, mehrmals desinfiziert, dann ein paar Punkte mit der Betäubungsspritze gesetzt und schon kam der erste Schnitt. „Spüren Sie noch etwas?“, fragt mich eine sehr hübsche Ärztin. „Wenn ja, wäre es wohl jetzt zu spät oder?“, grinse ich zurück. Bei dieser Antwort muss sie ebenfalls lächeln. Dabei verziehen sich ihre Augenbrauen. Diese sind sehr gepflegt, das kann ich gut erkennen. „Echt schöne Augenbrauen haben Sie“, kommt mir so über meine Lippen. „Herr Peter, flirten Sie etwa mit mir während der Operation?“ „Nein, ich bin in glücklichen Händen, ich habe eine tolle Frau. Aber dennoch sind Sie hübsch, Ihre Augenbrauen.“ Sie freut sich, das ist nicht zu übersehen. Ob es die Freude über das berechtigte Lob ist oder über einen Mann, der seine Frau so sehr liebt? Der Port, eine kleine Dose von circa 2,5 cm Durchmesser, wird nun gesetzt, der Schlauch Richtung Herz gelegt. Die Dose unter die Haut im Unterarm, der Schlauch durch die Vene. Es verläuft alles richtig gut und vor allem zügig. Die Ärztin überwacht per Monitor die Lage des Zugangs, indem etwas Kontrastmittel im Schlauch auf dem Röntgenbild sichtbar ist. So erkenne auch ich nahezu jeden Zentimeter, der gelegt wird. Doch irgendwie ist sie mit der Lage nicht hundertprozentig zufrieden und sie zieht ihn nochmal etwas heraus. Meine Vene zieht sich im Oberarm zusammen, ob das Herausziehen ein Fehler war? Es ist nicht zu übersehen, dass sich die Ärztin überhaupt nicht freuen kann. Jetzt kommt sie mit dem Schlauch nicht mehr zurück, es wird kompliziert. Der Kreislauf sackt ab und ich bekomme kalten Schweiß auf dem Körper zu spüren. Um mich besser überwachen zu können, ruft sie zur Sicherheit zwei Mitarbeiter bei, sie ist sehr bedacht. Einen Patienten zu verlieren, ist nicht ihr Ansinnen. „Herr Peter, jetzt schön durchhalten. Sind Sie noch da?“ „Ja klar. Kein Thema, ich arbeite mit“, antworte ich aus meiner Lage. Ich konzentriere mich und versuche meinen Körper zu stabilisieren. Im Kopf bin ich total klar und ruhig. Nach einer Stunde haben wir es dann geschafft. Der Port sitzt, er ist frei und ich wieder stabil. Die Ärztin näht den Schnitt noch mit ein paar Stichen, schließlich wollte ich aufstehen. „Sie wollen zu Fuß auf ihr Zimmer? Das kann ich nicht erlauben“, bekomme ich erklärt. Zum zweiten Mal erfahre ich den riesigen Logistikaufwand der Klinik, denn der Abholdienst wird bestellt. Er bekommt über Funk Abholort und Zielort sowie Patient übermittelt. Während ich auf dem Flur im Bett liegend warte, fallen mir Dinge auf, die ich im Normalfall nie sehen würde. Unter der Fensterbank hängen noch Schmutz und Spinnweben, hier schaut der Putzdienst vermutlich selten nach. An der RZB Seilaufhängung der Notleuchte fehlt eine Endkappe und die Lichtschienen im Flur sind von der Firma Erco. Ich kenne diese Firmen noch von meiner Zeit aus dem Elektrogroßhandel. Und an den Steckdosen und den Warnmeldern sind Schaltkreise aufgeführt. Es ist echt interessant, wie sich liegend im Bett der Blickwinkel ändert und was einem im Alltag so alles entgeht? Innerhalb von 5 Minuten werde ich abgeholt und auf mein Zimmer gefahren. Hunger! Ich habe mittlerweile richtig Hunger. Das Risotto ist heute hervorragend. Und endlich beginnt meine erste Chemotherapie mit Portzugang, aus Sicherheitsgründen mit Überwachungsmonitor. Diese Überwachung wird bei der ersten Gabe hochdosierter Chemotherapeutika grundsätzlich angeschlossen. Das Ärzteteam möchte vermeiden, dass eine Unverträglichkeit oder andere Komplikationen und Reaktionen des Körpers zu spät erkannt würden. Aber irgendwann ist das einem alles egal. Meine Kraft und meine Nerven benötige ich für mich, für das Gesundwerden, nicht für Gedanken über Sinn oder Unsinn mancher Maßnahmen. Die erste Therapie zu Beginn eines Blockes ist die beschriebene Antikörperbehandlung. Das Mittel Rituximab soll helfen gezielter und schonender zu behandeln. Meine Frau besucht mich eine Stunde später, die Kommunikation hält sich leider ungewollt in Grenzen. Begleitend zur Antikörperbehandlung wird noch ein Mittel gespritzt, das mich sehr müde macht. Ständig fallen mir die Augen zu, obwohl ich nicht schlafe. Die Leidtragende kommt extra nach einem harten Arbeitstag ins Klinikum und wir können kaum das tun, was uns so stark macht, kommunizieren. Meine erste Nacht ist mal wieder von sehr wenig Schlaf geprägt. Ständig ist eine Infusion durch und wird gewechselt, gepaart von irgendwelchen Mitteln, die zu bestimmten Uhrzeiten auf dem Plan stehen. Als Entschädigung ist mein Frühstück am nächsten Morgen echt klasse. Ich habe Appetit, ich habe Zeit. Besser kann es kaum sein. Bis zum Mittag lese ich die Tageszeitung. Der Merkur ist zu meiner neuen Lieblingszeitung geworden. Die Mischung aus Wirtschaft und Politik sowie regionalen Nachrichten und Sport, das ist genau mein Ding. Gegen 11.00 Uhr sucht mich Schwester Melanie auf. Schwester Melanie ist eine ruhige, sachliche Pflegekraft. Sie inspiziert und pflegt die frische Narbe vom Portzugang. Dabei erklärt sie, was sie macht, und bindet mich anschaulich mit ein. Meine Wunde sieht richtig gut aus. Die Ärztin hat sauber gearbeitet, meine Narbe hat keinerlei Anzeichen von Entzündungen oder Sekret. Ich bin richtig zufrieden. Mittlerweile kommt das Mittagessen und wie abgesprochen gleichzeitig ein Ärzteteam zur Rückenmarkpunktion. Das Team besteht aus Frau Dr. Stiegel, Dr. Witzel und einer weiteren Ärztin. Ich überlege erst gar nicht, ob das nicht Zeit haben könnte bis nach dem Essen. Bei meinem Krankheitsbild ist laut G-Mall-Protokoll aus dem Jahr 2002 eine zusätzliche Behandlung mit jeweils drei verschiedenen Chemotherapien, sogenannten Zytostatika, nötig
Portnadel (Hubernadel) als Aufsatz für den Port im Unterarm. Auf meinem Therapieplan entdeckte ich eine Dreifach-Prophylaxe mit der Abkürzung „i.th“. Nun weiß ich, was damit gemeint ist, intrathekal heißt das. Diese Behandlung findet jeweils am 2. und am 5. Tag eines Blocks statt. Das bedeutet pro Block 6 Therapeutika zusätzlich ins Rückenmark. Dabei wird die entsprechende Menge an Flüssigkeit, die injiziert werden soll, vorher entnommen. Das Verhältnis muss exakt aufeinander abgestimmt sein, ansonsten drohen z. B. durch Unterdruck starke Kopfschmerzen. Die entnommene Flüssigkeit wird dann labortechnisch nach Befall und Rückständen untersucht, da das Burkitt Lymphom die Blut-Hirnschranke gerne durchbricht. Bei mir wurde in der Rückenmarksflüssigkeit, dem sogenannten Liquor, nichts entdeckt, weshalb ich diesen riskanten und auch schmerzhaften Eingriff in Frage stelle. Doch Frau Dr. Stiegel erklärt, dass sie das gern prophylaktisch durchziehen möchte. Ich bin da sehr skeptisch und äußere das auch. Doch sie schaut mich mit ihren lieben blauen Augen an und ich spüre, dass es ihr wichtig ist weiter nach dem Protokoll zu verfahren. Den Ablauf hatte ich ja schon einmal hinter mir und ich wusste, was auf mich zukommen wird. Nach 20 Minuten ist alles vorbei. Noch etwa 20 Minuten liege ich geschwitzt auf einem Sandsäckchen, damit sich das Loch vom Zugang besser verschließt. Das Essen hält sich erstaunlich lange warm unter der Abdeckhaube. Es schmeckt zumindest auch noch nach gut einer Stunde. Im Laufe des Nachmittags erhalte ich bis in den späten Abend hinein 4 verschiedene Chemotherapien. Ifosfamid, Vincristin bekomme ich und auch Dexamethason und Methotrexat, MTX abgekürzt. Das bedeutet, dass ich allein an diesem Tag 7 Zytostatika verabreicht bekomme. Manches Mittel ist gelb, manches Mittel ist rötlich
Kapitel 12. Müde. Meine Nacht war sehr unruhig. Die innere Uhr tickte unentwegt und erinnerte mich daran, früh aufzustehen. Meine Frau fährt mich diesen morgen an die S-Bahn. Ihr fällt es nicht leicht mich nach den zuletzt sehr schönen Tagen wieder fortzuschicken. Wir umarmen uns früh morgens am Bahnhof sehr lange und innig und verabreden uns für den Abend zum Telefonieren. Morgen sehen wir uns ja wieder, es ist dennoch schwer. Es ist kurz vor sieben, als ich in der Klinik eintreffe. In der Aufnahme ziehe ich meine Nummer und setze mich auf einen freien Stuhl. Heute ist viel los und das um diese Uhrzeit. Doch 4 Schalter sind offen, das haben wir auch selten. Meinen Gedanken, dass das dadurch schneller vorangeht, begrabe ich nach einer Stunde aber wieder. Im Schnitt nimmt Schalter 3 die Hälfte aller Patienten auf, an den anderen Schaltern tut sich beinahe nichts. Ob die heute ein Anlernprogramm für Neueinsteiger zur stationären Aufnahme am Laufen haben? Meine Nummer wird nun auch am Schalter 3 aufgerufen. Im kleinen Aufnahmeräumchen sitzt eine Dame, die mich sogar kennt. Bei dieser Menge Patienten, die hier durchgeschleust werden, finde ich das bewundernswert. Und siehe da, meine Kerndaten wie Adresse, Telefonnummer und vieles mehr benötige ich bei ihr heute nicht. Sie lächelt und wünscht mir noch eine gute und erfolgreiche Weiterbehandlung. Kurz nach halb neun bin ich dann auf Station. Axel empfängt mich und überbringt mir die freudige Nachricht: „Max, es tut mir ja leid, aber es ist sonst kein Bett mehr frei. Du darfst heute in das berühmte Zimmer 74, das kennst du ja!“ Und er hat dabei so ein verschmitztes Lächeln im Gesicht, dieser Schelm. „Kein Problem. Es ist mein erstes Zimmer gewesen und es ist das mit den besten Geschichten. Na, da bin ich mal gespannt, was diesmal auf mich zukommt?“ An diesem Vormittag passiert, mal abgesehen vom Anschließen an die Matrix, sprich den Portzugang setzen, bis zum Mittag zunächst nichts. Für die nächsten Blöcke entschließe ich mich einfach nicht mehr so früh zu kommen. Mein Gewicht habe ich in den letzten Wochen wieder bis auf 70,4 kg gebracht, Blutdruck 120/80, Puls bei 63, Nierenwerte sind ebenfalls in der Norm. Jedoch gibt es einen neuen Stationsarzt. Ich bin ehrlich, es hat mich zuerst getroffen, dass ich nun ohne meine Frau Dr. Stiegel auskommen soll. Dann erfahre ich, dass sie komplett in die Ambulanz ins Tumorzentrum gewechselt ist. Für später kann sich das als sehr angenehm entwickeln, aber hier oben auf Station vermisse ich sie schon. Der neue Stationsarzt bringt mir zum Beginn der Therapie Rituximab. Ich lese etwas Münchner Merkur, den ich von zu Hause mitgenommen habe. Doch mir fallen ständig die Augen zu, die Fenistilbeigabe wirkt wieder. Meine erste Nacht in der 74 war durch ständiges Klingeln, Rufen und extrem lautes, unrhythmisches Schnarchen unterbrochen. Der Pflegedienst hat natürlich alles protokolliert. Deshalb haut mich am Morgen Marie gleich an: „Na, bist du auch wieder da? Das freut mich aber. Wie war deine Nacht?“ Marie fragt immer. Sie ist echt ein Schatz für diese Abteilung. Ich erzähle kurz, wie es mir zu Beginn erging. „Oh, das tut mir leid. Und kein Bett ist mehr frei, sonst hätte ich mal für dich geschaut.“ „Aber nein“, entgegne ich Marie. „Dann war es wenigstens wie immer!“ Beide müssen wir daraufhin laut lachen. Mit ihr kann man so schön lachen. In ihrer offenen Art klopft sie mir auf die Schulter. „Du machst das schon, du bist ein starker Mann.“ Ja, das muss ich auch. Gegen 11.00 Uhr bekomme ich meine erste Chemo. Der Stationsarzt teilt mir mit, dass meine intrathekale Behandlung auch gleich durchgeführt wird. Als er selbst ein paar Minuten später vor meinem Bett steht, bin ich zunächst verwundert. Ich glaube, er hat meinen Blick verstanden und versichert mir: „Herr Peter, ich bin auf dem Gebiet Spezialist. Ich habe von Ihrer Tortur gehört, darf ich es dennoch versuchen?“ „Klar. Sie haben drei Versuche“, antworte ich mit einem Lachen. „Aber mal ehrlich, machen Sie ruhig. Ich bin auch froh, wenn wir das heute hinbekommen, dann wäre dieser Eingriff schon erledigt.“ Das kann er verstehen. Er prüft, sucht, markiert. Dann kommen Desinfektion, Abdeckung, Desinfektion, nochmal prüfen und los. Er probiert es zweimal, aber der zweite Anlauf sitzt bereits. Die drei Zytostatika, wie die Substanzen heißen, sind injiziert. Nun sind es nur noch 3 Behandlungen im Liquor-Raum, die ich bis Ende meiner Therapie überstehen muss. Bei diesem Gedanken bemerke ich, dass ich schon abzähle, immer eins weniger. Eine halbe Stunde darf ich auf dem bekannten Sandsäckchen liegen und ruhen. Als meine Frau heute Abend eintrifft, habe ich bereits am zweiten Tag knapp 5 kg zugelegt, folglich wird Lasix verabreicht. Trotz Routine sagt mir mein Gefühl, dass es mit der Wasseransammlung diesmal früher losgeht. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Dafür darf ich mit meiner Frau zusammen in der Küche sitzen und entspannt essen. Die Leute sind echt der Hit hier auf Station. Es ist der 09. Dezember, eine weitere unruhige Nacht liegt hinter mir. Gegen 03.30 Uhr war nochmal eine Entwässerung vonnöten, die Lauferei war anstrengend, allein die erste Stunde rannte ich 6-mal. Die Waage spiegelt am Morgen zumindest meine nächtliche Tätigkeit wider, 71,4 kg sind es noch! Mein Blutdruck nähert sich wieder den alten, niedrigen Werten von 90/50, Puls 53. Der typische Schluckauf will sich ab heute Vormittag erneut einstellen, ich spüre förmlich den Kampf im Magenbereich. Honig gegen schmerzhaften Schluckauf, der Honig siegt. Die Mukositis beginnt und die Appetitlosigkeit ebenfalls. Es ist der typische Ablauf des dritten Tages. Der 4. Tag zeigt, dass der Schluckauf weiterkämpft ohne Erfolg, dann stellt er schließlich den Kampf ganz ein. Mein Gewicht ist bei 71,8 kg und Blutdruck 100/60. Frühstück und Abendbrot werden erneut von einem starken Sättigungsgefühl begleitet, dafür bekommt mir das Mittagessen richtig gut, auch das wiederholt sich. Obwohl mein Gewicht nur bei 72,2 kg ist, sind meine Tränensäcke unter den Augen größer als die von Horst Tappert. Auch in den Beinen merke ich das Wasser. Ich denke, ich habe weiter abgenommen, denn das Wasser fühlt sich eher wie 5 kg an. Wenn ich diese von den 72 kg abziehe? Am 12. Dezember beginnt für mich der letzte aktive Tag im 4. Chemoblock. Für den heutigen Tag stehen noch 3 Therapien ins Rückenmark an und 4 Therapien über meinen Portzugang. Diese Mengen sind kaum vorstellbar, gut, dass das nicht jeden Tag so ist. Nach meiner Rückenmarksbehandlung beginnen Kopfschmerzen, auch die Ohren fühlen sich taub an. Meine Konzentration und mein Unwohlsein gehen stündlich Stufe für Stufe in den Keller. Ausgerechnet heute muss sich mein Zustand so negativ verändern, wo sich meine Frau, Martha und Swen angekündigt haben. Trotz meiner Freude auf den Besuch schränkt sich meine Gesprächsteilnahme ziemlich ein. Gerne hätte ich heute mehr von den dreien gehabt. Obwohl diese Nacht noch ausreichend gespült werden musste, liegt mein Gewicht am kommenden Morgen bei 71,2 kg. Nach dem spärlichen Frühstück gehe ich 2 Stunden spazieren, denn die Infusionen sind abgeschlossen. Mittlerweile laufe ich ausschließlich mit Mütze, Schal und dicker Jacke umher, ja, auch mit Mundschutz. Meine lichter gewordenen Haare und meine dünne Haut halten Kühle und Wind nicht mehr ab. Die Sonne scheint bei knapp über null Grad, es ist ein herrliches Wetter. Heute lohnt sich der frühe Spaziergang total, ich genieße wieder jeden Sonnenstrahl. Manche Blätter hängen noch an den Ästen, die Isar raucht angenehm anzusehen aus ihrem Flussbett. Einige Jogger laufen mir über den Weg. Ich spüre, wie gern ich mitlaufen würde, aber aktuell ist daran kein Gedanke zu verschwenden. Die Beine sind wie nach dem letzten Block wieder richtig matt. Meine Bewegungen sind langsam, die kleinen Steigungen auf dem Weg schwer. Trotzdem gehe ich zufrieden mit nach wie vor leichtem Kopfschmerz auf Station. Der Stationsarzt kommt auch sogleich auf mein Zimmer. Wenn alles klappt, sagt der Stationsarzt, könnte ich bei guten Werten noch morgen nach Hause. Morgen schon? Ob sie Betten benötigen?, denke ich so bei mir. Aber dieses Angebot würde ich natürlich nicht ausschlagen. Ich stecke eilig mein Mobiltelefon in die linke Jackentasche meines Trainingsanzugs, da ich noch schnell auf Toilette muss. Normalerweise liegt das Telefon in meiner Schublade des Patientencontainers neben dem Bett. Und es passiert, wie es passieren muss, wenn man mal von seinen Gewohnheiten abweicht. Kaum stehe ich vom WC-Sitz auf, berührt die beladene Jackentasche unglücklich das Bein, sodass das Telefon im Aufstehen noch nach hinten fällt und es macht plumps. Nie hätte ich das machen dürfen, grob fahrlässig war es, aber ich griff innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde in die Öffnung der Notdurft und zog das Telefon wieder heraus. Anschließend wusch und desinfizierte ich minutenlang meine Hände. Dem Telefon hat es nichts genutzt, selbst einen Tag später probierte meine Tochter noch den Reis-Trick, indem das Telefon in Reis gewickelt trocknen sollte, aber es hatte sein Leben verwirkt. Trauern brauchte ich nun nicht. Wie schon häufiger von mir zitiert: Verschwende deine Zeit nicht für das Geschehene, sondern konzentriere dich auf das, was kommt. Es war vorbei und ich schaute nach vorn, hätte ich auch eine Wahl gehabt? Meine Kopfschmerzen halten leider den 14. ebenfalls noch an. Der Stationsarzt vermutet inzwischen einen Zusammenhang mit der intrathekalen Behandlung. Diese Symptome können bei einer Differenz der Liquor Flüssigkeit auftreten. Ein weiteres Anzeichen für diese Prognose ist, dass bei total waagrechter Lage die Schmerzen schwinden und dass der Schmerz auf Medikamente keine Reaktion zeigt. So ist es schließlich auch. Ich erfahre, dass dieser Schmerz viele Tage anhalten kann, bis der Körper wieder den Ausgleich herstellen konnte. Bis zur Visite gehe ich auch heute nochmal für eine Stunde an die Luft, Englischer Garten, Treppensteigen, das brauche ich jetzt. Zurück auf dem Zimmer warte ich nur noch auf meine Papiere. Die Tür geht wieder auf und ein junger, gelockter Mann, Ende 20, steht diesmal im Raum. Es ist ein mir bekannter Physiotherapeut. Zu Beginn meiner Therapie hatte ich nach gezielter, begleitender Bewegung gefragt. Die angebotenen Programme stellten sich für mich als reine Information, eher für einen späteren Zeitpunkt heraus. Jedes Mal, wenn nun dieser junge Physiotherapeut die letzten Monate in unserem Zimmer aufkreuzte, sprach ich ihn an. Er schaute dann grundsätzlich auf seinen Zettel und sagte stets in seinem Berliner Dialekt: „Nee, hier stehen Se nich druff.“ Jetzt, am 14. Dezember, am Tag meiner Abreise, da kommt er wieder in mein Zimmer. „Herr Peter?“ „Ja?“, blicke ich in seine Richtung. „Sind se dett?“ „Ja!“, nicke ich nochmal bestätigend und sage: „Wir kennen uns doch. Seit Ende September habe ich Sie doch schon öfters angesprochen. Sie sind der Physiotherapeut, richtig?“ Die Spitze konnte ich mir trotz Kopfschmerz nicht verkneifen. „Wees ick nich. Ja, ick bin der Therapeut. Ick seh, Se sinn uffm Bett. Oder können Se ooch uffstehn?“ „Ja klar kann ich aufstehen. Was haben Sie denn vor?“ „Ja, wenn Se uffstehn können, dann könnt ’mer was im Stehen machen, wa.“ Meine Freude stieg leicht an. „Gut, ich bin ehrlich, ich freue mich über jede Bewegung. Wo gehen wir hin? Haben Sie einen Kraftraum?“ „Nee, nee. Nen Kraftraum gibt’s nich. Wir könnten vielleicht een Band ans Bettende spannen und mit den Knien hoch und runter? Ober vielleicht gehn wir ooch uffm Gang?“ „Auf den Gang? Und was machen wir dann auf dem Gang?“ „Na, vielleicht gehn mer 4–6-mal hin und her?“ Ich lächele freundlich und sage abschließend: „Sie machen ja nur Ihren Job, das ist auch gut so. Aber ich war gerade heute Morgen für über 1 Stunde spazieren im Englischen Garten und bin trotz Kopfschmerzen dreimal die Treppe hoch- und runtergegangen. Aber auf dem Gang 35 Meter 6-mal hin und her Laufen, nein, das brauche ich nicht. Sie haben bestimmt Patienten, die Sie nötiger haben als ich. Aber vielen Dank!“ „Se wolln mich uffn Arm nehmen oder? Über ne Stunde im Englischen Garten bei Ihrer Behandlung?“ Doch mein Blick verriet ihm etwas Anderes, er ging verwundert und ohne seine Arbeit zu verrichten in Richtung nächstem Auftrag. Als ich kurz nach Mittag zu Hause ankomme, lege ich mich zuerst auf die Couch, ganz waagrecht. Und wieder spüre ich, wie die Schmerzen schwinden. Die restlichen Wassereinlagerungen sind am kommenden Morgen auch weg, mein Gewicht beträgt 66 kg. Trotz guter, für meine Umstände intensiver Bewegung schwindet beinahe ausschließlich Muskelmasse. Die Beine werden sichtbar dünner, obwohl ich diesmal nur eine Woche im Krankenhaus lag. Über das Wochenende genießen wir zu zweit unsere Gemeinsamkeit. Der Kopfschmerz begleitet mich weiter. Der Schmerz zieht sich vom Nacken in einem breiten Strang zum Kopf hoch. Die Haut in diesem Bereich fühlt sich fremd und kalt an. Es hilft nur ganz flachliegen. Sobald ich aufstehe, dauert es maximal eine halbe Stunde und der Schmerz beginnt von neuem. Durch meinen Honig habe ich kaum noch die bekannten anderen Nebenwirkungen der ersten Blocks, dennoch kann ich fast nichts unternehmen, nur Kopfschmerzen. Es zerrt an meiner Kraft. Meine Bewegungen laufen ab wie in Zeitlupe. Ich raffe mich nicht einmal auf, in die Firma zu fahren, mein Akku läuft im roten Bereich. Meine restlichen spärlichen Behaarungen fallen nun auch am Kopf, den Augenbrauen, den Wimpern und auch in der Nase aus. Nie hätte ich geglaubt, dass auch die Nasenhaare eine Aufgabe haben. Obwohl ich spüre, dass mir ein Tropfen in der Nase herabläuft, schaffe ich es kaum, mir rechtzeitig ein Taschentuch aus der Hosentasche zu ziehen. Der Tropfen hat bereits unerlaubt die Nase herabtropfend verlassen. Das Gefühl ist sehr unangenehm. Am Montag will ich mit meiner Frau den heimischen Weihnachtsmarkt besuchen, auch diesen Besuch lassen wir, wie auch unsere Spaziergänge, aus. Die Kopfschmerzen stellen sich bisher als alleinige Nebenwirkung, dafür mit großer Beachtung dar. Einzig etwas Nasenbluten, speziell nach dem Putzen der Nase, tritt ab und zu in Erscheinung. Selbst die Mukositis bricht nicht mehr aus. Nach dem letzten Block dauerte die Mukositis 2,5 Tage, vielleicht auch nur, weil ich den Honig direkt nach dem Krankenhaus abgesetzt hatte. Und diesmal „0“ Tage, das bedeutet eine extreme Erleichterung für mich. Aber dann sind die Thrombozyten so niedrig, dass meine Nase nun 2 Tage ununterbrochen blutet. Zur Absicherung kontaktiere ich Fr. Dr. Stiegel. Gut dass sie mir ihre private Nummer für Notfälle vertrauensvoll überließ. Kalte Umschläge, leicht angefrorene Röllchen aus Taschentuch in die Nase und noch ein paar Tipps probiere ich aus. Doch die Nase läuft und läuft. Am kommenden Morgen scheint das Bluten aufgehört zu haben und ich entferne langsam meine über Nacht eingelegte Tamponage. Das Teil, das ich dann zu sehen bekomme, sieht beinahe aus wie ein lebendiger Wurm. Etwa 8 cm lang ist er und wenn er jetzt noch zappeln würde, dann müsste man vielleicht noch draufhauen. Die Nase beginnt erneut leicht zu bluten. Auch die Ruhe über Nacht brachte keine Besserung. Im Laufe des Tages stellen sich viele rote Flecken an den Beinen ein. Es sieht anfangs nach einer Allergie aus, womöglich durch die Behandlungen. Obwohl es vom zeitlichen Ablauf her sowie aufgrund der letzten Blutwerte nicht relevant ist, so bin ich mir dennoch sicher, dass meine Thrombozyten völlig im Keller sind. Geistesgegenwärtig entschließe ich mich ins Klinikum zu fahren und mich untersuchen zu lassen. Es stellt sich heraus, dass nur noch Bluttransfusionen helfen, und zwar unverzüglich. Noch einen Tag und ich hätte innerlich verbluten können, in so großer Gefahr befand ich mich unbewusst. Und noch am selben Tag sitze ich wieder in der Ambulanz auf einem Stuhl. Direkt nach der zweiten Infusion hört die Nase auf zu bluten. Dieses Problem scheint wenigstens gelöst. Mit den Flecken an den Beinen werde ich mich ein paar Tage abfinden müssen. Inzwischen steht Weihachten vor der Tür, auf die Feiertage freue ich mich sehr. Mein Appetit ist groß, ich kann jede Art von Speisen zu mir nehmen. Meine Kopfschmerzen sind noch präsent und nervig. Notgedrungen arrangiere ich mich mit meiner Situation. Regelmäßig lege ich mich flach auf unsere Couch, anschließend habe ich längere Zeitabschnitte ohne Schmerzen. Maximilian reist per Bahn ein paar Tage zuvor an und möchte etwas Zeit mit mir verbringen. Wir gehen gemeinsam ein paar Waldwege ab und reden sehr viel miteinander. Es ist seit meiner Erkrankung das erste Mal, dass wir etwas Zeit zu zweit verbringen können, was wir nutzen. Zum einen für die Vater-Sohn-Beziehung, aber auch um Fragen zu beantworten. Mich interessieren sein Studium, seine Lerninhalte, ihn interessieren Dinge, die er über den Krankheitsverlauf vielleicht noch nicht weiß. Während des Gesprächs erinnere ich mich zum Beispiel an Alpträume, die ich im Vorfeld hatte. Nie hatte ich Alpträume, außer, ich war mal als Kind fiebrig. „Ich kann das schlecht beschreiben Maximilian“, erzähle ich ihm. „Mitten in der Nacht wachte ich schweißgebadet auf, fast panisch. Zweimal hatte ich solche Angst, dass ich mich nicht mehr traute, einzuschlafen. Kannst du dir das vorstellen?“ Natürlich ist das schwer, sich das vorzustellen. Maximilian möchte ebenso die Geschichte hören, als ich unter Schmerzen ohnmächtig im Bad lag. Wie währenddessen der Tag meiner Entlassung wie im Film ablief. Wie stressig meine Monate davor waren. „Papa, ich habe zwar keine Ahnung, aber wenn das nicht alles zusammenhängt, würde ich mich sehr wundern“, sagt er noch. „Ja mein Schatz, das kann natürlich sein. Aber der Firma eine Schuld zuzuschieben wäre auch unfair. Vielleicht war es ein Beschleuniger?“, mutmaße ich. Am 2. Weihnachtstag kommen Sebastian mit seiner Roni und Martha mit ihrem Swen. Den Kindern an Weihnachten etwas Gutes tun, macht ja schon riesig Spaß. In diesem Jahr nehme ich das alles noch viel emotionaler wahr. Wendy und ich sind sehr glücklich, dass die Kinder bei uns sind. Wir unterhalten uns wieder über Familienthemen. Jeder hat so seinen eigenen Beitrag und jedem ist die Meinung der anderen auch wichtig. Während einer nötigen Pause auf meiner Couch in waagrechter Lage legen sich Martha und Maximilian neben mich. Martha hat dem digitalen Zeitalter geschuldet die Idee, ein niedliches Dreier-Foto mit ihrem Smartphone von uns zu schießen. Es entsteht ein unvergessliches Bild. Sebastian erzählt noch am späten Abend, wie er bei der Überbringung der Nachricht meiner Krebserkrankung regungslos im Auto saß und seine Tränen nur so rannen. Er tat mir so leid, diese Geschichte hören Wendy und ich zum ersten Mal. Martha und Swen steuern am 26. spät abends erneut ihre Münchner Wohnung an. Da mein 5. Block, der Block B2, am 28. Dezember wieder starten wird, bleiben Sebastian, Roni und Maximilian noch einen Tag länger und wir wollen noch etwas zusammen unternehmen. Als wir uns zum Frühstück versammeln, erleben wir eine kleine Überraschung
Kapitel 14. Am 23. Januar startet mein Block C2. Ich habe wieder ein Kampfgewicht von 70,5 kg, das sind zumindest knapp 5 kg mehr als nach dem letzten Aufenthalt. Zum Abschluss liege ich stationär noch einmal auf der 74, meinem Klingelzimmer. Hier schließt sich der Kreis. Allerdings bin ich erstaunt, dass ich einen Patienten vom 4. Block wieder antreffe. Es ist der Patient, der schon mit mir und Georg gemeinsam auf dem Zimmer lag. Der arme Kerl liegt immer noch hier und das seit Anfang Dezember, er tut mir leid. Bis 14.30 Uhr passiert nicht viel. Die Portnadel wird gesetzt, ich werde ein paar meiner ungeduldigen Fragen bezüglich REHA los, die Blutwerte werden ermittelt. Als mich diesen Nachmittag ein Arzt aufsucht, erhalte ich die Information zum Nierenspülen. Mal wieder ist mein Nierenwert zu hoch. Es ist natürlich wichtig, dass die Niere gut arbeiten kann. Dementsprechend beginne ich wiederum mit Spülungen. Am 24. beginnt dann auch die Therapie, es ist 16.00 Uhr … wie schnell so ein Tag rumgeht? So empfange ich meine Frau und Martha gemeinsam mit meinem „Bruder“, wie ich meinem 4-rädrigen Freund stets nenne. Durch die Spülungen vom Vortag und der ersten Behandlung ist mein Gewicht bereits bei 75,1 kg. Genauso war es mir während des letzten Aufenthalts vorgekommen, mein Körper lagert das Wasser immer schneller ein. Was das wieder bedeutet, weiß ich bereits: laufen, laufen, laufen. Zwischendurch führen wir Familiengespräche, so gut es geht. Meine neuen Zimmerkollegen sind das Gegenteil von allen bisherigen Kollegen aus Zimmer 74. Sie klingeln überhaupt nicht mehr. Auch nicht, wenn ihre Fusionen durch sind. Der B. Braun Infusionsapparat alarmiert zwar ständig, das Signal scheint aber die Ohren der Patienten nicht zu erreichen. So nach 20 x Piepen geht einem das Geräusch gerade in der Nacht an die Substanz. Ich übernehme das Drücken, ohne ein Wort zu verlieren, ich bin zu müde. Am nächsten Tag schaffe ich sogar 77,8 kg auf die Waage. Und wirklich, so sehe ich auch aus. Mein Gesicht ist geschwollen, die Beine kann ich kaum noch beugen. Mein Puls liegt dem Wasser geschuldet bei 43, der Blutdruck ist bei 95/60, aber Fieber habe ich auch diesmal nicht. Der Mund- und Rachenraum beginnt sich anzuspannen, die Appetitlosigkeit ist ab heute Morgen wieder gänzlich präsent. Und den Blutwerten folgend sind heute bereits zwei Bluttransfusionen fällig. Das ist in einer sehr frühen Phase der Behandlung. Bis zum 28. bewegt sich mein Gewicht zwischen 73 kg und 75 kg und die Tage verhalten sich ähnlich den letzten Blöcken. Aber heute sind die letzten 3 Chemotherapien fällig. Diesen Tag empfinde ich als echten Meilenstein. Wenn es nach der Logik der letzten Blöcke verlaufen sollte, also keinerlei Komplikationen auftreten sollten, dann steht morgen mein letzter stationärer Entlassungstag an. Ich hoffe, dass die Mitarbeiter vom Sozialdienst meine REHA-Maßnahmen in die Wege leiten konnten, dass ich bis morgen noch etwas erfahren werde. Mein Gefühl sagt mir, dass das eher nicht klappen wird. Dann erledige ich das von zu Hause, auch wenn ich dann etwas mehr Lauferei haben werde. Und exakt heute am 29. Januar werde ich tatsächlich entlassen. Nach 5 Monaten Behandlung ist es ein sehr emotionaler Moment und ich bin echt stolz, das geschafft zu haben. Natürlich weiß ich um die Besonderheit der nächsten 7–10 Tage mit Nachsorge und Regeneration für den Körper. Alle Diensthabenden drücken mich nochmal, wünschen mir viel Glück und alles erdenklich Gute. Es ist rührend, so sehr sind wir uns ans Herz gewachsen. „Komme bald wieder lieber Max“, gibt mir Marie mit auf den Weg. „Aber bitte nur als Besucher“, fügt sie schnell mit ihrem charmanten Lächeln an. Dem Wunsch kann ich nur beipflichten. Und an Axel habe ich natürlich ebenfalls eine wichtige Frage: „Und Axel, habe ich Dir nicht versprochen ohne Fieber diesen Marathon durchzustehen? Was ist nun mit meiner Urkunde?“ Wir beide müssen lachen. Es macht nicht wirklich etwas aus, dass er sie vergessen hat. Ich habe genug Grund zur Freude. Dieses Mal ist meine Wahrnehmung anders, als ich zu Hause ankommend aus dem Taxi steige. Ich bewundere die Bäume, die Sträucher im Vorgarten, selbst die Hauswand. Es ist ein wunderbares Gefühl, ein finales Gefühl. Fertig, geschafft. Mir kommt unweigerlich eine Träne die Wange herabgerollt. Dennoch: Obwohl ich ein gutes Gefühl für den letzten Block hatte, stelle ich zu Hause fest, dass nun die berühmte Mukositis erneut anklopft. Es fühlt sich anders an, als schreit sie von innen heraus, dass sie betrogen wurde und jetzt mit allen Mitteln sich zeigen möchte. Und noch etwas zeigt sich seit langer Zeit wieder. Eine geringe Lichtempfindlichkeit stelle ich fest. Gut, dass ich meinen Honig regelmäßig einnehme. Dass die ersten Tage zu Hause wieder ein großes Stück Arbeit darstellen, war mir klar, diesen Kampf musst du immer führen. Akzeptiert habe ich das bis heute nicht. Beim Essen bin ich wegen der anbahnenden Probleme auf der Hut. Ich achte darauf, was ich esse, wie ich es esse. Einen leichten Kopfdruck verspüre ich ebenfalls, dieser wird am 2. Tag wieder weniger und mein Geschmack stellt sich ebenfalls ein. Ich bin echt optimistisch. Heute Vormittag habe ich für Wendy einen Kuchen gebacken. „Mensch Schatz, der ist dir super gelungen“, lobt mich meine Frau. Es ist ein Blaubeerkuchen aus dem Simply Yummi Rezept. Doch wenn du denkst, du hättest das Glück, dann …! Diesen Spruch eines ehemaligen Arbeitskollegen aus Großhandelszeiten habe ich gerade im Kopf, als ich beinahe zusehen kann, wie sich mein Zustand verschlechtert. Meine angedeuteten Blasen an der Zungenwurzel sind innerhalb von wenigen Stunden trotz Honigs so stark entzündet, dass an Essen kaum noch zu denken ist. Selbst das Sprechen quält mich wieder. Und am Abend ist endgültig alles vorbei. Keine Chance mehr auch nur irgendetwas in den Mund zu stecken. Die Mukositis ist so extrem, wie es nach dem 2. Block im letzten Oktober war. Diese Höllenqualen halten bis Dienstagabend, den 06. Februar, an. Brei, Joghurt und eingeweichter Zwieback begleiten mich nun erneut ein letztes Mal. Es gibt aber Abwechslung: Grießbrei, Haferbrei, Kartoffelbrei (Püree)! Dazwischen viel lauwarmes Wasser mit Geschmack von irgendeiner Brühe. Am Montag entdecke ich auf meiner Hand rote Flecken. Ich versuche einen Termin im Tumorzentrum zu bekommen, die Thrombozyten werden mal wieder ganz unten sein. Der neue Stationsarzt beschafft mir einen Platz in der Ambulanz und es stellt sich heraus, dass es mal wieder höchste Zeit war, um nicht Gefahr zu laufen, zu verbluten. Nachdem wieder alles in Ordnung ist, erstaunt mich immer, wie schnell sich mein Körper erholt. Innerhalb eines Tages ohne Schmerzen mit einem geregelten Ablauf schießt mir die Kraft durch den Körper. Ich beginne meine Bauchmuskeln, meine Oberschenkel zu trainieren. Alles natürlich sehr angepasst und im Rahmen. Ich bin mir sicher, dass neben Optimismus und Freude die Bewegung das „A“ und „O“ für mich sind. Mein Gewicht nach dieser Woche liegt noch bei knapp 64 kg
Kapitel 15. Pünktlich vor dem Wochenende des 09. Februars habe ich meine Tiefphase vollends überwunden. Meine Kraft ist zurück, essen kann ich auch wieder und andere Nebenwirkungen stelle ich auch nicht mehr fest. Das war echt knapp, denn Besuch aus der Heimat hat sich angemeldet. Mein Laufkumpel Mike und seine tolle Frau Marina kommen nach Hohenbrunn. Mit Mike laufe ich seit über 20 Jahren. Wir liefen im Einklang, wir liefen im Team. Mike hatte sich im letzten Jahr sofort angeboten, falls wir Hilfe benötigen sollten. Und er wäre auch sofort gekommen, das wissen meine Wendy und ich. Auch wenn wir diese Hilfe nicht annahmen. Es war schon eine Hilfe, zu wissen, dass jemand da sein würde, im Falle eines Falles. „Laufsachen brauchen wir noch nicht“, sagte ich noch am Telefon. „Aber wir freuen uns riesig auf euch.“ Die Begrüßung wird sehr emotional, aber das hatte ich erwartet. Denn als Marina in der Tür steht und mich so anschaut, ist es mit der Freude bereits aus. Zumindest äußerlich ist die Freude fort, es laufen nur noch Tränen. Tränen des Wiedersehens, Tränen wegen meiner schweren Krankheit und körperlichen Belastung, also vielleicht doch auch Tränen der Freude. Man kann es beim ersten direkten Treffen einfach nicht aufhalten, wenn man so eng befreundet ist. Allerdings bewegt mich Mike am meisten. Männer weinen eher weniger, weinen heimlich. Doch er kann seine roten, nassen Augen nicht kontrollieren. Mike ist glücklich mich wiederzusehen. Und mir geht es nicht anders. Zur Stärkung bringen die beiden „Ahle Worscht“, eine echte hessische Spezialität, selbstgemachte Marmelade und noch ein paar Dinge mit. „Na, jetzt kann es doch nur noch aufwärtsgehen oder?“, sage ich noch. Wendy wischt sich noch nach einer Stunde ihre Tränen von den Wangen. Wir reden viel bis in den späten Abend, machen einen Ausflug an den Starnberger See, wir arbeiten so alles Mögliche auf. „Und endlich erfahre ich auch mal wieder etwas aus der Heimat. Das freut mich so richtig“, ergänzt mein Schatz noch am Sonntag vor der Abreise. Die Woche vom 19.–22. Februar glich vom Pensum her eher einer Arbeitswoche. Blutkontrollen, Dienstag großer CT im Klinikum, Mittwoch die 98 Chemotherapie mit Rituximab in der ambulanten Tagesklinik, Donnerstag gleich um 08.00 Uhr Kontrolle der Thrombose in der Gefäßchirurgie. Inzwischen laufe ich ins Tumorzentrum, um meinen anschließenden Termin bei Frau Dr. Stiegel wahrzunehmen. Sie kommt mir bereits auf dem Gang entgegen und ich darf mich schon vor ihrer Tür platzieren, an der Anmeldung und dem Wartezimmer vorbei. Kaum eine Minute später öffnet sie ihre Tür erneut und ich darf mich auf einem Stuhl vor ihrem Schreibtisch platzieren. Sie ist stets wuselig, am Telefonieren, am Notizen machen, schnell nochmal raus, um jemandem irgendetwas zu sagen. Sie macht einen zerstreuten Eindruck, obwohl sie nicht zerstreut ist. Es ist einfach ihre ganz eigene Art alles zu koordinieren. Definitiv hat sie die Qualität eines Oberarztes, wenn denn nur eine Planstelle frei wäre. Zumindest würde ich das exakt so beurteilen. An diesem Morgen stehen zwei wichtige Themen an. Sie möchte mit mir das Ergebnis des CT besprechen, ich habe noch Fragen zur zukünftigen Medikation sowie zur Reha. Bezüglich der Medikamente möchte ich vermeiden, dass ich längere Zeit Dinge zu mir nehme, die eventuell nun nicht mehr nötig sind. Und in Richtung Rehabilitation hätte ich den Stand des Prozesses gerne gewusst. Zumindest ein Zeitplan der Maßnahme wäre hilfreich. Diesen könnte ich anschließend mit meinem Arbeitgeber besprechen. Leider erfahre ich jetzt, dass ich mich um meine Rehabilitation selbst kümmern darf. Es stellt sich nach zwei weiteren Telefonaten heraus, dass es vom sozialen Dienst keinen Anstoß für meine Reha gab. Ich hake das Thema schnell ab. Ob ich mich nun ärgern würde oder nicht, es ist, wie es ist. Als letztes Thema besprechen wir gemeinsam das Abschlussergebnis des CT. Obwohl mir klar ist, dass nach dem Ergebnis von Anfang Januar kein bösartiges Gewebe mehr zu finden ist, so warte ich dennoch mit etwas Spannung auf das Ergebnis. Ich meine, wo sollte von Anfang Januar nochmals irgendetwas auftauchen? Nachdem keine Restgewebe zu finden war und ich anschließend noch zwei weitere hochdosierte Blocks hinter mich bringen durfte? Und obwohl das Ergebnis auf der Hand lag, freue ich mich riesig über Frau Doktors Erläuterungen meines positiven Ergebnisses. Nachdem wir alle Themen abgearbeitet haben und ich sogleich einen neuen Termin zur Nachsorge für April bekomme, begebe ich mich auf den Heimweg. In der U-Bahn suche ich mir einen Platz am Fenster am Ende des Wagons. Die U 5 setzt sich in Bewegung Richtung Heimat und ich denke nach. Jetzt wird mir so richtig bewusst, was ich im letzten halben Jahr alles über mich habe ergehen lassen müssen. Während ich durch das Fenster starre mit Blick auf die schwarzen Ränder des U-Bahn-Tunnels, wird mir klar, welch große Belastung das für meine Familie und für mich war. Und mir wird bewusst, was für ein riesen Glück ich hatte, dass alles genau so eintrat. Während ich so anonym dasitze, kommen mir bei all diesen Gedanken Tränen der Erleichterung. Ich kann nicht sagen, welche Last von mir in diesem Moment abfällt. Und es ist mir egal, ob irgendjemand das überhaupt interessieren würde, ob vielleicht irgendein Fahrgast mich seltsam ansehen sollte, ich lasse es einfach laufen. Genau dieses Gefühl der Erleichterung teile ich nun in der WhatsApp-Familiengruppe. Sie alle sollen es zuerst hören, von mir persönlich: „Hallo liebe Familie. Ich komme gerade vom Arzt mit dem Ergebnis der CT Untersuchung. Es ist absolut kein Restgewebe mehr zu erkennen. Man kann sagen, nein man darf sagen, dass ich komplett geheilt bin. Ich sitze zurzeit in der U-Bahn Richtung Heimat, aber ich konnte nicht länger mit dieser Nachricht warten, ich bin völlig gerührt. Jetzt schauen wir gemeinsam nach vorn und dann feiern wir am 01. April meinen 50. Geburtstag. Wir wollen einfach noch viele glückliche Zeiten erleben, ich liebe euch so sehr. Bis dann!“ Zu Hause eingetroffen wasche ich mir erst einmal mein Gesicht. Ich schaue in den Spiegel und sehe einen alten, fahlen und krank aussehenden Mann, der keine Haare, Augenbrauen und keine Wimpern hat. Doch dann fange ich an zu lächeln. Es ist das Lächeln, das mir schon oft im Leben half. Es ist das Lächeln, das von innen kommt und mein wahres Ich nach außen bringt. Es ist ein Lächeln, das mich anspornt und das mich auf meinem weiteren Weg begleiten wird. Meine letzte Februar-Woche wird schließlich von Sport und kleinen Arbeiten geprägt. Meine kleine Joggingrunde dehnt sich so ganz nebenbei auf 3 km aus. Im Großen und Ganzen entwickeln sich meine körperliche Fitness und meine Gesundheit in die richtige Richtung. Lediglich bei hoher Konzentration beim Lesen, Telefonieren, selbst bei inhaltlosen Gesprächen schwitze ich unkontrolliert, teils sehr stark. Mit meinem Chef Alex treffe ich mich und bespreche den möglichen Ablauf bis zum Start meines Berufslebens. „Stell dir mal vor“, erzähle ich Alex während des Essens. „Ich soll mich erst einmal zu Hause erholen. Schließlich hatte ich doch eine so lange und schwere Krebserkrankung. Einen REHA-Antrag könne ich doch immer noch stellen, bekomme ich zu hören. Und das nur, weil ich mit der REHA Druck mache. Ich kann doch nicht ein halbes Jahr zu Hause bleiben, wenn ich jetzt schon merke, dass ich von Tag zu Tag fitter werde? Soll ich den Sozialkassen in solch einem Zeitraum unnötig auf der Tasche liegen? Nein! Das will ich nicht!“ „Mensch, du hast Luxusprobleme, wirklich Max“, sagt Alex. Meine Frau stimmt Alex bei diesem Satz nickend zu. Ich erkläre Alex meinen Plan. „Nach der letzten ambulanten Therapie im März, vielleicht im April möchte ich gerne meine REHA antreten können und im Mai würde ich schließlich zur Wiedereingliederung an der Arbeit erscheinen.“ „Es ist wichtig, dass du dich erstmal um dich kümmerst, Max. Bei der Arbeit nimmt nach wenigen Tagen doch keiner mehr Rücksicht auf dich. Mach dir bitte keinen Stress.“ „Nein, für mich ist es Stress, wenn ich mich gut fühle und mir noch ein halbes Jahr zu Hause die Zeit vertreiben soll. Das will ich nicht. Wenn ich mich schlapp und krank fühle, würde ich doch alles genauso akzeptieren. Aber zum Glück ist es anders. Versteht das denn keiner?“ Klar, die Blicke von Alex sind nachdenklich, betroffen. Er spürt nur zu gut, was ich empfinde und dass ich unbedingt will. Dennoch muss ich bezüglich der REHA auf eine Antwort der Rentenkasse warten. Meine Haut ist nach den vielen Zytostatika sehr trocken und muss mehrmals am Tag gecremt werden. Und noch etwas ist mit meiner Haut. Meine Frau hat sich zuerst nicht getraut, es mir zu erklären, nicht, dass sie missverstanden würde. Aber dann sagt sie es mir doch. Meine Haut ist seit Wochen zu einer fremden Hülle geworden. Sie hat einen anderen Geruch und fühlt sich wie ein transplantiertes Fremdgewebe an, nicht mehr wie „Max“. Oh die Arme. Ich kann mir gut vorstellen, was sie alles ertragen muss. Diese Chemie richtet mehr an, als man sich denken kann. Dennoch bin ich froh, dass sie sich durchringt, mir zu erzählen, wie sich mein körperlicher Zustand für sie anfühlt. Wenn es sich im ersten Moment auch nicht toll anhören mag. Inzwischen bin ich wenigstens wieder bei 70 kg Gewicht. Nicht alle neuen Kilos sind wieder aufgebaute Muskelmasse, ein paar ungewollte Fettpölsterchen haben sich ebenfalls angesammelt. Die Tage rinnen dahin. Inzwischen hat der März begonnen. Ich habe große Lust für meine Arbeitskollegen einen Kuchen zu backen. Es sollte eine nette Aufmerksamkeit werden, ein kleines Dankeschön. Alex erzählte mir, dass die Freude im Büro über die Nachricht meiner überstandenen Krankheit sehr groß war. Alle Kollegen haben seit meinem Ausfall ohne ein Murren sämtliche Aufgaben übernommen. Das allein ist es mir schon wert, mal überraschend mit einem Kuchen vorbeizukommen. Zwei dieser tollen Kollegen haben uns letzten November nach Feierabend geholfen, Großgeräte umherzutragen, weil diese Arbeiten für mich nicht mehr möglich waren. Das war echt klasse. Unser Team funktioniert, was nicht nur an den Mitarbeitern liegt. Alex hat hier einen großen Anteil, das ist nicht von der Hand zu weisen. Folglich wäre jeder andere Kuchen vom Namen her passender, dennoch nennt man den Kuchen, den ich backe, „Tränchenkuchen“. Dafür schmeckt dieser Kuchen sensationell gut und ich möchte ja schließlich auch ein Stück mitessen
Kapitel 16. Pünktlich zum 01. April, meinem 1. Geburtstag nach überstandener Krankheit und dem 50. insgesamt, schaffe ich meine ersten 10 km in 50 Minuten. Mein Gewicht ist noch etwas unter dem Gewicht, das ich vor der Krankheit hatte, meine Beinmuskulatur aber ist wieder die alte. Es fühlt sich wie ein Start in ein zweites Leben an. Damit der Aufbruch in ein neues Leben richtig schön wird, planten wir im Vorfeld eine Überraschung für unsere Kinder. Die Familie sollte an meinem Geburtstag im Mittelpunkt stehen. Für mich sind meine Frau und meine Kinder die größten Geschenke in meinem Leben und mit ihnen wollte ich meinen Tag verbringen. Und heute ist es endlich so weit. Wir wollten früh aufstehen, denn ich habe für uns einen 9-Sitzer-Bus angemietet. Den möchte ich noch abholen und dann gleich frische Semmeln mitbringen. Zum Frühstück werden Martha und Swen sowie Sebastian und Roni eingetroffen sein. Maximilian sollte dann ebenfalls aufgestanden sein, er schläft bei uns. Wendy wacht, wie so oft, als Erste auf. Sie rutscht auf meine Bettseite und drückt mich gaaanz fest, gaaanz lang und gaaanz innig. Ihre Freude, ihre Liebe und vielleicht auch ihre Erleichterung, dass ich so selbstverständlich neben ihr liege, das ist es, was ich in diesem Moment spüre. Schnell gehe ich ins Bad und bin auch schon unterwegs zum Abholen des Mietwagens. Alle Kinder stehen quasi Spalier, als ich zurück bin. Bei der Überbringung der herzlichsten Wünsche meiner Kinder ist jedem einzelnen die Besonderheit des Tages anzumerken. Es ist nicht unbedingt die Besonderheit des Geburtstages an und für sich. Es ist die Besonderheit, dass wir uns noch haben. Das Bewusstsein, dass das Leben nicht selbstverständlich ist. Alle sind so froh über diesen Tag und es werden ausschließlich Freudentränen vergossen. Wir starten mit dem Frühstück. Alles ist fein gedeckt mit frischen Brötchen, Marmelade, Wurst und Käse und was das Herz begehrt. Es ist unglaublich, mit welcher Selbstverständlichkeit ich eine knusprige Semmel esse oder andere Dinge tue. Und es ist noch unglaublicher, wie schnell man auch wieder vergisst! Deshalb muss ich mich nach wie vor kneifen. Ich bin schon aufgeregt und frage mich, ob den Kindern der Tag gefallen wird. „Papa, was hast du denn heute vor?“ Martha ist natürlich die Erste, die die Neugierde packt. Alle sind neugierig, aber sie, sie fragt halt. „Soll ich es dir sagen?“, frage ich. „Oh nee. Dann sagst du nur wieder etwas Schönes, das kenne ich bereits“, kommt prompt leicht kauend zurück. Die Jungs lachen sogleich auf. Und die anwesenden NEUEN, also die Partner von Martha und Sebastian, suchen mit ihren Augen nach der Stelle, die zum Lachen führte. Ganz nebenbei werden sie aufgeklärt. Den Satz etwas Schönes, den kennen die Kinder zur Genüge. Diesen Satz haben sie sich vermutlich viele Male bei zu großer Neugier anhören müssen. „Ja aber, wenigstens ein bisschen kannst du doch verraten. Los sag uns zumindest mal die Richtung Papa“, bettelt sie weiter. „Okay, Bayern! So, nun weißt du es“, schließe ich ab. Die Bande am Tisch ringelt sich weg. So viel haben sich das alle wohl schon gedacht, von Hohenbrunn aus startend. Wir räumen gemeinsam den Tisch ab, dabei wird sich viel und durcheinander unterhalten. Ja, nicht ich allein rede viel in der Familie. Ich frage mich öfters, von wem die Kinder das nur haben? Endlich geht es los. Es dauert nicht lange, bis jeder seinen Platz gefunden hat und schon beginnt wieder das allgemeine lustige Plaudern. Der Diesel startet und der Chef am Steuer, in diesem Fall natürlich ich, signalisiert: „Anschnallen, es geht los!“ „Papa, mir kannst du es doch sagen, wo geht es denn nun hin?“ Ja auch Maximilian probiert sein Glück vom Beifahrersitz aus. Aber ich schüttele lediglich mit einem breiten Grinsen meinen Kopf. „Das kannst du vergessen“, mischt sich Sebastian ein. „Wenn, dann kommt eh wieder sein Lieblingssatz. Ich habe das schon lange aufgegeben. Frage doch mal die Mutti, die weiß es bestimmt“, stachelt er sogleich in Richtung Wendy. „Nee, das ist ja genauso vergebens, die sprechen sich doch sowieso immer ab!“ Da haben die Kinder wohl Recht, denkt sich meine Wendy, das haben sie schon gelernt. Und sie lächelt zufrieden in sich hinein, meine Erzieherin. Schließlich kommen wir nach knapp über einer Stunde in Bad Reichenhall an und halten vor dem Bergwerk. Jetzt kommt langsam Stimmung in den Bus. „Oh wie schön“, schwärmt Martha gleich. „Papa, das ist ja genial. Hier waren wir doch früher auch schon, oh da freue ich mich.“ Sie schwärmt und zehrt von solchen Erinnerungen mehr als die anderen beiden. Im Jugendalter war das natürlich alles langweilig. Als sie erwachsen wurde, erschienen ihre Erinnerungen immer angenehmer und immer schöner. „Und hier haben wir doch diese komischen Sachen anziehen müssen, stimmt’s?“, erzählt Sebastian. „Ja, stimmt“, bestätige ich. „Wir waren in 2006 schon einmal hier, erinnert ihr euch noch an das schöne Familienbild? Das, welches auf dem Wohnzimmerschrank steht? Und das ist mein 1. Wunsch für heute. Ich wünsche mir als Geburtstagsgeschenk ein Familienbild, identisch zu dem von damals. Und …“, ergänze ich noch schnell, „… das bitte in der richtigen Reihenfolge! Das Neue aus 2018 kommt dann neben das aus 2006. Das wird ein Hingucker, glaubt mir.“ Der einzige kleine Wermutstropfen an der Sache, die zwei neuen Familienmitglieder müssen auf der Bergmannsrutsche, da wo das Bild geschossen wird, mal ohne ihre Partner hinunter. Aber das machen Swen und Roni gern für mich. „Ich weiß noch genau, wie ich auf dem Bild meine Hände wie zum Gebet faltete“, wirft Maximilian ein. Und klar, die Reihenfolge steht ebenfalls fest. Also ab geht’s hinunter zum Bergsee tief ins Innere der Berchtesgadener Alpen. Es wird ein ebenso schöner Ausflug wie in 2006. Und schon wieder umgezogen und draußen denken alle, das war es wohl nun für heute. Die Überraschung war ja auch schön. Doch das war es noch nicht. Es ist ungefähr 13.30 Uhr. Der Hunger stellt sich so langsam schleichend bei dem einen oder anderen ein. „Wisst ihr was“, erzähle ich wieder am Steuer sitzend. „Wir haben ja noch Zeit. Was haltet ihr davon, wenn wir die Alpenstraße noch etwas entlangfahren. So können wir noch ein wenig von den Bergen sehen.“ Natürlich hat da keiner der Anwesenden etwas dagegen. So fahren wir über Inzell Richtung Ruhpolding, eine Kurve nach der anderen nehmend. Und selbstverständlich war es wieder unsere Martha, die irgendetwas vermutete und mich stocherte. „Du fährst doch bestimmt noch wohin mit uns und nicht umsonst hierher oder?“ „Nein, ich suche nur etwas zum Essen, eine Kleinigkeit. Ihr schafft es ja eh nicht bis heute Abend“, erwidere ich. „Oh, ich kenne dich doch. Du fährst nach Oberaudorf, stimmt’s?“ Ich lächele nur. „Oder zu diesem Wasserfall, wie heißt der noch?“ „Tatzelwurm“, kommt von mir. „Ja genau. Ah, jetzt habe ich dich, du fährst zum Tatzelwurm.“ „Nein“, antworte ich ruhig. Und als ich in Ruhpolding anstatt Richtung Reit im Winkel nach rechts abbiege und Ruhpolding ansteuere, beginnt sie plötzlich vor Freude wieder an zu heulen. „Jetzt habe ich es: Du fährst zur Windbeutel Gräfin! Oh, ich freue mich so Papa, du bist klasse.“ Die Windbeutel Gräfin steuerten wir nahezu in jedem Urlaub einmal an, wenn wir in Oberaudorf auf dem Hocheck verbrachten. Hier gibt es die berühmten Lohengrin Windbeutel. Diese sind je nach Jahreszeit unter anderem gefüllt mit Ananas, Kirschen, Erdbeeren, Heidelbeeren. Hinzu eine Kugel Vanilleeis und einen Liter Schlagsahne. Es ist der Hit, ehrlich. Vielleicht ist es auch weniger Sahne, ich glaube aber, dass es nicht viel weniger ist. Ich habe aufgrund der meist vollbesetzten Gasträume im Vorfeld einen Tisch für uns reserviert. Swen und Roni können ihren Augen kaum trauen, so groß sind die Windbeutel, die uns anschließend serviert werden. Schnell entsteht ein nettes Bild mit riesen Windbeuteln an einem vollbesetzten Tisch. Das ist definitiv ein weiteres Highlight an diesem Tag. Wir lassen den Tag abends bei einer gemütlichen Brotzeit zu Hause ausklingen. Selten empfand ich einen Geburtstag so schön wie den heutigen. Für den 12. 04. Ist eine große Abschlussbesprechung mit Frau Dr. Stiegel angesetzt worden. Bis dahin beschäftige ich mich mit Hausarbeit, Sport und Telefonieren. So wie ich mich bereits fühle, habe ich wirklich ein schlechtes Gewissen gegenüber meinen Arbeitskollegen
Kapitel 17. Der Montag startet in der Einrichtung mit Pfand für PKW, Pfand für Telefon und Pfand für Fernseher. Etwa 80,- € Bargeld an Pfand sind zu Beginn fällig. Ich glaube, ich laufe gleich morgen den Bankautomaten nochmal an. Ansonsten läuft alles sehr professionell und ruhig ab. Mein vorletztes Kapitel in Sachen Krebserkrankung startet. Ich bin froh, dass es nun zum Ende kommt. Es kann losgehen. Anamnese, Therapieziel, Therapieplan, Selbsteinschätzung! Alle Informationen, die man im Vorfeld abgeben musste, werden nochmals durchgesprochen. Gegen mein starkes Schwitzen erhalte ich Sweatosan. Die Ärztin möchte prüfen, ob wir durch diese Unterstützung diese unangenehme Nebenwirkung eindämmen können. Die Anwendungen sind sehr abwechslungsreich. Es werden nicht nur sportliche Aktivitäten wie Nordic Walking oder Zirkeltraining angeboten, auch die kognitiven Fähigkeiten kommen nicht zu kurz. Die Mitarbeiter sind äußerst homogen und aufeinander abgestimmt, das ist deutlich zu erkennen. Es existiert ein alter Stamm an Personal, was meist ein gutes Zeichen für jede Einrichtung ist. Das Essen im großen Speisesaal ist gut und abwechslungsreich. Nur am Tisch ist es anfangs etwas schwierig. Die meisten der Patienten sind eine eingefahrene Gemeinschaft und reisen auch schon die nächsten Tage ab. Da kommt man als Neuer schwer rein und meine Frau fehlt mir so sehr. Seit dem letzten langen Krankenhausaufenthalt waren wir nicht mehr so lange getrennt. Jetzt weiß ich nicht, ob sie das kommende Wochenende in meinem Zimmer verbringen kann. Da mein Aufenthalt vorgezogen werden konnte, ist keine Zubuchung möglich gewesen. Noch am Dienstag stelle ich für die kommende Woche einen Antrag für meine Frau. Da könnte sie Urlaub machen, allerdings nur, wenn sie auf meinem Zimmer sein kann. Wegen der Kurzfristigkeit, so erfahre ich, geht das wohl auch nicht. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass alle Beistellbetten ausgebucht sein sollten. Ich führe mit der kaufmännischen Leitung ein Gespräch und finde offensichtlich mit der Vokabel „Wirtschaftlichkeit“ das richtige Wort, plötzlich geht es doch. Darüber sind wir sehr froh. Am nächsten Tag hält der Chefarzt der Onkologie einen Begrüßungsvortrag. Er macht zunächst einen sehr verstreuten und in seine Fachwelt hineinlebenden Eindruck. Doch er überrascht mich außerordentlich. Sein Vortrag ist so frei, witzig, zielführend und angenehm, dass es echt eine Freude ist, ihm zuzuhören. Im Anschluss an den Vortrag habe ich ein Gespräch mit der Abteilung für soziale Belange. Es geht um meine Wiedereingliederung. „Herr Peter, wie stellen Sie sich denn Ihre Wiedereingliederung vor? Haben Sie sich darüber schon einmal Gedanken gemacht? Ich sehe, Sie haben ja bereits alle Anträge mit dabei“, stellt die nette, sachliche Mitarbeiterin fest. „Ja, das habe ich bis auf den Starttermin im Vorfeld erledigen können. Für mich ist es wichtig, dass ich bald wieder anfangen kann. Aber was muss ich wissen? Weil eigentlich wollte ich am liebsten einfach wieder anfangen.“ „Ah, das habe ich mir schon gedacht“, kommt als Reaktion. „Aber einfach anfangen geht natürlich nicht. Der Träger, in ihrem Fall ist das die Deutsche Rentenversicherung, möchte, dass Sie langsam beginnen und sich Zeit lassen.“ „Ja und was schlägt man da vor? Oder gibt es ein festes Schema?“, frage ich. „Nein, ein festes Schema gibt es nicht. Aber wenn ich mir Ihre Krankheitsgeschichte ansehe, dann schlage ich vor, dass Sie sich erstmal weiter zu Hause erholen und vielleicht mit zunächst 2 Stunden am Tag Anfang August oder besser Anfang September beginnen.“ „Nein, entschuldigen Sie bitte. Das geht nicht. Ich habe der Firma Ende Juni als letzte Planung gemeldet. Da dachte ich, das wäre sehr spät. Und für 2 Stunden, da brauche ich ja gar nicht erst in die Firma zu fahren. 2 Stunden benötige ich ja schon, um alle Mitarbeiter zu begrüßen“, scherze ich noch. Aber mit 2 Stunden beginnen, das wollte ich definitiv nicht. Und schon gar nicht im August oder September. „Ja gut, wie haben Sie sich das denn vorgestellt?“ „Was sind denn die Mindestbedingungen?“, möchte ich wissen. Sie blättert: „Ja. Hier steht, dass Sie mindestens 3 Wochen machen müssen und mit 6 Stunden aufhören müssen.“ „Ja super“, antworte ich mit einem Lächeln. „Dann haben wir es ja. Sie schreiben jetzt hin: 1. Woche: 4 Stunden, 2. Woche: 5 Stunden, 3. Woche 6 Stunden fertig. Geht das? Und Beginn würde ich sagen, machen wir Ende Juni.“ „Gut, klar. Das kann ich machen. Sie wissen aber genau, was Sie wollen?“ „Ja, das weiß ich genau!“ Mein Aufenthalt in der Einrichtung gestaltet sich von Tag zu Tag besser. Das hat mehrere Gründe. Beinahe jeden Tag treffen neue Patienten ein und andere Patienten verlassen die Einrichtung. Und jeden Tag weiter werde ich zum routinierten, erfahrenen Ansprechpartner für die sogenannten Neulinge. Eine Rentnerin von über 80 Jahren kommt an unseren Tisch. Sie hört nicht alles und ist in der Umsetzung mancher Dinge etwas langsam. Sie ist eine tolle, lustige Persönlichkeit, die viel Leid hinter sich hat. Ihre Zurückhaltung und ihren Respekt gegenüber so vielen neuen Dingen verstehe ich zu gut. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie es mir erst vor wenigen Tagen erging. Aus diesem Grund liegt es für mich auf der Hand sie am Tisch einzubinden, Hilfe anzubieten. Nicht nur in ihrem Alter ist es keinesfalls selbstverständlich das Essen elektronisch zu ordern. Ich erkläre ihr nochmal in aller Ruhe die Essensbestellung am Terminal, den Plan der Einrichtung mit seinen Räumlichkeiten und Anwendungsabläufen. Folglich freunden wir uns schnell an und lachen viel miteinander. Selbst meine Frau findet meine neue Bekanntschaft klasse. „Du und deine Weiber, zum Glück ist sie schon über 80“, lacht sie mit mir um die Wette, als wir gemeinsam den Speisesaal verlassen. Wendy ist an diesem Wochenende zu Besuch. Sie schläft zwei Nächte in einem Hotel ein paar Kilometer weiter. Zum Glück schläft sie ab nächster Woche dann in meinem Zimmer. Wir schauen uns am Abend das Pokalfinale Bayern–Frankfurt an, indem die Frankfurter den Bayern mit 3:1 den Rang ablaufen. Die folgende Woche stelle ich immer mehr fest, dass mir etwas Auslastung fehlt. Bei vielen Übungen würde ich gern noch mehr Gas geben oder häufiger sportlich in Anspruch genommen werden. Allerdings muss ein Therapeut verständlicher Weise die ganze Truppe im Blick haben. Die fehlende Auslastung ist für mich der Antrieb für den Samstag eine Wanderung mit meiner Frau anzustoßen. Das Wetter ist schön, also starten wir auf die Hochplatte, gegenüber der Kampenwand in den Chiemgauer Alpen. In meinem Kopf setzte sich der Gedanke ab, dass eine Hochplatte eher eine Platte ist. Beim Aufstieg erfahren wir allerdings, dass es doch ein steiler Gipfel ist. Ich hätte mich ja im Vorfeld über das Internet erkundigen können, jetzt war es dazu zu spät. Ich bin halt kein Dinky! Wie früher auch, entschädigt der gigantische Ausblick ins Gebirge für alle Anstrengungen. Ich bin froh, dass wir das bis oben geschafft haben. Heute habe ich keinen Grund, mich über Mangel an Auslastung zu beschweren. Wir steigen entspannt und zufrieden vom Gipfel ab und steuern gezielt eine Almhütte an. Das ist so klasse im Gebirge. An so vielen Stellen gibt es Almen und Almhütten und in den meisten schmeckt es dann auch entsprechend: rustikal und gut! An der Ausgabe der Almhütte stehend entdecke ich unverhofft einen Arbeitskollegen. Er steht am unteren Ende der Treppe und hat noch ein paar Stufen Zeit, bis er oben an die Ausgabe kommt. Mich hat er noch nicht gesehen und just in diesem Moment springt mir der Schalk in den Nacken. Ich spreche ihn provozierend und laut vom oberen Ende der Treppe an. Als er noch nach der Quelle des vermeintlichen Affronts sucht, hat mich seine Partnerin schon aus der Menge identifiziert. Da sie mich nicht kennt, ist sie logischerweise erschrocken und weiß nicht, wie sie diese Provokation einordnen sollte. Mein Arbeitskollege benötigt einige Sekunden, bis sein Gehirn den noch im Krankenstand befindlichen Kollegen an diesem Ort zusammenbringt. Aber dann klärt er zügig seine Freundin auf und wir lachen gemeinsam. Als ich ihm dann von meinem Gipfelblick erzähle, schaut er nicht schlecht. „So weit wollte ich heute aber nicht mehr, es reicht schon bis hierher“, sagt er noch. Am Sonntag bekomme ich etwas Fieber. Meine Frau macht sich sofort Sorgen. Zu tief in ihr sitzt noch die Angst der Erkrankung. Aber ich beruhige sie schnell, da es sich für mich lediglich wie ein Erkältungseffekt anfühlt. Natürlich komme ich meinen Pflichten nach und melde meinen Zustand dem Pflegeteam. Knapp 39 Grad werden digital gemessen. Am Montag steht eine Untersuchung beim onkologischen Chefarzt auf meinem Plan. „Ich bin überrascht, dass Sie mich untersuchen. Wie komme ich zu der Ehre?“, begrüße ich den Chefarzt, als er das Behandlungszimmer betritt. „Herr Peter, das erkläre ich Ihnen gerne“, lächelt er mich an. „Sie haben einen solch aggressiven und bösartigen Krebs, der zu den schlimmsten seiner Art zählt, da muss ich selbst ran. Sie müssen wissen, dass Fieber mit ihrer Vorgeschichte kein gutes Signal ist. Wir sind allerdings erstaunt, in welch tollem Zustand Sie bereits nach so kurzer Zeit und den 99 Chemotherapien sind.“ „Danke Herr Professor“, sage ich. „Dann hat der Umstand meines Fiebers ja auch etwas Gutes, so lernen wir uns wenigstens kennen. Ich dachte schon, Sie müssen ran, weil jemand krank sei. Aber eines muss ich noch korrigieren. Ich habe diesen Krebs nicht, ich hatte! Der ist fort, glauben Sie mir.“ Die folgenden 35 Minuten werden eine angenehme Unterhaltung und zum Glück stellt der Professor nicht das Geringste fest. Aber sicher ist ja sicher. Ich teile meine Vermutung, dass es eine kleine Erkältungsinfektion sein wird. Am nächsten Tag kristallisieren sich exakt diese Anzeichen über die Blutwerte heraus. In Folge der Erkältung versäume ich etwas Programm und den Reinigungsdienst muss ich bitten meine nassgeschwitzten Bettbezüge zu tauschen. Zwei Tage später ist mein Körper wieder im Normalbetrieb. Meine Frau nimmt nun auch in meinem Appartement ihren Platz ein. Ich bin sehr froh, dass ich ihr ab heute das Zustellbett buchen konnte. Zustellbett? Wir stellen fest, dass die Arme auf einem ausziehbaren Sessel schlafen muss. Tauschen möchte sie aber auch nicht. Hauptsache, wir sind zusammen. Und so genießen wir die nächsten Tage und Abende am Chiemsee. Während meiner Anwendungen und Seminare lerne ich, dass der Ausdauersport von wenigstens einer halben Stunde für das Immunsystem am günstigsten ist. Stressbewältigung ist ebenfalls ein Seminar, das ich besuchen darf. Das Meiste der Inhalte kennt man eigentlich, dass man eines nach dem anderen machen, sich gegebenenfalls anders organisieren könnte oder einfach mal Abstand nimmt und zur Ruhe kommen sollte. Mein Freund Udo aus Fulda besucht mich in der letzten Woche meines Aufenthalts. Es ist ja nicht so, dass er mich jetzt mal besucht. Er war bereits letztes Jahr mit seiner Frau in unserer Mietwohnung zu Besuch. Es ist angenehm zu erfahren, dass einem Freund die Freundschaft so am Herzen liegt. Mit ihm fahre ich auf die Fraueninsel, für mich eine schönere Blume im Chiemsee als die berühmte Herreninsel. Udo und ich haben wieder tolle Gespräche, das macht es zwischen uns aus, denke ich. Die letzten Tage in meiner Einrichtung bekommen Wendy und ich noch Besuch von Martha und Swen sowie von meinem Freund Jürgen mit seiner neuen Liebe. Die Fraueninsel ist dann immer wieder das Ziel. Die kleine gemütliche Runde um das aktive Frauenkloster mit den Einkehrmöglichkeiten auf der Insel hat etwas von Urlaubsgefühl und Ruhe. Und die kurze Schiffsfahrt über den Chiemsee ist auch nicht alltäglich, das macht wirklich Spaß. In der REHA-Klinik avanciere ich mittlerweile zu dem Patienten, der am längsten vor Ort ist. Wenn es Neuankömmlinge mögen, binde ich sie in Gespräche ein. Ich versuche am Tisch eine familiäre Atmosphäre zu schaffen und helfe gern. In dem Umfeld der Rehabilitation lassen sich Gesprächsthemen und Erfahrungsaustausch über die verschiedenen Krebserkrankungen nicht vermeiden. Da gibt es wirklich viel Leid und jeder hat für sich seine eigenen Erfahrungen machen müssen. Jeder Mensch nimmt diese Krankheit anders wahr, bei jedem richtet die notwendige Therapie andere Nebenwirkungen an. Zuhören und Verständnis sind hier genauso gefragt wie Sensibilität und Psychologie. Nur wenn ich mitbekomme, dass jemand im eigentlichen Sinne richtig Glück hatte, dies aber nicht erkennen will, dann mische ich mich deutlicher, penetranter ein
Kapitel 19. Am 25. Juni ist es dann endlich so weit, meine Eingliederung startet. Zuvor darf ich mit meiner Frau, Maximilian, Martha und Swen noch das Johannisfeuer in Hohenbrunn bewundern. „Und“, wollte Swen wissen. „Freust du dich schon auf deine Arbeit? Wie fühlst du dich?“ Er wusste natürlich, wie wichtig es für mich war, wieder beginnen zu dürfen. Aber er wollte vielleicht auch nur mal abklären, wie es sich so kurz vor Beginn, nach so unendlich langer Zeit, wirklich anfühlt anzufangen. Dabei schaute ich ihm in seine hübschen rehbraunen Augen und sage voller Stolz: „Endlich. Ich bin so glücklich, es ist schwer zu beschreiben.“ Und das ist meine volle Überzeugung. Wieder arbeiten zu dürfen, noch besser, wieder zu können, das ist für mich Luxus pur. Und jetzt fahre ich also in die Tiefgarage. Aha, meine Zugangskarte funktioniert noch, das Tor öffnet sich. Ich gehe durch ein paar Türen, wie in einem kleinen Labyrinth, stempele ein und komme schließlich vor unserem Büro im zweiten Stock an. Schon beim Türöffnen überkommt mich ein unbeschreibliches Gefühl. Ich bin wieder da! Meine Kollegen spüren, hier passiert etwas nicht Alltägliches. Es ist wie ein Wunder, jetzt ist der Max wirklich da, gesund und voller Lust auf Arbeit. Ich kann die Freude kaum beschreiben, die sich in vielen Augen spiegelt. Alex führt mich zur Begrüßung erstmal wie einen „Neuen“ in jedes Büro. Mir kommt es so vor, als wäre auch er extrem stolz auf das Erreichte, so, als wäre es auch sein Triumpf. Er hat meine Krankheit ebenso durchgestanden, wie ich es tat, das ist unverkennbar. Auch zum Geschäftsführer gehen wir und ich nutze die Gelegenheit mich nochmals für die Fürsorge zu bedanken: „Wirklich, jeder Glückwunsch, jeder ausgerichtete Gruß half mir. Ich bin jetzt überglücklich starten zu können.“ „Das war doch selbstverständlich“, sagt er mit seinem jungenhaften, freundlichen Lächeln. „Aber denke daran, du arbeitest erstmal nur 4 Stunden und nicht gleich übertreiben.“ Alex hat natürlich auch noch etwas zu meinen 4 Stunden beizutragen: „Ja, in der Zeit hat der Max gerade seinen PC hochgefahren und seine Begrüßung abgehalten. Dann muss er ja beinahe wieder einpacken?“ Dabei lachen wir gemeinsam. Und dann höre ich ständig vom Weißwurstfrühstück um 10.00 Uhr, das es heute noch gibt. Klar, grenze ich mich da nicht aus, obwohl ich grundsätzlich morgens gut frühstücke. Auf dem Gang in die Kantine frage ich Alex nochmal: „Alex, nur mal für mich zur Info, was ist denn heute der Grund für ein Weißwurstfrühstück? Nicht dass ich dumm dastehe? Gibt es etwas Besonderes zu wissen?“ „Ja, wegen dir findet das natürlich statt, ansonsten gibt es doch keinen Grund“, sagt er floskelhaft im Laufen und freut sich dabei. Gut, er will mir nicht sagen, wegen was das Frühstück ausgegeben wird. Dann lass ich es halt auf mich zukommen. Wir kommen gerade in die Kantine, da sitzen nahezu alle Mitarbeiter unseres Vertriebskanals. Marketing, Key Account Büro, Geschäftsführer und noch ein paar Mitarbeiter mehr. Wir beginnen mit dem Frühstück, das vom Service sehr professionell aufgebaut ist. Sogar Weißbier steht bereit, alkoholfrei natürlich. Es muss definitiv etwas Besonderes passiert sein, das wird mir nun klar. Vielleicht haben wir auch ein exorbitantes Ergebnis eingefahren, das gefeiert werden muss? Endlich ergreifen Alex und der Geschäftsführer abwechselnd das Wort. „Schön, dass ihr heute so zahlreich der Einladung gefolgt seid. Heute wollen wir etwas feiern.“ Aha, denke ich für mich, jetzt erfahre ich es ja. „Es war eine schwere Zeit, die hinter uns liegt. Aber für unseren Max war es eine noch viel schwierigere Zeit. Er hat etwas geschafft, das nicht selbstverständlich ist. Und wenn ich zurückdenke, mit welchem Elan und Willen er an dieser Krankheit gearbeitet hat, dann kann ich nur sagen: Respekt. Herzlichen willkommen, wir sind alle froh, dass du wieder da bist Max!“ Das Frühstück wird wirklich mir zu Ehren durchgeführt. Ich bin total gerührt und mal wieder den Tränen nahe. Aber ich kann den Dank und das Lob nur zurückgeben. Entgegen meinen eher ausgiebigen Sätzen geht es jetzt doch eher knapp zu: „Danke liebes Bosch Team!!!“ Nach all den Emotionen geht es langsam in den Alltag über. Das ist es, was ich auch möchte. Meiner Frau erzähle ich von meinem Einstieg am Abend, auch sie kann es kaum fassen. „Dieser Alex, der ist echt der Hammer“, sagt sie noch. Meine erste Woche geht gut um, die zweite Woche mit 5 Stunden am Tag stellt sich als sehr anstrengend für mich dar. Und seltsamerweise nach dem kleinen Hänger in der 2. Woche geht die dritte und letzte Woche mit 6 Stunden wieder ganz leicht von der Hand. Meine Personalreferentin geht mit mir in dieser Woche gemeinsam zum Mittagessen. Sie meint es gut, und ihre Fürsorge ist berechtigt. „Bitte nicht gleich Vollgas geben Herr Peter“, impft sie mir ein. Dabei schaut sie mich mit ihrem flotten Kurzhaarschnitt und ihren schönen blauen Augen an. Sie weiß genau, was sie sagt und warum. Und sie merkt mir meinen Tatendrang an und mahnt zu Recht. „Wenn Sie irgendetwas spüren sollten während Ihrer kurzen Eingliederungsphase, dann bitte gleich melden. Sind Sie erstmal durch und wieder voll an Ihrem Arbeitsplatz, verlangt die Firma automatisch auch 100 % Leistung. Deshalb macht man diese Eingliederung, in Ihrem Fall auch eher über einen längeren Zeitraum. Ich hoffe, Sie nehmen sich das zu Herzen? Sie hatten keine Grippe oder einen Bruch Herr Peter.“ „Das weiß ich. Aber glauben Sie mir, ich habe ein sehr gutes Körpergefühl. Das hat mir vielleicht mein Leben gerettet und auf das werde ich auch in Zukunft hören. Versprochen“, schließe ich noch. Sie schaut mich kurz an und ich erkenne ein paar kleine, aber nicht so bedeutende Zweifel. Sie weiß vermutlich genau, dass so ein Vertriebler wie ich nie auf Halbmast fährt. Manche Arbeitskollegen schauen mich auf dem Flur begegnend einfach nur an und grüßen, einige aber sprechen mich an und erkundigen sich über die Zeit der Krankheit. Und ich spüre noch bei jedem Gespräch, bei jedem Telefon, dass durch die nötige Konzentration mein Adrenalin den Schweiß aus dem Körper holt. Es ist die unangenehme Seite der Chemotherapie. Ebenso unangenehm ist die Brüchigkeit meiner Finger- und Fußnägel. Diese Dinge benötigen mindestens genauso viel Zeit. Es dauert, bis auch der letzte Rest an Altlasten aus dem Körper ist. Noch während meiner Eingliederungsphase findet eine große Vorstellung unserer Produkte zur diesjährigen IFA in Berlin statt. Da möchte ich unbedingt dabei sein. Unsere Firma ist sehr bedacht auf die Fürsorge der Mitarbeiter und speziell in meinem Fall mit klarer Linie unterwegs. Deshalb dürfte ich aufgrund der notwendigen Zeit, die eine Tagung dieser Art in Anspruch nimmt, nicht teilnehmen. Doch ich kann meinen Vorgesetzten überzeugen, dass ich dabei sein möchte und auf mich achten werde. Ich klinke mich einfach nach meinen Stunden aus, das sollte ich doch dürfen? Der Kompromiss ist gefunden und ich darf teilnehmen. Natürlich ziehen sich diese Vertriebsveranstaltungen und am Abend spüre ich einen leeren Akku. Es ist zwar überwältigend, wie mich beinahe alle Vertriebsmitarbeiter willkommen heißen. Das ist äußerst positiv, dennoch zehrt es stark an mir. Da ich noch sehr viel Urlaub habe und bis zur Messe in Berlin wieder vollends fit sein möchte, entscheide ich mich für einen anschließenden Urlaub. Ich denke, es ist die richtige Entscheidung, schließlich muss der Alturlaub ja auch mal weg. Für den 12. Juli bin ich zu meinem 2. Nachsorgetermin ins Klinikum bestellt. Es grenzt an Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Ist denn mein erster Nachsorgetermin vom April so lange her? Als ich im Warteraum eintreffe, trinke ich noch etwas Wasser, nicht, dass die Nierenwerte wieder zu hoch sind. Und dann sitze ich bei Frau Dr. Stiegel. Sie freut sich mich wiederzusehen. „Na Her Peter, wie gefällt Ihnen Ihre Arbeit?“ Diese Frage musste kommen. Natürlich bemerkt sie, dass ich stolz bin und mich riesig freue. Aber als ich von meinen zu starken und häufigen Schweißattacken erzähle, hakt sie schon ein: „Herr Peter, das G-Mall Protokoll war unglaublich anstrengend für Ihren Körper. Trotz präsenter Fitness müssen Sie weiterhin gut auf Ihren Körper hören und darauf achten, sich nicht zu überlasten.“ Irgendwie hat sie Recht und ich weiß es. Das heißt nicht, dass ich mich gerne damit abfinde. Auch mit dem Thema Entgiften des Körpers nach einer Chemotherapie beschäftige ich mich nun. Von Frau Dr. Stiegel weiß ich, dass das der Körper in etwa ein oder zwei Jahren von allein regelt. Da ich aber ein paar zusätzliche Wochen Urlaub habe, fange ich aktiv an mich zu entgiften. Ich besorge mir Bentonit. Das ist ein Magnet im übersetzten Sinne, das der Leber und den Organen hilft, vorhandenes Gift gezielt abzubauen. Und Gerstengraspulver, welches die Entgiftung zusätzlich unterstützt und der Darmflora hilft sich wiederaufzubauen. Ins Müsli noch ab und zu ein paar Aroniabeeren, diese schaden ebenfalls nicht. Das Bentonit nenne ich nach ein paar Tagen nur noch Beton. Es ist grau wie Beton, es riecht wie Beton und ich glaube zu wissen, es schmeckt auch so. Obwohl ich meine Werte oder meine Dosis nie mit einem Fachmann abgesprochen habe oder untersuchen ließ, ich habe ein gutes Gefühl und das ist es mir wert. Ein paar Tage später sitzen wir für gute 8 Stunden im Auto. Wir sind auf die Hochzeit unserer Nichte eingeladen. Die Fahrt von München nach Essen zieht sich, doch die anschließende Feier ist schön. Eine Hochzeit ist nach wie vor das Schönste im Leben. Und dass wir einen Großteil meiner Familie wieder einmal sehen, hat einen zusätzlichen Nebeneffekt. Meine Nichte und ihr Ehemann besuchten uns noch im letzten Jahr während meiner Krankheit und erzählten wieder zurück zu Hause von diesem Besuch. Dass so eine Geschichte neugierig macht, ist verständlich. So kommt es, dass mich eine mir bis dato unbekannte Freundin des Hauses auf meine Krankheit anspricht. Ohne in die Tiefe zu gehen, gebe ich der Freundin Auskunft. Nachdem ich in meinem Vokabular mehrmals das Wort Glück benutzte, genauso empfinde ich es auch, schaut sie mich völlig perplex an: „Du bist aber echt makaber. Wie kannst du bei dieser schweren Krankheit noch von Glück sprechen?“ „Aber ja, genau das Alles ist doch Glück, sonst säße ich jetzt nicht hier oder?“ Für den 27. Juli ist meine Portexplantation terminiert. Ich bin mittlerweile wirklich froh, wenn dieses Relikt aus meinem Unterarm entfernt wird. Je normaler mir die Handgriffe im Alltag von der Hand gehen, desto mehr ist der Port im Weg. Bereits Mitte Juni war ich zum Aufklärungsgespräch im Klinikum. Meine erste Anlaufstelle war die Radiologie. Das war die Abteilung, die den Port implementierte. Die behandelnden Ärzte wüssten genau, wie sie ihr eigenes Handwerk behandeln müssten. Aber ich täuschte mich. Nur in der ambulanten Chirurgie in der anhängenden Poliklinik werden Portexplantationen vorgenommen, wurde ich aufgeklärt. Hier fanden dann auch das Aufklärungsgespräch, die Blutentnahme und Terminabsprache für heute statt. Eine Bedingung für eine Explantation, so erfuhr ich noch, sind wenigstens zwei unbedenkliche Nachsorgetermine, die hatte ich ja nun hinter mir. An der Patientenaufnahme herrscht heute reger Betrieb. Ein anderer Patient kommt gleichzeitig mit mir an. Er scheint etwas nervös zu sein und ich lasse ihm gerne beim Anmelden den Vortritt. Wir warten etwa 15 Minuten und schon ist er an der Reihe. Innerhalb eines Wimpernschlags schießt ihm das Adrenalin durch den Körper. Ich glaube, es wird mal wieder ein abwechslungsreicher Vormittag. Er regt sich auf und macht einen riesen Aufstand, weil er beinahe eine Stunde hier wartet. Eine absolute Frechheit sei dies, stellt er noch unüberhörbar fest. Ich schaue in aller Ruhe auf meine Uhr, komme aber selbst beim gröbsten Aufrunden nicht auf seine These. Vor allem denke ich bei mir, warum er sich aufregt, wenn er doch genau in diesem Moment aufgerufen wird? Nun bin ich an der Reihe. Für 09.00 Uhr war ich bestellt, es ist jetzt kurz nach, passt. Eine nette, unbekümmerte Dame steht mir am Tresen gegenüber. „Guten Morgen, Max Peter, ich habe hier um 09.00 Uhr einen Termin zur Portexplantation.“ Die Dame antwortet etwas naiv: „Warum kommen Sie denn nicht gleich vor und sagen, dass Sie einen Termin haben?“ Ich schmunzele etwas in mich hinein und entgegne: „Nun stellen Sie sich mal vor, ich hätte mich bei diesem Andrang noch vorgedrängelt. Was glauben Sie, wie wohl der Patient vor mir reagiert hätte?“ Ich glaube, sie hat den Hinweis nicht gänzlich verstanden und antwortet nur mit einen „Na ja“ und sucht und blättert. „Ich finde Sie aber nicht, was wollen Sie?“ Nochmal erkläre ich ihr alles in Ruhe, zeige ihr den Notizzettel mit dem Datum aus ihrer Abteilung. „Schauen Sie mal nach dem Tumorzentrum, möglicherweise gibt es da einen Hinweis? Meine Blutwerte wurden mir hier doch auch vor ein paar Wochen abgenommen, vielleicht finden Sie diese?“ Sie findet nichts, solange sie auch sucht, weder im Blätterstapel noch im System. Jetzt wird sie nervös. Während sie weitersucht, fällt ihr ein: „Ja, jetzt weiß ich es. Portentnahmen machen wir doch überhaupt nicht. Wissen Sie was, das machen immer die in der gegenüberliegenden Notaufnahme. Sehen Sie das, das da drüben? Da müssen Sie hin.“ Nun von ihrem eigenen Wissen beeindruckt, zeigt sie in Richtung Ausgang ein paar Meter weiter. „Liebe Frau, glauben Sie mir, da muss ich bestimmt nicht hin. Ich war hier, hatte hier mein Aufklärungsgespräch und habe einen Termin. Wir sehen uns gleich wieder, glauben Sie mir.“ Ich schüttele nur meinen Kopf, bleibe aber entspannt. In der Notaufnahme wissen die Mitarbeiter von keiner Portentnahme etwas oder haben je von mir als Patient gehört. Das war mir schon vorher klar. Da muss wohl die Dame der chirurgischen Ambulanz etwas missverstanden haben. Ich trotte wieder zurück, es ist etwa 10.00 Uhr. „Da sind Sie ja schon wieder, was wollen Sie denn noch?“, kommt etwas beängstigend rüber. Eigentlich war ich für sie bereits abgehakt. „Wissen Sie was“, sage ich. „Sie rufen jetzt im TTZ bei Frau Dr. Stiegel an, und der Fall wird sich klären. Und anschließend rufen Sie mir bitte einen Arzt. Vielen Dank.“ Ich diskutiere nicht weiter mit ihr, sondern setze mich auf einen Stuhl im Wartebereich. Es dauert nicht lange, da kommt ein Arzt auf mich zu. „Sind Sie der Herr Peter?“ „Ja“, bestätige ich kurz. „Hm ja, kommen Sie doch bitte mal mit.“ Er geht vor, ich hinterher in einen kleinen Besprechungsraum. „Ja, das ist so. Da muss wohl ein Fehler gemacht worden sein. Wir müssen zuerst einen Besprechungsbogen ausfüllen.“ „Entschuldigung, aber ich glaube, das benötigen wir nicht. Der wurde schon ausgefüllt.“ „Ja, aber wann waren Sie denn hier?“ „Ich war so am 17. 06. rum hier. Den genauen Tag müsste ich aber nochmal nachsehen, wenn das Ihnen hilft.“ Ich will gerade mein Handy zur Hand nehmen, da antwortet er: „Nein, das brauchen Sie nicht. Diese Bögen dürfen zwingend nur 2 Wochen aufgehoben werden. Ansonsten verlieren sie ihre Gültigkeit.“ „Wie?“, frage ich. „Aber warum macht man dann einen Termin für heute, über 5 Wochen später? Das passt doch nicht zusammen?“ Er ist nun noch unsicherer als zuvor. „Also man hat Ihnen im Juni für heute einen Termin gemacht? Für heute?“ „Ja, ich habe sogar noch Ihren Terminnotizzettel dabei. Warum?“ „Das ist seltsam. Weil wir die Portexplantationen ausschließlich mittwochs machen.“ „Mittwochs? Und ich werde für Freitag bestellt? Nun wird’s lustig“, sage ich noch. „Und Ihre Dame von der Aufnahme meint zu wissen, dass Sie generell keine Portexplantationen durchführen würden.“ Ich kann nur noch lächeln, es entsteht gerade ein Theaterstück. Doch die Vorstellung ist noch nicht aus. „Das heißt, Sie wollen mich heute gar nicht operieren? Ich bin heute völlig umsonst hier?“ „Ja das tut mir aber leid. Ich kann mich nur bei Ihnen entschuldigen. Aber heute kommen wir nicht in den OP-Bereich hinein. Aber ich schaue mal und werde mir Ihre Akte holen.“ Er geht aus dem Zimmer. Hauptsache, das Ding kommt irgendwie heraus, denke ich mir. Die Tür geht wieder auf und der Arzt ist zurück auf seinem Stuhl. Sein Gesicht verrät, dass er einen Schritt weiter ist. „Also Herr Peter, wenn ich mir Ihre Aktenlage ansehe, dann gehören Sie in die Radiologie. Alles andere macht bei Ihnen überhaupt keinen Sinn.“ „Ach ja“, sage ich beinahe triumphierend. „Diese Abteilung war mein ursprüngliches Ziel. Aber Sie tun mir nun bitte einen Gefallen. Ich werde auf keinen Fall einfach dort hinlaufen und meine Geschichte versuchen irgendjemandem zu erklären. Sie rufen bitte für mich dort an und versuchen das zu regeln, ja? In der Zwischenzeit gehe ich gemütlich durch Ihr Labyrinth, ich kenne den Weg. Vielen Dank Herr Doktor“, sage ich noch zum Abschluss und gebe ihm die Hand. Und ich kann es kaum glauben, in der Radiologie wartet man bereits auf mich und empfängt mich vorinformiert. Das hat schon einmal geklappt, ich freue mich. Der Kollege klärt mich auf, wir machen für den 01. 08. einen Termin. Mit einem Eingriff noch am heutigen Tag habe ich auch nicht mehr gerechnet. Während ich das Krankenhaus verlasse, schwirrt der Choleriker in meinem Kopf herum. Was wäre wohl passiert, hätte er meinen Tag erwischt? Ich glaube, das Klinikum wäre gesprengt worden! Die Zeit rennt wie die letzten Wochen dahin, der 01. August lässt nicht mehr lange auf sich warten. Ich stehe mit meiner Frau auf, wir frühstücken gemütlich und anschließend fahre ich zum Max-Weber-Platz ins Klinikum. Mein kleiner OP-Termin ist für 09.00 Uhr angesetzt, bereits um 09.15 Uhr liege ich mit rasiertem und mehrfach desinfiziertem Arm auf dem OP Tisch. Die Stiche in den Unterarm mit der Betäubungsspritze spüre ich kaum, so toll setzt der Arzt die Nadel. Zwar ist der Port minimal angewachsen, aber letztendlich liegt er doch auf dem Ablagetisch und ich kann mir das Teil nochmal genau ansehen. Der Arzt fragt mich, ob ich das Teil als Andenken mitnehmen möchte. Ich nehme es mit, allerdings ausschließlich in meinem Kopf. Dort kann ich es auch nicht verlieren. Die Portexplantation war für mich der allerletzte Schritt in ein normales Leben zurück, ohne Anschlussmöglichkeit an die „Matrix“
Kapitel 20. Mit meinem Dienst auf der IFA 2018 in Berlin, schließt sich letztendlich der Kreis des Burkitt Lymphoms. Hier hatte ich meinen letzten Arbeitstag!
Отрывок из книги
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
.....
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
.....