Carl Schmitts Gegenrevolution
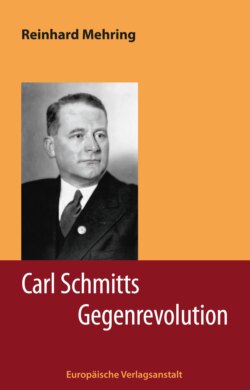
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Reinhard Mehring. Carl Schmitts Gegenrevolution
Carl Schmitts Gegenrevolution
Vorwort
Inhalt
Zur Einführung in die Thematik
I. Der „schmale Weg des Transzendentalismus“. Schmitts Weg zur gegenrevolutionären Souveränitätslehre. 1. Fehlende Antwort auf den Rechtshegelianismus?
2. Erste Antwort auf Neukantianer
3. Schmitts Binder-Kritik
4. Positionierung zu Kaufmanns Kritik der neukantischen Rechtsphilosophie
5. Transzendentale Souveränität?
6. Rekapitulation
II. Offene Anfänge? Carl Schmitts frühe Option für die Gegenrevolution. 1. Zwischenkriegszeit
2. Berlin ist wieder Weimar? Regierungsbildungskrise 2017/18
3. Quellenfrage
4. Rückblick 1928
5. Münchner Umbrucherfahrung
6. Spiegel der Politischen Romantik
7. Briefliche Äußerungen
8. Die Jakobiner nach 1918
9. Gegenrevolutionäre Bejahung der „konstitutionellen Demokratie“
III. Die Spanische Grippe und die Lehre von der „kommissarischen Diktatur“ 1. Die Spanische Grippe in München
2. Jenaer Auslegung der „kommissarischen Diktatur“
IV. Gegen romantischen Utopismus: Schmitts Novalis-Bild. 1. Das Buch Politische Romantik
2. Novalis-Erwähnungen in der Politischen Romantik
3. 1815 statt 1798: Hegel statt Novalis, Staat statt Nation
V. Gegen den Anarchismus: Fritz Mauthner und Gustav Landauer im Visier
1. Von Mauthner zu Landauer: von der Sprachskepsis zur anarchistischen Revolutionsmystik
2. Landauer und Schmitt als Antipoden in der Münchner Revolution
3. Schmitts Mauthnerkritik
4. Schmitts Sicht des Anarchismus
VI. Cortés-Maske im Spanienmythos. 1. Exzentrische Autorenmaske: Juan Donoso Cortés (1809–1853)
2. Stierkampf als Passion
3. Nationalmythen
4. Die Donoso Cortés-Identifikation
5. Kontext der Erstveröffentlichung
6. Gegenrevolutionäres Outing
7. Mythisierung des Legitimitätsvorbehalts
8. Vom Marxismus zum Bolschewismus
9. Die Landung des Mythos
I. Max Weber und Carl Schmitt
1. Ein „legitimer Schüler“ Webers?
2. Webers politisches Denken
3. Schmitts juristische Transposition
II. Cato oder Plato? Max Webers letzte Worte
III. Biographie eines Antipoden: Hans Kelsen (1881–1973)
1. Aufstieg zum „Verfassungsvater“
2. „Staatsform und Weltanschauung“: Kelsens „Relativismus“
3. Kassierter Kölner Wettstreit
IV. Demokratiediskurs als philosophische Bewegung. Zum Methoden- und Richtungsstreit in der Weimarer Staatsrechtslehre. 1. Von der Parteinahme zur Historisierung
2. Demokratisches „Immanenzdenken“ als Konsensposten
3. Von den Voraussetzungen der Verfassung
4. Grenzen der Aktualisierung
V. Liberale Demokratie als Paradoxon? Carl Schmitts Beisetzung des klassischen Liberalismus
1. Ist Schmitts historizistische Kritik des „relativen“ Rationalismus plausibel?
2. Mentalitätsgeschichte und zitationspolitischer Liberalismuseid: die Constant-Referenz
3. Verfassungssystematische Konsequenzen
4. Antibürgerlicher Affekt und religiöser Individualismus
VI. Soziale Realität versus „Begriffsrealismus“: Otto Kirchheimer und der Links-Schmittismus. 1. Was ist Links-Schmittismus?
2. Franz Neumanns Brief vom 7. September 1932
3. Kirchheimers Verhältnis zu Schmitt
4. Zum „Begriffsrealismus“
5. Zum Revolutionsmythos im Links-Schmittismus
VII. Abrechnungen enger Weggefährten: Eduard Rosenbaum und Moritz J. Bonn
1. Rosenbaum, Schmitt und der Reichstagsbrand
2. Der Weltgeist im Souffleurkasten: Moritz Julius Bonn. 2. 1. Bonns Autobiographie So macht man Geschichte
2. 2. „Ich verbrenne keine Ketzer“: Bonn über Schmitt
2. 3. „Ritualmordmesser“ eines „Schmonzologen“: Schmitt über Bonn
3. Schluss
Überleitung
I. Vordenker der souveränen Diktatur? Das antiliberale Rousseau-Bild und Carl Schmitt
1. Kleine Blütenlese der Rousseau-Rezeption
2. Rousseau als Vater der souveränen Diktatur
3. Vom Dementi der Theorie durch das Leben
II. Goethe oder Shakespeare? Rollenspiele im Nationalsozialismus. 1. Einbruch des hermeneutischen Spiels in die Zeitdeutung
2. Mephistophelisches Spiel? Gründgens als Modell
3. Gründgens oder Krauss? Hamlet oder King Lear?
4. Aus der „Bruderschaft“ von Rameaus Neffe?
III. Konstitutionalismus und Antisemitismus: Carl Schmitts Rechtswissenschaftsgeschichte
1. Leerstellen im Verfassungsbild
2. Linienführung
3. Verfassungsgeschichte als kontrafaktische Legitimitätserzählung
4. „Aufgaben“ und Perspektive
5. Antisemitische Codierung
6. Antisemitisches Programm
7. In Schmitts paradigmatischen Stahl-Gewittern
IV. „Autor vor allem der ‚Judenfrage‘ von 1843“: Carl Schmitts Bruno Bauer
1. Philologische Befunde
2. Bruno Bauer im „Depositum“ für Erich Przywara
3. Schmitts Löwith-Glosse
4. Bauers Streitschrift Zur Judenfrage
5. Überleitung
V. „Ich müsste mich mit Triepel auseinandersetzen“. Triepel, Schmitt und Die Hegemonie
1. Blütenlese biographischer Erwähnungen
2. Triepel-Erwähnungen im Werk
3. Triepels Präferenz für „Hegemonie“
4. Schmitts Triepel-Besprechung
5. „Abscheu“ vor dem Nationalsozialismus: Vom Stil des Rechts
VI. Savigny oder Hegel? Die Schrift Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft
1. Fassungen der Schrift
2. Eckpunkte von Schmitts Rechts- und Staatstheorie. 2. 1. Antwort mit Hölderlin
2. 2. „Urwort“ Nomos: von Salin zu Schmitt
2. 3. Hegel statt Savigny
2. 4. Gegenbegriff Gerechtigkeit
3. Die Rolle Savignys in Schmitts Rechtswissenschaftsgeschichte
4. Aufbauanalyse der Schrift. 4. 1. Der Bedeutungskern der Savigny-Identifikation
4. 2. Zur rechtstheoretischen Krisis-Analyse
4.3. „Aufspaltung des Rechts“: Problembefund als Ausgangsfrage
5. Ablenkungsmanöver
I. Legitimität gegen Legalität? Schmitts Absetzung von Johannes Winckelmann. 1. Spiritus rector Winckelmanns
2. Zur Korrespondenz zwischen Schmitt und Winckelmann
3. Schmitts späte Weber-Rezensionen
4. Die Legitimität der Legalität als Problem
5. Rekonstruktion der Legitimität der Legalität?
II. Sinnkritik nach Carl Schmitt. Reinhart Kosellecks Rezeption im Briefwechsel
III. Akkreditierung im Schmittianismus? Herfried Münklers Korrespondenz mit Carl Schmitt. 1. Edition der Korrespondenz 1982/83. 1. 1. [undatierter handschriftl. Brief vom 5. Februar 1982]
1. 2. [Nachlass Carl Schmitts RW 265-10047; maschinenschriftlich mit handschriftl. Unterschrift sowie Unterstreichungen und Bemerkungen Schmitts: Briefkopf: Dr. Herfried Münkler / Judengasse 11 / 6360 Friedberg/H. 1; Schmitt: „erhalten 27. April 82 / b. 28/4/82“]
1. 3. [handschriftl. Brief]
1. 4. [Nachlass Carl Schmitt RW 265-10048; maschinenschriftlich Brief]
1. 5. [handschriftl. Brief]
2. Analyse der Korrespondenz. 2. 1. Kontaktbeginn
2. 2. Münklers Aufsatz Partisanen der Tradition
2. 3. Schmitts erste Antwort: weltpolitische Aspekte
2. 4. „Theorie einer Hegung des Krieges“?
2. 5. Akkreditierung im Schülerkreis?
2. 6. Schmittianer?
2. 7. Münklers frühe Distanzierung
2. 8. Schmitts Curiositas-Warnung
2. 9. Spätere Historisierungen
IV. Im „Labyrinth der Legitimitäten“ und Ethos-Analyse. Schmitt und Münkler über neue Kriege und Krieger. 1. Schmitts Theorie des Partisanen im Kontext des kriegsrechtlichen Werks. 1. 1. Wendung zum „diskriminierenden“ Kriegsbegriff
1. 2. „Terrane Legitimität“? Theorie des Partisanen
2. Münklers Ethosanalyse der Spannung „heroischer“ und „postheroischer“ Mentalitäten. 2. 1. Anknüpfungen
2. 2. Transformation in Kriegssplitter
V. „Neue Normalität“ und Postheroismus in Merkels anfänglicher Corona-Politik. 1. Vorbemerkung April 2021
2. Goethes Heroismus
3. Merkels Postheroismus
VI. Statt eines Schlusses: Gespräch mit Damen über den abwesenden Herrn Schmitt. 1. Rekapitulation
2. Überleitung zur Fiktionalisierung
3. Hotel Atlantic, Hamburg 1963
Nachwort
Siglen der wichtigsten Werke Carl Schmitts
Briefwechsel
Nachweise
Teil A
Teil B
Teil C
Teil D
Anmerkungen. Vorwort und Einleitung
Teil A
Teil B
Teil C
Teil D
Отрывок из книги
Reinhard Mehring
Die vorliegenden Studien radikalisieren auf heutiger Quellenbasis Hasso Hofmanns4 Generalbefund: Legitimität gegen Legalität. Hofmanns Problemgeschichte beschrieb einen „Weg“ von der „rationalen“ und „existentialistischen“ zur „rassischen“ und „geschichtlichen“ Legitimität. Die folgenden Studien analysieren diesen Weg als Destruktionsbewegung und Legitimitätskritik; sie pointieren den Befund, dass Schmitt mit der Legalität auch die Legitimität problematisch wurde. Der „Weg“ endete mit Legitimitätszweifel und Legitimitätszerfall. Zwar war Schmitt auch ein rechtspolitischer Akteur. Seine Rolle als „Kronjurist“ im Präsidialsystem und „Führerstaat“ ist keinesfalls gering und muss für einige Aspekte noch tiefenscharf geklärt werden. Diese Akteursrolle steht in den folgenden Studien aber nicht im Zentrum. Als Soldat drückte Schmitt sich vor der Front und war bis 1933 eigentlich nirgendwo organisiert: weder in einer Studentenverbindung noch in der Kirche, einer Partei, einem Freikorps oder einer sozialen Bewegung. An der Universität strebte er nicht in Ämter, war nie Dekan oder Rektor. Er stürmte nicht an der Seite D’Annunzios Fiume, war nicht am Marsch auf Rom oder zur Feldherrenhalle beteiligt und putschte auch nicht wie später Salan oder Mishima. Den „Zugang zum Machthaber“ fand er deshalb auch nur sehr gelegentlich in untergeordneter Rolle. Er wirkte nicht auf Hitler oder Himmler, Goebbels oder Rosenberg. Die NS-Spitzenpolitiker, denen er nachweislich begegnete – u.a. Göring, Frick, Frank und Freisler –, ließen sich von ihm auch nicht ernstlich beeinflussen. Sieht man vom Umgang mit Johannes Popitz ab, so hatte Schmitt wohl nur auf Hans Frank bis 1936 einen beachtlichen Einfluss, der im Detail aber schwer zu klären ist. Es ist sehr zweifelhaft, ob er als „Staatsrat“ auf Göring wirkte. Unter den NS-Akteuren gehörte er allenfalls in die zweite Reihe. Er war aber vor allem ein „Totengräber“ Weimars und „Quartiermacher“ des Nationalsozialismus, wie es einstige Weggefährten schon früh sahen.
.....
II.Sinnkritik nach Carl Schmitt. Reinhart Kosellecks Rezeption im Briefwechsel
III.Akkreditierung im Schmittianismus? Herfried Münklers Korrespondenz mit Carl Schmitt
.....