Handbuch Medizinrecht
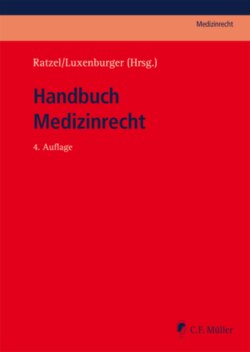
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Thomas Vollmöller. Handbuch Medizinrecht
Handbuch Medizinrecht
Impressum
Vorwort
Autorenverzeichnis
Inhalts- und Bearbeiterübersicht
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
1. Kapitel Einleitung
Anmerkungen
2. Kapitel Das medizinrechtliche Mandat
A. Allgemeines
B. Medizinrecht als Querschnittsfach
I. Öffentlich-rechtliche Prägung des Medizinrechts
II. Medizinrecht und gesellschaftspolitische Strömungen
C. Informationen
I. Printmedien und Organisationen
II. Informationsbörsen
D. Mandantentypologie im Medizinrecht
E. Das Honorar
I. Mandatsbearbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
II. Auszug aus dem Streitwertkatalog der Sozialgerichtsbarkeit 2017
III. Auszug aus dem Streitwertkatalog der Verwaltungsgerichtsbarkeit 2013 (i.d.F. v. 31.5./1.6. und 18.7.2013)
IV. Zivilrechtliche Verfahren
Anmerkungen
3. Kapitel Europäisches Gesundheitsrecht
A. Einführung
B. Gesundheitsrecht in der Europäischen Union
1. Bedeutung der europäischen Einigung
2. Die Union in Gestalt des Vertrags von Lissabon
1. Organe
2. Rechtsquellen
a) Primäres Unionsrecht
b) Sekundäres Unionsrecht
c) Vorrang und Vollzug des Unionsrechts
a) Zuständigkeiten
b) Verfahrensarten
a) Grundlagen
b) Maßnahme gleicher Wirkung wie mengenmäßige Beschränkungen
c) Entscheidungen des EuGH
2. Freiheiten des Personen- und Dienstleistungsverkehrs
a) Niederlassungsfreiheit
b) Arbeitnehmerfreizügigkeit
c) Freiheit des Dienstleistungsverkehrs
d) Richtlinien zu den Freiheiten des Personen- und Dienstleistungsverkehrs
e) Entscheidungen des EuGH
3. Kartellrecht
4. Beihilferecht
5. Vergaberecht
6. Sozialpolitik
7. Allgemeine Gleichbehandlung
8. Gesundheitswesen
9. Rechtsangleichung
Anmerkungen
C. Gesundheitsrecht im Rahmen der Tätigkeit des Europarats
I. Einführung
II. Organisation und Aufgaben des Europarats
III. Übereinkommen mit Bezug zum Gesundheitsrecht
IV. Entscheidungen des EGMR mit Bezug zum Gesundheitsrecht
Anmerkungen
4. Kapitel Das Gesundheitswesen in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland
A. Gesetzgebungskompetenz des Bundes
Anmerkungen
B. Berufswahlfreiheit, Berufsausübungsfreiheit, Unternehmensfreiheit, Art. 12 Abs. 1 GG
Anmerkungen
C. Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, Art. 2 Abs. 2 GG
Anmerkungen
D. Menschenwürde, Art. 1 Abs. 1 GG
Anmerkungen
E. Freiheit von Wissenschaft, Lehre und Forschung, Art. 5 Abs. 3 GG
Anmerkungen
5. Kapitel Infektionsschutzrecht
I. Gesetzliche Grundlagen
Anmerkungen
II. Koordinierung und Früherkennung
Anmerkungen
III. Überwachung und Meldewesen
Anmerkungen
IV. Verhütung übertragbarer Krankheiten
Anmerkungen
V. Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
Anmerkungen
VI. Entschädigung
Anmerkungen
VII. Sanktionen
6. Kapitel Berufsrecht der Gesundheitsberufe unter Einschluss der Darstellung des Rechts der Selbstverwaltung
A. Einführung
Anmerkungen
B. Geschichte
I. Allgemeines
1. Begriff des Freien Berufes
2. Freie Heilberufe: Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Tierärzte, Psychotherapeuten
Anmerkungen
C. Selbstverwaltung
I. Begriff der Selbstverwaltung
II. Idee der Selbstverwaltung
III. Staatsrechtlicher Begriff der Selbstverwaltung
IV. Funktionale Selbstverwaltung
V. Perspektiven der Selbstverwaltung
1. Geschichte der Heilberufe-Kammern
2. Kammerverfassung
a) Mitgliedschaft
b) Organe
c) Finanzierung
d) Berufsgerichtsbarkeit
e) Ahndung von Wettbewerbsverstößen
f) Dachverbände
3. Selbstverwaltungs-Aufgaben
a) Berufsaufsicht
b) Vertretung des Gesamtinteresses
c) Förderung des Berufsstandes
4. Übertragene Aufgaben
5. „Kammern“ auf Bundesebene
a) Bundesärztekammer (BÄK)
b) Bundeszahnärztekammer (BZÄK)
c) Bundesapothekerkammer (BAK)
d) Bundestierärztekammer (BTK)
e) Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK)
1. Geschichte
2. Kassenärztliche und Kassenzahnärztliche Vereinigungen im SGB V
3. Neue Aufgaben und Strukturen der Selbstverwaltung in der Gesetzlichen Krankenversicherung
VIII. Weitere Selbstverwaltungseinrichtungen der Heilberufe – Berufsständische Versorgungswerke
Anmerkungen
D. Berufsrecht der Heilberufe
I. Geschichte
1. Europäisches Recht
2. Qualitätssicherung, Verbraucherschutz
1. Berufszugang
a) Musterberufsordnung 2004
b) Unvereinbarkeiten, Unabhängigkeit
c) Zusammenarbeit mit bestimmten (ausgewählten) Gesundheitshandwerkern
d) Handwerk und Hilfsmittelabgabe, verkürzter Versorgungsweg
e) Kooperation mit Sanitätshäusern
f) Mittelbare Vorteile und Umgehungsstrategien
g) Unabhängigkeit
aa) Vorteilsgewährung und Zuweisung gegen Entgelt, wirtschaftliche Einflussnahme
bb) Vorteilsgewährung für sonstige Tätigkeiten
cc) Kooperationsverträge zwischen Krankenhäusern und Vertragsärzten – Schnittstellenoptimierung oder Zuweisungsprovision?
dd) Exkurs: Wahrung der ärztlichen Unabhängigkeit bei der Zusammenarbeit mit Dritten[171]
aa) Einführung in das Thema
bb) Werbung, Information und Meinungsfreiheit
cc) Differenzierung stationär/ambulant?
dd) „Anpreisen“
ee) Arzt und Medien
ff) Der Arzt als Unternehmer/mittelbare Werbung
i) Berufsrechtlicher Adressatenkreis
aa) Inhalt und Aufmachung der Praxisschilder
bb) Zulässige/unzulässige Angaben und berufsbezogene Informationen
cc) Unzulässige Fremdwerbung
dd) Titel
ee) Verzeichnisse
ff) Kollegialität
gg) Verpflichtung zur Weiterbildung
hh) Poolpflicht
aa) Rechtsgrundlagen und Maßnahmenkatalog
bb) Verfahrensvoraussetzung
cc) Verfahrensgegenstand
dd) Rechtsmittel und sonstige Verfahrensgrundsätze
1. Geschichte
2. Berufszugang
aa) Allgemeines
bb) Regelungen im Einzelnen
b) Berufsordnung für Zahnärzte in der EU
1. Geschichte
2. Berufszugang
a) Berufsordnung
b) Grenzen der Berufsausübung
c) Nebengeschäfte
1. Geschichte
2. Berufszugang
3. Berufsausübung
a) Musterberufsordnung
aa) Regelungen im Einzelnen
1. Geschichte
2. Berufszugang
3. Berufsausübung
Anmerkungen
E. Berufsrecht anderer Heilberufe oder Heilhilfsberufe (Gesundheitsfachberufe)
I. Allgemeines
1. Heilpraktiker
2. Altenpfleger und Altenpflegehelfer, Pflegeberufe
3. Ergotherapeut
4. Diätassistent
5. Hebammen und Entbindungspfleger
6. Gesundheits- und Krankenpfleger/Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger
7. Logopäde
8. Masseur/Medizinischer Bademeister und Physiotherapeut
9. Orthoptist
10. Pharmazeutisch-technischer Assistent
11. Podologe
1. Notfallsanitäter[75]
2. Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent, Medizinisch-technischer Radiologieassistent, Medizinisch-technischer Assistent für Funktionsdiagnostik, Veterinärmedizinisch-technischer Assistent
3. Medizinischer Fachangestellter
4. Pharmazeutisch-kaufmännischer Angestellter
5. Zahnmedizinische Fachangestellte
6. Tiermedizinische Fachangestellte
IV. Gesundheitshandwerk
1. Hörgeräteakustiker
2. Augenoptiker
3. Orthopädiemechaniker und Bandagisten
4. Orthopädieschuhmacher
5. Zahntechniker
V. Andere Dienstleistungsberufe im Gesundheitswesen
Anmerkungen
7. Kapitel Das Leistungsrecht der gesetzlichen Krankenversicherung
Anmerkungen
A. Einleitung
I. Definition Leistungsrecht
II. Leistungsrecht und Leistungserbringungsrecht
Anmerkungen
B. Grundprinzipien des Leistungsrechts
I. Prinzip der umfassenden Versorgung
1. Der allgemein anerkannte Stand medizinischer Erkenntnisse nach § 2 Abs. 1 S. 3 SGB V
2. Die begrenzte Offenheit für besondere Therapiemethoden
3. Berücksichtigung des medizinischen Fortschrittes/Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden
a) Grundsätze für die vertragsärztliche Versorgung
b) Grundsätze für die Krankenhausbehandlung
c) Arzneimittel
d) Sonstige Leistungsbereiche
4. Das Gebot der Wirksamkeit und Qualität
II. Prinzipien der Eingrenzung der Versorgung
1. Das Prinzip der Eigenverantwortlichkeit
2. Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit
3. Das Prinzip der Wirtschaftlichkeit
4. Hierarchie der Leistungsarten
Anmerkungen
C. Leistungsarten
I. Das Sachleistungsprinzip des § 2 Abs. 2 S. 1 SGB V
1. Das Verhältnis Versicherter-Leistungserbringer
2. Leistungsverpflichtung
3. Kein Rückgriff
1. Wahlrecht: Kostenerstattung, § 13 Abs. 2 SGB V
2. Kostenerstattung nach § 13 Abs. 3 SGB V – Systemversagen
3. Kostenerstattung nach § 13 Abs. 3a SGB V – fristgerechte Entscheidung
4. Abgrenzung Selbstzahlerleistungen, IGEL
III. Geldleistungsansprüche
IV. Satzungsleistungen
Anmerkungen
D. System der Anspruchskonkretisierung durch untergesetzliches Recht
I. Anspruchskonkretisierung durch sonstige Rechtsnormen außerhalb des Rechts der gesetzlichen Krankenversicherung
II. Leistungsvoraussetzungen und -ausschlüsse durch Rechtsverordnungen
III. Untergesetzliche Normkonkretisierung
a) Richtlinien- und Regelungskompetenz
b) Verfassungsrechtliche Anforderungen
c) Verfassungsrechtliche Grenzen im Einzelfall
d) Exkurs: Grenze der Leistungsbegrenzungen am Beispiel des „Off-Label-Use“
aa) Anspruch und Eingrenzungen
bb) Problemlage „Off-Label-Use
cc) Compassionate use
2. Normsetzungsverträge
a) Bundesmantelvertrag (BMV)
b) Gesamtverträge
c) Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM)
d) Sonstige Verträge
1. Rahmenempfehlungen
2. Hilfsmittelverzeichnisse nach § 139 SGB V
3. Begutachtungsrichtlinien – MD
Anmerkungen
E. Anspruchsstruktur und Anspruchskonkretisierung im Einzelfall
I. Allgemeines
1. Antragsbedürftige Leistungen
2. Förmliche Anspruchsberechtigung
3. Vorliegen des Versicherungsfalls
III. Norm- und Anspruchskonkretisierung durch Inanspruchnahme
1. Speziell: Der Versicherungsfall der Krankheit
2. Kein Wahlrecht des Patienten
3. Inanspruchnahme
4. Auswirkungen im Verhältnis zur Krankenkasse
a) Anspruchsprüfung durch den MD
b) Nachträgliche Überprüfung im Verhältnis Krankenkasse zu Leistungserbringer am Beispiel der Krankenhausbehandlung
Anmerkungen
F. Tendenz
8. Kapitel Vertragsarztrecht
A. Einführung
I. Rahmenbedingungen
II. Begriffsdefinition
Anmerkungen
B. Historische Entwicklung
I. Das Kassenarztrecht vor der RVO
II. Die Zeit der RVO
III. Das SGB V und die Gesundheitsreformen
Anmerkungen
C. Die Beteiligten im Vertragsarztrecht
I. Die Krankenkassen und deren Verbände
1. Rechtsstatus
2. Organisationsstruktur
3. Amtshaftung
4. Korruptionsbekämpfungsstellen
5. Aufgaben der KV
6. Dienstleistungsgesellschaften
1. Der Gemeinsame Bundesausschuss
a) Rechtsstatus
b) Zusammensetzung
c) Aufgaben
d) Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen
e) Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen
2. Der Bewertungsausschuss (BewA)
a) Rechtsstatus
b) Zusammensetzung
c) Aufgaben
d) Beschlussfassung
e) Institut des Bewertungsausschusses
f) Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI)
3. Zulassungs- und Berufungsausschüsse
4. Die Landesausschüsse
5. Die Schiedsinstitutionen
6. Prüfungs- und Beschwerdeausschuss
IV. Die Leistungserbringer
V. Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG)
VI. Der Staat
Anmerkungen
D. Rechtsgrundlagen des Vertragsarztrechts
I. Rechtssetzungsinstrumentarium
1. Gesetze
2. Rechtsverordnungen
3. Satzungen
4. Verträge mit Normwirkung
5. Richtlinien
6. Normenhierarchie
a) Vertragspartner
b) Inhalt
c) Qualitätssicherungsvereinbarungen nach § 135 Abs. 2 SGB V
d) Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM)
a) Vertragspartner
b) Allgemeiner Inhalt
c) Qualitätsförderungsverträge
a) Honorarverteilungsmaßstäbe (HVM)
b) Vereinbarungen nach § 84 SGB V
c) Prüfvereinbarung
4. Selektivverträge
a) Hausarztzentrierte Versorgung nach § 73b SGB V
b) Besondere Versorgung nach § 140a SGB V
c) Modellvorhaben
d) Bereinigungsverfahren
5. Dreiseitige Verträge
6. Vereinbarungen über zahntechnische Leistungen
7. Vergütungsvereinbarung zum Standard- und Basistarif der PKV
8. Rechtsqualität der Verträge
III. Schiedswesen
1. Die Funktion des Schiedswesens
a) Die Schiedsämter
b) Die sektorenübergreifenden Schiedsgremien
c) Besetzung
d) Rechtsstellung der Mitglieder
a) Verfahrenseinleitung und Fristen
b) Schiedsspruch
c) Gestaltungsspielraum der Schiedsinstitutionen
4. Rechtsschutz der Betroffenen
5. Schiedsstellen
Anmerkungen
E. Grundprinzipien des Vertragsarztrechts
1. Gesetzessystematik
2. Das Rechtsverhältnis zwischen Arzt und Patient
1. Rechtsgrundlage
2. Inhalt
3. Überweisung
1. Rechtsgrundlagen
2. Der Umfang der Verpflichtung
3. Ärztliche Vertreter und Assistenten
4. Die Delegation ärztlicher Leistungen
5. Gerätebezogene Leistungen
6. Laborleistungen
1. Begriffsdefinition
2. Adressaten des Gebotes
V. Qualitätssicherung
Anmerkungen
F. Die vertragsärztliche Versorgung
1. Sektorale Versorgung
2. Sektorenübergreifende Versorgungsformen
1. Allgemeine Beschreibung
2. Die ambulante ärztliche Versorgung
3. Die zahnärztliche Versorgung
4. Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden
5. Ärztlich veranlasste Leistungen Dritter
a) Arzneimittelversorgung
b) Heilmittelversorgung
c) Hilfsmittelversorgung
d) Weitere Leistungen
1. Die Intention des Gesetzgebers
2. Die Grenzen der Versorgungsbereiche
3. Die Folgen der Trennung
1. Die Bedeutung des Psychotherapeutengesetzes
2. Inhalt und Umfang der psychotherapeutischen Versorgung
1. Inhalt und Bedeutung der Sicherstellung
a) Verantwortlichkeit der KV
b) Umfang und Inhalt des besonderen Sicherstellungsauftrages
c) Gewähr einer ordnungsgemäßen Versorgung
d) Folgen unzureichender Sicherstellung
Anmerkungen
G. Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung
I. Einleitung
II. Rechtsgrundlagen
III. Zuständige Behörden
IV. Sonstige Beteiligte am Zulassungsverfahren
1. Patientenvertreter
2. Beteiligungsrechte der Länder
V. Bedarfsplanung, §§ 99 ff. SGB V
1. Grundstrukturen
2. Bedarfsplan, § 99 SGB V
3. Bedarfsplanungs-Richtlinie
4. Über-/Unterversorgung, §§ 100, 101 SGB V
VI. Zulassung Ärzte/Zahnärzte
1. Fachliche Voraussetzungen
2. Persönliche Eignung
3. Versorgungsauftrag
a) Pflicht zur Durchführung von Sprechstunden
b) Überprüfung der Pflicht zur Durchführung von Sprechstunden bzw. der Erfüllung des Versorgungsauftrages
4. Sonderfall der befristeten Zulassung
5. Verfahrensvoraussetzungen
6. Entscheidung durch die Zulassungsgremien
7. Vertragsarztsitz
8. Sonderregelungen für Psychotherapeuten
9. Ruhen der Zulassung
10. Entziehung der Zulassung
11. Kollektiver Zulassungsverzicht
12. Teilzulassung
13. Sonderbedarfszulassung
a) Lokaler Versorgungsbedarf
b) Besonderer Versorgungsbedarf in speziellen fachlichen Teilbereichen
c) Besonderer Versorgungsbedarf bei der Dialyse
d) Belegarzt
14. „Gnadenquartal/Praxisverweser/Witwenquartal“
VII. Ermächtigung
VIII. Ambulante Leistungserbringung durch das Krankenhaus
1. Ambulante Behandlung durch Krankenhäuser bei Unterversorgung
2. Ambulante spezialfachärztliche Versorgung
3. Geriatrische Institutsambulanzen
IX. Sonderformen von zugelassenen Einrichtungen
1. Hochschulambulanzen
2. Psychiatrische Institutsambulanzen
3. Sozialpädiatrische Zentren
4. Ambulante Behandlung in Einrichtungen der Behindertenhilfe
5. Ambulante Behandlung in stationären Pflegeeinrichtungen
6. Medizinische Behandlungszentren
7. Belegarztwesen
8. Eigeneinrichtungen
a) Eigeneinrichtungen der KV
b) Eigeneinrichtungen der Krankenkassen
c) Eigeneinrichtungen der Kommunen
X. Nachbesetzungsverfahren
1. Entscheidung über die Ausschreibung
2. Ausschreibungsverfahren
3. Auswahlverfahren
4. Verfahrensrechtliches
XI. Kooperative Praxisformen
1. Praxisgemeinschaft
2. Berufsausübungsgemeinschaft
a) Örtliche Berufsausübungsgemeinschaft
b) Überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft
c) Teilberufsausübungsgemeinschaft
d) Besonderheiten im zahnärztlichen Bereich
e) Job-Sharing
3. Medizinische Versorgungszentren und Einrichtungen nach § 311 Abs. 2 SGB V
XII. Anstellung von Ärzten/Assistenten/Vertretern
1. Angestellter
a) Angestellter ohne „Zulassungssperre“
b) Angestellter mit „Zulassungssperre“
c) Verzicht zu Gunsten der Anstellung
d) Hochschullehrer/wissenschaftliche Mitarbeiter
e) Besonderheiten im zahnärztlichen Bereich
2. Assistenten
3. Vertreter
XIII. Zweigpraxis/ausgelagerte Praxisräume
1. Zweigpraxis im ärztlichen Bereich
2. Zweigpraxis im zahnärztlichen Bereich
XIV. Fortbildungsverpflichtung
Anmerkungen
H. Das vertragsärztliche Vergütungssystem
I. Die Struktur des Systems
1. Sektorale Budgets
a) Strukturelle Bedingungen
b) Verhältnis der KV zu den Krankenkassen
c) Die Vergütung des Vertragsarztes
1. Inhalt und Bedeutung
a) Begriff
b) Vereinbarung
aa) Zahlungsanspruch
bb) Abgeltungsprinzip
c) Bestandteile der Gesamtvergütung
2. Höhe der Gesamtvergütung
a) Beitragssatzstabilität
b) Morbiditätsrisiko
c) Behandlungsbedarf
d) Abzugsposten
III. Honorarsteuerungsinstrumente
a) Begriff und Bedeutung
b) Funktion
c) Punktwertrelation
d) Orientierungswert
e) Auslegungsregeln
f) Inhalt und Systematik des EBM
aa) Gliederung
bb) Leistungsinhalte
cc) Zeitvorgaben
a) Sachkosten
b) Ausgedeckelte Leistungen
3. Honorarverteilungsmaßstab
a) Grundsätze
b) Rechtsqualität des HVM
c) Gestaltung der Honorarverteilung
IV. Arzt- und arztgruppenbezogene Regelleistungsvolumen (RLV)
1. Historie der Honorarreform
a) Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung
b) Arzt- und praxisbezogene Regelleistungsvolumina
c) Honorarobergrenze
d) Korrektur der Obergrenze im Einzelfall
e) Konvergenzregelung
V. Psychotherapeutische Leistungen
VI. Besonderheiten der vertragszahnärztlichen Vergütung
1. Degression
2. BEMA-Z
3. Zahnersatz
Anmerkungen
I. Das vertragsärztliche Honorar
1. Anspruchsgrundlage
2. Honoraranforderung
a) Honorarabrechnung
b) Garantieerklärung
3. Die Honorarfestsetzung
a) Verfahren
b) Der Honorarbescheid
c) Vorläufigkeit der Honorarfestsetzung
1. Rechtliche Befugnis
2. Die Abrechnungsprüfung nach § 106d SGB V
a) Prüfungsrahmen
b) Prüfmethoden
aa) Prüfung nach Zeitprofilen
bb) Weitere Prüfziele
3. Aufhebung und Änderung von Honorarbescheiden
a) Verfahren
b) Ausschlussfrist
c) Vertrauensschutz
d) Berechnung der Rückforderung
Anmerkungen
J. Die Wirtschaftlichkeitsprüfung
I. Einführung
1. Begriff der Wirtschaftlichkeit
2. Allgemeine rechtliche Grundlagen
3. Abgrenzung zu anderen, das Honorar betreffenden Prüfungen
II. Gegenstand der Wirtschaftlichkeitsprüfung
III. Allgemeine Ausführungen zu den Prüfverfahren
1. Strenge Einzelfallmethode
2. Eingeschränkte Einzelfallprüfung
3. Einzelfallprüfung mit Hochrechnung
4. Statistische Vergleichsprüfung
IV. Statistische Vergleichsprüfung
1. Prüfungsfolge
2. Intellektuelle Prüfung
3. Bildung der Vergleichsgruppe
4. Offensichtliches Missverhältnis
5. Vertikalvergleich
6. Praxisbesonderheiten
7. Kompensatorische Einsparungen
8. Besonderheiten bei der Sparten- und Einzelleistungskürzung
9. Darlegungs- und Beweislast
10. Mitwirkungspflicht
11. Konsequenzen bei festgestellter Unwirtschaftlichkeit
a) Beratung vor Kürzung
b) Höhe der Kürzung/des Regresses
12. Wirtschaftlichkeitsprüfung und Budgetierung
V. Besonderheiten der Wirtschaftlichkeitsprüfung für die ärztlichen Leistungen
VI. Besonderheiten der Wirtschaftlichkeitsprüfung für ärztliche veranlasste Leistungen im Rahmen eines statistischen Vergleiches
1. Einleitung
2. Für Arzneimittel und Heilmittel gemeinsam geltende Regelungen
a) Rahmenvorgaben
b) Datenlage
c) Praxisbesonderheiten
d) Schadenberechnung
e) Beratung vor Regress
3. Arzneimittel
4. Heilmittel
VII. Sonstiger Schaden und sonstige Verstöße gegen die Wirtschaftlichkeit der Behandlungsweise
1. Sonstiger Schaden
2. Sonstige Verstöße gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot
3. Verfahrensrechtlicher Schutz bei umstrittenen Verordnungen
4. Schadensberechnung
VIII. Besonderheiten bei der zahnärztlichen Versorgung
IX. Prüfvereinbarung
X. Verwaltungsverfahren
1. Zusammensetzung der Prüfgremien
2. Verfahren bei der Entscheidungsfindung
3. Beurteilungs- und Ermessensspielräume
4. Mitwirkungspflicht des Arztes am Verwaltungsverfahren
5. Begründung von Bescheiden
6. Ausschlussfrist
7. Beschwerdeverfahren
8. Vergleich
Anmerkungen
K. Disziplinarrecht
I. Rechtsgrundlagen
1. Disziplinarbefugnis
2. Abgrenzung zu anderen Verfahren
a) Strafverfahren
b) Berufsgerichtsbarkeit
c) Entzug der Zulassung
d) Widerruf der Approbation
II. Verfahren
1. Verfahrensbeteiligte
2. Antragsgrundsatz
3. Ausschlussfrist
1. Tatbestand
a) Vertragsärztlicher Pflichtenbezug
b) Vorwerfbarkeit
c) Erforderlichkeit einer Maßnahme
2. Ausgewählte Pflichten
a) Statusbezogene Pflichten
aa) Behandlungspflicht
bb) Präsenzpflicht
cc) Pflicht zur Teilnahme am Bereitschaftsdienst
dd) Statusmissbrauch
aa) Dokumentationspflicht
bb) Pflicht zur persönlichen Leistungserbringung
cc) Pflicht zur peinlich genauen Abrechnung
dd) Verstoß gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot
ee) Verstoß gegen das Zuwendungsverbot
ff) Verstoß gegen das Zuweisungsverbot
1. Disziplinarbescheid
2. Disziplinarmaßnahmen
3. Rechtsschutz
Anmerkungen
L. Verfahrensrecht
I. Vorbemerkung
II. Anwendbares Recht
III. Verwaltungsverfahren
1. Ausgeschlossene Personen/Besorgnis der Befangenheit
2. Zusicherung
3. Aufhebung von Verwaltungsakten
4. Drittwiderspruch/Klagebefugnis Dritter
5. Erstattung der Kosten für das Widerspruchsverfahren
IV. Gerichtliches Verfahren
1. Örtliche Zuständigkeit
2. Besetzung des Gerichts
3. Einbeziehung weiterer Bescheide
4. Feststellungsklage
5. Bescheidungsurteil
6. Einstweiliger Rechtsschutz
a) Wegfall der aufschiebenden Wirkung auf Grund gesetzlicher Anordnung
b) Anordnung der sofortigen Vollziehung
Anmerkungen
9. Kapitel Besondere Versorgung
A. Entwicklung
Anmerkungen
B. Begriff
1. Begriffsbestimmung
2. Einzelne Leistungssektoren
3. Verzahnung der Leistungssektoren
II. Interdisziplinär-fachübergreifende Versorgung
III. Besondere ambulante ärztliche Versorgungsaufträge
IV. Verhältnis der besonderen Versorgung zur Regelversorgung
Anmerkungen
C. Vertragspartner in der besonderen Versorgung
Anmerkungen
D. Vertrag zur besonderen Versorgung
I. Rechtsnatur und Freiwilligkeit
II. Ausschreibung
1. Leistungsspektrum und vertraglicher Versorgungsauftrag
2. Abweichungen vom Zulassungsstatus
3. Gewährleistungsregelungen und Garantieübernahmen
4. Qualitätsvorgaben und -vereinbarungen
5. Grenzen der Abweichungsklausel
6. Diagnosevorgaben
IV. Vergütung
V. Beitritt Dritter zum Integrationsvertrag
Anmerkungen
E. Teilnahme der Versicherten
I. Teilnahmeerklärung
II. Teilnahmebedingungen
III. Datenschutz
Anmerkungen
F. Anschubfinanzierung
Anmerkungen
G. Bereinigung der Gesamtvergütung
Anmerkungen
10. Kapitel Medizinische Versorgungszentren
A. Entstehungsgeschichte, Rechtstatsachen
I. Entstehungsgeschichte
II. Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG)
III. GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG)
IV. Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-OrgWG)
V. GKV-Versorgungsstrukturgesetz (GKV-VStG)
VI. GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG)
VII. Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG)
VIII. Zahlen, Daten, Fakten
IX. Vor- und Nachteile
Anmerkungen
B. Beschreibung und Gründungsvoraussetzungen
I. Vorgaben des Gesetzgebers
II. Merkmal der „Einrichtung“
1. Fachspezifischer Umfang
2. Personeller Umfang
3. Besonderheiten der Zahnmedizin-MVZ
4. Zeitlicher Umfang der Tätigkeit
IV. Ärztliche Leitung
V. Eintragung in das Arztregister
1. Sichtweise des Gesetzgebers
2. Sog. Angestelltenvariante
3. Sog. Vertragsarztvariante
4. Sog. „Mischvariante“
1. Gründerpluralität
2. MVZ in der Trägerschaft von Ärzten
3. MVZ in der Trägerschaft von Krankenhäusern
4. MVZ in der Trägerschaft von Erbringern nichtärztlicher Dialyseleistungen nach § 126 Abs. 3 SGB V
5. MVZ in der Trägerschaft von gemeinnützigen Trägern
6. MVZ in der Trägerschaft von Kommunen
7. MVZ in der Trägerschaft von Praxisnetzen
8. MVZ in der Trägerschaft von MVZ
VIII. Ort der Niederlassung
IX. Überörtliches MVZ, Filialbildung
1. Keine Zulassungsbeschränkungen
2. Neufassung des § 20 Abs. 2 Ärzte-ZV
3. Aufhebung der Altersgrenzen
XI. Selbstschuldnerische Gesellschafterbürgschaft/Sicherheiten
XII. Verlust der Gründereigenschaft
Anmerkungen
C. Rechtsform des MVZ
I. Gesetzliche Vorgaben, Gesetzgebungskompetenz
II. Kriterien für die Rechtsformwahl
III. Gesellschaftszweck, eigenständige Gesellschaft
IV. Unzulässige/unzweckmäßige Rechtsformen
1. Rechtslage bis zum 31.12.2011
2. Rechtslage ab dem 1.1.2012
3. Rechtslage ab dem 23.7.2015
4. Rechtslage ab dem 11.5.2019
5. Umfassender Bestandschutz
6. Natürliche Einzelperson
7. Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)
8. Partnerschaftsgesellschaft
9. Exkurs: Gesetzgebungskompetenz für die Heilkunde-GmbH
10. GmbH
11. Exkurs: GmbH & Still
12. Eingetragene Genossenschaft
13. Öffentlich-rechtliche Rechtsform
1. Rechtsformwechsel
2. Verschmelzung und Abspaltung
3. Aufnahme stiller Gesellschafter
1. Beitritt und Übertragung von Geschäftsanteilen
2. Ausscheiden
3. Veränderungen auf Gesellschafterseite
VIII. Zusammenfassung
Anmerkungen
D. Erwerb und Verlust der MVZ-Zulassung
I. Zuständigkeiten
II. Prüfungsumfang und Ermessensausübung
III. Widerspruchsverfahren
IV. Klageverfahren
1. Entziehung
2. Beendigung der Zulassung
3. Nachbesetzung der MVZ-Zulassung
4. Schicksal der Arztstellen
VI. Sonderkonstellation: Vorgaben zur Qualitätssicherung
VII. Sonderkonstellation: Weiterbildungsermächtigung
Anmerkungen
E. Rechte und Pflichten aus dem Zulassungsstatus
I. Gesetzliche Generalverweisung
1. Präsenzpflicht
2. Residenzpflicht
3. Einhaltung der Fachgebietsgrenzen
4. Verbot der Behandlungsablehnung aus sachwidrigen Gründen
5. Pflicht zur persönlichen Leistungserbringung
6. Plausible und vollständige Honorarabrechnung
7. Wirtschaftlichkeitsgebot
8. Mitwirkungspflichten gegenüber der KV
9. Pflicht zur Fortbildung
10. Vertragsärztliche Rechte
Anmerkungen
F. Der im MVZ angestellte Arzt
I. Status
II. Genehmigung, Widerruf
III. Arbeitszeitgestaltung
IV. Privatärztliche Tätigkeit
V. Vergütung
VI. Verbot der Zuweisung gegen Entgelt
VII. Nachvertragliches Wettbewerbsverbot
VIII. Regelungen zum Vertragsarztsitz
IX. Vertretung
Anmerkungen
G. Haftung – insbesondere aus dem Behandlungsvertrag
I. Behandlungsvertrag
II. Sonstige Haftung
Anmerkungen
H. Abrechnung
I. Vertragsärztlicher Bereich
1. Förmlichkeit der Honorarabrechnung
2. Verweis zur Abrechnungs- und Wirtschaftlichkeitsprüfung
1. Erbringung und Abrechnung von Leistungen
2. Sog. Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL)
Anmerkungen
I. Beschaffung von Zulassungen
I. Grundsatz der Bedarfsplanungsneutralität
II. Umwandlung der Zulassung bei Verzicht
1. Zulassungsverzicht
2. Grundsatz der Personenidentität
3. Unerheblichkeit der Niederlassungsform
4. Teilzeittätigkeit
5. Aufnahme der Tätigkeit
III. Beendigung der Zulassung und Fortführung der Praxis
IV. Nachbesetzung einer Arztstelle im MVZ
1. Rechtslage bis zum 31.12.2006
2. Rechtslage ab dem 1.1.2007
Anmerkungen
J. Kooperation mit Dritten
I. Ermächtigte Krankenhausärzte
II. MVZ-Träger als Gesellschafter einer Berufsausübungsgemeinschaft
III. Das MVZ als Mitglied von Organisationsgemeinschaften
IV. Apotheker
V. Krankenhausapotheke
VI. Das MVZ in der integrierten Versorgung
Anmerkungen
11. Kapitel Der Behandlungsvertrag
A. Rechtsnatur
I. Behandlungsvertrag als neue Sonderform des Dienstvertrages
II. Vertrag zugunsten Dritter
III. Vertragsinhalt
Anmerkungen
B. Zustandekommen des Behandlungsvertrages
I. Übereinstimmende Willenserklärungen
II. Notfallbehandlung
III. GKV-Patient
IV. Hinzuziehung von Ärzten
1. Behandlung durch angestellte Ärzte
2. Überweisung an Weiterbehandler
3. Überweisung an Mitbehandler
a) Ärzte mit Patientenkontakt
b) Ärzte ohne Patientenkontakt
c) Hinzuziehung externer Ärzte im Rahmen wahlärztlicher Behandlung
V. Abschlussfreiheit
VI. Pflichten aus dem Behandlungsvertrag
1. Pflichten des Arztes
2. Rechte und Pflichten des Patienten
Anmerkungen
12. Kapitel Die ärztliche Abrechnung gegenüber Selbstzahlern
A. Das Arzthonorar
I. Gegenstand des Honoraranspruches
1. Gebühren
a) Entschädigungen (Zahnarzt)
b) Entschädigungen (Arzt)
a) Nach der GOZ
b) Nach der GOÄ
c) GOÄ-Auslagen für Zahnärzte/GOZ-Auslagen für Ärzte
1. Geltung von GOÄ und GOZ
2. Abdingbarkeit
3. GOÄ für Zahnärzte
4. GOZ für Ärzte
1. Einzelleistungsvergütung
2. Punktzahl
3. Punktwert
4. Gebührensatz
5. Steigerungssatz
1. Medizinische Indikation
2. Versorgung nach medizinischem Erkenntnisstand
3. Verlangensleistungen
Anmerkungen
B. Berechnungsfähigkeit von Gebühren und Auslagen
I. Gebühren und Gebührenverzeichnis
1. Gebührenabschnitte
2. Leistungslegende
3. Prinzip der Kostenabgeltung
4. Selbstständigkeit von Leistungen (Zielleistungsprinzip)
II. Analogziffern
III. Eigene Leistungen
1. Persönlich erbrachte Leistungen und Basislabor
2. Delegierte Leistungen und fachfremde Angestellte
3. Leistungen des Wahlarztes
4. Hinweispflicht auf Liquidation Dritter
5. Gebührenhöhe
a) Steigerungskriterien
b) Vereinbartes Honorar
c) Gebührenminderung stationärer Leistungen
6. Vorschuss
IV. Berechnung von Kosten
V. IGeL
Anmerkungen
C. Die Arztrechnung
I. Inhalt
II. Schriftform
III. Inkasso/Klageverfahren
Anmerkungen
13. Kapitel Erstattungsfragen gegenüber PKV und Beihilfe
A. Beihilfe
I. Gegenstand der Beihilfe
II. Beihilfefähige Aufwendungen
III. Voraussetzungen der Beihilfefähigkeit
IV. Vorgreiflichkeit
V. Widerspruchsfristen
VI. Verwaltungsgerichtlicher Schwellenwert
VII. Fürsorgepflicht
Anmerkungen
B. PKV
I. Anspruchsvoraussetzungen
1. Auf den Arzt
2. Auf die PKV
3. Klage gegen die PKV oder den Patienten
III. Inanspruchnahme von Leistungserbringern im Gesundheitswesen
1. Anzeigepflicht von Risiken
2. Rücktrittsmöglichkeit
Anmerkungen
14. Kapitel Arzthaftungsrecht
A. Einleitung
Anmerkungen
B. Behandlungsvertrag
I. Vertragsparteien/Passivlegitimation
a) Urlaubsvertretung/Notfalldienst
b) Berufsausübungsgemeinschaft (Gemeinschaftspraxis)
c) Praxisgemeinschaft
d) MVZ
e) Ermächtigte Ärzte
f) Privatambulanz
g) Krankenhausambulanz
h) Besondere Versorgung nach § 140a SGB V
i) Notarzt im Rettungsdienst
j) D-Ärzte/H-Ärzte
2. Stationäre Behandlung
a) Totaler Krankenhausaufnahmevertrag
b) Totaler Krankenhausvertrag mit Arztzusatzvertrag
c) Gespaltener Krankenhausvertrag
II. Vergütungspflicht
1. Facharztstandard
2. Abweichende Vereinbarung
Anmerkungen
C. Behandlungsfehler
I. Einleitung
II. Einzelne Fallgruppen
1. Das Übernahmeverschulden
2. Organisationsverschulden
3. Diagnosefehler
4. Nichterhebung diagnostischer Kontrollbefunde
5. Therapieauswahlverschulden
6. Therapiefehler
7. Therapeutische Sicherungsaufklärung
8. Information über Behandlungsfehler
9. Wirtschaftliche Aufklärung
10. Die Haftung des Arztanfängers
a) Grundlagen
b) Haftung
aa) Der Anspruch der Mutter auf Schmerzensgeld
bb) Der Anspruch auf Ersatz des Unterhaltsschadens
d) Beweislast
12. Fernbehandlung
13. Hinterbliebenengeld
III. Grober Behandlungsfehler
Anmerkungen
D. Kausalität
I. Die haftungsbegründende Kausalität
II. Die haftungsausfüllende Kausalität
Anmerkungen
E. Beweis
I. Grundsatz
II. Grober Behandlungsfehler
III. Befunderhebungsfehler[10]
IV. Vollbeherrschbare Risiken
V. Sicherungsaufklärung
VI. Dokumentationsmängel
Anmerkungen
F. Die ärztliche Aufklärungspflicht
I. Dogmatischer Ausgangspunkt
II. Grundlagen
III. Umfang und Inhalt der Aufklärungspflicht
1. Die Diagnoseaufklärung
2. Die Behandlungsaufklärung
3. Risikoaufklärung
4. Die Aufklärung über Behandlungsalternativen
1. Mündliche Aufklärung
2. Verständliche Aufklärung – Die Aufklärung von fremdsprachigen Patienten
3. Rechtzeitige Aufklärung
1. Der Aufklärungspflichtige
2. Der Aufklärungsadressat
a) Die Aufklärung minderjähriger Patienten
b) Die Aufklärung einwilligungsunfähiger volljähriger Patienten
c) Patientenverfügung[196]
VI. Verzicht und mutmaßliche Einwilligung
1. Schadensursächlichkeit
2. Zurechnungszusammenhang
3. Rechtmäßiges Alternativverhalten und hypothetischer Kausalverlauf
1. Beweislast der Behandlungsseite
2. Beweislast des Patienten
Anmerkungen
G. Die Verjährung
1. Kenntnis
2. Grob fahrlässige Unkenntnis
II. Die Verjährung von Ansprüchen aus einer Aufklärungspflichtverletzung
III. Kenntnis des Sozialversicherungsträgers bei Regressansprüchen
IV. Anspruchsübergang auf Sozialhilfe- und/oder Sozialversicherungsträger
V. Spätfolgen
1. Hemmungsbeginn und -wirkung
2. Beendigung der Hemmung
VII. Stillhalteabkommen (pactum de non petendo)
Anmerkungen
H. Die ärztliche Dokumentationspflicht
1. Therapiesicherung
2. Rechenschaftspflicht
3. Beweissicherung
II. Inhalt und Umfang der Dokumentation
III. Form der Dokumentation
IV. Zeitpunkt der Dokumentation
V. Aufbewahrung und Verlust der Dokumentation
VI. Folgen einer Verletzung der Dokumentationspflicht
Anmerkungen
I. Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht
I. Ausgangspunkt
1. Inhalt der Patientenverfügung
2. Rechtliche Bedeutung der Patientenverfügung
3. Die Voraussetzungen einer Patientenverfügung
4. Widerruf
5. Gestaltungsvorschläge
1. Die Bedeutung der Vorsorgevollmacht
2. Die Voraussetzungen der Vorsorgevollmacht
3. Form
4. Widerruf
5. Aufklärung
6. Die Entscheidung des Bevollmächtigten
IV. Zusammenfassung
Anmerkungen
J. Selbstständiges Beweisverfahren
Anmerkungen
15. Kapitel Haftpflichtversicherungsrecht
A. Einführung
I. Der Grundsatz
II. Berufsrecht
III. Keine Ausnahmen
Anmerkungen
B. Deckungsumfang
1. VVG und AVB
2. Off-Label-Use
a) Rechtliche Grundlagen
b) Deckungsschutz
c) Haftung des pharmazeutischen Unternehmens
d) Erstattungsfähigkeit in der GKV
e) Regelungsmodelle
f) Das Prüfschema
g) Konsequenzen für die Praxis
a) Räumlicher Umfang
b) Sachlicher Umfang
4. Persönlicher Umfang
II. Die Haftpflicht des angestellten und/oder beamteten Krankenhausarztes
III. Der geschützte Versicherungszeitraum
Anmerkungen
C. Obliegenheiten
I. Anzeige- und Mitwirkungspflichten des Arztes
II. Regulierungshoheit des Versicherers
III. Keine „geborene“ Passivlegitimation des Haftpflichtversicherers
Anmerkungen
D. Eingreifen der Pflichtversicherungsregelungen des VVG
I. Versicherungspflicht durch entsprechende Regelungen in den Landesgesetzen
II. Direktanspruch als Ausnahme
III. Fiktiver Deckungsanspruch und Nachhaftung
IV. Haftung als Gesamtschuldner
V. Rangfolge mehrerer Ansprüche
VI. Obliegenheiten des Dritten
Anmerkungen
E. Mehrfachversicherung des identischen Interesses – Innenausgleich
Anmerkungen
F. Erschöpfung der Deckungssumme
Anmerkungen
16. Kapitel Arztstrafrecht
A. Einleitung
Anmerkungen
B. Das materielle Arztstrafrecht
I. Bedeutung des materiellen Arztstrafrechts
a) Sorgfaltspflichtmaßstab
aa) Facharztstandard
bb) Zeitpunkt der Bestimmung
cc) Grundsatz der Methodenfreiheit
dd) Übernahmeverschulden
ee) Berücksichtigung von Sonderwissen
ff) Bedeutung des groben Behandlungsfehlers
b) Strafbarkeit durch Unterlassen
c) Behandlungsfehler
d) Aufklärungsmängel
aa) Einwilligung
bb) Besondere Probleme der ärztlichen Aufklärungspflicht
cc) Durchführung der Aufklärung
dd) Die mutmaßliche Einwilligung
ee) Wegfall der Aufklärungspflicht
ff) Fortfall der Haftung trotz Verletzung der Aufklärungspflicht
gg) Irrtumsprobleme im Rahmen der Einwilligung
e) Organisationsfehler im Rahmen der Delegation
aa) Vertrauensgrundsatz
bb) Vertrauensgrundsatz bei typischen Fallkonstellationen
f) Kausalität zwischen Sorgfaltspflichtverletzung und Erfolg
2. Vorsätzliche, gefährliche und schwere Körperverletzung sowie Körperverletzung mit Todesfolge
3. Unterlassene Hilfeleistung
4. Ärztliche Sterbehilfe
a) Sterbehilfe
b) Weiterbehandlung
c) Neugeborene
5. Organentnahme
6. Schwangerschaftsabbruch
aa) Begriff und Strafbarkeit
bb) Voraussetzungen der §§ 2, 3 KastrG
cc) Andere Behandlungsmethoden gem. § 4 KastrG
aa) Begriff und Strafbarkeit
bb) Rechtfertigende Einwilligung
a) Embryonenschutzgesetz
b) Gendiagnostikgesetz
9. Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse (§ 278 StGB) und Urkundenfälschung (§ 267 StGB)
aa) Schutzbereich und Täterkreis
bb) Schutz fremder Geheimnisse
cc) Begriff des Offenbarens
aa) Handlungsbedarf aus Sicht des Gesetzgebers
bb) Kein Offenbaren nach § 203 Abs. 3 StGB
cc) Sorge-Tragen für den Geheimnisschutz Dritter nach § 203 Abs. 4 StGB
c) Zeitliche Geltung der Verschwiegenheitspflicht
d) Subjektiver Tatbestand
e) Rechtfertigungsgründe
aa) Ausdrückliche und stillschweigende Einwilligung
bb) Mutmaßliche Einwilligung
cc) Rechtfertigender Notstand gem. § 34 StGB
dd) Zivilrechtliche Offenbarungspflichten
ee) Spezielle gesetzliche Offenbarungspflichten
f) Entschuldigungsgründe
g) Qualifikation gem. § 203 Abs. 6 StGB
h) Verwertung fremder Geheimnisse gem. § 204 StGB
i) §§ 203, 204 StGB als Sonderdelikte
j) Antragserfordernis gem. § 205 Abs. 1 StGB
k) Zeugnisverweigerungsrecht gem. § 53 StPO
l) Zeugnisverweigerungsrecht mitwirkender Personen gem. § 53a StPO
m) Hinweise für die Praxis
a) Allgemeines
b) Kritik an gesetzgeberischer Aktivität und Risiken der Strafbarkeit
c) Vorteilsannahme (§ 331 StGB)
d) Bestechlichkeit (§ 332 StGB)
e) Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr (§ 299 Abs. 1 StGB)
f) Bestechlichkeit im Gesundheitswesen (§ 299a StGB)
g) Bestechung im Gesundheitswesen (§ 299b StGB)
h) Besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit und Bestechung (§ 300 StGB)
i) Erweiterung der Zusammenarbeit nach § 81a und § 197a SGB V
j) Verteidigung und Präventivberatung
12. Abrechnungsbetrug
a) Typische Fallkonstellationen des Abrechnungsbetruges
aa) Vertragsärztlicher Bereich
(1) „Luftleistungen“
(2) „Leistunggssplitting“
(3) Auslegung bestimmter Leistungsziffern
(4) Medizinisch nicht indizierte Leistungen
(5) Medizinisch nicht indizierte Medikamente
(6) „Scheingesellschafter“/Strohmanntätigkeit
(7) Nicht persönlich erbrachte Leistungen nach Weisung
(8) Nichtberücksichtigung von Rabatten und Kick-back-Zahlungen
bb) Privatärztlicher Bereich
b) Verhältnis mehrerer Tathandlungen
c) Schadensberechnung
d) Vorsatz im Hinblick auf die Rechtswidrigkeit des Vermögensvorteils
a) Liberalisierung des Werbeverbots
aa) Strafbarkeit nach § 16 Abs. 1 UWG
bb) Strafbarkeit gem. §§ 3 Nr. 3 S. 2 Buchst. a, 14 HWG
c) Strafbarkeit gem. § 148 Nr. 1 GewO
d) Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft gem. § 219a StGB
a) Allgemeines
aa) § 29 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. a BtMG i.V.m. § 13 Abs. 1 BtMG
bb) Vorsatz, Fahrlässigkeit und Versuch
c) Strafbarkeit nach dem StGB
a) Überblick
b) Strafbarkeit nach § 95 AMG
c) Strafbarkeit nach § 96 AMG
d) Bußgeldvorschriften nach § 97 AMG
e) Strafbarkeit nach dem Anti-Doping-Gesetz
f) Strafbarkeit nach dem StGB
Anmerkungen
C. Die Verteidigung in Arztstrafsachen
1. Allgemeine Hinweise
2. Verteidigung im Ermittlungsverfahren
a) Stellungnahme
b) Durchsuchung
c) Einstellungsmöglichkeiten
d) Strafbefehl
3. Verteidigung im Zwischenverfahren
4. Verteidigung in der Hauptverhandlung
II. Die Beratung von Geschädigten und Hinterbliebenen
III. Der Zeugenbeistand
IV. Rechtsfolgen arztstrafrechtlichen Fehlverhaltens
Anmerkungen
17. Kapitel Kooperationen im Gesundheitswesen, Ärztliches Gesellschaftsrecht
A. Kooperationsrahmen
Anmerkungen
B. Berufsausübungsgemeinschaften
I. Begriff
a) Vorbemerkung
b) Rechtstatsachen
c) Motive
d) Gesellschaftsrechtliche Vorgaben
e) Gesellschaftsrechtlich relevante Vorgaben des ärztlichen Berufsrechts
f) Vertragsarztrechtliche Vorgaben
g) Rechtsnatur der Berufsausübungsgemeinschaft
a) Abschluss eines Gesellschaftsvertrages
b) Formerfordernisse
c) Schriftformerfordernis im Vertragsarztrecht
3. Gründungskonstellationen
a) „Eintritt“ in eine Einzelpraxis
b) Zusammenschluss mehrerer Praxen
c) Beitritt zu einer bestehenden Berufsausübungsgemeinschaft
4. Gesellschafter
5. Gesellschaftszweck, Förderpflicht
a) Zweck
b) Förderpflicht
c) Einlagen, Beiträge
aa) Sacheinlagen
(1) Übertragung zu Eigentum
(2) Sacheinlage dem Werte nach
(3) Einbringung zur Gebrauchsüberlassung
bb) Geldeinlagen
cc) Dienstleistungen
6. Sitz
7. Firmierung, Außenauftritt
a) Rechtsnatur
b) Durchführung
c) Ablauf von Gesellschafterversammlungen
d) Stimmrechte
e) Mehrheiten
f) Beschlussmängel
9. Geschäftsführung
10. Vertretung der Gesellschaft
a) Allgemein
b) Nullbeteiligungsgesellschaft
c) Beteiligung Dritter am Ergebnis
12. Buchführung/Überschussrechnung/Bilanzierung
13. Ergebnisverteilung
a) Grundsätze der Haftung
b) Beitrittshaftung
c) Rechtsscheinhaftung
d) Nachhaftung
e) Interne Ausgleichsansprüche
a) Ordentliche Kündigung
b) Außerordentliche Kündigung
c) Vereinbarung von Festlaufzeiten
d) Anschlusskündigung
e) Ausschluss
f) Hinauskündigung ohne wichtigen Grund
g) Ausscheiden aufgrund sonstiger Umstände (Berufsunfähigkeit, Altersgrenze)
h) Tod
i) Insolvenz
j) Ausscheiden aus der Zwei-Personen-Gesellschaft
a) Abfindungsanspruch
b) Abfindungsbilanz
17. Auseinandersetzung/Liquidation
a) Übertragung des Gesellschaftsanteils
b) Aufnahme eines neuen Gesellschafters
a) Vereinbarungen zum Vertragsarztsitz
b) Regelungen zur Aufteilung von Regelleistungsvolumina und zu Anstellungsgenehmigungen
aa) Grundsätzliches
bb) Gegenständliche Grenzen
cc) Zeitliche Grenze
dd) Räumliche Grenze
ee) Ausnahmen
ff) Auswirkungen auf den Abfindungsanspruch
gg) Abwerbungs- und Beschäftigungsverbot
hh) Vertragsstrafe
ii) Keine unzulässige Rechtsausübung
d) Ehevertrag
e) Schlichtung, Mediation
f) Schiedsgerichts-, Schiedsgutachterverfahren
g) Schriftform
h) Bedingungen
i) Salvatorische Klausel
a) Rechtsgrundlage
b) Zulassungsvoraussetzungen
c) Status, Wegfall der Beschränkung
d) Zivilrechtliche Besonderheiten
a) Berufsrechtliche Entwicklung
b) Vertragsarztrecht
c) Gestaltungsmissbrauch
d) Rechtsformen
e) Gesellschaftsrechtliche Aspekte
aa) Gesellschaftszweck
bb) Gesellschafterbeiträge
cc) Vermögensbeteiligung
dd) Ergebnisverteilung
f) Außenauftritt
a) § 18 Abs. 3 MBO-Ä
b) Vertragsarztrechtliche Vorgaben
c) Gesellschaftsvertragliche Aspekte
d) Haftungsfragen
e) Wettbewerbssicherung
4. So genannte „gemischte Berufsausübungsgemeinschaft“
1. Allgemeines
2. Partnerschaftsfähigkeit
a) Schriftformerfordernis
b) Firmierung
c) Vertragsfreiheit
4. Haftung
5. Registerpflichtigkeit
6. Umwandlung
7. Die Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung (PartG mbB)
1. Allgemeines
2. Berufsrechtliche Vorgaben
3. Vertragsarztstatus, Privatabrechnung
1. Definition
2. Berufsrechtliche Vorgaben
3. Vertragsarztrechtlicher Status
Anmerkungen
C. Organisationsgemeinschaften
1. Definition, Abgrenzung
2. Datenlage, Motive
3. Genehmigung/Anzeige
4. Berufsrechtliche Vorgaben
5. Vertragsarztrechtliche Vorgaben
6. Nachbesetzungsverfahren (§ 103 Abs. 3a, 4–6 SGB V)
7. Rechtsform, Vertragsinhalt
8. Haftung
9. Umwandlung
1. Definition
2. Rechtsform
3. Gesellschafterstatus
1. Definition
2. Rechtsgrundlagen
3. Rechtsform
4. Abrechnung
5. Kooperation mit Laborärzten
6. Exkurs: Speziallabor
IV. Leistungserbringergemeinschaft
1. Definition
2. Formalien
3. Vertragsarztrechtliche Besonderheiten
4. Beziehungen der Gesellschafter untereinander
5. Beziehungen zu den Patienten
1. Definition
2. Zulässigkeitsgrenzen
Anmerkungen
18. Kapitel Arbeitsrecht der Klinikärzte
A. Einführung
Anmerkungen
B. Klinikarzt als Erfüllungsgehilfe des Klinikträgers
I. Stellung des Klinikarztes
II. Weisungsrecht, insbesondere des Klinikträgers als Arbeitgeber
III. Persönliche Leistungserbringung
IV. Arbeitszeitgesetz
1. Allgemeine Regelungen
2. Sondervorschriften für Krankenhäuser
3. Notfälle
4. Öffnungsklauseln
V. Tarifrecht
1. Gegenwärtige Tarifsituation[49]
2. Tarifvertragsentwicklung
3. Konsequenzen
a) Geltung der Tarifverträge
b) Tarifpluralität/Tarifkonkurrenz
c) Weitere Probleme
d) Ausblick
VI. Inhaltskontrolle von Dienstverträgen
VII. Vergütung
VIII. Nebentätigkeit
1. Aufhebungsvereinbarung
2. Befristung
3. Altersgrenzenvereinbarung als besonderer Grund für Befristungen
4. Probezeit
5. Kündigung des Arbeitsvertrages
Anmerkungen
C. Besonderheiten der Klinikorganisation bei der Ausgestaltung des ärztlichen Dienstes
I. Ärztlicher Dienst
1. Stellung des Chefarztes
2. Persönliche Leistungserbringung
3. Dienstaufgaben/Nebentätigkeit
a) In Bezug auf die jeweilige Fachabteilung
b) Verantwortung für die Wirtschaftlichkeit
5. Weisungsrecht gegenüber nachgeordneten Klinikärzten
a) Allgemeines
b) Beteiligungsvergütung versus Liquidationsrecht
7. Anpassungs- und Entwicklungsklausel
8. Versetzungsvorbehalt
III. Oberärzte
IV. Assistenzärzte
V. Ärztliche Freelancer
Anmerkungen
D. Schlussbemerkung
Anmerkungen
19. Kapitel Das Liquidationsrecht des Chefarztes
A. Begriff, Inhalt und Rechtsgrundlagen des Liquidationsrechts
1. Begriff
2. Wahlärztliche Leistungen bei stationärer Behandlung
a) Das System der Krankenhausaufnahmeverträge
aa) Der totale Krankenhausaufnahmevertrag mit Arztzusatzvertrag
bb) Der gespaltene Krankenhausaufnahmevertrag
cc) Der totale Krankenhausaufnahmevertrag
b) Persönliche Leistungserbringung des Chefarztes bei wahlärztlichen Leistungen
aa) Der Kernbereich wahlärztlicher Leistungen
(1) Chirurgie und andere operative Fächer
(2) Anästhesie
(3) Konservative Fächer
cc) Ärztliche Leistungen außerhalb des Kernbereichs wahlärztlicher Leistungen
a) Die Tätigkeit des Chefarztes in der Ambulanz
b) Persönliche Leistungserbringung im ambulanten Bereich
4. Liquidationsrecht für gutachterliche Tätigkeit
5. Weitere Bereiche des Liquidationsrechts
6. Liquidationsrecht und Corona
1. Das Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG)
2. Der Arbeitsvertrag des Chefarztes
III. Liquidationsrecht für niedergelassene Ärzte
Anmerkungen
B. Rahmenbedingungen des Liquidationsrechts
I. Die Wahlleistungsvereinbarung
1. Vertragsparteien der Wahlleistungsvereinbarung
2. Form der Wahlleistungsvereinbarung
3. Inhalt der Wahlleistungsvereinbarung
4. Rechtsfolgen bei Unwirksamkeit der Wahlleistungsvereinbarung
II. Vertretervereinbarung
1. Inhalt
2. Auskunftspflichten des Chefarztes und Auskunftsrechte des Krankenhausträgers
1. Inhalt
2. Grenzen des Vorteilsausgleichs
1. Rechtsgrundlagen
2. Inhalt der Mitarbeiterbeteiligung
VI. Anpassung des Liquidationsrechts
VII. Steuerliche Behandlung der Liquidationserlöse
Anmerkungen
20. Kapitel Kauf und Verkauf einer Arztpraxis
Anmerkungen
A. Einleitung
Anmerkungen
B. Vorbereitung und Umsetzung der Abgabe und Übernahme
I. Langfristige Vorbereitung der Praxisabgabe (Veräußerer)
1. Grundlegende Entscheidung zur Praxisabgabe (Veräußerer)
2. Planungsphase (Veräußerer)
1. Dokumentation (Veräußerer)
2. Suche nach einem Nachfolger (Veräußerer)
3. Vorbereitungsphase (Käufer)
III. Umsetzungsphase
Anmerkungen
C. Der Praxiskauf als Unternehmenskauf
1. Arztpraxis
2. Teilpraxis mit hälftiger Zulassung
3. Anteil an einer Kooperationsgemeinschaft
4. Konkretisierung des Kaufgegenstands
5. Vertragsarztsitz als Regelungs- bzw. Kaufgegenstand?
1. Veräußerung einer Einzelpraxis
2. Veräußerung von Anteilen an einer Kooperationsgemeinschaft
3. Exkurs: Haftung für Verbindlichkeiten
III. Veräußerer- und Käuferqualifikationen
IV. Ermittlung des Praxiswertes, Kaufpreisfindung
1. Kriterien für die Ermittlung
a) Hinweise der Bundesärztekammer
b) Modifizierte Ertragswertmethode
aa) Discount-Cash-Flow (DCF)-Methode
bb) Indexierte Basis-Teilwert (IBT)-Methode
d) Verkehrswert i.S.d. § 103 Abs. 4 SGB V
2. Sittenwidrigkeit
Anmerkungen
D. Vorüberlegung zum Praxiskaufvertrag
1. Absichtserklärung, Letter of Intent, Geheimhaltungsvereinbarung
2. Punktation und Vorvertrag
3. Vertrauenstatbestand
II. Übernahme von Vertragsverhältnissen und Gesellschaftsanteilen
1. Mietvertrag über Praxisräume
a) Exkurs: Ort der Niederlassung
b) Übernahme eines bestehenden Mietvertrages
2. Versicherungsverträge
3. Leasing- und Wartungsverträge
4. Belegarztverträge
5. Übergang der Arbeitsverhältnisse
6. Gesellschaftsanteile
7. Besondere Versorgungsformen
1. Übertragung der Patientenkartei
2. Honorarforderungen
Anmerkungen
E. Zulassungs- und Nachbesetzungsverfahren
I. Einleitung des Nachbesetzungsverfahrens
II. Sicherung vor Zulassungsverlust und vor Zulassung eines unerwünschten Bewerbers
1. Ermessenskriterien
2. Positionsverbesserung des Nachfolgers
IV. Widerspruch und Klage vor den Sozialgerichten
V. Zivilrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten zur Zulassungsnachbesetzung
VI. „Übernahme“ bzw. Rückumwandlung einer Arztstelle
Anmerkungen
F. Der Praxiskaufvertrag
1. Schriftform und notarielle Beurkundung
2. Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Vertragsparteien, Einwilligungen
a) Pflichten des Veräußerers
b) Pflichten des Käufers
1. Anspruchsgrundlagen
2. Beschaffenheitsmängel der Arztpraxis, Garantie, Due-Diligence-Prüfung
a) Sachmängel
b) Rechtsmängel
c) Mängel des Gesellschaftsanteils
d) Verjährung
3. Mängelhaftungsausschluss
IV. Rückkehrverbot
V. Fälligkeit und Fristen
1. Schiedsgerichtsverfahren und Mediation
a) Schiedsverfahren
b) Wirtschaftsmediation
2. Salvatorische Klausel
1. Bereicherungsrechtliche Ansprüche
2. Rücktritt vom Kaufvertrag, Störung der Geschäftsgrundlage
Anmerkungen
G. Steuerrechtliche Erwägungen
I. Versteuerung des Gewinns aus Veräußerung
II. Steuerliche Geltendmachung des Kaufpreises
1. Umsatzsteuer
2. Gewerbesteuer
3. Lohnsteuer
Anmerkungen
H. Anwaltsgebühren
Anmerkungen
21. Kapitel Praxisbewertung
A. Einführung
I. Entwicklungen des Umfeldes von Arztpraxen
II. (Praxis-)Wert versus Preis versus Verkehrswert
Anmerkungen
B. Einführung in die Unternehmensbewertung
I. Bewertungsverfahren/-Methoden
II. Bewertungsgrundsätze
1. Maßgeblichkeit des Bewertungszwecks
2. Bewertungseinheit
3. Stichtagsprinzip
4. Äquivalenzprinzipien
III. Bewertung von Unternehmen
1. Bewertung von KMU
2. Bewertung von Freiberuflerpraxen
Anmerkungen
C. Methoden der Arztpraxisbewertung
1. Entwicklung
2. Anwendung
a) Werteverzehr Anlagevermögen/kalkulatorische Abschreibungen
b) Unternehmerlohn
c) Kapitalisierungszeitraum
d) Abzug persönlicher Steuern
e) Kapitalisierungszinssatz
aa) Systematik
bb) Berechnung
g) Umlaufvermögen
aa) Nicht betriebsnotwendiges Vermögen
bb) Steuerliche Vorteile aus der Abschreibung des Goodwill – Tax Amortisation Benefit (TAB)[46]
4. Zusammenfassung – Berechnung des Praxiswerts
5. Diskussion der modifizierte Ertragswertmethode in der Literatur
II. Hinweise der Bundesärztekammer
1. Ideeller Wert
2. Sachwert
3. Würdigung
III. Weitere Bewertungsverfahren
Anmerkungen
D. Rechtsprechung
Anmerkungen
E. Einzelfragen der Bewertung
I. Einzelaspekte zum ideellen Wert der Arztpraxis
II. Methodenunabhängiger Rahmen zum Sachwert[15]
III. Der Markt für Arztpraxen
IV. § 738 BGB und Ertragswert
V. Berücksichtigung von Steuern
1. Vertragsärztliche Zulassung und Ertragswert
2. Liquidationswert in gesellschaftsrechtlichen Abfindungsfällen bei Mitnahme der Zulassung
3. Recht und Betriebswirtschaftslehre
4. Vertragsärztliches Nachbesetzungsverfahren (§ 103 Abs. 4 SGB V)
5. Verkehrswertentschädigung nach § 103 Abs. 3a SGB V
6. Zugewinnausgleich (§ 1376 BGB)
7. Andere Bewertungsanlässe
8. MVZ
9. GmbH
10. Investoren
a) Abgrenzung: endlicher Kapitalisierungszeitraum vs. unendliche Rente
b) Risikozuschlag und Betafaktoren bei der unendlichen Rente
Anmerkungen
F. Zusammenfassung
22. Kapitel Kooperationen zwischen niedergelassenem Arzt und Krankenhaus
A. Einleitung
Anmerkungen
B. Belegärztliche Tätigkeit
I. Voraussetzungen für eine Belegarzttätigkeit
1. Zulassung zur vertragsärztlichen Versorgung/Belegarztanerkennung
2. Sonderzulassung
3. Zulassung zur Krankenhausbehandlung
4. Belegarztvertrag
5. Haftung des Belegarztes
6. Vergütung belegärztlicher Leistungen
II. Kooperativer Belegarztvertrag
III. Der Belegarztvertrag mit Honorarvertrag
Anmerkungen
C. Der Konsiliararzt
I. Der Begriff
II. Haftung des Konsiliararztes
1. Stationäre Operationen durch externe Honorarärzte und/oder Vertragsärzte (ohne Belegarztstatus)
2. Teilanstellungsvertrag vs. Honorararzt
3. Angemessenheit der Vergütung
4. Zielvereinbarung
5. Arbeitszeit
6. Einbeziehung stationärer Entgelte in die Gewinnermittlung einer BAG?
Anmerkungen
D. Sonstige Kooperationen zwischen niedergelassenen (Vertrags-)Ärzten und Krankenhäusern
I. Ambulante Operationen im Krankenhaus durch niedergelassene Vertragsärzte
II. Einbindung niedergelassener Vertragsärzte in die präoperative Diagnostik und postoperative Therapie
1. Die vor- und nachstationäre Behandlung nach GKV-VStG
2. Ambulante spezialfachärztliche Versorgung (ASV) gem. § 116b Abs. 2 SGB V
3. Das Entlassmanagement
Anmerkungen
23. Kapitel Der beamtete Arzt
A. Einleitung
Anmerkungen
B. Rechtsgrundlagen
Anmerkungen
C. Dienstrechtliche Stellung
Anmerkungen
D. Nebentätigkeitsbereich
I. Abgrenzung Dienstaufgaben/Nebentätigkeit
II. Nebentätigkeit
III. Nutzungsentgelt/Mitarbeiterbeteiligung
IV. Pflicht zur Übernahme einer Nebentätigkeit
Anmerkungen
E. Berufsrechtliche Stellung
Anmerkungen
F. Haftung
24. Kapitel Grundzüge des Datenschutzrechts im Gesundheitswesen
A. Einführung
I. Rechtsgrundlagen
a) DS-GVO
b) Weitere europäische Rechtsquellen
2. Nationale Regelungen
a) Gesundheitsdaten
b) Sozialdaten
c) Leistungsdaten
d) Datenverarbeitung
2. Zulässigkeit der Datenverarbeitung – Erlaubnistatbestände
a) Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten
b) Erlaubnistatbestand der Einwilligung in die Datenverarbeitung
c) Weitere Erlaubnistatbestände
3. Rechte der betroffenen Person
4. Auftragsverarbeitung
5. Sanktionen
Anmerkungen
B. Datenschutz in der Arztpraxis
I. Grundlagen
II. Datenschutz und ärztliche Schweigepflicht
1. Informationspflicht des Verantwortlichen nach Art. 13 DS-GVO
2. Recht auf Auskunft aus Art. 15 DS-GVO vs. § 630g BGB
3. Recht auf Löschung aus Art. 17 DS-GVO vs. Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten
IV. Verarbeitungsverzeichnis
V. Auftragsverarbeitung – Verarbeitung der Daten durch Dritte
Anmerkungen
C. Datenschutz im Krankenhaus
I. Anwendbares Recht
II. Datenverarbeitung im Krankenhaus
1. Informationspflicht des Verantwortlichen nach Art. 13 DS-GVO
2. Recht auf Auskunft aus Art. 15 DS-GVO
IV. Rechenschaftspflicht – Krankenhausinformationssysteme
Anmerkungen
D. Datenschutz im Bereich der Forschung
I. Verarbeitung zu Forschungszwecken aufgrund Einwilligung der Betroffenen nach Art. 9 Abs. 2 lit. a DS-GVO
II. Verarbeitung zu Forschungszwecken nach Art. 9 Abs. 2 lit. j DS-GVO
1. Klinische Prüfungen nach AMG/VO (EU) Nr. 536/2014 und MPVO
2. Forschungsvorhaben und Sozialdatenschutz
Anmerkungen
E. Ausblick
Anmerkungen
25. Kapitel Der Arzt im Strafvollzug
A. Gesundheitsfürsorge
Anmerkungen
B. Aufgabenbereiche des Anstaltsarztes
Anmerkungen
C. Rechte und Pflichten zur Weitergabe von Daten
Anmerkungen
D. Externe Ärzte und Therapeuten
Anmerkungen
26. Kapitel Der Arzt als Sachverständiger
A. Der ärztliche Sachverständige als „Richter in Weiß“?!
Anmerkungen
B. Aufgabe und Stellung des ärztlichen Sachverständigen im gerichtlichen Verfahren
I. Aufgabe des Sachverständigen
II. Pflichten und Rechte des ärztlichen Sachverständigen im Verfahren
1. Pflicht zur Gutachtenerstattung
2. Pflicht zur persönlichen Erstattung des Gutachtens
3. Pflicht zur rechtzeitigen Gutachtenerstattung
4. Pflicht zur Unparteilichkeit
5. Vergütung des Sachverständigen
Anmerkungen
C. Auswahl und Ablehnung des ärztlichen Sachverständigen
I. Kriterien der Auswahl des ärztlichen Sachverständigen
II. Ablehnung wegen der Besorgnis der Befangenheit
Anmerkungen
D. Inhalt des Beweisbeschlusses
I. Medizinische Grundfragen der Beurteilung der Haftungsvoraussetzungen im Arzthaftpflichtprozess
1. Prüfung des Behandlungsfehlers
2. Prüfung von Körper- und Gesundheitsschäden
3. Prüfung des Kausalzusammenhangs
II. Medizinische Vorfragen der Beurteilung von Rechtsfragen – Beweislast und Aufklärung
1. Beurteilung des groben Behandlungsfehlers
2. Beurteilung von Aufklärungsfehlern
Anmerkungen
E. Überprüfung des Gutachtens im Verfahren
I. Inhaltliche Überprüfung des Gutachtens
II. Ergänzungsgutachten, mündliche Erörterung und Einholung eines weiteren Gutachtens
Anmerkungen
F. Haftung des ärztlichen Sachverständigen im Verfahren
Anmerkungen
G. Zusammenfassung
Anmerkungen
27. Kapitel Transfusionswesen
A. Einleitung
B. Gesetzliche Grundlagen
Anmerkungen
C. Der Zweck des Gesetzes
Anmerkungen
D. Begriffsbestimmungen
E. Gewinnung von Blutbestandteilen
Anmerkungen
F. Die Anwendung von Blutprodukten
G. Rückverfolgung
Anmerkungen
H. Meldewesen
I. Empfänger der Daten
II. Adressat der Meldepflicht
III. Inhalt der Meldung
IV. Anonymisierung
V. Hämophilieregister
I. Sachverständige
J. Mitteilungspflichten
K. Haftung für Blut und Blutbestandteile
L. Straf- und Bußgeldvorschriften
28. Kapitel Transplantationswesen
A. Einleitung
Anmerkungen
B. Zweck des Gesetzes
Anmerkungen
C. Entnahme beim toten Spender
Anmerkungen
D. Entnahme beim lebenden Spender
Anmerkungen
E. Entnahme und Vermittlung bestimmter Organe, Transplantationszentren, Zusammenarbeit bei der Entnahme von Organen und Geweben
Anmerkungen
F. Richtlinien zum Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaften
Anmerkungen
G. Verbot des Organ- und Gewebehandels, straf- und bußgeldrechtliche Vorschriften
29. Kapitel Reproduktionsmedizin
A. Künstliche Befruchtung
1. Rechtliche Grundlagen
2. Die Richtlinien
1. Zulässigkeit
2. Sicherheitsaspekte heterologer Verfahren
3. Anonymitätszusage
4. Dokumentation
1. Behandlung lesbischer Paare
2. Künstliche Befruchtung einer alleinstehenden Frau
IV. Kryokonservierung
V. Familien- und unterhaltsrechtliche Konsequenzen
Anmerkungen
B. Präimplantationsdiagnostik (PID)
I. Die Problematik
1. Verfassungsrechtliche Ebene
2. Embryonenschutzgesetz
3. Die Neuregelung in § 3a ESchG
II. Zusammenfassung und Ausblick
III. Rechtliche Regelungsebenen im Bereich der assistierten Reproduktion
Anmerkungen
30. Kapitel Biomedizinische Forschung
A. Einführung
Anmerkungen
B. Erscheinungsformen biomedizinischer Forschung
Anmerkungen
C. Rechtsgrundlagen
1. Zivilrecht
2. Strafrecht
1. Die klinische Prüfung mit Arzneimitteln
2. Die klinische Prüfung von Medizinprodukten
3. Leistungsbewertungen bei In-vitro-Diagnostika
Anmerkungen
D. Ethikkommissionen
I. Definition nach Art. 2 Nr. 11 VO (EU) 536/2014
II. Definition nach Art. 2 VO (EU) 2017/745 Nr. 56 und VO (EU) 2017/746 Nr. 59
1. Klinische Prüfungen nach dem Arzneimittelgesetz-
2. Klinische Prüfungen nach dem Medizinproduktegesetz
IV. Das Verfahren vor der Verwaltungsbehörde und der Ethikkommission nach der VO 536/2014 bei Arzneimitteln
1. Monozentrische Prüfung
2. Multizentrische Prüfung
3. Beteiligung der Ethikkommission
4. Besonderheiten bei der Leistungsbewertung nach VO (EU) 2017/746
1. Tätigkeit nach dem Transfusionsgesetz und dem Transplantationsgesetz
2. Tätigkeit nach dem Strahlenschutzgesetz (StrlSchG)
3. Landesrechtliche Vorschriften
1. Zusammensetzung
2. Verfahrensgang
Anmerkungen
E. Forschung über Biobanken und Register
Anmerkungen
F. Schweigepflicht und Datenschutz
I. Schweigepflicht
II. Datenschutz
1. Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung und der Datennutzung
a) Die Einwilligung
b) Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten
c) Garantien und Ausnahmen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu Forschungszwecken
2. Bereichsspezifische Regelungen für die biomedizinische Forschung
a) Arzneimittelgesetz und GCP-VO
b) Medizinproduktegesetz und die Verordnungen (EU) 2017/745 und 2017/746
3. Anwendbares nationales Recht für sonstige Bereiche biomedizinischer Forschung
a) Bundesrecht – BDSG (2018)
b) Landesrechtliche Datenschutzvorschriften
III. Ärztliche Schweigepflicht
Anmerkungen
G. Einbeziehung von Probanden und Patienten in Forschungsprojekte
Anmerkungen
H. Haftung
Anmerkungen
I. Interessenskonflikte
J. Fälschung von Forschungsergebnissen
Anmerkungen
31. Kapitel Krankenhausplanung, Krankenhausfinanzierung, Versorgungsverträge
A. Einführung
I. Gesetzgebungskompetenz
II. Krankenhausbegriff
1. § 2 Nr. 1 KHG
2. § 107 Abs. 1 SGB V
3. § 30 GewO
III. Abgrenzung zwischen Krankenhaus und Rehabilitationseinrichtung
1. Allgemein- und Fachkrankenhäuser
2. Krankenhäuser der Grund-, Regel- und Maximalversorgung
V. Belegkrankenhäuser und Anstaltskrankenhäuser
VI. Tages- und Nachtkliniken, Praxiskliniken
VII. Universitätskliniken
VIII. Trägerschaft der Krankenhäuser
Anmerkungen
B. Krankenhausplanung
1. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Krankenversorgung zu sozial tragbaren Pflegesätzen
2. Krankenhausplanung als Grundlage für eine staatliche Investitionslenkung
II. Anwendungsbereich des KHG
III. Aufnahme in den Krankenhausplan und ihre Folgen
1. Anspruch auf Förderung
2. Berechtigung und Verpflichtung zur Behandlung von gesetzlich Krankenversicherten
IV. Inhalt des Krankenhausplans
1. Krankenhauszielplanung
2. Bedarfsanalyse
3. Krankenhausanalyse
4. Versorgungsentscheidung
1. Die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung
a) Die Bedarfsermittlung
b) Die Bedarfsermittlung nach Einführung des DRG-Systems
c) Bedarfsgerechtigkeit
d) Überprüfung der Bedarfsermittlung
e) Fehler bei der Bedarfsermittlung
2. Leistungsfähigkeit
3. Beitrag zu sozial tragbaren Pflegesätzen
VI. Planaufstellung – Mitwirkung der Beteiligten
VII. Feststellung der Aufnahme in den Krankenhausplan durch Bescheid
VIII. Rechtsnatur des Krankenhausplans und Verhältnis zum Feststellungsbescheid
IX. Die Umsetzung der Versorgungsentscheidung
X. Erlass des Feststellungsbescheides
XI. Auswahlentscheidung
1. Beachtung der Vielfalt der Krankenhausträger
2. Gewährleistung der wirtschaftlichen Sicherung freigemeinnütziger und privater Krankenhäuser
3. Kostengünstigkeit
4. Gleichbehandlungsgrundsatz, Art. 3 Abs. 1 GG
5. Berücksichtigung öffentlicher Interessen
6. Rangverhältnis der Auswahlkriterien?
XII. Rechtsschutz
a) Rechtsgrundlage
b) Kündigung des Versorgungsvertrages
a) Anfechtungswiderspruch und Anfechtungsklage
b) Verpflichtungswiderspruch und Verpflichtungsklage
c) Fortsetzungsfeststellungsklage
3. Kein Rechtsschutz der Kostenträger
4. Rechtsschutz konkurrierender Krankenhäuser
a) Die Entscheidung des BVerfG vom 14.1.2004 zur offensiven (aktiven) Konkurrentenklage
b) Negative Konkurrentenklage
a) Das konkurrierende Krankenhaus
b) Das die Krankenhausplanaufnahme begehrende Krankenhaus
c) Das bereits in den Krankenhausplan aufgenommene Krankenhaus
6. Streitwert
Anmerkungen
C. Krankenhausfinanzierung
1. Freie Krankenhausfinanzierung
2. Monistische Finanzierung
3. Duale Finanzierung
II. Adressat des KHG
III. Investitionsförderung
1. Begriff
a) Einzelförderung
b) Pauschalförderung
c) Strategische Erwägungen
1. Historie
a) Begriffe
b) Zielsetzung
3. Vergütung auf Basis des KHEntgG
a) Entgelte für allgemeine Krankenhausleistungen
b) Umfang der allgemeinen Krankenhausleistungen
c) Honorararzt
d) Entgeltvereinbarung („Pflegesatzvereinbarung“)
aa) Vertragsparteien
bb) Vereinbarungszeitraum/Laufzeit
cc) Formvorschriften
dd) Inhalte
ee) Entgeltverhandlungen („Pflegesatzverhandlungen“)
ff) Rechtscharakter
e) Schiedsstellenverfahren
aa) Bildung der Schiedsstelle
bb) Verfahren vor der Schiedsstelle
cc) Rechtscharakter
dd) Inhalt
f) Genehmigungsverfahren
aa) Verfahren
bb) Prüfungsumfang
cc) Rechtscharakter
aa) Rechtsweg
bb) Rechtsschutzbedürfnis
cc) Vorverfahren
dd) Klagebefugnis
ee) Aufschiebende Wirkung
ff) Taktische Erwägungen
4. Vergütung auf Basis der BPflV
5. Mindestmengen
V. Krankenhausbehandlungsverträge
a) Selbstzahler
b) Kassenpatient
2. Der gespaltene Krankenhausaufnahmevertrag
3. Wahlleistungen
a) Form der Vereinbarung
b) Unterrichtung des Patienten
c) Zeitpunkt der Vereinbarung
d) Angemessenheit der Vergütung
e) Schuldner der Wahlleistungen
f) Wahlärztliche Leistungen
g) Wahlleistung Unterbringung
h) Sonstige „Wahlleistungen“
4. Unterbringungsverfahren
VI. Abrechnung stationärer Krankenhausleistungen – Fehlbelegung
1. Rechtsverhältnis zwischen Patient, Krankenhaus und Krankenkasse
a) Rechtsgrundlage des Vergütungsanspruchs der Krankenhäuser
aa) Prozesszinsen
bb) Vorgerichtliche Anwaltskosten als Verzugsschaden?
cc) Verzugszinsen bei Rückforderungen von Krankenkassen
c) Stationäre Behandlungsbedürftigkeit und Überprüfung durch die Krankenkassen
d) Einschaltung des MDK durch die Krankenkassen
e) Auskunfts- und Mitwirkungspflichten der Krankenhäuser im Abrechnungsverfahren
f) Abgrenzung ambulante, stationäre und teilstationäre Behandlung
g) Abgrenzung zwischen Krankenhausbehandlung und Rehabilitation
h) Kostenübernahmeerklärungen der Krankenkassen
i) Zahlungsfristen
j) Nachforderung der Krankenhäuser gegenüber Krankenkassen nach Endabrechnung
k) Verjährung
l) Klageverfahren
3. Vereinbarung über das Nähere zum Prüfverfahren
4. MDK-Reformgesetz
a) Umstrukturierung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) in MD
b) Änderung der Prüfverfahren
c) Sanktionsregelung
d) Strukturprüfungen
e) Aufrechnungsverbot
f) Ambulante Operationen
g) Prüfverfahrensvereinbarung
h) Einzelfallbezogene Erörterung
i) Schlichtungsausschuss
Anmerkungen
32. Kapitel Arzneimittelrecht
A. Einleitung
B. Rechtsgrundlagen
I. Europarechtliche Rechtsgrundlagen
II. Nationale Rechtsgrundlagen
Anmerkungen
C. Zweck des Gesetzes
Anmerkungen
D. Geltungsbereich, Arzneimittelbegriff
I. Die Bedeutung der Norm
II. Tierarzneimittel
III. Arzneimittel, Begriff und Abgrenzung
IV. Fiktive Arzneimittel
Anmerkungen
E. Ausnahmen
I. Ausnahmen vom Geltungsbereich des AMG
1. Lebensmittel
2. Tabakerzeugnisse
3. Kosmetische Mittel
4. Reinigungsmittel
5. Biozid-Produkte
6. Futtermittel
7. Medizinprodukte
8. Abgrenzung zur Transplantation
9. Abgrenzung zur Bluttransfusion
10. Zweifelsfallregelung
11. Die Arzneimittelvermutung
12. Arzneimittel für neuartige Therapien
Anmerkungen
F. Herstellungserlaubnis
I. Berufs- oder gewerbsmäßige Abgabe an andere
II. Blut- und Blutprodukte
III. Organ- und Gewebetransplantate
1. Apotheken
2. Krankenhaus- und Bundeswehrapotheken
3. Tierärzte
4. Großhändler für Umfüllen, Abpacken und Kennzeichnen
5. Einzelhändler und § 50 AMG
V. Gewebe
VI. Zuständigkeit
Anmerkungen
G. Zulassung von Arzneimitteln
I. Fertigarzneimittel
II. Tierarzneimittel
III. Inhalt der Zulassung
1. Grundsatz
2. Ablauf des Verfahrens
3. Tierarzneimittel im zentralen Zulassungsverfahren
V. Geltungsbereich einer zentralen Zulassung
1. Antragstellung
2. Beurteilung der eingereichten Unterlagen
3. Beteiligung von Kommissionen
4. Mängelrügen
5. Verfahrensbesonderheiten
6. Rechtsanspruch
7. Auflagen gem. § 28 AMG
8. Rechtsschutz
Anmerkungen
H. Klinische Prüfung
I. Definition und Voraussetzungen
1. Anforderungen an die klinische Prüfung
2. Minderjährige und Nichteinwilligungsfähige als Teilnehmer an der klinischen Prüfung
II. Ethikkommissionen
1. Zusammensetzung
2. Verfahrensgang
a) Monozentrische Prüfung
b) Multizentrische Prüfung
3. Bewertung der klinischen Prüfung durch die Ethikkommission, Genehmigungsverfahren bei der Bundesoberbehörde
4. Nachträgliche Änderungen
5. Datenschutz
Anmerkungen
I. Registrierung von Arzneimitteln
J. Abgabe von Arzneimitteln
I. Apothekenpflicht
II. Inhalt und Umfang der Apothekenpflicht
III. Ausnahmen von der Apothekenpflicht
IV. Versandhandelsverbot
V. Verbot des Direktbezuges
VI. Inhalt und Umfang der Ausnahmen von der Apothekenpflicht
VII. Weitere Ausnahmen von der Apothekenpflicht nach § 45 AMG
VIII. Die Ausweitung der Apothekenpflicht
IX. Die Beschränkung der Ausweitung
X. Der Vertriebsweg
XI. Bezug in Eigenbedarf
XII. Die Verschreibungspflicht
XIII. Die Verschreibung (Rezept)
XIV. Der Freiverkauf
XV. Die Sachkenntnis
XVI. Die Abgabe im Reisegewerbe
XVII. Großhandel mit Arzneimitteln (§ 52a AMG)
Anmerkungen
K. Arzneimittelüberwachung
I. Gegenstand der Überwachung
II. Zweck der Überwachung
III. Befugnis der Behörden
1. Betretungs- und Besichtigungsrecht
2. Einsichtsrecht
3. Auskunftspflicht
IV. Aussageverweigerungsrecht
V. Erlass von vorläufigen Anordnungen
Anmerkungen
L. Sicherung und Kontrolle der Qualität
I. Inhalt der Betriebsverordnungen
II. Geltungsbereich der Betriebsverordnungen
III. Beobachtung, Sammlung und Auswertung von Arzneimittelrisiken
1. Der Stufenplan
2. Person des Stufenplanbeauftragten
3. Führung von Unterlagen
4. Anzeigepflicht
5. Regelmäßiger Bericht
Anmerkungen
M. Ein- und Ausfuhr von Arzneimitteln
I. Die Einfuhrerlaubnis
II. Das Zertifikatverfahren
III. Haftungsrechtliche Gesichtspunkte
IV. Das Verbringungsverbot
V. Die Apothekeneinfuhr
VI. Die Ausfuhr von Arzneimitteln
Anmerkungen
N. Tierarzneimittel
I. Herstellung
II. Zulassung
III. Tierarzneimittel im zentralen Zulassungsverfahren
IV. Klinische Prüfung
V. Abgabe von Tierarzneimitteln
Anmerkungen
O. Arzneimittelhaftung
I. Gefährdungshaftung
1. Haftung für Entwicklungs- und Herstellungsfehler
2. Instruktionsfehler
II. Verschuldenshaftung
1. Haftung des pharmazeutischen Unternehmers
2. Haftung des Arztes
a) Aufgabenspektrum
b) Behandlungsfehler
aa) Vertrag
bb) Geschäftsführung ohne Auftrag
cc) Unerlaubte Handlung
c) Kausalität
d) Beweislast
Anmerkungen
P. Arzneimittelstrafrechts- und Bußgeldvorschriften
I. Arzneimittelstrafrechtsvorschriften
1. Das Verhältnis von AMG zum StGB
2. Die Straftaten nach §§ 95, 96 AMG
3. Der Adressat der Straftaten nach §§ 95, 96 AMG
4. Verjährung
II. Arzneimittelbußgeldvorschriften
1. Das Verhältnis zum Ordnungswidrigkeitengesetz
2. Die Ordnungswidrigkeiten nach § 97 AMG
3. Der Adressat der Ordnungswidrigkeit
4. Zuständigkeiten
5. Sanktionen und Verfolgungsverjährung
Anmerkungen
33. Kapitel Grundzüge des Medizinprodukterechts
A. Vom MPG zur MDR/MP-VO[1]
Anmerkungen
B. Begriffsbestimmungen (§ 2 MP-VO vormals § 3 MPG)
I. Die Bedeutung der Norm
II. Die Zweckbestimmung gemäß Art. 2 Nr. 12 MP-VO vormals § 3 Nr. 1a–d i.V.m. Nr. 10 MPG
III. Sonderproblematik: Tissue Engineering
IV. In-vitro-Diagnostika (§ 3 Nr. 4–7 MPG)
V. Sonderanfertigung (Art. 2 Nr. 3 MP-VO vormals § 3 Nr. 8 MPG)
VI. Zubehör (Art. 2 Nr. 2 MP-VO vormals § 3 Nr. 9 MPG)
VII. Inverkehrbringen (Art. 2 Nr. 28 MP-VO vormals § 3 Nr. 11 MPG)
VIII. Das „als neu aufbereitete“ Medizinprodukt
IX. Hersteller (Art. 2 Nr. 30 MP-V vormals § 3 Nr. 15 MPG)
X. Benannte Stellen (Art. 2 Nr. 42 MP-VO vormals § 3 Nr. 20 MPG)
XI. Eigenherstellung (Art. 5 Abs. 5 MP-VO vormals § 3 Nr. 21 MPG)
XII. In-vitro-Diagnostika aus Eigenherstellung (§ 3 Nr. 22 MPG i.d.F. der 3. MPG-Novelle, künftig Art. 5 IVDVO)
Anmerkungen
C. Gefahrenprävention
Anmerkungen
D. Konformitätsbewertung
Anmerkungen
E. Klinische Bewertung und klinische Prüfung, Leistungsbewertung
I. Klinische Prüfung
II. Leistungsbewertungsprüfung (§ 24 MPG, künftig Kapitel IV Art. 56–77 IvD-VO)
III. Ethik-Kommissionen
Anmerkungen
F. Haftung
I. Problemaufriss
II. Grundtypen der Produkthaftung
III. Produzentenhaftung
IV. Haftungsvoraussetzungen
V. Markt- und Produktbeobachtungspflichten
Anmerkungen
G. Werbung für und mit Medizinprodukten (Medizinprodukte und HWG)
Anmerkungen
H. Das Medizinprodukt in der gesetzlichen Krankenversicherung
I. Praktische Relevanz
II. Medizinprodukte als Hilfsmittel im SGB V
III. Das Hilfsmittelverzeichnis gem. § 139 SGB V
IV. Kostenerstattung für Medizinprodukte in der GKV
Anmerkungen
34. Kapitel Apothekenrecht
A. Einführung
Anmerkungen
B. Die öffentliche Apotheke
I. Betriebserlaubnis
1. Antragserfordernis
2. Erlöschen der Betriebserlaubnis
3. Rücknahme/Widerruf der Betriebserlaubnis
a) Nationale Gesetzgebung
b) Europarechtskonformität
2. Verbot partiarischer Rechtsverhältnisse
3. Apothekenpacht
4. Arzneimittel- und Ärztebevorzugungsverbot
5. Versandhandel
a) Anforderungen an Apotheker mit deutscher Betriebserlaubnis
b) Anforderungen an Apotheker aus anderen Mitgliedstaaten
6. Heimversorgung
a) Abschlussfreiheit des Heims
b) Zwingende Mindestregelungen des Versorgungsvertrags
c) Beteiligung mehrerer Apotheken an der Heimversorgung
d) Überprüfung der bewohnerbezogenen Arzneimittelverwahrung
e) Regelung der Eigenversorgung von Heimbewohnern
f) Vergütung von zusätzlichen Dienstleistungen
Anmerkungen
C. Der Apothekenbetrieb
I. Der Apothekenleiter und sein Personal
1. Der Apothekenleiter
2. Apothekenpersonal
3. Qualitätsmanagement
4. Apothekenterminals
II. Die Apothekenbetriebsräume
1. Räumliche Mindestausstattung
a) Die Offizin
b) Die Rezeptur
c) Das Laboratorium
2. Räumliche Anordnung
III. Die Herstellung von Arzneimitteln
1. Abgrenzung
2. Allgemeine Qualitätsstandards
3. Rezepturarzneimittel
4. Defektur
5. Auftragsherstellung
6. Besondere Kontroll-, Prüf- und Kennzeichnungspflichten
1. Arzneimittelabgabe
2. Rezeptsammelstellen
V. Apothekenübliche Waren und Dienstleistungen
a) Randsortiment und Präsentation
b) Einzelfälle aus der Rechtsprechung
2. Apothekenübliche Dienstleistungen
1. Allgemeine Grundlagen
2. Kundenbindungssysteme
Anmerkungen
D. Besondere Apothekentypen
I. Filialapotheken
1. Betriebserlaubnis
2. Grenzüberschreitende Filialisierung
a) Ausstattung
b) Der Filialapotheker
c) Verpachtung
d) Beendigung der Betriebserlaubnis
II. Zweigapotheke
1. Besonderheiten
2. Krankenhausversorgende Apotheke
IV. Notapotheke
Anmerkungen
35. Kapitel Heilmittelwerberecht
A. Einleitung
B. Gesetz über die Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens
I. Sinn und Zweck des Gesetzes
II. Regelungsansatz und Verhältnis zu Wettbewerbsrecht und allgemeinem Deliktsrecht
III. Erfasster Personenkreis und Überwachungsbehörden
IV. Entwicklung und Anwendungsbereich des Gesetzes
1. Werbebegriff
2. Einschränkungen des Anwendungsbereichs
3. Abgrenzung zu Unternehmenswerbung und redaktioneller Berichterstattung
a) Arzneimittel
b) Abgrenzung Arzneimittel – Lebensmittel
1. Allgemeines Irreführungsverbot nach § 3 S. 1 HWG
a) § 3 S. 2 Nr. 1 HWG
b) Exkurs zu § 3a HWG
c) Prüfung und Widerlegung eines Verstoßes nach § 3 S. 2 Nr. 1 HWG
d) § 3 S. 2 Nr. 2 HWG
e) § 3 S. 2 Nr. 3 Buchst. a und b HWG
3. Pflichtangaben nach § 4 HWG
4. Exkurs zur Arzneimittelwerbung im Internet
5. Verwendung von Gutachten und Zitaten gemäß § 6 HWG
6. Eingeschränktes Zuwendungsverbot nach § 7 HWG
7. Vergleichende Werbung
8. (Un-)zulässige Werbung für Fernbehandlung
VI. Unterscheidung von Fachkreis- und Publikumswerbung
1. Absoluter Vorbehalt der Fachkreiswerbung im Rahmen von § 10 HWG
2. Besondere Verbote für die Laienwerbung gemäß § 11 HWG
3. Verhältnis von HWG und Europarecht
4. Besonderheiten im Rahmen von § 11 HWG bei der Werbung für Medizinprodukte
5. Verbot krankheitsbezogener Werbung nach § 12 HWG
Anmerkungen
36. Kapitel Pflegepflichtversicherung
A. Vorbemerkungen
Anmerkungen
B. Die Organisation der Pflegeversicherung
C. Versicherungspflicht und Kontrahierungszwang
I. Versicherungspflicht
II. Kontrahierungszwang
Anmerkungen
D. Beginn und Ende des Versicherungsschutzes
I. Beginn des Versicherungsschutzes
1. Beendigung des sozialen Versicherungsverhältnisses
2. Kündigung des privaten Versicherungsverhältnisses
Anmerkungen
E. Die Leistungen der Pflegeversicherung
I. Leistungen bei häuslicher Pflege
1. Häusliche Pflegehilfe
2. Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen
3. Kombination von Geldleistung und Sachleistung (Kombinationsleistung)
4. Pflegebedürftige in ambulant betreuten Wohngruppen
5. Verhinderungspflege
6. Pflegehilfsmittel und technische Hilfen
7. Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen
8. Teilstationäre Pflege
9. Kurzzeitpflege
10. Persönliches Budget
II. Vollstationäre Pflege
III. Entlastung und Förderung
IV. Leistungen für Pflegepersonen nach § 19 SGB XI
Anmerkungen
F. Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit
I. Begriff der Pflegebedürftigkeit
II. Dauer der Pflegebedürftigkeit
1. Bereiche i.S.d. § 14 Abs. 2 SGB XI
2. Modularisierung und Gewichtung nach § 15 SGB XI i.V.m. § 14 Abs. 2 SGB XI
3. Übergangsregelung § 140 SGB XI
IV. Tätigkeit auf Antrag
V. Begutachtung durch den ärztlichen Sachverständigen
VI. Entscheidung des Versicherers und der Pflegekassen
VII. Klageverfahren
Anmerkungen
37. Kapitel Ambulante Pflegedienste
A. Vorbemerkung
Anmerkungen
B. Sicherstellung der Pflege durch ambulante Pflegedienste
I. Vertragsstrukturen
1. Verträge nach SGB XI
2. Verträge nach SGB V
3. Verträge nach SGB XII und SGB IX
4. Vergütung ohne Versorgungsvertrag und bei Vertragsbruch
5. Verjährung
6. Verträge mit den Versicherten
II. Organisation der Pflegedienste
III. Die neue Chimäre: insbesondere anbieterorganisierte Pflege-Wohngemeinschaften
1. Grundzüge
a) Vergütung ambulanter Sachleistung nach § 37 SGB V und § 36 SGB XI
b) Wohngruppenzuschlag nach § 38a SGB XI
aa) Zuschlag auch für anbieterorganisierte Wohngemeinschaften
bb) Zuschlag für Einsiedler in der Gemeinschaft
cc) Zuschlag neben Pflege
dd) Zuschlag bei gemischten Wohngemeinschaften
ee) Zuschlag bei kurzfristigem Auszug/Versterben von Mitbewohnern
c) Anschubfinanzierung nach § 45e SGB XI
d) Leistungen zur Entlastung nach § 45a und § 45b SGB XI
IV. Qualitätssicherung und Prüfungsverfahren
Anmerkungen
C. Selbstständigkeit in der ambulanten Pflege
Anmerkungen
38. Kapitel Rehabilitationswesen
A. Begriff und Entwicklung des Rehabilitationswesens
Anmerkungen
B. Das Rehabilitationsrecht im SGB IX
1. Behindertenbegriff
a) Wunsch- und Wahlrecht
b) Persönliche Budgets
c) Erstattung selbstbeschaffter Leistungen
d) Mitwirkungspflichten
3. Koordination und Kooperation der Rehabilitationsträger
1. Ausführung von Leistungen zur Teilhabe
2. Rehabilitationsdienste und -einrichtungen
3. Leistungsort
4. Ambulante, teilstationäre und betriebliche Leistungen
5. Qualitätssicherung
6. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
Anmerkungen
C. Die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung
I. Allgemeines
II. Ambulante (einschließlich teilstationäre) Rehabilitation
1. Begriff der ambulanten Rehabilitation
2. Leistungserbringer der ambulanten Rehabilitation
3. Voraussetzungen/Verfahren
III. Stationäre Rehabilitation
a) Abgrenzungen
b) Verzahnungen
a) Zertifizierung nach § 37 Abs. 3 SGB IX
b) Versorgungsvertrag nach § 111 SGB V
b) Vergütung
3. Voraussetzungen/Verfahren
IV. Rehabilitation und besondere Versorgung
V. Mutter-Kind-Kuren
VI. Sonstige Rehabilitationsleistungen, Fahrtkosten
Anmerkungen
39. Kapitel Berufsgenossenschaftliche Heilbehandlung
A. System der gesetzlichen Unfallversicherung
I. Aufgaben
II. Trägerschaft und Finanzierung
III. Europarecht
Anmerkungen
B. Versicherter Personenkreis und Versicherungsfall
I. Versicherter Personenkreis
II. Versicherungsfall
Anmerkungen
C. Umfang der Heilbehandlung
Anmerkungen
D. Durchführung der Heilbehandlung
I. Gesetzliche Regelung und Vertrag Ärzte/UVTr
II. Besondere Verfahrensarten
1. Durchgangsarztverfahren
2. Verletzungsartenverfahren und Schwerstverletzungsartenverfahren
III. Verordnung von Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln sowie häuslicher Krankenpflege
Anmerkungen
E. Haftung und Haftungsbeschränkung
Anmerkungen
F. Reform der gesetzlichen Unfallversicherung
Anmerkungen
40. Kapitel Rettungsdienst, Notarzt
A. Einführung
I. Bedeutung des Rettungsdienstes
II. Rechtsgrundlagen
Anmerkungen
B. Aufgaben und Struktur des Rettungsdienstes
1. Aufgaben
2. Trägerschaft und Durchführung
1. Aufgaben
2. Trägerschaft und Durchführung
III. Kosten
IV. Aufsicht
Anmerkungen
C. Genehmigungsverfahren
I. Genehmigungspflicht
II. Genehmigungsvoraussetzungen
III. Pflichten des Unternehmers
Anmerkungen
D. Organisation des Rettungsdienstes
I. Einrichtungen
II. Rettungsmittel
III. Einsatzsysteme
Anmerkungen
E. Personal im Rettungsdienst
1. Notarzt
2. Leitender Notarzt
3. Ärztlicher Leiter Rettungsdienst
1. Notfallsanitäter
2. Rettungsassistenten
3. Rettungssanitäter
4. Rettungshelfer
III. Fortbildung
Anmerkungen
F. Aufgabenverteilung im Rettungsdienst
1. Notarzt
2. Leitender Notarzt
3. Ärztlicher Leiter Rettungsdienst
1. Rettungsteam
2. Leitstellenpersonal
Anmerkungen
G. Haftungsfragen
Anmerkungen
H. Reformbestrebungen
Anmerkungen
41. Kapitel Steuerrecht
A. Grundsätze der Besteuerung des niedergelassenen Arztes
I. Aufnahme der Tätigkeit
1. Neugründung einer Praxis
2. Praxisübernahme
3. Exkurs: Abschreibung einer Vertragsarztzulassung
aa) Freiberufliche Tätigkeit des Arztes
bb) Mithilfe fachlich vorgebildeter Arbeitskräfte und Gewerblichkeit
cc) Gewerbliche Tätigkeit des Arztes
aa) Wahlrecht zur Art der Gewinnermittlung
bb) Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG
cc) Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 EStG
a) Umsatzsteuerliche Grundsätze
b) Abgrenzung § 4 Nr. 14 Buchst. a und b UStG
aa) Einleitung
bb) Leistung im Bereich der Humanmedizin
cc) Qualifikation des Leistungserbringers
dd) Art der Leistung
ee) Rechtsform des Unternehmers/Beschäftigung von Arbeitnehmern
aa) Einleitung
bb) Voraussetzungen für die Umsatzsteuerbefreiung
cc) Beschränkung und Umfang der Umsatzsteuerbefreiung
e) Kleinunternehmerregelung
f) Beweislastregeln
g) Lieferung von Gegenständen durch Ärzte/Veräußerung eines Praxisteils oder eines ideellen Praxiswertes
a) Steuerliche Voraussetzungen einer Praxisveräußerung
b) Fortführung und Wiederaufnahme einer freiberuflichen ärztlichen Tätigkeit
c) Steuerfolgen einer Praxisveräußerung
2. Unentgeltliche Praxisabgabe
IV. Besteuerung der Beendigung/Aufgabe der Praxis
Anmerkungen
B. Besteuerung der Berufsausübungsgemeinschaften
1. Gründung einer Gemeinschaftspraxis
a) Unentgeltliche Aufnahme eines Arztes in eine Einzelpraxis
aa) Steuerfolgen
bb) Exkurs § 24 Umwandlungssteuergesetz (UmwStG)
cc) „Einbringungsmodell“ (§ 24 Umwandlungssteuergesetz)
dd) „Überlassungsmodell“ (Nutzungsüberlassung der Einzelpraxis)
ee) „Gewinnvorabmodell“ (Ausgleich über die Gewinnverteilung)
c) Zusammenschluss mehrerer Einzelpraxen zu einer Gemeinschaftspraxis
aa) Steuerliche Grundsätze zur Mitunternehmerschaft
bb) Steuerliche Vermögensbereiche einer Gemeinschaftspraxis
(1) Gesamthandsbereich
(2) Ergänzungsbereich
(3) Sonderbetriebsbereich
cc) Steuerpflicht und Gewinnermittlung
dd) Einkunftsart und Abgrenzung
aa) Leistungen und Lieferungen der Gemeinschaftspraxis
(1) Grundsätze zum Leistungsaustausch bei Gesellschaftsverhältnissen
(2) Nutzungsüberlassungen an die Gemeinschaftspraxis
(3) Geschäftsführungsvergütungen der Gemeinschaftspraxis
(4) Erbringung ärztlicher Leistungen an die Gemeinschaftspraxis
a) Entgeltliche Praxisanteilsveräußerung
b) Unentgeltliche Praxisanteilsabgabe
4. Ausscheiden aus einer Gemeinschaftspraxis gegen Sachwertabfindung und Beendigung der Gemeinschaftspraxis durch Realteilung
a) Beendigung der Gemeinschaftspraxis durch „echte“ Realteilung
b) Ausscheiden aus einer Gemeinschaftspraxis im Rahmen einer „unechten“ Realteilung
c) Exkurs: Begriff Teilbetrieb
d) Exkurs: Umsatzsteuerliche Problematik
II. Die Teilgemeinschaftspraxis
1. Gewinnverteilungsabrede in der Teilgemeinschaftspraxis
2. Tätigkeitserfordernis der Ärzte in der Teilgemeinschaftspraxis
a) Ertragsteuerliche Besonderheiten
b) Umsatzsteuerliche Besonderheiten
III. Die überörtliche Gemeinschaftspraxis und Filialbildung („Zweigpraxis“)
Anmerkungen
C. Besteuerung neuerer/sonstiger Kooperationsformen
1. Einleitung
2. Gründung
a) MVZ-Personengesellschaft (MVZ-GbR) mit angestellten Ärzten
b) MVZ-Personengesellschaft (MVZ-GbR) mit Vertragsärzten
c) MVZ-Kapitalgesellschaft (MVZ-GmbH) mit angestellten Ärzten
d) MVZ-Kapitalgesellschaft (MVZ-GmbH) mit Vertragsärzten
aa) „Reine“ MVZ-Kapitalgesellschaft („Freiberufler“-MVZ-GmbH)
bb) MVZ-Kapitalgesellschaft (MVZ-GmbH) mit Vertragsärzten als Mitunternehmerschaft
(1) Voraussetzung für die Annahme einer Mitunternehmerschaft
(2) Folgen einer Mitunternehmerschaft zwischen MVZ-GmbH und den Vertragsärzten
cc) MVZ-Kapitalgesellschaft (MVZ-GmbH) mit Vertragsärzten als „Subunternehmer“
e) Umsatzsteuerliche Fragestellungen bei der Gründung eines MVZ
3. Laufende Besteuerung
(1) Gewinnermittlung und Einkunftsart
(2) Vergütungen an die Gesellschafter in der Angestellten-Variante
bb) Laufende Ertragsbesteuerung der MVZ-GmbH
b) Laufende Umsatzbesteuerung
II. Integrierte Versorgung – Ertragsteuern
III. Managementgesellschaften
1. Ertragsteuern
2. Umsatzsteuer
Anmerkungen
D. Besteuerung der Praxis-/Apparate-/Laborgemeinschaften
1. Grundzüge der Ertragsbesteuerung
2. Grundzüge der Umsatzbesteuerung
1. Ertragsteuerliche Folgen der Leistungen an Nichtmitglieder
2. Umsatzsteuerliche Folgen der Leistungen an Nichtmitglieder
1. Ertragsteuerliche Folgen der Beteiligung von nicht freiberuflich ärztlich tätigen Mitgliedern
2. Umsatzsteuerliche Folgen der Beteiligung von nicht ärztlichen Mitgliedern
IV. Abgrenzung zur Betreibergesellschaft
Anmerkungen
E. Besteuerung wahlärztlicher Leistungen eines Chefarztes und seiner nachgeordneten Mitarbeiter
Anmerkungen
F. Zuweisung gegen Entgelt aus steuerlicher Sicht
I. Steuerliche Vorüberlegungen
II. Steuerliche Beurteilung von Entgelten für die Zuweisung von Patienten
III. Steuerliche Beurteilung von verdeckten Entgelten für die Zuweisung von Patienten
IV. Steuerliche Beurteilung von unzutreffend deklarierten Entgelten für die Zuweisung von Patienten
V. Steuerliche Beurteilung kooperativer Zuweisermodelle
Anmerkungen
42. Kapitel Ärztliche Versorgungswerke
A. Einleitung
Anmerkungen
B. Versorgungswerke als Teil des Alterssicherungssystems der Bundesrepublik
Anmerkungen
C. Geschichtliche Entwicklung
Anmerkungen
D. Normgefüge
I. Satzung
II. Landesrecht
1. Grundgesetz
2. Einfach gesetzliches Bundesrecht
IV. Europarecht
Anmerkungen
E. Rechtliche Ausgestaltung
I. Rechtsform
II. Organisation und Verwaltung
III. Mitgliedschaft
IV. Leistungsumfang
1. Pflichtleistungen
a) Altersrente
b) Berufsunfähigkeitsrente
c) Hinterbliebenenrente
2. Freiwillige Leistungen
V. Finanzierung
Anmerkungen
F. Die Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht (§ 6 SGB VI)
I. § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI
1. Verwaltungsrechtliche Sichtweise
a) Pflichtmitgliedschaft in einer Ärztekammer
b) Pflichtmitgliedschaft in einem Versorgungswerk
c) Zwischenbefund
2. Sozialrechtliche Sichtweise
3. Konsequenzen
1. § 6 Abs. 5 S. 1 SGB VI
2. § 6 Abs. 5 S. 2 SGB VI
Anmerkungen
43. Kapitel Betriebsarzt
A. Fachrichtung Arbeitsmedizin
Anmerkungen
B. Anforderungen an Betriebsärzte
Anmerkungen
C. Rechtliche Stellung des Betriebsarztes
Anmerkungen
D. Aufgaben des Betriebsarztes
E. Arbeitsmedizinische Untersuchungen
1. Begriff
a) Pflichtvorsorge
b) Angebotsvorsorge
c) Wunschvorsorge
2. Umfang der Vorsorgemaßnahme
3. Vorsorgebescheinigung
4. Sanktionen
5. Auswahl des Arztes
1. Trennungsprinzip
2. Einstellungsuntersuchung
a) Eignungsuntersuchung ohne Anlass
b) Anlassbezogene Eignungsuntersuchungen
c) Auswahl des Arztes
Anmerkungen
F. Schweigepflicht
I. Grundsatz
1. Einstellungsuntersuchung
2. Eignungsuntersuchungen
a) Eignungsuntersuchung ohne Anlass
b) Anlassbezogene Eignungsuntersuchung
3. Vorsorgemaßnahme
III. Rechtfertigender Notstand
Anmerkungen
G. Betriebsärzte und Arzneimittel
Anmerkungen
H. Umsatzsteuerpflichtige Leistungen
Anmerkungen
I. Haftung des Betriebsarztes
Anmerkungen
Stichwortverzeichnis
Отрывок из книги
Handbuch Medizinrecht
Das Inhaltsverzeichnis belegt, wie weit der thematische Bogen im Medizinrecht mittlerweile gespannt werden kann. Neue Themen wurden aufgenommen: Unter dem Eindruck der Corona-Pandemie war ein Kapitel zum Infektionsschutzrecht überfällig. Die DS-GVO hinterlässt auch im Medizinrecht Spuren. Ein zusätzliches Kapitel hierzu deckt den Informationsbedarf. Die zahlreichen Aktivitäten im Gesundheitsministerium haben den Autoren, insbesondere den Autoren des Kapitels zum Vertragsarztrecht, schlaflose Nächte bereitet; ihnen gilt an dieser Stelle besonderer Dank. Das Gesetz zur Bekämpfung der Korruption im Gesundheitswesen machte nicht nur den Strafrechtlern viel Arbeit, sondern führte auch dazu, dass das Kapitel zu sektorübergreifenden Kooperationen grundlegend überarbeitet werden musste. Dies gilt natürlich auch für solch dynamische Fächer wie das Liquidationsrecht und das Steuerrecht. Aber auch all die anderen Teams haben beachtliche Ergebnisse vorzuweisen, weil sie nicht nur die bisherigen Beiträge überarbeitet im Sinne von aktualisiert haben. Der Leser wird zum Teil völlig neue Gliederungen und Schwerpunkte finden. Autorenteam und Herausgeber haben sich bemüht, nicht nur die Anregungen aus der Leserschaft, sondern auch die eine oder andere Kritik aufzunehmen und umzusetzen. Der Bearbeitungsstand konnte durch eine sehr flexible Kooperation mit dem C.F. Müller Verlag sehr aktuell gehalten werden. Dies zeigt beispielhaft, dass das Kapitel zum IfSG noch die Änderungen vom August 2020 eingepflegt hat. Aber auch die übrigen Kapitel befinden sich weitgehend auf dem Stand von September 2020. Somit wird das Handbuch im Zeitpunkt seines Erscheinens wieder den status quo im Medizinrecht abbilden. Dennoch bringt es die Schnelllebigkeit des Medizinrechts aufgrund vielfältiger gesetzgeberischer Aktivitäten mit sich, dass bereits im Zeitpunkt des Erscheinens schon wieder Neuerungen abzusehen sind. Dies wird sich nie vermeiden lassen, was jeder mit der Materie Vertraute bestätigen kann.
.....
V.Fälligkeit und Fristen
VI.Schiedsverfahren, Wirtschaftsmediation, Salvatorische Klausel
.....