Gewalt und Mobbing an Schulen
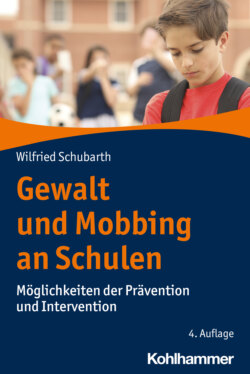
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Wilfried Schubarth. Gewalt und Mobbing an Schulen
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Vorwort zur 3., aktualisierten Auflage
Wie sich Gewalt und Mobbing in den letzten Jahren entwickelt haben und welche Gegenstrategien nötig sind
a) Haben Gewalt und Mobbing, einschließlich Gewalt gegen Lehrkräfte, in den letzten Jahren zugenommen?
Gewaltrückgang bis 2014, Trendwende seit 2015/2016?
Mehr Gewalt gegen Lehrkräfte?
b) Welche Rolle spielen Cybermobbing und Hate Speech?
Wie sollte mit Cybermobbing umgegangen werden?
Hate Speech – eine neue Herausforderung auch für Schule?
c) Welche neueren Erkenntnisse gibt es zur Intervention und Prävention von Gewalt und Mobbing an Schulen?
Fortbildungsbedarf zur Intervention bei Gewalt- und Mobbingfällen
Welche Interventionsstrategien sind erfolgreich?
Welche Interventionskompetenzen brauchen Lehrkräfte?
Literatur
Teil I Gewalt und Mobbing an Schulen. 1 Von Amokläufern und Voyeuren: Zur öffentlichen Debatte um »Schule und Gewalt«
2 Prävention von Gewalt – eine Aufgabe von Schule?
Welche gesellschaftlichen Funktionen hat eigentlich die Schule?
3 Gewaltbegriff und Gewaltverständnis
Wo fängt Gewalt an?
Welche Formen von Gewalt gibt es an Schulen?
4 Theoretische Erklärungsmodelle für Aggression bzw. Gewalt und Folgerungen für die Prävention
4.1 Psychologische Theorien
Aggression als Folge eines Triebes
Aggression als Reaktion auf Frustration
Aggression als Folge von Lernprozessen
Aggression – entwicklungspsychologisch bedingt
Aggression als Ausdruck kognitiver Prozesse
Aggression als Folge eines bedrohten Selbst
Gewalt als Folge verweigerter schulischer Anerkennung
Aggression als Folge physiologischer Bedingungen
4.2 Soziologische Theorien
Anomietheorie
Subkulturtheorien
Theorien des differenziellen Lernens
Etikettierungstheorien
Devianz als soziales Handeln
Delinquenz als Folge mangelnder Selbstkontrolle
Gewalt als Folge von Modernisierung und Individualisierung
Gewalt als Folge der anomischen Struktur von Schule
4.3 Integrative Erklärungsmodelle
Gewalt als Form der »produktiven Realitätsverarbeitung«
Gewalt als Form männlicher Lebensbewältigung
Schule als gewaltfördernde Institution
Resümee: Konsequenzen für die Gewaltprävention
5 Empirische Ergebnisse zu Ausmaß und Ursachen von Gewalt und Mobbing
5.1 Zur Entwicklung der schulbezogenen Gewaltforschung
5.2 Ausmaß, Erscheinungsformen und Ursachen von Gewalt
1. Gewalt an Schulen: weder dramatisieren noch verharmlosen
2. Die »kleine« Gewalt dominiert, aber auch Mobbing ist verbreitet
3. Der »harte Kern« als besondere Herausforderung
4. Gewalt an Schulen unterscheidet sich stark nach Geschlecht, Schulform und Alter
5. Gewalthandlungen innerhalb und außerhalb der Schule hängen zusammen
6. Schülergewalt als Schulproblem
7. Lehrergewalt als Zeichen mangelnder Professionalität und Überforderung
8. Schülergewalt als Folge »struktureller Gewalt«
9. Auch die »große« Gewalt fällt nicht vom Himmel
10. Gewaltintervention wirkt
Hat die Gewalt (an Schulen) zugenommen? (vgl. auch das Einführungskapitel)
Welche Gewaltphänomene sind an Schulen verbreitet?
Wie groß ist der Anteil von »Tätern« bzw. »Opfern«?
Welchen Einfluss haben Geschlecht, Schulform, Alter und andere Merkmale?
Förderschulen besonders belastet?
Junge Migranten stärker belastet?
Welche Ursachen bzw. Risikofaktoren für Gewalt an Schulen wurden ermittelt?
Exkurs: »Rechte Jugendgewalt« im Aufwind?
5.3 Erscheinungsformen, Struktur und Hintergründe von Mobbing. Mobbing – ein Alltagsphänomen an Schulen?
Welche Folgen hat Mobbing?
Wer sind die Mobbingopfer, wer die Mobbingtäter?
Mobbing – ein Gruppenphänomen? Welche Hintergründe hat Mobbing?
Cyberbullying und Happy Slapping – neue Mobbingphänomene? (vgl. auch das Einführungskapitel)
5.4 Forschungsbefunde zu Amokläufen an Schulen
Lassen sich Amokläufe verhindern?
5.5 Sexuelle Gewalt an Schulen (Juliane Ulbricht)
Welche Befunde gibt es zum Ausmaß sexueller Gewalt in Schulen?
Welche Möglichkeiten der Prävention gibt es?
5.6 Relevanz der Ergebnisse für die Gewaltprävention
6 Wiederholungsfragen zu Teil I
Teil II Möglichkeiten der Prävention und Intervention. 1 Begriffe »Gewaltprävention« und »Gewaltintervention«
2 »Systemische schulische Gewaltprävention« als ursachenbezogene Prävention
3 Allgemeine Möglichkeiten der Prävention und Intervention
3.1 Präventionsmöglichkeiten
1. Individuelle Schülerebene
2. Klassenebene
3. Schulebene
3.2 Interventionsmöglichkeiten
Was tun bei Mobbing?
4 Spezielle Möglichkeiten: Schulische Präventions- und Interventionsprogramme
4.1 Präventionsprogramme gegen Gewalt. Streit-Schlichter-Programme (Peer-Mediation) Ziele und Hintergrund
Inhalt und Methoden
Einführung und Etablierung von Peer-Mediation an Schulen
Evaluation und Gesamtbewertung
Weiterführende Literatur
Programm »FAUSTLOS« Ziele und Hintergrund
Inhalt und Methoden
1. Empathietraining
2. Impulskontrolle
3. Umgang mit Ärger und Wut
Evaluation und Gesamtbewertung
Weiterführende Literatur
Sozialtraining in der Schule. Ziele und Hintergrund
Inhalt und Methoden
Evaluation und Gesamtbewertung
Weiterführende Literatur
Training mit aggressiven Kindern. Ziele und Hintergrund
Inhalt und Methoden
Evaluation und Gesamtbewertung
Weiterführende Literatur
Verhaltenstraining für Schulanfänger. Ziele und Hintergrund
Inhalt und Methoden
Evaluation und Gesamtbewertung
Weiterführende Literatur
Komm, wir finden eine Lösung!
Inhalt und Methoden
Evaluation und Gesamtbewertung
Weiterführende Literatur
Programm »Soziales Lernen« Ziele und Hintergrund
Inhalt und Methoden
Evaluation und Gesamtbewertung
Weiterführende Literatur
4.2 Interventionsprogramme gegen Gewalt. Coolness-Training (CT) Ziele und Hintergrund
Inhalte und Methoden
Fachstandards zur Durchführung von Coolness-Training (CT®)
Evaluation und Gesamtbewertung
Weiterführende Literatur
Die Trainingsraum-Methode. Ziele und Hintergrund
Inhalt und Methoden
Evaluation und Gesamtbewertung
Weiterführende Literatur
Interventionsprogramm zur gewaltfreien Konfliktlösung. Ziele und Hintergrund
Inhalt und Methoden
Evaluation und Gesamtbewertung
Weiterführende Literatur
4.3 Programme gegen Mobbing. Das Anti-Bullying-Interventionsprogramm nach Olweus. Ziele und Hintergrund
Inhalt und Methoden
Schulebene:
Klassenebene:
Persönliche Ebene:
Evaluation und Gesamtbewertung
Weiterführende Literatur
Das Programm »fairplayer« Ziele und Hintergrund
Inhalt und Methoden
Evaluation und Gesamtbewertung
Weiterführende Literatur
Das Programm »ProACT + E« Ziele und Hintergrund
Inhalt und Methoden
Evaluation und Gesamtbewertung
Weiterführende Literatur
Das Berner Mobbing-Präventionsprogramm »Be-Prox« Ziele und Hintergrund
Inhalt und Methoden
Evaluation und Gesamtbewertung
Weiterführende Literatur
Der »No Blame Approach« Ziele und Hintergrund
Inhalt und Methoden
1. Gespräch mit dem Opfer
2. Treffen mit der Unterstützungsgruppe (ohne Opfer)
3. Einzelne Nachgespräche mit allen Beteiligten
Evaluation und Gesamtbewertung
Weiterführende Literatur
Die »Farsta-Methode« Ziele und Hintergrund
Inhalt und Methoden
Evaluation und Gesamtbewertung
Weiterführende Literatur
Das »Trainer-Konzept« Ziele und Hintergrund
Inhalt und Methoden
Evaluation und Gesamtbewertung
Weiterführende Literatur
4.4 Gewaltunspezifische Präventionsprogramme. Das Buddy-Projekt. Ziele und Hintergrund
Inhalt und Methoden
Evaluation und Gesamtbewertung
Weiterführende Literatur
PIT – Prävention im Team. Ziele und Hintergrund
Inhalte und Methoden
Evaluation und Gesamtbewertung
Weiterführende Literatur
Programm »Erwachsen werden« (Lions-Quest) Ziele und Hintergrund
Inhalt und Methoden
Evaluation und Gesamtbewertung
Weiterführende Literatur
Programm »Eigenständig werden« Ziele und Hintergrund
Inhalt und Methoden
Evaluation und Gesamtbewertung
Weiterführende Literatur
Konstanzer Trainingsmodell (KTM) Ziele und Hintergrund
Inhalt und Methoden
Phase I: Situationsauffassung
Phase II: Handlungsauffassung
Phase III: Handlungsausführung
Phase IV: Handlungsergebnisauffassung
Evaluation und Gesamtbewertung
Weiterführende Literatur
Training mit Jugendlichen. Ziele und Hintergrund
Inhalt und Methoden
Evaluation und Gesamtbewertung
Weiterführende Literatur
Programm »FIT FOR LIFE« Ziele und Hintergrund
Inhalt und Methoden
Evaluation und Gesamtbewertung
Weiterführende Literatur
Fit und stark fürs Leben. Ziele und Hintergrund
Inhalt und Methoden
Evaluation und Gesamtbewertung
Weiterführende Literatur
4.5 Sonstige Konzepte im Kontext der Gewaltprävention
Konzepte zur Förderung der Moralentwicklung und der »Civic Education«
Interkulturelles Lernen und Demokratie- und Menschenrechtserziehung
Geschlechtsspezifische Ansätze
Täter-Opfer-Ausgleich im Kontext Schule
Schulsozialarbeit
Schulinterne Lehrerfortbildung zur Gewaltprävention (SchiLF)
Konzept »Erziehende Schule«
Konzept »Lebenswelt Schule«
Medienpädagogische Konzepte
Konzepte der Elternarbeit und Elternbildung
5 Was wirkt? Zur Wirksamkeit von Präventions- und Interventionsprogrammen
Zwischen Wunsch und Wirklichkeit – Das Beispiel »Streitschlichterprogramme«
6 Gewaltprävention durch Schulentwicklung: eine Anleitung zum Handeln
Phase 1: Einstieg und Vorklärung
Phase 2: Datensammlung und Diagnose
a) Fragebogen zur schulischen Gewaltbelastung und zum Gewaltverständnis
b) Problemdiagnose mittels der Moderationsmethode
Phase 3: Ziel- und Prioritätensetzung
Phase 4: Maßnahme- und Projektplanung
Phase 5: Durchführung und Projektsteuerung
Phase 6: Evaluation
7 Wiederholungsfragen zu Teil II
Teil III Perspektiven der Gewaltprävention
1. Gewaltprävention muss der veränderten Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen Rechnung tragen
2. Gewaltprävention muss auch die veränderte Schulwirklichkeit zum Thema machen
3. Entgegen dem allgemeinen Trend, sich von Erziehung zurück zu ziehen, muss Gewaltprävention auf eine verstärkte Erziehungsoffensive setzen
4. Im Fokus der öffentlichen Debatte um »Schule und Gewalt« stehen Extremereignisse wie Amokläufe und weniger die schultypischen Phänomene von Gewalt und Mobbing
5. Neue Gewaltphänomene wie Amokläufe, Cyberbullying oder Happy Slapping erfordern auch neue Formen der Gewaltprävention
6. In der Präventions- und Interventionsdebatte vollzieht sich ein Paradigmenwechsel hin zu Ansätzen mit stärker konfrontativen Elementen und klarer Grenzsetzung
7. Wenn Gewaltprävention nachhaltig sein soll, muss sie »systemisch«, d. h. ursachenbezogen sein, und mehrere Ebenen einbeziehen
8. Gewaltprävention kann nicht verordnet werden, sondern ist von jeder einzelnen Schule selbst zu gestalten
9. Die beste Gewaltprävention ist noch immer ein aktiver Schulentwicklungsprozess oder umgekehrt: Eine »gute, demokratische Schule« ist die beste Gewaltprävention
10. Die erfreuliche Botschaft der Gewaltforschung ist, dass Prävention und Intervention Gewalt und Mobbing vermindern können. Dies sollte als Aufforderung zum Handeln verstanden werden
Literatur
Отрывок из книги
Der Autor
Wilfried Schubarth hat eine Professur für »Erziehungs- und Sozialisationstheorie« im Bereich Bildungswissenschaften der Universität Potsdam. Seine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind die Jugend-, Schul- und Bildungsforschung, vor allem Gewalt und (Rechts)Extremismus, Werte- und Demokratiebildung, Lehrkräftebildung, Prävention und Intervention sowie Hochschulforschung. Er ist Mitherausgeber der Reihe Brennpunkt Schule.
.....
Ungeachtet der Bemühungen von Schulen besteht bei Prävention bzw. Intervention von Gewalt und Mobbing ein deutlicher Handlungsbedarf. Darauf macht auch unsere eigene Studie zu Interventionskompetenzen bei Lehrkräften aufmerksam (vgl. ausführlich Bilz/Schubarth/Dudziak u. a. 2017). Bisher konnte man nur mutmaßen, wie Lehrkräfte in konkreten Gewalt- oder Mobbingfällen reagieren – nun liegen empirische Befunde vor: Gestützt auf eine repräsentative Lehrer- und Schülerbefragung zeigt unsere Studie, dass die Mehrheit der Lehrkräfte bei Gewalt und Mobbing nicht wegschaut, sondern sich um eine Beendigung des Gewalt- oder Mobbingfalls bemüht. Damit wird die Mehrheit der Lehrerschaft ihrem Erziehungsauftrag gerecht, dass Gewalt und Mobbing an Schulen nicht geduldet werden dürfen. Sowohl die Lehrer- als auch die Schülerschaft gibt mehrheitlich an, dass in Gewalt- und Mobbingfällen interveniert wird. Erwartungsgemäß fallen die Selbstauskünfte der Lehrkräfte günstiger und die Beobachtungen der Schülerschaft kritischer aus. Nur eine kleine Minderheit der Lehrkräfte (2 %) gibt an, bei dem letzten, selbst erlebten Gewalt- bzw. Mobbingfall nicht interveniert zu haben. Die große Mehrheit, d. h. rund drei Viertel der Lehrkräfte, berichtet, in der entsprechenden Situation interveniert zu haben. Weitere 21 % haben die Situation zunächst beobachtet und ggf. erst später interveniert.
Im Vergleich zur Lehrersicht sieht die Schülerschaft das Lehrerhandeln bei Gewalt und Mobbing deutlich kritischer: Eines der auffälligsten Ergebnisse ist der Befund, dass rund 30 % der Schülerinnen und Schüler berichten, dass die Lehrkräfte von dem von ihnen berichteten Fall nichts erfahren haben. Dass Lehrkräfte nicht alles erfahren, ist nicht unerwartet; dass aber immerhin jeder dritte bis vierte Gewalt- bzw. Mobbingfall ihnen nicht zu Ohren kommt, weist auf einen erheblichen Handlungsbedarf hin. Mehr noch: Jede zehnte Lehrkraft hat – aus Schülersicht – nichts unternommen und das Geschehen nicht weiter beachtet. Bei fünf Prozent der Fälle wurde der Mobbingfall sogar bagatellisiert. Weitere 14 % gaben an, dass die Lehrkräfte die Situation nur beobachtet haben. Umgekehrt haben in ca. 70 % der geschilderten realen Gewalt- oder Mobbingsituationen, von denen eine Lehrkraft erfahren hat, die Lehrkräfte auch interveniert.
.....