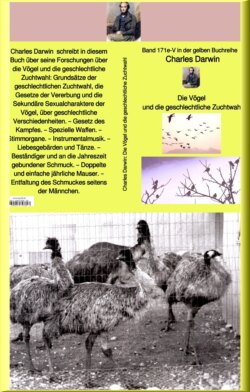Читать книгу Charles Darwin: Die Vögel und die geschlechtliche Zuchtwahl - Carles Darwin - Страница 5
Zweiter Teil – Geschlechtliche Zuchtwahl – Achtes Kapitel – Grundsätze der geschlechtlichen Zuchtwahl
ОглавлениеZweiter Teil – Geschlechtliche Zuchtwahl – Achtes Kapitel –
Grundsätze der geschlechtlichen Zuchtwahl
* * *
Sekundäre Sexualcharaktere. – Geschlechtliche Zuchtwahl. – Art und Weise der Wirksamkeit. – Überwiegen der Männchen. – Polygamie. – Allgemein ist nur das Männchen durch geschlechtliche Zuchtwahl modifiziert. – Begierde des Männchens. – Variabilität des Männchens. – Wahl vom Weibchen ausgeübt. – Geschlechtliche Zuchtwahl verglichen mit der natürlichen. – Vererbung zu entsprechenden Lebensperioden, zu entsprechenden Jahreszeiten und durch das Geschlecht beschränkt. – Beziehungen zwischen den verschiedenen Formen der Vererbung. – Ursachen, weshalb das eine Geschlecht und die Jungen nicht durch geschlechtliche Zuchtwahl modifiziert werden.
* * *
Anhang: Über die proportionalen Zahlen der beiden Geschlechter durch das ganze Tierreich. – Die Verhältniszahlen der beiden Geschlechter in Bezug auf natürliche Zuchtwahl.
* * *
Bei Tieren mit getrenntem Geschlechte weichen die Männchen notwendig von den Weibchen in ihren Reproduktionsorganen ab; diese bieten daher die primären Geschlechtscharaktere dar. Die Geschlechter weichen aber oft auch in dem ab, was Hunter sekundäre Sexualcharaktere genannt hat, welche in keiner direkten Verbindung mit dem Akte der Reproduktion stehen. Es besitzen z. B. die Männchen gewisse Sinnesorgane oder Lokomotionsorgane, welche den Weibchen völlig fehlen, oder sie haben dieselben höher entwickelt, damit sie die Weibchen leicht finden oder erreichen können; oder ferner es besitzt das Männchen besondere Greiforgane, um das Weibchen sicher halten zu können. Diese letzteren Organe von unendlich mannigfacher Art gehen allmählich in diejenigen über und können in manchen Fällen kaum von denselben unterschieden werden, welche gewöhnlich für primäre angesehen werden, so z. B. die komplizierten Anhänge an der Spitze des Hinterleibs bei männlichen Insekten. In der Tat, wenn wir nicht den Ausdruck „primär“ auf die Generationsdrüsen beschränken, ist es kaum möglich, wenigstens soweit die Greiforgane in Betracht kommen, zu entscheiden, welche derselben primär und welche sekundär genannt werden sollen.
Das Weibchen weicht oft vom Männchen dadurch ab, dass es Organe zur Ernährung oder zum Schutze seiner Jungen besitzt, wie die Milchdrüsen der Säugetiere und die Abdominaltasche der Marsupialien. Auch die Männchen besitzen in einigen wenigen Fällen ähnliche Organe, welche den Weibchen fehlen, wie die Taschen zur Aufnahme der Eier, welche die Männchen gewisser Fische besitzen, und die temporär entwickelten Bruttaschen gewisser männlicher Frösche. Die Weibchen der meisten Bienen haben einen speziellen Apparat zum Sammeln und Eintragen der Pollen, und ihre Legerohre ist zu einem Stachel für die Verteidigung ihrer Larven und der ganzen Genossenschaft modifiziert worden. Zahlreiche ähnliche Fälle könnten angeführt werden, doch berühren sie uns hier nicht. Es gibt indessen andere geschlechtliche Verschiedenheiten, die uns hier besonders angehen und welche mit den primären Organen in gar keinem Zusammenhang stehen, so die bedeutendere Größe, Stärke und Kampflust der Männchen, ihre Angriffswaffen oder Verteidigungsmittel gegen Nebenbuhler, ihre auffallendere Färbung und verschiedene Ornamente, ihr Gesangsvermögen und andere derartige Charaktere.
Außer den vorgenannten primären und sekundären geschlechtlichen Differenzen weichen die Männchen von den Weibchen zuweilen in Bildungen ab, welche zu verschiedenen Lebensgewohnheiten in Beziehung stehen und entweder gar nicht oder nur indirekt auf die Reproduktionsfunktionen Bezug haben. So sind die Weibchen gewisser Fliegen (Culicidae und Tabanidae) Blutsauger, während die Männchen von Blüten leben und keine Kiefer an ihrer Mundöffnung haben. [Westwood, Modern Klassifiktion of Insekts. Vol. II. 1840, p. 541. In Bezug auf die Angaben über Tanais, welche weiterhin erwähnt werden, bin ich Fritz Müller zu Dank verbunden.] Nur die Männchen gewisser Schmetterlinge und einiger Crustaceen (z. B. Tanais) haben unvollkommene, geschlossene Mundöffnungen und können keine Nahrung aufnehmen. Die complementären Männchen gewisser Cirripeden leben wie epiphytische Pflanzen entweder auf der weiblichen oder der hermaphroditischen Form und entbehren einer Mundöffnung und der Greiffüße. In diesen Fällen ist es das Männchen, welches modifiziert worden ist und gewisse bedeutungsvolle Organe verloren hat, welche die Weibchen besitzen. In anderen Fällen ist es das Weibchen, welches derartige Teile verloren hat. So ist z. B. der weibliche Leuchtkäfer ohne Flügel, wie es auch viele weibliche Schmetterlinge sind; von diesen verlassen einige niemals ihre Cocons. Viele weibliche parasitische Crustaceen haben ihre Schwimmfüße verloren. Bei einigen Rüsselkäfern (Curculionidae) besteht eine bedeutende Verschiedenheit zwischen dem Männchen und Weibchen in der Länge des Rostrums oder des Rüssels. [Kirby and Spenge, Introduktion to Entomology. Vol. III. 1826, p. 309.] Doch ist die Bedeutung dieser und vieler anderer Verschiedenheiten durchaus nicht erklärt. Verschiedenheiten der Struktur zwischen den beiden Geschlechtern, welche zu verschiedenen Lebensgewohnheiten in Beziehung stehen, sind meist auf die niederen Tiere beschränkt; aber auch bei einigen wenigen Vögeln weicht der Schnabel des Männchens von dem des Weibchens ab. Beim Huia von Neu-Seeland ist der Unterschied merkwürdig groß; wir erfahren von Dr. Buller, [The Birds of New Zealand, 1872, p. 66.] dass das Männchen seinen starken Schnabel dazu benutzt, die Insektenlarven aus faulendem Holz auszumeißeln, während das Weibchen mit seinem weit längeren, bedeutend gekrümmten und biegsamen Schnabel die weicheren Teile sondiert; sie helfen sich auf diese Weise gegenseitig. In den meisten Fällen stehen die Verschiedenheiten im Bau in einer mehr oder weniger direkten Beziehung zu der Fortpflanzung der Art. So wird ein Weibchen, welches eine Menge Eier zu ernähren hat, mehr Nahrung erfordern als das Männchen und wird infolgedessen spezieller Mittel bedürfen, sich dieselben zu verschaffen. Ein männliches Tier, welches nur eine sehr kurze Zeit lebt, kann ohne Schaden infolge von Nichtgebrauch seine Organe zur Beschaffung von Nahrung verlieren, es wird aber seine locomotiven Organe in vollkommenem Zustande behalten, damit es das Weibchen erreichen kann. Andererseits kann das Weibchen getrost seine Organe zum Fliegen, Schwimmen oder Gehen verlieren, wenn es allmählich Gewohnheiten annimmt, welche ein derartiges Vermögen nutzlos machen.
Wir haben es indessen hier nur mit geschlechtlicher Zuchtwahl zu tun. Dieselbe hängt von dem Vorteil ab, welchen gewisse Individuen über andere Individuen desselben Geschlechts und derselben Spezies erlangen in ausschließlicher Beziehung auf die Reproduktion. Wenn die beiden Geschlechter in ihrer Struktur in Bezug auf die verschiedenen Lebensgewohnheiten, wie in den oben erwähnten Fällen, voneinander abweichen, so sind sie ohne Zweifel durch natürliche Zuchtwahl modifiziert worden in Verbindung mit einer auf ein und dasselbe Geschlecht beschränkten Vererbung. Es fallen ferner die primären Geschlechtsorgane und die Organe zur Ernährung und Beschützung der Jungen unter diese selbe Kategorie. Denn diejenigen Individuen, welche ihre Nachkommen am besten erzeugten oder ernährten, werden ceteris paribus die größte Anzahl hinterlassen, diese Superiorität zu erben, während diejenigen, welche ihre Nachkommen nur schlecht erzeugten oder ernährten, auch nur wenige hinterlassen werden, dieses ihr schwächeres Vermögen zu erben. Da das Männchen das Weibchen aufzusuchen hat, so braucht es für diesen Zweck Sinnes- und Lokomotionsorgane. Wenn aber diese Organe für die anderen Zwecke des Lebens notwendig sind, wie es meistens der Fall ist, so werden sie durch natürliche Zuchtwahl entwickelt worden sein. Hat das Männchen das Weibchen gefunden, so sind ihm zuweilen Greiforgane, um dasselbe fest zu halten, absolut notwendig. So teilt mir Dr. Wallace mit, dass die Männchen gewisser Schmetterlinge sich nicht mit den Weibchen verbinden können, wenn ihre Tarsen oder Füße gebrochen sind. Die Männchen vieler ozeanischer Crustaceen haben ihre Füße und Antennen in einer außerordentlichen Weise zum Ergreifen des Weibchens modifiziert. Wir dürfen daher vermuten, dass diese Tiere wegen des Umstandes, dass sie von den Wellen des offenen Meeres umhergeworfen werden, jene Organe absolut nötig haben, um ihre Art fortpflanzen zu können; und wenn dies der Fall ist, so wird deren Entwicklung das Resultat der gewöhnlichen oder natürlichen Zuchtwahl sein. Einige in der ganzen Reihe äußerst niedrig stehende Tiere sind zu dem nämlichen Zwecke modifiziert worden; so ist die untere Fläche des hinteren Endes ihres Körpers bei gewissen parasitischen Würmern in erwachsenem Zustand wie eine Raspel rau geworden; damit winden sie sich um die Weibchen und halten sie beständig. [Mr. Perrier führt diesen Fall an (Revue Scientifique, 1. Fevr., 1873, p. 865) als einen, der den Glauben an geschlechtliche Zuchtwahl völlig untergrabe; er glaubt nämlich, dass ich alle Verschiedenheiten zwischen den Geschlechtern der geschlechtlichen Zuchtwahl zuschreibe. Es hat sich daher dieser ausgezeichnete Naturforscher, wie so viele Franzosen, nicht die Mühe genommen, auch nur die ersten Grundsätze der geschlechtlichen Zuchtwahl zu verstehen. Ein englischer Zoologe behauptet, dass die Klammerorgane gewisser männlicher Tiere sich nicht hätten durch die Wahl des Weibchens entwickeln können! Hätte ich nicht diese Bemerkung gefunden, so würde ich es nicht für möglich gehalten haben, dass irgend jemand, der dies Kapitel gelesen hat, sich hätte einbilden können, ich behauptete, dass die Wahl des Weibchens mit der Entwicklung von Greiforganen beim Männchen irgend etwas zu tun habe.]
Wenn die beiden Geschlechter genau denselben Lebensgewohnheiten folgen und das Männchen hat höher entwickelte Sinnes- oder Lokomotionsorgane als das Weibchen, so kann es wohl sein, dass diese in ihrem vervollkommneten Zustand für das Männchen zum Finden des Weibchens unentbehrlich sind; aber in der ungeheuren Mehrzahl der Fälle dienen sie nur dazu, dem einen Männchen eine Überlegenheit über ein anderes zu geben. Denn die weniger gut ausgerüsteten Männchen werden, wenn ihnen Zeit gelassen wird, auch noch dazu kommen, sich mit den Weibchen zu paaren, und sie werden in allen übrigen Beziehungen, nach der Struktur des Weibchens zu urteilen, gleichmäßig ihrer gewöhnlichen Lebensweise gut angepasst sein. In derartigen Fällen muss geschlechtliche Zuchtwahl in Tätigkeit getreten sein. Denn die Männchen haben ihre jetzige Bildung nicht dadurch erreicht, dass sie zum Überleben in dem Kampf ums Dasein besser ausgerüstet sind, sondern dadurch, dass sie einen Vorteil über andere Männchen erlangt und diesen Vorteil nur auf ihre männlichen Nachkommen überliefert haben. Es war gerade die Bedeutung dieses Unterschieds, welche mich dazu führte, diese Form der Zuchtwahl als „geschlechtliche Zuchtwahl“ zu bezeichnen. Wenn ferner der hauptsächlichste Dienst, welchen die Greiforgane dem Männchen leisten, darin besteht, das Entschlüpfen des Weibchens noch vor der Ankunft anderer Männchen oder während des Angriffs von solchen zu verhüten, so werden diese Organe durch geschlechtliche Zuchtwahl vervollkommnet worden sein, d. h. durch den Vorteil, welchen gewisse Männchen über ihre Nebenbuhler erlangt haben. Es ist aber in den meisten derartigen Fällen unmöglich, zwischen den Wirkungen der natürlichen und der geschlechtlichen Zuchtwahl zu unterscheiden. Es ließen sich leicht ganze Kapitel mit Einzelheiten über die Verschiedenheiten zwischen den Geschlechtern in ihren Sinnes-, Lokomotions- und Greiforganen füllen. Da indessen diese Bildungen von nicht mehr Interesse als andere den gewöhnlichen Lebenszwecken angepasste sind, so will ich sie fast ganz übergehen und nur einige wenige Beispiele von jeder Klasse anführen.
Es gibt viele andere Bildungen und Instinkte, welche durch geschlechtliche Zuchtwahl entwickelt worden sein müssen, – so die Angriffswaffen und die Verteidigungsmittel, welche die Männchen zum Kampf mit ihren Nebenbuhlern und zum Zurücktreiben derselben besitzen – ihr Mut und ihre Kampflust, – ihre Ornamente verschiedener Art, – ihre Organe zur Hervorbringung von Vokal- und Instrumentalmusik – und ihre Drüsen zur Absonderung riechbarer Substanzen. Die meisten dieser letzteren Bildungen dienen nur dazu, das Weibchen anzulocken oder aufzuregen. Dass diese Auszeichnungen das Resultat geschlechtlicher und nicht gewöhnlicher Zuchtwahl sind, ist klar, da unbewaffnete, nicht mit Ornamenten verzierte oder keine besonderen Anziehungspunkte besitzende Männchen in dem Kampf um's Dasein gleichmäßig gut bestehen und eine zahlreiche Nachkommenschaft hinterlassen würden, wenn nicht besser begabte Männchen vorhanden wären. Wir dürfen schließen, dass dies der Fall sein würde; denn die Weibchen, welche ohne Waffen und Ornamente sind, sind doch imstande, leben zu bleiben und ihre Art fortzupflanzen. Sekundäre Geschlechtscharaktere von der eben erwähnten Art werden in den folgenden Kapiteln ausführlich erörtert werden, da sie in vielen Beziehungen von Interesse sind, aber ganz besonders, da sie von dem Willen, der Wahl und der Rivalität der Individuen jedes der beiden Geschlechter abhängen. Wenn wir zwei Männchen sehen, welche um den Besitz des Weibchens kämpfen, oder mehrere männliche Vögel, welche ihr stattliches Gefieder entfalten und die fremdartigsten Gesten vor einer versammelten Menge von Weibchen anstellen, so können wir nicht daran zweifeln, dass sie, wenn auch nur durch Instinkt dazu getrieben, doch wissen, was sie tun, und mit Bewusstsein ihre geistigen und körperlichen Kräfte anstrengen.
In derselben Art und Weise, wie der Mensch die Rasse seiner Kampfhähne durch die Zuchtwahl derjenigen Vögel verbessern kann, welche in den Hahnenkämpfen siegreich sind, so haben auch, wie es den Anschein hat, die stärksten und siegreichsten Männchen oder diejenigen, welche mit den besten Waffen versehen sind, im Naturzustande den Sieg davon getragen und haben zur Verbesserung der natürlichen Rasse oder Spezies geführt. Im Verlauf der wiederholten Kämpfe auf Tod und Leben wird ein geringer Grad von Variabilität, wenn derselbe nur zu irgendeinem Vorteile, wenn auch noch so unbedeutend, führt, zu der Wirksamkeit der geschlechtlichen Zuchtwahl genügen; und es ist sicher, dass sekundäre Sexualcharaktere außerordentlich variabel sind. In derselben Weise wie der Mensch je nach seiner Ansicht von Geschmack seinem männlichen Geflügel Schönheit geben oder, richtiger ausgedrückt, die ursprünglich von der elterlichen Spezies erlangte Schönheit modifizieren kann, – wie er den Sebright-Bantam-Hühnern ein neues und elegantes Gefieder, eine aufrechte und eigentümliche Haltung geben kann, – so haben auch allem Anscheine nach im Naturzustand die weiblichen Vögel die Schönheit oder andere anziehende Eigenschaften ihrer Männchen dadurch erhöht, dass sie lange Zeit hindurch die anziehenderen Männchen sich erwählt haben. Ohne Zweifel setzt dies ein Vermögen der Unterscheidung und des Geschmacks von Seiten des Weibchens voraus, welches auf den ersten Blick äußerst unwahrscheinlich erscheint; doch hoffe ich durch die später anzuführenden Tatsachen zu zeigen, dass die Weibchen faktisch dies Vermögen besitzen. Wenn indessen gesagt wird, dass die niederen Tiere einen Sinn für Schönheit haben, so darf nicht etwa vermutet werden, dass ein solcher Sinn mit dem eines kultivierten Menschen mit seinen vielgestaltigen und komplizierten assoziierten Ideen vergleichbar ist. Richtiger würde es sein, den Geschmack am Schönen bei Tieren mit dem bei den niedrigsten Wilden zu vergleichen, welche sich mit allen möglichen brillanten, glänzenden oder merkwürdigen Gegenständen bedecken und dies bewundern.
Nach unserer Unwissenheit in Bezug auf mehrere Punkte ist die genaue Art und Weise, in welcher geschlechtliche Zuchtwahl wirkt, etwas unsicher zu bestimmen. Wenn trotzdem diejenigen Naturforscher, welche bereits an die Veränderlichkeit der Arten glauben, die folgenden Kapitel lesen wollen, so werden sie, denke ich, mit mir darüber übereinstimmen, dass geschlechtliche Zuchtwahl in der Geschichte der organischen Welt eine bedeutende Rolle gespielt hat. Es ist sicher, dass bei fast allen Tieren ein Kampf zwischen den Männchen um den Besitz des Weibchens besteht. Diese Tatsache ist so notorisch, dass es überflüssig sein würde, hier Beispiele anzuführen. Es können daher die Weibchen unter der Voraussetzung, dass ihre geistigen Fähigkeiten für die Ausübung einer solchen Wahl hinreichen, eines von mehreren Männchen auswählen. In zahlreichen Fällen aber machen besondere Umstände den Kampf zwischen den Männchen besonders heftig. So kommen bei unseren Zugvögeln allgemein die Männchen vor den Weibchen auf den Brüteplätzen an, so dass viele Männchen bereit sind, um jedes einzelne Weibchen zu kämpfen. Die Vogelfänger behaupten, dass dies unabänderlich bei der Nachtigall und dem Plattmönche der Fall ist, wie mir Mr. Jenner Weir mitgeteilt hat, welcher die Angabe in Bezug auf die letztere Spezies selbst bestätigen kann.
Mr. Swaysland von Brighton, welcher während der letzten vierzig Jahre unsere Zugvögel bei ihrem ersten Eintreffen zu fangen pflegte, hat niemals die Erfahrung gemacht, dass die Weibchen irgendeiner Art vor ihren Männchen ankämen. Während eines Frühlings schoss er neununddreißig Männchen von Ray's Bachstelze (Budytes Raii), ehe er ein einziges Weibchen sah. Mr. Gould hat durch die Sektion der zuerst in England ankommenden Becassinen ermittelt, dass die männlichen Vögel vor den weiblichen ankommen. Dasselbe gilt für die meisten Zugvögel der Vereinigten Staaten. [J. A. Allen, On the Mammals and Winter Birds of East Florida, in: Bull. Mus. Comp. Zoology, Harvard Kollege. Vol. II, p. 268.] In der Periode, in welcher der Lachs in unseren Flüssen aufsteigt, ist die Majorität der Männchen vor den Weibchen zur Brut bereit. Allem Anschein nach ist dasselbe bei Fröschen und Kröten der Fall. In der ganzen großen Klasse der Insekten schlüpfen die Männchen fast immer vor dem anderen Geschlecht aus dem Puppenzustand aus, so dass sie meistens eine Zeit lang schwärmen, ehe irgendwelche Weibchen sichtbar sind. [Selbst bei denjenigen Pflanzen, bei denen die Geschlechter getrennt sind, werden die männlichen Blüten allgemein vor den weiblichen reif. Viele hermaphroditische Pflanzen sind, wie zuerst C. K. Sprengel gezeigt hat, dichogam, d. h. ihre männlichen und weiblichen Organe sind nicht zu derselben Zeit fortpflanzungsfähig, so dass sie sich nicht selbst befruchten können. In solchen Pflanzen ist nun allgemein der Pollen in derselben Blüte früher reif, als die Narbe, obschon einige exzeptionelle Fälle vorkommen, bei denen die weiblichen Organe vor den männlichen die Reife erlangen.] Die Ursache dieser Verschiedenheit zwischen der Periode der Ankunft der Männchen und der Weibchen und deren Reifeperiode ist hinreichend klar. Diejenigen Männchen, welche jährlich zuerst in ein Land einwandern oder welche im Frühjahr zuerst zur Brut bereit sind oder die eifrigsten sind, werden die größte Anzahl von Nachkommen hinterlassen, und diese werden ähnliche Instinkte und Konstitutionen zu vererben neigen. Man muss im Auge behalten, dass es unmöglich gewesen wäre, die Zeit der geschlechtlichen Reife bei den Weibchen wesentlich zu ändern, ohne gleichzeitig die Periode der Hervorbringung der Jungen zu stören – eine Periode, welche durch die Jahreszeiten bestimmt werden muss. Im Ganzen lässt sich nicht daran zweifeln, dass fast bei allen Tieren, bei denen die Geschlechter getrennt sind, ein beständig wiederkehrender Kampf zwischen den Männchen um den Besitz der Weibchen stattfindet.
Die Schwierigkeit in Bezug auf geschlechtliche Zuchtwahl liegt für uns darin, zu verstehen, wie es kommt, dass diejenigen Männchen, welche andere besiegen, oder diejenigen, welche sich als den Weibchen am meisten anziehend erweisen, eine größere Zahl von Nachkommen hinterlassen, um ihre Superiorität zu erben, als die besiegten und weniger anziehenden Männchen. Wenn dieses Resultat nicht erlangt wird, so können die Charaktere, welche gewissen Männchen einen Vorteil über andere verleihen, nicht durch geschlechtliche Zuchtwahl vervollkommnet und angehäuft werden. Wenn die Geschlechter in genau gleicher Anzahl existieren, so werden doch die am schlechtesten ausgerüsteten Männchen schließlich auch Weibchen finden (mit Ausnahme der Fälle, wo Polygamie herrscht) und dann ebenso viele und für ihre allgemeinen Lebensgewohnheiten gleichmäßig gut ausgerüstete Nachkommen hinterlassen wie die bestbegabten Männchen. Infolge verschiedener Tatsachen und Betrachtungen war ich früher zu dem Schluss gekommen, dass bei den meisten Tieren, bei denen sekundäre Sexualcharaktere gut entwickelt sind, die Männchen den Weibchen an Zahl beträchtlich überlegen sind; dies ist aber durchaus nicht immer richtig. Verhielten sich die Männchen zu den Weibchen wie zwei zu eins oder drei zu zwei oder selbst in einem noch etwas geringeren Verhältnisse, so würde die ganze Angelegenheit einfach sein. Denn die besser bewaffneten oder größere Anziehungskraft darbietenden Männchen würden die größte Zahl von Nachkommen hinterlassen. Nachdem ich aber, soweit es möglich ist, die numerischen Verhältnisse der Geschlechter untersucht habe, glaube ich nicht, dass irgendwelche bedeutende Ungleichheit der Zahl für gewöhnlich existiert. In den meisten Fällen scheint die geschlechtliche Zuchtwahl in der folgenden Art und Weise in Wirksamkeit gekommen zu sein.
Wir wollen irgendeine Spezies, z. B. einen Vogel, annehmen und die Weibchen, welche einen Bezirk bewohnen, in zwei gleiche Massen teilen; die eine bestehe aus den kräftigeren und besser genährten Individuen, die andere aus den weniger kräftigen und weniger gesunden. Es kann darüber kaum ein Zweifel bestehen, dass die ersteren im Frühjahr vor den letzteren zur Brut bereit sein werden; und das ist auch die Meinung von Mr. Jenner Weir, welcher viele Jahre hindurch die Lebensweise der Vögel aufmerksam beobachtet hat. Auch darüber kann kein Zweifel bestehen, dass die kräftigsten, am besten genährten und am frühesten brütenden Weibchen im Mittel es erreichen werden, die größte Zahl tüchtiger Nachkommen aufzuziehen. [Das Folgende ist ein ausgezeichnetes, von einem erfahrenen Ornithologen erwähntes Zeugnis von dem Charakter der Nachkommen. Mr. J. A. Allen spricht (Mammals and Winter Birds of East Florida, p. 229) von den späteren Bruten nach der zufälligen Zerstörung der ersten, und sagt, dass man diese „kleiner und blasser gefärbt finde, als die zeitiger in der Saison ausgebrüteten. In Fällen, wo mehrere Bruten in jedem Jahre erzogen werden, sind der allgemeinen Regel zufolge die Vögel der früheren Bruten in jeder Beziehung die vollkommensten und kräftigsten“.] Wie wir gesehen haben, sind allgemein die Männchen schon vor den Weibchen zum Fortpflanzungsgeschäft bereit; von den Männchen treiben nun die stärksten und bei einigen Spezies die am besten bewaffneten die schwächeren Männchen fort, und die ersteren werden sich dann mit den kräftigeren und am besten genährten Weibchen verbinden, da diese die ersten sind, welche zur Brut bereit sind. [Hermann Müller ist in Bezug auf diejenigen weiblichen Bienen, welche zuerst in jedem Jahre ausschlüpfen, zu demselben Schluss gelangt, s. seinen bemerkenswerten Aufsatz: „Anwendung der Darwin'schen Lehre auf Bienen“, in: Verhandl. d. naturhist. Ver. der preuß. Rheinl. XXIX. Jahrg., 1872, p. 45.] Derartige kräftige Paare werden sicher eine größere Zahl von Nachkommen aufziehen, als die zurückgebliebenen Weibchen, welche unter der Voraussetzung, dass die Geschlechter numerisch gleich sind, gezwungen werden, sich mit den besiegten und weniger kräftigen Männchen zu paaren; und hier findet sich denn alles, was nötig ist, um im Verlauf aufeinanderfolgender Generationen die Größe, Stärke und den Mut der Männchen zu erhöhen oder ihre Waffen zu verbessern.
Aber in einer großen Menge von Fällen gelangen die Männchen, welche andere Männchen besiegen, nicht unabhängig von einer Wahl seitens der Weibchen in den Besitz derselben. Die Bewerbung der Tiere ist durchaus keine so einfache und kurz abgemachte Angelegenheit, wie man wohl denken möchte. Die Weibchen werden durch die geschmückteren oder die sich als die besten Sänger zeigenden oder die am besten gesticulierenden Männchen am meisten angeregt oder ziehen vor, sich mit solchen zu paaren. Es ist aber offenbar wahrscheinlich, wie es auch in manchen Fällen faktisch beobachtet worden ist, dass diese Männchen in derselben Weise es auch vorziehen werden, sich mit den kräftigeren und lebendigeren Weibchen zu begatten. [Ich habe Mitteilungen in diesem Sinne in Bezug auf die Hühner erhalten, welche ich später noch erwähnen werde. Selbst bei solchen Vögeln, welche sich, wie der Tauber, für ihre Lebenszeit paaren, verlässt, wie ich von Mr. Jenner Weir höre, das Weibchen seinen Genossen, wenn er krank oder schwach wird.] Es werden daher die kräftigeren Weibchen, welche zuerst zum Brutgeschäft kommen, die Auswahl unter vielen Männchen haben; und wenn sie auch nicht immer die stärksten und am besten bewaffneten wählen werden, so werden sie sich doch diejenigen aussuchen, welche überhaupt kräftig und gut bewaffnet sind und in manchen anderen Beziehungen am meisten Anziehungskraft ausüben. Beide Geschlechter solcher zeitigen Paare werden daher beim Aufziehen von Nachkommen, wie oben auseinandergesetzt wurde, einen Vorteil über andere haben; und dies hat offenbar während eines langen Verlaufes aufeinander folgender Generationen hingereicht, nicht bloß die Stärke und das Kampfvermögen der Männchen zu erhöhen, sondern auch ihre verschiedenen Zieraten und andere Punkte der Anziehung reicher entwickeln zu lassen.
In dem umgekehrten und viel selteneren Fall, wo die Männchen besondere Weibchen auswählen, ist es klar, dass diejenigen, welche die kräftigsten sind und andere besiegt haben, die freieste Wahl haben; und es ist beinahe gewiss, dass sie ebensowohl kräftigere als mit gewissen Anziehungsreizen versehene Weibchen sich wählen werden. Derartige Paare werden bei der Erziehung von Nachkommen einen Vorteil haben, und dies wird noch besonders dann der Fall sein, wenn das Männchen die Kraft besitzt, das Weibchen während der Paarungszeit zu verteidigen, wie es bei einigen der höheren Tiere vorkommt, oder wenn es das Weibchen bei der Sorge um das Junge unterstützt. Dieselben Grundsätze werden gelten, wenn beide Geschlechter gegenseitig gewisse Individuen des anderen Geschlechts vorzogen und auswählten, unter der Voraussetzung allerdings, dass sie nicht bloß die mit größeren Reizen versehenen, sondern gleichzeitig auch die kräftigeren Individuen auswählten.
* * *
Numerisches Verhältnis der beiden Geschlechter. – Ich habe oben bemerkt, dass geschlechtliche Zuchtwahl eine einfache Angelegenheit wäre, wenn die Männchen den Weibchen an Zahl beträchtlich überlegen wären. Ich wurde hierdurch veranlasst, soweit ich es tun konnte, die proportionalen Zahlen beider Geschlechter bei so vielen Tieren wie nur möglich zu untersuchen; doch sind die Materialien nur dürftig. Ich will hier nur einen kurzen Abriss der Resultate geben und die Einzelheiten für eine anhangsweise Erörterung aufbewahren, um hier den Gang meiner Beweisführung nicht zu unterbrechen. Nur domestizierte Tiere bieten die Gelegenheit dar, die proportionalen Zahlen bei der Geburt festzustellen; es sind aber speziell für diesen Zweck keine Berichte abgefasst oder Listen etc. geführt worden. Indessen habe ich auf indirektem Wege eine beträchtliche Menge statistischer Angaben gesammelt, aus denen hervorgeht, dass bei den meisten unserer domestizierten Tiere die Geschlechter bei der Geburt nahezu gleich sind. So sind von Rennpferden während einundzwanzig Jahren 25.560 Geburten registriert worden, und die männlichen Geburten standen zu den weiblichen in dem Verhältnisse von 99,7:100. Bei Windspielen ist die Ungleichheit größer als bei irgendeinem anderen Tiere, denn während zwölf Jahren verhielten sich unter 6.878 Geburten die männlichen Geburten zu den weiblichen wie 110,1:100. Es ist indess in einem gewissen Grade zweifelhaft, ob man mit Sicherheit schließen darf, dass dieselben proportionalen Zahlen ebenso unter natürlichen Verhältnissen wie im Zustande der Domestikation auftreten würden; denn unbedeutende und unbekannte Verschiedenheiten in den Lebensbedingungen affizieren in einer gewissen Ausdehnung das Verhältnis der beiden Geschlechter zu einander. So verhalten sich in Bezug auf den Menschen die männlichen Geburten in England wie 104,5, in Russland wie 108,9 und bei den Juden in Livland wie 120 zu 100 weiblichen Geburten. Ich werde aber auf diesen merkwürdigen Punkt, den Excess männlicher Geburten, im Anhange zu diesem Kapitel zurückkommen. Am Kap der guten Hoffnung wurden indessen während mehrerer Jahre männliche Kinder europäischer Herkunft im Verhältnis von zwischen 90 und 99 zu 100 weiblichen geboren.
Für unseren gegenwärtigen Zweck haben wir es hier mit dem Verhältnisse der beiden Geschlechter nicht zur Zeit der Geburt, sondern zur Zeit der Reife zu tun, und dies bringt noch ein anderes Element des Zweifels mit sich. Denn es ist eine sicher bestätigte Tatsache, dass bei dem Menschen eine beträchtlich bedeutendere Zahl der männlichen Kinder vor oder während der Geburt und während der ersten wenigen Jahre der Kindheit stirbt als der weiblichen. Dasselbe ist fast sicher mit den männlichen Lämmern der Fall und dasselbe dürfte wahrscheinlich auch für die Männchen einiger anderen Tiere gelten. Die Männchen mancher Tiere töten einander in Kämpfen oder sie treiben einander herum, bis sie bedeutend abgemagert sind. Sie müssen auch, während sie im eifrigen Suchen nach Weibchen umherwandern, oft verschiedenen Gefahren ausgesetzt sein. Bei vielen Arten von Fischen sind die Männchen viel kleiner als die Weibchen und man glaubt, dass sie oft von den letzteren oder von anderen Fischen verschlungen werden. Bei manchen Vögeln scheint es, als ob die Weibchen zeitiger stürben als die Männchen; auch sind sie einer Zerstörung, während sie auf dem Nest sitzen oder während sie sich um ihre Jungen mühen, sehr ausgesetzt. Bei Insekten sind die weiblichen Larven oft größer als die männlichen und dürften infolgedessen wohl häufiger von anderen Tieren gefressen werden. In manchen Fällen sind die reifen Weibchen weniger lebendig und weniger schnell in ihren Bewegungen als die Männchen und werden daher nicht so gut imstande sein, den Gefahren zu entrinnen. Bei den Tieren im Naturzustand müssen wir uns daher, um uns über die Verhältnisse der Geschlechter im Reifezustand ein Urteil zu bilden, auf bloße Schätzung verlassen, und diese ist, vielleicht mit Ausnahme der Fälle, wo die Ungleichheit stark markiert ist, nur wenig zuverlässig. Soweit sich aber ein Urteil bilden lässt, können wir nichtsdestoweniger aus den im Anhange gegebenen Tatsachen schließen, dass die Männchen einiger weniger Säugetiere, vieler Vögel und einiger Fische und Insekten die Weibchen an Zahl beträchtlich übertreffen.
Das Verhältnis zwischen den Geschlechtern fluktuiert unbedeutend während aufeinanderfolgender Jahre. So variierte bei Rennpferden für je hundert geborener Weibchen die Zahl der Männchen von 107,1 in dem einen Jahre bis zu 92,6 in einem anderen Jahre, und bei Windspielen von 116,3 zu 95,3. Wären aber Zahlen aus einem noch ausgedehnteren Bezirk, als England ist, tabellarisch zusammengestellt worden, so würden wahrscheinlich diese Fluktuationen verschwunden sein, und so wie sie sind, dürften sie kaum genügen, um zur Wirksamkeit der geschlechtlichen Zuchtwahl im Naturzustande zu führen. Nichtsdestoweniger scheinen bei einigen wenigen wilden Tieren, wie im Anhang gezeigt werden wird, die Proportionen entweder während verschiedener Jahre oder in verschiedenen Örtlichkeiten in einem hinreichend bedeutenden Grade zu schwanken, um zu einer derartigen Wirksamkeit zu führen. Denn man muss beachten, dass irgendein Vorteil, der während gewisser Jahre oder in gewissen Örtlichkeiten von denjenigen Männchen erlangt wurde, welche imstande waren, andere Männchen zu besiegen, oder welche für die Weibchen die meiste Anziehungskraft besaßen, wahrscheinlich auf deren Nachkommen überliefert und später nicht wieder eliminiert werden würde. Wenn während der aufeinanderfolgenden Jahre infolge der gleichen Zahl der Geschlechter jedes Männchen überall imstande wäre, sich ein Weibchen zu verschaffen, so würden die kräftigeren oder anziehenderen Männchen, welche früher erzeugt wurden, doch immer noch mindestens ebensoviel Wahrscheinlichkeit haben, Nachkommen zu hinterlassen, als die weniger kräftigen und weniger anziehenden.
* * *
Polygamie. – Die Gewohnheit der Polygamie führt zu denselben Resultaten, welche aus einer faktischen Ungleichheit in der Zahl der Geschlechter sich ergeben würden. Denn wenn jedes Männchen sich zwei oder mehrere Weibchen verschafft, so werden viele Männchen nicht imstande sein, sich zu paaren; und zuverlässig werden diese letzteren die schwächeren oder weniger anziehenden Individuen sein. Viele Säugetiere und einige wenige Vögel sind polygam; bei Tieren indessen, welche zu den niederen Klassen gehören, habe ich keine Zeugnisse hierfür gefunden. Die intellektuellen Kräfte solcher Tiere sind vielleicht nicht hinreichend groß, um sie dazu zu führen, einen Harem von Weibchen um sich zu sammeln und zu bewachen. Dass irgendeine Beziehung zwischen Polygamie und der Entwicklung sekundärer Sexualcharaktere existiert, scheint ziemlich sicher zu sein; und dies unterstützt die Ansicht, dass ein numerisches Übergewicht der Männchen der Tätigkeit geschlechtlicher Zuchtwahl ganz außerordentlich günstig sein würde. Nichtsdestoweniger bieten viele Tiere, besonders Vögel, welche ganz streng monogam leben, scharf ausgesprochene sekundäre Sexualcharaktere dar, während andererseits einige wenige Tiere, welche polygam leben, nicht in dieser Weise ausgezeichnet sind.
Wir wollen zuerst schnell die Klasse der Säugetiere durchlaufen und uns dann zu den Vögeln wenden. Der Gorilla scheint polygam zu sein, und das Männchen weicht beträchtlich vom Weibchen ab. Dasselbe gilt für einige Paviane, welche in Herden leben, die zweimal so viele erwachsene Weibchen als Männchen enthalten. In Süd-Amerika bietet der Mycetes caraya gut ausgesprochene geschlechtliche Verschiedenheiten in der Färbung, dem Bart und den Stimmorganen dar; und das Männchen lebt meist mit zwei oder drei Weibchen. Das Männchen des Cebus kapucinus weicht etwas von dem Weibchen ab und scheint auch polygam zu sein. [Über den Gorilla s. Savage und Wyman in: Boston Journ. of Natur. Hist. Vol. V. 1845-47, p. 423. Über Cynozephalus s. Brehm, Illustriertes Tierleben. 2. Aufl. Bd. I. 1876, p. 159. Über Mycetes s. Rengger, Naturgesch. d. Säugetiere von Paraguay. 1830, p. 14, 20. Über Cebus s. Brehm, a. a. O. p. 201.] In Bezug auf die meisten anderen Affen ist über diesen Punkt nur wenig bekannt, aber manche Spezies sind streng monogam. Die Wiederkäuer sind ganz außerordentlich polygam und sie bieten häufiger geschlechtliche Verschiedenheiten dar als vielleicht irgendeine andere Gruppe von Säugetieren, besonders in ihren Waffen, aber gleichfalls in anderen Merkmalen. Die meisten hirschartigen, rinderartigen Tiere und Schafe sind polygam, wie es auch die meisten Antilopen sind, obgleich einige der letzteren monogam leben. Sir Anderew Smith erzählt von den Antilopen in Süd-Afrika und sagt, dass in Herden von ungefähr einem Dutzend selten mehr als ein reifes Männchen sich findet. Die asiatische Antilope Saiga scheint der ausschweifendste Polygamist in der Welt zu sein; denn Pallas [Pallas, Spicilegia zoologica Fascic. XII. 1777, p. 29. Sir Anderew Smith, Illustrations of the Zoology of South Africa. 1849, pl. 29 über den Kobus. Owen gibt in seiner Anatomy of Vertebrates, Vol. III, 1868, p. 633, eine Tabelle, welche unter Anderem auch zeigt, welche Arten von Antilopen in Herden leben.] gibt an, dass das Männchen sämtliche Nebenbuhler forttreibt und eine Herde von ungefähr hundert um sich sammelt, welche aus Weibchen und Kälbern besteht. Das Weibchen ist hornlos und hat weichere Haare, weicht aber in anderer Weise nicht viel vom Männchen ab. Das wilde Pferd der Falkland-Inseln und der westlichen Staaten von Nord-Amerika ist polygam; mit Ausnahme der bedeutenderen Größe und der Verhältnisse des Körpers weicht aber der Hengst nur wenig von der Stute ab. Der wilde Eber bietet in seinen großen Hauern und einigen anderen Charakteren scharf markierte sexuelle Merkmale dar. In Europa und in Indien führt er mit Ausnahme der Brunstzeit ein einsames Leben, aber um diese Zeit vergesellschaftet er sich in Indien mit mehreren Weibchen, wie Sir W. Elliot annimmt, welcher reiche Erfahrung in der Beobachtung dieses Tieres besitzt. Ob dies auch für den Eber in Europa gilt, ist zweifelhaft, doch wird es von einigen Angaben unterstützt. Der erwachsene männliche indische Elefant bringt, wie der Eber, einen großen Teil seiner Zeit in Einsamkeit hin; aber wenn er sich mit anderen Tieren zusammentut, so findet man, wie Dr. Campbell angibt, „selten mehr als ein Männchen mit einer großen Herde von Weibchen“. Die größeren Männchen treiben die kleineren und schwächeren fort oder töten sie. Das Männchen weicht vom Weibchen durch seine ungeheueren Stoßzähne und bedeutendere Größe, Kraft und Ausdauer ab. Die Verschiedenheit ist in dieser letzteren Beziehung so groß, dass die Männchen, wenn sie gefangen sind, um ein Fünftel höher geschätzt werden als die Weibchen. [Dr. Campbell in: Proceed. Zoolog. Soc. 1869, p. 138. s. auch einen interessanten Aufsatz von Lieutenant Johnstone in: Proceed. Asiatic. Soc. of Bengal, May, 1868.] Bei anderen pachydermen Tieren weichen die Geschlechter sehr wenig oder gar nicht voneinander ab, auch sind sie, soweit es bekannt ist, keine Polygamisten. Von keiner Spezies aus den Ordnungen der Chiroptern, Edentaten, Nagetiere und Insektenfresser habe ich gehört, dass sie polygam sei, mit Ausnahme der gemeinen Ratte unter den Nagern, von der, wie einige Rattenfänger versichern, die Männchen mit mehreren Weibchen leben. Nichtsdestoweniger weichen die beiden Geschlechter einiger Faultiere (Edentaten) in dem Charakter und der Farbe gewisser Gruppen von Haaren an den Schultern voneinander ab. [Dr. Gray in: Annals and Mag. of Nat. Hist. 1871. Vol. VII, p. 302.] Auch bieten viele Arten von Fledermäusen (Chiroptern) gut ausgesprochene geschlechtliche Verschiedenheiten dar, hauptsächlich in dem Umstand, dass die Männchen Riech-Drüsen und -Taschen besitzen und von hellerer Färbung sind. [s. Dr. Dobson's vortrefflichen Aufsatz in: Proceed. Zool. Soc. 1872, p. 214] In der großen Ordnung der Nager weichen, soweit ich es habe verfolgen können, die Geschlechter nur selten voneinander ab, und wenn sie es tun, ist es nur unbedeutend in der Färbung des Pelzes.
Wie ich von Sir Anderew Smith höre, lebt der Löwe in Süd-Afrika zuweilen mit einem einzigen Weibchen, meistens aber mit mehr als einem, und in einem Falle fand man, dass er sogar mit fünf Weibchen lebte, so dass er also polygam ist. Er ist, soweit ich ausfindig machen kann, der einzige Polygamist in der ganzen Gruppe der landbewohnenden Carnivoren und er allein bietet wohlausgesprochene Sexualcharaktere dar. Wenn wir uns indess zu den See-Carnivoren wenden, so stellt sich der Fall sehr verschieden, wie wir hernach sehen werden. Denn viele Spezies von Robben bieten außerordentliche sexuelle Verschiedenheiten dar, und sie sind in eminentem Grade polygam. So besitzt der männliche See-Elefant der Südsee nach der Angabe von Péron stets mehrere Weiber, und von dem See-Löwen von Forster sagt man, dass er von zwanzig bis dreißig Weibchen umgeben wird; im Norden begleitet den männlichen See-Bär von Steller selbst eine noch größere Zahl von Weibchen. Es ist eine interessante Tatsache, dass, wie Dr. Gill bemerkt, [The Eared Seals, in: Amerikan Naturalist. Vol. IV, Jan. 1871.] bei den monogamen Arten, „oder denen, welche in kleinen Gesellschaften leben, nur wenig Unterschied in der Größe zwischen den Männchen und Weibchen besteht; bei den sozialen Arten oder vielmehr bei solchen, bei denen die Männchen sich Harems halten, sind die Männchen ungeheuer viel größer als die Weibchen“.
Was die Vögel betrifft, so sind viele Spezies, in denen die Geschlechter bedeutend voneinander abweichen, sicher monogam. In Groß-Britannien sehen wir z. B. gut ausgesprochene Verschiedenheiten bei der wilden Ente, welche mit einem einzigen Weibchen sich paart, bei der gemeinen Amsel und beim Gimpel, von dem man sagt, dass er sich für's Leben paart. Dasselbe gilt, wie mir Mr. Wallace mitgeteilt hat, für die Cotingiden von Süd-Amerika und für viele andere Vögel. In mehreren Gruppen bin ich nicht imstande gewesen ausfindig zu machen, ob die Spezies polygam oder monogam leben. Lesson sagt, dass die Paradiesvögel, welche wegen ihrer geschlechtlichen Verschiedenheiten so merkwürdig sind, polygam leben; Mr. Wallace zweifelt aber, ob er für diesen Ausspruch hinreichende Belege gehabt hat. Mr. Salvin teilt mir mit, er werde zu der Annahme veranlasst, dass die Kolibris polygam leben. Der männliche Witwenvogel (Vidua), welcher wegen seiner Schwanzfedern so merkwürdig ist, scheint sicher ein Polygamist zu sein. [The Ibis. Vol. III. 1861, p. 133, über den Progne-Witwenvogel. s. auch über Vidua axillaris ebenda, Vol. II. 1860, p. 211. Über die Polygamie des Auerhahns und der großen Trappe s. L. Lloyd, Game Birds of Sweden. 1867, p. 19 und 182. Montagu und Selby sprechen vom Birkhuhn als einem polygamen, vom Schneehuhn als einem monogamen Vogel.] Mr. Jenner Weir und andere haben mir versichert, dass nicht selten drei Staare ein und dasselbe Nest frequentieren; ob dies aber ein Fall von Polygamie oder Polyandrie ist, ist nicht ermittelt worden.
Die hühnerartigen Vögel bieten fast ebenso scharf markierte geschlechtliche Verschiedenheiten dar wie die Paradiesvögel und Kolibris, und viele ihrer Arten sind bekanntlich polygam; andere dagegen leben in strikter Monogamie. Welchen Kontrast bieten die beiden Geschlechter des polygamen Pfauen oder Fasane und des monogamen Perlhuhns oder Rebhuhns dar! Es ließen sich viele ähnliche Fälle noch anführen, wie in der Gruppe der Waldhühner, bei denen die Männchen des polygamen Auerhuhns und des Birkhuhns bedeutend von den Weibchen abweichen, während die Geschlechter des monogamen Moor- und schottischen Schneehuhns nur sehr wenig voneinander verschieden sind. Unter den Laufvögeln bieten, wenn man die trappenartigen ausnimmt, nur wenig Spezies scharf markierte sexuelle Verschiedenheiten dar, und man sagt, dass die große Trappe (Otis tarda) polygam sei. Unter den Watvögeln weichen nur äußerst wenige Arten sexuell voneinander ab; aber der Kampfläufer (Machetes pugnax) bietet eine sehr auffallende Ausnahme dar und Montagu glaubt, dass diese Art polygam sei. Hiernach wird es daher ersichtlich, dass bei Vögeln oft eine nahe Beziehung zwischen Polygamie und der Entwicklung scharf markierter sexueller Verschiedenheiten besteht. Als ich Mr. Bartlett, welcher über Vögel so bedeutende Erfahrung besitzt, im zoologischen Garten frug, ob der männliche Tragopan (einer der Gallinaceen) polygam sei, überraschte mich seine Antwort: „Ich weiß es nicht, ich sollte es aber nach seinen glänzenden Farben wohl meinen“.
Es verdient Beachtung, dass der Instinkt der Paarung mit einem einzigen Weibchen im Zustand der Domestikation leicht verloren geht. Die wilde Ente ist streng monogam, die domestizierte Ente stark polygam. Mr. W. D. Fox teilt mir mit, dass bei einigen halb gezähmten Wildenten, welche auf einem großen Teich in seiner Nachbarschaft gehalten wurden, so viele Entriche von den Wildhütern geschossen wurden, dass nur einer für je sieben oder acht Weibchen übrig gelassen wurde, und doch wurden ganz ungewöhnlich große Bruten erzogen. Das Perlhuhn lebt in strikter Monogamie. Mr. Fox findet aber, dass dieser Vogel am besten fortkommt, wenn man auf zwei oder drei Hennen einen Hahn hält. Die Kanarienvögel paaren sich im Naturzustande; aber die Züchter in England bringen mit vielem Erfolge nur ein Männchen zu vier oder fünf Weibchen. Ich habe diese Fälle angeführt, da sie es wahrscheinlich machen, dass Arten, die im Naturzustand monogam sind, sehr leicht entweder zeitweise oder beständig polygam werden können.
In Bezug auf die Reptilien und Fische muss bemerkt werden, dass zu wenig von ihrer Lebensweise bekannt ist, um uns in den Stand zu setzen, von ihren Hochzeitsarrangements zu sprechen. Man sagt indess, dass der Stichling (Gasterosteus) ein Polygamist sei, [Noel Humphreys, River Gardens, 1857.] und das Männchen weicht während der Brütezeit auffallend vom Weibchen ab.
Fassen wir nun die Mittel zusammen, durch welche, soweit wir es beurteilen können, die geschlechtliche Zuchtwahl zur Entwicklung sekundärer Sexualcharaktere geführt hat. Es ist gezeigt worden, dass die größte Zahl kräftiger Nachkommen durch die Paarung der kräftigsten, der am besten bewaffneten und der, im Kampfe mit anderen, siegreichen Männchen mit den kräftigsten und am besten ernährten Weibchen, welche im Frühjahr zuerst zur Brut bereit sind, erzogen wird. Wenn sich derartige Weibchen die anziehenderen und gleichzeitig auch kräftigeren Männchen auswählen, so werden sie eine größere Zahl von Nachkommen aufbringen als die sich verspätenden Weibchen, welche sich mit den weniger kräftigen und weniger anziehenden Männchen paaren müssen. Dasselbe wird eintreten, wenn die kräftigeren Männchen die mit größerer Anziehungskraft versehenen und zu derselben Zeit gesünderen und kräftigeren Weibchen auswählen; und besonders wird dies gelten, wenn das Männchen das Weibchen verteidigt und es bei der Beschaffung von Nahrung für die Jungen unterstützt. Der in dieser Weise von den kräftigeren Paaren beim Aufziehen einer größeren Anzahl von Nachkommen erlangte Vorteil hat allem Anschein nach hingereicht, geschlechtliche Zuchtwahl in Tätigkeit treten zu lassen. Aber ein großes Übergewicht an Zahl seitens der Männchen über die Weibchen würde noch wirksamer sein: – mag das Übergewicht nur gelegentlich und lokal oder bleibend sein, mag es zur Zeit der Geburt oder später infolge der bedeutenderen Zerstörung der Weibchen eintreten, oder mag es indirekt ein Resultat eines polygamen Lebens sein.
Das Männchen allgemein mehr modifiziert als das Weibchen. – Wenn die beiden Geschlechter voneinander in der äußeren Erscheinung abweichen, so ist es durch das ganze Tierreich hindurch das Männchen, welches, mit seltenen Ausnahmen, hauptsächlich modifiziert worden ist; denn allgemein bleibt das Weibchen den Jungen seiner eigenen Spezies und ebenso auch anderen erwachsenen Gliedern derselben Gruppe ähnlicher. Die Ursache hiervon scheint darin zu liegen, dass die Männchen beinahe aller Tiere stärkere Leidenschaften haben als die Weibchen. Daher sind es die Männchen, welche miteinander kämpfen und eifrig ihre Reize vor den Weibchen entfalten; und diejenigen, welche siegreich aus solchen Wettstreiten hervorgehen, überliefern ihre Superiorität ihren männlichen Nachkommen. Warum die Männchen ihre Merkmale nicht auf beide Geschlechter vererben, wird hernach betrachtet werden. Dass die Männchen aller Säugetiere begierig die Weibchen verfolgen, ist allgemein bekannt. Dasselbe gilt für die Vögel. Aber viele männliche Vögel verfolgen nicht sowohl die Weibchen, als entfalten auch ihr Gefieder, führen fremdartige Gesten auf und lassen ihren Gesang erschallen in Gegenwart der Weibchen. Bei den wenigen Fischen, welche beobachtet worden sind, scheint das Männchen viel eifriger zu sein als das Weibchen; und dasselbe ist bei Alligatoren und, wie es scheint, auch bei Batrachiern der Fall. Durch die ungeheure Klasse der Insekten hindurch herrscht, wie Kirby bemerkt, [Kirby and Spence, Introduktion to Entomology. Vol. III. 1826, p. 342] „das Gesetz, dass das Männchen das Weibchen aufzusuchen hat“. Wie ich von zwei bedeutenden Autoritäten, Mr. Blackwall und Mr. C. Spence Bate, höre, sind unter den Spinnen und Crustaceen die Männchen lebendiger und in ihrer Lebensweise herumschweifender als die Weibchen. Wenn bei Insekten und Crustaceen die Sinnes- oder Lokomotionsorgane in dem einen Geschlecht vorhanden sind, in dem anderen dagegen fehlen, oder wenn sie, wie es häufig der Fall ist, in dem einen Geschlecht höher entwickelt sind als in dem anderen, so ist es beinahe unabänderlich, soweit ich es nachweisen kann, das Männchen, welches derartige Organe behalten oder dieselben am meisten entwickelt hat, und dies zeigt, dass das Männchen während der Bewerbung der beiden Geschlechter der tätigere Teil ist. [Ein parasitisches Insekt aus der Ordnung der Hymenopteren bietet (vgl. Westwood, Modern Classific. of Insekts. Vol. II, p. 160) eine Ausnahme von dieser Regel dar, da das Männchen rudimentäre Flügel hat und niemals die Zelle, in welcher es geboren wurde, verlässt, während das Weibchen gut entwickelte Flügel besitzt. Audouin glaubt, dass die Weibchen dieser Spezies von den Männchen befruchtet werden, welche mit ihnen in derselben Zelle geboren werden; es ist aber viel wahrscheinlicher, dass die Weibchen andere Zellen besuchen und dadurch nahe Inzucht vermeiden. Wir werden später einigen wenigen exzeptionellen Fällen aus verschiedenen Klassen begegnen, wo das Weibchen anstatt des Männchens der aufsuchende und werbende Teil ist.]
Das Weibchen ist andererseits mit sehr seltenen Ausnahmen weniger begierig als das Männchen. Wie der berühmte Hunter [Essays and Observations, edited bei Owen. Vol. I. 1861, p. 174.] schon vor langer Zeit bemerkte, verlangt es im Allgemeinen geworben zu werden; es ist spröde, und man kann oft sehen, dass es eine Zeit lang den Versuch macht, dem Männchen zu entrinnen. Jeder, der nur die Lebensweise von Tieren aufmerksam beobachtet hat, wird imstande sein, sich Beispiele dieser Art in's Gedächtnis zurückzurufen. Nach verschiedenen später mitzuteilenden Tatsachen zu urteilen und nach den Wirkungen, welche getrost der geschlechtlichen Zuchtwahl zugeschrieben werden können, übt das Weibchen, wenn auch vergleichsweise passiv, allgemein eine gewisse Wahl aus und nimmt ein Männchen im Vorzug vor anderen an. Oder wie die Erscheinungen uns zuweilen zu glauben veranlassen dürften: es nimmt nicht dasjenige Männchen, welches ihm das anziehendste war, sondern dasjenige, welches ihm am wenigsten zuwider war. Das Ausüben einer gewissen Wahl von Seiten des Weibchens scheint ein fast so allgemeines Gesetz wie die Begierde des Männchens zu sein.
Wir werden natürlich veranlasst, zu untersuchen, warum das Männchen in so vielen und so weit voneinander verschiedenen Klassen gieriger als das Weibchen geworden ist, so dass es das Weibchen aufsucht und den tätigeren Teil bei der ganzen Bewerbung darstellt. Es würde kein Vorteil und sogar etwas Verlust an Kraft sein, wenn beide Geschlechter gegenseitig einander suchen sollten. Warum soll aber fast immer das Männchen der suchende Teil sein? Bei Pflanzen müssen die Eier nach der Befruchtung eine Zeit lang ernährt werden, daher wird der Pollen notwendig zu den weiblichen Organen hingebracht, er wird auf die Narbe entweder durch die Tätigkeit der Insekten oder des Windes oder durch die eigenen Bewegungen der Staubfäden gebracht. Bei den Algen und anderen Pflanzen geschieht dies sogar durch die lokomotive Fähigkeit der Antherozoiden. Bei niedrig organisierten Tieren, welche beständig an einem und demselben Ort befestigt sind und getrennte Geschlechter haben, wird das männliche Element unabänderlich zum Weibchen gebracht, und wir können hiervon auch die Ursache einsehen; denn wenn die Eier selbst sich vor ihrer Befruchtung lösten und keiner späteren Ernährung oder Beschützung bedürften, so könnten sie wegen ihrer relativ bedeutenderen Größe weniger leicht transportiert werden als das männliche Element. Daher sind viele der niederen Tiere in dieser Beziehung den Pflanzen analog. [Prof. Sachs (Lehrbuch der Botanik, 1870, p. 633) bemerkt bei der Schilderung der männlichen und weiblichen reproduktiven Zellen: „es verhält sich die eine bei der Vereinigung aktiv, ... die andere erscheint bei der Vereinigung passiv“.] Da die Männchen fest angehefteter und im Wasser lebender Tiere dadurch veranlasst wurden, ihr befruchtendes Element auszustoßen, so ist es natürlich, dass diejenigen ihrer Nachkommen, welche sich in der Stufenleiter erhoben und die Fähigkeit der Ortsbewegung erlangten, dieselbe Gewohnheit beibehielten; sie werden sich den Weibchen so sehr als möglich nähern, um der Gefahr zu entgehen, dass das befruchtende Element während eines langen Weges durch das Wasser verloren geht. Bei einigen wenigen der niederen Tiere sind die Weibchen allein festgeheftet und in diesen Fällen müssen die Männchen der suchende Teil sein. In Bezug auf Formen, deren Urerzeuger ursprünglich freilebend waren, ist es aber schwer zu verstehen, warum unabänderlich die Männchen die Gewohnheit erlangt haben, sich den Weibchen zu nähern, anstatt von ihnen aufgesucht zu werden. In allen Fällen würde es indessen, damit die Männchen erfolgreich Suchende werden, notwendig sein, dass sie mit starken Leidenschaften begabt würden; die Erlangung solcher Leidenschaften würde eine natürliche Folge davon sein, dass die begierigeren Männchen eine größere Zahl von Nachkommen hinterließen, als die weniger begierigen.
Die größere Begierde des Männchens hat somit indirekt zu der viel häufigeren Entwicklung sekundärer Sexualcharaktere bei Männchen als beim Weibchen geführt. Aber die Entwicklung solcher Charaktere wird auch, wie ich nach einem langen Studium der domestizierten Tiere schließe, noch dadurch bedeutend unterstützt, dass das Männchen viel häufiger variiert als das Weibchen. Natusius, welcher eine sehr große Erfahrung hat, ist entschieden derselben Meinung. [Vorträge über Viehzucht. 1872, p. 63.] Einige gute Belege zugunsten dieser Schlussfolgerung kann man durch eine Vergleichung der beiden Geschlechter des Menschen erlangen. Während der Novara-Expedition [Reise der Novara: Anthropologischer Teil. 1867, p. 216, 269. Die Resultate wurden nach den von K. Scherzer und Schwarz angeführten Messungen berechnet von Dr. Weisbach. Über die größere Variabilität der Männchen bei domestizierten Tieren s. mein „Varieren der Tiere und Pflanzen im Zustande der Domestikation“. 2. Aufl. Bd. II, p. 85.] wurde eine ungeheure Zahl von Messungen der verschiedenen Körperteile bei verschiedenen Rassen angestellt; und dabei wurde gefunden, dass die Männer in beinahe allen Fällen eine größere Breite der Variation darboten als die Weiber. Ich werde aber auf diesen Gegenstand in einem späteren Kapitel zurückzukommen haben. Mr. J. Wood, [Proceedings of the Royal Society. Vol. XVI. July 1868, p. 519, 524.] welcher die Abänderungen der Muskeln beim Menschen sorgfältig verfolgt hat, druckt die Schlussfolgerung gesperrt, dass „die größte Zahl von Abnormitäten an einem einzelnen Leichnam bei den Männern gefunden wird“. Er hatte vorher bemerkt, dass „im Ganzen unter hundertundzwei Leichnamen die Varietäten mit überzähligen Bildungen ein halb Mal häufiger bei Männern vorkommen als bei Frauen, was sehr auffallend gegen die größere Häufigkeit von Varietäten mit Fehlen gewisser Teile bei Weibern kontrastiert, was vorhin besprochen wurde“. Professor Macalister bemerkt gleichfalls, [Proceed. Royal Irish Academy. Vol. X. 1868, p. 123.] dass Variationen in den Muskeln „wahrscheinlich bei Männern häufiger sind als bei Weibern“. Gewisse Muskeln, welche normal beim Menschen nicht vorhanden sind, finden sich auch häufiger beim männlichen Geschlechte entwickelt als beim weiblichen, obgleich man annimmt, dass Ausnahmen von dieser Regel vorkommen. Dr. Burt Wilder [Massachusetts Medical Society. Vol. II. No. 3. 1868, p. 9.] hat hundertzweiundfünfzig Fälle von der Entwicklung überzähliger Finger in Tabellen gebracht. Von diesen Individuen waren 86 männliche und 39, oder weniger als die Hälfte, weibliche, während die übrigbleibenden siebenundzwanzig in Bezug auf ihr Geschlecht unbekannt waren. Man darf indess nicht übersehen, dass Frauen häufiger wohl versuchen dürften, eine Missbildung dieser Art zu verheimlichen, als Männer. Ferner behauptet Dr. L. Meyer, dass die Ohren der Männer in der Form variabler sind als die der Frauen. [Virchow's Archiv. 1871, p. 488.] Endlich ist die Temperatur beim Mann variabler als bei der Frau. [Die Schlussfolgerungen, zu denen neuerdings Dr. Stockton Hough in Bezug auf die Temperatur des Menschen gelangt ist, sind mitgeteilt in: Popul. Science Review, 1. Jan. 1874, p. 97.]
Die Ursache der größeren allgemeinen Variabilität im männlichen als im weiblichen Geschlecht ist unbekannt, ausgenommen in so weit als sekundäre Geschlechtscharaktere außerordentlich variabel und gewöhnlich auf die Männchen beschränkt sind; wie wir sofort sehen werden, ist diese Tatsache bis zu einem gewissen Grade verständlich. Durch die Wirksamkeit der geschlechtlichen und der natürlichen Zuchtwahl sind männliche Tiere in vielen Fällen von ihren Weibchen sehr verschieden geworden; aber die beiden Geschlechter neigen auch, unabhängig von Zuchtwahl, infolge der Verschiedenheit der Konstitution dazu, in etwas verschiedener Weise zu variieren. Das Weibchen hat viele organische Substanz auf die Bildung seiner Eier zu verwenden, während das Männchen bedeutende Kraft aufwendet in den heftigen Kämpfen mit seinen Nebenbuhlern, im Umherwandern beim Aufsuchen des Weibchens, im Anstrengen seiner Stimme, in dem Erguss stark riechender Absonderungen usw.; auch wird dieser Aufwand gewöhnlich auf eine kurze Periode zusammengedrängt. Die bedeutende Kraft des Männchens während der Zeit der Liebe scheint häufig seine Färbung intensiver zu machen, unabhängig von irgendeinem auffallenden Unterschiede vom Weibchen. [Professor Mantegazza ist geneigt, anzunehmen (Lettera a Carlo Darwin, in: Archivio per l'Anthropologia, 1871, p. 306), dass die bei so vielen männlichen Tieren gewöhnlichen hellen Farben Folge der Gegenwart und Retention von Samenflüssigkeit bei ihnen sind; dies kann aber kaum der Fall sein; denn viele männliche Vögel, z. B. junge Fasanen, werden im Herbste ihres ersten Jahres hell gefärbt.] Beim Menschen und dann wieder so niedrig in der Stufenreihe, wie bei den Schmetterlingen, ist die Körpertemperatur beim Männchen höher als beim Weibchen, was den Menschen betrifft, in Verbindung mit einem langsameren Pulse. [In Bezug auf den Menschen s. Dr. J. Stockton Hough, dessen Folgerungen in der Popul. Science Review, 1874, p. 97 mitgeteilt sind. s. Girard's Beobachachtungen über Schmetterlinge, angeführt im Zoological Record, 1869, p. 347.] Im Großen und Ganzen ist der Aufwand an Substanz und Kraft bei beiden Geschlechtern wahrscheinlich nahezu gleich, wenngleich er auf verschiedene Weise und mit verschiedener Schnelligkeit bewirkt wird.
Es kann infolge der eben hier angeführten Ursachen kaum ausbleiben, dass die beiden Geschlechter, wenigstens während der Fortpflanzungszeit, etwas verschieden in der Konstitution sind; und obgleich sie genau den nämlichen Bedingungen ausgesetzt sein mögen, werden sie in etwas verschiedener Art zu variieren neigen. Wenn derartige Abänderungen von keinem Nutzen für eines der beiden Geschlechter sind, werden sie durch geschlechtliche oder natürliche Zuchtwahl nicht gehäuft und verstärkt werden. Nichtsdestoweniger können sie bleibend werden, wenn die erregende Ursache beständig wirkt; und in einer Übereinstimmung mit einer häufig vorkommenden Form der Vererbung können sie allein auf das Geschlecht überliefert werden, bei welchem sie zuerst auftraten. In diesem Fall gelangen die beiden Geschlechter dazu, permanente, indess bedeutungslose Verschiedenheiten der Charaktere darzubieten. Mr. Allen zeigt z. B., dass bei einer großen Anzahl von Vögeln, welche die nördlichen und südlichen Vereinigten Staaten bewohnen, die Exemplare aus dem Süden dunkler gefärbt sind, als die aus dem Norden; dies scheint das direkte Resultat der Verschiedenheiten zwischen den beiden Gegenden in Bezug auf Temperatur, Licht u. s. f. zu sein. In einigen wenigen Fällen scheinen nun die beiden Geschlechter einer und derselben Spezies verschieden affiziert worden zu sein: beim Agelaeus phoeniceus ist die Färbung der Männchen im Süden bedeutend intensiver geworden, während es beim Cardinalis virginianus die Weibchen sind, welche so affiziert worden sind. Bei Quiscalus major sind die Weibchen äußerst variabel in der Färbung geworden, während die Männchen nahezu gleichförmig bleiben. [J. A. Allen, On the Mammals and Winter Birds of East Florida, in: Bull. Mus. Comp. Zoology, Harvard Kollege. Vol. II, p. 234, 280, 295.]
In verschiedenen Klassen des Tierreichs kommen einige wenige ausnahmsweise Fälle vor, in welchen das Weibchen statt des Männchens gut ausgesprochene sekundäre Sexualcharaktere erlangt hat, wie z. B. glänzendere Farben, bedeutendere Größe, Kraft oder Kampflust. Bei Vögeln findet sich zuweilen eine vollständige Transposition der jedem Geschlecht gewöhnlich eigenen Charaktere; die Weibchen sind in ihren Bewerbungen viel gieriger geworden, die Männchen bleiben vergleichsweise passiv, wählen aber doch, wie es scheint und wie man nach den Resultaten wohl schließen darf, sich die anziehendsten Weibchen aus. Hierdurch sind gewisse weibliche Vögel lebhafter gefärbt oder in anderer Weise auffallender verziert, sowie kräftiger und kampflustiger geworden als die Männchen, und es werden dann auch diese Charaktere nur den weiblichen Nachkommen überliefert.
Man könnte vermuten, dass in einigen Fällen ein doppelter Vorgang der Zuchtwahl stattgefunden habe, dass nämlich die Männchen die anziehenderen Weibchen und die letzteren die anziehenderen Männchen sich ausgewählt haben. Doch würde dieser Prozess, wenn er auch zur Modifikation beider Geschlechter führen könnte, doch nicht das eine Geschlecht vom anderen verschieden machen, wenn nicht geradezu ihr Geschmack für das Schöne ein verschiedener wäre. Dies ist indess für alle Tiere, mit Ausnahme des Menschen, eine zu unwahrscheinliche Annahme, als dass sie der Betrachtung wert wäre. Es gibt jedoch viele Tiere, bei denen die Geschlechter einander ähnlich sind und bei denen beide mit denselben Ornamenten ausgerüstet sind, welche der Tätigkeit der geschlechtlichen Zuchtwahl zuzuschreiben uns wohl die Analogie veranlassen könnte. In solchen Fällen dürfte mit größerer Wahrscheinlichkeit vermutet werden, dass ein doppelter oder wechselseitiger Prozess geschlechtlicher Zuchtwahl eingetreten war. Die stärkeren und früher reifen Weibchen würden die anziehenderen und kräftigeren Männchen gewählt, und die letzteren alle Weibchen mit Ausnahme der anziehenderen zurückgewiesen haben. Nach dem aber, was wir von der Lebensweise der Tiere wissen, ist diese Ansicht kaum wahrscheinlich, da das Männchen allgemein begierig ist, sich mit irgendeinem Weibchen zu paaren. Es ist wahrscheinlicher, dass die, beiden Geschlechtern gemeinsam zukommenden Zierden von einem Geschlecht, und zwar im Allgemeinen dem männlichen, erlangt und dann den Nachkommen beider Geschlechter überliefert wurden. Wenn allerdings während einer langdauernden Periode die Männchen irgendeiner Spezies bedeutend die Weibchen an Zahl überträfen und dann während einer gleichfalls lange andauernden Periode unter verschiedenen Lebensbedingungen das Umgekehrte einträte, so könnte leicht ein doppelter, aber nicht gleichzeitiger Prozess der geschlechtlichen Zuchtwahl in Tätigkeit treten, durch welchen die beiden Geschlechter sehr voneinander verschieden gemacht werden könnten.
Wir werden später sehen, dass viele Tiere existieren, bei denen weder das eine noch das andere Geschlecht brillant gefärbt oder mit speziellen Zieraten versehen ist, und bei denen doch die Individuen beider Geschlechter oder nur des einen wahrscheinlich durch geschlechtliche Zuchtwahl einfache Farben, wie weiß oder schwarz, erlangt haben. Die Abwesenheit glänzender Farben oder anderer Zieraten kann das Resultat davon sein, dass Abänderungen der richtigen Art niemals vorgekommen sind oder dass die Tiere selbst einfache Farben, wie schlichtes Schwarz oder Weiß, vorgezogen haben. Düstere Farben sind oft durch natürliche Zuchtwahl zum Zweck des Schutzes erlangt worden, und die Entwicklung auffallender Farben durch geschlechtliche Zuchtwahl scheint durch die damit verbundene Gefahr zuweilen gehemmt worden zu sein. In anderen Fällen aber dürften die Männchen wahrscheinlich lange Zeit hindurch miteinander um den Besitz der Weibchen gekämpft haben; und doch wird keine Wirkung erreicht worden sein, wenn nicht von den erfolgreicheren Männchen eine größere Zahl von Nachkommen zur weiteren Vererbung ihrer Superiorität hinterlassen worden ist, als von den weniger erfolgreichen Männchen; und dies hängt, wie früher gezeigt wurde, von verschiedenen komplizierten Zufälligkeiten ab.
Geschlechtliche Zuchtwahl wirkt in einer weniger rigorosen Weise als natürliche Zuchtwahl. Die letztere erreicht ihre Wirkungen durch das Leben oder den Tod, auf allen Altersstufen, der mehr oder weniger erfolgreichen Individuen. In der Tat folgt zwar der Tod auch nicht selten dem Streit rivalisierender Männchen. Aber allgemein gelingt es nur dem weniger erfolgreichen Männchen nicht, sich ein Weibchen zu verschaffen, oder dasselbe erlangt später in der Jahreszeit ein übriggebliebenes und weniger kräftiges Weibchen, oder erlangt, wenn die Art polygam ist, weniger Weibchen, so dass es weniger oder minder kräftige oder gar keine Nachkommen hinterlässt. Was die Strukturverhältnisse betrifft, welche durch gewöhnliche oder natürliche Zuchtwahl erlangt werden, so findet sich in den meisten Fällen, solange die Lebensbedingungen dieselben bleiben, eine Grenze, bis zu welcher die vorteilhaften Modifikationen in Bezug auf gewisse spezielle Zwecke sich steigern können. Was aber die Strukturverhältnisse betrifft, welche dazu führen, das eine Männchen über das andere siegreich zu machen, sei es im direkten Kampfe oder im Gewinnen des Weibchens durch allerhand Reize, so findet sich für den Betrag vorteilhafter Modifikationen keine bestimmte Grenze, so dass die Arbeit der geschlechtlichen Zuchtwahl so lange fortgehen wird, als die gehörigen Abänderungen auftreten. Dieser Umstand kann zum Teil den häufigen und außerordentlichen Betrag von Variabilität erklären, welchen die sekundären Geschlechtscharaktere darbieten. Nichtsdestoweniger wird aber die natürliche Zuchtwahl immer entscheiden, dass die siegreichen Männchen keine Charaktere solcher Art erlangen, wenn dieselben für sie in irgend hohem Grade schädlich sein würden, sei es dass zu viel Lebenskraft auf dieselben verwendet würde, oder dass die Tiere dadurch irgend großen Gefahren ausgesetzt würden. Es ist indess die Entwicklung gewisser solcher Bildungen – z. B. des Geweihes bei manchen Hirscharten – bis zu einem wunderbaren Extreme geführt worden und in manchen Fällen bis zu einem Extreme, welches, soweit die allgemeinen Lebensbedingungen in Betracht kommen, für das Männchen von einem unbedeutenden Nachteile sein muss. Aus dieser Tatsache lernen wir, dass die Vorteile, welche die begünstigten Männchen aus dem Sieg über andere Männchen im Kampfe oder in der Bewerbung erlangt haben, wodurch sie auch in den Stand gesetzt wurden, eine zahlreichere Nachkommenschaft zu hinterlassen, auf die Länge bedeutender gewesen sind als diejenigen, welche aus einer vielleicht etwas vollkommeneren Anpassung an die äußeren Lebensbedingungen resultieren. Wir werden ferner sehen, und dies hätte sich niemals voraus erkennen lassen, dass das Vermögen, das Weibchen durch Reize zu fesseln, in einigen wenigen Fällen von größerer Bedeutung gewesen ist als das Vermögen andere Männchen im Kampf zu besiegen.
* * *
Gesetze der Vererbung
Um zu verstehen, in welcher Weise geschlechtliche Zuchtwahl gewirkt und im Laufe der Zeit in die Augen fallende Resultate bei vielen Tieren vieler Klassen hervorgebracht hat, ist es notwendig, die Gesetze der Vererbung, soweit dieselben bekannt sind, im Geiste gegenwärtig zu halten. Zwei verschiedene Elemente werden unter dem Ausdrucke „Vererbung“ begriffen, nämlich die Überlieferung und die Entwicklung von Besonderheiten. Da aber diese meistens Hand in Hand gehen, wird die Unterscheidung oft übersehen. Wir sehen diese Verschiedenheit an denjenigen Merkmalen, welche in den früheren Lebensjahren überliefert werden, welche aber erst zur Zeit der Reife oder während des höheren Alters entwickelt werden. Wir sehen denselben Unterschied noch deutlicher bei sekundären Sexualcharakteren; denn diese werden durch beide Geschlechter hindurch vererbt und doch nur in dem einen allein entwickelt. Dass sie in beiden Geschlechtern vorhanden sind, zeigt sich offenbar, wenn zwei Spezies, welche scharf markierte sexuelle Merkmale besitzen, gekreuzt werden. Denn eine jede überliefert die ihrem männlichen und weiblichen Geschlecht eigenen Charaktere auf die Bastardnachkommen beider Geschlechter. Dieselbe Tatsache wird offenbar, wenn Besonderheiten, welche dem Männchen eigen sind, gelegentlich beim Weibchen sich entwickeln, wenn dieses alt und krank wird, wie z. B., wenn die gemeine Haushenne die wallenden Schwanzfedern, die Sichelfedern, den Kamm, die Sporne, die Stimme und selbst die Kampflust des Hahns erhält. Dasselbe tritt auch umgekehrt bei kastrierten Männchen zutage. Ferner werden gelegentlich, und zwar unabhängig von hohem Alter oder Krankheit, Merkmale von dem Männchen auf das Weibchen übertragen: so z. B. wenn in gewissen Hühnerrassen Sporne regelmäßig bei den jungen und gesunden Weibchen auftreten. In Wahrheit haben sie sich aber nur einfach beim Weibchen entwickelt; denn in jeder Brut wird jedes Detail der Struktur des Spornes durch das Weibchen hindurch auf dessen männliche Nachkommen vererbt. Es werden später viele Fälle angeführt werden, wo das Weibchen mehr oder weniger vollkommen solche Charaktere darbietet, welche dem Männchen eigen sind, bei diesen zuerst entwickelt und dann auf das Weibchen überliefert worden sein müssen. Der umgekehrte Fall, dass sich Charaktere zuerst beim Weibchen entwickelt haben und diese dann auf das Männchen überliefert worden sind, ist weniger häufig, es dürfte daher gut sein, ein recht auffallendes Beispiel hierfür anzuführen. Bei Bienen wird der Pollen-sammelnde Apparat allein vom Weibchen zum Einsammeln des Pollens für die Larven benutzt, und doch ist er in den meisten Spezies teilweise auch bei den Männchen entwickelt, für welche er völlig nutzlos ist, und bei dem Männchen des Bombus, der Hummel, ist er vollkommen entwickelt. [H. Müller, Anwendung der Darwin'schen Lehre etc., in: Verhandl. d. nat. Ver. d. preuß. Rheinlande etc. XXIX. Jahrg. 1872, p. 42.] Da nicht ein einziges anderes Hymenopter, selbst nicht einmal die Wespe, welche so nahe mit der Biene verwandt ist, mit einem Pollen-sammelnden Apparat versehen ist, so haben wir keinen Grund, etwa zu vermuten, dass ursprünglich die männlichen Bienen ebensogut Pollen einsammelten wie die Weibchen, wenngleich wir einigen Grund haben, zu vermuten, dass ursprünglich männliche Säugetiere ihre Jungen ebensogut säugten wie die Weibchen. In allen Fällen von Rückschlag endlich werden Charaktere durch zwei, drei oder viele Generationen hindurch vererbt und dann unter gewissen unbekannten günstigen Bedingungen entwickelt. Diese bedeutungsvolle Unterscheidung zwischen Überlieferung und Entwicklung wird am leichtesten im Sinne behalten werden mit Hilfe der Hypothese der Pangenesis. Dieser Hypothese zufolge stößt jede Einheit oder Zelle des Körpers Keimchen oder unentwickelte Atome ab, welche den Nachkommen beider Geschlechter überliefert werden und sich durch Selbstteilung vervielfältigen. Sie können während der früheren Lebensjahre oder während aufeinanderfolgender Generationen unentwickelt bleiben; ihre Entwicklung zu kleinsten Einheiten oder Zellen, die denen gleichen, von welchen sie selbst herrühren, hängt von ihrer Verwandtschaft oder Vereinigung mit anderen Einheiten oder Zellen ab, die sich vor ihnen im gesetzmäßigen Verlaufe des Wachstums entwickelt haben.
* * *
Vererbung auf entsprechenden Perioden des Lebens. – Die Neigung hierzu ist eine sicher ermittelte Tatsache. Wenn ein neues Merkmal an einem Tier auftritt, so lange es jung ist, mag dasselbe nun während des ganzen Lebens bestehen bleiben oder nur eine Zeit lang währen, so wird es der allgemeinen Regel nach in demselben Alter auch bei den Nachkommen wiedererscheinen und die gleiche Zeitdauer bestehen bleiben. Wenn auf der anderen Seite ein neuer Charakter im Alter der Reife erscheint oder selbst während des hohen Alters, so neigt er dazu, bei den Nachkommen in demselben vorgeschrittenen Alter wiederzuerscheinen. Treten Abweichungen von dieser Regel auf, so erscheinen die überlieferten Charaktere viel häufiger vor als nach dem entprechenden Alter. Da ich diesen Gegenstand mit hinreichender Ausführlichkeit in einem anderen Werke [Das Varieren der Tiere und Pflanzen im Zustande der Domestikation. 2. Aufl. Bd. II, p. 86. In dem vorletzten Kapitel desselben Bandes ist die oben erwähnte provisorische Hypothese der Pangenesis ausführlich erörtert worden.] erörtert habe, so will ich hier nur zwei oder drei Beispiele anführen, um den Gegenstand in das Gedächtnis des Lesers zurückzurufen. Bei mehreren Hühnerrassen weichen die Hühnchen, während sie noch mit dem Dunenkleid bedeckt sind, die jungen Vögel in ihrem ersten wirklichen Gefieder und dann auch die erwachsenen in ihrem Federkleid bedeutend voneinander, ebenso wie von ihrer gemeinsamen elterlichen Form, dem Gallus bankiva, ab; und diese Eigentümlichkeiten werden von jeder Zucht ihren Nachkommen zu den entsprechenden Lebensaltern treu überliefert. So haben z. B. die Hühnchen der geflitterten (spangled) Hamburger, so lange sie mit Dunen bekleidet sind, einige wenige dunkle Flecken auf dem Kopf und am Rumpf, sind aber nicht längsweise gestreift, wie in vielen anderen Zuchten; in ihrem ersten wirklichen Gefieder sind sie „wundervoll gestrichelt“, d. h. jede Feder ist von zahlreichen dunklen Strichen quer gezeichnet; aber in ihrem zweiten Gefieder werden die Federn alle geflittert, d. h. erhalten einen dunklen runden Fleck an der Spitze. [Diese Tatsachen sind nach der hohen Autorität eines großen Züchters, Mr. Teebay, in Tegetmeier's Poultry Book, 1868, p. 158 mitgeteilt. Über die Charaktere von Hühnchen verschiedener Rassen und über die Rassen der Tauben, welche oben erwähnt werden, s. das Varieren der Tiere und Pflanzen usw. 2. Aufl. Bd. I, p. 179, 277; Bd. II, p. 88.] Es sind daher in dieser Zucht in drei verschiedenen Lebensperioden Abänderungen aufgetreten und sind dann auf diese wieder überliefert worden. Die Taube bietet einen noch merkwürdigeren Fall dar, da die ursprüngliche elterliche Spezies mit Vorschreiten des Alters keine Veränderung des Gefieders erleidet, ausgenommen, dass zur Zeit der Reife die Brust mehr iridesziert. Und doch gibt es Rassen, welche ihre charakteristischen Farben nicht eher erlangen, als bis sie sich zwei-, drei- oder viermal gemausert haben; und diese Modifikationen des Gefieders werden regelmäßig vererbt.
* * *
Vererbung zu entsprechenden Jahreszeiten. – Bei Tieren im Naturzustand kommen zahllose Beispiele vor, dass Merkmale zu verschiedenen Zeiten des Jahres periodisch erscheinen. Wir sehen dies an dem Geweih der Hirsche und dem Pelzwerk arktischer Tiere, welches während des Winters dick und weiß wird. Zahlreiche Vögel erlangen allein während der Brutzeit glänzende Farben und andere Zierden. Pallas gibt an, [Novae Spezies Quadrupedum e Glirium ordine. 1778, p. 7. Über die Vererbung der Farbe bei Pferden s. das Varieren der Tiere und Pflanzen im Zustande der Domestikation. 2. Aufl. Bd. I, p. 56. Vergl. auch in demselben Buch Bd. II, p. 82 eine allgemeine Erörterung über die durch das Geschlecht beschränkte Vererbung.] dass in Sibirien die domestizierten Rinder und Pferde während des Winters heller gefärbt werden, und ich habe selbst eine ähnliche auffallende Veränderung der Farbe, d. h. von einer bräunlichen Rahmfarbe oder einem Rotbraun bis zum vollkommenen Weiß bei mehreren Ponies in England beobachtet. Obgleich ich nicht weiß, ob diese Neigung, ein verschieden gefärbtes Kleid während verschiedener Jahreszeiten anzunehmen, vererbt wird, so ist dies doch wahrscheinlich der Fall, da alle Farbenschattierungen vom Pferd streng vererbt werden. Auch ist diese durch die Jahreszeit bestimmte Vererbung nicht merkwürdiger als eine durch Alter oder Geschlecht beschränkte.
* * *
Vererbung durch das Geschlecht beschränkt. – Die gleichmäßige Überlieferung von besonderen Merkmalen auf beide Geschlechter ist die häufigste Form der Vererbung, wenigstens bei denjenigen Tieren, welche keine stark markierten geschlechtlichen Verschiedenheiten darbieten und in der Tat auch bei vielen mit solchen. Es werden aber ziemlich allgemein Besonderheiten ausschließlich auf dasjenige Geschlecht vererbt, bei welchem sie zuerst erschienen. Hinreichende Belege über diesen Punkt sind in meinem Werk über das „Varieren der Tiere und Pflanzen im Zustand der Domestikation“ mitgeteilt worden; ich will aber auch hier ein paar Beispiele anführen. Es gibt Rassen vom Schaf und der Ziege, bei denen die Hörner des Männchens bedeutend in der Form von denen des Weibchens abweichen; und diese im Zustand der Domestikation erlangten Verschiedenheiten werden regelmäßig auf dasselbe Geschlecht wieder überliefert. Bei weiß, braun und schwarz gefleckten (tortoise-shell) Katzen sind der allgemeinen Regel zufolge nur die Weibchen so gefärbt, wogegen die Männchen rostrot sind. Bei den meisten Hühnerrassen werden die jedem Geschlecht eigenen Merkmale nur auf dieses selbe Geschlecht vererbt. Diese Form der Überlieferung ist so allgemein, dass es eine Anomalie ist, wenn wir bei gewissen Rassen Abänderungen gleichmäßig auf beide Geschlechter vererbt sehen. So gibt es auch gewisse Unterrassen von Hühnern, bei welchen die Männchen kaum voneinander unterschieden werden können, während die Weibchen beträchtlich in der Färbung abweichen. Bei der Taube sind die Geschlechter der elterlichen Spezies in keinem äußeren Merkmal voneinander verschieden; nichtsdestoweniger ist bei gewissen domestizierten Rassen das Männchen vom Weibchen verschieden gefärbt. [Dr. Chapuis, Le Pigeon Voyageur Belge. 1865, p. 87. Boitard et Corbié, Les Pigeons de Volière etc. 1824, p. 173. s. auch in Bezug auf ähnliche Verschiedenheiten bei gewissen Rassen in Modena: „Le variazioni dei Colombi domestici“, del Paolo Bonizzi, 1873.] Die Fleischlappen bei der englischen Botentaube und der Kropf bei der Kropftaube sind beim Männchen stärker entwickelt als beim Weibchen; und obschon diese Eigentümlichkeiten durch lange fortgesetzte Zuchtwahl seitens des Menschen erlangt worden sind, so ist doch die geringe Verschiedenheit zwischen den beiden Geschlechtern gänzlich Folge der Form von Vererbung, welche hier geherrscht hat. Denn sie sind nicht infolge der Wünsche des Züchters, sondern eher gegen diese Wünsche aufgetreten.
Die meisten unserer domestizierten Rassen sind durch die Anhäufung vieler unbedeutender Abänderungen gebildet worden; und da einige der aufeinanderfolgenden Stufen nur auf ein Geschlecht, einige auf beide Geschlechter überliefert worden sind, so finden wir in den verschiedenen Rassen einer und derselben Spezies alle Abstufungen zwischen bedeutender sexueller Verschiedenheit und vollständiger Ähnlichkeit. Es sind bereits Beispiele angeführt worden von den Rassen des Huhns und der Taube, und im Naturzustand sind analoge Fälle von häufigem Vorkommen. Bei Tieren im Zustand der Domestikation, – ob aber auch im Naturzustand, will ich nicht zu sagen wagen, – kann das eine Geschlecht ihm eigentümliche Charaktere verlieren und hierdurch dazu kommen, dass es in einem gewissen Grad dem anderen Geschlechte ähnlich wird; z. B. haben die Männchen einiger Hühnerrassen ihre männlichen Schwanz- und Sichelfedern verloren. Auf der anderen Seite können aber auch die Verschiedenheiten zwischen den Geschlechtern im Zustand der Domestikation erhöht werden, wie es beim Merinoschafe der Fall ist, wo die Mutterschafe die Hörner verloren haben. Ferner können Merkmale, welche dem einen Geschlechte eigen sind, plötzlich beim anderen erscheinen, wie es bei denjenigen Unterrassen des Huhns der Fall ist, bei denen die Hennen, während sie noch jung sind, Sporne erhalten, oder, wie es bei gewissen Unterrassen der polnischen Hühner sich findet, bei denen, wie man wohl anzunehmen Grund hat, ursprünglich zuerst die Weibchen eine Federkrone erhielten und sie später auf die Männchen vererbten. Alle diese Fälle sind unter Annahme der Hypothese der Pangenesis verständlich; denn sie hängen davon ab, dass die Keimchen gewisser Teile des Körpers, trotzdem sie in beiden Geschlechtern vorhanden sind, doch durch den Einfluss der Domestikation entweder ruhend erhalten oder zur Entwicklung gebracht werden.
Es findet sich hier noch eine schwierige Frage, welche passender auf ein späteres Kapitel verschoben werden mag, nämlich ob eine ursprünglich in beiden Geschlechtern entwickelte Eigentümlichkeit durch Zuchtwahl in ihrer Entwicklung auf ein Geschlecht allein beschränkt werden kann. Wenn z. B. ein Züchter beobachtete, dass einige seiner Tauben (bei welcher Spezies Merkmale gewöhnlich in gleichem Grad auf beide Geschlechter überliefert werden) in ein blasses Blau variierten, kann er dann durch lange fortgesetzte Zuchtwahl eine Rasse erziehen, bei welcher nur die Männchen von dieser Färbung sind, während die Weibchen unverändert bleiben? Ich will hier nur bemerken, dass dies äußerst schwierig sein dürfte, wenn es auch vielleicht nicht unmöglich ist. Denn das natürliche Resultat eines Weiterzüchtens von den blassblauen Männchen würde das sein, seinen ganzen Stamm mit Einschluss beider Geschlechter in diese Färbung hinüberzuführen. Wenn indessen Abänderungen der bewussten Färbung aufträten, welche vom Anfang an in ihrer Entwicklung auf das männliche Geschlecht beschränkt wären, so würde nicht die mindeste Schwierigkeit vorliegen, eine Rasse zu bilden, welche dadurch charakterisiert ist, dass beide Geschlechter eine verschiedene Färbung zeigen, wie es in der Tat mit einer belgischen Rasse erreicht worden ist, bei welcher nur die Männchen schwarz gestreift sind. Wenn in einer ähnlichen Weise irgendeine Abänderung bei einer weiblichen Taube aufträte, welche vom Anfang an in ihrer Entwicklung auf die Weibchen beschränkt wäre, so würde es leicht sein, eine Rasse zu erziehen, bei welcher nur die Weibchen in dieser Weise charakterisiert wären. Wäre aber die Abänderung nicht ursprünglich in dieser Weise beschränkt gewesen, so würde der Prozess äußerst schwierig, vielleicht unmöglich sein. [Es gereicht mir zur großen Genugtuung, seit Veröffentlichung der ersten Auflage des vorliegenden Werkes die folgenden Bemerkungen eines sehr erfahrenen Züchters, des Mr. Tegetmeier, zu finden (the „Field“, Sept. 1872). Nachdem er einige merkwürdige Fälle von Überlieferung der Färbung nur auf ein Geschlecht und der Bildung einer Unterrasse mit diesem Merkmale bei Tauben beschrieben hat, sagt er: „Es ist ein eigentümlicher Umstand, dass Mr. Darwin die Möglichkeit einer Modifikation der geschlechtlichen Färbung bei Vögeln durch eine Methode künstlicher Zuchtwahl ausgesprochen hat. Als er dies tat, kannte er die von mir mitgeteilten Fälle nicht; es ist aber merkwürdig, wie außerordentlich nahe er in seiner Vermutung der richtigen Methode des Züchtens gekommen ist“.]
* * *
Über die Beziehung zwischen der Periode der Entwicklung eines Merkmals und seiner Überlieferung auf ein Geschlecht oder auf beide. – Warum gewisse Merkmale von beiden Geschlechtern, andere nur von einem Geschlecht, nämlich von demjenigen, bei welchem die Besonderheit zuerst auftrat, geerbt werden, ist in den meisten Fällen völlig unbekannt. Wir können nicht einmal eine Vermutung aufstellen, warum bei gewissen Unterrassen der Taube schwarze Streifen, trotzdem sie durch das Weibchen zur Vererbung gelangen, sich nur beim Männchen entwickeln, während jedes andere Merkmal gleichmäßig auf beide Geschlechter überliefert wird; warum ferner bei Katzen die schwarz, braun und weiße Färbung (tortoise-shell) mit seltenen Ausnahmen nur bei den Weibchen sich entwickelt. Ein und dieselbe Eigentümlichkeit, wie fehlende und überzählige Finger, Farbenblindheit usw. kann beim Menschen nur von den männlichen Gliedern einer Familie und in einer anderen Familie nur von den weiblichen geerbt werden, trotzdem sie in beiden Fällen ebenso gut durch das entgegengesetzte wie durch das gleichnamige Geschlecht überliefert wird. [Verweisungen sind gegeben in meinem „Varieren der Tiere und Pflanzen im Zustande der Domestikation“. 2. Aufl. Bd. II, p. 82.] Obgleich wir uns hiernach in Unwissenheit befinden, so scheinen doch häufig zwei Regeln zu gelten; nämlich, dass Abänderungen, welche zuerst in einem von beiden Geschlechtern in einer späteren Lebenszeit auftreten, sich bei demselben Geschlechte zu entwickeln neigen, während Abänderungen, welche zeitig im Leben in einem der beiden Geschlechter zuerst auftreten, zu einer Entwicklung in beiden Geschlechtern neigen. Ich bin indessen durchaus nicht der Meinung, hierin die einzige bestimmende Ursache zu erblicken. Da ich nirgends anders diesen Gegenstand erörtert habe und er eine bedeutende Tragweite in Bezug auf geschlechtliche Zuchtwahl hat, so muss ich hier in ausführliche und etwas intrikate Einzelheiten eingehen.
Es ist an sich wahrscheinlich, dass irgendeine Besonderheit, welche in frühem Alter auftritt, zu einer gleichmäßig auf beide Geschlechter stattfindenden Vererbung neigt. Denn die Geschlechter weichen der Konstitution nach nicht sehr voneinander ab, ehe das Reproduktionsvermögen von ihnen erlangt worden ist. Ist auf der anderen Seite dieses Vermögen eingetreten und haben die Geschlechter begonnen, ihrer Konstitution nach voneinander abzuweichen, so werden die Keimchen (wenn ich mich auch hier der Sprechweise der Hypothese der Pangenesis bedienen darf), welche von jedem variierenden Teile in dem einen Geschlecht abgestoßen werden, viel wahrscheinlicher die gehörigen Wahlverwandtschaften besitzen, um sich mit den Geweben des gleichnamigen Geschlechts zu verbinden und sich demzufolge zu entwickeln, als mit denjenigen des anderen Geschlechts.
Zu der Annahme, dass eine Beziehung dieser Art existiere, wurde ich zuerst durch die Tatsache geführt, dass, sobald nur immer in irgendwelcher Weise das erwachsene Männchen von dem erwachsenen Weibchen verschieden geworden ist, das erstere in derselben Weise auch von den Jungen beider Geschlechter verschieden ist. Die Allgemeinheit dieser Tatsache ist durchaus merkwürdig. Sie gilt für beinahe alle Säugetiere, Vögel, Amphibien und Fische, auch für viele Crustaceen, Spinnen und einige wenige Insekten, nämlich gewisse Orthopteren und Libellen. In allen diesen Fällen müssen die Abänderungen, durch deren Anhäufung das Männchen seine eigentümlichen männlichen Merkmale erlangt hat, in einer etwas späten Periode des Lebens eingetreten sein, sonst würden die jungen Männchen ähnlich ausgezeichnet worden sein; und in Übereinstimmung mit unserem Gesetze werden sie nur auf erwachsene Männchen vererbt und entwickeln sich nur bei diesen. Wenn andererseits das erwachsene Männchen den Jungen beider Geschlechter sehr ähnlich ist (wobei diese mit seltenen Ausnahmen einander gleich sind), so ist es meist auch dem erwachsenen Weibchen ähnlich; und in den meisten dieser Fälle treten die Abänderungen, durch welche das junge und alte Tier ihre gegenwärtigen Merkmale erlangten, wahrscheinlich in Übereinstimmung mit unserer Regel während der Jugend auf. Hier kann man aber wohl zweifeln, denn zuweilen werden die Besonderheiten auf die Nachkommen in einem früheren Alter vererbt als in dem, in welchem sie zuerst bei den Eltern erscheinen, so dass die Eltern sich änderten, als sie erwachsen waren, und ihre Eigentümlichkeiten dann auf die Nachkommen vererbt haben können, während diese jung waren. Überdies gibt es viele Tiere, bei denen die beiden Geschlechter einander sehr ähnlich und doch von ihren Jungen verschieden sind; und hier müssen die Merkmale der Erwachsenen spät im Leben erlangt worden sein; trotzdem werden diese Merkmale in scheinbarem Widerspruch gegen unser Gesetz auf beide Geschlechter vererbt. Wir dürfen indessen die Möglichkeit oder selbst Wahrscheinlichkeit nicht übersehen, dass Abänderungen der nämlichen Natur zuweilen gleichzeitig und in gleicher Weise bei beiden Geschlechtern, wenn sie ähnlichen Bedingungen ausgesetzt sind, zu einer im Ganzen späteren Periode des Lebens auftreten; und in diesem Falle werden die Abänderungen auf die Nachkommen beider Geschlechter in einem entsprechenden späten Lebensalter vererbt. Hier würde denn kein wirklicher Widerspruch gegen unsere Regel eintreten, dass die Abänderungen, welche spät im Leben auftreten, ausschließlich auf das Geschlecht vererbt werden, bei dem sie zuerst erscheinen. Dieses letztere Gesetz scheint noch allgemeiner zu gelten als das andere, dass nämlich Abänderungen, welche in einem der beiden Geschlechter früh im Leben auftreten, zu einer Vererbung auf beide Geschlechter neigen. Da es offenbar unmöglich war, auch nur annäherungsweise zu schätzen, in einer wie großen Anzahl von Fällen durch das ganze Tierreich hindurch diese beiden Sätze Gültigkeit haben, so kam ich auf den Gedanken, einige auffallende und entscheidende Beispiele zu untersuchen und mich auf das aus ihnen erhaltene Resultat zu verlassen.
Einen ausgezeichneten Fall bietet für diese Untersuchung die Familie der hirschartigen Tiere dar. Bei sämtlichen Arten, mit Ausnahme einer einzigen, entwickelt sich das Geweih nur beim Männchen, trotzdem es ganz sicher durch das Weibchen überliefert wird und auch wohl imstande ist, sich gelegentlich abnormer Weise bei diesem zu entwickeln. Andererseits ist beim Rentier das Weibchen mit einem Geweihe versehen, so dass bei dieser Art das Geweih entsprechend unserem Gesetze zeitig im Leben auftreten müsste, lange bevor die beiden Geschlechter zur Reife gelangen und in ihrer Konstitution sehr auseinander gehen. Bei allen den anderen Arten der Hirsche müsste das Geweih später im Leben auftreten und infolge hiervon nur bei demjenigen Geschlechte zur Entwicklung gelangen, bei dem es zuerst am Urerzeuger der ganzen Familie erschien. Ich finde nun bei sieben zu verschiedenen Sektionen der Familie gehörigen und verschiedene Gegenden bewohnenden Spezies, bei welchen nur die Männchen Geweihe tragen, dass das Geweih zuerst in einer Zeit erscheint, welche von neun Monaten nach der Geburt, und dies beim Rehbock, bis zu zehn oder zwölf oder selbst noch mehr Monaten nach derselben variiert, letzteres bei den Hirschen der sechs anderen größeren Spezies. [Ich bin Herrn Cupples sehr verbunden, welcher von Mr. Robertson, dem erfahrenen Oberwildwart des Marquis of Breadalbane, Erkundigungen über den Rehbock und den Hirsch in Schottland für mich eingezogen hat. In Bezug auf den Damhirsch bin ich Mr. Eyton und anderen für Mitteilungen zu Dank verpflichtet. Wegen des Cervus alces von Nord-Amerika s. Land and Water, 1868, p. 221 u. 254. und wegen Cervus virginianus und strongylocerus desselben Kontinents s. J. D. Caton in: Ottawa Acad. of Natur. Science. 1868, p. 13. Wegen des Cervus Eldi von Pegu s. Lieutenant Beavan in: Proceed. Zoolog. Soc. 1867, p. 762.] Aber bei dem Rentier liegt der Fall sehr verschieden. Denn wie ich von Professor Nilsson höre, welcher freundlich genug war, meinetwegen spezielle Untersuchungen in Lappland anstellen zu lassen, erscheinen die Hörner bei den jungen Tieren innerhalb der ersten vier oder fünf Wochen nach der Geburt, und zwar zu derselben Zeit bei beiden Geschlechtern. Wir haben daher hier ein Gebilde, welches sich zu einer äußerst ungewöhnlich frühen Lebenszeit in einer Spezies der Familie entwickelt und welches auch allein in dieser einen Spezies beiden Geschlechtern eigen ist.
Bei mehreren Arten von Antilopen sind die Männchen allein mit Hörnern versehen, während in einer größeren Zahl beide Geschlechter Hörner haben. In Bezug auf die Periode der Entwicklung derselben teilt mir Mr. Blyth mit, dass im zoologischen Garten gleichzeitig einmal ein junger Kudu (Antilope strepsiceros), bei welcher Art nur die Männchen gehörnt sind, und das Junge einer nahe verwandten Spezies, nämlich das Eland (Antilope oreas), lebten, bei welchem beide Geschlechter gehörnt sind. Nun waren in strenger Übereinstimmung mit unserem Gesetz bei dem jungen männlichen Kudu, trotzdem derselbe bereits zehn Monate alt war, die Hörner merkwürdig klein, wenn man die schließlich von ihnen erreichte Größe in Betracht zieht, während bei dem jungen männlichen Eland, obgleich er nur drei Monate alt war, die Hörner bereits sehr viel größer waren als bei dem Kudu. Es ist auch der Erwähnung wert, dass bei der gabelhörnigen Antilope [Antilokapra amerikana. Ich habe Dr. Kanfield für Angaben in Betreff der Hörner des Weibchens zu danken; s. auch seinen Aufsatz in: Proceed. Zoolog. Soc. 1866, p. 209. s. auch Owen, Anatomy of Vertebrates. Vol. III, p. 627.] nur einige wenige Weibchen, etwa eines unter fünf, Hörner haben; diese finden sich in einem rudimentären Zustand, wennschon sie zuweilen über einen Zoll lang werden. Es befindet sich daher diese Spezies, was den Besitz von Hörnern seitens der Männchen allein betrifft, in einem intermediären Zustand, und die Hörner erscheinen nicht eher, als ungefähr fünf oder sechs Monate nach der Geburt. Im Vergleich daher mit dem Wenigen, was wir von der Entwicklung der Hörner bei anderen Antilopen wissen und was in Bezug auf die Hörner der Hirsche, Rinder usw. bekannt ist, treten die der Gabelhorn-Antilope in einer intermediären Lebensperiode auf, d. h. weder sehr früh, wie bei Rindern und Schafen, noch sehr spät, wie bei den größeren Hirschen und Antilopen. Bei Schafen, Ziegen und Rindern, bei denen die Hörner in beiden Geschlechtern gut entwickelt sind, wenn sie auch in der Größe nicht völlig gleich sind, können sie schon bei der Geburt oder bald nachher gefühlt oder selbst schon gesehen werden. [Mir ist versichert worden, dass bei den Schafen in Nord-Wales schon zur Zeit der Geburt die Hörner immer gefühlt werden können und zuweilen selbst einen Zoll lang sind. In Bezug auf das Rind sagt Youatt (Cattle, 1834, p. 277), dass der Vorsprung des Stirnbeines bei der Geburt die Haut durchbohrt und dass die Hornsubstanz sich bald auf demselben bildet.] Unser Gesetz lässt uns indess in Bezug auf einige Schafrassen im Stich, z. B. bei den Merinos, wo nur die Widder gehörnt sind. Denn infolge eingezogener Erkundigungen [Prof. Victor Carus hat für mich bei den höchsten Autoritäten in Bezug auf die Merino-Schafe in Sachsen Erkundigungen eingezogen. An der Guineaküste in Afrika gibt es indessen eine Schafrasse, bei welcher wie bei den Merinos nur die Widder allein Hörner haben; und Mr. Winwood Reade teilt mir mit, dass in einem von ihm beobachteten Falle ein junger, am 10. Februar geborener Widder zuerst am 6. März die Hörner zeigte, so dass die Entwicklung der Hörner in diesem Falle zu einer späteren Lebensperiode eintrat, unserem Gesetze zufolge, als bei dem Waliser Schaf, bei dem beide Geschlechter gehörnt sind.] bin ich nicht imstande, zu sagen, dass die Hörner bei dieser Rasse später im Leben entwickelt werden als bei gewöhnlichen Schafen, bei denen beide Geschlechter gehörnt sind. Es ist aber bei domestizierten Schafen das Vorhandensein oder das Fehlen der Hörner kein scharf fixiertes Merkmal, denn eine gewisse Zahl von Merinomutterschafen trägt kleine Hörner und einige Widder sind hornlos, während bei den meisten Rassen gelegentlich auch hornlose Mutterschafe geboren werden.
Dr. W. Marshall hat neuerdings die Protuberanzen, welche so häufig am Kopf von Vögeln auftreten, speziell studiert [Über die knöchernen Schädelhöcker der Vögel, in: Niederländ. Archiv für Zoologie. Bd. I. Heft 2. 1872.] und gelangt zu dem folgenden Schluss, dass sie sich bei denjenigen Arten, bei denen sie auf die Männchen beschränkt sind, spät im Leben entwickeln, während sie bei den Arten, bei denen sie beiden Geschlechtern zukommen, in einer sehr frühen Periode entwickelt werden. Sicherlich ist dies eine auffallende Bestätigung meiner zwei Vererbungsgesetze.
Bei den meisten Arten der prachtvollen Familie der Fasanen weichen die Männchen auffallend von den Weibchen ab und erreichen ihre Körperzierde in einer verhältnismäßig späten Periode des Lebens. Der Ohrenfasan (Crossoptilon auritum) bietet indess eine merkwürdige Ausnahme dar, denn hier besitzen beide Geschlechter die schönen Schwanzfedern, die großen Ohrbüschel und den scharlachnen Sammet um den Kopf; und ich finde, dass alle diese Besonderheiten in Übereinstimmung mit unserem Gesetz sehr zeitig im Leben erscheinen. Das erwachsene Männchen kann indessen vom erwachsenen Weibchen durch das Vorhandensein von Spornen unterschieden werden; und in Übereinstimmung mit unserer Regel fangen diese, wie mir Mr. Bartlett versichert hat, sich nicht vor dem Alter von sechs Monaten zu entwickeln an und, können selbst in diesem Alter die beiden Geschlechter kaum unterschieden werden. [Beim gemeinen Pfau (Pavo cristatus) besitzt nur das Männchen Sporne, während der Javanische Pfau (Pavo muticus) den ungewöhnlichen Fall darbietet, dass beide Geschlechter mit Spornen versehen sind. Ich glaubte daher sicher erwarten zu dürfen, dass sich dieselben bei der letzten Spezies früher im Leben entwickeln würden, als beim gemeinen Pfau. Mr. Hegt in Amsterdam teilt mir aber mit, dass bei jungen, zu beiden Spezies gehörenden Vögeln des vorhergehenden Jahres eine am 23. April 1869 vorgenommene Vergleichung keine Verschiedenheit in der Entwicklung der Sporne zeigte. Indessen waren zu dieser Zeit die Sporne nur durch unbedeutende Höcker oder Erhebungen repräsentiert. Ich glaube annehmen zu dürfen, dass man es mir mitgeteilt haben würde, wenn später irgendeine Verschiedenheit in der Schnelligkeit der Entwicklung bemerklich gewesen wäre.] Der männliche und weibliche Pfau differieren auffallend voneinander in fast jedem Teile ihres Gefieders, mit Ausnahme des eleganten Federstutzes auf dem Kopf, welcher beiden Geschlechtern eigen ist; und dieser entwickelt sich sehr früh im Leben, lange zuvor, ehe die anderen Zieraten sich entwickeln, welche auf das Männchen beschränkt sind. Die wilde Ente bietet einen analogen Fall dar, denn der schöne grüne Spiegel auf den Flügeln ist beiden Geschlechtern gemeinsam, trotzdem er beim Weibchen dunkler und etwas kleiner ist; und dieser entwickelt sich zeitig im Leben, während die gekräuselten Schwanzfedern und andere dem Männchen eigentümlichen Zierden später entwickelt werden. [Bei einigen anderen Arten der Familie der Enten ist der Spiegel bei beiden Geschlechtern in einem bedeutenden Grade verschieden; ich bin aber nicht imstande gewesen, nachzuweisen, ob seine völlige Entwicklung bei den Männchen solcher Arten später im Leben eintritt als bei der gemeinen Ente, wie es unserer Regel zu Folge der Fall sein sollte. Wir haben aber bei dem verwandten Mergus cucullatus einen Fall dieser Art: hier weichen die beiden Geschlechter auffallend in der allgemeinen Befiederung und auch in einem beträchtlichen Grade in dem Spiegel ab, welcher beim Männchen rein weiß, beim Weibchen gräulich-weiß ist. Nun sind die jungen Männchen zuerst in allen Beziehungen den Weibchen ähnlich und haben einen gräulich-weißen Spiegel; dieser wird aber in einem früheren Alter rein weiß als in dem, in welchem das erwachsene Männchen seine stärker ausgesprochenen sexuellen Verschiedenheiten im Gefieder erhält, s. Audubon, Ornithological Biography. Vol. III 1835, p. 249-250.] Zwischen solchen extremen Fällen großer sexueller Übereinstimmung und bedeutender Verschiedenheit, wie denen des Crossoptilon und des Pfauen, könnten viele mitten inneliegende angeführt werden, bei denen die einzelnen Merkmale in der Reihenfolge ihrer Entwicklung unseren beiden Gesetzen folgen.
Da die meisten Insekten ihre Puppenhülle in einem geschlechtsreifen Zustande verlassen, so ist es zweifelhaft, ob die Periode der Entwicklung das Übertragen ihrer Merkmale auf eines oder beide Geschlechter bestimmt. Wir wissen aber nicht, ob die gefärbten Schuppen z. B. in zwei Arten von Schmetterlingen, von denen bei der einen beide Geschlechter verschieden gefärbt sind, während bei der anderen beide gleich sind, in demselben relativen Alter im Cocon sich entwickeln. Auch wissen wir nicht, ob alle Schuppen gleichzeitig auf den Flügeln einer und derselben Spezies von Schmetterlingen entwickelt werden, bei welcher gewisse gefärbte Auszeichnungen auf ein Geschlecht beschränkt sind, während andere Flecke beiden Geschlechtern gemeinsam sind. Eine Verschiedenheit dieser Art in der Periode der Entwicklung ist nicht so unwahrscheinlich, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Denn bei den Orthoptern, welche ihren erwachsenen Zustand nicht durch eine einzige Metamorphose, sondern durch eine Reihe aufeinanderfolgender Häutungen erreichen, gleichen die jungen Männchen einiger Spezies zuerst den Weibchen und erlangen ihre unterscheidenden männlichen Merkmale erst während einer späteren Häutung. Streng analoge Fälle kommen auch während der aufeinanderfolgenden Häutungen gewisser männlichen Krustentiere vor.
Wir haben bis jetzt nur die Übertragung von Merkmalen in Bezug auf die Periode der Entwicklung bei Spezies im Naturzustand betrachtet. Wir wollen uns nun zu den domestizierten Tieren wenden und zuerst Monstrositäten und Krankheiten berühren. Das Vorhandensein überzähliger Finger und das Fehlen gewisser Phalangen muss in einer frühen embryonalen Periode bestimmt werden – wenigstens ist die Neigung zu profusen Blutungen angeboren, wie es wahrscheinlich auch die Farbenblindheit ist; – doch sind diese Eigentümlichkeiten und andere ähnliche oft in Bezug auf ihre Überlieferung auf ein Geschlecht beschränkt, so dass das Gesetz, dass Merkmale, welche in einer frühen Periode sich entwickeln, auf beide Geschlechter vererbt zu werden neigen, hier vollständig fehlschlägt. Wie aber vorhin bemerkt wurde, scheint dieses Gesetz keine auch nur annähernd so allgemeine Gültigkeit zu haben, wie der umgekehrte Satz, dass nämlich Eigentümlichkeiten, welche spät im Leben an einem Geschlecht erscheinen, auch nur ausschließlich auf dieses Geschlecht vererbt werden. Aus der Tatsache, dass die oben erwähnten abnormen Eigentümlichkeiten auf ein Geschlecht beschränkt werden, und zwar lange ehe die geschlechtlichen Funktionen in Tätigkeit treten, können wir schließen, dass eine Verschiedenheit irgendwelcher Art zwischen den Geschlechtern schon zu einem äußerst frühen Lebensalter bestehen muss. Was geschlechtlich beschränkte Krankheiten betrifft, so wissen wir zu wenig von der Zeit, zu welcher sie überhaupt entstehen, um irgendeinen sicheren Schluss zu ziehen. Indessen scheint die Gicht unter unser Gesetz zu fallen, denn sie ist meist verursacht durch Unmäßigkeit im Mannesalter und wird vom Vater auf seine Söhne in einer viel ausgesprocheneren Art als auf seine Töchter vererbt.
Bei den verschiedenen domestizierten Schafen, Ziegen und Rindern weichen die Männchen von ihren respectiven Weibchen in der Form oder der Entwicklung ihrer Hörner, ihrer Stirn, ihrer Mähne, ihrer Wamme, ihres Schwanzes und ihrer Höcker auf den Schultern ab; und in Übereinstimmung mit unserem Gesetze werden diese Eigentümlichkeiten nicht eher vollständig entwickelt, als ziemlich spät im Leben. Bei Hunden weichen die Geschlechter nicht voneinander ab, ausgenommen darin, dass bei gewissen Rassen, besonders bei dem schottischen Hirschhunde, das Männchen viel größer und schwerer als das Weibchen ist. Und wie wir in einem späteren Kapitel sehen werden, nimmt das Männchen bis zu einer ungewöhnlich späten Lebenszeit beständig an Größe zu, welcher Umstand nach unserer Regel es erklären wird, dass die bedeutendere Größe nur seinen männlichen Nachkommen vererbt wird. Andererseits ist die dreifarbige Beschaffenheit des Haares (tortoise-shell), welche auf weibliche Katzen beschränkt ist, schon bei der Geburt völlig deutlich, und dieser Fall streitet gegen unser Gesetz. Es gibt eine Taubenrasse, bei welcher nur die Männchen mit Schwarz gestreift sind, und die Streifen können selbst bei Nestlingen schon nachgewiesen werden; sie werden aber deutlicher mit jeder später eintretenden Mauserung, so dass dieser Fall zum Teil unserer Regel widerspricht, zum Teil sie unterstützt. Bei der englischen Botentaube und dem Kröpfer tritt die völlige Entwicklung der Fleischlappen und des Kropfes ziemlich spät im Leben ein; und diese Merkmale werden in Übereinstimmung mit unserem Gesetze in Vollkommenheit nur den Männchen vererbt. Die folgenden Fälle gehören vielleicht in die früher erwähnte Klasse, bei welcher die beiden Geschlechter in einer und derselben Art und Weise auf einer ziemlich späten Periode des Lebens variiert und infolgedessen ihre neuen Merkmale auf beide Geschlechter in einer entsprechend späten Periode vererbt haben; und wenn dies der Fall ist, so widersprechen derartige Fälle unserer Regel nicht. Es gibt Unterrassen der Tauben, welche Neumeister [Das Ganze der Taubenzucht. 1837, p. 21, 24. In Bezug auf die gestreiften Tauben s. Dr. Chapuis, Le Pigeon Voyageur Belge. 1865, p. 87.] beschrieben hat, bei denen beide Geschlechter im Verlaufe von zwei oder drei Mauserungen die Farbe verändern, wie es in gleicher Weise auch der Mandelpurzler tut. Nichtsdestoweniger sind diese Veränderungen, trotzdem sie ziemlich spät im Leben auftreten, beiden Geschlechtern gemeinsam. Eine Varietät des Kanarienvogels, nämlich der „London Prize“, bietet einen ziemlich analogen Fall dar.
Bei den Hühnerrassen scheint die Vererbung verschiedener Besonderheiten auf ein Geschlecht oder auf beide Geschlechter allgemein durch die Periode bestimmt zu werden, in welcher sich solche Auszeichnungen entwickeln. So weicht in allen den Zuchten, bei welchen das erwachsene Männchen bedeutend in der Färbung von den Weibchen und von der wilden Stammart abweicht, dasselbe auch von dem jungen Männchen ab, so dass die erst neuerdings erlangten Eigentümlichkeiten in einer verhältnismäßig späten Periode des Lebens erschienen sein müssen. Andererseits sind bei den meisten Rassen, bei denen die beiden Geschlechter einander ähnlich sind, die Jungen in nahezu derselben Art und Weise gefärbt wie ihre Eltern, und dies macht es wahrscheinlich, dass ihre Farben zuerst früh im Leben auftraten. Wir sehen Beispiele dieser Tatsache bei allen schwarzen und weißen Rassen, bei denen die Jungen und Alten beider Geschlechter einander gleich sind. Auch kann nicht behauptet werden, dass in einem schwarzen oder weißen Gefieder etwas Eigentümliches liege, welches zu seiner Vererbung auf beide Geschlechter führe. Denn bei vielen natürlichen Spezies sind allein die Männchen entweder schwarz oder weiß, während die Weibchen sehr verschieden gefärbt sind. Bei den sogenannten Kukuksunterrassen des Huhns, bei welchen die Federn quer mit dunklen Streifen gestrichelt sind, sind beide Geschlechter und die Hühnchen in nahezu derselben Art und Weise gefärbt. Das Gefieder der Sebright-Bantam-Hühner mit schwarz geränderten Federn ist in beiden Geschlechtern dasselbe und bei den Hühnchen sind die Schwungfedern deutlich, wenn schon unvollkommen gerändert. Die geflitterten Hamburger bieten indess eine teilweise Ausnahme dar, denn wennschon die beiden Geschlechter sich nicht vollkommen gleich sind, so ähneln sie sich doch einander mehr, als es die Geschlechter der ursprünglichen elterlichen Spezies tun; und doch erreichen sie ihr charakteristisches Gefieder spät im Leben, denn die Hühnchen sind deutlich gestrichelt. Wendet man sich zu anderen Merkmalen außer der Farbe, so besitzen allein die Männchen der wilden elterlichen Spezies und der meisten domestizierten Rassen einen wohlentwickelten Kamm; aber bei dem jungen spanischen Hahne ist er in einem sehr frühen Alter bedeutend entwickelt, und in Übereinstimmung mit dieser frühen Entwicklung beim Männchen ist er auch bei den erwachsenen Weibchen von ungewöhnlicher Größe. Bei der Kampfhahnrasse wird die Kampfsucht in einem wunderbar frühen Alter entwickelt, wovon merkwürdige Beweise gegeben werden könnten; und dieser Charakter wird auch auf beide Geschlechter vererbt, so dass die Hennen wegen ihrer außerordentlichen Kampfsucht jetzt allgemein in besonderen Behältern ausgestellt werden. Bei den polnischen Rassen bildet sich die Protuberanz des Schädels, welche die Federkrone trägt, zum Teil schon ehe die Hühnchen ausschlüpfen, und die Federkrone selbst beginnt sehr bald zu wachsen, wenn auch anfangs nur schwach. [Wegen ausführlicher Einzelheiten und Verweisungen über alle diese Punkte in Bezug auf verschiedene Rassen des Huhns s. Das Varieren der Tiere und Pflanzen im Zustande der Domestikation. 2. Aufl. Bd. I, p. 278 und 285. Was die höheren Tiere betrifft, so sind die geschlechtlichen Verschiedenheiten, welche im Zustande der Domestikation entstanden sind, in demselben Werke unter den die einzelnen Spezies behandelnden Abschnitten beschrieben.] Und in dieser Rasse charakterisiert eine große knöcherne Protuberanz und eine ungeheure Federkrone die erwachsenen Tiere beider Geschlechter.
Nach dem nun endlich, was wir jetzt von den Beziehungen gesehen haben, welche in vielen natürlichen Spezies und domestizierten Rassen zwischen der Periode der Entwicklung ihrer Merkmale und der Art und Weise ihrer Überlieferung existieren, – wenn z. B. die auffallende Tatsache des frühen Wachstums des Geweihes beim Rentier, bei dem beide Geschlechter Geweihe tragen, im Vergleich mit dessen viel später eintretendem Wachstum bei den anderen Spezies, bei denen das Männchen allein ein Geweih trägt, – können wir schließen, dass die eine, wenn auch nicht die einzige Ursache der Vererbung von Eigentümlichkeiten ausschließlich auf ein Geschlecht der Umstand ist, dass sie sich in einem späteren Alter entwickeln, und zweitens, dass eine, wenn auch wie es scheint weniger wirksame Ursache der Vererbung von Besonderheiten auf beide Geschlechter deren Entwicklung in einem frühen Alter ist, in einer Zeit also, wo die Geschlechter in ihrer Konstitution nur wenig voneinander abweichen. Es scheint indessen, als wenn doch irgendeine Verschiedenheit zwischen den Geschlechtern selbst während einer frühen embryonalen Periode existieren müsste; denn in diesem Alter entwickelte Merkmale werden nicht selten auf ein Geschlecht beschränkt.
* * *
Zusammenfassung und Schlussbemerkungen. – Nach der vorstehenden Erörterung über die verschiedenen Gesetze der Vererbung sehen wir, dass Merkmale der Eltern oft oder selbst ganz allgemein geneigt sind, sich bei demselben Geschlecht in dem nämlichen Alter und periodisch in derselben Jahreszeit, in welcher sie zuerst bei den Eltern auftraten, zu entwickeln. Diese Regeln sind aber infolge unbekannter Ursachen beiweitem nicht fixiert. Die aufeinanderfolgenden Stufen im Verlaufe der Modifikation einer Spezies können daher leicht auf verschiedenen Wegen überliefert werden; einige dieser Stufen werden nur auf ein Geschlecht, andere auf beide vererbt, einige auf die Nachkommen eines bestimmten Alters und einige andere auf allen Altersstufen. Es sind nicht bloß die Gesetze der Vererbung äußerst kompliziert, sondern es sind auch die Ursachen so, welche die Variabilität herbeiführen und beherrschen. Die auf diese Weise verursachten Abänderungen werden durch geschlechtliche Zuchtwahl erhalten und angehäuft, welche an sich wieder eine äußerst verwickelte Angelegenheit ist, da sie von der Gluth der Liebe, dem Mut und der Nebenbuhlerschaft der Männchen ebensowohl wie von dem Wahrnehmungsvermögen, dem Geschmacke und dem Willen der Weibchen abhängt. Geschlechtliche Zuchtwahl wird auch bedeutend von der auf die allgemeine Wohlfahrt der Spezies gerichteten natürlichen Zuchtwahl beherrscht. Es kann daher nicht anders sein, als dass die Art und Weise, in welcher die Individuen eines von beiden Geschlechtern oder beider Geschlechter durch geschlechtliche Zuchtwahl beeinflusst worden sind, im äußersten Grade kompliziert ist.
Wenn Abänderungen spät im Leben bei einem Geschlecht auftreten und auf dasselbe Geschlecht in demselben Alter überliefert werden, so werden notwendigerweise das andere Geschlecht und die Jungen unverändert bleiben. Wenn die Abänderungen spät im Leben auftreten, aber auf beide Geschlechter in demselben Alter vererbt werden, so werden nur die Jungen unverändert gelassen. Indessen können Abänderungen auf jeder Periode des Lebens in einem Geschlechte oder in beiden auftreten und auf beide Geschlechter in allen Altersstufen überliefert werden, und dann werden alle Individuen der Art in ähnlicher Weise modifiziert werden. In den folgenden Kapiteln werden wir sehen, dass alle diese Fälle im Naturzustand häufig auftreten.
Geschlechtliche Zuchtwahl kann niemals auf irgendein Tier wirken, bevor nicht das Alter der Fortpflanzungsfähigkeit erreicht ist. Infolge der großen Begierde des Männchens hat sie meistens auf dieses Geschlecht und nicht auf die Weibchen gewirkt. Hierdurch sind die Männchen mit Waffen zum Kampfe mit ihren Nebenbuhlern oder mit Organen zur Entdeckung und zum sichern Festalten der Weibchen oder zum Reizen oder zum Gefallen derselben versehen worden. Wenn die Geschlechter in dieser Hinsicht voneinander abweichen, so ist es auch, wie wir gesehen haben, ein äußerst allgemeines Gesetz, dass das erwachsene Männchen mehr oder weniger vom jungen Männchen verschieden ist; und wir können aus dieser Tatsache schließen, dass die aufeinanderfolgenden Abänderungen, durch welche das erwachsene Männchen modifiziert wurde, allgemein nicht lange vor dem Eintritt des reproduktionsfähigen Alters entwickelt wurden. Sobald aber nur immer einige oder viele der Abänderungen früh im Leben aufgetreten sind, werden die jungen Männchen in einem größeren oder geringeren Grade an den Auszeichnungen der erwachsenen Männchen teilhaben. Verschiedenheiten dieser Art zwischen den alten und den jungen Männchen können bei vielen Tierarten beobachtet werden.
Es ist wahrscheinlich, dass junge männliche Tiere oft in einer Weise zu variieren gestrebt haben, welche in einem frühen Alter nicht bloß für sie von keinem Nutzen, sondern geradezu schädlich gewesen sein würde – wie z. B. die Erlangung glänzender Farben, welche sie ihren Feinden viel sichtbarer gemacht haben würden, oder von Gebilden, wie großen Hörnern, welche während ihrer Entwicklung viel Lebenskraft beansprucht haben würden. Bei jungen Männchen auftretende Abänderungen dieser Art werden beinahe gewiss durch natürliche Zuchtwahl beseitigt worden sein. Andererseits wird bei erwachsenen und erfahrenen Männchen der aus der Erlangung derartiger Eigentümlichkeiten hergeleitete Vorteil den Umstand, dass sie dadurch Gefahren in mancherlei Graden ausgesetzt wurden, mehr als aufgehoben haben.
Da die Abänderungen, welche dem Männchen eine Superiorität über andere Männchen beim Kampfe oder beim Aufsuchen, Festalten oder Bezaubern des anderen Geschlechts geben, wenn sie durch Zufall beim Weibchen aufträten, diesem von keinem Nutzen sein würden, so werden sie in diesem Geschlecht durch geschlechtliche Zuchtwahl nicht erhalten worden sein. Wir haben hinreichende Belege dafür, dass bei domestizierten Tieren Abänderungen aller Arten durch Kreuzung und zufällige Todesfälle bald verloren gehen, wenn sie nicht sorgfältig bei der Nachzucht ausgewählt werden. Infolge hiervon werden Abänderungen der obigen Art, wenn sie durch Zufall bei Weibchen auftreten und ausschließlich in der weiblichen Linie weiter vererbt werden, äußerst geneigt sein, verloren zu gehen. Wenn indessen die Weibchen abänderten und ihre neu erlangten Besonderheiten ihren Nachkommen beiderlei Geschlechts überlieferten, so werden diejenigen derselben, welche den Männchen von Vorteil waren, von diesen durch geschlechtliche Zuchtwahl erhalten und folglich die beiden Geschlechter in der nämlichen Art und Weise modifiziert werden, trotzdem derartige Merkmale für die Weibchen von keinem Nutzen sind. Ich werde indessen später auf diese verwickelten Fälle zurückzukommen haben. Endlich können die Weibchen auch Merkmale durch Überlieferung von dem männlichen Geschlecht erlangen und haben sie allem Anschein nach auch oft erlangt.
Unaufhörlich hat die Natur von Abänderungen, welche spät im Leben auftreten und nur auf ein Geschlecht überliefert werden, Vorteil gezogen und hat solche durch geschlechtliche Zuchtwahl mit Beziehung auf die Reproduktion der Art angehäuft. Es erscheint daher auf den ersten Blick als unerklärliche Tatsache, dass ähnliche Abänderungen nicht auch häufig durch natürliche Zuchtwahl mit Beziehung auf die gewöhnliche Lebensweise angehäuft worden sind. Wäre dies eingetreten, so würden die beiden Geschlechter häufig in verschiedener Weise modifiziert worden sein, z. B. zum Zwecke des Fangens von Beute oder des Entgehens der Gefahr. Verschiedenheiten dieser Art zwischen den beiden Geschlechtern treten gelegentlich auf, besonders bei den niederen Tieren; dies setzt voraus, dass beide Geschlechter im Kampf um die Existenz verschiedenen Lebensgewohnheiten folgen, was bei den höheren Klassen selten ist. Der Fall liegt indessen ganz verschieden, wenn es sich um die reproduktiven Funktionen handelt, in welcher Hinsicht beide Geschlechter notwendig voneinander verschieden sind. Denn es haben sich Bildungsabänderungen, welche auf diese Funktionen Bezug haben, oft als von Wert für das eine Geschlecht herausgestellt und sind, da sie in einer späteren Periode des Lebens aufgetreten sind, nur auf ein Geschlecht überliefert worden. Derartige Abänderungen, in dieser Weise erhalten und überliefert, haben dann zur Entwicklung sekundärer Sexualcharaktere geführt.
* * *
In den folgenden Kapiteln werde ich von den sekundären Sexualcharakteren bei Tieren aller Klassen handeln und werde in jedem einzelnen Falle die in dem vorliegenden Kapitel auseinandergesetzten Grundsätze anzuwenden versuchen. Die niedrigsten Klassen werden uns nur für sehr kurze Zeit aufhalten; aber die höheren Tiere, besonders die Vögel, müssen in einer ziemlichen Ausführlichkeit betrachtet werden. Man muss dabei im Auge behalten, dass ich aus bereits angeführten Gründen nur beabsichtige, einige wenige erläuternde Beispiele von den zahllosen Bildungen zu geben, durch deren Hilfe das Männchen das Weibchen findet oder, wenn es dasselbe gefunden hat, festhält. Auf der anderen Seite werden alle die Bildungseigentümlichkeiten und Instinkte, durch welche ein Männchen andere Männchen besiegt und durch welche dasselbe das Weibchen anlockt oder aufreizt, ausführlich erörtert werden, da diese in vielen Fällen die interessantesten sind.
* * *