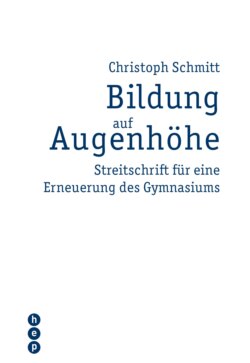Читать книгу Bildung auf Augenhöhe - Christoph Schmitt - Страница 8
Die Umkehr der Vorzeichen: Vom Lehren zum Lernen
ОглавлениеWenn aber das Lernen der Jugendlichen gegenüber dem Lehren der Lehrpersonen den Vorzug erhält, dann kommt umgehend die Qualität des Unterrichts in den Blick und damit die Frage nach der Qualität der Prozesse, in denen junge Menschen am Gymnasium lernen. Das ändert natürlich nichts an der Bedeutung der Lerninhalte, des »Stoffes«, um den sich heute nach wie vor alles dreht. Dieser bildet selbstredend ein wichtiges Moment des Lernens. Aber er ist nach einer Umkehr der Vorzeichen nicht mehr der unangefochtene »Herrscher über Gymnasien«.
Wenn das Gymnasium das Lehren dem Lernen unterordnet, nimmt der Stoff noch immer einen der oberen Plätze auf der Prioritätenliste ein, aber er bildet nicht mehr den Rahmen. Lernen am Gymnasium würde dann nicht mehr um des Stoffes willen erfolgen. »Stoff« wäre in der Schule dazu da, Lernen zu ermöglichen, zu qualifizieren und zu fördern. Wenn Lernprozesse am Gymnasium von diesem Anspruch her qualifiziert würden, dann wären sämtliche Lerninhalte funktional abzustimmen: »Schulisch erworbenes Wissen bewährt sich nicht, indem es auf spätere Berufs- und Lebenssituationen angewendet wird, sondern dann, wenn es die Chancen verbessert, neue Anforderungen situationsadäquat unter Berücksichtigung von Werten, Zwecken und Zielen zu interpretieren, und das zur Bewältigung der Anforderungen notwendige Um- und Neulernen erleichtert« (Deutsches PISA-Konsortium 2001, S. 30). Wissensinhalte (»Stoff«) sind für das Lernen der Jugendlichen nur brauchbar, wenn sie den Prozess des Lernens qualifizieren, nicht umgekehrt. Schulisches Lernen und Lehren hat also nicht irgendwelche Inhalte in die Hefte und Köpfe junger Menschen zu befördern. Der Stoff ist dazu da, dass sich junge Menschen klar beschreibbare Kompetenzen aneignen, mit deren Hilfe sie sich selbst und die komplex codierte Welt erschließen.
Das Wissensübertragungsmodell, das die Qualität von Bildung an der Menge des Stoffes bemisst, den eine Schülerin »beherrschen können soll«, entspringt der irrigen und längst widerlegten Vorstellung, dass es menschliche Lernprozesse mit Substanzen zu tun haben, die im Verlauf dieser Prozesse von A nach B transportiert werden. In dieser Vorstellung eignet sich ein Schüler oder eine Schülerin den Stoff in Form einer Substanz an, häuft Wissen an wie andere Geld oder Getreide. Lernprozesse verkommen in diesem Modell zu Versuchen, sich das Wissen und die vorgegebenen Zusammenhänge irgendwie zu merken. Allerdings findet das außerhalb des Unterrichts statt, weil dieser ja streng sachorientiert, will heißen, am Lehrer und seinem Material orientiert ist. »Viele Schüler […] klagen darüber, dass sie Inhalte und Prozesse des Lernens in der Schule als sinnlos erleben. […] Die wirkungsvollste und vor allem nachhaltigste Strategie gegen diese Schulverdrossenheit dürfte das didaktische Umsteuern von gedächtnisorientiertem zu verständnisintensivem Lernen sein, die Abkehr von der Bevorratung mit deklarativem Wissen, die Zuwendung zum Erwerb intentionalen, anwendungsfähigen Wissens, der Aufbau handlungsbezogener Kompetenzen« (Nipkow 2004, S. 68).
Um die Qualität gymnasialer Lernprozesse in den Blick zu bekommen, müssen wir zuerst nach Merkmalen suchen, die uns diese Qualität zu beschreiben und zu erfassen helfen. Solche »Standards« sind im modernen Bildungswesen auf der Seite der Lernenden mithilfe von Bildungsstandards, Bildungszielen und Kompetenzen formuliert, auf der Seite der Lehrenden mithilfe der »Lehrerexpertise« (vgl. Gläser-Zikuda/Seifried 2008; Reimann/Rapp 2008). Dennoch ist, wenn im Rahmen gymnasialer Bildung die tatsächliche Qualität in den Blick genommen wird, meist nur von den Schülerinnen und Schülern und ihren Leistungen die Rede. Was die Jugendlichen in welchem Umfang in sich aufnehmen können sollen und welche Kompetenzen sie an den Tag legen können, das ist hochreflektiert und klar formuliert. Welche Art von Schule und Unterricht dem entsprechen muss, das ist hingegen nicht annähernd so deutlich artikuliert. Wie lässt sich diese Art von »Schulqualität« beschreiben? Wo liegen hierfür die Referenzpunkte? Mithilfe welcher Begriffe lässt sich erfassen, wie ein Unterricht funktioniert, der die Lernenden und ihr Lernen in den Mittelpunkt des Interesses stellt? Carina Fuchs hat mit ihrem Entwurf eines »selbstwirksamen Lernens« eine belastbare und praktizierbare Antwort auf solche Fragen gegeben (Fuchs 2005). Welche Aufgaben den Lehrenden zukommen, wenn sie nicht lehren, sondern ihre Schülerinnen und Schüler als Lerncoaches zu persönlichen Lernerfolgen anstiften, das hat Fuchs in einer weiteren Publikation anschaulich konkretisiert (Fuchs 2006).
Für mich selbst bieten sich dazu folgende Kriterien an: Die Qualität gymnasialer – wie aller schulischen – Lernprozesse hat erstens etwas zu tun mit den Bedingungen, unter denen sie stattfinden sollen und können. Die Atmosphäre, in der Lernen sich vollzieht, bestimmt nämlich maßgeblich über die Qualität und die Nachhaltigkeit dieses Lernens. Dann hängt das Gelingen lebendiger und nachhaltiger Lernprozesse stark davon ab, ob Lehrende wie Lernende verstehen, wie sie an die dafür nötige Aufmerksamkeit (vgl. Kapitel 4, »Erste Alternative«) herankommen ohne sie mit Konzentration zu verwechseln. Drittens gelingen Lernprozesse umso eher, je differenzierter die Beteiligten sich um das Phänomen des Verstehens (vgl. Kapitel 5, »Zweite Alternative«) bemühen. Hier geht es um die Frage, welche menschlichen Grundbedürfnisse hinter diesem Begriff stecken und wann ein Mensch wirklich verstanden hat, statt einfach nur Verständnis zu simulieren. Und nicht zuletzt muss sich ein Perspektivenwechsel im gymnasialen Bildungswesen um eine tief greifende Reform der Beziehungs- und Gesprächskultur kümmern (vgl. Kapitel 6, »Dritte Alternative«).
Ich werde im zweiten Teil dieses Buches mithilfe dieser Phänomene beschreiben, was gymnasiale Lernprozesse als Bildungsprozesse qualifizieren kann. Ich gehe der Frage nach, was es braucht, um gymnasiale Lernprozesse bildungsgerecht zu gestalten – noch vor aller Technik und Methodik, und ich werde die Frage klären, vor welchen Herausforderungen Lernende stehen, wenn sie sich mit der Aufgabe ihrer Bildung konfrontiert sehen. Dabei geht es auch um die Frage, wie das Gymnasium sich selbst und seinen Auftrag neu interpretieren muss, damit es den Herausforderungen einer »Bildung auf Augenhöhe« gerecht werden kann, die an die Stelle der anachronistisch gewordenen Bulimie-Pädagogik treten muss. Ich bin froh, wenn ich am Ende einen Weg aufgezeigt habe, wie sich gymnasiales Lernen aus seinem Prokrustesbett befreien kann – oder weniger martialisch formuliert: wie es aus seinem Dornröschenschlaf aufwachen kann, auch wenn der Prinz vorläufig ausbleibt.
2 Diese Anforderungen an schulische Bildungsprozesse sind an prominenten Stellen klar formuliert: In der Einführung zur ersten PISA-Studie (vgl. PISA 2000, S. 15-68) bzw. exemplarisch für etliche Bemühungen in neuerer Zeit in den Anliegen und Zielen des Bildungsplans der Schulen in Baden-Württemberg, die auf dem Landesbildungsserver unter www.bildung-staerkt-menschen.de vorgestellt werden. Für die Schweizer Gymnasien vgl. die Bildungsziele, die in Kapitel drei dieses Buches im Abschnitt »Warum der Mensch hinter dem Schüler in der Schule eigentlich gar nicht vorkommt« vorgestellt werden.