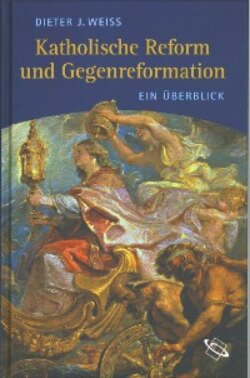Читать книгу Katholische Reform und Gegenreformation - Dieter J. Weiß - Страница 23
Verfall des religiösen Lebens und konfessionelle Unsicherheiten
ОглавлениеDer eigentliche Verfall des religiösen Lebens erfolgte in den katholisch gebliebenen Gebieten erst gegen Mitte des 16. Jahrhunderts. Benno Hubensteiner hat für das Jahrzehnt von etwa 1540 bis 1550 das Wort vom Zeitgraben des 16. Jahrhunderts geprägt. Jetzt erst starb die Generation von Angehörigen des geistlichen Standes, die ihre theologische Ausbildung und Weihe noch in der Zeit empfangen hatte, die von den Frömmigkeitsformen und den Denkstrukturen des ausgehenden Mittelalters geprägt war. In den Jahrzehnten nach 1520 verschlechterte sich die religiöse Situation – im Hinblick auf den Rückgang der Priesterweihen – rapide. Unmittelbar nach der Reformation war der Hochschulbesuch eingebrochen, so dass studierte Priester bald nicht mehr ausreichend zur Verfügung standen. Auch Ordensberufungen blieben aus, so dass viele Konvente vom Aussterben bedroht waren. Bischöfe und Domkapitel bemühten sich oft vergeblich, die Domprädikaturen mit geeigneten Theologen zu besetzen. Ein Teil der Geistlichkeit in den Landpfarreien, aber auch in städtischen Stiften, lebte im Konkubinat, war unzulänglich ausgebildet und in dogmatischen Fragen unsicher. Dies erleichterte konfessionelle Mischformen. Den Bamberger Fiskalatsrechnungen etwa ist zu entnehmen, das von den die geistliche Jurisdiktion des Bischofs anerkennenden Pfarreien in der Jahrhundertmitte weniger als die Hälfte mit persönlich residierenden Pfarrern besetzt war, denn ein Großteil war vakant. Reformmandate blieben weitgehend auf dem Papier, die Gläubigen identifizierten sich noch nicht mit ihnen.
Auch die evangelisch gewordenen Territorien waren von solchen Entwicklungen nicht frei. In den Jahren 1560/61 ließ der Nürnberger Rat in den Pfarreien des Landgebiets der Reichsstadt eine Visitation vornehmen. In den meisten Dörfern wurden schwere kirchliche Missstände offenbar, mangelnde Glaubenskenntnis und verbreiteter Aberglauben („abgötterei oder götzenopfer“), womit die Visitatoren auch fortlebende katholische Frömmigkeitsformen meinten. Die Verhältnisse in den Gebieten, die wir nicht durch Visitationsakten kennen, dürften kaum anders gewesen sein.
In den habsburgischen Erblanden hatte sich trotz der eindeutig katholischen Haltung Kaiser Karls V. und seines Bruders Ferdinands I. reformatorisches Gedankengut ausgebreitet. Erzherzog Ferdinand ordnete 1528 die Durchführung einer Visitation an, die in weiten Bereichen ein Bild des religiösen Zusammenbruchs erbrachte. Die Situation wurde durch den Angriff und die erste Belagerung Wiens durch die Türken 1529 verschärft; die osmanische Bedrohung dauerte in der Folgezeit an. Die neue Lehre verbreitete sich besonders unter den adeligen Ständen, die von ihren Landsitzen für die Verkündigung des evangelischen Glaubens sorgten. 1544 ließ Ferdinand I. eine neuerliche Visitation vornehmen, die den starken Rückgang der Zahl der Priester offenbarte. Auch in Oberösterreich engagierte sich der Adel für die Reformation, seine Schlosspfarreien dienten als Ansatzpunkte für den Ausbau eines Pfarrnetzes der Augsburger Konfession. Die Entwicklung in Innerösterreich war ähnlich, auch hier fiel die Begeisterung für Neuerungen mit einem Verfall altkirchlichen Lebens zusammen.
Der einfachen Bevölkerung mussten Wechsel im Bekenntnis der Landesherren und der von ihnen eingesetzten Theologen und Pfarrer nicht immer auffallen. Nach der Einführung der Reformation blieben besonders in Nord- und Ostdeutschland, aber auch in Nürnberg Riten aus katholischer Zeit in Gebrauch wie lateinisches Chorgebet, die Verwendung von Paramenten, die Klingelzeichen und die Elevation von Hostie und Kelch. Die meisten Hochstifte der nördlichen Reichshälfte standen bereits vor der Reformation unter dem wachsenden Druck der benachbarten weltlichen Fürsten. Diese bemühten sich, sie in den dauernden Besitz ihrer Dynastien zu bringen. Einzelne Bischöfe und Mitglieder der Domkapitel neigten zur Reformation. Dazu gehörten die Hochstifte Lübeck, Ratzeburg, Bremen und Verden, Hildesheim, Osnabrück, Paderborn, Münster, Minden, Magdeburg und Halberstadt.
Bis zum Augsburger Religionsfrieden vollzogen nur zwei geistliche Reichsfürsten den Übergang zur Reformation. Der Hochmeister des Deutschen Ordens, Albrecht von Brandenburg (1511–1525, 1525 –1568 Herzog in Preußen), war erst 1524 sitz- und stimmberechtigtes Mitglied des Reichstags geworden, als er 1525 zum neuen Glauben übertrat und sein säkularisiertes Territorium als Lehen von der Krone Polen empfing. Der Versuch des Kölner Kurfürsten Hermann von Wied (1515 –1546/47, † 1552), der sich zunächst für die Abwehr reformatorischer Regungen engagiert hatte, sein Erzstift ab etwa 1539 als geistliches Fürstentum evangelischen Bekenntnisses zu etablieren, scheiterte am Widerstand der Mehrheit des Domkapitels, des Klerus der freien Reichsstadt Köln und der Kölner Universität.