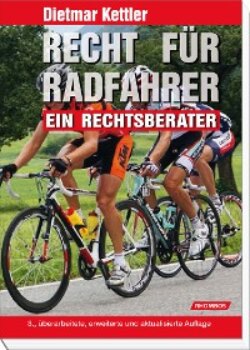Читать книгу Recht für Radfahrer - Dietmar Kettler - Страница 6
Wie funktioniert Recht?
ОглавлениеJuristische Laien meinen oft, wenn sie eine Gerichtsentscheidung in einer Tageszeitung, einer Zeitschrift oder einem Buch gefunden haben, die dort wiedergegebene Aussage sei „Recht“, „ihr Fall“ müsse genauso entschieden werden. Vor dieser Annahme kann ich nur warnen. Es sei hier deutlich gesagt: Dass eine Frage irgendwann irgendwo mal in einer bestimmten Weise entschieden worden ist, bedeutet nicht, dass der eigene ─ ähnliche ─ Fall genauso entschieden werden muss. Erstens ist das Leben viel zu vielgestaltig, als dass der eigene Fall einem anderen, schon entschiedenen, gleichen könnte. Zweitens sind sich Gerichte durchaus uneinig in der Auslegung von Gesetzen – was sich auch bei guten Gesetzen nicht vermeiden lässt. Wie weit rechts man fahren muss, um dem Rechtsfahrgebot zu genügen: Darauf gibt es keine allgemein gültige und immer richtige Antwort. Urteile ─ auch von Obergerichten ─ bieten also für spätere Fälle nur Argumente, kein bindendes Präjudiz (zu deutsch: Vorentscheidung). Und letztlich erfolgt die Wiedergabe eines Urteils in den nichtjuristischen Medien sehr oft missverständlich oder gar falsch.
Das führt zu der Frage: Wie funktioniert Recht?
Grundlegend ist die Unterscheidung zwischen Normen einerseits und Sachverhalten andererseits.
Normen (Regeln, Vorschriften) sind allgemein gehalten und enthalten u.a. Gebote und Verbote. Sie sind von einem Normgeber im vorhinein für die Zukunft und für eine unbestimmte Vielzahl von Sachverhalten gesetzt (daher auch: „Gesetz“).
Sachverhalte sind hingegen ganz konkret: Das Geschehen, das sich zu einem bestimmten Zeitpunkt und an einem bestimmten Ort zugetragen hat, bildet einen Sachverhalt.
Normen haben einen Geltungsanspruch; sie sollen auf möglichst jeden Sachverhalt der darin benannten Art angewendet werden. (Rechts-) Normen beinhalten zwar Recht, ohne Rechtsanwendung stehen sie aber „bloß auf dem Papier“. Das bringt Schwierigkeiten mit sich: Hat niemand den Sachverhalt bemerkt, bleibt jede Rechtsanwendung aus. Beispiel: Hat niemand den Rotlichtverstoß nachts um drei Uhr gesehen, wird er nicht geahndet. Hat aber jemand den Sachverhalt bemerkt, muss für diesen konkreten Sachverhalt das Recht noch gefunden werden; hier fängt die eigentliche Rechtsanwendung an. Der Polizist, der Unfallgegner, man selbst und später das Gericht prüfen: Passt die Norm auf den Sachverhalt? Oder umgekehrt: Ist dieser Sachverhalt in der Norm benannt? Bei dieser Prüfung gibt es wiederum zwei Arten von Schwierigkeiten: Erstens die des Beweises; vor Gericht wird sehr oft darum gestritten, ob sich der Sachverhalt wirklich so zugetragen hat, wie die eine Seite behauptet. Ist aber der Sachverhalt unstreitig oder steht er durch gerichtliche Entscheidung fest, gehen die Schwierigkeiten weiter: Gerade weil die Norm sehr allgemein formuliert ist, sind sich z.B. Polizist und Verkehrsteilnehmer uneinig darüber, ob sie auf den Sachverhalt anwendbar ist. Beide Seiten legen die Norm verschieden aus. Zwei Beispiele sollen das verdeutlichen: Eine rote Ampel bedeutet nach § 37 StVO „Halt vor der Kreuzung“. Da Radfahrerampeln zumeist keine Gelbphase haben und nur Rot oder Grün zeigen, kommt es notwendigerweise immer wieder vor, dass Radfahrer bei Rot noch über die Kreuzung fahren. Rot kann sinnvoll also nur bedeuten: „Halt vor der Kreuzung, wenn das noch möglich ist“. Je nach Geschwindigkeit kann bzgl. der ersten Sekunden der Rotphase Streit darüber entstehen, ob ein Halt noch möglich war oder nicht und damit auch, ob das Verhalten als Rotlichtverstoß zu ahnden ist oder nicht. Ein ebenso deutliches Beispiel ist die Radwegebenutzungspflicht. Die Radfahrer müssen Radwege benutzen, wenn dies für die jeweilige Fahrtrichtung „durch Zeichen 237, 240 oder 241 angeordnet ist“, heißt es u.a. in § 2 StVO. Vom konkreten Zustand des Radweges steht nichts in der StVO. So gibt es immer wieder Polizisten, die im Winter Radfahrer unter Verweis auf diese Norm verwarnen, weil diese den schnee- oder eisglatten Radweg für nicht benutzbar halten und auf der Fahrbahn fahren. Tatsächlich ist die Rechtsprechung sich einig, dass sich die Radwegebenutzungspflicht trotz ihrer weiten Formulierung nur auf zumutbare Radwege bezieht. War der Zustand des Radweges noch zumutbar oder nicht, wird sich der Rechtsanwender fragen müssen.
Hier kommt es auf Argumente an. Dem Polizisten und auch später dem Gericht gegenüber kommt in dieser Situation den irgendwo gefundenen Urteilen für die eigene Rechtsfrage nur ein zweitrangiger Wert zu. Gleiches gilt für die vermeintliche Rechtsautorität bekannter Wissenschaftler. Viel wichtiger ist es, überzeugend zu argumentieren, warum das Gesetz so und nicht anders auszulegen ist. Denn es gilt in dieser eigenen Sache nicht das Urteil XYZ, sondern nur das Gesetz. Allerdings sollte es den Rechtsanwender nachdenklich stimmen, dass „alle anderen“ oder auch nur ein Urteil eines Obergerichts eine Frage so und nicht anders gesehen und beantwortet haben. ♦