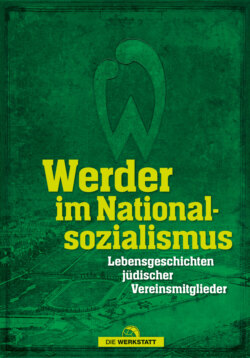Читать книгу Werder im Nationalsozialismus - Dirk Harms - Страница 8
ОглавлениеDer SV Werder von der Gründung bis 1945
Ein Abriss der Vereinsgeschichte mit Augenmerk auf der Zeit ab 1933
von Lukas Bracht
Einleitung
„Die […] großen politischen Umwälzungen in Deutschland sind von uns besonders freudig begrüßt worden. Der S.V. Werder hat seit seiner Gründung stets den nationalen Gedanken vertreten und nicht erst jetzt nach der Umwälzung sein nationales Herz entdeckt. […] Wir brauchen daher nicht die Fahne nach dem Winde zu drehen, sondern treten aus innerer Überzeugung an die große Aufgabe, die uns durch die neue Regierung auferlegt worden ist. […] Wir erwarten von unseren Mitgliedern, daß sie sich restlos in den Dienst dieser guten Sache stellen. Wir müssen als Werderaner auch hier an der ersten Stelle stehen.“1
Diese Äußerung des damaligen Werder-Vorsitzenden Bernhard Stake aus dem April 1933 sowie ähnliche Aussagen in der seit 1911 herausgegebenen Mitgliederzeitung, den Vereinsnachrichten (VN), erzeugen das Bild eines Vereins, der sich gegenüber den damals neuen nationalsozialistischen Machthabern äußerst anpassungswillig zeigte. Der Historiker Nils Havemann erklärte den SV Werder aus diesem Grund sogar zu einem „NS-Vorzeigeverein“2.
In diesem Beitrag wird die Rolle des Sport-Vereins Werder von 1899 (im Folgenden: SV Werder) vor allem zu Beginn des Dritten Reichs untersucht. Im Speziellen geht es darum, wie schnell sich der Verein an die nationalsozialistischen Machthaber und deren Ideologie angepasst hat und ob diese Anpassung in vorauseilendem Gehorsam oder eher als im Sinne des Vereinserhalts unvermeidbare Reaktion auf die neuen Verhältnisse geschah. Dazu werden verschiedene Bereiche des Vereinslebens wie Versammlungen, Veranstaltungen, die Mitgliederzeitung und die Rolle des „Führerprinzips“ und der „Vereinsführer“ beleuchtet. Zudem wird auf den „Arierparagrafen“ in der Vereinssatzung und den Ausschluss jüdischer Mitglieder bei Werder eingegangen.
Der Text bietet dabei zunächst einen kurzen Abriss der Vereinsgeschichte von Werder zwischen 1899 und 1933. Im Hauptteil wird dann die Anpassung des SV Werder an die politischen Veränderungen nach der „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten anhand von verschiedenen Quellen zur Vereinsgeschichte untersucht. Der Untersuchungszeitraum dieser Arbeit ist dabei auf die Phase zwischen 1933 und 1936 begrenzt. In jenen Jahren genossen Sportvereine im Deutschen Reich noch einen gewissen Spielraum in der Gestaltung des Vereinslebens. Nach den Olympischen Spielen 1936 in Berlin wurde diese Freiheit mehr und mehr eingegrenzt und war spätestens ab 1940 marginalisiert.
Forschungsstand und Quellenlage
Für die Beschäftigung mit der Vereinshistorie Werder Bremens findet man in der Chronik zum 90-jährigen Vereinsjubiläum eine gute Basis vor.3 Darin bieten die Autoren Wallenhorst und Klingebiel sowie Letzterer auch mit seinen weiteren Publikationen4 einen sehr vielschichtigen und durchaus kritischen Einblick. Im WUSEUM ist darüber hinaus eine Darstellung der mittlerweile 120-jährigen Vereinshistorie inklusive einer Dauerausstellung zu jüdischen Sportlern bei Werder Bremen zu besichtigen.
Der vorliegende Aufsatz basiert jedoch weniger auf Sekundärliteratur als vielmehr auf einer Untersuchung verschiedener Quellen zur Geschichte des SV Werder während des Dritten Reichs. Durch die Zerstörung der Geschäftsstelle des Vereins am 18./19. August 1944 ist ein großer Teil der vereinsinternen Akten allerdings leider nicht mehr verfügbar. Protokollbücher, Mitgliederverzeichnisse und Unterlagen zur internen Kommunikation hätten einen Einblick in den Vereinsalltag erleichtert. Die vorliegende Arbeit bedient sich daher im Wesentlichen an staatlichen Standorten gelagerter Akten. Das Vereinsregister (VR) am Amtsgericht Bremen (AGB) beinhaltet die Vereinssatzungen, Protokolle von Mitglieder- und Generalversammlungen sowie die Korrespondenz des Vereins mit dem Amtsgericht. Darüber hinaus liefern die Entnazifizierungsakten von Vereinsfunktionären und die Wiedergutmachungsakten von jüdischen Mitgliedern Informationen rund um verschiedene damalige Vereinsmitglieder. Die bedeutendste Quelle stellen allerdings die Vereinsnachrichten (VN) aus dem Vereinsarchiv des SV Werder Bremen (VAWB) dar, da diese sowohl Einblicke in das Vereinsleben ermöglichen als auch Rückschlüsse auf die Außendarstellung und Mitgliederbindung des Vereins zulassen.
Bei allen untersuchten Quellen (mit Ausnahme der Entnazifizierungs- und Wiedergutmachungsakten) muss bedacht werden, dass es sich hier nicht um interne Dokumente handelte, sondern auch immer mindestens ein beschränkter Kreis an Externen Einblick hatte. Bei den Vereinsnachrichten erscheint dies leicht nachvollziehbar. Doch auch die Protokolle von satzungsändernden Versammlungen mussten an das Amtsgericht geschickt werden, was eine Kontrollmöglichkeit der Vereine durch die Behörden deutlich macht. Es muss in der kritischen Analyse berücksichtigt werden, dass die untersuchten Dokumente in diesem Wissen verfasst wurden. Daher ist immer eine gewisse Vorsicht vor voreiligen Rückschlüssen geboten, denn es kann nicht mit absoluter Sicherheit gesagt werden, ob Versammlungen tatsächlich so abliefen wie in den Protokollen niedergeschrieben und ob der Vereinsalltag tatsächlich in der Art und Weise stattfand, wie es in den Vereinsnachrichten dargestellt wurde.
Neben der Auswertung der Primärquellen und Sekundärliteratur sind zudem die Ergebnisse früherer akademischer Ausarbeitungen des Autors in diese Arbeit eingegangen.5
Werder im Kaiserreich (1899–1918)
Nachdem der Fußball bereits in den 1870er Jahren aus England nach Deutschland gekommen war, begann das Spiel mit dem runden Leder hierzulande vor allem ab ca. der 20. Jahrhundertwende mit einer zunehmenden Zahl an Vereinsgründungen allmählich Fuß zu fassen. Der Durchbruch sollte ihm während des wilhelminischen Kaiserreichs in Deutschland allerdings noch nicht gelingen. Bis in die frühen Jahre der Weimarer Republik mussten die Kicker um Anerkennung kämpfen. Das Turnen der „Turnvater Jahn“-Bewegung war die favorisierte Sportart und Fußball aus ästhetischen Gründen als „Fußlümmelei“ verpönt.6
Ausschnitt aus der ersten schriftlich überlieferten, auf der Generalversammlung am 12. März 1912 genehmigten Satzung mit dem „heiklen“ Gründungsdatum (Quelle: Vereinsregister Amtsgericht Bremen, 173, Nr. 4)
Der „Fußball-Verein Werder“ (im Folgenden: FV Werder) wurde 1899 von Schülern der Realschule C. W. Debbe gegründet, wobei das exakte Datum ein wenig strittig ist: Einige frühere Satzungen (namentlich die von 1912, 1931, 1932 und 1933) nennen den 1. Februar, laut den meisten anderen Quellen inklusive der offiziellen Vereinsdarstellung trug sich das historische Ereignis jedoch erst drei Tage später zu, am 4. Februar.7
Keinen Zweifel indes gibt es daran, dass die Mitgliederzahl bereits bis Sommer 1899 auf vierzig bis fünfzig anwuchs.8 In den ersten Jahren war man vorwiegend mit dem Aufbau von Vereinsstrukturen beschäftigt. Dies schloss bezüglich der Spielstätte mehrmalige Umzüge ein, vom „Kuhhirten“ auf dem Stadtwerder ging es auf das Neuenlander Feld und weiter auf die Huckelriede. 1913 wurde mit dem Bau einer Tribüne an der Huckelriede begonnen, die allerdings im November 1916 durch starken Wind zerstört wurde. Die Werderaner durften daraufhin größere Veranstaltungen vorübergehend auf dem Tribünenplatz ihres Stadtrivalen BSC am Peterswerder durchführen.
Im FV Werder stand neben dem Sport auch die Geselligkeit und Freundschaft der Mitglieder im Vordergrund. In Rückblicken wurde oft an „feuchtfröhliche“9 Bierabende in den Anfangsjahren des Vereins erinnert. In sportlicher Hinsicht war der FV Werder derweil seit seiner Gründung einer der besten Bremer Vereine, auch bedingt durch den Beitritt einiger spielstarker Kicker aus den Niederlanden und aus Großbritannien.10 Die Erfolge bestanden in Bremer Stadtmeisterschaften sowie dem Aufstieg als erster Bremer Verein in die höchste Spielklasse des Norddeutschen Fußball-Verbands (NFV) im Jahr 1913.
Größter Rivale in jenen Jahren war der Bremer Sport-Club (BSC). Die Rivalität dieser beiden Mannschaften wurde in den Bremer Zeitungen mitunter zum Duell „Links der Weser“ (BSC) gegen „Rechts der Weser“ (FV Werder) stilisiert. Dies galt allerdings allenfalls für die jeweiligen Spielstätten, denn die Wohnorte auch der Werderaner lagen in jenen Jahren bereits zu einem erheblichen Teil in Stadtteilen „links der Weser“.11 Die Zahl der Mitglieder im FV Werder stieg bis 1912 moderat auf etwa 200, um dann bis Anfang 1914 auf 310 anzuwachsen.12
So nahm der Verein dann auch nicht von ungefähr bereits frühzeitig für sich in Anspruch, in der Entwicklung des Bremer Fußballs eine Vorreiterrolle eingenommen und zu dessen wachsender Akzeptanz und Beliebtheit in der Hansestadt maßgeblich beigetragen zu haben:
„Seit jenen längst vergangenen Tagen haben wir unter den Bremer Fußball-Vereinen in gesellschaftlicher Beziehung stets den ersten Platz eingenommen, und auch in sportlicher Hinsicht durchweg in dominierender Stellung gestanden. Wir dürfen für uns das Verdienst in Anspruch nehmen, den Fußballsport hier in Bremen in erster Linie gefördert zu haben, und zwar dadurch, daß wir das große Publikum durch häufige Veranstaltung von Wettspielen gegen spielstarke Vereine aus allen Gegenden des Reiches und auch des Auslandes, auf unseren Sport aufmerksam machten, und auf diese Weise dazu beitrugen, den Sportgedanken in die breiten Schichten der bremischen Bevölkerung hineinzutragen.“13
Dass diese forsche Selbsteinschätzung dabei keineswegs übertriebenes Eigenlob war, sah auch der NFV so, der dem Verein mit Blick auf die Förderung des lokalen wie regionalen Fußballs ebenfalls „einen bedeutenden und hervorragenden Anteil“14 attestierte.
Der Erste Weltkrieg wurde dann sowohl finanziell als auch personell eine herausfordernde Zeit für den FV Werder. Im August 1916 waren 158 von 300 Mitgliedern im Kriegsdienst15, darunter auch die jüdischen Mitglieder Alfred Ries sowie Arthur und Herbert Rosenthal. 53 Werderaner fielen im Ersten Weltkrieg.16 Mitgliedsbeiträge fielen ab 1914 zu erheblichen Teilen weg, Einnahmen von inserierenden Unternehmen in den VN sanken und Sportveranstaltungen wie die früher durchgeführten Stiftungsfeste waren während des Krieges keine substanzielle Einnahmequelle mehr. Der Verein finanzierte sich über außerordentliche Spenden und Stiftungen („Kriegsspenden“, „Offiziersspenden“) sowie die Tatkraft seiner Mitglieder. Viele von ihnen sandten auch Grußkarten von ihren Kriegseinsätzen, die in den VN abgedruckt wurden. Auf diesem Wege konnten Mitglieder und Verein sowie die Werderaner untereinander in Kontakt bleiben.
Diese Feldpostbriefe geben heute noch wertvolle Aufschlüsse über das Frontleben – auch in Bezug auf den Fußball: Vor allem die an der Ostfront kämpfenden Werder-Mitglieder berichteten von dortigen Fußballspielen zwischen verschiedenen Regimentern und Bataillonen.17 Nach dem Ersten Weltkrieg sollten von der Front bzw. aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrende Soldaten einen erheblichen Multiplikator-Effekt auf die Verbreitung des Fußballs in Deutschland haben.18
Politische Einordnung des Vereins
Der FV Werder war seit seiner Gründung ein Sportverein im bürgerlichen Milieu. Die erste Vereinssatzung forderte von Neu-Mitgliedern „höhere Schulbildung“19 für einen Beitritt. Mit dieser Klausel hoben sich die Gründer bewusst von einem Großteil der damaligen gesellschaftlichen Schichten ab und schufen die Grundlage für eine bürgerlich-konservative Prägung des Vereins.
Beim SV Werder gab man sich elitär und unterließ es in der Satzung von 1912 dann auch gleich, etwas näher zu erläutern, was zu den „ganz besonderen Fällen“ einer Ausnahme hätte zählen können (Quelle: Vereinsregister Amtsgericht Bremen, 173, Nr. 4)
Dieses Merkmal zeigte sich auch im Vereinsleben: Bierabende wurden als „Kommerse“20 bezeichnet, und Vereinspublikationen aus jener Zeit suggerieren einen Vereinsalltag ähnlich dem einer Studentenverbindung. So wurde das alljährliche Vereinsjubiläum „nicht in Form eines Ball-Abends, wie dieses bei fast sämtlichen hiesigen Fussball-Vereinen üblich ist, sondern durch einen Kommers mit Abendtafel“21 gefeiert. Dies kann als ein Hinweis auf das Selbstverständnis der Vereinsmitglieder als Teil der bürgerlichen Bildungsschicht gedeutet werden. Explizit politische Äußerungen konnten in den VN in den Jahren bis 1918 nicht nachgewiesen werden.
Werder in der Weimarer Republik (1919–1933)
Nach dem Ersten Weltkrieg setzte in Deutschland die Entwicklung des Fußballs zu einem Massenphänomen ein. Die Mitgliederzahlen in den Sportvereinen und die Zuschauerzahlen bei Sportveranstaltungen stiegen ab Beginn der Weimarer Republik rasant an.22 Die Ursachen hierfür lagen unter anderem in der Einführung der für die Arbeiterschaft erstmals ein nennenswertes Reservoir an buchstäblicher „Freizeit“ bringenden 48-Stunden-Woche, der politischen Emanzipation der Frauen, der Etablierung neuer Sportarten und der veränderten Rolle von Sport in der Gesellschaft.
Bei Werder verdoppelte sich die Mitgliederzahl zwischen Mai 1919 und April 1921 nahezu, von 559 auf 1.065. Dazu trug auch die Gründung einer Damenabteilung im Dezember 1919 bei, in die im Verlauf des Jahres 1920 bereits 66 Mitglieder eintraten. Der Verein teilte diesbezüglich mit, dass man mit der Aufnahme von Frauen „einem vielseitigen Wunsche und dem Zuge der Zeit gefolgt“23 sei. Zulauf von Jugendlichen bekamen Sportvereine in Deutschland derweil nicht zuletzt in Folge der sich nach dem Ersten Weltkrieg verändernden Rolle von Sport in der hiesigen Gesellschaft. Nach dem Wegfall der Wehrpflicht aufgrund des Versailler Vertrags wurde die Aufgabe der körperlichen Ertüchtigung der Jugend zunehmend von Sportvereinen in Form von Wehrsport adressiert. Sie entwickelten so ihre Rolle vom reinen Anbieter von Freizeitsport zu einem wesentlichen Bestandteil der körperlichen (Wehr-)Ausbildung in der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Allein in den Jahren 1919 und 1920 wuchs Werder auch deshalb um insgesamt 315 jugendliche Mitglieder.
Ein weiterer Faktor für das Wachstum des Vereins war der Ausbau des allgemeinen sportlichen Angebots. Vor 1919 gab es bei Werder lediglich eine Fußballabteilung. Im Laufe der 1920er Jahre kamen immer mehr Abteilungen hinzu: Kegeln und Schach (1919), Tennis, Billard und Cricket (alle 1920) sowie Rugby (1924), Handball und Leichtathletik (ab 1928).24 Sinnbildlich für diese Neuausrichtung war die Umbenennung von „Fußball-Verein ‚Werder‘“ in „Sport-Verein ‚Werder‘“ im Januar 1920.25 Die Fußballabteilung stellte jedoch ungebrochen den Großteil an Mitgliedern. Im Jahr 1921 war mit den genannten 1.065 allerdings auch bereits der Zenit der Mitgliederentwicklung bei Werder vor 1945 erreicht, bis Januar 1932 sollte der Mitgliederstand in wirtschaftlich teils schwierigen Jahren mit Hyperinflation und Weltwirtschaftskrise auf nur noch 407 sinken.
Derweil stiegen in der Weimarer Republik wie erwähnt die Zuschauerzahlen bei Sportgroßveranstaltungen deutlich an. Zum Endspiel um die Deutsche Meisterschaft 1920 kamen 35.000 Menschen auf den Germania-Platz in Frankfurt am Main, drei Jahre später waren es beim DM-Finale im Berliner Grunewaldstadion schon 64.000 Besucher.26 Auch der SV Werder verbuchte bei Auftritten seiner 1. Mannschaft einen merklichen Zuwachs, selbst wenn die Zahlen geringer waren als beispielsweise in Hamburg.27 Für durchschnittliche Ligaspiele der Grün-Weißen lagen die Angaben zumeist im niedrigen vierstelligen Bereich, zu wichtigen Partien oder Derbys kamen allerdings bereits im Jahr 1920 bisweilen 5.000 oder mehr Zuschauer.28 Um dem steigenden Interesse gerecht zu werden, wurden in den 1920er Jahren in vielen Städten Stadien aus- oder neugebaut, so z. B. das Städtische Stadion in Nürnberg (später Franken-, heute Max-Morlock-Stadion) oder der Sportpark Müngersdorf in Köln. Auch Werder beschäftigte sich mit dem Ausbau seiner Sportstätte, trug letztlich jedoch erst ab 1930 seine Heimspiele im Weserstadion aus (zunächst pachtweise)29, das bereits zu diesem Zeitpunkt 40.000 Menschen Platz bot.
Politische Einordnung des Vereins
Während der Weimarer Republik gab es in ganz Deutschland bürgerliche, konfessionelle und sozio-politische Sportverbände. Der SV Werder war Mitglied im bürgerlichen DFB, dem standen in Bremen der Arbeiter-Turn- und Sportbund (ATBS), die Kampfgemeinschaft für Rote Sporteinheit („Rotsport“) und – allerdings erst nach 1933 – jüdische Vereine wie die Sportgruppe Schild und der JTSV Bar Kochba gegenüber. Dabei waren die Zugehörigkeiten nicht zwingend bzw. unweigerlich exkludierend, sondern – wie die Geschichte von Werder zeigt – beispielsweise jüdische Sportler durchaus auch Mitglieder in bürgerlichen Vereinen. Die Mitgliedschaft in einem bestimmten Sportverein konnte aber dennoch auch betonter Ausdruck sozialer, politischer oder konfessioneller Zugehörigkeit sein.
Laut der Vereinssatzung des SV Werder aus dem Jahr 1932, die zwar aufgrund eines Formfehlers nie Rechtsgültigkeit erlangte, zuvor aber von den Mitgliedern ratifiziert worden war und neben einer nahezu identischen, ebenfalls nicht offiziell in Kraft getretenen Fassung aus dem Jahr 1931 die erste von ihm bekannte aus Weimarer Zeit darstellt, war „jede politische Betätigung innerhalb des Vereins […] verboten“30. Ob dieses Verbot erst mit dieser Satzung eingeführt wurde oder bereits früher in Kraft war, lässt sich anhand der vorliegenden Quellen nicht beantworten. Die Geschehnisse rund um die Bremer Räterepublik im Januar 1919 sind in diesem Kontext jedoch auffallend: So vermeldete der Verein in der VN-Ausgabe vom März 1919, dass „bei der Säuberung Bremens von den Spartakisten […] eine Anzahl unserer Mitglieder im Freikorps Caspari“ beteiligt gewesen und Werder-Mitglied Arthur Rosenthal gar verwundet worden sei31, und in der folgenden VN-Ausgabe wurden die Werder-Mitglieder aufgefordert, sich der Bremer Stadtwehr anzuschließen.32 Hier offenbart sich also eine der wenigen öffentlich präsentierten politischen Aktionen des Vereins zwischen 1919 und 1933.
Darüber hinaus war der SV Werder während der Weimarer Zeit auch Mitglied im Verband bremischer Bürgervereine, einer politisch liberal ausgerichteten Vereinigung.33 Allerdings sind aus den untersuchten Dokumenten ab dem Jahr 1920 keine öffentlichen Eingriffe dieses Verbands ins aktuelle politische Geschehen ersichtlich.
Im Nachklang der Bremer Räterepublik war die später satzungsgemäß vorgeschriebene politische Abstinenz bei Werder noch nicht das Gebot der Stunde (Quelle: Werder-Vereinsarchiv)
Werder in der NS-Zeit (1933–1945)
Seit seiner Gründung war Werder ein Sportverein im bildungsbürgerlichen Milieu und zur Zeit der Weimarer Republik Mitglied im DFB, dem bürgerlichen deutschen Fußballverband. Innerhalb des Spektrums der verschiedenen Sportverbände lässt sich dem Verein daher, ohne viel Widerspruch zu ernten, eine bürgerlich-konservative Ausrichtung unterstellen. Dennoch scheint der politische Diskurs im Vereinsalltag bis 1933 keine allzu große Rolle gespielt zu haben. Umso überraschender erscheint die unmittelbare und eindeutige Positionierung wie Außendarstellung des Vereins in den ersten Jahren des Dritten Reichs.
In diesem Kapitel wird die Anpassung des SV Werder an die neuen politischen Gegebenheiten zwischen 1933 und 1936 untersucht. Zentrale Kriterien dabei sind die Entdemokratisierung von Vereinsstrukturen („Führerprinzip“, „Vereinsführer“), die Politisierung und Ideologisierung des Vereinslebens (Versammlungen, Veranstaltungen, Sprachgebrauch in den VN, Wehr- und Volkssport, „Dietwesen“) und der Ausschluss von jüdischen Mitgliedern aus dem Verein („Arierparagraf“).
Vereinsentwicklung
Der SV Werder erlebte in den Jahren nach der „Machtergreifung“ einen erheblichen sportlichen Aufschwung. Bis 1933 hatte es lediglich zu Siegen auf lokaler bis regionaler Ebene gereicht, nun konnte bereits in der Saison 1933/34 mit der Meisterschaft in der neu gebildeten Gauliga VIII (Niedersachsen) der erste überregionale Titel und damit der bis dahin größte Erfolg der Vereinsgeschichte gefeiert werden. Dadurch waren die Werderaner erstmals auch in der Endrunde um die deutsche Fußballmeisterschaft vertreten, wo man sich in der Vorrunde unter anderem gegen Schalke 04 achtbar schlug, aber letztlich als Gruppendritter vorzeitig die Segel streichen musste. In den folgenden Jahren belegten die Grün-Weißen in der Liga stets einen der vorderen Plätze und sollten letztlich mit insgesamt vier Titeln Rekordmeister der Gauliga VIII werden.34
In finanzieller Hinsicht bewirkte derweil ein substanzieller Schuldenerlass von 75 % im Jahr 193335 eine nachhaltige Entlastung der Vereinskasse, deren Stand während der Weimarer Republik analog zur wirtschaftlichen Lage in starkem Maße Schwankungen unterworfen gewesen war.
Die schlagartig verbesserte finanzielle Situation sowie die ebenso umgehend einsetzenden sportlichen Erfolge legen einen positiven Einfluss der sich zur gleichen Zeit vollziehenden politischen Veränderungen nahe. Als Mitglied des bürgerlichen Sportverbandes DFB brauchte der SV Werder zudem ein Verbot nicht zu fürchten, im Gegensatz zu den Vereinen der Arbeitersportverbände, die bereits mit der „Reichstagsbrandverordnung“ im Februar 1933 aufgelöst wurden, und den kirchlichen Sportverbänden, deren Ende im Rahmen der weiteren Gleichschaltung der Sportorganisationen 1935 kam.36
Trotz der Konkurrenz durch die nationalsozialistischen Jugendorganisationen und entgegen dem allgemeinen Trend in deutschen Turn- und Sportvereinen zu jener Zeit37 stiegen die Mitgliederzahlen bei Werder zwischen Januar 1934 und Dezember 1936 erheblich an, von 391 auf 822. Dies zeugt von einer gewissen Attraktivität des Vereins für bestehende wie für neue Anhänger. Dabei ist Werders gestiegene Mitgliederzahl ab 1933 bis zu einem gewissen Punkt mit Sicherheit den sportlichen Erfolgen der Gauligamannschaft zuzuschreiben. Die positive Entwicklung legt aber zugleich nahe, dass der politische wie gesellschaftliche Kurs des Vereins auch auf Zustimmung in der Mitgliederschaft getroffen und von dieser wenigstens zu einem erheblichen Teil mitgetragen worden sein muss – aus einem Sportverein, dessen Philosophie den eigenen Grundsätzen zuwiderläuft, hätte man schließlich auch damals ohne Weiteres austreten können. Werders betont im Einklang mit der Ideologie der neuen Machthaber stehende Ausrichtung wurde also nicht nur von den maßgebenden Entscheidungsträgern im Verein beeinflusst, sondern wird die Akzeptanz der breiten Basis widergespiegelt haben.
Allerdings: Vor allem bürgerliche Vereine, die finanziell von den politischen Veränderungen profitiert hatten, wollten die angenehmen Begleiterscheinungen durch die neuen Machthaber natürlich nicht missen.38 Es ist somit zugleich davon auszugehen, dass die Vereinsführung von Werder die finanzielle Entlastung unmittelbar nach der „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten und den damit einhergehenden sportlichen Aufschwung einfach mit allen Mitteln sichern wollte und sich auch deshalb betont „auf Linie“ präsentierte.
Entdemokratisierung der Vereinsstrukturen
Das wesentlichste Element der Entdemokratisierung der Vereine war deren Selbstgleichschaltung durch die Einführung des „Führerprinzips“ in der inneren Organisation. Die Strukturen, Prozesse und Befugnisse innerhalb der Verwaltung und Leitung eines Vereins wurden damit stark vereinfacht und zentralisiert – zugunsten des neuen „Vereinsführers“ und zuungunsten der Mitgliederversammlung. Der Vereinsführer wurde zwar noch von den Vereinsmitgliedern gewählt, konnte dann jedoch seine Mitarbeiter im Vorstand ernennen und entlassen, ohne dabei auf weitere Zustimmung angewiesen zu sein.39
Die Anwendung des Führerprinzips in den Sportvereinen bündelte somit die zuvor verteilten Befugnisse in der Person eines Einzelnen, womit eine gravierende Einschränkung der Rechte der General- bzw. der Mitgliederversammlungen verbunden war. Der Historiker Klaus Vieweg bezeichnet dann auch die Ersetzung des Mehrheitsprinzips „durch den Führergrundsatz und die Besetzung der Führerposten mit nationalsozialistischen Persönlichkeiten als das vielleicht […] wesentlichste Mittel der Gleichschaltung der Vereine und Verbände“40.
Die Einführung des Führerprinzips bei Werder
Der SV Werder zeigte sich in der Implementierung des Führerprinzips sehr proaktiv, ja geradezu enthusiastisch. Zwar wurde es letztlich erst im Oktober 1933 offiziell in der Vereinssatzung verankert41, doch bereits zuvor waren bis dahin im Verein geltende demokratische Prinzipien abgewickelt und die Meinungsvielfalt unterbunden worden, als im Mai 1933 Bernhard Stake ohne jegliche satzungsgemäße Grundlage zum fortan allein die Geschicke der Grün-Weißen bestimmenden Vereinsführer deklariert wurde und seinen künftigen Mitarbeiterkreis ohne Einbindung der Mitgliederversammlung selbst benannte.42 Mit Inkrafttreten der Satzung vom 9. Oktober 1933 lag die Leitung des SV Werder dann endgültig nahezu ausschließlich in der Verantwortung des (immerhin noch jährlich zu wählenden) jeweiligen Vereinsführers.
Werders Vereinsführer von 1933 bis 1938
Deren erster war besagter Bernhard „Peter“ Stake (Jahrgang 1893), der bereits verschiedene Ämter im Verein bekleidet hatte, bevor er im Januar 1931 zum Nachfolger von Alfred Ries als Vereinsvorsitzender gewählt worden war und schließlich in der Generalversammlung am 14. Mai 1933 spontan und „einstimmig zum neuen Vereinsführer bestellt“43 wurde. Stake, seit 1932 mit einem Malerbetrieb selbstständig und neben dem SV Werder in einigen weiteren Bremer Sportvereinen aktiv (Rugby-Verein, Ruder-Verein), war ab 1933 Mitglied im „Stahlhelm“ und wurde nach dessen Eingliederung in die SA im Jahre 1934 auch dort als Mitglied geführt. Zwar trat er in der ersten Jahreshälfte 1935 „freiwillig“44 aus der SA-Reserve aus, war dafür dann aber ab 1937 NSDAP-Parteimitglied, da ihm „von dem Obmann meines Betriebes der Eintritt in die Partei nahegelegt wurde“45.
In Stakes Entnazifizierungsakte finden sich mehrere Entlastungsschreiben zu seinen Gunsten – unter anderem von den jüdischen Vereinsmitgliedern Theodor Eggert und Alfred Ries. So beschreibt Eggert, wie Stake ihn und seine Familie während der NS-Zeit unterstützt habe, derweil Ries Stake als „anständigen Kerl“ bezeichnet, der „seiner guten Gesinnung charaktervoll treu geblieben [sei], was man in der damaligen Zeit nur von wenigen Menschen beobachten konnte“46. Allzu lange währte Stakes Zeit als Vereinsführer indes nicht: Bereits auf der Mitgliederversammlung am 9. Oktober 1933 stellte er sein Amt wegen „geschäftlicher Inanspruchnahme“47 wieder zur Verfügung.
Auf ihn folgte Willy Stöver (1900–1951), der nun von Oktober 1933 bis Mai 1937 das Amt des Vereinsführers bei Werder bekleidete. Stöver war jahrelang bei der Norddeutschen Lloyd in Bremen angestellt, bevor er 1939 als Verpflegungsoffizier in das Ersatzverpflegungsmagazin Bremen II eingezogen wurde. Mit dem Dienstantritt in der Wehrmacht ruhte fortan seine seit 1933 bestehende Mitgliedschaft im Nationalsozialistischen Fliegerkorps (NSFK) bzw. in dessen Vorgängerorganisationen (seit 1938 als Freiballon- und Obertruppführer) einstweilen ebenso wie die in der Deutschen Arbeitsfront (DAF) sowie in der NSDAP48, wo er 1936 bzw. 1937 eingetreten war.
Willy Stöver (links) zusammen mit Vereinskollege Hermann Werries am 14. Mai 1938 auf der Tribüne des Berliner Olympiastadions beim 3:6 der DFB-Elf im Länderspiel gegen England (Quelle: Werder-Vereinsarchiv)
Nach dem Krieg gab Stöver in seinem Antrag auf Weiterführung seines Berufs zu Protokoll, dass von ihm als langjährigem Mitarbeiter des Landesverkehrsverbandes Unterweser und Jade e. V. nach dessen Übernahme durch den Reichsfremdenverkehrsverband der Eintritt in die Partei gefordert worden sei, und erklärte, er sei der NSDAP beigetreten, „um Weiterungen aus dem Wege zu gehen und keine finanziellen Ausfälle zu haben“49. Bekannte beschrieben Stöver als „guten Kamerad und fairen Sportsmann“50 und attestierten ihm, dass er sich nicht politisch betätigt und „die Judenverfolgung der Nationalsozialisten stets abgelehnt“51 habe. Seine Einstellung gegenüber den damaligen Machthabern sei stets anders gewesen, „als sie hätte als Mitglied der NSDAP sein sollen“52. Stövers Gesuch wurde im August 1946 zwar zunächst abgelehnt, das Entnazifizierungsverfahren gegen ihn im April 1948 aber schließlich eingestellt.
Im SV Werder war Stöver seit 1925 Mitglied und amtierte neben seiner Funktion als Vereinsführer auch noch 1937 als 2. Vorsitzender sowie 1938 als Vorsitzender der Ortsgruppe Bremen des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen (DRL). Als von ihm in der Vereinsarbeit übernommene Aufgaben nannte Stöver in seinem Entnazifizierungsverfahren mit Blick auf den SV Werder „schriftstellerische Betätigung und Ansprachen“. Er habe in den Vereinszeitungen „kleinere sportliche Ausführungen veröffentlicht“ sowie in Versammlungen des Vereins „kleine Reden über Sport und notwendige Erklärungen gehalten“53.
Die Protokolle der Mitglieder- und Generalversammlungen sowie die untersuchten VN-Ausgaben sprechen indes zumindest hinsichtlich Stövers Wirkens beim SV Werder eine andere Sprache. Bereits in seiner 30-minütigen programmatischen Rede anlässlich der erstmaligen Wahl zum Vereinsführer im Oktober 1933 kündigte er mit Bezug auf die weitreichenden Befugnisse seines Amtes an, „von meinem Recht gegebenenfalls rücksichtslos Gebrauch [zu] machen“54, um eine vollständige Unterordnung der Mitglieder unter die Richtlinien der Vereinsführung durchzusetzen. Der SV Werder sei ein Kreis von Menschen mit gleicher Gesinnung. Daher habe man – so hieß es von ihm einige Monate später – „die Pflicht und die Schuldigkeit, in unserer Gemeinschaft mit einheitlichem Willen der nationalsozialistischen Ideenrichtung zu folgen“55. Und zufrieden konstatierte er, dass der Parlamentarismus ein Ende habe: „Die gründliche Reinigung des deutschen Hauses von schweren Fäulniserscheinungen ist […] in unserem Vaterlande durchgeführt. Wir sind jetzt wieder frei und brauchen uns nicht mehr von jenen liberalistischen Kreisen führen lassen, die noch vor einem Jahr glaubten, die Geschicke eines bis dahin in sich zusammengefallenen Deutschland zu lenken.“56
In den Nachkriegsjahren war Willy Stöver weiterhin bei Werder aktiv und amtierte von Oktober 1947 bis April 1949 nochmals als 2. Vorsitzender des Vereins. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 50. Vereinsjubiläum am 24. Mai 1949 wurde er zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt, im Ältestenrat und im Altherren-Konvent führte er bis zu seinem Tod am 19. Dezember 1951 den Vorsitz.57
Auf Stöver als Vereinsführer folgte im Mai 1937 Adolf Hecht, der bei Werder zuvor Leiter des Leichtathletikausschusses und Kassenprüfer gewesen war. In seiner Funktion als Vereinsführer baute Hecht auf Stövers Vorarbeit auf, trieb das Einigkeitsdogma im Verein voran und schränkte die Meinungsvielfalt weiter ein („Es muß jetzt Schluss sein mit Nörgeleien und eigenen Meinungen“58), um den Sport dem Wohl der „Volksgemeinschaft“ unterzuordnen.59 Da seit 1935 ein neuer Vereinsführer allerdings einer Bestätigung durch den Reichssportführer bedurfte60, musste Hecht zunächst eine „Gesinnungsprüfung“ durch die Gestapo durchlaufen, bevor er seinen Posten antreten konnte.61 Dass dieses Verfahren dann mehrere Monate dauerte, kann dabei kaum als Indiz einer etwaigen Opposition Hechts gegen die politischen Machthaber gewertet werden. Im Gegenteil: Er war bereits im Februar 1931 in die NSDAP eingetreten und wurde in den VN als „alter Kämpfer der Bewegung“62 bezeichnet. Mehrere Belastungszeugen im Entnazifizierungsverfahren attestierten ihm zudem, ein „ganz gemeiner Nazi“ gewesen zu sein63, wobei sich dies primär auf seine berufliche Tätigkeit im Bremer Arbeitsamt bezog.
Dem gegenüber stand Hechts eigene Darstellung, dass er im Februar 1931 zwar zunächst aus Überzeugung in die NSDAP eingetreten, spätestens mit der Niederschlagung des „Röhm-Putsches“ im Sommer 1934 aber ernüchtert gewesen und nur aus Angst vor Jobverlust nicht aus der Partei ausgetreten sei. Neben mehreren belastenden Zeugnissen erhielt Hecht auch ein unterstützendes Schreiben vom gemäß der nationalsozialistischen Rassenideologie als „Halbjude“ geltenden Werder-Mitglied Hans Wolff: Hecht habe ihn während der NS-Zeit unterstützt und nicht aus dem Verein ausgeschlossen, obwohl er über seine Abstammung Bescheid gewusst habe.64
Der Historiker Arthur Heinrich schreibt, dass das „verbreitete […] Selbstverständnis der designierten Vereinsführer von ihrer Stellung im Verein“65 in der Tendenz zur Anpassung an die neuen politischen Gegebenheiten eine wesentliche Rolle gespielt hat. Diese Beobachtung lässt sich am Beispiel SV Werder bestätigen. Willy Stöver und Adolf Hecht waren beide langjährige Vereinsmitglieder, die bis 1933 bei Werder politisch nicht in Erscheinung getreten waren, sich nach der „Machtergreifung“ aber sehr linientreu äußerten und die Gleichschaltung des Vereins nach nationalsozialistischen Ideen durch ihre Art der Vereinsführung und durch ihre Äußerungen in den VN maßgeblich vorantrieben.
Politisierung und Ideologisierung des Vereinslebens
Nachdem Politik im Vereinsalltag des SV Werder seit seiner Gründung nur am Rande relevant gewesen war, betrieb der Verein ab 1933 eine bewusste, grundlegende Politisierung und Ideologisierung seines Vereinslebens: „So kam es, daß im ersten Viertel dieses Jahres [1933, Anm. d. Autors] auch im Werder die politische Wendung stark in den Vordergrund trat. Die großen Umwälzungen in Deutschland wurden überall freudig begrüßt.“66
In den folgenden Abschnitten wird diese neue bzw. zunehmende politische und ideologische Färbung des Vereinslebens untersucht, die sich vor allem in den Mitgliederversammlungen, in den Rahmenerscheinungen bei Sport- wie sonstigen Vereinsveranstaltungen, im nationalsozialistischen Sprachgebrauch in den VN, im Wehr- und Volkssport und im „Dietwesen“ zeigte.
Mitgliederversammlungen
In den Versammlungsprotokollen ab dem Jahr der nationalsozialistischen „Machtergreifung“ lässt sich eine deutliche, zuvor nicht vorhandene bzw. qua Satzung ja sogar untersagte politisch-ideologische Prägung des Vereinslebens beim SV Werder erkennen. Bereits die Generalversammlung (GV) im Mai 1933 wurde vom nun als Vereinsführer amtierenden Vorsitzenden Bernhard Stake mit einem „mit großer Begeisterung aufgenommenen dreifachen ‚Sieg Heil‘ auf unseren Volkskanzler Adolf Hitler und unser deutsches Vaterland“67 geschlossen.
Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung im Oktober 1933, auf der unter anderem das Verbot politischer Betätigung im Verein aus der Vereinssatzung gestrichen wurde, waren dann, wie im Protokoll explizit erwähnt wurde, zwei Vertreter der örtlichen Schutzstaffel (SS) anwesend.68 Diese Politisierung der Versammlungen kann man auch an den Eröffnungsansprachen des nunmehrigen Vereinsführers Willy Stöver erkennen. So gab er in der GV 1935 zu Protokoll, dass ihm bei der Ausübung seiner Tätigkeit im Verein „unser Führer Adolf Hitler als Vorbild [diene], der durch strikte Beibehaltung seines geraden Kurses es fertig gebracht habe, Deutschland wieder da hin zu bringen, wo es heute steht“69.
Mit Blick auf die Generalversammlungen sind zudem einige interessante Entwicklungen zu verzeichnen, so z. B. ein sprunghafter Anstieg der Teilnehmerzahlen: Obwohl der SV Werder am 31. Dezember 1933 mit 391 deutlich weniger Mitglieder aufwies als noch 1931 (765) oder 1932 (407), waren zur GV am 9. Oktober 1933 deren 165 erschienen70 (also etwa 40 % der gesamten Mitgliederschaft), im Gegensatz zu beispielsweise lediglich 65 Anwesenden bei der GV am 27. Januar 1931.
Ein ebenso interessantes Phänomen ist die verkürzte Dauer der Veranstaltungen: Während sich die GV 1931 noch zwei Stunden und 40 Minuten hingezogen hatte und die Versammlung vom 1. Februar 1932 wegen Eintritts der Polizeistunde gegen Ende gar vertagt werden musste, wurden die Versammlungen der folgenden Jahre trotz größerer Teilnehmerzahl durchweg in weniger als zwei Stunden durchgeführt.
Vereinsveranstaltungen
Auch die vom Verein organisierten Veranstaltungen standen ab 1933 voll und ganz im Zeichen der nationalsozialistischen Politik und verfolgten sogar ganz explizit nicht mehr nur ihren Selbstzweck, sondern sollten in erster Linie die Unterordnung des Vereins gegenüber der „Volksgemeinschaft“ veranschaulichen und zur Stärkung des nationalen Bewusstseins beitragen.71
Ganz in diesem Sinne veränderte sich bereits der äußere Rahmen von Sportveranstaltungen, die nun von Fahnengruppen, Aufmärschen und dem obligatorischen Hitlergruß vor einem Spiel begleitet wurden.
Vereinsführer Willy Stöver bezeichnete dies als „neuzeitliche Sport-Propaganda“ und schrieb außerdem begeistert davon, „welch ein Fortschritt […] allein schon die symbolische Handlung [sei], wenn vor einem sportlichen Wettkampf Aktive wie Zuschauer ihre Verbundenheit durch den deutschen Gruß zum Ausdruck bringen“.72 Laut Stöver waren Sportveranstaltungen „wieder mehr als eine bloße Schaustellung, da sie jetzt in erster Linie ihrer nationalen Aufgabe“73 dienten, indem sie vaterländisches Empfinden stärkten und Volksbewusstsein erweckten. Aus Freizeitsportveranstaltungen waren politische Events geworden.
Hakenkreuzfahnen auf den Tribünen des Weserstadions – ab 1933 ein gewohntes Bild bei Werder-Spielen (Quelle: Werder-Vereinsarchiv)
Die in ihrer Bedeutung ebenfalls gestiegenen Gedenkveranstaltungen förderten derweil eine Rückbesinnung auf die Vergangenheit Deutschlands. Dies äußerte sich z. B. in den Vereinsfeierlichkeiten zum Totensonntag, die ab 1933 in größerem Format abgehalten wurden. Stöver führte in seiner Einladung zum Gedenktag 1933 aus, dass man „in unserem neuen Deutschland den Glauben an einen lebendigen Gott wiedergefunden“ habe und „aus diesem Glauben heraus […] auch die Achtung vor unseren gefallenen Kameraden wieder wachgerufen“74 worden sei. Bei der Enthüllung eines Ehrenmals am Weserstadion am 13. August 1934 wies er zudem ganz im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie auf die Bedeutung der „Machtergreifung“ für die Rückbesinnung auf die deutsche Vergangenheit hin:
„Wenn wir an dieser Stätte heute ehrfurchtsvoll der großen Kämpfer gedenken, so tun wir dieses mit einem berechtigten Stolz […]; denn erst nach der nationalsozialistischen Revolution im vorigen Jahr sind wir alle voll davon beseelt, daß unsere Kameraden Wegbereiter für die deutsche Zukunft gewesen sind.“75
Darüber hinaus ließ sich der Verein mit der „Saar-Kundgebung“ am 30. April 1934 auch ganz bewusst und vermutlich sogar maßgeblich auf eigene Initiative hin vor den politischen Karren der Nationalsozialisten spannen. Das „Saargebiet“ war im Versailler Vertrag ab 1920 für 15 Jahre unter das Mandat des Völkerbunds bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Abhängigkeit von Frankreich gestellt und für das Jahr 1935 eine Volksabstimmung über seinen künftigen Status festgelegt worden. Laut „Kreis-Propagandaleiter“ Hoffmann waren alle Kreisstellen „vom Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda verpflichtet […], jede Möglichkeit, für das Saargebiet Propaganda zu machen, wahrzunehmen“76. Unter dem Motto „Deutsch ist die Saar“77 wurde nun also vor einem Freundschaftsspiel gegen die Sportfreunde 05 Saarbrücken im Weserstadion eine Kundgebung abgehalten, an der mit der Hitlerjugend und einer Standarte der Sturmabteilung (SA) auch NS-Organisationen beteiligt waren.78
Die Initiative für diese Veranstaltung und die Beteiligung des Vereins dürfte nicht unwesentlich von Seiten des SV Werder ausgegangen sein.79 In seinem Jahresbericht für das Jahr 1934 nahm Willy Stöver für sich und den Verein jedenfalls in Anspruch, „unseren kleinen Teil dazu beigetragen zu haben, daß unsere deutschen Volksgenossen an der Saar wieder frei von jeglicher Fremdherrschaft sind“80.
Bei der „Saar-Kundgebung“ im Schauspielhaus eröffnete Willy Stöver noch vor Bremens regierendem Bürgermeister Richard Markert den Redeteil des offiziellen Programms (Quelle: Werder-Vereinsarchiv)
Für den Bereich der Vereinsveranstaltungen lässt sich festhalten, dass ab der „Machtergreifung“ eine zunehmende Verbindung von Sport und Politik zu beobachten ist, die auch vonseiten Werders aktiv betrieben wurde. Man begrüßte nicht nur den politischen Rahmen sportlicher Veranstaltungen, sondern ließ sich bewusst und teils auf eigene Initiative hin für nationalsozialistische Propaganda instrumentalisieren.
Vereinsnachrichten
Besonders deutlich wurde die neue politisch-ideologische Prägung des Vereinslebens im nunmehr klar nationalsozialistischen Schreibstil in den Ausgaben der Vereinsnachrichten ab 1933. Die VN dienten nicht mehr ausschließlich als Bindeglied zwischen den Mitgliedern und dem Vorstand bzw. der Verwaltung des Vereins, sondern als Medium zur Proklamation einer ideologischen Programmatik, also auch zur Öffentlichkeitsarbeit.
Die Titelseite der VN-Ausgabe von Mai 1933, in deren „Rundschau“ keine Fragen offengelassen wurden, welcher Wind nun auch bei Werder wehte (Quelle: Werder-Vereinsarchiv)
Die zentrale Forderung an alle Werder-Mitglieder wurde bereits in der „Rundschau“ der VN-Ausgabe vom Mai 1933 deutlich: „Wie in Deutschland sich das ganze Volk zu Adolf Hitler bekennt, so steht in unserer großen grünweißen Schar ein geschlossener Kreis von Menschen, der im völkischen Sinne mit Stolz aufblickend auf seine ruhmreiche Tradition und in steter Dankbarkeit an unsere Helden des großen Weltkrieges alles einsetzen will für unser höchstes Ziel – Deutschland!“81 Von den Mitgliedern wurde nicht nur eine Unterordnung unter die Vereinsinteressen erwartet und Einmütigkeit und Geschlossenheit in den eigenen Reihen gefordert, sondern zudem ihre Einordnung in die deutsche „Volksgemeinschaft“ propagiert. Die Pflichterfüllung „nicht nur auf dem grünen Rasen, sondern als deutschbewusster Volksgenosse […] gegenüber dem Vaterlande“ und der „Wiederaufbau unseres geliebten Vaterlandes“ wurden als fortan dringlich zu leistende Aufgaben der Werder-Mitglieder angemahnt.82
Ein nahezu beliebig ersetzbares Beispiel: Auch in den VN von Januar 1934 konnte sich der Leitartikler einen Mangel an NS-Enthusiasmus nicht vorwerfen lassen (Quelle: Werder-Vereinsarchiv)
Als Konsequenz aus der Betonung der „Volksgemeinschaft“ und einem verstärkten Nationalismus und Patriotismus wurde zugleich Abweichlern gegenüber ein härterer Kurs eingeschlagen. Vereinsführer Stöver unterstrich seine Bereitschaft, Mitglieder, die sich nicht der Vereinsführung unterordneten, aus dem Verein auszuschließen.83 Meinungsvielfalt war dabei schon in den Jugendmannschaften nicht erwünscht. So betonte Jugendführer Henry Schierloh bei der Einweihung des neuen Jugendheims in Borgfeld die Bedeutung der Gemeinschaftspflege in Sportvereinen als Teil der Gemeinschaft im „erwachten Deutschland“84. Damit verband er einen „Zusammenschluss an gleichgesinnten Individuen“ und kündigte an, Mitglieder, die sich nicht bedingungslos dem Gemeinwohl unterordneten, aus der Gemeinschaft auszuschließen: Derjenige, der „sich nicht eingliedern kann, für den ist bei uns kein Platz“85.
Der SV Werder stellte sich durch die ideologische Anpassung und die Politisierung der Artikel in den Vereinsnachrichten also klar in den Dienst der nationalsozialistischen Propaganda und verankerte die NS-Politik über die mediale Vermittlung nicht nur im Alltag und in der Freizeitgestaltung, sondern auch in den Köpfen seiner Mitglieder.
Wehr- und Volkssport
Im April 1933 forderte der DFB seine Mitgliedsvereine auf, durch einen Ausbau der Jugendarbeit „mit allen Kräften an der nationalen Erneuerung mitzuarbeiten“86. Der Sportler müsse seinen Sport primär in dem Sinne betreiben, „den der Nationalsozialismus ‚politisch‘ nennt, d. h. er muß sich bewußt bleiben, daß er seinen Körper stählt, um dem Vaterlande zu dienen, sich für den Fall eines Falles voll einsatzbereit zu machen“87.
Schon zuvor hatten Turn- und Sportvereine, so auch der SV Werder, Wehrsport für jugendliche Mitglieder angeboten. Die Werderaner beanspruchten dabei für sich, sie seien sogar „die ersten [gewesen], die den Wehrsportgedanken offen aufgenommen haben“88. Wie im Abschnitt zur Weimarer Republik angedeutet, wurde bei Werder tatsächlich bereits ab 1919 Wehrsport im Verein praktiziert – dies war seinerzeit allerdings kein Alleinstellungsmerkmal. Nun jedoch wurde seitens des Vereins die Arbeit zur jugendlichen (Wehr-)Ertüchtigung noch einmal deutlich forciert: Bereits im Mai 1933 sprach der damalige Vorsitzende Bernhard Stake von „der großen Aufgabe, unsere Jugend zu wehrtüchtigen deutschen Männern heranzubilden“89. Dabei könne man in den eigenen Reihen auf „viele Jugendliche, die seit Jahren in treuer Pflichterfüllung in der Bewegung der nationalen Revolution stehen“90, bauen.
In der Praxis beinhaltete die Wehrsportausbildung im Verein eine Kombination von Leichtathletik, Gymnastik sowie Geländeübungen und -läufen. Der Jugend- und Wehrsport in den Sportvereinen war dabei seit 1933 massiver Konkurrenz durch die SA und vor allem durch die Hitlerjugend (HJ) ausgesetzt.91 Dennoch konnte der SV Werder allem Anschein nach den Jugendlichen ein attraktives Programm bieten. Ein Indikator hierfür ist der Anstieg der Zahlen an jugendlichen Mitgliedern ab 1933: Im Dezember 1934 verzeichnete der Verein deren 95 – ein Anstieg von mehr als 50 % im Vergleich zum Vorjahr (63). In den Jahren 1936 und 1937 wurden dann sogar 105 bzw. 113 Eintritte von Jugendlichen notiert, und das obwohl ab August 1936 die Jugendabteilungen der 10- bis 14-Jährigen in Sportvereinen gänzlich aufgelöst und der HJ zugeführt wurden.92
Neben dem Wehrsport für Jugendliche bot der SV Werder auf Verfügung der Gauleitung seit Oktober 1933 für seine erwachsenen Sportler den sogenannten Volkssport an.93 Dieser beinhaltete sowohl praktische als auch theoretische Aspekte einer Wehrausbildung. Zum Repertoire gehörten Pistolen- und Gewehrschießen, Geländeübungen und Keulenwerfen genauso wie Kartenlesen, Umgang mit einem Kompass und Vermittlung von Wissen bezüglich der Gliederung und Ausrüstung von Armeen.94
Der Verein fühlte sich also ganz offensichtlich nicht mehr nur der sportlichen Betätigung, sondern verstärkt auch der militärischen (Vor-)Ausbildung seiner Mitglieder verpflichtet. Besonders im Jugendbereich stieß dies auf Resonanz. Laut dem Historiker Horst Weder wurde der Sport durch die Einführung von Wehrsport „mit faschistischer Wehrhaftigkeit gleichgesetzt“95.
Dietwesen
Analog zum Wehrsport, der wie erwähnt bereits in den 1920er Jahren auch in allenfalls bürgerlich-konservativen, aber im Wesentlichen unpolitischen Sportvereinen praktiziert worden war, handelte es sich beim Dietwesen um keine genuin nationalsozialistische Erfindung. Vielmehr ging es zurück auf die völkisch ausgerichtete deutsche Turnbewegung, hatte sich ob der geistigen Nähe jedoch problemlos in die NS-Ideologie integrieren lassen: „Im sog. Dietwesen – ‚Diet‘ bedeutet zugleich ‚Volk‘ und ‚deutsch‘ – ging es um die Pflege des deutschen Volkstums, um die Erhaltung und Wahrung seiner rassisch-bedingten Eigenart.“96 Ganz in diesem Sinne war der „Dietwart“ für die Aufrechterhaltung des völkischen Geistes im Vereinsleben und bei Veranstaltungen sowie für die entsprechende Schulung der Vereinsmitglieder verantwortlich.
Mit der „Dietordnung“ des DRL vom 27. April 1937 wurde es für Vereine verpflichtend, einen Dietwart zu ernennen.97 Der SV Werder indes schuf dieses Amt bereits in der Vereinssatzung von 193598, und spätestens ab dem 6. August 1936 gab es mit Werner von Wienczkowski einen Dietwart im Verein. Dieser dürfte den Anforderungen des Reichssportführers an jenes Amt zur vollsten Zufriedenheit entsprochen haben, schließlich hatte er seine Linientreue schon Jahre zuvor unter Beweis gestellt, so in der VN-Ausgabe vom Mai 1933, für die er als Schriftleiter verantwortlich gewesen war. Ganz im nationalsozialistischen Stil schrieb von Wienczkowski hier von „der Wesensart und der Rasse“ als „einenden Linien aller Deutschen“ und betonte, dass Deutschland erst dann wieder einen Aufstieg erleben könne, „wenn in völkischer Art das ganze deutsche Volk endgültig auf seine abertausend Jahre alte Geschichte und seine große Kultur“ zurückfinde.99
Neben der körperlichen Ausbildung ging es beim SV Werder also augenscheinlich auch um eine geistige Erziehung seiner Mitglieder im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie, und das abermals bereits frühzeitig, wie die Installierung eines Dietwarts noch weit vor der offiziellen Anordnung dazu verdeutlicht.
Ausschluss jüdischer Mitglieder
Auf die individuellen Schicksale einiger spezifischer jüdischer Vereinsmitglieder des SV Werder nach der nationalsozialistischen „Machtergreifung“ und die Repressionen, denen sie fortan ausgesetzt waren, wird in den einzelnen Beiträgen dieses Buches ausführlicher eingegangen. Hier kann es daher bei einer kurzen Einführungsdarstellung belassen werden, die neben einem Blick auf die Umsetzung des „Arierparagrafen“ auch eine erste Kurzzusammenfassung der später ausführlich beschriebenen Biografien liefert.
Der „Arierparagraf“
Der DFB gab im April 1933 gemeinsam mit dem Deutschen Sportbund (DSB) eine Mitteilung heraus, wonach fortan „Angehörige der jüdischen Rasse ebenso wie Personen, die sich in der marxistischen Bewegung herausgestellt haben […], in führenden Stellungen der Landesverbände und Vereine für nicht tragbar“ erachtet würden.100 Gleichwohl stand es Sportvereinen im DFB anschließend aber noch bis 1940 frei, in ihren Satzungen eigene Voraussetzungen für eine Vereinsmitgliedschaft zu definieren und somit auch individuelle Regelungen bezüglich des Umgangs mit jüdischen Mitgliedern zu treffen. Erst die Einheitssatzung des Nationalsozialistischen Reichsbundes für Leibesübungen (NSRL, Nachfolger des DRL) erzwang die Implementierung eines „Arierparagrafen“, der Juden eine Vereinsmitgliedschaft untersagte.101
Mit §4, Abs. 6 der Satzung vom 29. April 1940 hatte nun auch der SV Werder einen „Arierparagrafen“ (Quelle: Vereinsregister Amtsgericht Bremen, 173, Nr. 231)
Ab diesem Zeitpunkt schloss auch der SV Werder „Personen, die nicht deutschen oder artverwandten Blutes oder solchen gleichgestellt sind“102, qua Satzung kategorisch aus dem Verein aus, nachdem man bereits spätestens ab August 1939 im Anmeldeformular für Neumitglieder auch die „Abstammung“ abgefragt hatte.103 Schon lange zuvor waren derweil manch andere Vereine in Eigeninitiative tätig geworden und hatten sich auf gemeinsame Mitgliedskriterien verständigt, so beispielsweise in der „Stuttgarter Erklärung“ vom 9. April 1933, in der sich 14 Vereine aus dem süddeutschen Raum – darunter der VfB Stuttgart, der 1. FC Nürnberg und der FC Bayern München – zur Implementierung eines „Arierparagrafen“ in der Vereinssatzung verpflichteten.104
Allem Anschein nach gab es eine solche Erklärung im norddeutschen Raum nicht, jedenfalls ist in allen gesichteten Quellen nichts Dementsprechendes zu finden. Viel schwieriger festzustellen ist ohnehin, ob die „Stuttgarter Erklärung“ von den unterzeichnenden Vereinen tatsächlich konsequent umgesetzt wurde. Darüber hinaus ist angesichts der mit der nationalsozialistischen Machtübernahme einsetzenden allgemeinen Entrechtung von gemäß der NS-Ideologie „nicht-arischen“ Menschen natürlich ebenfalls denkbar, dass Vereine jüdische Sportler einfach ohne satzungsgemäße Grundlage aus ihren Reihen ausschlossen. Einen Hinweis darauf, dass dies auch beim SV Werder praktiziert wurde, liefert der weiter unten sowie im entsprechenden Beitrag dieses Buches näher thematisierte Vereinsausschluss des jungen Leo Weinstein. Für weitere Fälle gibt es allerdings keine konkreten Anhaltspunkte.
Jüdische Vereinsmitglieder
Die Central-Verein-Zeitung, das von 1922 bis 1938 erschienene, den Untertitel „Blätter für Deutschtum und Judentum“ tragende Organ des „Central-Vereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens“, schrieb im April 1927 in einem Artikel, dass „alle jüdischen Sportler Bremens […] fast ausschließlich im A.B.T.S. (Allgemeiner Bremer Turn- und Sportverein)“ Mitglied seien.105 Dies lässt im Umkehrschluss die Vermutung zu, dass es im SV Werder nur vergleichsweise wenige Mitglieder jüdischer Konfession gab. Eine endgültige Aussage darüber, welchen Anteil jüdische Mitglieder im Verein ausmachten, kann allerdings nicht getroffen werden, da durch die Zerstörung der Geschäftsstelle des SV Werder in der Bahnhofstraße 35 im August 1944 keinerlei Mitgliederlisten aus jener Zeit erhalten geblieben sind. Allerdings lassen sich in den 1910er, 1920er und 1930er Jahren durchaus einzelne jüdische Werder-Mitglieder finden, die auf den weiteren Seiten dieses Buches porträtiert werden.
Zunächst taucht die Familie Rosenthal auf. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg waren Vater Albert sowie die Söhne Arthur, Herbert und Hermann Mitglieder bei Werder.106 Arthur, zeitweise Werbe- und Pressewart des Vereins, wurde bereits weiter oben wegen seiner Beteiligung an der Niederschlagung der Bremer Räterepublik erwähnt. Anscheinend waren jedoch alle vier Rosenthals bereits vor 1933 nicht mehr im Verein aktiv.
Alfred Ries ist eine der einflussreichsten Persönlichkeiten in Werders Vereinshistorie. Bereits als 26-Jähriger wurde er 1923 zum ersten Mal zum Vereinsvorsitzenden gewählt. 1933 verließ er Bremen und später Deutschland wegen antisemitischer Verfolgung, war allerdings noch bis zu seiner selbst-initiierten Abmeldung im Sommer 1935107 Vereinsmitglied. Der SV Werder organisierte am 7. Januar 1933 eine Verabschiedung für Ries und ernannte ihn bei dieser Gelegenheit zum Ehrenmitglied.108 Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte er nach Bremen zurück, wurde erneut Vereinsvorsitzender (1947–51 und 1963–67) und bekleidete zudem wichtige Ämter im DFB und im diplomatischen Dienst der Bundesrepublik Deutschland.109
Ein weiteres jüdisches Mitglied im SV Werder war Theodor Eggert, der nach den Nürnberger Rassengesetzen als „Mischling 1. Grades“ (zwei jüdische Großelternteile) galt. Bereits 1919 als Jugend-Mitglied bei Werder eingetreten, musste Eggert ab 1942 im Arbeitserziehungslager Bremen-Farge bzw. dem dortigen U-Boot-Bunker „Valentin“ Zwangsarbeit leisten. Dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt aus dem Verein ausgeschlossen worden wäre, kann nicht belegt werden.
Auch Hans-Egon „Hansi“ Wolff wurde nach den Nürnberger Rassengesetzen als „Mischling“ eingestuft, war aber dennoch zwischen 1933 und 1945 durchgehend Vereinsmitglied und auch als Amtsträger im Verein aktiv. Nach 1945 bekleidete er ebenfalls noch jahrzehntelang unterschiedliche Vereinsämter und war bei den Grün-Weißen eine so prägende Figur, dass mitunter gar von „Hansi Werder im Sport-Verein Wolff“ die Rede war.110
Des Weiteren taucht in Werders Mitgliederlisten der Name Leo Weinstein auf, später Professor für Romanistik an der Stanford University. Lührs und Marßolek berichten, dass es für den damals erst 12-Jährigen ein sehr einschneidendes Erlebnis gewesen sei, „als ihm Anfang 1934 sein Trainer mit sichtlichem Bedauern mitteilen mußte, daß Juden nicht mehr Mitglieder beim SV Werder sein durften“111. Weinstein ist somit der einzige anhand der untersuchten Akten nachvollziehbare Fall des tatsächlichen Ausschlusses eines jüdischen Mitglieds aus dem SV Werder vor 1940.
Mit Hugo Grünberg schließlich trat im Sommer 1920 ein weiteres jüdisches Mitglied bei Werder ein.112 Ein Austritts- oder Ausschlussdatum des ebenfalls in diesem Buch porträtierten, für den Verein vornehmlich als Schiedsrichter aktiven Grünberg ist nicht bekannt – wohl aber, dass er die nationalsozialistische Verfolgung nicht überlebte: Im November 1941 nach Minsk deportiert, wurde er am 28. Juli 1942 im Zuge einer Massenexekution im dortigen jüdischen Ghetto ermordet, ebenso wie Arthur Rosenthal.
Zusammenfassung
Mit Blick auf seitens des Vereins vollzogene direkte Repressions- und/oder Exklusionsmaßnahmen gegenüber seinen jüdischen Mitgliedern lässt sich sagen, dass Leo Weinstein das einzige bekannte Beispiel für einen proaktiven Ausschluss durch den SV Werder vor 1940 ist. Dieser Vorgang wurde allerdings in den VN, die für das Jahr 1934 fast vollständig in Werders Vereinsarchiv vorliegen, nicht dokumentiert. Das deckt sich mit der allgemein auf die Situation in norddeutschen Sportvereinen vor 1940 bezogenen Beobachtung der Sporthistoriker Lorenz Peiffer und Henry Wahlig, dass „sich der Ausschluss jüdischer Mitglieder eher im Verborgenen abspielte“113.
Aus diesem Grund ist es schwierig, eine konsequente Ausschlusspraxis des Vereins gegenüber jüdischen Mitgliedern festzustellen, aber auch, sie vollkommen auszuschließen. Warum Weinstein, nicht jedoch Wolff oder Eggert, aus dem Verein ausgeschlossen wurde, bleibt unklar. Peiffer und Wahlig kommen in ihrer Untersuchung zu dem Schluss, dass der SV Werder lediglich „volljüdische“ Mitglieder ausschloss, während „Halbjuden“ im Verein verbleiben durften.114 Angesichts des kaum existierenden Quellenmaterials und der ohnehin offenbar nur geringen Zahl jüdischer Werder-Mitglieder kann diese Aussage nicht mit letzter Sicherheit unterstützt werden.
Schlussbetrachtung
Eine eindeutige Beurteilung, ob der SV Werder tatsächlich – was seinerzeit im Übrigen auch andere Fußballvereine wie der Hamburger SV115 und der FC Bayern München116 von sich behaupteten – „seit seiner Gründung stets den nationalen Gedanken vertreten hat“ und somit 1933 „die Fahne nicht nach dem Winde“ drehen musste117, ist anhand der gegenwärtigen Aktenlage nicht zulässig. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Werder ein Verein im bürgerlichen Milieu war, doch auf eine völkische oder gar nationalsozialistische Vorprägung deutet in den untersuchten Akten nichts hin.
Nachdem die politische Betätigung im Verein noch 1932 per Satzung verboten war, förderte Werder ab 1933 eine Verbindung von Sport und Politik im Vereinsleben und verankerte dadurch die nationalsozialistische Ideologie auch im Alltag, in der Freizeitgestaltung und in den Köpfen seiner Mitglieder. Dabei passte sich der Verein teils proaktiv, teils reaktiv den Vorstellungen der neuen politischen Machthaber an.
Einige Aspekte sprechen dafür, dass Werder eine eher passive Rolle in der Anpassung eingenommen hat. Man wollte bei den übergeordneten Instanzen nicht in Ungnade fallen, wehrte sich daher nicht gegen die Politisierung der Rahmenbedingungen bei Sportveranstaltungen sowie generell im Vereinsalltag, führte aber erst im Zuge der 1940 verordneten NSRL-Einheitssatzung einen „Arierparagrafen“ ein und verfügte mit Hansi Wolff sogar über einen „halbjüdischen“ Geschäftsstellenmitarbeiter.
Die Eigeninitiative bzw. Bereitwilligkeit, sich für politische Propagandazwecke zur Verfügung zu stellen, spricht dagegen für eine aktive Anpassung des SV Werder an die neuen Gegebenheiten. Dies gilt auch mit Blick auf den frühen Vereinsausschluss von Leo Weinstein. Ein „vorauseilender Gehorsam“ zeigte sich zudem in der frühzeitigen Übernahme des Führerprinzips und der Einsetzung eines Dietwarts. Begleitet wurde dies von einer öffentlichkeitswirksamen und betonten Darstellung des „gleichgeschalteten“ Vereinslebens.
Insgesamt ordnete sich der SV Werder vollständig der nationalsozialistischen Sportauffassung wie Ideologie unter und hat sich speziell im Jahre 1933 über ein hinreichendes Mindestmaß an bloßer Anpassung hinaus mit den neuen Gegebenheiten arrangiert. Durch präventive „Selbst-Gleichschaltung“ wollte man sicherstellen, dass „wir […] als Werderaner auch hier an der ersten Stelle stehen“118. In der Konsequenz spricht dies mehr für ein aktives, mindestens bereitwilliges Handeln des Vereins als für eine von reinem Nutznießer-Gedankengut gelenkte passiv-reaktive Vereinspolitik. Ob das dargestellte Ausmaß des Phänomens der Anpassung den SV Werder nun aber tatsächlich zu einem „NS-Vorzeigeverein“119 macht, kann anhand des untersuchten Materials in dieser Deutlichkeit nicht unterstützt werden.
Ausblick
Nach Kriegsende verbot die Militärregierung in Bremen zunächst den Sportbetrieb in allen vormals dem NSRL angehörenden Sportvereinen – so auch im SV Werder.120 Der im November 1945 neu gegründete „Turn- und Sportverein Werder von 1945“, auf dessen Gründungsversammlung die beiden langjährigen „halbjüdischen“ Vereinsmitglieder Theodor Eggert und Hansi Wolff zu „Obleuten“ gemacht wurden121, musste sich aufgrund der namentlichen Nähe zum Vorgängerverein kurzfristig in „Grün-Weiß von 1899“ umbenennen.122 Von der Wiederzulassung der Sportvereine unter altem Namen durch die Militärregierung machte der Verein dann bereits am 25. März 1946 Gebrauch, zwei Tage nach Veröffentlichung der entsprechenden Anordnung im Weser-Kurier.123
In der Satzung des neu gegründeten Vereins vom April 1946 hieß es dabei in Bezug auf die künftige Rolle der Politik im Vereinsleben: „Die Politik zu Gunsten einer Partei wird abgelehnt. Dagegen wird ausdrücklich anerkannt, dass eine Anti-Nazi-Politik als staatstragendes Mittel gefördert werden soll und jede Handlung auf demokratischer Grundlage zu erfolgen hat.“124
Im Vorstand des SV Werder saß weiterhin Theodor Eggert. Hansi Wolff war ab 1945 dreißig Jahre lang als Geschäftsführer des Vereins engagiert. Alfred Ries kehrte Ende 1946 nach Bremen zurück und übernahm ab Oktober 1947 erneut den Vorsitz des Vereins.125 Gleichzeitig wurde Willy Stöver 2. Vorsitzender126 und sollte dies bis April 1949 bleiben. Auf der Generalversammlung im Februar 1948 wurde ein Festausschuss zur Organisation der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Vereinsjubiläum gebildet: Neben Stöver waren sowohl sein Vorgänger als auch sein Nachfolger im Amt des „Vereinsführers“, Bernhard Stake und Adolf Hecht, Teil dieses Teams.127 Aus Anlass des Jubiläums gab der SV Werder 1949 zudem eine Vereinschronik heraus. Mitherausgeber neben dem Vereinsvorsitzenden Alfred Ries war ebenfalls Stöver, der nun ausgerechnet das Kapitel zur Vereinsgeschichte zwischen 1932 und 1939 beitrug.
Der jüdische Vorsitzende der 1920er Jahre und der linientreue Vereinsführer der frühen NS-Zeit bildeten angesichts ihrer Vorgeschichte ein nicht zu erwartendes Duett. Allerdings schienen die beiden Männer auch während Ries‘ Abwesenheit aus Bremen Verbindung gehalten zu haben. Laut der Aussage von Stövers langjährigem Bekannten August Heyer im Entnazifizierungsverfahren führte Stöver „bis in die jüngste Zeit“ eine „briefliche Verbindung mit dem jüdischen Freund Alfred Ries, Zagreb“128. Dies mag zum Teil erklären, warum die beiden Männer bereits 1949 wieder zusammenarbeiteten. Eine Unbedenklichkeitserklärung von Ries ist in Stövers Entnazifizierungsakte allerdings nicht zu finden.
Dass Alfred Ries überhaupt nach Bremen und zum SV Werder zurückkehrte, war in erster Linie seiner Verbundenheit zu seiner Geburtsstadt und zu seinem Herzensverein sowie in besonderem Maße seinem Willen zur Versöhnung und zum Verzeihen zu verdanken.