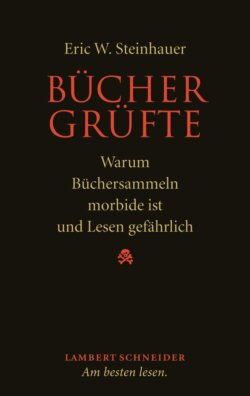Читать книгу Büchergrüfte - Eric Steinhauer - Страница 7
1.
WAS BÜCHERSAMMLUNGEN MIT TOD UND VERFALL ZU TUN HABEN
ОглавлениеFür Menschen, die Bücher lieben, sind Bibliotheken überaus freundliche und sympathische Orte. Hören sie das Wort Bibliothek, so entsteht vor ihrem geistigen Auge das Traumbild eines gemütlichen Lesesaales, wo in gedämpftem Licht edel eingebundene Bände in schönen Regalen stehen; bequeme Sessel laden zum Verweilen ein und zu ausgiebiger Lektüre. Eine etwas zu strenge Bibliothekarin könnte dieses Idyll vielleicht ein wenig stören, aber gleich an Monster zu denken, an Friedhöfe und Gräber, käme wohl niemandem in den Sinn.
Nach der Lektüre des vorliegenden Buches könnte sich das grundlegend ändern. Es wird sich nämlich zeigen, dass Bibliotheken ganz und gar nicht die freundlichen Bücherparadiese sind, als die sie uns immer erscheinen. Vielmehr werden sie sich als überaus morbide, manchmal sogar als regelrecht unheimliche Orte erweisen, die sehr viel mit Tod und Verfall und eher wenig mit Gemütlichkeit zu tun haben. Die Morbidität der Bibliothek drängt sich nicht auf. Sie zeigt sich erst auf den zweiten Blick. Dann aber sehr eindrücklich. Dieser zweite Blick auf ihre dunklen Seiten legt je nach Perspektive echte Leichen, schleichende Verwesung, ansteckende Seuchen, unheimliches Grauen oder melancholische Verstimmungen frei, die in der Zusammenschau die Bibliothek als eine morbide Anstalt, als eine unheimliche Büchergruft erscheinen lassen. Wer jetzt meint, angesichts des digitalen Wandels habe die Bibliothek als Büchersammlung ohnehin keine Zukunft mehr und werde insoweit tatsächlich zu einem Friedhof ungelesener alter Bücher verkommen, die niemand mehr braucht, macht es sich zu leicht. Es kann nämlich sein, dass es gerade ihre dunklen und unheimlichen, ja melancholischen Seiten sind, die langfristig das Überleben der traditionellen Bibliothek sichern werden, weil diese Seiten einem zutiefst menschlichen Bedürfnis entsprechen und mit keiner noch so raffinierten Technik digitalisiert werden können.
Das klingt unwahrscheinlich? Begeben wir uns doch einfach in eine gut besuchte Bibliothek, wie wir sie in jeder größeren Universitätsstadt finden können. Vordergründig betrachtet, befinden wir uns an einem lebendigen Ort mit vielen jungen Menschen. Und weil Bibliotheken reichlich Gelegenheiten bieten, interessante Bekanntschaften zu machen, liegt zudem eine leicht erotische Spannung in der Luft. Von morbider Melancholie aber ist nichts zu bemerken. Wirklich? Schauen wir einfach noch etwas genauer, etwas schärfer hin und fragen uns: Was sehen wir heutzutage eigentlich im Publikumsbereich einer gut frequentierten Bibliothek? Diese Frage ist weniger trivial, als es zunächst scheint. Denn richtet man den Blick auf die Arbeitsplätze der Bibliotheksbesucher, dann fällt sofort auf, dass dort kaum noch Bücher, dafür aber umso mehr Notebooks, Smartphones und andere mobile Endgeräte zu finden sind, begleitet vielleicht noch von etwas Papier, meist Photokopien oder Ausdrucken von Foliensätzen. Was auch immer die Besucher im Lesesaal einer Bibliothek arbeiten, sie tun es jedenfalls nicht mehr mit den dort vorhandenen Büchern. Der reichhaltige Bestand an gedruckter Literatur, der noch vor einigen Jahren viele Leser geradezu magisch angezogen hat, scheint sie nicht mehr zu interessieren. Nur als Treffpunkt und Arbeitsplatz ist die Bibliothek attraktiv geblieben, obwohl man dank der digitalen Möglichkeiten das, was man dort tut, auch überall sonst genauso gut tun könnte.
Ein ähnliches Bild bietet sich bei einem Blick in die Hochglanzbroschüren bibliothekarischer Selbstdarstellung und die einschlägige Fachpresse: Wir sehen auf bunten Photos meist junge Leute mit Notebooks oder Mobiltelefonen hantieren. Die Bücherwand in ihrem Rücken – häufig bibliographische Nachschlagewerke oder Enzyklopädien mit einer ästhetisch besonders ansprechenden Reihenanmutung – ist zu einer bloßen Kulisse geworden, deren einzige Aufgabe es zu sein scheint, dem Betrachter zu signalisieren, dass es irgendwie um Bibliotheken und ihre Dienstleistungen geht.
Komplettiert wird diese Beobachtung durch ein anderes Phänomen, das vordergründig das genaue Gegenteil der demonstrativ inszenierten Digitalität des modernen Bibliothekskunden zu sein scheint. Die Rede ist von opulenten Bildbänden und Kalendern, die ‚schöne alte Bibliotheken‛ abbilden oder von Menschen handeln, die – wie auch immer – ‚mit Büchern leben‘. Aber diese Bildbände und Kalender, so faszinierend sie gerade für den bibliophilen Betrachter auch sein mögen, strahlen eine merkwürdige Sterilität aus, wie sie sonst nur pornographischem Material eigen ist, denn die abgebildeten Bibliotheken sind meist menschenleer. Und die Bücher, mit denen vorgeblich ‚gelebt‘ wird, stehen etwas verloren in ihren Regalen wie wertvolles Porzellan, das zwar bewundert und abgestaubt, aber nur noch selten benutzt wird. Wer wirklich mit seinen Büchern lebt, bei dem bevölkern sie nicht bloß die Regale, bei dem breiten sie sich chaotisch auf Sessel, Tisch und Bett aus. Der echte Büchermensch legt viele kleine Lesezeichen in sie hinein und will sie immer bei der Hand haben. Von alledem aber sieht man in den Bildbänden oder auf den Kalenderblättern fast nichts. Und wenn manche dieser Bildbandbibliophilen zu allem Überfluss noch dazu übergehen, ihre Sammlung farblich zu sortieren, was ja meint, sie als bloßes Dekorationsobjekt zu behandeln, ist das deprimierende Bild komplett. Die schönen alten Bücher werden, und genau darin liegt das Pornographische, nur noch begafft, aber nicht mehr gelesen. Also auch dort, wo in privaten oder traditionsreichen Sammlungen die überkommene Buchkultur eigentlich besonders gepflegt werden sollte, sind Bücher nicht viel mehr als bloße Kulisse und schmückendes Beiwerk. Als Objekte der Lektüre jedoch haben sie offenbar keine Funktion mehr, weder in der Welt einer museal und dekorativ gewordenen Bibliophilie noch im digitalen Alltag der Gegenwart.
Aber einfach wegwerfen wollen wir sie auch nicht. Und tatsächlich ist die Bestürzung groß, wenn Bibliotheken als Einrichtungen geschlossen oder ganze Büchersammlungen vernichtet werden. Denken wir nur an den schrecklichen Brand der Herzogin Anna Amalia Bibliothek am 2. September 2004 in Weimar. Doch was genau regt die Menschen da eigentlich auf, wenn sie selbst kaum noch Bücher zur Hand nehmen? Die in Weimar verbrannten Bücher jedenfalls hätten sie wahrscheinlich niemals gelesen. Und wer wird die 50.000 verbrannten Bände, wenn er ehrlich ist, tatsächlich vermissen? Und trotzdem beklagt man den Verlust. Welche Funktion aber haben weitgehend ungelesene Bücher, die verstaubt und vergessen in den Bibliotheken herumstehen?
Angesichts des dynamischen Medienwandels hin zum Digitalen drängt sich die Metapher eines Friedhofes oder einer Büchergruft geradezu auf, um den Zustand der Bücher zu beschreiben, die bei vollen Lesesälen ungenutzt in den Regalen stehen. Dazu passt, dass unter Bibliothekaren die Rede von einem ‚toten Bestand‘ schon lange üblich und gängig ist, wenn es um selten bis gar nicht nachgefragte Literatur geht. Vielleicht haben Bibliotheken im digitalen Zeitalter ja die merkwürdige Aufgabe, nicht mehr benötigte Bücher wie auf einem Friedhof zwischen Bewahren und Vergehen, zwischen Erinnern und Vergessen in der Schwebe zu halten? Aus der Empörung, ja sogar Trauer, die das Verschwinden von Bibliotheken oft begleitet, spricht nicht nur eine gewisse Sympathie für Randständiges und Lebloses. Darin könnte auch die unausgesprochene Erwartung zum Ausdruck kommen, dass die Bibliotheken sich um diese eigentlich unnützen Bücher kümmern sollten, um sie der Nachwelt zu erhalten. Durch diese Erwartung bekommt die bibliothekarische Arbeit aber einen leicht morbiden Zug, der zunächst freilich, denkt man an den Begriff des ‚toten Bestands’, auf einer rein metaphorischen Ebene verbleibt.
Zu dieser eher bildlich gemeinten Morbidität gehört auch die häufig zu findende Vorstellung, dass in Bibliotheken Lebende und Tote miteinander ins Gespräch kommen, wenn die Verstorbenen in ihren Schriften und Büchern uns anreden und wir durch unsere Lektüre ihre Gedanken und Worte zu neuem Leben erwecken und weiterentwickeln. Sehr passend kann man in älteren Lesesälen manchmal die Inschrift „Mortui vivos docent“ (Die Toten belehren die Lebenden) oder eine ihrer Abwandlungen lesen. Aber nicht nur dort. Der gleiche Spruch findet sich auch auf den Wänden der Sektionssäle anatomisch-pathologischer Institute. Während in der Bibliothek der Geist des Verstorbenen den Leser belehrt, ist es auf dem Sektionstisch sein Körper, der Auskunft gibt. Diese Arbeitsteilung zwischen Büchermagazin und Prosektur aber ist brüchig, denn der Tod in der Bibliothek ist nicht nur eine Metapher, man kann ihm dort auch ganz real begegnen.