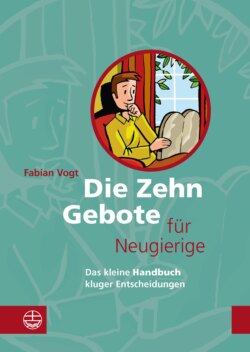Читать книгу Die Zehn Gebote für Neugierige - Fabian Vogt - Страница 13
ОглавлениеDer Schöpfer des Himmels und der Erde hat jeden Menschen dazu bestimmt, sein Repräsentant auf Erden zu sein.
Matthias Köckert
Für das Volk Israel war der Dekalog damals zuallererst eine Auszeichnung. Und was für eine! „Gott zeigt uns, seinem Volk, dessen Freiheit ihm so am Herzen liegt, wie das mit dem Leben funktioniert. Was für ein Geschenk!“ Da erstaunt es nicht, dass die Zehn Gebote bis heute im Judentum hoch geehrt und geachtet werden. Und das seit mehr als 3000 Jahren.
Allerdings: Obwohl die Ereignisse am Sinai gerne auf das 13. Jahrhundert vor Christus datiert werden, stammen die heute überlieferten Aufzeichnungen dieser Worte höchstwahrscheinlich erst aus dem 8. oder dem 6. Jahrhundert vor Christus – und sie werden schon in den fünf Büchern Mose in zwei leicht unterschiedlichen Fassungen überliefert (einmal direkt in der Erzählung von der Verkündigung, 2. Mose 20) und einmal in den Abschiedsreden von Mose, in denen er sich noch einmal an die gute alte Zeit erinnert, 5. Mose 5). Die beiden Versionen stimmen zwar im Wesentlichen überein, bringen aber zum Beispiel recht unterschiedliche Begründungen für das Sabbatgebot.
Zu solchen kleinen Ungereimtheiten kommt die verrückte Situation, dass sich die unterschiedlichen Glaubensgruppierungen der Welt bis heute nicht auf eine gemeinsame Zählweise einigen konnten. Wirklich! Jeder zählt ein bisschen anders. Das liegt unter anderem daran, dass in der Einleitung der Gebote nicht ganz klar ist: Was gehört noch zur Erzählung vom Exodus und was ist schon ein Gebot? Außerdem stellt sich die Frage: Ist die Idee, der Mensch möge sich bitte kein Bild von Gott schnitzen, eine erläuternde Ergänzung des Auftrags „Du sollst keine anderen Götter neben mir haben“ oder ist das ein eigenes Gebot?
Je nachdem, wie man diesen Anfangsteil bewertet und aufteilt, wird dann das Sabbatgebot entweder zum dritten oder zum vierten Gebot. Und weil bei der einen Zählung am Ende dann ja was fehlt, kamen einige Theologen auf die Idee, zum Ausgleich das sehr ausführliche letzte Gebot, nämlich das mit dem „Du sollst nicht begehren …“ in der Mitte zu teilen.
Man muss diese verschiedenen Nummerierungen nicht unbedingt kennen (so wichtig sind sie zum Glück gar nicht), sollte aber zumindest wissen, dass es da Unterschiede gibt. Warum? Na, zum Beispiel, wenn einen jemand schelmisch fragt, wie man’s denn mit dem sechsten Gebot hält. Dann denken Katholiken und Lutheraner nämlich errötend an „Ehebruch“, während Juden, Orthodoxe und Reformierte „eiskalten Mord“ im Blick haben. Um diese numerische Hürde zu umgehen, teile ich den Einleitungsteil der Gebote bewusst in drei Abschnitte, die dann jeder zueinander ordnen und zählen kann, wie er will – bin mir aber bewusst, dass ich damit das Problem nicht wirklich löse.
Ähnlich unklar wie die Nummerierung ist bis heute die Gliederung der Zehn Gebote. Gliederung? Natürlich: Da in der Geschichte vom Sinai ja berichtet wird, Gott habe sein Werk auf zwei Steintafeln gemeißelt, wird seit Ewigkeiten darüber sinniert, welche Gebote wohl auf welcher Tafel standen. Witzig, oder? Das klingt auf den ersten Blick ziemlich banal, bringt aber ganz ernsthafte theologische Fragestellungen mit sich. Zum Beispiel: Unterscheidet Gott möglicherweise zwischen den Geboten, die ihn selbst betreffen, und denjenigen, die das menschliche Miteinander beschreiben? Geht es also erst um die Gottesliebe und anschließend um die Menschenliebe? Und wenn dem so ist, gehört dann das Sabbatgebot mit zum Aspekt „Gott ehren“ oder gehört es eher auf die zweite Tafel zur Sammlung „Menschen ehren“? Höchst kompliziert. Zumal man im Judentum selbst das „Achten der Eltern“ als Einbindung der Generationen in die große Geschichte Gottes mit den Menschen versteht und es somit kurzerhand den Gottesgeboten zuordnet.
Für alle Besserwisser kommen hier die korrekten Zahlen: Im Judentum glaubt man, auf jeder Tafel hätten 5 Gebote gestanden. Katholiken und Lutheraner gehen davon aus, dass links 3 und rechts 7 Gebote standen, und der Rest pocht auf 4 + 6. Wobei das insgesamt völliger Humbug ist, weil man Hebräisch ja von rechts nach links schreibt, so dass die Aufteilung auf den Tafeln ursprünglich genau andersherum war: rechts 3 und links 7 … oder so. Irgendwie halt.
All das tut aber für das Verständnis der jeweiligen Ideale doch nicht ganz so viel zur Sache. Viel entscheidender ist, dass wir jetzt – nach Abklärung dieser letzten Details – endlich mit dem ersten Gebot einsteigen können.