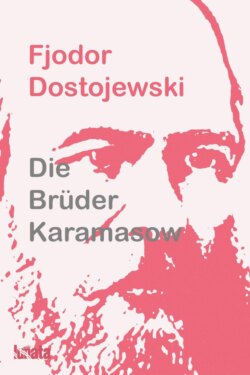Читать книгу Die Brüder Karamasow - Fjodor Dostojewski - Страница 10
3. Die zweite Ehe und die Kinder daraus
ОглавлениеBald nachdem Fjodor Pawlowitsch den vierjährigen Mitja losgeworden war, heiratete er zum zweitenmal, und diese zweite Ehe dauerte ungefähr acht Jahre. Er holte sich seine zweite, ebenfalls sehr junge Frau, Sofja Iwanowna, aus einem anderen Gouvernement, wohin er mit einem Juden wegen eines kleinen Liefergeschäfts gefahren war. Obgleich Fjodor Pawlowitsch ein Trinker und Wüstling war, beschäftigte er sich nämlich ununterbrochen mit der vorteilhaften Anlage seines Kapitals und brachte seine Geschäftchen immer glücklich, wenn auch fast immer auf betrügerische Weise, zu Ende. Sofja Iwanowna, Tochter eines Diakons, war seit ihrer Kindheit Waise; aufgewachsen war sie im Hause ihrer Wohltäterin, Erzieherin und Peinigerin, einer angesehenen reichen, alten Dame, der Witwe des Generals Worochow. Näheres weiß ich nicht; ich habe nur gehört, daß man die sanfte, gutmütige, fügsame Pflegetochter einmal aus einer Schlinge befreite, die sie an einem Nagel in der Rumpelkammer befestigt hatte – so schwer ertrug sie den Eigensinn und die ewigen Vorwürfe der boshaften Alten, die durch den Müßiggang ein so unausstehlicher Querkopf geworden war. Fjodor Pawlowitsch bewarb sich um die Hand des Mädchens, die alte Frau zog Erkundigungen ein und wies ihm die Tür; und wieder schlug er, wie bei seiner ersten Ehe, eine Entführung vor. Wahrscheinlich hätte sie ihn um keinen Preis geheiratet, wäre ihr rechtzeitig Näheres über ihn bekannt gewesen. Aber er stammte aus einem anderen Gouvernement, und der Verstand des sechzehnjährigen Mädchens reichte nur zu der Überlegung: Lieber in den Fluß gehen als länger bei der Wohltäterin bleiben. So vertauschte sie die Wohltäterin mit einem Wohltäter. Fjodor Pawlowitsch erhielt diesmal keine Kopeke; die Generalin war wütend, gab nichts und verfluchte die beiden. Er hatte auch nicht damit gerechnet, etwas zu bekommen; ihn reizte nur die auffallende Schönheit des Mädchens, vor allem ihr unschuldiger Gesichtsausdruck, der auf ihn, den immer nur lüsternen Liebhaber körperlicher weiblicher Reize, starken Eindruck machte. »Diese unschuldigen Äuglein strichen mir damals wie ein Rasiermesser übers Herz«, sagte er später mit seinem gemeinen häßlichen Kichern. Doch auch das konnte für einen so verdorbenen Menschen nichts anderes als ein sinnlicher Reiz sein. Da er von seiner Heirat keinerlei materiellen Vorteil hatte, machte Fjodor Pawlowitsch mit seiner Frau keine Umstände; sie hatte ihm sozusagen »Schaden gebracht«, und er hatte sie gewissermaßen »aus der Schlinge genommen« – also trat er, ihre unglaubliche Demut und Fügsamkeit ausnutzend, die gewöhnlichsten ehelichen Anstandsregeln geradezu mit Füßen. In seinem Hause feierte er vor den Augen seiner Frau Orgien mit liederlichen Weibern. Als charakteristisch führe ich an, daß sich der Diener Grigori, ein finsterer, dummer, eigensinniger, rechthaberischer Mensch, der die frühere Hausfrau, Adelaida Iwanowna, gehaßt hatte, diesmal auf die Seite der Frau stellte und sich ihretwillen mit Fjodor Pawlowitsch für einen Diener fast unerlaubt heftig stritt. Einmal verhinderte er sogar eine Orgie und jagte alle Dirnen gewaltsam aus dem Haus. Später bekam die unglückliche, seit frühester Kindheit verschüchterte junge Frau eine Art nervöse Frauenkrankheit, die am häufigsten beim einfachen Volk, bei Bäuerinnen, vorkommt, die sogenannte »Schreikrankheit«. Infolge dieser mit hysterischen Anfällen verbundenen Krankheit verlor sie zeitweilig sogar den Verstand. Sie gebar jedoch ihrem Mann zwei Söhne, Iwan und Alexej, Iwan im ersten Jahr ihrer Ehe, Alexej drei Jahre später. Als sie starb, war der kleine Alexej noch keine vier Jahre alt, und wenn das auch seltsam ist, ich weiß zuverlässig, daß er sich später sein ganzes Leben an die Mutter erinnerte, natürlich nur wie im Traum. Nach ihrem Tod erging es den beiden Knaben fast ebenso wie dem ersten, Mitja: Der Vater vergaß sie und kümmerte sich nicht im geringsten um sie; sie kamen zu demselben Grigori ins Gesindehaus. Da fand sie auch die alte querköpfige Generalin, die Wohltäterin und Erzieherin ihrer Mutter. Sie war noch am Leben und hatte all die acht Jahre die ihr angetane Kränkung nicht vergessen. Über Sofjas Schicksal hatte sie ständig unterderhand die genauesten Nachrichten erhalten, und als sie hörte, wie krank sie war und unter welchen schlimmen Umständen sie lebte, hatte sie mehrmals zu ihren Kostgängerinnen gesagt: »Das geschieht, ihr recht; das hat ihr Gott zur Strafe für ihre Undankbarkeit geschickt.«
Genau drei Monate nach Sofja Iwanownas Tod erschien die Generalin plötzlich in unserer Stadt und fuhr geradewegs zu Fjodor Pawlowitsch. Sie hielt sich zwar nur ungefähr eine halbe Stunde auf, richtete aber dennoch viel aus. Es war gegen Abend. Fjodor Pawlowitsch, den sie in den acht Jahren nicht gesehen hatte, empfing sie betrunken. Sie soll ihm sofort ohne alle Erklärungen zwei schallende Ohrfeigen versetzt und ihn dreimal an den Haaren fast bis zur Erde gezerrt haben. Dann ging sie, ohne ein Wort zu sagen, in das Gesindehaus zu den Knaben. Da sie auf den ersten Blick sah, daß sie ungewaschen waren und schmutzige Wäsche trugen, verabreichte sie unverzüglich auch noch dem Diener Grigori eine Ohrfeige und erklärte ihm, sie werde die Kinder zu sich nehmen. Darauf nahm sie die beiden, wie sie waren, wickelte sie in eine Decke, setzte sie in den Wagen und fuhr mit ihnen in die Stadt, wo sie wohnte. Grigori ertrug die Ohrfeige wie ein Sklave, wortlos; als er die alte Dame zum Wagen geleitete, verbeugte er sich tief und sagte eindringlich, Gott werde ihr lohnen, was sie an den Waisen tun wolle. »Ein Tölpel bist du trotzdem!« rief ihm die Generalin im Abfahren zu. Fjodor Pawlowitsch fand bei näherer Überlegung die Sache ganz in Ordnung und erhob später bei seinem formellen Einverständnis mit der Erziehung der Kinder durch die Generalin in keinem Punkt Einspruch. Von den Ohrfeigen jedoch erzählte er selbst in der ganzen Stadt.
Bald darauf starb auch die Generalin. In ihrem Testament hatte sie für jeden der Knaben tausend Rubel ausgesetzt; das Geld sollte unter allen Umständen für sie und nur für sie verausgabt werden, »zu ihrer Erziehung«, und zwar so, daß es bis zu ihrer Volljährigkeit reiche; für derartige Kinder reiche ein solches Geschenk vollauf; wenn jemand Lust habe, so möge er selbst seinen Beutel auftun und so weiter, und so weiter. Ich habe das Testament nicht gelesen, weiß aber, daß es wirklich solch eine sonderbare Bestimmung enthielt. Der Haupterbe der Alten, der Adelsmarschall jenes Gouvernements, Jefim Petrowitsch Poljonow, erwies sich allerdings als Ehrenmann. Nach einer langen Korrespondenz mit Fjodor Pawlowitsch mußte er einsehen, daß von ihm kein Geld zur Erziehung seiner Kinder zu bekommen war; der Vater weigerte sich zwar nie direkt, zog aber die Sache in die Länge und erging sich höchstens in sentimentalen Redensarten. Also nahm er sich selbst der Kinder an und gewann vor allem Alexej, den jüngeren, lieb; dieser wurde sogar lange Zeit in seiner Familie erzogen. Dies bitte ich von vornherein zu beachten. Wenn die jungen Menschen jemandem für ihre Erziehung und Bildung zu Dank verpflichtet waren, so Jefim Petrowitsch, einem edeldenkenden, humanen Menschen, wie man ihn selten findet. Er ließ die von der Generalin hinterlassenen Summen von je tausend Rubeln unangetastet, so daß sie bei Volljährigkeit der Knaben mit den Zinsen auf je zweitausend angewachsen waren, erzog die Knaben auf seine eigenen Kosten und gab dabei natürlich weit über tausend Rubel für jeden aus. Auf eine ausführliche Schilderung ihrer Kinder- und Jugendzeit verzichte ich wiederum, ich führe nur das Wichtigste an. Iwan entwickelte sich zu einem finsteren, verschlossenen Knaben; er war nicht schüchtern, schien aber schon als Zehnjähriger zu spüren, daß sie in einer fremden Familie aufwuchsen und von fremder Barmherzigkeit lebten und daß sie einen Vater hatten, dessen man sich schämen mußte und so weiter, und so weiter. Dieser Knabe zeigte schon in früher Kindheit (wenigstens erzählte man das) ungewöhnliche, glänzende Fähigkeiten. Ich weiß nichts Genaues, jedenfalls verließ er wohl, kaum dreizehnjährig, die Familie Jefim Petrowitschs und kam auf ein Moskauer Gymnasium, wo ein erfahrener, angesehener Pädagoge, ein Jugendfreund Jefim Petrowitschs, ihn in Pension nahm. Iwan selbst erzählte später, all das sei eine Folge von Jefim Petrowitschs »feuriger Begeisterung für gute Taten« gewesen; er habe sich durch die Idee begeistern lassen, ein genial veranlagter Knabe müsse auch einen genialen Erzieher haben. Übrigens waren Jefim Petrowitsch wie auch der geniale Erzieher bereits tot, als der junge Mann nach dem Gymnasium die Universität bezog. Da Jefim Petrowitsch mangelhafte Anordnungen getroffen hatte und die Auszahlung des Geldes der Generalin sich infolge der unvermeidlichen Formalitäten verzögerte, ging es dem jungen Mann in den beiden ersten Universitätsjahren recht schlecht; er mußte selbst für seinen Unterhalt sorgen und gleichzeitig studieren. Es sei vermerkt, daß er nicht einmal versuchte, mit seinem Vater in Briefwechsel zu treten – vielleicht aus Stolz oder aus Verachtung, vielleicht auch in der kühlen, gesunden Erkenntnis, daß von seinem werten Papa doch keine ernsthafte Beihilfe zu erwarten war. Wie auch immer, jedenfalls verlor der junge Mann nicht den Kopf und verschaffte sich Arbeit. Zuerst gab er Privatstunden für zwanzig Kopeken, dann lieferte er bei den Zeitungsredaktionen zehnzeilige Artikel über Straßenvorfälle mit der Unterschrift »Ein Augenzeuge« ab. Die kleinen Notizen sollen immer so interessant und pikant abgefaßt gewesen sein, daß sie schnell Anklang fanden. Schon hierdurch zeigte der junge Mann seine praktische und geistige Überlegenheit gegenüber den vielen, immer notleidenden und unglücklichen studierenden Jugendlichen beiderlei Geschlechts, die in den Hauptstädten von früh bis spät in die Redaktionen der Zeitungen und Journale laufen und nichts Besseres wissen, als ständig zu betteln, man möge ihnen Übersetzungen aus dem Französischen oder die Anfertigung von Reinschriften übertragen. Einmal mit den Redaktionen bekannt geworden, brach Iwan Fjodorowitsch die Verbindungen nicht wieder ab und ließ in seinen letzten Universitätsjahren talentvolle Rezensionen von allerlei fachwissenschaftlichen Büchern drucken, so daß er sogar in literarischen Kreisen bekannt wurde. Jedoch zog er erst in der allerletzten Zeit, und zwar ganz plötzlich, die Aufmerksamkeit eines größeren Leserkreises auf sich. Ein ziemlich eigenartiger Zufall brachte es mit sich, daß ihn auf einmal viele beachteten und in Erinnerung behielten. Als Iwan Fjodorowitsch eigentlich schon von der Universität abgehen und für seine zweitausend Rubel ins Ausland reisen wollte, veröffentlichte er in einer der größten Zeitungen plötzlich einen sonderbaren Aufsatz, der ihm sogar beim nichtfachmännischen Publikum Beachtung verschaffte. Es war ein Aufsatz über ein Thema, das ihm anscheinend ganz fernlag, da er Naturwissenschaften studiert hatte: die kirchliche Gerichtsbarkeit. Nachdem er einige andere Meinungen geprüft hatte, trug er seine persönliche Ansicht vor. Besonderes Interesse erregten der Ton seiner Arbeit und ihre überraschenden Schlußfolgerungen. Viele Kirchliche hielten den Verfasser für einen ihrer Anhänger, bis ihm auf einmal nicht nur die Verfechter ziviler Gerichtsbarkeit, sondern auch die Atheisten Beifall spendeten. Schließlich erklärten einige besonders scharfsinnige Köpfe, der ganze Aufsatz sei nur eine dreiste Farce und eine Verhöhnung. Ich erwähne das alles, weil der Aufsatz seinerzeit auch in das berühmte Kloster nahe unserer Stadt gelangte und bei dessen Insassen, die sich lebhaft für die Frage der kirchlichen Gerichtsbarkeit interessierten, die größte Verwunderung hervorrief. Als sie dann den Namen des Verfassers erfuhren, erregte es ihr besonderes Interesse, daß er aus unserer Stadt stammte und ein Sohn »eben dieses Fjodor Pawlowitsch« war. Gerade zu dieser Zeit erschien übrigens auch der Verfasser selbst in unserer Stadt.
Warum kam Iwan Fjodorowitsch damals zu uns? Ich habe mir diese Frage, gleichsam beunruhigt schon damals gestellt. Diese verhängnisvolle Ankunft, die vielerlei Folgen hatte, blieb mir noch lange nachher, ja fast immer unklar. Es war schon an und für sich seltsam, daß ein derart gelehrter, stolzer und anscheinend vorsichtiger junger Mann in solch einem Haus erschien, bei einem Vater, der ihn zeit seines Lebens ignoriert hatte, der unter keinen Umständen Geld herausrücken würde, auch wenn er vom eigenen Sohn darum gebeten worden wäre, und der dennoch sein Leben lang fürchtete, seine Söhne Iwan und Alexej könnten einmal kommen und Geld von ihm verlangen. Und siehe da, der junge Mann läßt sich im Haus dieses Vaters nieder, bleibt einen und noch einen Monat bei ihm, und beide leben so gut miteinander, wie man es sich besser nicht vorstellen kann. Das letztere erstaunt mich besonders, und so wie mir ging es vielen. Pjotr Alexandrowitsch Miussow, der entfernte Verwandte Fjodor Pawlowitschs, von dem ich schon gesprochen habe, tauchte damals zufällig wieder bei uns, auf seinem nahe bei der Stadt gelegenen Gut, auf, er war aus Paris, wo er ständig wohnte, zu Besuch gekommen. Ich erinnere mich, daß gerade er sich am allermeisten wunderte, nachdem er den jungen Mann kennengelernt hatte; er interessierte ihn sehr, und nicht ohne innerlichen Schmerz maß er sich manchmal mit ihm im Wissen. »Er ist stolz«, sagte er damals zu uns, »er wird sich stets sein Geld verdienen, hat auch jetzt schon genug zu einer Auslandreise – was will er denn hier? Daß er nicht zu seinem Vater gekommen ist, um Geld zu erbitten, ist klar: Der Vater gibt ihm auf keinen Fall welches. Trinken und Ausschweifungen mag er nicht, und doch kann der Alte nicht mehr ohne ihn leben, so haben sie sich aneinander gewöhnt!« Das war die Wahrheit. Der junge Mann hatte sogar sichtlich Einfluß auf den Alten; ja, dieser begann beinahe schon, auf ihn zu hören, obwohl er mitunter ungewöhnlich und geradezu boshaft eigensinnig war. Bisweilen benahm er sich sogar etwas anständiger ...
Erst später stellte sich heraus, daß Iwan Fjodorowitsch teils auf Bitten, teils in Angelegenheiten seines älteren Bruders Dmitri Fjodorowitsch gekommen war. Ihn sah er damals gleichfalls zum erstenmal, hatte mit ihm aber schon vor seiner Ankunft aus Moskau in einer wichtigen Sache, die mehr Dmitri Fjodorowitsch anging, in Briefwechsel gestanden. Was das für eine Sache war, wird der Leser später ausführlich erfahren. Trotzdem erschien mir, auch als ich diesen Umstand kannte, Iwan Fjodorowitsch noch immer rätselhaft, und sein Besuch blieb mir unerklärlich.
Ich füge noch hinzu, Iwan Fjodorowitsch schien damals zwischen dem Vater und seinem älteren Bruder Dmitri Fjodorowitsch vermitteln zu wollen, denn der letztere hatte sich mit dem Vater zerstritten und sogar einen formellen Prozeß gegen ihn angestrengt.
Ich wiederhole, diese kleine Familie war damals zum erstenmal im Leben vollzählig beisammen, einige von ihnen sahen sich überhaupt zum erstenmal. Nur der jüngste Sohn, Alexej Fjodorowitsch, lebte bereits ein Jahr bei uns; er war also früher als alle Brüder zu uns gekommen. Über ihn in der einleitenden Erzählung zu sprechen, bevor ich ihn im Roman auf die Bühne bringe, fällt mir besonders schwer. Ich muß aber auch über ihn eine Vorbemerkung machen und vorbereitend einen sonderbaren Punkt erklären; ich bin nämlich genötigt, meinen künftigen Helden gleich in der ersten Szene in der Kutte eines Novizen vorzustellen. Ein Jahr etwa hatte er damals schon in unserm Kloster verbracht, und er bereitete sich, wie es schien, ernstlich darauf vor, sich für das ganze Leben darin einzuschließen.