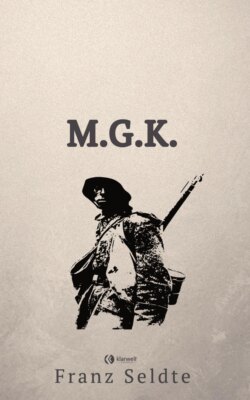Читать книгу M.G.K. - Franz Seldte - Страница 7
3. Kapitel. Vormarsch.
Оглавление„Verflucht, dieses frühe Werken, es kann einem den ganzen Feldzug verleiden“, brummte Stahl, noch halb schlafend, vor sich hin, um dann laut fortzufahren:
„Herein, wenn‘s kein Schneider ist!“
Es war nicht der erwartete Schütze Bremer, Bursche und Gefechtsordonnanz in einer Person, sondern der Vizefeldwebel Jäckel, der auf einer Meldekarte seinem Zugführer einen tadellos geschriebenen Etat- und Mannschaftsbestand des ersten Zuges übergab.
„Donnerwetter, Jäckel, da haben Sie ja die reine Geschäftsinventur aufgenommen. Danke schön! Haben Sie schon Kaffee getrunken? Kommen Sie mit ran und frühstücken Sie mit. Und vorher, während ich mich wasche, haben Sie die Freundlichkeit, mir das ganze Schauspielerpersonal des ersten Maschinengewehrzuges zu erklären. Bitte kriegen Sie keinen Schreck. Ich pflege morgens zu müllern, aber ich denke, Sie werden schon Menschen in ihrem Urzustande gesehen haben.“
Während nun Stahl einen kurzen Müller-Übungsgang machte und sich in seiner Gummibadewanne kalt mit Hilfe eines großen Schwammes abduschte, stand Jäckel am Fenster und hielt einen begeisterten Bericht, dass der erste Zug der Maschinengewehrkompagnie Altmark aus einem Führer, nämlich dem Leutnant Stahl, aus zwei Maschinengewehrbedienungen, aus soundso viel Reserveschützen, soundso viel Pferden, soundso viel Fahrzeugen usw. bestände.
Dass weiter die tüchtige Kompaniemutter, der Kompaniefeldwebel Bach, ein Ostpreuße, von den Leuten „Der Russe“ genannt, und der in seinem Fache gewaltig tüchtige Fahnenschmied, der Sergeant Wieland, dem ersten Zuge zugeteilt wären.
Stahl hatte an der frischen Weise des Vizefeldwebels, der der erste Gewehrführer des Zuges war, seine helle Freude, und diese Freude steigerte sich, als er nachher vor seinem Zuge stand und sich nach Jäckels Plan jeden einzelnen Mann ansah und sich mit jedem einzelnen, nach Namen, Stand und Familienverhältnissen und Heimatsort fragend, bekannt machte.
Den größten Teil der Unteroffiziere und Mannschaften kannte Stahl schon von seiner letzten Übung aus dem Jahre 1913 her, die er bei der Maschinengewehrkompanie aus dem Truppenübungsplatz abgeleistet hatte.
Es waren alles ausgezeichnete, kräftige norddeutsche Jungen, meist Söhne der engeren Heimat, Altmärker. Und auch die eingezogenen Reservisten schienen sich gut einzupassen.
Der Zugführer sah dann sorgfältig die Geschirre, Fahrzeuge und Ausrüstung der Mannschaft durch, und als er den Eindruck gewonnen hatte, dass alles gut im Schwung war, versammelte er Schützen und Fahrer um sich und sagte ihnen, dass er den Dienst streng, korrekt und gerecht auffassen wolle, dass er in und außer Dienst für jeden da sein wolle und dass er nicht nur Vorgesetzter sein, sondern zu jedem jederzeit in kameradschaftlichem Verhältnis stehen wolle.
Stahl glaubte den richtigen Ton getroffen zu haben, als er Vertrauen und Verständnis in den ruhigen Mienen dieser Männer aus Altmärker Stadt und Land las, und gelobte sich innerlich selbst, alles, was in seinen Kräften stände, für seine Leute zu tun.
Aus diesen Gedanken weckte ihn die scharfe Kommandostimme seines Kameraden, des Leutnant Richard Redern, der den zweiten Zug führte und der älteste der Zugführer war. Redern forderte Meldung des Zuges und teilte ihm mit, dass der Hauptmann befohlen habe, der in der Kompanie jeweilig älteste Offizier hätte beim Antreten die Kompanie zu revidieren und dem Führer zu melden.
5.20 Uhr erschien der Hauptmann, nahm die Meldungen des ältesten Offiziers und den Rapport des Feldwebels entgegen und ließ Punkt 5.30 Uhr antreten, um die Maschinengewehrkompanie in die Marschkolonne des Regiments einzufädeln.
In langem Kriegsmarsche, eingereiht in die Marschordnung laut Divisionsbefehl, zog das Regiment in südlicher Richtung.
Es war ein wundervoller Sommermorgen. Die Frische des Morgens ließ aber unter der aufsteigenden Sonne bald nach, und die noch nicht marschgewohnte Truppe hatte keinen Blick für das taufrische Land, sondern empfand die zunehmende Hitze quälend und war froh, als um 11 Uhr Ortsunterkunft bezogen wurde.
Die Müdigkeit aber war vergessen, als ein deutscher Flieger eine Meldung abwarf, die die Mitteilung vom Siege bei Lunéville brachte. Großer Jubel brauste durch die Reihen.
Nach der Mittagsrast wurden die Schutzschilde hervorgeholt, und die Züge exerzierten zum ersten Male mit ihnen. Hierbei machte man die Erfahrung, dass die Schilde sich trotz ihrer Kleinheit von der Umgebung durch ihre metallische Farbe zu sehr abhoben.
Richard Redern aber bewies, dass er nicht nur ein guter Kroki- und Kartenzeichner war, und ließ die Schilde mit einem buntgemaserten Anstrich versehen. Er traf damit instinktiv die in den letzten Kriegsjahren übliche Aufteilung der Flächen an Fahrzeugen und Geschützen in unregelmäßige farbige Ornamente.
Am Morgen des 13. August, 1.45 Uhr, wurde das Regiment alarmiert und begann, zum Gros gehörend, den Vormarsch über Aachen. Die Sonne meinte es bald wieder besonders gut.
Auf den überfüllten Straßen geht der Marsch. Das Gelände beginnt hügelig zu werden. Der Marsch ist anstrengend, und aufatmend begrüßt die Truppe einen langen Halt von 2 ½ Stunden vor der Stadt. Dann folgt der lange und anstrengende Marsch durch Aachen, wo der kommandierende General des Armeekorps den Vorbeimarsch abnimmt.
Die Bevölkerung Aachens begrüßt begeistert die durchmarschierenden Truppen und überschüttet sie mit Liebesgaben und Blumen. Früchte, Schokolade, Gläser mit Wein werden den Soldaten gereicht. Man muss aufpassen, dass es des Guten nicht zu viel wird, und muss überhaupt Obacht geben. Das wurde dem Leutnant Stahl schnell und eindringlich beigebracht. Beim Reiten auf einer abschüssigen Straße hatte er mehr Augen für die Bevölkerung als auf sein Pferd, und mit einem Male wurde er aus der Begeisterung jäh zur Erde zurückgeführt, als er aus dem Sattel seines hochbeinigen Braunen, der über eine Apfelsinenschale ausrutschte, mit der Verlängerung des Rückens auf dem nicht sehr elastischen Straßenpflaster landete.
Er hörte die Engel im Himmel pfeifen, und es war ihm, als ob die Sonne außer ihrer Wärme auch noch einige Kugelblitze von sich gegeben hätte.
Wäre ihm der Sturz zu Hause passiert, so hätte er sicher alle Viere von sich gestreckt und sich reif für eine Tragbahre empfunden. So aber, angesichts seiner Leute und der jubelnden Bevölkerung, riss er das Pferd hoch, sprang mit einem Satz und mit einem stummen Fluch hinauf und ritt weiter, als ob nichts geschehen wäre.
Als Aachen endlich durchschritten war, kreuzte sich das Regiment mit Truppenteilen, die von Lüttich, das sie erobert, zurückkamen. Man sah in den Marschkolonnen Leute mit leichten Verwundungen und sah auch gefangene Belgier.
Mit starkem Interesse, auch mit einem Anflug von Eifersucht, blickten die frischen Regimenter auf ihre Kameraden, die schon die Feuertaufe hinter sich hatten. Aus den Marschkolonnen flogen von den Altmärkern Rufe und Fragen zu den siegreichen Kameraden hinüber. Vor allem die Frage: „Na, wie war‘s denn?“ Und die Antwort kam zurück: „Das werdet ihr alleene schon früh jenug merken!“ —
Hinter Aachen teilten sich die Straßen. Ein Pionierkommando wies die Wege an, und als Leutnant Stahl die scharfe Stimme des über und über mit Staub bedeckten Pionieroberleutnants veranlasste, näher hinzuschauen, erkannte er in ihm seinen alten Korpsbruder und sein Konsemester Friedrich Wilhelm Keil aus Oker am Harz wieder. Scharf leuchteten aus dem gesunden Gesicht des alten Herrn Kilian die beiden pfündigen Durchzieher. Die scharfe Nase ragte wie immer trotzig in die Luft, und beim Kommandieren rollte die Zunge mit altgewohntem Schlage des Harzer Edelrollers, wie es sich für einen alten Mensursekundanten geziemt.
„Grüß Gott, alter Sankt Kilian!“
„Grüß di Gott, alter Bazi Tobias, und das Leben noch frisch und der altgermanische Durst?“
„Jawoll, altes Konsemester. Schwingt Ihr den Humpen noch wie sunst?“
„Umsunst.“
Lachend trennten sie sich. Wie der Igel zur Zylinderbürste, dachte sich Stahl, passt dieses fröhliche Umtrunkswort in diese gottverdammte, staubige Hitze, wo man nicht Pfungstädter Heiles, sondern Sand in der Kehle hat.
Die Hitze wurde immer drückender, und die Truppe musste einen bemerkbaren Ausfall an Marschkranken abgeben. Rechts und links in den Chausseegräben sah man sie mit geöffnetem Waffenrock liegen. Das Gros marschierte unaufhaltsam vorwärts. Das Ziel für das Regiment waren für heute die drei Orte an der Grenze: Neutral-, Preußisch- und Belgisch-Moresnet.
‘Belgisch-Moresnet sollte unbedingt vor dem Einmarsch der Feinde besetzt werden und die Marschstraße gesichert sein, weil sich mehrende Anzeichen von der Aufhetzung belgischer Zivilbevölkerung und hinterlistige Franktireurüberfälle auf deutsche Soldaten bemerkbar machten.
Vom Hauptmann, der vorn beim Regimentsstabe ritt, wie es als Kompanieführer der Maschinengewehrkompanie seine Bestimmung war, kam ein Radfahrer, um die beiden Leutnants Stahl und Redern nach vorn zu holen. Beide trabten an der Kolonne vorbei und meldeten sich beim Kompanieführer. Dieser ritt mit ihnen zum Regimentskommandeur vor, und hier bekamen die beiden Maschinengewehroffiziere den Auftrag, mit einer starken Husarenpatrouille nach Belgisch-Moresnet vorauszureiten und das dort in der Nähe befindliche feste Schloss zu besetzen.
Das war der erste kriegerische Auftrag, und den Leutnants wurde es gehörig warm um das Herz, als sie zur Kompanie zurückkehrten und den Befehl und die Führung ihrer Züge ihrem dienstältesten Vizefeldwebel übertragen. Dann wechselten beide die Pferde, befahlen ihre Reitburschen zu sich und begaben sich wieder zum Regimentsstabe. Nach kurzer Zeit trabte ein Halbzug Husaren heran, dessen Führung Leutnant Redern übernahm.
Um Zeit zu gewinnen, ließ Redern trotz der Hitze Trab und Galopp reiten und legte nur die unbedingt nötigen Schrittpausen für die Pferde ein. Rechts der Straße tauchte nach kurzer Zeit das erwartete schlossartige Gebäude auf. Der Führer ließ halten und besprach die Lage. Man kam überein, dass das Schloss im Halbkreis umstellt werden sollte. Mit einer kleinen Patrouille von wenigen Mann sollte der Leutnant Stahl durch das offene Tor einreiten und, falls er das Schloss unbesetzt fände, den Rest der Reiter nachholen.
Als die Umgehung ausgeführt war, wurde den Reiten: noch eine kurze Pause zum Verschnaufen gegeben. Dann erklang das Pfeifensignal, der Leutnant Stahl zog die Parabellum-Pistole, seine Husaren legten die Lanzen ein und mit einem scharfen Hurra brachen sie aus dem Hinterhalt heraus auf die Chaussee, scharf rechts ab über die Brücke in das Schloss ein. Vor einer Freitreppe rissen sie die Pferde hoch, und dampfend und schnaubend tanzten die erregten Tiere auf dem Hofe.
Auf die Freitreppe aber traten zwei ältere Männer, von denen der eine ein Verwalter, der zweite der Besitzer sein konnte. Der Leutnant Stahl ritt an die beiden heran und teilte ihnen in kurzer dienstlicher Form mit, dass er laut Befehl den Schlosshof besessen müsse, dass jeder Widerstand zwecklos wäre und die Besitzer sich in die Lage zu finden hätten, widrigenfalls —. Während Stahl diese wohlgesetzte Rede hielt, tänzelte sein Pferd unter ihm herum, und ob er wollte oder nicht, er musste einen Blick auf die Toreinfahrt werfen.
Vor Erstaunen wäre er beinahe vom Gaul gefallen. Denn rechts und links der Schlosseinfahrt standen zwei Schilderhäuser, und vor diesen präsentierten sage und schreibe in der Tracht friderizianischer Grenadiere zwei entsprechend bemalte lebensgroße Holzfiguren das Gewehr. Als er mit einem Ruck seinen Gaul wieder rumgeworfen hatte, sah Stahl in das lächelnde Gesicht des älteren Herrn, der mit freundlicher, ruhiger Stimme sagte: „Herr Leutnant, Sie hätten sich nicht so anstrengen brauchen, ich habe gar nichts gegen Deutschland, mein Schwiegersohn ist selber preußischer Major.“
Einen Augenblick sah Stahl den Redner verblüfft an, dann sprang er vom Gaul herunter, warf seinem Reitburschen Mariechen die Zügel zu, ging die Freitreppe zu dem alten Herrn hinauf, stellte sich vor und sagte: „Nun dann geben Sie uns wenigstens für die schöne Fantasia, die wir Ihnen vorgeritten, einen guten Bügeltrunk.“ Der Besitzer nickte lächelnd Gewähr und führte den Leutnant in ein kühles Jagdzimmer.
Als kurz darauf der Leutnant Redern mit dem Hauptteil der Patrouille erschien, fand er zu seiner Verblüffung einen guten Römer Rheinwein als Friedenstrunk für sich schon bereitstehen. Nachdem noch einer zweiten Flasche der Garaus gemacht war, die Husaren ihre Pferde getränkt und etwas abgefüttert hatten, ritt der Trupp weiter, um nunmehr auch durch Belgisch-Moresnet durchzustoßen und die Straßenkreuzungen zu besetzen und zu sichern.
An einer der Nebenchausseen fanden sie beim Rekognoszieren eine reizende kleine Villa, in der ein deutscher Ingenieur mit Frau und Kindern wohnte. Hier wurden sie zum Kaffee eingeladen und zum Abendbrot. Der gastfreundliche Ingenieur wusste zu berichten, dass die Belgier über einzelne versprengte deutsche Patrouillen unweit Aachen hergefallen seien und sie ermordet hätten.
„Ich weiß nicht, meine Herren, ob Sie Belgien kennen mit seinen zwei Bevölkerungsschichten, den Flamen und den Wallonen. Besonders bei den letzteren handelt es sich um eine einfache, unwissende Industriebevölkerung, fanatisiert und in der Hand des niederen Klerus, der gegen die Deutschen hetzt. In Belgien, dem Land der Kleinwaffenindustrie, hat schon jeder Lausejunge den Browning in der Tasche. Von der Größe des deutschen Heeres haben diese kindlichen Fanatiker keine Ahnung und sie denken mit ihren Revolvern den Vormarsch aufhalten zu können.“
Der Hausherr ließ es sich nicht nehmen, die Abendtafel festlich zu bestellen und fuhr die Offiziere sogar mit dem Auto zum unweit gelegenen Biwakplatz der Kompanie zurück.
Bei Belgisch-Moresnet biwakierte die Truppe zum ersten Mal im Freien. Die Zelte waren aufgeschlagen, die Wachtfeuer lohten und den Maschinengewehroffizieren bot sich das wundervolle Bild eines nächtlichen Heerlagers. Das kleine Offizierszelt hatten die Burschen schon gerichtet, die Schlafsäcke lagen bereit, die Oberkleider wurden abgeworfen, und der Hauptmann gebot Ruhe.
Stahl konnte lange nicht zum Schlaf kommen. Das Schlafen auf knisterndem Stroh war doch noch ungewohnt. Die Geräusche der Nacht, die Tritte der Posten, das Stampfen der an langen Leinen angepflockten Pferde, das Durchscheinen der Lagerfeuer durch die Zeltleinwand und die Eindrücke des ereignisvollen Marsches hielten ihn noch wach. Und dann meldete sich, nachdem die Entspannung einsetzte, doch wieder der alte Herr corpus, und ob er sich auf die rechte oder linke Polarhälfte legte, die Erinnerung des Aachener Steinpflasters sandte ihre zarten Grüße nach.
Die Wachtfeuer sanken herunter, die Pferde wurden ruhiger, und der gute, alte Bordeaux des Ingenieurs gab das seine dazu. Auch Stahl schlief ein. Als um 3 Uhr geweckt wurde, musste er sich besinnen, wo er war, und auf die Frage des Hauptmanns: Was die Herren in dieser ersten Biwakfeldnacht geträumt hätten — da dieses in Erfüllung ginge — zu seiner Schande gestehen, dass er nicht die geringste Spur eines Traumes gehabt habe.
Vielleicht, aber auch nur sehr vielleicht, hatte er etwas freie Magensäure von den guten Weinen des Tages vorher und sicher, aber ganz sicher fühlte er die südliche Verlängerung seines Rückens beim Aufstehen erheblich. Das ging aber schnell vorbei. Der Bursche meldete, dass die Gummibadewanne bereitstände, und Stahl verschwand aus dem Zelt, um mit Unterstützung seines Burschen und zum höchsten Erstaunen des ersten Zuges der Maschinengewehrkompanie sich in Adams Kostüm aus einem Stalleimer mit kaltem Wasser zu bearbeiten und dann der etwas sprachlosen Kompanie einen exakten Müller-Kursus vorzuführen.
Erregte schon der Müller-Kursus die Belustigung der Schützen, so fanden sie für die schwarzbraun gebrannten Knie ihres Zugführers keine Erklärung. Die kurze Wichs, die Samslederne vom Tegernsee, war den Altmärkern unbekannt. Plausibler erschien es ihnen schon, als der kritische Gefreite Meier die Vermutung aussprach, dass Stahls Großmutter vermutlich eine Mulattin gewesen wäre.
Als Leutnant Stahl frisch gebadet und innerlich und äußerlich erneut zum Frühstück im Offizierszelt erscheinen wollte, war dieses längst in seine Bestandteile, sprich Zeltbahnen und Zeltpflöcke, aufgelöst. Die beiden Zugführer, Leutnant Redern und Rose, waren verschwunden, und der Hauptmann fragte mit etwas kühlem Tone, ob der Zug Stahl schon marschbereit stände. Das Frühstück war also eine etwas theoretische Angelegenheit, und Stahl verschwand schleunigst zu seinem Zuge, den zu seiner beruhigenden Freude der Vizefeldwebel Jäckel schon nachgesehen hatte.
Die Züge der Maschinengewehrkompanie formierten sich auf dem Biwakplatz. Die Zugführer standen vor ihren Zügen. Der Dienstälteste, also Redern, meldete dem Hauptmann, der Feldwebel machte Rapport, und 4.15 Uhr erfolgte der Abmarsch in Richtung auf die Maas.
Südlich des Städtchens Visé bei Argenteau war die Maasbrücke von den Belgiern gesprengt worden, aber eine deutsche Pionierkompanie hatte schon eine neue Brücke auf das westliche Ufer geschlagen. Der Marsch ging bei glühender Hitze den Tag hindurch parallel der holländischen Grenze nach Richelle und Argenteau. Hier wurde Ortsbiwak bezogen. Die Bevölkerung aller dieser Orte zeigte sich sehr unruhig. Dumpfer Geschützdonner war den ganzen Tag hörbar und die Kolonnengerüchte wollten wissen, dass bei Lüttich noch um verschiedene Forts gekämpft würde.
In allen Ortschaften sah man abgebrannte Häuser von den Franktireurkämpfen her. Tote Pferde, die in der Hitze schnell auftrieben, mischten ihren bestialischen Geruch mit dem widerlichen Brandgeschmack, der in den Dorfstraßen eingeklemmt saß.
Endlich, schweißtriefend und staubbedeckt, erreichten die Truppen die angewiesenen Quartiere um 2 Uhr mittags. Nur eine Kompanie des dritten Bataillons musste über Argenteau noch weiter marschieren bis auf das westliche Maasufer, um die Brücke gegen Franktireurüberfälle zu sichern. Die Maschinengewehrkompanie erhielt eine schöne Koppel links der Hauptstraße des Dorfes Richelle angewiesen. Essen wurde ausgegeben und man traf alle Anstalten, um nach Möglichkeit Mann und Ross Ruhe zu geben. Aber trotz des herrlichen Sommernachmittages wollte eine rechte Ruhe nicht eintreten. Die Mannschaften wurden scharf angewiesen, nicht allein in den weitverzweigten Gehöften umherzugehen und unbedingt in der Nähe des Biwakplatzes zu bleiben.
Als die glühendste Hitze vorbei war, gingen die Offiziere der Kompanie gemeinsam durch den wohlhabenden Ort. Während sie die Hauptstraße hinunterschritten, hörten sie auf einem Gehöft wilde deutsche Fluche und angstvolles Kreischen von Frauenstimmen. Sie liefen hinzu und fanden deutsche Soldaten einen Misthaufen umschaufelnd, daneben ein paar schreiende belgische Bäuerinnen und vor diesen einige blutgetränkte deutsche Ulanenwaffenröcke.
Einer der Leute meldete, sie hätten das ganze Gehöft durchsucht und unter dem verdächtig frischen feuchten Mist die deutschen Uniformen gefunden. Die Frauen wurden festgenommen und verhört. Es war aber nichts Genaues herauszubringen und man ließ sie wieder frei.
Der deutschen Soldaten hatte sich eine starke Erregung bemächtigt, und auch in der Maschinengewehrkompanie schwirrten die wildesten Gerüchte. Deshalb wurde im Offiziersrate der MGK. beschlossen, zur Ruhe und Sicherheit der Truppe für die Nacht und während des Ortsbiwaks einen Einwohner als Geisel zu nehmen.
Einer der Gewehrführer war ein Unteroffizier der Reserve Böhmen Er erhielt als Neusprachler den Auftrag, eine kurze französische Proklamation zu entwerfen, dass als Garantie für die Sicherheit der Truppe ein angesehener Bürger des Ortes bei der Maschinengewehrkompanie die Nacht zuzubringen hätte. Bliebe die Nacht ruhig, so würde der als Geisel Festgenommene beim Abmarsch ohne weiteres entlassen. Geschähen Überfälle auf deutsche Soldaten, so würde der Mann sofort standrechtlich erschossen.
Ein Offizier, der Leutnant Rose, mit 6 Maschinengewehrschützen und einem Hornisten von der kleinen Kapelle, die sich die Mannschaft der Maschinengewehrkompanie selbst als Marschmusik zusammengestellt hatte, gingen einmal die Dorfstraße hinauf und hinunter. Als die Einwohner aufmerksam geworden waren, blies der Hornist ein Signal, und der Oberlehrer in Feldgrau verlas jetzt nicht mehr seinen Tertianern, sondern einer verbissenen Wallonenbevölkerung einen stilreinen französischen Aufsatz. Darauf wurde der angesehenste Einwohner der Straße, ein Schuhmachermeister, festgenommen. Seine Familie brach in ein Wehgeschrei aus und war nur schwer davon zu überzeugen, dass die Drohung der Proklamation nicht sofort vollstreckt würde. Erst als er den Befehl erhielt, sich warme Oberkleidung und Essen für die Nacht mitzunehmen, begriffen sie, dass man keine sofortige Erschießung beabsichtigte.
Langsam kam die Dämmerung. Der Gewehr- und Waffenappell war vorüber, die Befehle für den nächsten Tag, soweit eingetroffen, wurden ausgegeben, und der Hauptmann erklärte als Abschluss der ganzen Kompanie die allgemeine Lage. Dann flammten wieder die Biwakfeuer auf. Die Mannschaften saßen vor ihren Zelten oder gingen vor diesen im Gespräche auf und ab. Ein Frieden lag über dem Dorfe, als ob es nirgends Krieg gäbe.
Am großen Feuer der Unteroffiziere zwischen der Lagerwache, die die Posten zu stellen und die Ablösung zu regeln hatte, saß der belgische Schuhmachermeister. Es ging ihm nicht schlecht. Die gutmütigen Deutschen gaben ihm zu essen und zu trinken. Nur in einem war seine Bewegungsfreiheit etwas eingeschränkt. Eine solide Pferdeleine war um seine Ferse geknüpft und das andere Ende um einen soliden Baumstamm, und falls er seine diesbezüglichen kleinen oder großen menschlichen Wünsche zu erledigen beabsichtigte, so musste er dieses im 3-m-Radius des deutschen Hanfseiles tun.
Gemütsbewegungen pflegen sich bei vielen Leuten auf die Darmtätigkeit zu legen, und so ging, etwas nervös angeregt, auch unser Schuster ab und zu seine 3-m-Partie und bot, wenn gerade die Wachtfeuer auflohten, manch merkwürdige Silhouette.
Vor dem ersten Hahnenkrähn wurde geweckt. Stahl hatte aus den bisherigen Erlebnissen gelernt. Er ließ sich früher als die anderen Herren durch seinen Burschen wecken und beeilte auch seinen Müller-Kursus. Dann ging er zur Feldküche, mit deren Führer er schon um Tage vorher „einige ernsthafte Worte“ gesprochen hatte, und nun gab es Kaffee und Frühstück nicht nur reichlich und früh genug für die Mannschaften, sondern auch für die Offiziere.
Aber Stahl sah zu seinem Erstaunen, dass seine Kameraden, selbst der Hauptmann, auf ein richtiges Frühstück sehr geringen Wert zu legen schienen, und auch später musste er bemerken, dass die in zäher preußischer Offizierszucht Aufgewachsenen in ihren Anforderungen an Essen und Trinken von einer verblüffenden spartanischen Einfachheit waren.
Stahl dachte an das reichliche heimatliche Morgenfrühstück. Es war also ein Unterschied zwischen seinen Lebensgewohnheiten als Kaufmann und als Reserveoffizier und denen der anderen als aktive Offiziere. Und war nur dieser Unterschied? Hatten die Aktiven außer dieser Genügsamkeit den Reserveoffizieren nicht auch die selbstverständliche Sicherheit im Befehlen und Gehorchen voraus? Entstammten sie nicht überhaupt verschiedenen Welten?
Ob er es je in allem den aktiven Kameraden gleich und recht machen würde? Nun, er würde sich die größte Mühe geben, wenngleich er aus der Zeit seiner Übungen wusste, dass der Erziehungsgang des aktiven Offiziers und sein eigener als Kaufmann, als Student, als Angestellter und dann im Daseinskampfe bis zum Chef der Firma ihn innerlich hatten grundverschieden werden lassen von jenen straffen Typen des deutschen Berufsoffiziers.
Aber rotzverdammt! — zum ersten Mal flog ihm dieses Wort durch den Sinn und kam ihm auf die Zunge, dass für die ganze Kompanie später eine Art Barometer werden sollte. — Rotzverdammt noch einmal! Man ist hier nicht Kaufmann und Fabrikbesitzer, man ist hier Soldat. Und ist man auch soundso viele Jahre älter als die dienstgleichen oder rangälteren Offiziere, so wird man es ihnen schon gleich tun. Wofür hat man seinen bewussten Willen? Mit dem Körper des trainierten Sportsmannes wird es gemacht. Und Altmärker Soldatenblut haben auch wir.
Die Sterne waren im Abbleichen. Der frühe Morgenwind brachte vom nahen Flusse herauf die Kühle. Die Kompanie rückte ab und der Schuster wurde freigegeben. Er bedankte sich und hatte es gar nicht so eilig, hinwegzugehen.
Nach kurzem Marsch war das Maasufer erreicht und über die hölzerne Pionierbrücke ging es nach dem reichen flämischen Dorfe Genoels-Elderen, unweit der großen Chaussee Maastricht-Tongern.
Als ob sie von der Hölle in den Himmel gekommen, so war den norddeutschen Feldgrauen zumute, als sie von den verbissenen—Wallonen zu den blonden, sauberen Flamen kamen. Niederdeutsche Menschen, niederdeutsche Laute begrüßten sie hier, und ruhige, behäbige Wohlhabenheit gab ein befriedigendes Bild für den marschmüden Infanteristen.
Der Regimentskommandeur, der den Wert und die Verwendungsmöglichkeit gutberittener Offiziere erkannt hatte, sandte die Leutnants Rose und Stahl von der Maschinengewehrkompanie mit einem Quartiertrupp voraus. Die Maschinengewehroffiziere verteilten schnell die großen Höfe und Plätze für die 3 Bataillone, die Maschinengewehrkompanie und den Regimentsstab.
Es ist nicht immer leicht, großen Herren die Sache rechtzumachen, und schon in den wenigen Tagen des Vormarsches hatte die gesamte Maschinengewehrkompanie begriffen, dass es sicher eine hohe Ehre und manche Vorteile bedeutet, direkt dem Regimentsführer und nicht erst einem Bataillonskommandeur unterstellt zu sein. Jedoch Ehren werden teuer erkauft, und jedes Ding hat seine zwei Seiten.
Als die beiden quartiermachenden Maschinengewehrleutnants das Dorf erkundet hatten, sahen sie sich beide wortlos in die treuen blauen Augen, die bei beiden aber ziemlich dunkelbraun waren, und fragten sich dann: Wohin den Regimentskommandeur mit seinem Stabe und wohin den zweiten König des Regiments, den Kommandeur des 2. Bataillons, Major Klinge? „Ehre dem Ehre gebühret!“ meinte Stahl. „Es gibt nur einen wirklich vornehmen Ort, wo wir den Regimentskommandeur unterbringen können, und das ist die Priesterschule. Der Oberst ist selber ein hochgelehrter Mann, Generalstäbler pp., der Führer des katholischen Priesterseminars ist sicher Doktor vieler Grade; ich glaube nicht, dass wir es wagen dürfen, bei Vorhandensein solcher Zelebrität unseren hohen Mandarin in einen gewöhnlichen Bauernhof zu legen.“ „Sehr richtig, der Herr“, nickte Rose, „und dann legen wir wohl den zweiten Bataillonsstab in die zwar bescheidene, aber nicht ganz so üble Boerderij Michaels.“
„Und die Maschinengewehrkompanie?“
„Nun, bei den bekannten bescheidenen Ansprüchen der Maschinengewehrleute dürften sie noch bei Mynheer Michaels in einer Ecke des Hofes mit unterschlüpfen.“
„Sehr richtig, der Herr.“
Als, vom Chausseestaub bepudert, die Marschkolonnen des Infanterieregiments Altmark in der Nachmittagshitze einrückten, da traute mancher kaum seinen Augen. Eine freundliche blonde Bevölkerung stand an den Türen und auf den Straßen und lachte den Deutschen entgegen, und die Quartiermacher standen gesäubert und fröhlich lächelnd da, die verschiedenen Truppenteile in ihre Quartiere zu bringen, so wie früher bei einem heimatlichen Manöver. Der Infanterist ahnte, hier ist gut sein. Die Maschinengewehrkompanie fuhr mit schneidigem Winkel in den großen Hof der Boerderij ein. Die Bataillonskommandeure nickten wohlwollend angesichts der freundlichen Bauernhöfe, und mit würdigen Mienen und mit voller Satisfaktion schritt der Regimentsstab unter Leitung des Regimentsadjutanten auf den hochragenden geistlichen Bau zu.
In der Bürgermeisterei des Mynheer Michaels entwickelte sich ein geschäftiger Betrieb.
Der Major Klinge hatte zwei gute Zimmer bekommen, und der Hofbesitzer hatte es sich nicht nehmen lassen, sein saalartiges gutes Zimmer mit einer langen Tafel, darob weiße Tischtücher und Blumenvasen standen, zu versehen.
Der Hauptmann Seebach, der Kapitän der Maschinengewehrkompanie, hatte neben dem Major ein kleines, aber gutes Zimmer gefunden, und die drei Maschinengewehrleutnants hatten zwar keine Betten, aber in einer entzückenden Giebelstube waren Strohschütten sauber bereitet, auf denen derbe Leinentücher mit den nun schon recht gut eingespielten Schlafsäcken lagen.
Die Unteroffiziere und Mannschaften kamen in den großen Scheunen reichlich unter, die Fahrzeuge fanden Platz und Deckung, und als beim großen Appell am Nachmittag bekanntgegeben wurde, dass am nächsten Tag, den 16.August, Sonntags, ein allgemeiner Ruhetag sein sollte, da war große Freude, und die weitere Mitteilung, dass am Nachmittag 3.30 Uhr ein Feldgottesdienst stattfände, wurde mit derselben Ruhe hingenommen, mit der ein arabisches Sprichwort sagt, dass am Grunde auch des besten Glases Wein ein Pfefferkörnchen vorhanden sei.
Die behagliche Ruhe wirkte auf alle erfrischend. Major Klinge ließ die Offiziere seines Bataillons zu einem großen Abendbrot in die gute Stube seines Quartiers einladen, dazu die Offiziere der Maschinengewehrkompanie. Zwischen Major Klinge und Leutnant Stahl bestand schon aus Friedenszeiten die Art Bekanntschaft, wie sie zwischen den Reserveoffizieren und den aktiven Offizieren eines Regiments etwas äußerlich zu sein pflegt. Aber auf diesen wenigen Tagen des Vormarsches begann schon jene Umstellung, die unter voller Würdigung des Ranges doch der Persönlichkeit des einzelnen mehr Raum, Beachtung und Wertschätzung angedeihen ließ. Und wenn auf den Stunden des Marsches der Leutnant der Reserve Stahl neben dem aktiven Kommandeur des zweiten Bataillons geritten war, so war ihm hin und wieder aufgefallen, dass das Gesprächsthema sehr viel öfter von der reinen Fachsimpelei und vom reinen Soldatentum auf irgendein anderes Gebiet mit weiteren Interessen sich ausdehnte.
Es fügte sich gut, dass der zu Major Klinge gehörige Bataillonsadjutant, der Leutnant Wärter, ebenfalls ein liebenswürdiger und nicht nur kommissig eingestellter Offizier war und so fügte es sich weiter zwanglos, dass am Nachmittag im Quartier zwischen dem Herrn Major Klinge und den Leutnants Wärter und Stahl ein sympathisches Gespräch stattfand, dessen Wünsche und Inhalt der Leutnant Stahl dem Mynheer Michaels übermittelte. Dieser wieder sprach mit seiner respektablen Hausfrau, und darauf erhub sich in der raumvollen Küche des Gehöftes ein verheißungsvolles Rumoren.
Als am Abend pünktlich 7.30 Uhr frisch rasiert und gescheitelt die Herren des Bataillons und der Maschinengewehrkompanie beim Major Klinge antraten, da lieferte die Küche von Mevrouw Michaels ein Festessen, dessen sich selbst ein Kasinofeldwebel nicht hätte zu schämen brauchen. Die Ordonnanzen, unterstützt durch die beiden appetitlichen Töchter des Hauses, Rath und Esther, hatten manch fröhlichen Stafettenlauf zwischen Speisezimmer und Küche zu bestehen. Ein sympathischer alter Bordeaux befeuchtete die Zunge, und aus den respektablen Kellern des Hauses stellte der Wirt, der zur Tafel geladen war, manche Flasche Sekt perlenden Inhalts auf den Tisch, deren kleine Marke den Deutschen nicht bekannt, deren Güte aber unbestreitbar war. Gerade als die Speisen abgetragen waren und die schweren silbernen Leuchter mit den Kerzen auf dem Tisch flatterten, die Zigarren brannten und dazwischen ganz altmodische, aber behagliche Petroleumlampen mit Majolikafüßen ihr mildes Licht verbreiteten, tat sich die Tür auf und vornehm und kühl, reserviert und etwas säuerlich, erschien der Regimentsadjutant, um zu sagen, dass der Herr Oberst mit seinem Quartier durchaus nicht zufrieden sei und dass er über die Quartiermacher einige scharfe Bemerkungen hätte fallen lassen. Als der Hauptmann Riechert gebeten war, Platz zu nehmen, um ein bescheidenes Glas mitzutrinken, streifte er die etwas zeremonielle Hülle ab und vertraute dem ihm näherstehenden Leutnant Rose an, dass er ihn für einen ausgefochten Schweinehund halte und dass es sicher nicht auf einem Zufall beruhte, dass er, der Regimentsadjutant mit dem Regimentskommandeur — oder umgekehrt — in ein derartiges unglaubliches Quartier gelegt worden sei. Wäre der Kommandeur nicht so müde, so würde er heute noch das Quartier gewechselt haben; so aber hätte er sich nach einer höflichen gegenseitigen Visite mit dem Vorsteher des Alumnates früh und verärgert zur Ruhe begeben.
Nicht nur nicht aber die Zimmer wären von einer fatalen Dürftigkeit und scheinbar geringer Sauberkeit, abgesehen von einem säuerlichen Mief, sondern auch die Verpflegung wäre offensichtlich die von sich kasteienden, bereits auf ein jenseitiges Leben gerichteten Heiligen.
Der Herr Regimentskommandeur beabsichtige nicht allein vom ganzen Regiment schlecht zu leben in diesem Feldzuge. Von der Maschinengewehrkompanie ginge beim Regimentsstabe das Gerücht von einer sehr guten Küchenhaltung. Der Regimentskommandeur überlege ernstlich, ob er seine Verpflegung nicht der Maschinengewehrkompanie übertragen solle.
Die bemerkenswerten Ausführungen des Regimentsadjutanten fanden ihre volle Beachtung, und im Kreise der Auguren wurde beschlossen, den Herrn Regimentskommandeur nebst Adjutanten zu bitten, während der kurzen Dauer des Aufenthalts im Dorfe an der Tafel des Major Klinge gütigst sich mitverpflegen zu lassen.
Was nun den Lebenswandel der Maschinengewehrkompanie selbst anbelangt, so hielt sich Stahl für verpflichtet, dem Hauptmann Riechert vorsichtig klarzumachen, dass die spartanische Auffassung des Hauptmanns Seebach sowohl wie seiner Herren wahrhaft beängstigend wäre und dass der Herr Regimentskommandeur ganz entschieden den Gefahren einer Unterernährung entgegenginge, falls er bei der Maschinengewehrkompanie hospitieren wollte.
An diesem Abend wurde noch mancher Becher geleert auf die Zukunft, auf den Sieg, auf die Lieben daheim. Wenngleich man erst wenige Tage von daheim weg war, so hatte man doch das Gefühl, als ob eine Welt zwischen diesem kleinen belgischen Ort und Deutschland läge, und schmerzlich wurde das Eintreffen der Post erwartet.
Nach der scharfen Marschwoche war für Mann und Pferd der Ruhesonntag eine wirkliche Erholung. Es wurde nicht geweckt, und so konnten auch die Offiziere der Maschinengewehrkompanie bis zur unerhörten Zeit von ½ 9 Uhr morgens ruhen. Nach großer Wäsche, Generalreinigung von Mann und Ross begann der erste Dienst: Exerzieren mit den neuen Schilden am Maschinengewehr und Zugexerzieren. Da der Leutnant Redern mit der Bemalung der Schilde noch nicht zufrieden war, so erhielten sie um 12 Uhr sonntags einen neuen Anstrich und standen nun in der prallen Sonne aus dem Hofe, um schnell zu trocknen. Nach dem Feldgottesdienst am Nachmittag wurde die Zeit benutzt, um nach Haus zu schreiben.
Die Briefe und -Postkarten Unterlagen sämtlich einer scharfen Zensur. Sie war auch verdammt nötig. Und den die Briefzensur durchführenden Offizieren sträubten sich manchmal die Haare. In manchen Mannschaftsbriefen traten schon ganz wilde Krieger auf, die mit Rücksicht auf Liebesgabenpakete von furchtbaren Kämpfen und Abenteuern berichteten, obwohl die Truppe bisher nur einmal gefangene Feinde gesehen hatte.
Der frühe Abend vereinte noch einmal alle dienstfreien Offiziere mit dem Regimentskommandeur. Als diese große Runde um den langen Tisch versammelt war und die Maschinengewehroffiziere wieder für die Beköstigung zu sorgen hatten, da ging dem Leutnant Stahl doch der Gedanke durch den Kopf, wie lange wird diese Runde noch geschlossen zusammen sein können?
Man trennte sich früh, denn der Befehlsempfänger überbrachte von der Division die Meldung, dass am nächsten Morgen um 4 Uhr der Abmarsch in der Richtung auf Alten stattzufinden hätte. Das hieß: 2.30 Uhr Wecken.
Der Abmarsch fand bei übler Dunkelheit statt. Der Himmel war bewölkt. Die Truppe war es noch nicht wie in späteren Zeiten gewöhnt, zu jeder Tag- und Nachtzeit reibungslos aufzubrechen.
Nach langem Marsch wird bei Alten biwakiert. Die Maschinengewehrkompanie ist zum Schutz des Regimentsstabes befohlen und ist kaum zur Ruhe gegangen, als eine Ordonnanz die Offiziere zum Obersten ruft.
Im Schlafzimmer des Obersten bietet sich ein herrliches Bild. Der Oberleutnant von Mertens ist beim Oberst schon anwesend in voller Kriegsbemalung. Der Herr Oberst ist im Gewand der Nacht, und mit seinem schmalen und haarlosen Kopfe sowie seiner großen braunen Hornbrille bietet er bei der unsicheren Kerzenbeleuchtung das Bild eines älteren, würdigen, hochgejahrten chinesischen Mandarinen. Hinter ihm steht als des Obersten getreuer Schatten der Regimentsadjutant Riechert.
Diese friedlichen Betrachtungen des Leutnant Stahl werden schnell zerstört durch die Mitteilungen des Generalkommandos, dass morgen oder heute noch die Belgier angegriffen werden.
Mit einem Schlag ist der Ernst in den Vordergrund gerückt, und trotz der warmen Sommernacht berührt Stahl etwas wie ein kühler Luftzug und leise schauert er zusammen.
Vor den Herren liegt eine große Karte ausgebreitet. Die Stellungen der eigenen Anmarschlinien sind im Ganzen bezeichnet. Genau westlich vom jetzigen Quartier von Süden nach Norden fließt parallel der Eisenbahnlinie Tirlemont-Diest der Geetebach. In diesem Geeteabschnitt sollen nach den neuesten Meldungen die belgischen Truppen aufmarschiert sein, um den deutschen Angriff zu erwarten. Der Oberleutnant von Mertens und die Leutnants Redern und Stahl erhalten den Auftrag, unverzüglich zu einem Aufklärungsritt aufzubrechen, eine gute Marschstraße zu erkunden und zu bezeichnen. Sie sollen so weit vorreiten, als es die Lage zulässt und dann das Regiment erwarten. Als wahrscheinlich zu erreichendes Ziel wird ihnen eine Ferme, Engelferme, bezeichnet, die jedoch auf ihren Karten nicht vermerkt ist.
Die drei Offiziere wiederholen ihren Austrag und sind in kurzer Zeit mit ihren Reitburschen unterwegs. Die Nacht ist noch dunkler wie die gestrige. Der Himmel ist bewölkt und schickt ab und zu feinen, dunstigen Regen zur Erde. Trotzdem wird schnell geritten. Die Spannung, bald an den Feind heranzukommen, die schwüle Nacht und der Regen lassen die Brillengläser von Mertens und Stahl immer wieder beschlagen. Es ist ein Saureiten, wie in einem Treibhaus, Reiter und Pferde dampfen, nur die abwechselnd eingelegten Schrittpausen sind eine gewisse Erholung. Man sieht nichts. Man hört nur den Vordermann reiten. Es geht in Kolonne zu einem. An der Spitze Richard Redern, der wie eine Katze auch bei Nacht sieht und gut beritten ist.
Solange es noch die angesetzte Hauptstraße ein Stück vorwärts geht, ist die Orientierung einigermaßen möglich, wenn man rechts und links die dunkeln Mauern der Chausseebäume sieht und das Stück Himmel dazwischen, der über einem sich wenigstens um eine Schattierung heller abzeichnet.
Nun geht es langsam vorwärts, denn alle 100 Meter muss einer der Reitburschen um einen Baum ein Strohseil als Markierung winden, und so geht es östlich, bis bei Tageshelle ein Kanal erreicht ist. Hier halten die sechs Reiter und warten das Herankommen des Regiments ab.
Von 8 Uhr ab ist Kanonendonner zu hören und verstärkt die Spannung der Wartenden. Sie sind bei den Bauernhäusern eines kleinen Ortes abgesessen, haben Deckung ausgesucht und frühstücken aus dem Brotbeutel. Sie trinken kalten Kaffee, haben die Karabiner schussbereit und lassen die feuchten Kleider auf dem Leibe trocknen.
Die Offiziere der Maschinengewehrkompanie haben sich nämlich stillschweigend Karabiner angeschafft. Genauso, wie sie dazu übergegangen sind, den Degen am Sattel zu lassen und ein aufpflanzbares Seitengewehr an dessen Stelle zu tragen. Der Leutnant Stahl ist noch etwas weiter gegangen. Aus irgendeinem Ahnungsgefühl heraus hat er in seinem Gepäck ein kurzes japanisches Schwert, das Geschenk eines Korpsbruders, mitgenommen. Da die blanke Lackscheide zu sehr glänzte und beim Reiten klappernd anschlug, so hat sie der Kompaniesattler in braunes Leder eingenäht. Dies kurze japanische Hiebschwert ist für einen alten Fechter für Hieb und Stoß eine herrliche Waffe. Es hat eine eigene Gleichgewichtsverteilung, und im Schlagliegt eine merkwürdige Schwungkraft.
Das Regiment ist herangekommen. Neben dem Regiment Altmark ist das Schwesterregiment Börde aufmarschiert. Die Maschinengewehrkompanie Altmark ist als Reserve des Generalkommandos bestimmt worden. Sie hält hinter einem Gehöft, und die Offiziere besprechen sich.
„Kinder, jetzt geht die Sache anscheinend wirklich los. Wir sind zwar Reserve, aber man wird sich den Einsatz von Maschinengewehren nicht entgehen lassen. — Wir haben noch Zeit, lasst die Leute nochmals austreten. Erfahrung aus früheren Kriegen lehrt, dass vor Angriffen selbst ein General mal aus der Hose muss.“
Die Anregung des Hauptmanns wird durch die Zugführer weitergegeben und findet viele Anhänger. Fast die ganze Kompanie sitzt um das Gehöft herum.
Auf Befehl des Kompanieführers muss Stahl den Standort der Kompanie dem Brigadekommandeur, General von Schöttler, melden. Da er ungedeckt im gestreckten Galopp auf den General zureitet, so empfängt er von diesem den ersten fürchterlichen Anpfiff im Feldzug.
„Herr, sind Sie in drei Deibels Namen vollkommen verrückt geworden? Wollen Sie gefälligst runter von Ihrem Bock, oder haben Sie sich noch nen eigenen Flieger mitgebracht, um die Stellung des Brigadestabes möglichst schnell dem Gegner bekanntzugeben?“
In diesem Augenblick trug der Reitunterricht, den der Leutnant Stahl vor etwa 15 Jahren beim Stallmeister eines Zirkusses gehabt hatte, seine Früchte. Mit einem wahren Panthersatz flog er vom Pferde und landete direkt vor dem General.
Der hörte die Erledigung des Auftrages schweigend an, durchbohrte den Überbringer mit Blicken, als ob er ihn ausfressen wollte, und gab ihm das sanfte Geleitwort: „Scheren Sie sich in drei Deibels Namen zu Ihrer Kompanie zurück.“
Einen Augenblick überlegte Stahl, ob sich der General vielleicht darunter einen Fußmarsch mit hinterhergezogenem Pferde dachte. Dann aber kam eine gewisse Abenteuerstimmung über ihn. Er grüßte den General, führte das Pferd einige Meter abseits, sprang hinauf und jagte, dieses Mal den Waldrand benutzend, in hohem Bogen von dem ungastlichen Kommando weg.
In der Zwischenzeit war der Befehl eingetroffen, dass die Maschinengewehrkompanie dem Regiment wieder zugeteilt und von diesem dem 2. Bataillon als Reserve überwiesen sei. Das 2. Bataillon wird nunmehr entfaltet, und zwei Züge Infanterie unter den Leutnants Cortez und Herder werden eingesetzt. Mit weiten Zwischenräumen, mit Aufklärern an der Spitze vorweg geht es quer durch den Wald, Richtung Geet-Betz. Die Maschinengewehrkompanie folgt auf Waldwegen vorläufig noch in Gefechtskolonne, Kolonne zu einem.
Vorn wird der Wald lichter, und plötzlich beginnt ein wildes Infanteriefeuer aus kürzeste Entfernung. Sofort werden die Maschinengewehre frei gemacht, die Fahrzeuge fahren in Deckung zurück, und der Zug des Leutnants Rose, der heute die Spitze hat, wird als erster eingesetzt.
Noch ist vom Feinde in dem waldigen Gelände nichts zu sehen, aber das Feuer verstärkt sich.
Dann wird der laute Knall einer Sprengung hörbar, gefolgt von dem scharfen Hurra deutscher Stimmen. Die Maschinengewehrkompanie hastet nach vorn. Der Zug des Leutnants Rose geht in Feuerstellung, findet aber keinen Gegner mehr vor.
Dort wo der Waldweg auf den reißenden, tief eingeschnittenen Geetebach trifft, hat der Feind die Brücke gesprengt. Als die Maschinengewehrkompanie an die Lichtung herankommt, ist vom Feinde nichts mehr zu sehen, aber das feindliche Feuer hat die ersten Opfer vom Regiment gefordert. Rechts des Weges liegt sonderbar bleich ein deutscher Trompeter auf der Seite. Die Trompete ist auf den Rücken gerutscht. In der erstarrten rechten Hand hält er noch das Gewehr. Die linke Hand ragt in die Luft. Das Handgelenk ist durchschossen, und im Augenblick des Anschlages muss die Kugel weiter direkt durch Herz und Rücken gegangen sein.
Wenige Meter rechts von ihm liegt, schwer verwundet von zwei Kopfschüssen, der Leutnant Herder. Es muss irgendein Nervenzentrum durch einen Streifschuss berührt sein, denn unaufhörlich schlagen die Hände und Füße des verwundeten Offiziers einen Wirbel.
Links und rechts des Weges sind die Schützen bis an den Geetebach vorgedrungen, und drüben auf der anderen Seite liegen mehr oder minder deutlich sichtbar die Leichen belgischer Kavalleristen.
An einem Busch sind zwei Bambuslanzen in die Erde gestoßen, mit deren schwarz-rot-gelben Fähnchen der Wind spielt.
Die umgehende Verfolgung des Feindes wird angeordnet. Aber der Bach ist so tief und reißend, dass er höchstens von einzelnen Schwimmern, aber keineswegs von größeren Truppen oder Fahrzeugen überwunden werden kann. Deshalb stockt die Verfolgung, und es dauert geraume Zeit, bis eine Pionierkompanie nach vorn gezogen wird, die sofort beginnt, mit behelfsmäßigem Material eine Brücke an der gleichen Stelle wieder über den Bach zu schlagen.
Die entfalteten Kompanien werden zusammengezogen. Die Maschinengewehrkompanie holt die Fahrzeuge nach und bringt die Maschinengewehre an Ort.
Die Maschinengewehrkompanie hält lange an der Stelle, wo der fahlbleiche Trompeter liegt, und dieser Anblick des ersten Toten wirkt auf alle tief ein. Der Leutnant Stahl ist wieder zu Pferde gestiegen, weil er annimmt, dass die Brücke bald fertig ist und die Maschinengewehrkompanie zur Verfolgung mit eingesetzt wird.
Obwohl er nicht will, zwingt der Tote ihn immer wieder, den Blick nach rechts über den Pferdehals auf ihn zu werfen. Stahl dreht sich im Sattel rum und sieht, wie die hinter ihm stehenden aufmarschierten Schützen ebenfalls den Toten ansehen. Er sieht die braunen Gesichter seiner Leute bleich werden, und ihm selber steigt ein Würgen in der Kehle hoch.
Da springt er vom Pferde, lässt die Zeltbahn des Trompeters abschnallen und über den Toten breiten. Das gleiche tut der nach vorn geeilte Stabsarzt, der die Verwundeten verbunden hat, mit dem Leutnant Herder, der ruhiger geworden und scheinbar dem Ende nahe ist.
Gott sei Dank, die Brücke ist fertig, und das Kommando „Fahrer und Führer fertig zum Aufsitzen“ ertönt.
Aufatmen geht durch die Reihen der Schützen.
Die Kompanie überschreitet schnell die Brücke über den Geetebach. Hinter einem Wegeknick fährt sie an einem Gasthaus vorbei. Verwundete belgische Kavalleristen liegen darin. Davor auf der Straße liegen tote Pferde, blutige Tschakos und Lanzen mit den feindlichen schwarz-rot-goldenen Fähnchen. Die Sonne brennt heiß vom Himmel. Der Bahnhof von Geet-Betz brennt, und die Flammen schlagen knisternd heraus. Endlich wird um 4.30 Uhr kurzer Halt gemacht. Die Spannung, die alle erfasst hat, lässt nach. Der Hunger meldet sich, und die Kompanie empfängt Essen.
Auf Feldwegen geht dann der Vormarsch weiter, genau in westlicher Richtung. Die Verfolgung des Feindes hat eingesetzt. Auf den Straßen liegen weggeworfene Soldatensachen, Tornister, Mützen und zum Erstaunen der Deutschen auch Waffen. Die Wege sind mit fliehenden Zivilisten zu Fuß und zu Wagen bedeckt, und es kostet Mühe, diese Flüchtigen auf die Seitenwege und Rebenstraßen abzubiegen. In der Nähe des Ortes Kersbeek wird bei einbrechender Dunkelheit mitten in einem Haferfeld zum Biwakieren geschritten.
Die Sommernacht ist warm, und die umgestürzten Hafergarben eignen sich gut für eine Lagerstatt. Die Offiziere der Maschinengewehrkompanie liegen zusammen. In den Schlafsack gehüllt, sehen sie in den dunklen Sommerhimmel hinein, an dem die Sterne nur teilweise sichtbar werden. Ein warmer, weicher Wind streicht über die Felder.