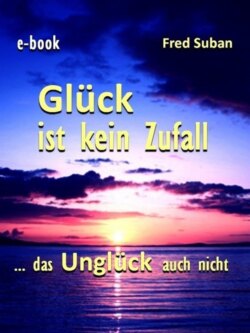Читать книгу Glück ist kein Zufall – das Unglück auch nicht - Fred Suban - Страница 7
2. Frageform und Fragestellung
ОглавлениеWenn ich an die Bedeutung des Fragens denke, kommt mir unweigerlich die Erinnerung an einen unserer Mathematiklehrer, der uns in der Schule das Dreisatzrechnen mit folgenden Worten beibrachte:
„Die Fragestellung ist der Schlüssel zur Lösung,
richtig gestellte Fragen führen zur richtigen Lösung,
falsch gestellte Fragen zum falschen Resultat.“
Dazu 2 Beispiele zur Erinnerung für jene, denen diese Rechenart nicht mehr geläufig ist:
Beispiel 1
Sie kaufen auf dem Markt 8 Äpfel, diese wiegen zusammen 1,2 kg.
Wie viele Äpfel würde ich bekommen für 3 kg?
Lösung:
1) für 1,2 kg bekomme ich 8 Äpfel
2) für 1,0 kg bekomme ich 1,2-mal weniger
3) für 3,0 kg bekomme ich wie viele Äpfel?
Daraus ergibt sich folgende Formel: (8 x 3) : 1,2 = 20 Äpfel
Würde man die Fragen jedoch folgendermaßen formulieren:
„8 Äpfel wiegen 1,2 kg
1 Apfel wiegt 8-mal weniger
3 kg sind wie viele Äpfel?“,
würde sich Folgendes ergeben: (1,2 x 3) : 8 = 0,45 Äpfel
Erläuterung:
Die Positionen 1 und 3 sind immer in der Klammer zuerst zu multiplizieren, Position 2 steht hinter der Klammer-Rechnung und ist mit dem Resultat aus der Klammer zu dividieren.
Beispiel 2
Die Äpfel sind in 3,0-kg-Säcken zu je 20 Stück abgepackt, Sie möchten jedoch nur 8 Stück.
Frage: Wie schwer sind denn diese 8 Stück?
Lösung:
1) 20 Stück wiegen 3 kg (3 x 8) : 20 = 1,2 kg
2) 1 Stück wiegt 20-mal weniger
3) 8 Stück wiegen?
Einfachheitshalber wird bei beiden Beispielen von gleichen Zahlen ausgegangen, die Fragestellung jedoch ist sehr unterschiedlich.
Während bei Beispiel 1 die Frage lautete, wie viele Äpfel man für ein bestimmtes Gewicht erhalten würde, war beim Beispiel 2 die Frage genau umgekehrt: Man wollte wissen, wie hoch das Gewicht bei einer bestimmten Anzahl Äpfel ist.
Stellenwert der Fragen
Den Zugang zu den Erinnerungen unseres Unterbewusstseins erreichen wir durch gezielte Fragen. Dabei spielen Frageform und Fragestellung eine zentrale Rolle. Die Frageform ist der Weg, wie man auf das Erinnerungsvermögen zugeht, die Fragestellung (also wie die Frage gestellt wird) bedeutet die Eingrenzung, also die Fokussierung des Erinnerungsvermögens auf eine gewählte Thematik.
Die Antworten unseres Unterbewusstseins sind intuitiv, emotional und visionär. Wenn wir also eine Antwort erwarten, muss auch die Frageform auf dieselbe Ebene gebracht werden und die Frage so gestellt sein, dass von den gespeicherten Erinnerungen entsprechende Intuitionen, Emotionen oder Visionen ausgelöst werden können.
Die Frageform „Warum?“ beispielsweise ist universell und neutral und öffnet den Zugang zum Unterbewusstsein ohne bestimmte Vorgaben. Dem Unterbewusstsein ist sozusagen freigestellt, was es an Erinnerung aktivieren will. Somit wird es vorbehaltlos alle Erinnerungen aufzeigen, die irgendwie mit der „Anfrage“ zusammenhängen. Dass diese Frageform zudem einen ungeahnten Denkprozess auslöst, kann mühelos durch eine Selbstbefragung getestet werden. Tun Sie das, werden Sie sich einmal dessen bewusst, wie wir intuitiv geleitet werden!
Wenn Sie sich beispielsweise beruflich verändern wollen, fragen Sie sich nicht, „was“ Sie tun müssen, um sich zu verändern. Denn darauf werden Sie kaum die gewünschte Antwort erhalten. Was soll denn das Unterbewusstsein antworten, wenn Sie selber nicht wissen, was Sie wollen?
Fragen Sie stattdessen: „Warum möchte ich mich verändern?“! So werden Sie sich der vielen Gründe bewusst, die Sie möglicherweise schon lange zuvor zu diesem Entschluss bewogen haben, und zudem werden Visionen für ein neues Ziel wach.
Als ich noch Organisationsleiter in einer großen Vertriebsfirma war, wies ich in meinen Seminaren immer wieder auf die Wichtigkeit des Fragens, insbesondere auf die Frageform „warum“ als die stärkste Frageform hin – sei es, um mit potenziellen Kunden ins Gespräch zu kommen, sei es, um Vorurteilen zu begegnen – und bot auch entsprechende praktische Trainings an. Dabei zeigte ich anhand von Beispielen immer wieder auf, wie negativ sich Vorurteile auswirken. Das Resultat zeigte eindeutig, dass diejenigen, die meinen Rat befolgten und auch an meinen Trainings teilnahmen, erfolgreicher wurden.
Ein Beispiel aus einer persönlichen Begegnung, was Vorurteile bewirken können:
Ich ärgerte mich stets über eine meiner Nachbarinnen, weil diese jedes Mal, wenn ich ihr begegnete, sich nach der anderen Straßenseite umdrehte, obwohl ich immer freundlich grüßte. Eigentlich hätte es mir egal sein können. Aber da ich dazu erzogen wurde, Menschen freundlich zu begegnen und zu grüßen, wollte ich das Verhalten der Nachbarin nicht einfach hinnehmen.
So beschloss ich, mich mit gezielter Selbstbefragung dieses Problems anzunehmen. Die Frage lautete nicht etwa, warum meine Nachbarin mich nicht grüßen wollte, denn darauf hätte ja mein Unterbewusstsein keine Antwort geben können. Nein, die Frage lautete, warum ich mich eigentlich jedes Mal ärgerte. Darauf wäre eigentliche die Antwort zu erwarten gewesen, weil auf meinen Gruß auch ein Gegengruß zu erwarten sei.
Aber nein, der eigentliche Grund war, so konnte ich in Erfahrung bringen, dass ich mich in meinem männlichen Stolz getroffen fühlte. Wäre es nämlich ein Mann, dann würde mich dies weit weniger gestört haben. Außerdem wurde mir noch bewusst, dass mich plötzlich ihre ganze Erscheinung zu stören begann.
Eigentlich hätte für mich die Geschichte damit enden können. Aber ein fahler Geschmack oder ein Stachel im Fleisch, wie sich Poeten auszudrücken pflegen, wäre zurückgeblieben, und ich hätte mich weiterhin geärgert. So entschloss ich mich, der Sache auf den Grund zu gehen, und nahm mir vor, die Dame bei der nächsten Begegnung anzusprechen. Ich wollte erfahren, warum sie mir aus dem Weg gehe, obwohl ich ihr keinen Anlass dazu gab und im Gegenteil immer freundlich grüßte.
Gesagt, getan: Die Antwort, die sie mir nach einigem Zögern gab, beschämte mich zutiefst: dass sie nämlich als Jugendliche von einem Mann vergewaltigt worden sei, der sie ebenso freundlich gegrüßt hatte, und dass bei jeder Begegnung mit mir die Erinnerung daran wieder wach geworden sei.
Ein anderes Beispiel:
Hans (Name geändert) arbeitete bei der Kehrichtabfuhr in meiner ehemaligen Wohngemeinde. Alle Leute ärgerten sich an seiner schroffen Umgangsform und der Art, wie er sich manchmal über seine Mitbewohner hermachte; es war allein seiner Zuverlässigkeit zu verdanken, dass ihm noch nicht gekündigt worden war. Ich wusste aber, dass er eigentlich ein netter, junger Mann sein könnte, wenn auch geistig etwas zurückgeblieben. So beschloss ich, mich bei nächster Gelegenheit einmal mit ihm zu unterhalten. Der Dialog verlief ungefähr nach folgendem Muster:
„Hans, viele Leute beklagen sich über dein Benehmen. Eigentlich passt dies gar nicht zu dir. Warum tust du das?“
„Du bist der Erste, der mir das sagt. Die meisten, die ich kenne, betrachten mich nur als den Kübelleerer, und da soll ich noch freundlich sein? Weißt du, eigentlich möchte ich auch etwas Sinnvolleres tun, aber dazu hatte ich nie eine Chance.“
„Denkst du wirklich, dass jeder, dem du begegnest, etwas Sinnvolleres tut; dass jeder so zuverlässig ist wie du? Jeder Mensch hat seine Fähigkeiten, auch du, nämlich deine Zuverlässigkeit, im Sommer wie im Winter, bei Regen und bei Schnee den Müll der anderen wegzuräumen. Das, Hans, schafft nicht jeder. Denke einmal nach, welch wichtige Funktion du dabei ausübst! Du hast auch schon miterlebt, was passiert, wenn deine Arbeitskollegen irgendwo im Ausland streiken, wenn sich dadurch Gestank und später Krankheiten verbreiten.
Siehst du nun, dass deine Arbeit unverzichtbar ist und vor allem, dass wir alle auf solche Leute wie dich angewiesen sind? Das kannst du ruhig einmal öffentlich kundtun. Wir sollten dankbar sein, dass es solche Leute wie dich überhaupt noch gibt. Manche, die dich gering schätzen, lenken damit nur von ihren eigenen Problemen ab.“
„Du hast eigentlich recht, aber so habe ich das noch nie gesehen, und so hat auch noch niemand mit mir gesprochen. Ich fühle mich nun als ganz anderer Mensch.“
Unnötig zu sagen, dass er noch beifügte: „Eigentlich müssten mir alle einmal ein Dankeschön sagen.“
„Wann“, „wie“, „wo“, „wohin“, „wie viel“ sind subjektive, sachbezogene Fragestellungen und folgen auf die universelle, neutrale Fragestellung „warum“. Sie beziehen sich auf ein durch die Frageform „warum“ festgelegtes Thema. Mit dieser Fragestellung wird der bewusste oder intellektuelle Denkprozess angesprochen und ermöglicht so eine realistische Einschätzung bezüglich Durchführbarkeit einer Zielsetzung oder eines Vorhabens: ob beispielsweise die fachlichen Kenntnisse, der Durchhaltewille ausreichen, die finanziellen Mittel und die Bereitschaft, diese einsetzen zu wollen, vorhanden sind und vor allem, ob die emotionale Vision auch tatsächlich der Durchführbarkeit entspricht.
Wenn Ihnen also, um beim oben genannten Beispiel zu bleiben, die Gründe für eine berufliche Veränderung bekannt sind und Sie sich emotional ein visionäres Ziel gesteckt haben, ist mit dem intellektuellen Denken die Durchführbarkeit abzuklären.
Oder um es einfach zu erklären: Wenn Sie sich Bademeister als Traumjob vorstellen, selber aber nicht schwimmen können, weil Ihnen aus gesundheitlichen Gründen jeweils der Schwimmunterricht in der Schule verwehrt geblieben ist, wird diese Vision für Sie kaum realisierbar sein.
Mehr darüber im Kapitel: „Der Mensch ist, was er denkt – der Mensch denkt, wie er ist“.