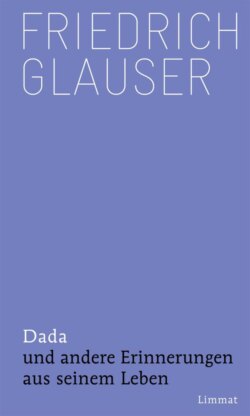Читать книгу Dada - Friedrich Glauser - Страница 6
ОглавлениеIm Landerziehungsheim
Das einzig Bleibende, das wir aus unserer Jugend bewahren, sind Bilder, und diese schlummern in uns. Manchmal nur weckt sie ein Geruch, ein Lied, ein Geschmack. Aber dann sehen wir sie plötzlich mit einer fast blendenden Deutlichkeit, unübertrefflich klar und scharf sind sie, und erst durch sie, durch diese Bilder, werden die Gefühle wieder lebendig, die uns damals ergriffen hatten. Dann kann es sein, dass das Erlebnis, das mit einem Bilde zusammenhängt, langsam uns wieder einfällt, nicht so stark wie damals, denn die Jahre haben es verschüttet; aber es bleibt uns doch eine Erinnerung an die erwartungsvolle Angst, die wir damals gespürt haben. Bitter und süss ist sie, wie starker türkischer Kaffee. Es kann manchmal schön sein, auf die «Suche nach der verlorenen Zeit» zu gehen.
Das Schweizer Landerziehungsheim – abgekürzt S.L.E.H. – lag auf einem Hügel, und der See war sehr nahe. Ein Sonderling hatte es zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts bewohnt, und Goethe hatte diesen Mann besucht, aber der ließ sich nicht blicken. So schrieb der Geheimrat folgende Verse an das Tor:
«Als Gottesspürhund hast du stets dein freches
Spiel getrieben,
Die Gottesspur ist nun vorbei und nur der
Hund ist dir geblieben.»
Es stimmte, auch heute noch. Die Gottesspur war vorbei. Der Pfarrer, der allwöchentlich kam, um uns die Weizäcker’sche Übersetzung des Neuen Testamentes liberal auszulegen, beschränkte seinen Protest gegen die freie Richtung der Schule auf eine kleine Demonstration: er badete mit Badehosen, während wir im Wasser herumschwammen ohne dieses Kleidungsstück. (Das war 1911 und damals sprach man nicht von Nacktkultur. Das ganze wurde dadurch selbstverständlich.) Und gebadet wurde im See von Ende April bis in den Oktober hinein, obligatorisches Baden, um ½ 4 Uhr, nach der Feldarbeit, und die Lehrer badeten mit uns. Übrigens störte uns der stumme Protest des Pfarrers gar nicht. Wir dekorierten dafür die Wände des Klassenzimmers, die Tafel, die Bänke mit ausgeschnittenen Bildern aus dem Simplicissimus und der Jugend, was ihn ärgerte. Aber er konnte nichts dagegen tun; der Direktor fand es sehr komisch.
Und dann, wenn die Herbstnebel das Land decken und sich mit dem Rauch von verbranntem Holz mischen, sehe ich den Platz vor dem Schloss; wir sind in zwei Reihen angetreten zum Dauerlauf, es ist dämmrig. Die um die Mittagszeit grellgelben Blätter der Zwergbirnbäume sind bleich, den See verdeckt eine wattige Masse, die in langsam-zäher Bewegung ist. Um eine Ecke des Hauses biegt der Deutschlehrer, ein kleines Männchen mit Galoschenkinn und graumeliertem Schnurrbart, das aussieht wie die Taschenausgabe eines britischen Obersten («Hott» nennen wir ihn, weil er zur Feldarbeit immer eine blaue Überbluse trägt, wie ein Fuhrmann), und er hat heute Aufsicht. Oben an einem Fenster des ersten Stockwerks erscheint der Direktor, er hat noch verstrubbelte Haare, und sein roter Spitzbart steht schief, das kommt vom Liegen. Wir aber sind angetreten zum Dauerlauf, und der wird von einem von uns kommandiert, Cavaluzz nennen wir ihn; er ist ein untersetzter, breiter Bursche, und Cavaluzz heißt er, weil sein Vater Major ist (nach der Ballade von Spitteler: «Herr Cavaluzzi, der Major»). «Ausrichten!» sagt er, und er kontrolliert, ob wir zwei parallele Geraden bilden. «Lauf Barriere!» kommandiert er dann und versucht die Stimme seines Vaters nachzuahmen; aber der Schneid misslingt ihm. Er ist nämlich musikalisch, trägt eine blonde Künstlermähne und komponiert. Nach dem Laufe müssen wir unsere Betten machen, dann gibt es zum Frühstück Haberbrei mit kalter Milch und Kakao. Und obwohl wir schon lange den Geruch des Haberbreis, des Porridge, nicht mehr ausstehen können, essen wir doch, denn wir sind hungrig.
Und dann beginnt die Schule. Die Klassen sind nicht scharf getrennt. Mit Corbaz, einem gemütlichen Neuenburger, der zwei Jahre älter ist als ich, mit Stein und Rösel hocke ich in der höchsten Klasse, in der siebenten. Aber nur für Französisch. Für die Hauptfächer bilden wir die fünfte Klasse, und wir sind eine etwas sonderbare Clique. Man hat es schwer mit uns, wir sind «Dilettanten», wie der Direktor und der Hott uns gern nennen, es fehlt uns an Ernst. Das kommt aber eigentlich nur daher, dass wir den Phrasen abhold sind, dass wir alle einen kleinen Sparren haben. Zu unserer eigenen Entschuldigung führen wir unsere Familienverhältnisse an. Die sind nicht ganz koscher, wie Rösel sagt, der gedrungen, leicht verfettet und schwarzhaarig ist, sich einer merkwürdig penetranten juristischen Denkweise befleißigt und auf seine israelitische Abstammung nicht nur stolz ist, sondern sie auch bewusst betont. Seine Sprache, seine Aufsätze wimmeln von Fremdwörtern, in die Unterhaltung flicht er gern jiddische Ausdrücke ein. Er sagt «Fisimatenten» und «Mischpoche», wenn er von seiner Familie spricht. Dem Hott geht er auf die Nerven, weil er in seinem Aufsatzstil Thomas Mann kopiert.
Ja, damals, im Jahre 1911, war die Blüte der Landerziehungsheime; ein Dr. phil. aus Deutschland, er hieß so ähnlich wie eine bekannte Fabrik optischer Apparate, Leitz oder so, hatte solch ein Institut in Deutschland gegründet. Etwas Neues? Wenn man will. Die britischen Colleges der Festlandmentalität angepasst. Lebenstüchtigkeit, Kameradschaftlichkeit zwischen Lehrern und Schülern, körperliche Ertüchtigung. Wir trugen sommers und winters blaue Hosen, die die Knie frei ließen, im Sommer trugen wir dazu nur ein Hemd und offene Sandalen an den Füßen. Und bei der Feldarbeit arbeiteten wir mit nacktem Oberkörper. Aber das kameradschaftliche Verhältnis mit den Lehrern? Es war wohl unsere Schuld, dass es nicht so recht gedeihen konnte.
Da war zum Beispiel der Direktor, ein robuster Mann mit Hodlerwaden, gutmütig und bisweilen jähzornig, der sich für einen Pädagogen hielt, weil er auf der Universität Pädagogik belegt hatte, weil er bei dem vorgenannten Dr. phil. in Deutschland Lehrer gewesen war. Aber er versagte bei uns, weil er von dem merkwürdigen Vorurteil besessen war, dass es unsere Pflicht sei, Vertrauen zu ihm zu haben (als ob Vertrauen etwas mit Pflicht zu tun hätte, Vertrauen hat man sich doch zu verdienen!). Wir versuchten es natürlich, vielleicht einmal, dann hatten wir genug. Unsere Seelenzergliederung ging ihm auf die Nerven, das spürten wir. So hielten wir schließlich Abstand von ihm, verkehrten mit ihm in leichtem Konversationston und würgten an unsern Konflikten, bis wir sie los waren oder bis sie uns vergiftet hatten. Das letztere war häufiger. Er, der Hott, der Naturgeschichtslehrer, den wir «Pistole» nannten, aus unerfindlichen Gründen, Charly, der Französisch und Griechisch und Latein gab, ein Neuenburger mit melancholischem Schnauz und einer Hitlerfranse, und der Papa, der uns Physik und Mathematik gab, ein dickes Männchen mit einem stoppligen Bart, den wir sehr gern hatten, weil er uns sachlich behandelte und streng und wir bei ihm schuften mussten, diese fünf also bildeten die alte Garde, die Vereinigung der Familienväter. Ihr stand die Fronde gegenüber, die Lehrer, die Junggesellen waren und eigentlich nur kurze Gastspiele gaben.
Da war einmal Borstle, ein Mann von der anziehenden Hässlichkeit einer rassenreinen Bulldogge. Er war klug und gab uns Geschichte, und seine Stunden waren richtige Vorlesungen. Es hieß, er bereite sich fünf Stunden vor, um uns eine Stunde zu geben. Am Abend nahm er uns oft auf sein Zimmer, das in einem kleinen Turme lag, und dann las er uns Maupassant vor, uns wenigen, die gut Französisch konnten, und bei Maupassant findet man allerlei, auch Sachen, die nicht «ad usum Delphini» sind. Wir waren keine Kronprinzen, und für Prüderie hatten wir nichts übrig. Borstle hatte eine Art, die Pointen vorzulesen – ein wenig atemlos, so als müsse er ein Gelächter unterdrücken –, die unwiderstehlich war. Wir lachten, und er kicherte mit. «L’histoire», sagte er, «de ce … de ce cochon de Morin.» Dann erzählte er uns Witze, uralte Jahrgänge, aus den Anekdotenbüchern des französischen siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts – und zu jener Zeit verstand man es, auch das Gröbste so zu sagen, dass es wirkte wie das geschickte und bunte Ballspiel eines Jongleurs. Etwas haben wir von ihm gelernt, von Borstle, nämlich: eine gewisse Vorurteilslosigkeit, eine trockene, unsentimentale Einstellung zum Erotischen. Bei mir hat sich seine Lehre zu dem Satz auskristallisiert: «Erotische Komplikationen sind immer unfruchtbar.» Ob es stimmt, weiß ich nicht. Tatsache ist ja, dass fast alle Romanschriftsteller, so die Mittelmäßigen, immer einen großen Schmu mit der Liebe treiben. Es gibt doch noch andere, interessantere Dinge, oder?
Dann war ein anderer Lehrer da, «Chleb» nannten wir ihn, der aussah wie Gerhart Hauptmann nach einer Verjüngungskur. Der war mit einem aus unserer Klasse befreundet, mit der Zwetschge, einem Burschen, der lang war wie ein Fastentag – und Zwetschge hieß er, weil er beim Sprechen die Worte durch die Nase zu quetschen schien. Dieser Chleb hatte der Zwetschge Sigmund Freuds Traumdeutung geliehen (die war damals gerade modern), und das Buch lasen wir alle, worauf unsere Rede so dunkel wurde und voll Symbolgehalt, dass sie einer Geheimsprache glich.
Ich habe mich oft gefragt, ob ich in diese Zeit nicht Fähigkeiten hineindichte, die gar nicht vorhanden waren. Aber dann scheint mir doch, als sei der sonderbare Instinkt, den wir bei der Beurteilung der Erwachsenen, der Lehrer, entwickelten, doch vorhanden gewesen. Es war wirklich so, als hätten wir das spezifische Gewicht ihres Charakters erfassen können. Unser Ohr muss damals geschärfter gewesen sein für den Ton der Worte, und in diesem Ton klang oft, nur allzu oft, eine gewisse Selbstüberheblichkeit mit, die des notwendigen Unterbaues ermangelte und daher unecht wirkte. Es ist merkwürdig, dass dieses Gefühl für das Unechte im Nebenmenschen später sich abstumpft. Es wird wohl so sein müssen, sonst ginge ja alle Geselligkeit zum Teufel, und es widerstrebt wohl jedem, als der arme Hund dazustehen, der er nun einmal ist.
Wir duldeten das Theaterspiel der Großen stillschweigend. Manchmal, wenn es zu übertrieben war, lachten wir. Ein Beispiel: Der Hott, jener Deutschlehrer, der aussah wie ein britischer Colonel, gab uns auch Englisch. Einmal sollte er verreisen, hatte aber einem von uns mitgeteilt, dass er vorher noch die Stunde geben werde. Wir warteten im Klassenzimmer, zehn Minuten, eine Viertelstunde – er kam nicht. Da gingen wir fort, standen noch schwatzend im Sälchen, das neben dem Speisesaal lag. Da schoss der Hott herein, pflanzte sich vor uns auf und kanzelte uns ab: Er halte immer seine Versprechungen, wenn er etwas gesagt habe, so gelte es, auf ihn könne man sich verlassen. Es sei eine Gemeinheit, dass wir nicht auf ihn gewartet hätten; dann rasselte es von großen Worten, von Pflichtbewusstsein und Verantwortlichkeitsgefühl (seine ausgezeichnete Diktion ermöglichte es ihm, auch solche Worte tadellos auszusprechen), seine Rede trieb einer Steigerung entgegen, wir fürchteten für ihn, dass die Steigerung ihm misslingen könne (Rösel gähnte), aber nein! Mit zwei Sätzen erklomm er die kleine Treppe im Hintergrund des Sälchens (eine Glastür war dort, die in einen Korridor führte), und Hott riss die Glastür auf, über die Achsel spuckte er die Worte über uns: «Ich verachte euch!» Bumm. Die Glastür schmetterte zu. «Vorhang fällt», sagte Rösel trocken. Wir lachten.
Letzthin habe ich die Zwetschge wieder getroffen. Er ist noch immer lang und hager, spricht durch die Nase, was weniger auffällt, da er das Französische mit englischem Akzent spricht. Er ist Ingenieur, hat eine gute Stelle und ein sehr geschmackvoll eingerichtetes Appartement, eine Garçonnière. Wir wärmten Schulerinnerungen auf. «Ja», sagte er, «der Hott hat es ja weit gebracht, ist Professor, gut. Seine Stunden waren ausgezeichnet, alles was recht ist. Aber er war doch ein Komödiant, weißt du, im Grund ein falscher Charakter!» Ich nickte und wunderte mich. Die Zwetschge hat mit dem Hott nie Anstände gehabt, seine Aufsätze wurden mit Glacéhandschuhen angefasst, während Rösels, Steins und meine zerpflückt wurden, wie Gänseblümchen von einem kleinen Kind, und doch sagte die Zwetschge … Ich glaube wirklich, wir hatten damals ein sicheres Urteil. Nun, Deutsch haben wir beim Hott gelernt, aber es ist ein wenig verschieden von dem, das er schätzte.
Aber noch über einen Lehrer haben wir gesprochen, die Zwetschge und ich: über unsern Mathematiklehrer, den Papa, wie wir ihn nannten. Wir haben beide gelächelt, so als ob eine angewandte Gleichung zweiten Grades wirklich etwas hervorragend Fröhliches gewesen sei. Warum? Er mischte sich nicht in unsere Angelegenheiten, er war streng, ohne zu strafen, er hatte manchmal einen trockenen Humor, den wir schätzten. Es war gut, auf den langen Schulreisen mit ihm zu wandern, er schwieg, aber sein Schweigen hatte Gehalt. Vielleicht liegt es doch an dem, dass einer schweigen kann? Aber es gibt auch leeres Schweigen. Das seine war gehaltvoll; in ihm war: Verständnis, das sich nicht aufdrängen will, innere Ruhe, aber lebendige Ruhe. Die andern waren alle so laut, ihre Ansichten hingen ihnen zum Munde heraus, wie Spruchbänder auf mittelalterlichen Bildern. Der kleine, dicke Mann hatte keine Phrasen zur Verfügung; das war erlösend, er klopfte uns nicht aufmunternd auf die Schulter, wie er überhaupt jegliche Berührung vermied. Er badete auch nicht mit uns. Übrigens kam er vom Handwerk, er war Uhrmacher gewesen. Genug von ihm!
Sport? Ja, wir spielten Tennis, wir hatten eine Fußballmannschaft, Rösel war ein guter Vorwärts links, ich hockte im Goal, weil ich bequem war. Überhaupt hatte unsere Klasse nicht viel für Sport übrig. Wir lasen lieber, lauter komplizierte Sachen, Ibsen und Dostojewski, Strindberg und Wedekind. Nicht alle, aber doch der bestimmende Kern: Rösel, Ted und die Zwetschge. Dann war da noch die Meise, ein nervöser Kerl mit einem Vogelkopf, der die ‹S› nicht aussprechen konnte. Er war Deutscher, musste den Weltkrieg mitmachen und erschoss sich dann in Wien. Er wollte Kunsthistoriker werden.
Wir waren aus allen Weltgegenden zusammengekommen. Aus Russland stammte Rösel, Stein aus Berlin, die Meise aus Darmstadt, nur die Zwetschge war schweizerischer Abstammung. Und wir stammten alle aus dem bessern Bürgertum, wie man damals sagte. Und kennen Sie diese Atmosphäre? Die wenigsten wohl. Die Luft, die über den «bessern Kreisen» lag, in jener schon historischen Zeit, die vor dem großen Kriege webte, war abgestanden, muffig; das Familienleben, das wir genossen hatten, war, vorsichtig gesagt, etwas merkwürdig. Was wunder, wenn wir alle ein wenig neurotisch waren? Wir alle waren aus irgendeinem Grund aus den Staatsschulen entfernt worden – weil es dort nicht mehr ging, weil die Konflikte unserer Eltern auf uns abgefärbt hatten, weil wir müde geworden waren und uns in die Blasiertheit gerettet hatten. Man hatte uns daheim so oft angelogen, wir waren trainiert auf das Erkennen der Lüge, auch wenn sie noch so gut verhüllt war. Sie hatten es schwer mit uns, die Lehrer; als Entschuldigung möge ihnen dienen, dass sie ja schließlich auch zu der Generation unserer Eltern gehörten. Vielleicht steckte uns der große Stumpfsinn in den Knochen, der damals umging. Und wir waren alles eher als sympathisch, das will ich gern zugeben.
Wie wir zum Beispiel mit den Kleinen verfuhren, war wenig anständig (ich spreche vom Großteil unserer Klasse und von den Ältern, die knapp vor der Matur standen, die sie in Zürich machen mussten). Entweder existierten sie gar nicht für uns, diese Kleinen, oder sie waren psychologische Studienobjekte. Es war interessant zu beobachten, wie sie sich verhielten, wenn man an einem Tag ihnen mit Interesse begegnete, um sie am nächsten Tage fallenzulassen. Eine schottische Dusche, psychologisch gehandhabt, warm, gleich darauf eisig kalt. Sie mussten uns ihre Träume erzählen, und diese dann durchzusprechen war geradeso interessant wie die chemischen Versuche, die wir im Labor machten.
Das klingt reichlich zynisch, aber ich kann Ihnen nicht helfen. Die goldne Jugendzeit, die, ach so weit, so weit entschwunden ist, wie es im Liedchen heißt, sie war gar nicht so golden. Sie war manchmal reichlich gemein, wir wollen es eingestehen. Hatte man uns daheim eigentlich besser behandelt, war dort nicht auch die schottische Dusche Trumpf? Wenn ich an die Besuche denke, die die Eltern manchmal machten! Man kroch fast in sich zusammen, weil man sich schämte, vor sich, vor den andern. Es gab Ausnahmen, rühmliche Ausnahmen, sicher, aber an diese erinnere ich mich nicht. Geheult habe ich im Heim eigentlich nur, wenn mein Vater mich besuchen kam. Aber das war vielleicht meine Schuld. Schuld? Wer will da von Schuld sprechen? Ich denke an Daniel, der aus Königsberg stammte, ein guter Mathematiker, ein ausgezeichneter Schachspieler, daneben unbeholfen, und den wir quälten, weil er so hilflos war. Und an den Besuch, den er einmal erhielt, von seinem Vater und seiner Stiefmutter! Der Vater, ein finniger Fettkoloss mit ewig feuchten Händen, die Stiefmutter aufgedonnert mit Pleureusen. Und gerade an diesem Nachmittag, es war ein Sonntag, las der Hott die Weber vor. Er las ausgezeichnet, ohne schwülstiges Pathos, und wir horchten sehr still. Dann war die Vorlesung zu Ende, und wir hockten alle stumm. Da steht Daniels Vater auf (was will er? Er wird doch nicht? Doch …), mit watschelndem Gang tritt er auf den Hott zu: «Also prima, Herr Doktor», sagt er mit einer Stimme, wie sie von Komikern gebraucht wird, wenn sie jüdische Witze erzählen wollen, «ich danke Ihnen, Herr Doktor, für den unauslöschlichen Genuss, den Sie gegeben haben, mir und meiner Frau. Und ich bin sicher, dass ich im Namen aller spreche, der Jugend, die hier versammelt ist …» das ging weiter und plätscherte wie Herbstregen, der Hott wurde langsam rot. Da rettete der Direktor die Situation, schob seinen Stuhl zurück, geräuschvoll, und machte mit lauter Stimme eine nebensächliche Bemerkung. Wir atmeten auf. Daniel saß da und knabberte an seinen Fingernägeln. Wir ließen ihn still sitzen. Nachher mussten wir sein Zimmer lüften. Seine Stiefmutter, die er Tante nennen musste, war so parfümiert, dass sie das ganze Zimmer verpestet hatte. Daniel? Was aus ihm geworden ist? Ich glaube, er ist im Weltkrieg gefallen.
Das Buch der verlornen Zeit hat viele Bilder, und sie drängen sich. Da war die «Andacht». Nichts Religiöses, wie Sie glauben könnten. Es war eine halbe Stunde Vorlesen am Abend, von halb acht bis acht Uhr. Und im Sommer am See. Gewöhnlich las der Hott vor, und er las gut; auch was er vorlas, war sorgfältig ausgewählt: Raabe und C. F. Meyer und Keller und von Spitteler den Olympischen Frühling. Chleb sagte: In zehn Jahren spricht kein Mensch mehr von diesem Autor. Wir glaubten ihm nicht, und er hat doch recht behalten. Wer interessiert sich heute noch für die gigantischen Götter aus Papiermaché des Herrn Spitteler? Germanisten. Und in der Hut solcher Leute schläft ein Autor seinen sanftesten Schlaf.
Aber Keller hat mich damals sehr getröstet. Die Stelle im Grünen Heinrich nämlich, wo der Held, noch klein, seine Mutter bestiehlt. Ich hatte daheim auch gestohlen, und mein Vater hatte mir prophezeit, ich würde ins Zuchthaus kommen. Ich glaubte ihm natürlich. Aber dass Keller da auch eine Jugenderinnerung gestaltete, das verstand ich. Die Einsamkeit lockerte sich.
Und Sommernachmittage sind da, Sonntage. Man liegt mit einem Buch auf irgendeinem Hügel und liest zur Abwechslung einmal Eichendorff. Eine Heuschrecke schnarrt mit roten Flügeln, Bienen ziehen Striche durch die Luft, es riecht nach Wald und dorrenden Wiesen, und manchmal bringt ein kleiner Wind den Geruch des Sees. Dann stützt man sich auf die Ellbogen und sieht unter sich das schmale blaue Seidenband, auf dem die Boote winzige unregelmäßige Muster sind. Bis der Abend kommt, und man steigt hinunter, die Andacht ist am See, unter dem Birnbaum, wir liegen alle im Kreis, die Wolken sehen aus wie angestrichene Tiere, unwahrscheinlich rote Foxterriers mit offener Schnauze oder violette Flamingos. Es ist entschieden friedlicher als im Gymnasium in Wien, denke ich, und letzthin hat der Vater geschrieben, dass in meiner frühern Klasse acht Schüler Selbstmord begangen haben. Aber das Grauen vor dieser Vergangenheit zergeht, der Hott liest gerade: «Frag mir nicht nach!»
Wir spielten Theater, und Hott machte Regie. Er machte sie gut, wie alles, was er anpackte. Warum waren wir immer misstrauisch? Wir spielten Grillparzers Der Traum ein Leben, wir spielten Shakespeare: Was Ihr wollt. Und dem «Heim» (wie der Direktor sein Besitztum nannte), dem Heim gegenüber, auf der andern Seite des Sees, war ein Mädcheninstitut, und die Mädchen übernahmen die Frauenrollen. So kam es, dass eine Rivalität ausbrach zwischen Rösel und Ted, weil beide die Rolle des Herzogs spielen wollten, der während des Stückes sich sehr mit Viola beschäftigt. Der Konflikt wurde beigelegt: Wir spielten das Stück viermal, die beiden Rivalen lernten jeder zwei Rollen, den Malvolio und den Herzog, weil beide neben dem «Getragenen» auch eine Neigung zum Komischen hatten. Mit Hott gab es natürlich noch einen Krach, ich weiß nicht mehr, weswegen, er kotzte uns an mit ciceronischer Beredsamkeit, er wolle nichts mehr mit uns zu tun haben. Wir probten ruhig allein weiter. Am Abend der Vorstellung kam er uns nach dem ersten Akt beglückwünschen. Und dabei hatte die Viola furchtbar dicke Waden; übrigens währte die Verliebtheit der beiden nicht lang. Schwierigere Probleme tauchten auf. Wir entdeckten die Politik.
Denn wir hatten eine Landsgemeinde, die aus der Versammlung aller sechzig Schüler bestand. Kein Lehrer durfte an ihr teilnehmen; denn wir verhandelten, kritisierten, und manchmal ging es ein wenig rabiat zu. Abgehalten aber wurde sie in dem kleinen Sälchen neben dem Speisesaal, von dem ich Ihnen schon erzählt habe.
Noch ein Bild: Vor uns thronten, um einen langen Tisch, die fünf Ausschussmitglieder. In der Mitte der Präsident, Cavaluzz, der Komponist, der die Narrenlieder vertont hatte, rechts von ihm die Zwetschge, an der Schmalseite des Tisches Rösel, den klobigen Kopf eingezogen, wie eine Schildkröte. Auf der andern Seite saß Paul, der nicht einmal einen Übernamen hatte, weil er allzu bedeutungslos war, und Pfumpf, ein Basler, dessen Gesichtshaut nicht nur im Frühling Blüten trieb. Vier von den Ausschussmitgliedern gehörten unserer Klasse an, nur Cavaluzz stand knapp vor der Matur.
Wir wollten den Paul «blackboulieren», wie Rösel in seinem Jargon sagte, und Ted an seine Stelle wählen. Das hatten wir in einer Geheimsitzung ausgemacht, in einer Nacht, nach zehn Uhr (und bekanntlich war um zehn Uhr Lichterlöschen; aber dann verhing man die Fenster mit Wolldecken und rauchte, obwohl Rauchen verboten war). Bei dieser Geheimsitzung war ich die Hauptperson, denn ich hatte gerade einen Triumph über den Direktor davongetragen: er hatte mich geohrfeigt, war beim Nachtessen, gerade als er (das war das Essensbeginnritual) «gesegnete Mahlzeit» sagen und sich den nach hinten geschwungenen Stuhl in die Kniekehlen hauen wollte, was ihn automatisch zum Absitzen brachte, gerade in diesem Moment war er ausgepfiffen worden. Solidaritätserklärung, beschlossen mit Stimmenmehrheit vom Ausschuss: einzig Paul hatte dagegen gestimmt. Rösel fand, das müsse ihn jetzt den Kragen kosten. Der Direktor hatte sich nachher bei mir entschuldigt (es war ja wirklich ein gröblicher Verstoß gegen die heiligen Prinzipien der modernen Pädagogik – Prügelstrafe: Verpönt!) – übrigens tat mir der Mann sehr leid, er war so ehrlich zerknirscht, und er konnte doch nichts dafür, dass ihm die Hand ausgerutscht war, ich hatte doch wirklich ein Ohrfeigengesicht – kurz, diese Ohrfeigengeschichte hatte mir die notwendige Popularität gebracht. Ich sollte bei den Kleinen Unterschriften sammeln, unter eine von Rösel entworfene Petition, die Pauls Entfernung aus dem Ausschuss wegen Unfähigkeit forderte. Und zugleich sollte ich für Stein Propaganda machen. Es war aber dieser Stein ein kleiner, turmschädliger Kerl, mit viel Witz, Alleskönner, Mathematiker, auch Verse verbrach er, satirische Verse in Heines Manier. Die Zwetschge und Pfumpf wurden nicht in den Plan eingeweiht; sie waren verdächtig, zur Gegenpartei zu halten.
Nun, die Unterschriften brachte ich mühelos zusammen. Ich war ja der jüngste der Klasse und hatte Anhänger bei den Kleinen, vielleicht, weil ich mich nicht getraute, die schottische Dusche anzuwenden. «Du hast ja schauspielerisches Talent», hatte Rösel gesagt und mir dabei auf die Schulter geklopft, «du wirst es dann noch brauchen in der Landsgemeinde!»
Vor der Landsgemeinde hatte mir noch Rösel mitgeteilt, soviel er wisse, würde die Gegenpartei eine Kontermine springen lassen, er könne nicht viel sagen, ich müsse dann angreifen. «Aber wir werden die Sache schon managen» (mänädschen, sagte er), ich solle nur aufpassen, wenn er winke. Darum placierte ich mich neben einem Fenster, etwa in der Mitte der Versammlung. Ich sah Rösels Hände gut, sie waren sehr weiß, aber sein Gesicht war im Dunkeln. Die Stehlampe vor dem Präsidenten trug einen dunklen Schirm, der das Licht nur auf die Tischplatte warf.
«Soviel ich weiß», sagte Cavaluzz mit neutraler Stimme, «hat Rösel eine Petition zu verlesen, die von einer genügenden Mehrheit unterzeichnet ist; ich habe einzig einen Formfehler zu rügen, dass diese Petition mir erst knapp vor Beginn der heutigen Landsgemeinde übergeben worden ist …» Hier unterbrach die Zwetschge: «Ich verlange zuerst das Wort! Wenn du gestattest?» Die letzten Worte waren an Rösel gerichtet, der schon die Hände auf den Tisch gestützt hatte, um sich hochzustemmen, sich nun aber mit einem gleichgültigen Nicken wieder niederließ.
«Die Petition, die der Landsgemeinde unterbreitet werden soll, ist eine Infamie!» War es das Wort oder der Zwetschge sonderbare Aussprache des Deutschen, kurz, es ging ein Meckern durch die Versammlung. Am lautesten war Corbaz’ Lachen, tief im Bass. Er war der Älteste in unserer Klasse, hatte saloppe Lebemannallüren, war ein guter Kerl und hielt zu unserer Clique. «Ich bitte, nicht zu lachen, die Petition, die ihr unterzeichnet habt, ist eine schmutzige politische Machenschaft …» Rösel hob ein wenig die Hand, ich schoss auf: «Ich verbitte mir diesen Ton, ich habe die Unterschriften gesammelt, und wir alle sind einig, dass …» ich blickte auf Rösel, der schüttelte leicht den Kopf; also hatte ich mich im Ton vergriffen, ruhiger fuhr ich fort: «Ich bitte den Präsidenten ums Wort, damit ich mich gegen diese Insinuationen verteidigen kann.» Cavaluzz schüttelte den Kopf. «Sprich weiter», sagte er zur Zwetschge.
Die Zwetschge entfaltete ein Papier, las vor. Die Vortragsstunden unseres Deutschlehrers hatten ihm wenig genützt, er las stockend und langweilig. Rösel gähnte verhalten, aber es war Theater, man merkte es. Doch schien es eine Art Zeichen zu sein. Denn – Zwischenruf Corbaz: «Neue Panama-Affäre? Untersuchungsausschuss?» Zwetschge kam nicht aus der Fassung. Er las von jüdischen Machenschaften, von moralischer Verantwortung. Das Lachen, das anschwoll, rollte von vorn nach hinten, flutete zurück, überschwemmte den Ausschusstisch. Die Zwetschge stand unbeweglich, Pfumpf grinste unverschämt, sagte dann in breitem Baslerdeutsch, ob hier eigentlich amerikanische Wahlmethoden herrschten? Und zwinkerte mit seinen Schweinsäuglein. Da zeigte sich, dass auch unsere Gegenclique nicht müßig gewesen war, sie hatte kurz vor der Landsgemeinde Anhänger geworben, die Frechsten natürlich unter den Kleinen. Ich wollte reden, Cavaluzz gab mir das Wort, aber es ging ein Gebrüll los und ein Geschrei, ich hätte mich den Juden verkauft, ein ganz merkwürdig sinnloser Pöbelhass sprang auf. Ted saß nicht weit von mir, er lächelte spöttisch. Da erhob sich Rösel, und mit der leichten Bewegung eines Schachspielers, der eine Partie aufgibt, die er nur gewinnen könnte, wenn der andere grobe Fehler machen würde, sagte er ruhig in das plötzliche Schweigen: «Bitte.» Dann nahm er die Petition und riss sie durch, zerriss sie noch einmal, knüllte sie zusammen, stopfte sie in die seitliche Rocktasche. Dann zog er ein verschlossenes Couvert hervor, überreichte es Cavaluzz: «Meine Demission», verbeugte sich leicht, ging in den Saal und setzte sich auf einen freien Stuhl.
«Wir werden jetzt zu einer Neuwahl schreiten», sagte Cavaluzz, nachdem er das Couvert geöffnet hatte. «Vorgeschlagen sind …» Er nannte ein paar Namen, Schüler der vierten Klasse. Ein langweiliger Kerl wurde gewählt mit fünfunddreißig Stimmen gegen fünfundzwanzig Enthaltungen. Auch der Ausschuss hatte nicht mitgestimmt.
Die Sache hatte ein Nachspiel. Wir wurden vom Direktor verhört, wir drei, Rösel, Ted und ich. Die Kleinen hatten wahrscheinlich geklatscht (der Direktor unterrichtete nur in den untern Klassen), und so fühlte sich der Direktor verpflichtet, die Sache zu untersuchen. Chleb, der verjüngte Gerhart Hauptmann, war anwesend als Protokollführer. Ich hatte damals einen richtigen Ehrlichkeitsrappel und erzählte die ganze Geschichte. Es sei doch mein gutes Recht, eine Aktion gegen einen Kameraden zu unternehmen, den ich für unfähig hielte. Ich war aufgeregt, der Direktor, der vielleicht kein ganz ruhiges Gewissen wegen der Ohrfeigen hatte, behandelte mich mit Glacéhandschuhen. Rösel schwieg, Ted war frech. Endlich wollte der Direktor wissen, wer die Petition aufgesetzt habe. «Ich habe sie konzipiert», sagte Rösel ruhig, und die Worte tropften verächtlich von seinen Negerlippen. Ob er nicht wisse, dass das schmutzige Politik sei? wollte der Direktor wissen. «Verzeihen Sie», sagte Rösel, «sollen wir hier fürs Leben vorbereitet werden oder für einen Kindergarten?» Er ließ das Fragezeichen in der Luft hängen, schritt gemessen zur Tür und verschwand. Nach dem Verhör machte mir Chleb Komplimente über meine Ehrlichkeit; aber ich konnte mich nicht lang an ihnen freuen, denn Rösel sagte nachher zu mir: «Du bist ein Schwätzer und wirst ein Schwätzer bleiben!» Ganz unrecht hat er ja nicht gehabt. So musste ich einige Tage an einem Zwiespalt tragen, denn Chleb, der mich bisher nicht beachtet hatte, sprach nun manchmal mit mir, was mich stolz machte. Er war nämlich ein Dichter, und ein Drama von ihm war von der Schillerstiftung mit einem Preis ausgezeichnet worden. Aber die Kehrseite war, dass Rösel mich nicht mehr beachtete. Und das kränkte mich.
Er ging dann bald fort, weil er einmal mit dem Hott einen furchtbaren Krach hatte, bei welchem er ruhig blieb, überlegen (und dies wurde ihm natürlich als Frechheit ausgelegt). Er ging dann in eine Presse. Sehen Sie, aber den Trick, den er damals in der Landsgemeinde angewandt hat, dieses elegante Aufgeben einer scheinbar verlorenen Partie, ein Aufgeben eigentlich nur, um einen sogenannten moralischen Vorteil zu ergattern, diesen Trick hat er später in seinem Beruf ausgebaut. Und er versagt fast nie. Chleb, der auch gern Aphorismen verfasste, tat einmal den apodiktischen Spruch: Ein Apfelbaum hat Äpfel, ein Birnbaum hat Birnen, wer beides hat, ist ein Obsthändler. Vielleicht ist Ted ein Obsthändler geworden. Er hat die Dichtkunst an den Nagel gehängt und ist in die Fußstapfen des Herrn Rathenau getreten. Kommerzienrat ist er auch schon, was kann nicht noch alles aus ihm werden! Aber vielleicht hat ihn die jetzige Regierung abgebaut, obwohl ich es nicht glaube.
Einmal, in der Legion, hatte ich meine Feldflasche aus einem lauen Flüsschen gefüllt. Und als ich dann das Wasser trank, war plötzlich wieder der Badestrand da. Das lange Sprungbrett, das weit in den See hineinführte, und ich stehe am Ende. Mit Schwung schmeißt mich der Direktor hinein, ich sinke unter, der Geschmack des lauen Wassers ist widerlich. Nachher habe ich erbrechen müssen. Die Methode war nicht gut, um das Schwimmen zu erlernen. Ich brauchte ein Jahr, bis ich es konnte, und dann ging es noch schlecht. Warum fällt mir diese Szene immer wieder ein? Sie hat doch irgendwie Symbolgehalt. Schwimmen lernte man im «Heim» schlecht, im wirklichen Sinne besser als im übertragenen. Es war eine Art Treibhaus, ich weiß von vielen meiner Kameraden: sie brauchten Jahre, um sich umzustellen. Es war wohl eine Scheinwelt, in der wir lebten, und es war dann schwierig, sich draußen wieder zurechtzufinden. Es gab auch so viele Sachen dort, über die zu sprechen schwierig ist. Kennen Sie die Verwirrungen des Zöglings Törleß von Musil? Wenn Sie Aufschlüsse über das Leben in Internaten wünschen, rate ich Ihnen, das Buch zu lesen.
Letzthin (das heißt vor zwei Jahren) habe ich das «Heim» wieder besucht. Der See ist schön, wie er immer war, und auch der Sommer hat nichts von seiner Tiefe verloren. Ein Ehemaliger, aber nicht einer von unserer Generation, hielt den Knaben einen Vortrag: Militärdienst, Bau einer Brücke. Die Versammlung lauschte begeistert, wenn man begeistert lauschen kann. Und da musste ich denken, wie wir uns benommen hätten. Unsere Klasse wäre mit Obstruktion vorgegangen, solche Sachen hätten wir uns nicht bieten lassen. Und das ist nicht etwa eine gefälschte Jugenderinnerung, denn zu meiner Zeit passierte das gleiche. Die «Pistole», der Naturgeschichtslehrer, berichtete uns einmal, vorsichtig, vorsichtig, über das Ergebnis der deutschen Reichstagswahlen, die gerade damals einen Sieg der Sozialdemokratie ergeben hatten. Wir hörten zu, höflich, aber unbeteiligt. Und der Lehrer merkte dies, denn obwohl er überzeugter Sozialist war, wagte er es nicht, seinen Vortrag mit einem Panegyrikum auf die Sozialdemokratie zu schließen. Er verherrlichte die Abstinenz, deren Wegbereiter die zielbewusste Arbeiterschaft sei. Nun gut, da konnten wir aus Höflichkeit folgen. Wir waren ihm ja alle in einen abstinenten Jugendbund gefolgt, mit viel geistigem Vorbehalt, aber wir waren ihm gefolgt.
Sie werden fragen, ob wirklich ein so großer Unterschied besteht zwischen der heutigen Generation und der unsern. Gewiss, der Unterschied war da. Für wen wurden damals die Landerziehungsheime gegründet? Für (wie man heute sagen würde) die schwererziehbaren Kinder des wohlhabenden Mittelstandes. Aber ein Trugschluss lief mit unter: Gewiss, wertvolle Menschen sind in der Jugend manchmal die störrischsten, die am schwersten zu leitenden. Aber das Reziproke braucht nicht wahr zu sein. Nicht jeder Schwererziehbare ist ein Genie oder ein Talent. Setzen Sie Unkraut ins Treibhaus, es wird wachsen und gedeihen – aber es wird keine Orchidee daraus, sondern eben nur Katzenschwanz. Die Milieutheorie, nach der die Umwelt, in der ein Mensch aufwächst, bestimmenden Einfluss auf seinen Charakter ausübt, hat mir von jeher Misstrauen eingeflößt. Und die Landerziehungsheime trieben Individualpädagogik, sie trieben sie mit einer derartigen Begeisterung, dass ein Fehlschlag nicht ausbleiben konnte. Denn schließlich ist und bleibt der Mensch doch ein Herdentier und hat sich als solches der Herde anzupassen. Einzelgänger werden geächtet, verfolgt, bei den Elefanten genau wie bei den Menschen. Aber wir wurden eigentlich zu Einzelgängern erzogen, jeder von uns hatte seine dilettantische Marotte, der eine Chemie, der andere Literatur, der dritte Fußball. Kameradschaft – ja. Man wollte uns zur Kameradschaft erziehen; aber über ein Zweigespann gedieh diese Kameradschaft nie. Auch die Gründung eines Vereins ehemaliger Schüler des «Heims» half über diese Tatsache nicht hinweg.
Die Psychoanalyse hat ein schönes Wort entdeckt und braucht es oft: Anpassung an die Realität. Nun, Anpassung an die Realität lernten wir wenig. Die englischen Colleges, von denen ich zu Anfang sprach und deren kontinentale Ableger die Landerziehungsheime waren, haben etwas vor unsern Schulen voraus: die Erziehung zum Gentleman, zur Fairness. Es ist dies ein (grob ausgedrückt) Unterdrücken privater Hysterien, ein Erlernen gewisser Höflichkeitsformen, einer gesellschaftlichen Kultur, die es dem einzelnen gestattet, seine Privatmeinungen, seine Individualität beizubehalten, aber sie für sich zu behalten und nicht alle und jedermann damit beglücken zu wollen. Die Engländer, man möge gegen sie einwenden, was man will, haben in dieser Beziehung entschieden einen Vorteil über uns. Man sehe nur ihre Politik! Wir alle aus unserer individualistischen Generation haben schwer umlernen müssen. Bei manchen hat es Jahre gebraucht, manche, die wendiger waren, haben es schneller gelernt. Man muss ja auch zugeben, dass eine schwere Zeit folgte, eine Zeit, der wir nicht gewachsen waren. Und in dieser Beziehung, Rücksichtnahme auf die Individualität des einzelnen, Überschätzung der Atmosphäre des Schulstaates, so als sei diese gleichzusetzen mit der Atmosphäre der menschlichen Gesellschaft, in dieser Beziehung scheinen mir die Landerziehungsheime, wie sie damals waren, ein pädagogischer Fehler gewesen zu sein.
Noch ein großer Unterschied scheint mir zwischen der heutigen jungen Generation und unserer damaligen zu bestehen: Wir sind eigentlich dem Zauber der großen Schlagworte nie erlegen, sie amüsierten uns, aber wir rochen die Lüge, die in ihnen steckte. Heute? Denken Sie an die Fronten und Fröntlein, an die Jungbünde und -bündlein. Glauben Sie, dass da überall Überzeugungen dahinterstecken? Vielleicht, ich will niemanden verdächtigen. Zusammenschluss, Sich-die-Ellbogen-Fühlen, ist vielleicht etwas Schönes, und wenn es nicht etwas Schönes ist, so doch sicher etwas Bequemes. Gewiss, die Entwicklung unserer Zivilisation drängt zur Wirkung der Masse, die Masse wird etwas zu sagen haben – aber sagt die Masse etwas? Die Masse sagt, was die Führer wollen. Von uns ist keiner ein Führer geworden, doch, einer, und dessen Geschichte ist so lustig, dass ich sie noch erzählen will.
Wir hatten einen Balten, einen kleinen kurzsichtigen Menschen mit großen Brillengläsern, Feo nannten wir ihn. Er war zwei Klassen unter uns, aber von einer so penetranten Klugheit, dass wir ihn duldeten. Wegen irgendeines Skandals wurde er aus dem «Heim» entfernt. Er stammte aus der Umgebung von Riga. Letzthin erzählte mir ein Bekannter folgendes: Nach dem Zusammenbruch des zaristischen Regimes flüchtete ein baltischer Baron, kleiner Leutnant von der Garde, Ungern-Sternberg, Baron, nach der Mongolei. Dort gelang es ihm, einige Stämme unter seine Herrschaft zu bringen, er wurde oberster Kriegsgott, ja Kriegsgott (nur Balten können auf so wunderbare Ideen kommen). Er herrschte nicht besser und nicht schlechter als sonst ein Gott, und sein Hauptpläsier war es, die Herren vom Hammer und der Sichel ein wenig anzuöden. Bis sich diese aufrafften und den obersten Kriegsgott der Mongolen ganz prosaisch erschossen. Nun, in der Begleitung dieses Ungern-Sternberg befand sich ein kleiner Mann, Feodossieff soll er geheißen haben, der die Funktionen eines Oberpriesters innegehabt haben soll. War es unser Feodossieff? Wenn er’s gewesen ist, so hat er wohl das schlagendste Beispiel für den Einzelgänger gebracht, den Einzelgänger, der sich höchstens zu einer Kameradschaft zu zweit aufschwingen kann. Und hat damit den Beweis erbracht, dass die Individualpädagogik der Landerziehungsheime doch fruchtbar gewesen ist, wenn die Frucht auch reichlich merkwürdig ausgefallen ist.
1933