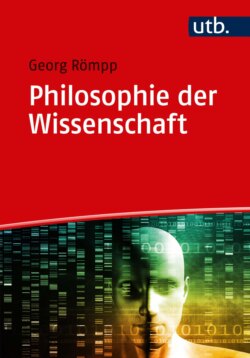Читать книгу Philosophie der Wissenschaft - Georg Römpp - Страница 7
ОглавлениеDie Wissenschaft erklärt uns die Welt. Sie tut dies, indem sie zunächst aufgrund von Beobachtungen Theorien über Ereignisse und Zusammenhänge in der Welt aufstellt. Diese Theorien werden dann durch Experimente auf ihre Übereinstimmung mit der Erfahrung geprüft. In Experimenten können wir die Wahrheit von Theorien durch gezielte Wahrnehmungen feststellen. Im Falle der Bestätigung entstehen daraus Gesetze, die das Geschehen in der Welt präzise beschreiben. Solche an der Erfahrung geprüften Gesetze gibt es in erster Linie in den Naturwissenschaften, obwohl auch die empirische Psychologie, die empirischen Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und andere Disziplinen bis hin zur empirischen Sprachwissenschaft auf diese Weise vorgehen, wenn sie nach Erfahrungswissen suchen. Auf diese Weise entwickelt die Wissenschaft ein immer besseres Wissen von der Welt. Es kann vorkommen, dass sich manche Gesetze als falsch erweisen, so dass sie aus dem Bereich des wissenschaftlichen Wissens ausgeschieden werden müssen. Aber dies geschieht aufgrund einer besseren und genaueren Prüfung auf deren Übereinstimmung mit dem Geschehen in der Welt, so dass sich der Wert der wissenschaftlichen Methode damit durch ein weiteres Fortschreiten im Wissen bestätigt.
Weil die Wissenschaft uns die Welt erklärt, können wir die Welt immer besser nach unseren Wünschen verändern und gestalten. Die Fortschritte in Medizin und Technik sind die besten Beweise dafür, dass die Wissenschaft die gesetzmäßigen Zusammenhänge in der Welt richtig erklärt. Wenn dabei unerwünschte Folgeprobleme entstehen, so suchen wir auf politischem Wege durch den Einsatz von mehr finanziellen Mitteln nach einem besseren wissenschaftlichen Wissen, das unseren Zielen besser entspricht. Auf diese Weise beeinflussen wir die Wissenschaft, weil wir Erklärungen wünschen, die uns interessieren, und technische Anwendungen wissenschaftlicher Erkenntnisse erwarten, die unseren Wünschen und Bedürfnissen entsprechen. Das ändert aber nichts daran, dass die Wissenschaft die Welt mithilfe der Erfahrung beschreibt und Wissen anhand von Beobachtungen und Experimenten gewinnt. Dies ist sogar der Garant dafür, dass neue Erkenntnisse sich unseren Wünschen entsprechend in technische Anwendungen umsetzen lassen.
Die beiden letzten Absätze enthalten eine Beschreibung dessen, was Wissenschaft ist, indem angegeben wird, was sie tut. Es gibt sicher auch andere Beschreibungen, aber für das Alltagswissen wären sie im Großen und Ganzen äquivalent mit der gerade gegebenen. Offenbar verfügt die Alltagssprache über ein tief eindringendes und umfangreiches Wissen über die Wissenschaft. Es bezieht sich nicht nur auf das Vorgehen und den Fortschritt der Wissenschaft, sondern auch auf die Beziehung zwischen dem wissenschaftlichen Wissen und der Welt, von der es uns nützliche Erkenntnisse zur Verfügung stellt. Wir könnten ein solches Wissen über die Wissenschaft als ‚Wissenschaftstheorie‘ bezeichnen. Sie genügt zwar sicherlich nicht den Ansprüchen der Wissenschaft selbst an eine wissenschaftliche Theorie, aber es handelt sich doch um eine Theorie insofern, als sie allgemeine und dem Anspruch nach wesentliche Strukturen eines Wirklichkeitsbereiches beschreibt, nämlich dessen, den wir als ‚Wissenschaft‘ bezeichnen.
Deshalb sollte jene Beschreibung der Wissenschaft zumindest dem Begriff des Wissens genügen können, der für das Wissen der Wissenschaft selbst gilt. Diese Standard-auffassung von ‚Wissen‘, auf der das Wissen der ‚Wissenschaft‘ beruht, ist sehr einfach mithilfe von drei Kriterien zu beschreiben. (1) Die Person, die beansprucht, etwas zu wissen, muss etwas über die Welt glauben. Das genügt aber natürlich nicht, denn bekanntlich glauben wir Vieles, was wir nicht wissen. Aber diese Beziehung zwischen der Person und einem Sachverhalt ist nichtsdestoweniger ein wichtiger Bestandteil eines jeden Wissens. (2) Das, was geglaubt wird, muss wahr sein. Damit unterscheidet sich Wissen vom Glauben und Meinen. Nun könnte es aber sein, dass eine Person etwas glaubt und dass das, was sie glaubt, zufällig auch wahr ist. Etwa könnte jemand in Deutschland zu einem bestimmten Zeitpunkt glauben und diesen Glauben auch aussprechen: ‚Heute regnet es in San Francisco‘. Wenn wir den Wetterbericht für diesen Tag konsultieren, dann stellen wir vielleicht fest, dass dies tatsächlich der Fall ist. Aber würden wir auch sagen, dieser Jemand wisse dies, wenn er keinen einzigen nachvollziehbaren Grund für seinen Glauben angeben kann? (3) Deshalb müssen wir für Wissen noch ein weiteres Kriterium heranziehen. Wer etwas glaubt, muss seinen Glauben auch begründen bzw. rechtfertigen können, damit wir ihm wirklich ein Wissen im Falle des Bestehens des betreffenden Sachverhaltes zuschreiben können. Solche Begründungen können besser oder schlechter sein. Der Glaube, heute regne es in San Francisco, lässt sich leicht durch den Hinweis auf ein Telefongespräch mit einem Menschen, der eben dort lebt, begründen. Er lässt sich aber nicht begründen durch den Verweis auf die gerade gesehene Episode einer Fernsehserie, deren Handlung in einem San Francisco im Dauerregen spielt.
Wir könnten dies auch so ausdrücken, dass mit dem Anspruch auf Wissen drei Dimensionen tangiert sind: (1) die subjektive Dimension des Glaubens bzw. des ‚Fürwahr-haltens‘, (2) die objektive Dimension des Wahrseins, (3) die intersubjektive Dimension der Gründe – in der amerikanischen Gegenwartsphilosophie wird hier regelmäßig vom ‚space of reasons‘ gesprochen. Diese dritte Dimension des Wissens wurde und wird sehr häufig ignoriert, obwohl sie schon in unserem alltäglichen Sprachgebrauch enthalten ist. Wir bezeichnen etwa einen Glauben, der durch falsche Prämissen begründet wird, auch dann nicht als Wissen, wenn er ‚zufällig‘ wahr ist. Sagt jemand ‚Haie sind Fische‘, so sind wir geneigt, ihm einen wahren Glauben zuzuschreiben. Aber sagen wir immer noch, er wisse dies, wenn er seinen Glauben so begründet: ‚Alle schwimmenden Tiere sind Fische, Haie sind schwimmende Tiere, also sind Haie Fische‘? Rein logisch ist dieser Zusammenhang korrekt, aber bekanntlich sind Wale keine Fische, so dass der Obersatz falsch ist, weshalb die Konklusion so nicht begründet werden kann.
Diese Analyse des Begriffs des Wissens, die zu drei Kriterien für dessen richtige Verwendung führt, ist dennoch nicht ganz unbestritten. Dies gilt weniger für die beiden ersten Kriterien – dass Wissen wahr und von jemandem geglaubt sein muss – als vielmehr für das dritte Kriterium. Dass das Wissen wahr sein muss, führt nur dann zu Problemen, wenn wir nach der Bedeutung dieses Adjektivs fragen und darüber hinaus noch danach, welche Kriterien denn erfüllt sein müssen, um etwas als wahr bezeichnen zu dürfen. Dieses Problem lassen wir hier auf sich beruhen, weil es weit besser gelingen wird, den Stand der Philosophie der Wissenschaft zu verdeutlichen, wenn wir uns auf den Aspekt des Begründens in jedem Wissen konzentrieren, als dies bei einer Beschäftigung mit dem Begriff der Wahrheit der Fall wäre, der in der Wissenschaft sowieso fast nirgends verwendet wird. Dass Wissen nicht als Gegenstand in der Welt vorhanden ist wie Steine, Bäume oder Kängurus, sondern von jemandem geglaubt bzw. für wahr gehalten werden muss, ist sicherlich einleuchtend.
Es wurden allerdings Beispiele gefunden, die es weniger selbstverständlich machen, dass Wissen auch begründet sein muss. Wir müssen uns hier aber auf die Behauptung beschränken, dass diese Beispiele nicht ausreichen, um den Aspekt der Begründung aus dem Begriff des Wissens auszuschließen. Etwa wird das bekannteste Beispiel so oder ähnlich beschrieben: Jemand schreibt in einer Prüfung von dem neben ihm sitzenden Kandidaten ab, und zwar von jemandem, von dem er weiß, dass er in diesem Fach ein Star ist, und was abgeschrieben wurde, ist unbezweifelbares Wissen des Prüfungsfaches. Der Schummler erfüllt also eigentlich alle drei Kriterien des Wissens: er glaubt, dass seine nur abgeschriebenen Kenntnisse gelten, sie sind auch tatsächlich wahr, und er kann gerechtfertigt glauben, dass diese Kenntnisse wahr sind, denn sich auf Autoritäten zu stützen, ist eine Form der Rechtfertigung, wenn auch nicht immer eine gute. Sagen wir in diesem Fall aber, dieser Prüfling verfüge über Wissen? Intuitiv könnten wir dies verneinen. Dann sind wir aber nicht ganz konsequent, denn der größte Teil unseres Wissens wird nur durch Autoritäten gerechtfertigt. Dass ‚to look forward to‘ in der englischen Sprache ein nachfolgendes Gerundium fordert (‚I am looking forward to seeing you‘), wissen Kontinentaleuropäer ebenso nur durch Autoritäten – etwa durch die Verfasser englischer Grammatiken – wie wir die fundamentalen Sätze der Quantenmechanik nur durch die rechtfertigende Vermittlung durch Physiklehrer und -professoren kennen, obwohl kaum jemand ohne ein Studium der theoretischen Physik eine ausreichende Begründung dafür geben kann.
Aber die Frage, welche Art von Begründung denn vorliegen muss, damit wir von ‚Wissen‘ sprechen können, weist uns auf eine weitere wichtige Struktur unserer Auffassung des Wissens hin, das wir der Wissenschaft zuschreiben, wie wir dies oben skizziert haben, und von dem eine ‚Wissenschaftstheorie‘ ein Wissen beansprucht, auch wenn es nur so einfach ist, wie wir es eingangs dem Alltagsverständnis zugeschrieben haben. Jene Beschreibung, die wir als eine einfache Form von ‚Wissenschaftstheorie‘ bezeichnen könnten, gibt einen Begriff von Wissenschaft an, der nicht unabhängig ist von der Bedeutung, die wir mit dem Begriff des Wissens verbinden, und wenn wir in diesen Begriff die Begründbarkeit einschließen, dann wird der gewusste Begriff des Wissens des Weiteren abhängig von der Bedeutung, in der wir bereit sind, von Begründung zu sprechen. Offensichtlich wird das Wissen von der Wissenschaft und das Wissen der Wissenschaft selbst verschieden sein, je nachdem, ob wir eine Begründung durch Autoritäten als ausreichend für diesen Begriff erachten oder nicht. Und selbst wenn wir dazu bereit sind, so werden sich weitere Fragen stellen wie: Wie viele Autoritäten benötigen wir? Genügt es, dass 95 % aller Klimatologen der Welt bestätigen, dass der Klimawandel wirklich und menschengemacht ist, oder müssen es 99 % sein? Welche Qualifikationen müssen die Autoritäten aufweisen? Genügt eine Promotion, müssen sie eine Professur haben, oder dürfen sich auch gewöhnliche Schullehrer einmischen? Und wenn das erstere oder das zweitere gilt, wo müssen sie studiert haben – in Stanford, am MIT, in Harvard/Yale/Princeton, oder darf es auch eine Universität in der bayerischen Provinz sein?
Wir haben zunächst einen Begriff von Wissenschaft skizziert, der heute weitgehend akzeptabel sein dürfte – außer vielleicht dort, wo die wilden Kerle der Philosophie wohnen. Wir haben dann den Begriff des Wissens nach einer Auffassung beschrieben, die man heute als Standardauffassung ansehen kann: jemand weiß etwas, wenn er es glaubt (‚für wahr hält‘), wenn es wahr ist und wenn er es begründen kann. Nun haben wir gesehen, dass der Begriff des Wissens in noch unabsehbare weitere Probleme führt, wenn wir ihn näher bestimmen wollen. Dies gilt nicht nur für den Begriff des Wissens, das die Wissenschaft von der Welt gewinnen kann, sondern auch für den Begriff des Wissens, den wir mit jenem Begriff von der Wissenschaft beanspruchen müssen. Die Antwort auf die Frage, ob und wie weit wir jenen Begriff von Wissenschaft nach einer genaueren Prüfung akzeptieren können, und ob und wie weit das Wissen der Wissenschaft wirklich so ist, wie es in jener Auffassung beschrieben wird, hängt also offenbar von einigen schwergewichtigen Begriffen und deren näherer Bedeutung ab.
Deshalb werden für die Prüfung der Angemessenheit jener Begriffe von Wissen und von Wissenschaft Fragen nach der Herkunft, der Richtigkeit und der Bedeutung von Begriffen eine zentrale Stelle einnehmen müssen. Wir haben bereits eine gut begründete Entscheidung darüber getroffen, welchem Begriff aus der Standarddefinition von Wissen wir im Folgenden in erster Linie nachgehen wollen: der Begriff des ‚Glaubens‘ (also der Subjektbeziehung des Wissens) wirft nur wenige Probleme auf, der Begriff der ‚Wahrheit‘ (der lange Zeit als die Objektbeziehung des Wissens bezeichnend aufgefasst wurde) ist in der Wissenschaft unbedeutend und würde Probleme aufwerfen, die weit über die Gegenwart der Philosophie hinausgreifen, wie etwa eben die Frage nach einer ‚Objektbeziehung‘ des Wissens selbst. Also zeigt sich der Begriff der Begründung als derjenige, dessen Untersuchung den besten Zugang dazu bietet, wie wir das Wissen von und das Wissen der Wissenschaft auffassen müssen.
1.2Der Regress des Begründens und der Beginn der Wissenschaft
Möglicherweise wurde und wird das Begründen und Rechtfertigen als die dritte Dimension des Wissens gerade deshalb so leicht außer Acht gelassen, wenn von Wissen die Rede ist, weil wir damit in ein folgenreiches Problem geraten. Wenn das Vorliegen von Wissen von Begründungen abhängt, so müssen diese Begründungen offenbar selbst die Kriterien für ‚Wissen‘ erfüllen, sonst können wir mit ihrer Hilfe kein Wissen erzeugen. Das zeigte sich schon in dem obigen Hai-Beispiel sehr deutlich: wenn der Obersatz, mit dessen Hilfe der Schluss durchgeführt wurde, falsch ist, dann kann mit ihm die Konklusion offenbar nicht begründet werden, und es handelt sich nicht um ein Wissen, obwohl die Konklusion wahr ist. Ganz ähnlich würde man den Glauben, dass Zeitreisen möglich sind, nicht als Wissen ansehen, wenn als Begründung deren Vorkommen in Hollywood-Filmen angegeben wird, obwohl diese Möglichkeit durch die Relativitätstheorie begründet werden kann und dann ein Wissen darstellen würde. Das Problem ist offenbar, dass Wissen anderes Wissen voraussetzt, damit ersteres begründet werden kann, wobei letzteres folglich selbst begründungspflichtig ist durch wieder anderes Wissen. Das Problem ist also das eines unendlichen Regresses.
Können wir diesen Regress nicht stoppen, so sind wir nicht berechtigt zu behaupten, dass wir überhaupt etwas wissen – weder in der Wissenschaft, noch über die Wissenschaft. Stoppen wir ihn aber auf eine falsche Weise, so können wir ebenfalls keinen Anspruch auf Wissen erheben. Etwa könnten wir uns entschließen, nach einigen Begründungsschritten bei unbegründeten Annahmen stehen zu bleiben. Das ist die häufigste Lösung, die wir im Alltag anwenden, wenn wir nach Begründungen – und nach Begründungen für Begründungen – gefragt werden. Damit kann man es sehr weit bringen und sehr überzeugend wirken; man muss nur solche unbegründeten Annahmen finden, die wir selbst und unsere Gesprächspartner als selbstverständlich unterstellen, d. h. an die sie glauben. Das mag für viele Zwecke ausreichen, aber von Wissen können wir dann natürlich nicht sprechen, denn jene Begründbarkeit, die zu den Kriterien für Wissen gehört, endet dann bei einem Glauben als einem ‚Fürwahrhalten‘, womit das zu begründende Wissen selbst nur einen Glauben darstellt – und dies auch dann, wenn es wahr ist.
Eine andere Möglichkeit zum Stoppen des Regresses der Begründung stellt eine zirkelhafte Begründungsweise dar, d. h. wir wiederholen einige Behauptungen, die wir bereits angeführt hatten. Das Ergebnis in Bezug auf den Begriff des Wissens wäre in diesem Fall aber nicht besser, und in der Regel findet sich bald ein Cleverle, das hier ‚Zirkel!‘ schreit. In der Geschichte des Wissens war es deshalb in der Tat das Stoppen des Regresses bei Glaubensüberzeugungen, mit dem das Kriterium der Begründungspflichtigkeit von Wissen zu erfüllen versucht wurde. Diese Methode war über viele Jahrhunderte hinweg allgemein anerkannt und wurde in allen Institutionen zur Erzeugung und Verarbeitung von Wissen eingesetzt. In grober Vereinfachung könnte man sagen, dass es der Glaube der christlichen Buchreligion in Verbindung mit dem Glauben an die unbezweifelbare Wahrheit der aristotelischen Philosophie war, der den Regress aus der Begründungspflichtigkeit des Wissens an ein unbezweifeltes Ende brachte.
Man versteht die neuzeitliche Naturwissenschaft in ihrem Wissensanspruch nicht ausreichend, wenn man sich nicht verdeutlicht, welchen Bruch das Aufkommen der wissenschaftlichen Denkweise in Bezug auf die Beendigung des Regresses darstellte, der aus der Begründungspflichtigkeit des Wissens entsteht, die ein Bestandteil der Bedeutung darstellt, die wir mit dem Begriff ‚Wissen‘ verbinden. Man könnte geradezu sagen, dass die Wissenschaft mit einer neuen Auffassung darüber begann, wie sich jener Regress verhindern lasse. Jeder weiß, wie diese neue Auffassung lautete: es kommt auf die Erfahrung an – genauer: auf die Erfahrung durch die Sinne, weshalb man auch von empirischer bzw. Erfahrungswissenschaft spricht, wenn man die neuzeitliche Methode der Wissenschaft bezeichnen will. Durch das Zeugnis unserer Sinneswahrnehmungen können wir nach dieser Auffassung auf etwas ‚Gegebenes‘ kommen, das der Frage ein Ende bereitet, ob die Begründung für ein Wissen denn selbst ein Wissen darstelle, das selbst begründet werde müsste mithilfe von Wissen, woraus die gleiche Frage wieder entstehen würde.
Man macht es sich in vielen Büchern über diesen Umbruch in den Auffassungen über unser Wissen im Entstehungsprozess der Naturwissenschaft zu leicht, wenn man auf neue Erkenntnisse verweist, die durch die Erfindung von Messinstrumenten möglich wurden; und man macht es sich auch zu leicht, wenn man darauf verweist, dass die Ausrichtung des Wissens an den Erfahrungen unserer Sinne sich so leicht durchsetzen konnte, weil sie erheblich erfolgreicher war als die alte Orientierung an einem geglaubten Buchwissen. Man könnte diese Veränderungen plausibler so beschreiben: Weil man nun bereit war, in unserem Wissen über die Welt den Regress der Begründung nicht mehr durch heilige Bücher, sondern in erster Linie durch das Zeugnis der Sinneserfahrung zu beenden, deshalb wurden Messinstrumente erfunden, die uns eine Sinneserfahrung auch dort ermöglichen, wo die Sinne, die uns mit unserer anatomischen und organischen Ausstattung zur Verfügung stehen, nicht mehr ausreichen können. Warum hätte man sich sonst die Mühe machen sollen, solche Instrumente zu erfinden, wenn die Sinneserfahrung doch sowieso nicht als Beendigung des Regresses der Begründung akzeptabel war?
Auch mit dem Argument, dass die Sinneserfahrung als letzte Begründungsgrundlage für unser Wissen deshalb den Siegeszug antreten konnte, weil sie weit erfolgreicher war als die ältere Orientierung an einigen mehr oder weniger heiligen Schriften und an rein vernünftigen Erörterungen ohne jeden Bezug zur Erfahrung, geraten wir in Schwierigkeiten. Dagegen lässt sich etwa einwenden, dass die Erfolge des neuen Denkens zunächst auf Spezialprobleme beschränkt waren, die winzig kleine Wissenschaftlergemeinden beschäftigten. Wenn wir heute an die Erfolge der Wissenschaft denken, dann kommt uns in der Regel der Fortschritt der Medizin in den Sinn und darüber hinaus die technische Anwendbarkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse von der Mondlandung über die Erfindung von CD- und DVD-Playern bis hin zur Entwicklung von Nuklearwaffen. Diese Anwendungen sind aber eine Erscheinung erst aus der jüngsten Geschichte, und selbst die medizinische Verwertbarkeit der Wissenschaft begann eigentlich erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Erfolge zu zeigen. Vor der Entdeckung von Antibiotika, Anästhetika und den Erkenntnissen der Virologie und Bakteriologie hatten Ärzte nicht viel mehr Möglichkeiten zur Heilung von Krankheiten als in den vorangegangenen Jahrhunderten.
Es könnte deshalb plausibler sein, die Veränderungen in der Auffassung des Wissens und seiner Begründbarkeit weg von einem Buchwissen hin zum Erfahrungswissen nicht durch den besseren Erfolg des letzteren zu erklären, sondern durch eine neue Definition von Erfolg, die mit der neuen Orientierung des Wissens an der Sinneserfahrung untrennbar verbunden war. Das alte Wissen wies sich im Grunde überhaupt nicht dadurch aus, dass es Erfolge in der Veränderung und Verbesserung der Welt des Menschen ermöglichte. Es fand seine Beglaubigung vielmehr schon darin, dass es sich auf den Willen Gottes, wie er in als heilig angesehenen Büchern niedergeschrieben war, und auf rein vernunftgegründete Argumentationen stützte, wie sie von den scholastischen Philosophen und Theologen auf der Grundlage des aristotelischen Denkens ausgearbeitet worden waren. Ein Erfolg des Wissens in unserem Sinne war in dieser Konzeption des Wissens überhaupt nicht vorgesehen, sondern ein solcher Erfolg wurde durch Kriterien bestimmt, die im Denken der Wissenschaft heute überhaupt nicht mehr vorkommen.
1.3Wissen und wissenschaftliches Erklären
Die Wissenschaft beendet den Regress des Begründens, indem sie ihr Wissen durch seinen Bezug auf die Erfahrung ausweist, weshalb neuzeitliche Wissenschaft gleichbedeutend ist mit empirischer Wissenschaft. Diese Minimaldefinition von Wissenschaft im Sinne von ‚science‘ wird heute nur an dem Rand der Wissenschaft nicht als selbstverständlich angesehen, wo die sog. ‚string theory‘ sich in der theoretischen Physik berechtigt sieht, ein kosmologisches Modell zu entwerfen, dessen Aussagen prinzipiell keine empirische Bestätigung oder Widerlegung zulassen. Eine solche ‚nicht-empirische‘ Wissenschaft wird überall sonst als ein Begriff angesehen, der dem eines ‚schwarzen Schimmels‘ gleicht. Möglicherweise ist der Hinweis nicht überflüssig, dass dies natürlich auch für die Quantenphysik und die Relativitätstheorie gilt. Die erfahrungsgeleitete Wissenschaft begründet ihr Wissen ‚letztlich‘ durch den Kontakt unserer Sinne mit der Welt, also durch Wahrnehmung. Ihre Grundlage ist die Annahme, dass unsere fünf Sinne in der Wahrnehmung eine solche Beziehung zur Welt aufnehmen, dass wir eine Grundlage für solche Aussagen und Aussagensysteme über sie finden, die der Definition von ‚Wissen‘ genügen.
Wir haben zu Beginn dieses Kapitels einen einfachen Begriff von ‚Wissenschaft‘ als ‚science‘ skizziert, der auf weite Akzeptanz Anspruch erheben kann, um diesen Begriff dann mit Blick auf die Philosophie der Wissenschaft durch denjenigen des ‚Wissens‘ zu erläutern und im ‚Begründen‘ zentrieren zu lassen. Auf dieser Grundlage können wir das Problem, das sich einer Wissenschaftsphilosophie stellt, nun dadurch erläutern, dass wir das Begründen in den Zusammenhang des Begriffs des Wissens zurückstellen. Dazu müssen wir einige Beziehungen zwischen dem ‚Begründetsein‘, dem ‚Für-wahr-halten‘ (Glauben) und dem ‚Wahrsein‘ als den Elementen des Wissens verdeutlichen.
Das Wissen der Wissenschaft liegt in der Form von Sätzen und Zusammenhängen von Sätzen vor, für die Geltung beansprucht wird. Niemand kann behaupten, über wissenschaftliches Wissen zu verfügen, wenn er es nicht sprachlich zum Ausdruck bringen kann. Ein solches Wissen muss also selbst als ein Teil der Welt darstellbar sein, sei es auf Papier oder anderen Materialien, mithilfe elektrochemischer Zustandsveränderungen auf einem Bildschirm oder als akustische Ereignisse in der gesprochenen Sprache. Als wissenschaftliches muss das Wissen mithilfe von Objekten in der Welt repräsentierbar sein. Eine solche Repräsentation muss es erlauben, das Wissen zu reproduzieren. Die Reproduktion muss nach zwei Richtungen möglich sein: zum einen muss sich das Wissen aufbewahren lassen, so dass es mithilfe von Objekten in der Welt, die als Zeichen fungieren, im Prinzip jederzeit als Wissen in einem Subjekt des Wissens wiederhergestellt werden kann; zum anderen muss es sich übertragen lassen, so dass andere Menschen es durch das Verstehen von Zeichen als ihr eigenes Wissen ansehen können, obwohl sie es nicht selbst erzeugt oder gewonnen haben. Ein wissenschaftliches Wissen muss dauerhaft sein und es muss intersubjektiv gelten.
Auf diese Weise stellt es sich als eine besondere Form des Erklärens dar. Eine wissenschaftliche Erklärung unterscheidet sich also von alltäglichen Erklärungen. Für eine wissenschaftliche Erklärung genügt das subjektive Gefühl nicht, dass etwas für den Augenblick und die gegebene Situation befriedigend klar geworden ist. Eine wissenschaftliche Erklärung soll also nicht nur (1) für gerade den oder die Menschen gelten, denen (2) hier und (3) jetzt in der gegebenen Situation etwas so klar wird, dass es ihnen genügt. Sie soll vielmehr (a) für alle Menschen und (b) überall und (c) immer gelten. Sie soll nicht ein bestimmtes Gefühl beschreiben und sie soll nicht den Zustand eines bestimmten Menschen in einer bestimmten Situation angeben.
Solche Erklärungen sind nicht beliebig durch andere Erklärungen ersetzbar. Im Alltag können wir die beklagenswerte Tatsache, dass der Champagner zu warm ist, wahlweise dadurch erklären, dass er zu lange auf dem Tisch stand, oder, wenn wir der Unzufriedenheit mit den schlechten Leistungen des Hauspersonals Ausdruck geben wollen, auch dadurch, dass der Butler nachlässig war. Natürlich sind diese beiden Erklärungen kompatibel. Aber für eine Alltagserklärung kommt es nur darauf an, dass ein ausreichendes Gefühl für das Klarwerden eines Ereignisses oder eines Phänomens entsteht, und dafür können wir zwischen der einen und der anderen Erklärung (und sicher noch vielen anderen) wählen. Es gibt hier eigentlich keine richtigen und falschen Erklärungen, sondern eine Erklärung gelingt, wenn sie uns das befriedigende Gefühl des genügenden Klarwerdens verschafft, und sie misslingt, wenn sie uns in dieser Hinsicht unbefriedigt lässt.
Wissenschaftliche Erklärungen sind also deshalb nicht beliebig ersetzbar durch andere Erklärungen, weil ihr Gelingen nicht durch das Kriterium der Erzeugung eines subjektiven Gefühls oder Zustandes beim Adressaten der Erklärung (der auch derjenige selbst sein kann, der die Erklärung gibt) bestimmt wird. Es mag viele Menschen geben, deren subjektiver Erklärungsbedarf dadurch befriedigt wird, dass der im Vergleich zu Menschen, die schon länger in Deutschland leben, geringere Bildungserfolg von Migranten auf genetische Faktoren zurückgeführt wird. Die wissenschaftliche Erklärung dagegen, welche die Ursache für diese Tatsache im vergleichsweise geringeren Bildungsstand der Herkunftsfamilien erkennt und weiß, dass der Bildungsstand der Eltern der wichtigste Faktor für die Prognose von Bildungserfolg darstellt, mag für eben diese Menschen gerade keine befriedigende Erklärung liefern, d. h. sie versetzt sie nicht in den entsprechenden Zustand, in dem sie ein Gefühl des ‚Klarwerdens‘ bzw. des ‚Erklärtseins‘ erleben. Aber solche Beispiele lassen sich auch auf dem Gebiet der Naturwissenschaft finden. Wer die kontraintuitive Idee eines Raum-Zeit-Kontinuums zum Besten gibt und dafür – wissenschaftlich korrekt – die Relativitätstheorie als Erklärung heranzieht, wird bei den meisten Menschen keinen Zustand des ‚Klarwerdens‘ mit dem Gefühl einer zufriedenstellenden Erklärung erreichen.
Diese fundamentalen Ansprüche an eine wissenschaftliche Erklärung, mit der wissenschaftliches Wissen sich von anderem und nicht wissenschaftlich erklärendem Wissen unterscheidet, werden in der Wissenschaft auf verschiedene Weise eingelöst. Hauptsächlich lassen sich vier verschiedene Typen der wissenschaftlichen Erklärung unterscheiden:
1) Die deduktiv-nomologische Erklärung, bei der die Ereignisse aus einem allgemeinen Gesetz abgeleitet werden. Der Erklärungserfolg hängt hier von der Geltung deterministischer Gesetze und von der richtigen Subsumtion einzelner Ereignisse ab. Es ist allerdings nicht richtig zu sagen, dass damit kausale Erklärungen vorgenommen werden. Eine kausale Erklärung beruht auf einem Unterschied in der Zeit nach früher und später, weshalb sie nur auf irreversible Vorgänge anzuwenden ist. Dagegen spielt die Verlaufsrichtung bei sehr vielen deterministischen Vorgängen wie etwa in der klassischen Mechanik oder Elektrodynamik keine Rolle. Für eine solche Erklärung hat es keine begründende Bedeutung, ob das Sonnensystem aus einem Materiewirbel entstanden ist, oder ob sich das Sonnensystem in den Materiewirbel zurückentwickelt. Man kann also deduktiv-nomologische Erklärungen nicht einfach mit Kausalerklärungen gleichsetzen. In der Wissenschaftstheorie des 20. Jahrhunderts galten deduktiv-nomologische Erklärungen lange Zeit als die Standardform wissenschaftlicher Erklärungen.
2) Man kann gegen eine solche Auffassung jedoch auf das – ältere – Verfahren der kausalen Modellierung verweisen. Dabei muss für die Erklärung eines Ereignisses nicht unbedingt ein einzelnes anderes Ereignis herangezogen werden, das die Ursache des ersteren ist. Eine Kausalerklärung kann erheblich komplexere Formen annehmen, wenn einzelne Faktoren identifiziert werden, die nur ‚kausal relevant‘ sind. Das entspricht der Alltagserfahrung, dass die meisten Ereignisse auf eine sehr komplizierte Weise Bedingungen erfordern, um überhaupt zustande zu kommen. Eine kausale Modellierung versucht dann ein solches Gefüge von Bedingungen aufzufinden, in dem die einzelnen Faktoren kausal relevant sind. Eine Kausalerklärung muss also nicht monokausal vorgehen, sondern kann ganz unterschiedliche deterministische und sogar probabilistische Gesetzmäßigkeiten heranziehen. Um eine Lawine auszulösen, müssen sehr viele verschiedene Faktoren zusammenkommen.
3) Darüber hinaus gibt es in der Wissenschaft aber auch probabilistische Erklärungen, die man in manchen Fällen als Spezialform von deduktiv-nomologischen Erklärungen auffassen kann. Aber erklärt werden kann auch mithilfe von statistischen Zusammenhängen, bei denen man nicht von Gesetzlichkeit und Kausalität sprechen kann. Dabei werden zur Erklärung Korrelationen herangezogen. Ein Beispiel dafür stellt der Zusammenhang zwischen Rauchen und Lungenkrebs dar, der grundsätzlich probabilistischer Natur ist, obwohl über die Kausalzusammenhänge Theorien bekannt sind, die aber weder im deduktiv-nomologischen noch im kausalen Sinne zur Erklärung ausreichen können. Mit einem probabilistischen Gesetz kann kein einzelnes Ereignis vorausgesagt werden, sondern es lassen sich nur Ereignisse für statistische Gesamtheiten prognostizieren.
4) Schließlich kann als Erklären in der Naturwissenschaft aber auch ein Verfahren bezeichnet werden, das zu einer Vereinheitlichung der Theorie führt. Das Erklären gilt dann als gelungen, wenn ein Ereignis in eine einheitliche und umfassende Theorie eingebettet werden kann. Etwas ist dann erklärt, sobald man es in einen umfassenden und kohärenten Wissenshorizont stellen kann. Das setzt natürlich voraus, dass diese ‚Grand Theory‘ selbst als gut bestätigt gilt und ihre wissenschaftliche Erklärungsfähigkeit nicht bezweifelt werden kann.
Die Wissenschaft erklärt und diese Erklärungen können nach verschiedenen Modellen ablaufen. Aber die Wissenschaft erklärt uns auch die Welt, d. h. die Erklärungen und der dadurch erreichte subjektive Zustand der Befriedigung durch Erklärungen sind nur wissenschaftlicher Natur, wenn sie von der Welt gelten, über die Welt etwas aussagen, und die Welt intersubjektiv geltend beschreiben. Damit stellt sich die Frage, was es denn genauer bedeutet, dass die Wissenschaft uns (a) die Welt beschreibt, wie sie ist, und uns (b) die Ereignisse der Welt erklärt. Wie kommen wir in der Wissenschaft also zur Welt? ‚Wissenschaft‘ ist offenbar ein Zusammenhang von Aussagen/Sätzen/Behauptungen über die Welt. Dieses ‚über‘ müssen wir aus wissenschaftsphilosophischer Perspektive also genauer untersuchen, wenn wir den Wissensanspruch der empirischen Wissenschaft (‚science‘) verstehen wollen. Es könnten sich folgenreiche Probleme daraus ergeben, dass ‚die Welt‘ kein Zusammenhang von Aussagen/Sätzen/Behauptungen ist, und hier können die Philosophen bei den Forschern aus den empirischen Wissenschaften auf Zustimmung hoffen. Aber aus philosophischer Perspektive stellt sich darüber hinaus die Frage, was es denn heißen solle, dass die Aussagen und Gesetze der Wissenschaft sich in der Weise des ‚über‘ oder auch des ‚von‘ auf die Welt beziehen.
Der Umgang mit dieser Frage wird seit langer Zeit durch die Auseinandersetzung zwischen zwei verschiedenen Wahrheitstheorien geprägt. In der traditionellen oder klassischen Theorie wird ‚Wahrheit‘ als Übereinstimmung zwischen einem wissenschaftlich behaupteten Sachverhalt und seinem wirklichen Bestehen in der Welt aufgefasst. Eine solche Theorie stößt sehr bald auf das Problem, wie denn ein sprachlich ausgedrückter und damit mental existierender Sachverhalt mit einem Ausschnitt der wirklichen Welt ‚übereinstimmen‘ könne. Wie kann die Sprache denn so zur Welt kommen, dass die Welt sich in ihr darstellen lässt? Dieses ungelöste Problem führte zur Ausarbeitung radikal anderer Auffassungen von Wahrheit. Etwa wurde vorgeschlagen, um eine Aussage als ‚wahr‘ bezeichnen zu dürfen, könne es schon ausreichen, dass eine ausreichende Kohärenz zwischen ihr und dem bereits geltenden Wissen sowie den sprachlich beschreibbaren Beobachtungen im Rahmen der wissenschaftlichen Forschung nachgewiesen werden könne. Wichtiger aber ist in der Gegenwart des philosophischen Denkens eine andere Auffassung geworden. Ihr zufolge kann es für die Behauptung der Wahrheit des wissenschaftlichen Wissens genügen, dass innerhalb der Wissenschaft ein Konsens über die Richtigkeit von Beschreibungen und Gesetzen besteht.
Eine Spezialform einer Konsenstheorie entsteht dann, wenn wir nicht einen wirklichen, sondern einen vernünftigen Konsens verlangen, um von ‚Wahrheit‘ reden zu können. Wir verlangen von wissenschaftlichen Aussagen dann nur, sie müssten vernünftig akzeptierbar sein und ihre Geltung hängt davon ab, dass sie eine vernünftig begründete Zustimmung finden. In der Regel geht es dabei um die Zustimmung derjenigen Wissenschaftler, die im gleichen Spezialgebiet arbeiten. Wissenschaftliche Aussagen gelten in diesem Fall also deshalb, weil sie für die ‚scientific community‘ akzeptabel sind, weil in ihr nicht per Abstimmung über die Akzeptanz von Theorien entschieden wird, sondern weil sie das Ergebnis vernünftiger Argumentationszusammenhänge darstellen.
Das schließt die Notwendigkeit von Kohärenz jedoch nicht aus, denn die vernünftige Abwägung bezieht sich vor allem auf die Frage, ob sich neue Theorien an das anschließen lassen, was bereits in gerade dieser Gemeinschaft der Wissenschaftler als geltend anerkannt ist. Es kommt nur selten vor, dass eine zunächst nicht anschließbare Theorie mithilfe umfangreicher Änderungen im bisherigen Wissensbestand akzeptiert wird. Müsste der bisherige Wissensbestand aber als vollständig falsch gelten, um eine neue Theorie akzeptieren zu können, so würde kein Wissen mehr vorhanden sein, um die vernünftige Akzeptierbarkeit einer neuen Theorie überprüfen zu können. Die newtonsche Mechanik koexistiert mithilfe einer Korrektur ihres Anwendungsbereiches auch mit der Quantenmechanik und subatomare Strukturen werden mithilfe der alten Begriffe von ‚Wellen‘ und ‚Partikeln‘ verstanden, obwohl keiner der beiden zu ihrer Beschreibung ausreicht.
Wenn wir für wissenschaftliche Aussagen beanspruchen, sie könnten/müssten ‚wahr‘ sein, dann können wir den zunächst als selbstverständlich angenommenen Weltbezug der Wissenschaft offenbar in radikal unterschiedlichen Weisen auffassen. Folgen wir einer Konsenstheorie, so gibt es keine Möglichkeit, sich gegen die herrschende Meinung abzusetzen und zu behaupten, ein Satz sei wahr, auch wenn alle anderen ihm nicht zustimmen. Eine solche Möglichkeit wird jedoch vor der Auffassung bewahrt, wissenschaftliche Aussagen müssten ‚wahr‘ im Sinne einer Übereinstimmung mit der Welt sein. Hier bleibt es im Prinzip immer offen, ob sich nicht vielleicht alle irren, die der gerade herrschenden wissenschaftlichen Theorie über ein bestimmtes Sachgebiet folgen, und eventuell gerade die Auffassung Geltung beanspruchen könne, die von allen Wissenschaftlern zu einer bestimmten Zeit abgelehnt wird. Vergleichbar ist die Lage dann, wenn wir vernünftige und nicht nur tatsächliche Zustimmung verlangen. Auch dann bleibt stets die Möglichkeit offen, dass sich alle irren, die sich einer bestimmten wissenschaftlichen Theorie verschrieben haben, und dass der eine, der eine andere Auffassung vertritt, insofern recht hat, als seine Theorie mit besserem – weil vernünftigerem – Recht Geltung beanspruchen kann.
Allerdings sind die Argumentationsstrategien in den beiden Fällen unterschiedlich. Verlangen wir, dass wissenschaftliche Aussagen ‚wahr‘ sein sollen, so müssen wir deren Übereinstimmung mit der Realität/der Welt nachweisen, und damit geraten wir in alle Probleme, die mit einer solchen Forderung verbunden sind. Grundsätzlich müssen wir eine Antwort auf die Frage haben, wie denn die Dinge und die Sachverhalte in der Welt in unsere sprachlichen Aussagen über die Welt kommen. Wir müssen uns der ‚Antinomie des Realismus‘ entledigen, d. h. des Problems, dass die Welt in einer realistischen Konzeption als von unserem Geist, unserem Denken und unserer Sprache unabhängig aufgefasst wird, wir aber gleichzeitig doch über einen so merkwürdigen Kontakt mit ihr verfügen, der eine kognitive Beziehung enthält, die uns ein Wissen von der Welt erlaubt.1 Die Welt muss also so sein, dass sie in sich das Potential enthält, in unserem Denken und unserer Sprache beschrieben zu werden, was eine vor aller Erfahrung anzunehmende Möglichkeitsbedingung des wissenschaftlichen Wissens von der Welt einschließt. Nur dann kann sich unser Denken sprachlich so zum Ausdruck bringen, dass sich darin die Welt selbst darstellen kann.
Hegel hatte dieses Problem von der Welt her gedacht so auf den Punkt gebracht: das ‚Absolute‘ muss bei uns sein wollen, wenn wir eine solche Auffassung durchführen wollen. Das Problem dabei ist offenbar, dass wir mit einer solchen Konzeptualisierung des Sich-zur-Sprache-Bringens der Welt in unseren Sprachen beträchtliche metaphysische Verpflichtungen eingehen müssen, die wir vermutlich nicht ohne Weiteres auf uns nehmen werden. Von der Sprache her gedacht hat Ludwig Wittgenstein im ‚Tractatus logico-philosophicus‘ ausführlich dargelegt, wie wir uns eine Sprache denken müssen, in der die Welt und ihre Sachverhalte sich selbst zum Ausdruck bringen können. Das dabei entstehende Problem, ob unsere wissenschaftliche Sprache dieser idealen Sprache entspricht oder entsprechen kann, hat Wittgenstein in seinem späteren Werk ‚Philosophische Untersuchungen‘ eingehend erörtert, und das Ergebnis war negativ. Unsere Sprachen sind durchaus nicht so, dass wir uns eine solche Angepasstheit an die Welt als solche vorstellen könnten, und wollten wir eine Sprache entsprechend konstruieren, damit sie diese Bedingung erfüllt, so würden wir sie nicht mehr verstehen, denn sie würde gegen fundamentale Voraussetzungen der Verwendung der Sprache zur Verständigung verstoßen.
In dieser Lage könnten wir also doch versucht sein, uns mit der rationalen Akzeptierbarkeit unserer wissenschaftlichen Aussagen zu bescheiden, die gegenüber einer bloßen Konsenstheorie den Vorteil hat, dass stets die Möglichkeit offen gehalten wird, dass jeder faktische Konsens in der Gemeinschaft der Wissenschaftler sich als falsch herausstellen könnte. Aber in diesem Fall können wir das wissenschaftliche Wissen gegenüber anderen Wissensformen nicht mehr mit einer besseren Einsicht in unsere Beziehungen zur Welt rechtfertigen. Allerdings können wir auch auf der Grundlage der Behauptung, wissenschaftliche Aussagen könnten sich nur durch ihre Übereinstimmung mit Sachverhalten in der Welt ausweisen, nicht auf das Argumentieren und damit auf das Gründegeben verzichten. In der Wissenschaft müssen für jede Behauptung über eine bessere Einsicht Gründe angegeben werden. Darin verwandelt sich die vermeintlich bessere ‚Einsicht‘ in die Welt auf jeden Fall in ein Argumentieren. Das gilt auch dann, wenn der Verteidiger einer nach seiner Vermutung besseren Einsicht eigentlich für die Wahrheit seiner Weisheit nur seine exklusive Beziehung zur Welt, wie sie an sich selbst ist, heranziehen wollte. In der Wissenschaft transformiert sich seine Vorstellung von selbst, indem sie Wirklichkeit nur durch den Eintritt in das Bemühen um rationale Überzeugung gewinnt.
Auf dieser Grundlage kann die Wissenschaftsphilosophie etwa gegen eine evolutionäre Auffassung des Wissens darauf verweisen, dass die Erklärungsansprüche der Naturwissenschaften sich nicht nur durch Anpassungserfolge und damit durch die biologische Selbsterhaltung ausweisen. Sie sind Leistungen eines sprach- und vernunft-begabten ‚Tieres‘, das zugleich ein ‚politisches‘ Lebewesen ist, weil es mit anderen Menschen zusammenlebt und mit ihnen Wissen erwirbt. Es lebt im Raum der Gründe, wo es anderen gegenüber nicht nur sein Handeln, sondern auch sein Wissen begründet. Die Erkenntnisse der Naturwissenschaften stützen sich deshalb keinesfalls nur auf die Beziehung des Menschen zur Natur, sondern ebenso auf die Begründungszusammen-hänge zwischen Menschen. Der Mensch ist ein Wesen mit Gründen, die er in seinen Handlungen realisiert, und diese Gründe verweisen auf ein Selbstverständnis in der Auseinandersetzung mit anderen sich selbst verstehenden Wesen. Wissen, wie die Naturwissenschaft es beansprucht, ist also nur in einem sozialen Raum möglich, in dem der Mensch als ein soziales Lebewesen lebt.
Wenn wir also Gründe geben, um uns für oder gegen eine bestimmte wissenschaftliche Theorie zu entscheiden, so halten wir uns nicht einfach an die ‚Sachen an sich‘, sondern an einen Prozess des Gründegebens, der im Dialog bzw. im Gespräch zwischen Menschen stattfindet. Wir halten uns dabei auch nicht an eine Vernunft an sich, die unabhängig vom Dialog irgendwo in der Welt herumliegen würde und uns sagen könnte, was für uns ‚Gründe‘ sind. Das soll keineswegs heißen, dass die Vernunft keine Rolle spielt. Aber wir müssen auf den Begriff der ‚Vernunft‘ den gleichen Gedanken anwenden wie auf den Begriff der ‚Wahrheit‘. Dann können wir nicht sagen, es gebe so etwas wie ‚Vernunft‘, wie es Katzen, Verkehrshindernisse oder Überschwemmungen gibt. Es ist nicht etwas ‚da draußen in der Welt‘, sondern es handelt sich um einen Begriff, der mit Gründen und Gegengründen bestimmt wird. Der Begriff der ‚Vernunft‘ erhält gerade durch diesen Prozess des Begründens eine gute Bestimmung, die freilich wieder mit Gründen in Frage gestellt werden und mit Hilfe von anderen Gründen gestützt werden kann.
Wie geht dieser Prozess des Dialogs zwischen Menschen vor sich, in dem wir begründen? Üblicherweise versuchen wir dabei andere Menschen davon zu überzeugen, dass sie sich unserer eigenen Auffassung anschließen sollen, und die anderen gehen genauso vor, d. h. sie versuchen, für ihre Gedankengänge bei uns zu werben. Das hört sich sehr einfach an, aber diese Beschreibung des Vorgangs des Begründens enthält eine wichtige Grundsatzentscheidung darüber, wie wir das Begründen auffassen wollen. Wenn dieser Dialog so vor sich geht, dann gibt es keine letzte Instanz für die Entscheidung darüber, was als ‚begründet‘ und was als ‚unbegründet‘ oder als ‚nicht ausreichend begründet‘ gelten soll. Man könnte auch sagen: es gibt keine letzte Instanz außerhalb des Dialoges selbst. Wenn wir im Dialog zu einer Definition – allgemein: zu einer Einigung über ein bestimmtes Verständnis – gekommen sind, so gilt sie.
Natürlich kann diese Einigung immer wieder revidiert werden. Etwa können andere Teilnehmer zu diesem Dialog kommen und andere Gründe und Gegengründe vorbringen. Es gibt Teilnehmer, die neue Erkenntnisse vorbringen, d. h. sich auf bestimmte bereits als geltend anerkannte Teile des Wissens stützen. Dann kann der Prozess des Begründens neu einsetzen. Es kann auch sein, dass einem Teilnehmer etwas Neues einfällt, was dazu führt, dass die diskutierte Angelegenheit in einem ganz neuen Licht gesehen wird und der Prozess des Begründens neu beginnen kann. Wie ein solcher Prozess des Begründens ganz genau aussieht, kann man im Grunde vorher nie genau wissen. Aber die Begründung endet nie bei einer ‚Sache selbst‘ oder bei einem Machtspruch einer Instanz, die ‚die Vernunft‘ genannt werden könnte und unabhängig von diesem Prozess des Begründens besteht. Wir können also den folgenden Begriff der Vernunft formulieren: als Vernunft können wir eben dieses Geschehen der Begründung in einem offenen und dialogischen Prozess zwischen sprachfähigen Lebewesen auffassen.
1.5Vorschau: Wissenschaft und Wissenschaftsphilosophie
Wir haben mit einem einfachen und weithin akzeptablen Begriff von Wissenschaft begonnen und daraus einige Probleme entwickelt, die nicht mehr selbst als wissenschaftlich bezeichnet werden können. Sie betreffen in erster Linie das Begründen, ohne das wir keinen Begriff von Wissen formulieren können. Wissenschaft beansprucht, den Regress des Begründens stoppen zu können. Empirische Wissenschaft beansprucht, diesen Regress durch die Berufung auf Erfahrung als sinnliche Wahrnehmung beenden zu können. Damit hat es die Wissenschaftsphilosophie zunächst mit dem Problem der Wahrnehmung zu tun, d. h. mit der Frage, ob und wie das sinnliche Wahrnehmen zur begründenden Grundlage für das Wissen der empirischen Wissenschaft werden kann. Mit dieser Frage beschäftigen wir uns im 2. und 3. Kapitel. In ersterem geht es um die Frage, wie das Wahrnehmen zum Begründen werden kann und was das für den Anspruch der Wissenschaft bedeutet, Aussagen und Theorien über die Welt machen zu können, wie sie wirklich ist. In letzterem wird die Frage nach dem Wahrnehmen in Bezug auf das Experiment gestellt, das heute als die entscheidende Instanz für die Begründung wissenschaftlichen Wissens gilt.
Von den unter den Titeln ‚Wahrnehmung‘ und ‚Experiment‘ aufgeworfenen Fragen führt der gedankliche Weg notwendig auf die Problematik des Zusammenhanges von Sprache, Bedeutung und Welt. Unsere fragmentarische Untersuchung einer weitgehend akzeptablen Beschreibung von Wissenschaft zeigte bereits eine durchgehende Problematik, auch wenn wir sie nicht immer explizit ausgeführt haben. Es ist das Problem Sprache und Welt, das die wissenschaftsphilosophische Frage nach der Erklärbarkeit der Welt in der Wissenschaft (‚science‘) seit der Mitte des 20. Jahrhunderts entscheidend bestimmt. Sollen wissenschaftliche Feststellungen und Theorien die ‚Welt‘ und Sachverhalte in ihr so beschreiben können, dass sich darin nicht subjektive Vorstellungen und Gedanken der Wissenschaftler darstellen, sondern objektive und universell geltende Gesetze, dann muss die wissenschaftliche Sprache die Möglichkeit einer solchen Darstellbarkeit der Welt in sich selbst enthalten. Dieses Problem wurde rasch das Zentrum der Frage nach dem Geltungsstatus der Wissenschaft. Die Wendung der Philosophie zur Sprache (‚linguistische Wendung‘) bot zur gleichen Zeit die Grundlage für eine solche philosophische Auffassung der Wissenschaft, und die folgende Wendung zum sozialen Zusammenhang unseres Denkens, Wissens und Handelns (‚pragmatische Wendung‘) verstärkte diese Richtung des Denkens weiter. Umgekehrt war es gerade die Untersuchung der Fähigkeit einer wissenschaftlichen Sprache, die szientifischen Ansprüche auf Darstellbarkeit der Welt in der Sprache zu erfüllen, die wesentlich zu jener Wendung zur Sprache und nachfolgend zur Wendung zur Pragmatik der Sprachverwendung beigetragen haben.
Wir untersuchen dieses Problem von Sprache und Welt im Folgenden anhand der leitenden Fragestellung, wie Wörter und Sätze einer Sprache ihre Bedeutung erhalten (4. Kapitel). Das hat den Vorteil, dass auf diese Weise die Beziehung der wissenschaftlichen Sprache zur Welt dort deutlich wird, wo wir beanspruchen, die Welt zur Sprache zu bringen. Auf der Ebene von Wörtern oder auch Sätzen als sprachlicher Ereignisse, die wie andere Gegenstände auch in der Welt vorkommen, sei es in der Gestalt von Tinte oder Druckerschwärze auf Papier oder elektrochemischer Vorgänge auf einem Bildschirm oder akustischer Ereignisse in der gesprochenen Sprache, können wir offenbar noch nicht nach einer solchen Beziehung fragen. Erst wenn wir solche Gegenstände als Zeichen auffassen, gewinnen wir eine sprachliche Beziehung zur Welt und zu uns selbst. Damit ist aber auch schon das Problem der Bedeutung gegeben, weil die Zeichen uns nicht von sich her sagen, wofür sie Zeichen sind. Wir müssen sie deshalb erklärt bekommen.
Das kann etwa dadurch geschehen, dass wir für die Erscheinung eines bestimmten Tieres das akustische Ereignis ‚Hase‘ zu verwenden lernen. Wir werden sehen, dass ein Verständnis von Bedeutung nach diesem Muster viel zu kurz greift, um die Beziehung der Sprache zur Welt aufklären zu können. Das zeigt sich bei Wörtern für ‚intangible‘ Gegenstände wie Liebe, Hass, Wohlwollen, Furcht, es zeigt sich aber auch bei Wörtern wie ‚Universität‘, ‚Staat‘, ‚Wirtschaft‘ oder ‚Attraktivität‘. Hier müssen wir erklären, was sie bedeuten, d. h. andere Wörter an ihre Stelle setzen. Damit wird aber angenommen, dass wir verschiedene Wörter austauschbar gebrauchen können. Das ist ebenfalls die Annahme bei einer Übersetzung zwischen verschiedenen Sprachen. Die Zeichen ‚Hase‘ und ‚hare‘ können wir ebenso identisch gebrauchen wie ‚Hass‘ und ‚hatred‘. Was ist dieses Identische? Nun, so pflegen wir zu sagen: ihre Bedeutung. Wie wir die Bedeutung aber näher verstehen können, und wie wir damit das Verhältnis von Sprache und Welt näher aufklären können, das stellt eines der Probleme dar, das die Philosophie seit Mitte des 20. Jahrhunderts in Atem hält.
Wenn es mithilfe der Frage nach der Bedeutung gelungen ist, die Problematik der Frage nach dem zu verstehen, wovon die wissenschaftliche Sprache handelt, dann können wir besser informiert auf die Frage zurückkommen, die sich in dieser einleitenden Reflexion auf den Begriff der Wissenschaft schon sehr deutlich meldete. Wie geht die Wissenschaftsphilosophie auf ihrem gegenwärtigen Stand mit der Frage nach dem Realismus in Bezug auf wissenschaftliche Aussagen und Theorien um? Dieser Stand ist offenbar fundamental durch die Reflexion auf Bedeutung in der Sprache geprägt. Wir werden sehen, wie sich aus dieser Perspektive das sog. ‚Realismus-Problem‘ in Bezug auf die empirische Wissenschaft darstellt (5. Kapitel).
Es sollte bereits jetzt deutlich sein, dass die Philosophie der Wissenschaft kein Konkurrenzunternehmen zur Wissenschaft darstellt. Sie will also auf keine Weise ein ‚besseres‘ Wissen von der Welt entwickeln oder auch nur beschreiben, wie ein solches besseres Wissen auszusehen hätte. In der Regel geht sie davon aus, dass die Wissenschaften uns das gegenwärtig ‚beste‘ Wissen über die Welt zur Verfügung stellen. Aber sie belässt es nicht dabei, sondern stellt die Frage, was ein solcher Superlativ denn bedeuten solle, m. a. W.: nach welchen Kriterien sagen wir, es handle sich bei der Wissenschaft um das ‚beste‘ verfügbare Wissen? Wenn wir darauf antworten, es sei deshalb das ‚beste‘ Wissen, weil wir damit am erfolgreichsten in der Welt solche Zwecke erreichen können, die uns Vorteile bringen, so stellt die Philosophie der Wissenschaft eine andere Frage: was bedeutet dabei ‚erfolgreich‘ und sogar ‚erfolgreicher‘ als andere Ansprüche auf Wissen wie etwa aus älteren Wissensformen wie Erkenntnis aus reiner Vernunft, Interpretation heiliger Schriften oder auch aus Wissensansprüchen, die auch heute noch im Rahmen von Esoterik und sog. ‚alternativen‘ Erkenntnissen etwa in der Medizin auftreten? Und dann stellt sich die weitere Frage, in welchem Zusammenhang dieses Kriterium des Erfolgs mit dem Bezug der Wissenschaft zur Realität – also zur Wirklichkeit unserer Erfahrung – steht, man könnte auch sagen: mit dem Wahrheitsanspruch der Wissenschaft.
Die Philosophie der Wissenschaft will auch nicht den Wissenschaftlern vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben und wie sie ‚gute‘ von ‚schlechter‘ Wissenschaft unterscheiden können. In der Regel sind Wissenschaftler relativ intelligente Menschen und können solche Fragen unter sich regeln. Mit dem Entwerfen von Vorschriften für ‚richtiges‘ Arbeiten in den Wissenschaften geben sich wohl noch einige Wissenschaftstheoretiker im engeren Sinne ab, während die Philosophie der Wissenschaft davon Abstand hält. Sie beschäftigt sich stattdessen mit ‚Wissenschafts-reflexion‘, d. h. sie verlässt die Haltung der Wissenschaft, die in Richtung der Dinge und Ereignisse in der Welt abzielt, und wendet sich zurück auf eben das Tun der Wissenschaft selbst. Dazu gehört zunächst die Rekonstruktion dessen, was Wissenschaftler tun, und an dieser Stelle wird noch sehr wenig bis überhaupt keine Philosophie eingesetzt, anders gesagt: eine empirische Beschreibung von Wissenschaft ist zwar eine wichtige Grundlage für die Philosophie der Wissenschaft, aber sie ist selbst noch keine Philosophie.
Wo die Philosophie beginnt, beschrieb Wilfrid Sellars so: „The ideal aim of philosophizing is to become reflectively at home in the full complexity of the multi-dimensional system in terms of which we suffer, think, and act.“2 Das entscheidende Wort für die Unterscheidung der Philosophie von anderen Formen des Denkens, Wissens oder der Überzeugungen über die Welt und das Leben der Menschen hat Sellars selbst kursiv setzen lassen: ‚reflectively – auf eine reflektierte Weise‘. Mit der Welt bekannt sein können wir offenbar auch auf andere Weise, etwa durch das Wissen der Naturwissenschaft, mithilfe unserer Alltagsüberzeugungen, mit denen wir in der Regel ganz gut zurechtkommen, oder auch auf der Grundlage von umfassenden Zusammenhängen von Gedanken über die Welt, wie wir sie in religiösen Systemen finden können. Aber keine dieser Wissens- und/oder Glaubensformen genügt dem Kriterium ‚reflektiv‘, das Sellars für die Philosophie reserviert.
Ein sehr allgemeines Verständnis für dieses Kriterium könnte so beschrieben werden. In der Wissenschaft ebenso wie in Systemen von Glaubensüberzeugungen geht es um Beschreibungen und Erklärungen für die Welt der Tatsachen bzw. der Dinge – was sie sind, wie sie sind, warum sie so sind, und auf welche Weise wir sie am besten nach unseren Wünschen beeinflussen können. In der Philosophie dagegen wird ‚zurück-beugend‘ – ‚reflektiert‘ wörtlich übersetzt – gedacht, d. h. das hier gesuchte Wissen bezieht sich auf eben die Beschreibungen und Erklärungen für die Welt der Tatsachen und Dinge, über die wir in der Wissenschaft ebenso wie in Systemen von Glaubensüberzeugungen und im alltäglich-lebensweltlichen Wissen Auskunft gewinnen wollen. Das philosophische Wissen bezieht sich also auf die begrifflichen und gedanklichen Mittel, mit denen wir nach einem ‚direkten‘ Wissen von der Welt streben. Man könnte die Unterscheidung deshalb auch mithilfe der Ausdrücke ‚intentio recta‘ und ‚intentio obliqua‘ beschreiben. Die erstere Intention richtet sich direkt auf die Dinge und Tatsachen, die letztere dagegen auf die Gedanken und Begriffe, mit denen wir uns in der intentio recta auf die Welt beziehen.
Auf dieser Grundlage lässt sich der gegenwärtige Stand des Denkens der Wissenschaftsphilosophie gut anhand der Unterscheidung zwischen Realismus und Anti-Realismus verdeutlichen, wie ihn Ian Hacking formuliert: „Der wissenschaftliche Realismus besagt, dass die von richtigen Theorien beschriebenen Gegenstände, Zustände und Vorgänge wirklich existieren.“3 Der ‚wissenschaftliche Realismus‘ erhebt also einen bestimmten Anspruch. Die ältere Wissenschaftsphilosophie hätte diesen in einem Satz formulierten Anspruch nach seinem Aussagewert aufgefasst und für diese Position oder für die entgegengesetzte Position des Anti-Realismus oder ‚Idealismus‘ argumentiert. Auf dem gegenwärtigen Stand dagegen wäre ein solches Argumentieren hoffnungslos veraltet.
Der neue Zugang zu einer solchen Position, wie Hacking sie hier beschreibt, stützt sich vielmehr auf ein Argumentieren, das sich auf die verwendeten Begriffe ‚wirklich‘ und ‚existieren‘ und auf ähnliche Ausdrücke wie ‚wirklich richtig‘ oder ‚wahr‘ oder ‚es gibt‘ richtet. Was ist damit gemeint und was meinen wir, wenn wir uns mit diesem Meinen auf ‚die Welt‘ beziehen? Natürlich würde die Position eines Anti-Realismus die gleiche Behandlung vonseiten der modernen Wissenschaftsphilosophie erfahren. Was soll es heißen, dass es so etwas wie Elektronen ‚nicht gibt‘ oder dass sie nicht ‚etwas Wahres‘ darstellen? Eine Entscheidung zwischen diesen beiden Positionen wäre deshalb eine Position, die heute nicht mehr eingenommen werden kann. Wohl aber kann man danach fragen, wie solche Ausdrücke wie ‚richtig‘, ‚wahr‘, ‚existieren‘ oder ‚es gibt‘ verwendet werden, was zwischen einem Sprecher, der solche Ausdrücke verwendet, und seinem Zuhörer geschieht, welche Ansprüche damit erhoben werden, wie man auf sie reagiert und wie man die erhobenen Ansprüche einlöst.
Wenn Wissenschaftler also behaupten, die Welt sei genau so, wie die Naturwissenschaft – und in erster Linie die Physik – es uns erklärt, und hinzufügen, es gebe das alles, von dem die Physik sagt, ‚Das gibt es‘, und betonen, das sei alles wirklich so, wie die Gesetze der Physik es beschreiben, dann ist das aus der Perspektive der Wissenschaftsphilosophie gar nicht so falsch. Also steht die Naturwissenschaft doch in Kontakt mit der Welt, wie sie an sich ist, und erklärt uns, wie die Wirklichkeit von Anbeginn der Zeit und bis in alle Ewigkeit hin war, ist und sein wird? Äh, jein. Der Philosoph muss auch an dieser Stelle den Spielverderber spielen, ohne aber einfach widersprechen zu können – er kann nur und immer wieder die lästige Antwort geben, die man eigentlich von Juristen erwartet: ‚Das kommt darauf an‘. Und worauf kommt es an? Nun, natürlich darauf, wie man solche Ausdrücke wie ‚es gibt‘ und ‚es ist‘ und ‚wirklich‘ und ähnliche versteht.
Wenn die Philosophie ‚Reflexion‘ ist und sich damit weder mit der empirischen Wirklichkeit (direkt) befasst noch Begriffsanalyse ist, so ist sie eine Erweiterung des Denkhorizontes der Wissenschaft und ihrer Theoriebildung über die ‚Welt‘. Ist sie damit ‚wahrer‘? Ist sie damit ‚näher‘ an der Wirklichkeit? Nein, denn natürlich gilt für sie das Gleiche wie für die Wissenschaft selbst. Wissenschaft ist grundsätzlich die (Selbst-)Explikation eines bestimmten Denkhorizontes. Nichts anderes ist die Philosophie, die ihre Geschichte hat und diese Geschichte expliziert. Die Philosophie kann die Naturwissenschaften nicht erkenntnistheoretisch ‚fundieren‘, sondern nur auf sie reflektieren und sie damit aufklären – was wiederum eine Aufklärung nur für jemanden darstellt und nicht für jedermann, d. h. ihre Akzeptanz ist denkgeschichtlich voraussetzungsvoll. Aber die Reflexion gehört zu einem vollständigen Verständnis dessen, was in der Wissenschaft geschieht. Durch die wissenschaftsphilosophische ‚intentio obliqua‘ kann eine Aufklärung über den Status dieser Erkenntnis gewonnen werden. Für das menschliche Selbstverständnis ist es gerade heute in der Zeit des Vordringens der reflexionslosen Gehirnforschung in die Formung der Art, wie wir uns selbst aufzufassen haben, entscheidend, wie wir Wissenschaft, also das Wissen in der ‚intentio recta‘, aufzufassen und zu verstehen haben. Alternative Wissensformen wie Glaubenssysteme können daraus ihren Standort besser bestimmen und erkennen, wie weit sie durch Wissenschaft bedroht werden oder vielleicht auch nicht.
1Der Ausdruck ‚Antinomie des Realismus‘ stammt von Hilary Putnam (The Dewey Lectures 1994: Sense, Nonsense, and the Senses: An Inquiry into the Powers of the Human Mind, in: Journal of Philosophy 91/1994, S. 445–517, S. 456). In diesen Vorträgen beschreibt Putnam das Problem auch so, dass wir uns eine Welt vorstellen müssten, „in which there are, as it were, ‚noetic rays‘ stretching from the outside into our heads“. (Putnam, a. a. O., S. 461) Putnams eigener Vorschlag zur Auflösung dieser Antinomie bestand übrigens in dem Vorschlag „zum natürlichen Realismus des einfachen Mannes“ zurückzukehren, also mit Hegel gesprochen, zum natürlichen Bewusstsein, und es dabei bewenden zu lassen (Putnam, The Threefold Cord: Mind, Body, and World, New York 1999, S. 15).
2Sellars, W., The Structure of Knowledge, in: Castaneda, H.-N., Hg., Action, Knowledge, and Reality, Indianapolis 1975, S. 295–347, S. 295.
3Hacking, I., Einführung in die Philosophie der Naturwissenschaften, Stuttgart 1996, S. 43.