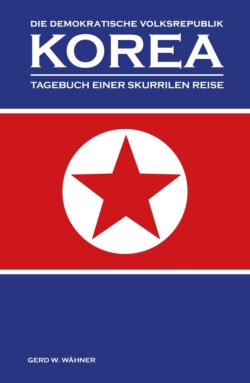Читать книгу Die Demokratische Volksrepublik KOREA - Gerd W. Wähner - Страница 11
ОглавлениеPjöngjang
Tagebucheintrag vom 3.10.1982:
„Hinflug früh am Morgen von Berlin-Schönefeld nach Moskau-Scheremetjewo. Dort Zwischenstopp und anschließend weiter nach Pjöngjang, Hauptstadt Nord-Koreas, genauer der ,Demokratischen Volksrepublik Korea’.
Ankunft am Mittag. Begrüßung in der Empfangshalle des Flughafens durch Herrn Zong Hong, meinen koreanischen Partner. ,Zong‘, erklärt der uns, sei sein Vorname, und ‚Hong‘ der Nachname. Wir könnten ihn gern mit ‚Zong‘ ansprechen.
Anschließend Fahrt mit dem Bus in die etwa zwanzig Kilometer entfernte Hauptstadt. Lautes, anhaltendes Hupen bei jedem Überholvorgang. Schrecklich!
Werden im Hotel ‚Ch’ŏllima‘3 abgeladen und beziehen Zimmer im 15. Geschoss, mit Blick auf Eiskunstlaufstadion und Wassersport-Komplex. Dahinter und daneben ist viel Beton zu sehen - vermutlich Regierungsgebäude; weiter entfernt Neubauten; dazwischen viele Grünflächen.
Am Nachmittag, bei warmer Sonne, erster Spaziergang: Unmittelbar hinter den repräsentativen Gebäuden an der Hauptstraße beginnt ein Gewirr kleiner, kurzer, meist ungepflasterter Straßen, an denen grob ausgeführte, überwiegend fünfgeschossige Wohnblöcke stehen. Davor und auf den Straßen: Kinder, Kinder, Kinder… Sie spielen wild und unbändig mit alten schlaffen Bällen, hängen an Klettergerüsten oder lassen mit Bindfaden am Schwanz festgebundene Libellen fliegen. Und alle sind ganz reißend verschmutzt. Sie begrüßen die Fremden weltmännisch mit einem ‚Hello!’
Die Häuserfassaden sind schmucklos, ohne nationales Kolorit, alles ist einfach und zweckmäßig. (Wen wunderts, der weiß, dass Pjöngjang während des Koreakrieges von der US Air Force ‚ausradiert‘ wurde, wie alles, was als lohnenswertes Ziel aus der Luft ausgemacht werden konnte. Tote, Trümmer, Trümmer, Tote…)
Immerhin, beinahe jeden Balkon schmücken Grünpflanzen.
Auf dem Platz zwischen Hotel, Eisstadion und Sportpalast marschieren Formationen von Kindern und Jugendlichen im Gleichschritt. Alle tragen Einheitskleidung; meist in blau und streng geschnitten, aber einige bunte Hemden und Blusen lockern das Bild ein wenig auf.
Sie marschieren allein und, wie es scheint, freiwillig. So etwas wie Freude an der gemeinsamen, exakten Bewegung ist ihnen anzusehen, Genugtuung darüber, Teil eines großen Ganzen zu sein. Der fremde Zuschauer erstarrt zunächst angesichts dieser vermeintlichen Pervertierung kindlicher Freuden, dieser Vergewaltigung kindlicher Individualität. Auf den ersten Blick. Auf den zweiten, genaueren, wird er feststellen, dass sie mit Lust dabei sind, ohne erwachsene Anführer oder Aufpasser an ihrer Seite. Die Indoktrination sitzt tief. Sie haben das Gewollte verinnerlicht, empfinden es als normal und ziehen offensichtlich Nutzen daraus.
Die Fremden werden von den Marschierenden auf ein Kommando hin militärisch gegrüßt und - als diese zur Erwiderung des Grußes den rechten Arm heben und winken - freuen sie sich, wie sich Kinder eben freuen, wenn man sie ernst nimmt."
Eintrag vom 5.10.1982:
„Vormittags Fahrt in den Ostteil der Stadt, vorbei am ‚Großen Theater’. Ziel ist der ‚Moran-bong-Park’, der größte der Stadt. Vielleicht ist der Größte auch der Schönste: Gepflegter Rasen, Blumenrabatten, eingefasst mit Buchsbaumhecken, sowie stattliche alte Bäume, darunter Lärchen, Fichten und Ahorn.
Auf dem ‚Moran-Hügel‘ befindet sich eine Aussichtsplattform. Etwas unterhalb dieser poussiert gerade eine Gruppe kindlicher Musikanten vor einem Fotografen. Sie stehen ihm Modell für ein Gruppenfoto. Die Gesichter sind stark geschminkt. Mit ihren kleinen Händchen umklammern sie die Musikinstrumente. Die Körper wirken puppenhaft erstarrt, kommen auf ein Korrekturkommando des Regisseurs für einen kurzen Augenblick in Bewegung, um sogleich wieder in die Erstarrung zurück zu fallen. Das geht solange, bis dem Fotografen die Unnatürlichkeit perfekt erscheint und er auf den Auslöser drückt.
Während eines Stopps bei der Rückfahrt zum Hotel kann der erste der obligatorischen Programmpunkte abgearbeitet werden: die Besichtigung des Triumpf-Bogens4 Wahrlich ein Prachtstück! Mit seinen sechzig Metern Höhe überragt er um zehn Meter den ‚Arc de Triomphe’ in Paris, erklärt Herr Hong, unser koreanischer Reisebegleiter. Das ist rechtens, denke ich, der ‚Große Führer’ überragt zwar nicht an Körper-, dafür aber an Geistesgröße schließlich jeden Staatsmann in Frankreich und anderswo in der westlichen Welt. Da darf auch sein Triumpf-Bogen etwas höher sein.
Siebzig steinerne Blumen schmücken die Torbögen des unförmigen, steinernen Kolosses. Oben, dicht unter den dreifach herauskragenden Simsplatten, stehen die Jahreszahlen 1925 und 1945. Sie sollen daran erinnern, erklärt Herr Hong, dass Kim Il-Sung im Jahre 1925 das Elternhaus verließ, um die Führung der revolutionären Bewegung gegen die japanischen Unterdrücker zu übernehmen und daran, dass 1945 die Befreiung vom imperialistischen Joch vollendet wurde.
Das muss ein großer Mensch sein, soviel wird selbst dem skeptischen Besucher allmählich klar. Und wer’s immer noch nicht glaubt, sollte sich zunächst einmal genauere Kenntnis über die untadelige Herkunft des ‚Großen Führers’ im eigens zu diesem Zwecke angelegten Revolutionären Zentrum Mangede‘ aneignen. In diesem Zentrum kann der Interessierte dessen Geburtshaus besichtigen. Es ist nur ein bescheidenes, schilfgedecktes Bauernhäuschen mit drei karg ausgestatteten Räumen im Inneren. Hier liegt vermutlich der Ursprung für die sprichwörtliche Bescheidenheit des großen Volkstribuns. (Dessen Eltern, Kim Hyong-jik und Kang Pan-sok, sollen gläubige Protestanten gewesen sein.)
Gegenüber dem Wohnhaus befindet sich ein Wirtschaftsgebäude. Es beherbergt landwirtschaftliche Geräte und Haushaltsgegenstände, darunter Pflüge, Sensen, Rechen, Irdene Gefäße, Nudelhölzer und was der Landmann und seine Frau sonst noch so brauchten. (Luise R. zitiert bei der Beschreibung eines Besuches von Mangede ihre kleine koreanische Führerin: ‚Dies ist die Mistgabel, mit der der Vater des großen Präsidenten…‘ (In dem Wissen, dass auch der Vater schon ein Revolutionär war, könnte man den Satz wie folgt ergänzen: ‚Dies ist die Mistgabel, mit welcher der Vater des großen Präsidenten begonnen hat, den Augiasstall auszumisten, den die Japaner hinterlassen haben.‘ Herkules lässt grüßen!)
Eltern und Großeltern des berühmten Sprösslings setzten, so wird berichtet, auch nach dessen Sieg und dem der Revolution ihr bäuerliches Leben fort. Könnten die vom Himmel herabschauen, wären sie vermutlich erschrocken über den Rummel auf ihrem kleinen, vormals so ruhigen Fleckchen Erde und möglicher Weise auch nicht übermäßig erfreut über dessen Verwandlung in eine Wallfahrtsstätte.“
Eintrag vom 6.10.1982:
„Vormittags Besuch des ‚Museum zur Erinnerung an den vaterländischen Befreiungskrieg’: Wenig Originaldokumente, aber wer würde die auch lesen. Umso mehr Anschauliches ist ausgestellt, darunter Kriegsgerät verschiedenster Art und – untergebracht in einer gesonderten Rotunde neben dem Hauptgebäude – das Panorama irgendeiner Schlacht, ganz sicher geführt und gewonnen vom großen KIS.
Nachmittags kommt bei uns nach so viel Geschichtsunterricht und Heldenverehrung endlich Freude auf. Die wird im ‚Park der Attraktionen’ vermittelt. Kindergeschrei stimmt die Reisegruppe auf die Hauptattraktion ein - die riesige Achterbahn.
Der Fahrpreis ist bei uns im Reisepreis inbegriffen. Da gibt es kein Halten. Alle sind dabei. Die Fahrt ist wirklich halsbrecherisch; bei jeder Kurve muss man fürchten, der Wagen flöge geradeaus weiter, um dann unsanft ganz tief unten auf der Erde aufzuschlagen. Das Freuden- und Angstgeschrei der Passagiere ist entsprechend groß. Am lautesten kreischt unsere blonde Monika und erwischt prompt eine volle Ladung Wasser, als ihre Gondel, wie alle anderen, zum Ende der Fahrt hin vor dem Ausgang in einem Wasserbecken abrupt abgebremst wird. Ist da etwa jemand schadenfroh?
Und wieder sind jede Menge Kinder unterwegs: Sie marschieren in Einheitskleidung und guter Ordnung singend durch den Park, stehen Schlange vor dem Zugang zu den Karussells und zur Wasserbahn oder sitzen auf dem Rasen. Wenn sie die ausländischen Touristen erblicken, grüßen sie artig. Ein wenig verlegen wirken sie dabei, aber sie haben es wohl geübt. Sehr liebe Gesichter sind darunter…
Am Abend geht es in den Staatszirkus. Gute und mittelmäßige Darbietungen wechseln einander ab. Das einheimische Publikum klatscht euphorisch, tröstet auch jene Artisten durch Beifall, denen mal ein Fehler unterläuft.
Interessant gestaltet sich die Abfahrt: Vor dem Zirkus stehen diverse Staatskarossen; Mercedes, BMW, Volvo, Audi, Lexus – alles was der dekadente Westen dem sozialistischen Osten anzubieten hat. Die Mehrheit der einheimischen Besucher wird auf bereitstehende LKW verfrachtet. Das fällt kaum auf, so schnell und diszipliniert läuft es ab. Unter lautem Gehupe, rücksichtslos auf irgendwelchen ungeschriebenen Vorfahrtsrechten beharrend, kämpfen sich die Funktionärsfahrer den Weg frei, dicht gefolgt von den Reisebussen mit Ausländern.
Zum anschließenden Dinner im Hotel wird, wie wohl üblich, europäische Küche angekündigt, extra für die deutschen Gäste zubereitet. Auf Drängen der Gruppe hin gehe ich in die Küche und interveniere beim Koch. Herr Hong begleitet mich und übersetzt:
‚Ihre eigens für uns zubereiteten europäischen Gerichte sind sicher sehr lecker, aber wir haben gehört, dass auch die traditionelle koreanische Küche äußerst gesund und schmackhaft sein soll. Gönnen Sie uns das Vergnügen, kochen Sie für uns koreanisch!’
Ein breites Lächeln auf dem runden, pausbäckigem Gesicht unter der gestärkten weißen Haube, eine Verbeugung vor dem höflichen Gast aus Deutschland und ein ‚Danke, sehr gern!’ kommen als Antwort.
Zong zeigt sein typisches Grinsen. Vielleicht freut er sich darüber, dass sein deutscher Partner so schnell gelernt hat, wie man in Korea Wünsche äußert und auch erfüllt bekommt.
Und prompt werden heute zum Dinner erstmals koreanische Gerichte serviert: scharf gewürztes Rindfleisch in dünnen Scheiben, dazu Bohnenkeime, Sprösslinge von Farnkraut, Spinat, Gemüse in scharfer Kimchi-Soße und dazu - selbstverständlich - Reis. Und genauso selbstverständlich ist es - zumindest an unserem Tisch - dass mit Stäbchen gegessen wird. Als Getränk wird ein schweres und süßes einheimisches Bier serviert. ‚Pjöngjang’ steht auf dem Flaschenetikett, also kommt es wohl aus der Hauptstadt.
Zum Abschluss des Essens gibt es - welch glücklicher Zufall - Kirschkompott, serviert in den hübschen blau-weißen Schälchen, Made in China. Ein glücklicher Zufall deshalb, weil ich das folgende, schon einmal anlässlich einer Reise in die Mongolei praktizierte Verfahren an unserem Tisch einführen und verfeinern kann: Den Wettkampf um den schnellsten Verzehr von Kirschkompott mit Stäbchen und Ablage der Kerne auf einem separaten Teller. Das Siel geht wie folgt: Die Kirschen werden mit Stäbchen aus der eigenen Kompottschale geangelt und verzehrt. Seine Kerne spuckt der spuckt der Mitspieler zwar zuerst auf den eigenen Teller, nimmt sie dann aber eiligst mit seinen Stäbchen wieder auf und legt sie auf den Teller des Nachbarn zu seiner rechten ab; mit Stäbchen, versteht sich.
Wer zuerst mit seinen (vor Spielbeginn abgezählten) Kirschen fertig ist und deren Kerne ordnungsgemäß auf das Tellerchen des Nachbarn befördert hat, ruft ‚Halt!’. Der wird zum Sieger erklärt und erhält zur Belohnung ein Stück koreanisches Riesenkonfekt. Und wer zu diesem Zeitpunkt die meisten Kerne auf seinem Teller zu liegen hat, ist der Verlierer. Auf dessen Rechnung geht die nächste Runde ‚Soju’, einem vorzüglichen koreanischen Reisschnaps.
Alle in der Runde signalisieren ihr Einverständnis mit den Spielregeln. Die Kirschen in den Schalen werden gezählt, die Anzahl vereinheitlicht. Sicherheitshalber demonstriere ich das Verfahren vor Spielbeginn noch einmal mit einer Kirsche aus meiner eigenen Schüssel. Deren Kern liegt nun auf dem Teller des Nachbarn rechts von mir. (Dadurch bin ich von Beginn an um einen Kern im Vorteil!)
Los geht’s! Kirsche angeln, versehentlich fallen lassen, erneut greifen und zum Munde führen, essen, glitschigen Kern auf den Teller spucken, mit den Stäbchen aufgreifen, auf dem Weg zum Nachbarteller wieder verlieren, erneut mit beiden Stäbchen in die Zange nehmen, auf dem Teller des Nachbarn abwerfen, schnell die nächste Kirsche aus der Schüssel gefingert, und so weiter. Bald kommt das ‚Halt!’. Danach werden die Kerne auf jedem Teller gezählt. Es folgen lautes Lachen, Klatschen und Schulterklopfen. Beim Soju, werden Trinksprüche auf den Gewinner, auf den Verlierer, auf den ‚Großen Führer’ und auf das tapfere nordkoreanische Volk ausgebracht.
Neidvoll sehen die Besteck-Muffel von den beiden benachbarten Tischen zu uns herüber. Vielleicht sollte ich mich morgen an einen der beiden anderen Tische setzen…“
Eintrag vom 7.10.1982:
„Vormittags Revolutionsmuseum, nachmittags Seidenstickerei. Erst das Grobe, dann das Feine.
Das Grobe übermannt uns schon auf dem Platz vor dem Eingang zum Museum: Überüberlebensgroß steht dort der ‚Große Führer’ in Bronze, zwanzig Meter hoch. Seine ausgestreckte Rechte weist dem Volk den Weg in eine lichte Zukunft. Leider darf man das Monument nur frontal fotografieren. Herr Hong diesbezüglich:
‚Bitte nur von vorn knipsen, nicht von hinten. Und auch keine Details… ‘‘
Also besser gleich rein ins Revolutionsmuseum. Dort wird das schon vor dem Denkmal des ‚Großen Führers’ aufgekommene Gefühl von der eigenen Nichtigkeit noch verstärkt. Die auf Bild- und Schrifttafeln im Museum präsentierten Taten der Heroen können das ohnehin angekratzte Selbstwertgefühl des sensiblen Besuchers weiter empfindlich verletzen.
Aus der Gruppe kommt der Wunsch, es bei dem bisher gesehenen, beispielhaftem bewenden zu lassen und sich nunmehr stärker der Kultur des Landes zuzuwenden.
Da ist der Besuch der Seidenstickerei ein guter Anfang. Wie erwartet empfängt uns auch dort, schon am Eingang, der ‚Große Führer’, hier passender Weise auf einem Seidenteppich abgebildet. Groß, sehr groß, wirkt er wieder – zumindest im Vergleich zu den beiden winzigen, puppenhaften Mädchen, die er links und rechts an den Händen hält.
Im Inneren werden wir durch einige helle, freundliche Räume geleitet, in denen jeweils sechs bis zehn Frauen an Nähmaschinen sitzen. Nach bunten Vorlagen sticken die allerliebsten Motive auf Tücher und Tischdecken: Grimmige Tiger, zauberhafte Feen, beutegierig in den Lüften kreisende Adler und bukolische Landschaften. Wem es gefällt…
Wem es nicht gefällt, wer sogar meint, das sei Kitsch, der wird im anschließenden Raum wieder versöhnt. Dort bekommt er Handstickerei vom Feinsten zu sehen: Blumen, Blüten, Schmetterlinge, Vögel, so zart und farbenfroh, dass er sich die Augen reibt. Da fände auch der kritische Besucher schon ein passendes Souvenir, wenn die Arbeiten nicht so exorbitant teuer wären. Verständlich: An einer etwas größeren Vorlage arbeitet ein fleißiges Mädchen oft ein ganzes Jahr lang.
Den freien Nachmittag nutzen wir (M., H. und ich) zu einer Fahrt an die Peripherie der Stadt. Einmal mit dem Trolleybus Nr. 1 von Endhaltestelle zu Endhaltestelle. Da bekommt man ein bisschen was vom anderen Pjöngjang geboten: Kleine Häuser mit heller Fassade und Walmdächern, gedeckt mit dunklen Ziegeln. An den Hauswänden hängt Paprika zum Trocknen. Die leuchtend roten Schoten machen sich sehr schön vor den hellen Hauswänden.
Die wenigen Menschen, denen wir begegnen, erweisen sich als sehr scheu. Werden sie angesprochen, wenden sie sich entweder ab oder legen den Zeigefinger quer über ihren Mund. Dieses Verhalten ist wohl weniger in der mangelnden Kenntnis von Fremdsprachen oder in Unhöflichkeit begründet, als vielmehr ein passiver Reflex, eine schon in Vorzeiten verinnerlichte Umgangsform Ausländern gegenüber.
Auch so war dieser 7. Oktober, bei uns zu Hause der ‚Tag der Republik’, schon ein sehr ereignisreicher Tag. Und jetzt, am Abend, geht es noch in die Oper. Aber was heißt hier Oper. Es geht in die ‚Große Oper’, in das ‚Mangende Kunsttheater der Hauptstadt’.
Dessen Inneres kann selbst den zwischenzeitlich schon einiges gewöhnten auswärtigen Besucher verblüffen. Großer Anspruch – großer Aufwand – große Wirkung: Dicke Teppiche bedecken den Boden allenthalben. Die Wände sind mit feinstem Marmor verkleidet und mit großformatigen Seitenteppichen behangen. Eine ins obere Geschoss führende Treppe erhebt sich aus einem großen Becken mit Wasserspielen, ohne dass man fürchten müsste, bei deren Benutzung nasse Füße zu bekommen. Kunstvoll mit Schnitzwerk und Intarsien aus Perlmutter versehene Türen führen in den Konzertsaal. Dessen Decke erstrahlt in den Farben des Regenbogens.
Der deutsche Tourist staunt zunächst und lächelt dann vielleicht mokant, der Besucher aus dem Volke dagegen wäre begeistert, könnte er diese Pracht sehen. Wo ist der aber? Wir sehen hier keinen, wir haben auch im ,Kulturpalast des Volkes’ keinen aus dem Volke gesehen. Neben den Funktionären sind die Ausländer hier wie dort anscheinend unter sich.
Auf dem Programm steht ‚The Song oft the Paradise’. Da sind wir natürlich gespannt und werden in unseren Erwartungen auch nicht enttäuscht. Soviel Kitsch, Pomp und Personenkult bekommt man nur einmal im Leben geboten. Die knallig-bunten Bühnenbilder, die märchenhaften Kostüme und die wehenden Spruchbänder muss man gesehen und den pathetischen, gekünstelten Gesang gehört haben!
„Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradiese sein.“
(Lukas 23:43)
3 Ch’ŏllima ist das geflügelte Pferd aus der chinesischen Mythologie, welches am Tag 1000 Ri (etwa 400 km) zurücklegen kann. Es steht für Wiederaufbau nach dem Koreakrieg und Industrialisierung des Landes – ist das koreanische Pendant zum chinesischen „großen Sprung nach vorn.“
4 Koreanisch: „Kaesŏnmun“ (Tor der triumphalen Rückkehr des Großen Führers aus dem Vaterländischen Befreiungskrieg gegen die Japaner)