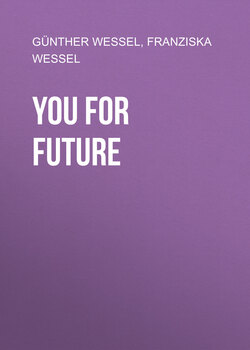Читать книгу You for Future - Günther Wessel - Страница 4
ОглавлениеAlter Songtext. „Die Ärzte“, 2004. Deine Schuld.
Wir wissen schon lange, dass unsere Art zu leben unser Leben selbst bedroht. Seit knapp 50 Jahren warnen uns Forschung und Wissenschaft, dass wir langsam, aber sicher die Welt zerstören, auf der wir leben. Passiert ist seither – nicht viel.
Warnungen, Mahnung, Vorschläge
Schauen wir zum Beispiel auf den Straßenverkehr: Als Günther so alt war, wie Franziska heute ist, also im Jahr 1974, gab es in Deutschland etwa 15–16 Millionen privater Autos. Inzwischen tummeln sich 46 Millionen privater Autos auf Deutschlands Straßen. Das sind dreimal so viele wie vor 45 Jahren. Und es werden immer noch mehr und immer noch größere. Dabei ist Deutschland in dieser Zeit nicht dreimal so groß geworden. Es wurde nur immer mehr mit Straßen zugebaut.
Im Berufsverkehr sitzen durchschnittlich weniger als 1,1 Personen in einem Auto – warum diese Autos vier bis sieben Sitze haben, ist da nicht einfach zu erklären. Und auch nicht, warum man 300 PS braucht, um sonntags Brötchen zu kaufen.
Das ist nicht schön. Es ist auch nicht schön, dass man heute auf fast keiner Straße mehr spielen kann. Dass sich vor Grundschulen am Morgen die Autos knubbeln, wenn alle Eltern ihre Kinder dorthin bringen, weil es zu gefährlich ist, die Kinder allein mit dem Rad zur Schule fahren zu lassen. Die Begründung, warum es gefährlich ist, ist interessant – weil es nämlich zu viele Autos gibt.
Es ist nicht schön, dass man bei Wanderungen in Deutschland gefühlt alle 15 Kilometer auf eine Autobahn trifft, dass wundervolle Landschaften durch Autobahnbrücken zerschnitten werden (wie es im Tal der Mosel passiert), dass Städte unter Feinstaubbelastung und Lärm leiden. Allein das deutsche Autobahnnetz umfasst heute 13.009 Kilometer, was nicht ganz der Strecke von Lissabon (Portugal) nach Wladiwostok (Russland) entspricht. Das ist knapp ein Drittel des Erdumfangs.
Man kann natürlich auch so tun, als sei das ein Naturgesetz: viele Straßen und viele Autos. Die Menschen wollen das eben so, ist die Antwort, die man dann gern hört. Oder: Wir können doch den Menschen nicht das Autofahren verbieten. Oder: Die Menschen brauchen ihre Autos.
Aber Autos fallen nicht vom Himmel, Autos werden gebaut und gekauft. Straßen werden gebaut, Brücken auch. Und es ist eine Entscheidung, sich ein Auto zu kaufen, genau wie es eine Entscheidung war, hier eine Autobahn zu bauen oder dort eine Schnellstraße. Und dort keinen Bus fahren zu lassen, keinen Radweg zu planen, keine Eisenbahnschienen verlegen zu lassen. All das sind Entscheidungen, die irgendwann gefallen sind. Das Schöne an solchen Entscheidungen ist: Man kann sie, wenn man will, auch rückgängig machen. Sie sind nicht unveränderlich.
Doch wir Menschen haben eine Tendenz: wenn etwas lange funktioniert hat, einfach genau so weiterzumachen. Gut ist das nicht, aber leicht zu erklären – es ist schließlich bequem.
So heißt die Standardformel, die man auch abgeleitet als „Das weiß man doch“ kennt. In der Politik gibt es dazu noch das „TINA-Prinzip“. TINA stammt aus der Zeit, als Margaret Thatcher Premierministerin von Großbritannien war. Ist lange her, das war von 1979 bis 1990, aber das TINA-Prinzip hat sich leider seitdem gehalten. TINA ist eine Abkürzung für den von ihr oft verwendeten Satz: There is no alternative – es gibt keine Alternative. Im Kern heißt das, dass es nur eine Lösung gibt, dass die Politik nur noch unser System verwaltet, alles ist mehr oder weniger vorherbestimmt. Oft wurde der Satz auch gebraucht, um zu große soziale oder ökologische Verbesserungen abzuwehren. Im Kern bedeutet er aber auch: Wir können die Welt nicht verändern.
Das waren noch einmal „Die Ärzte“. Wenn das tatsächlich so wäre, wenn man nichts verändern könnte, wäre das für die Demokratie natürlich fürchterlich. Denn das hieße ja, dass man die Demokratie nicht braucht, dass man nicht darüber streiten kann und muss, wie sich eine Gesellschaft entwickeln soll. Und was man dafür tun kann. Das ist giftig, antipolitisch und stellt uns Menschen als bloße Herde dar, die von wenigen anderen, die es angeblich aus irgendwelchen Gründen besser wissen, regiert werden müssen. Die einfach über uns bestimmen.
Dass man die Welt verändern kann, ist keine neumodische Erfindung. Durch alle Jahrhunderte gab es Menschen, die sich gegen Unrecht aufgelehnt haben. Schaut mal im Internet nach den üblichen Verdächtigen: Spartacus, der die Sklaven im alten Rom bei ihrem Aufstand anführte, Thomas Müntzer, Bauernführer in der Reformationszeit, Georg Büchner, Schriftsteller im 19. Jahrhundert. Und wenn ihr euch dafür interessiert: Es finden sich noch unzählige Weitere, die mehr oder weniger bekannt sind.
Dabei ist eines wichtig: Der deutsche Philosoph Immanuel Kant hat 1784 einen Satz des römischen Dichters Horaz übersetzt. „Sapere aude“ hieß der, und Kant übertrug ihn so:
Kant läutete damit die Aufklärung ein, das Zeitalter, in dem man begann, wieder mehr auf die Kraft der Vernunft zu setzen. Mit Vernunft wollte man damals Vorurteile überwinden und Bildung, Bürgerrechte oder allgemeine Menschenrechte durchsetzen.
Ein bisschen Philosophie kann nicht schaden - auch wenn es sich vielleicht etwas schwierig liest.
Immanuel Kant (1724-1804) war einer der wichtigsten deutschen Philosophen der Neuzeit. Aus seinem Aufsatz „Was ist Aufklärung“ vom Dezember 1784 stammt die Übersetzung des „Sapere aude“. Hier der Textzusammenhang: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbst verschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Muthes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen.“ „Sapere aude! – Habe Muth, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“ ist also der Wahlspruch der Aufklärung.
Und noch ein bisschen Philosophie: Der ökologische Imperativ
Viele Philosophen haben sich mit Kant und dessen Ideen beschäftigt. Einer war Hans Jonas (1903-1993), der 1979 sein Buch „Das Prinzip Verantwortung“ veröffentlichte – ein immer noch hochaktuelles Werk. In ihm entwickelt er den ökologischen Imperativ: „Handle so, daß die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden.“ Sprich: „Tu nichts, was das Leben der Menschen auf der Erde gefährdet.“
Aber warum braucht man Mut, um seinen Verstand zu nutzen? Warum ist das eigene Denken ein Wagnis? Na ja, da kann dann einiges passieren: weil man vielleicht erkennt, dass das, was man bisher gemacht hat, nicht so richtig toll ist. Oder man sieht, dass Menschen, die man respektiert und liebt, einem etwas beigebracht haben, was nicht wirklich gut ist. Weil vielleicht das eigene Weltbild erschüttert wird. Weil sich herausstellt, dass es Alternativen gibt, weil man merkt, dass der Satz „Das haben wir schon immer so gemacht“ keine gute Richtschnur fürs Handeln ist.
Weil man schließlich nicht unbedingt anders denkt als vorher, sich aber vielleicht irgendwann dazu entschließt, anders zu handeln. Statt also das zu tun, was bequem ist, das zu tun, was richtig ist. Sich engagieren, etwas ins Rollen bringen.
Durch Nachdenken überprüft man also sein eigenes Verhalten und erkennt vielleicht, dass man etwas ändern muss. Was nicht immer einfach ist. Denn was soll man machen, wenn man zwar weiß, dass Autofahren schlecht ist, es aber regnet und es zwei Kilometer bis zum Sportplatz oder Reitverein sind? Die berühmte Ausnahme zulassen und sich fahren lassen? Oder sich doch aufs Rad setzen? Das wäre einfacher, wüsste man bloß nicht über die Klimakrise Bescheid. Wenn man zum Beispiel die Folgen einer Handlung nicht voraussehen kann. Man ist dann unschuldiger und kann sich bequem fahren lassen oder ohne nachzudenken in den Urlaub fliegen.
Der amerikanische Schriftsteller Jonathan Safran Foer zitiert in seinem Buch „Wir sind das Klima“ eine Rede des damaligen Präsidenten Franklin D. Roosevelt während des Zweiten Weltkriegs: Der sagte, dass man, um die Truppen, die in Europa für die Freiheit der Welt kämpften, zu unterstützen, auf vieles verzichten müsse. Nicht nur auf Luxus, sondern auch auf viele kleinere Annehmlichkeiten. Doch das sei kein „Opfer“:
Die Regierung erhöhte radikal die Steuern, die Preise für Fahrräder, Schuhe, Feuerholz und anderes wurden staatlich festgelegt, Benzin wurde streng reguliert und die Höchstgeschwindigkeit auf 35 Meilen (56 Stundenkilometer auch auf Autobahnen) festgelegt, um Treibstoff und Gummi zu sparen. All das funktionierte, weil man sich einig in der Erreichung eines großen Ziels war.
Wir sind zwar nicht der Meinung, dass man, wenn man sich gegen den Klimawandel engagiert, nie, nie, nie, nie mehr fliegen, Auto fahren oder Plastiktüten benutzen darf. Wir möchten Leuten nichts verbieten oder ihnen ihr Handeln vorschreiben – es geht darum, die Konsequenzen abzuwägen. Zu verstehen, ob sich das Wochenende auf Mallorca lohnt, wenn man dafür Massen an CO² ausstößt. Vielleicht fliegt man ein erstes Mal und auch ein zweites Mal, vielleicht lernt man dann aber etwas. Wir hätten gern, dass sich die Kosten für die Umweltschäden beispielsweise im Preis eines Flugtickets niederschlagen – also vielleicht mit 180 Euro je Tonne CO², wie Fridays for Future fordert. Das würde den Hin- und Rückflug von Berlin nach Palma de Mallorca um 128 Euro verteuern. Und vielleicht würden viele Menschen dann nicht mehr so gedankenlos durch die Gegend fliegen.
Die Gedankenlosigkeit ist vielleicht ein Grund, warum viele Menschen den Klimawandel oder Umweltfragen oder andere politische Probleme nicht ernst genug nehmen.
Oder das, was man mit dem Fachausdruck Kognitive Dissonanz bezeichnet. Die entsteht, wenn zwei Bedürfnisse oder Gewissheiten oder Informationen sich widersprechen. Zum Beispiel: Ich fahre Auto. Das ist schlecht für die Umwelt, und die will ich eigentlich schützen. Gleichzeitig macht mir Autofahren Spaß. Oder: Ich rauche. Ich weiß aber auch, dass Rauchen meiner Gesundheit schadet. Dann entsteht ein Widerspruch, die berühmte Dissonanz. Kognitiv, weil es um das Wissen geht. Schließlich passt das alles nicht zusammen. Und dann muss man irgendetwas tun; entweder muss man sein Verhalten ändern, also mit dem Autofahren oder dem Rauchen aufhören, oder man muss seine Kognition, sein Wissen, anpassen. Sprich, sich sagen: Na ja, vielleicht ist das Autofahren ja doch nicht so schlimm. Oder: Vielleicht schadet mir das Rauchen gar nicht so sehr – ich mache ja Sport.
Das ist dann eben so eine Rechtfertigung, damit man sein Verhalten nicht ändern muss – also weiter Auto fahren kann. Oder rauchen.
Weil es auch Mut verlangt, aufzustehen und etwas zu sagen, wenn einen etwas stört. Öffentlich. Das ist eine Herausforderung, denn es wird immer Menschen geben, denen das nicht gefällt. Und die sind nicht immer fair. Sie lachen einen vielleicht aus, stellen einen als ahnungslos und dumm hin oder reagieren mit persönlichen Beschimpfungen.
Aber diese Herausforderung hat auch Vorteile: Man lernt, Argumente abzuwägen, man lernt, mit Mut für Überzeugungen einzustehen; man gewinnt immer größere Sicherheit – dadurch, dass die eigenen Überzeugungen wachsen und in der Debatte immer wieder überprüft und eventuell bestätigt werden. Eine Sicherheit schließlich, die auch das Vertrauen in die eigene Person stärkt. Dass es richtig ist, was man denkt und wie man handelt und sich das nicht einfach so ergibt. „Wage es, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.“ Und daraus folgend:
Es gibt Lehrer und Lehrerinnen, die werfen ihren Schülern vor, dass diese immer alles ausdiskutieren wollen. Nun kann man das einerseits verstehen – manchmal nervt es, wenn man ständig und über alles und jedes diskutieren muss. Aber im Kern finden wir, dass diese Lehrer irgendetwas falsch verstehen:
Und schaut man auf unsere Gesellschaft, gibt es genug Punkte, an denen man sich einmischen kann und sollte. Es gibt so viele Dinge, die nicht richtig sind, nicht so sind, wie sie sein sollten. Unsere Städte stehen vor dem Verkehrskollaps, und die Autoindustrie manipuliert fröhlich Abgaswerte. Politiker und Politikerinnen leugnen die Klimakrise oder schieben Argumente vor, warum man daran nichts ändern könne, obwohl sie sich in zahlreichen Verträgen genau dazu verpflichtet haben. Die Zerstörung der Tropenwälder geht weiter, damit dort Soja angebaut werden kann, das wir an unsere Masttiere verfüttern. Nur damit das Schweinekotelett oder Rinderfilet jeden Tag dick und breit und billig auf unserem Teller liegen kann. Jeder und jede Deutsche isst durchschnittlich 60 Kilo Fleisch im Jahr (was nebenbei bemerkt doppelt so viel ist, wie es gesund wäre) – alle zahnlosen Babys und Vegetarier und Vegetarierinnen eingerechnet. Es muss da draußen also Menschen geben, die weit über 60 Kilo im Jahr vertilgen. Vor Kurzem begegnete uns ein Mensch, der trug stolz ein schwarzes T-Shirt, auf dem in weißer Schrift stand: „Rinderfilet krümelt nicht“. Was lustig gemeint ist, was wir aber, bedenkt man die sozialen, gesundheitlichen und klimatischen Folgen unseres Fleischkonsums, nur sehr bedingt lustig finden. Wir verseuchen unsere Landschaft und unser Trinkwasser mit Gülle aus der Tiermast und giftigen Spritzmitteln, wir bauen überall gigantische Auslieferungshallen und Gewerbegebiete, voller gleich aussehender Schnellimbisse, Shopping-Malls und Baumärkte.
Tendenz leider immer noch steigend.
Und mehr: Unsere Industrien exportieren Waffen in alle Welt, die auf Umwegen auch in Krisengebiete gelangen, von wo dann die Menschen nach Europa zu flüchten versuchen. Nicht wenige ertrinken dabei im Mittelmeer, weil wir uns weigern, sie aufzunehmen, und sie deshalb keine andere Chance sehen, als sich Schleppern auszuliefern, die versprechen, sie für ihr letztes Geld nach Europa zu bringen.
Oft kann man hören: Das geht uns nichts an, dafür sind wir nicht verantwortlich. Aber ist das wirklich so?
Von dem australischen Moralphilosophen Peter Singer stammt dieses Gedankenexperiment: Bei einem Spaziergang an einem Teich sehen wir, wie ein Kind dort hineinfällt und zu ertrinken droht. Was machen wir? Ohne nachzudenken, springen wir hinein und versuchen, das Kind zu retten. Eine normale Handlung, selbst wenn wir uns dabei unsere neue Hose ruinieren. Trotzdem handeln wir einfach. Wir denken nicht darüber nach, ob die Hose mehr wert ist als das Kind. Kaum jemand würde sagen, dass er oder sie das nicht täte. Wir sehen die Not und handeln sofort. Nun folgt aber Singers Frage: Was unterscheidet das Kind, das vor unseren Augen zu ertrinken droht, von einem Kind, das irgendwo in Afrika, Asien oder sonst wo in der Welt verhungert? Warum handeln wir in dem einen Moment unmittelbar und bei größerer Entfernung überhaupt nicht? „Aus den Augen, aus dem Sinn“, könnte man sagen, aber das ist allenfalls eine Begründung, kein Argument. Genau wie das, dass man am Teich vielleicht der oder die Einzige ist, der oder die eingreifen kann. Gibt es einen Unterschied, der moralisch relevant ist, warum wir bei dem vor unseren Augen ertrinkenden Kind eingreifen, bei dem verhungernden in Afrika aber nicht? Zumal unsere Welt ja heute zu einem globalen Dorf geschrumpft ist und alle Lebensbeziehungen der Menschen durch die globalisierte Wirtschaftswelt und den globalen Informationsaustausch miteinander verknüpft sind.
Schwierig? Ja. Aber das heißt nicht, dass man sich diese Frage nicht stellen sollte.
Oft handelt man ja auch, ohne sich Fragen zu stellen. Wie bei dem Kind, das vor den eigenen Augen zu ertrinken droht. Und wenn man dann gehandelt hat, kommt es einem komisch vor, dass man überhaupt darüber hätte nachdenken können, so normal erscheint es einem. Man kann sich selbst motivieren, etwas zu tun, man kann auch sofort etwas tun – und daraus entwickelt sich dann eine zusätzliche Motivation. Ich helfe nicht, um mich gut zu fühlen, aber ich fühle mich gut, wenn ich jemandem geholfen habe.
Frage dich, was du in dieser Gesellschaft anders haben möchtest. Was sich ändern sollte, wo dein Leben nicht mit dem übereinstimmt, wie es deiner Meinung nach sein sollte. Du bist der Experte für dich selbst. Findest du die Schule gut – so, wie sie ist? Ist es fair, dass es manchen Kindern egal sein kann, wenn dauernd Unterricht ausfällt, weil ihre Eltern Nachhilfeunterricht bezahlen können? Ist es nicht überhaupt eine Katastrophe, dass dauernd Unterricht ausfällt (auch wenn es mitunter schön sein kann)? Ist es gerecht, dass ein Auto mit einer Person etwa zehnmal so viel Platz auf der Straße einnimmt wie ein Radfahrer? Dass Radfahrer und Fußgänger den Autos ständig Vorrang gewähren müssen? Dass die Ampel eine Minute Grün für Autos zeigt, aber nur 15 Sekunden für Fußgänger? Ist es okay, dass Bahnfahren teurer ist als Fliegen, obwohl es die Umwelt schont? Dass du mit 16 Jahren zwar Bier trinken, aber nicht wählen darfst? Dass Frauen im gleichen Job oft weniger verdienen als Männer? Dass Männer eher Karriere machen? Dass manche Menschen 1.000-mal so viel verdienen wie andere – oder sogar noch mehr? Dass die einen viel erben, die anderen für wenig Geld viel arbeiten? Ist es gut, wie Nutztiere gehalten und geschlachtet werden? Und warum zahlen manche Unternehmen trotz riesiger Gewinne keine oder lächerlich wenig Steuern?
Du siehst, es gibt viele Fragen, und wenn man einmal anfängt, welche zu stellen, fallen einem sofort weitere ein. Kein Grund zu verzweifeln – such dir eine aus, die dich am meisten interessiert und bei der du denkst, dass du am meisten bewegen kannst. Und lass dir dann nicht reinreden, diese Frage, dieses Thema sei im Vergleich zu anderen unwichtig – das ist es nämlich nicht, es ist DIR wichtig. Und da kann es auch um den Sportverein gehen. Auch dort kann man sich engagieren.
So, und jetzt widersprechen wir uns direkt selbst: Es gibt natürlich Themen, die wichtiger sind als andere. Klimaschutz ist eines, Demokratieverteidigung ein anderes, Rassismus ein drittes. Denn das sind eben Überlebensfragen. Für uns und unser Miteinander. (Das soll dich aber bitte nicht davon abhalten, dich im Sportverein zu engagieren!)
Engagement ist mitunter mühsam, es verleiht aber auch Kraft. Franziska:
„Wenn man mir vor einem Jahr erzählt hätte, dass ich heute Demonstrationen mit Hunderttausenden Menschen organisiere, hätte ich nur gestaunt und gesagt: Ich doch nicht! Ich hätte gar nicht gewusst, was ich da hätte machen sollen. Heute tue ich es einfach. Und ich weiß, dass ich etwas bewirke. Das ist toll. Es ist überwältigend!“
Selbstermächtigung heißt der Fachausdruck dafür. Man erlebt sich selbst als jemanden, der eine Veränderung seines eigenen Lebens bewirken kann – ein wirklich tolles Gefühl. Man ist dann keine Marionette mehr, deren Fäden jemand anders in der Hand hat. Man hält selbst die Fäden, gibt sie nicht mehr her und bestimmt, was man tut.
Denn du bist der Fachmann, die Fachfrau für deine Interessen. Und du hast ein Recht dazu. Solange deine Forderung sehr vage und unbestimmt ist und du sie nicht als Anspruch formulierst, sondern nur sagst: „Irgendwie finde ich das nicht gut“, dann ist das zwar ein erster Schritt, aber man kann dich und deine Idee sehr leicht beiseiteschieben. In dem Moment, wo du aber sagst: „Ich will das“, oder gar sagst: „Ich habe ein Recht darauf“, wird es schwieriger.
Dabei sollte man sich auch nicht davon irritieren lassen, dass es vielleicht kein explizit festgeschriebenes Recht ist: Rechtsbegriffe ändern sich schließlich. Als sich die Afroamerikanerin Rosa Parks am 1. Dezember 1955 weigerte, ihren Platz im Bus zu räumen, verstieß sie gegen geltendes Recht.
Rosa Parks (1913-2005) lebte in Montgomery, Alabama, einem US-Bundesstaat, in dem die Rassentrennung damals sehr ausgeprägt war. In den Bussen gab es vorn Sitzplätze für Weiße und im hinteren Teil Sitzplätze für Afroamerikaner. Einige Reihen in der Mitte durften von beiden genutzt werden. Allerdings mussten Afroamerikaner die gesamte Reihe räumen, wenn nur ein einziger Weißer in einer dieser Reihen sitzen wollte. Als nun ein Weißer verlangte, dass die Afroamerikaner ihre Plätze räumten, weil er in der Reihe sitzen wollte, standen alle auf – nur Rosa Parks weigerte sich.
Sie wurde wegen Störung der öffentlichen Ruhe verhaftet und verurteilt. Doch gleichzeitig war ihr mutiges Verhalten Ausgangspunkt einer großen Kampagne, die der Bürgerrechtler Martin Luther King organisierte. Die Afroamerikaner forderten ihre Rechte ein: Sie boykottierten den Busbetrieb, bis schließlich die Rassentrennung in Bussen und Bahnen aufgehoben wurde. Es war der Auftakt für die große Bürgerrechtsbewegung der Afroamerikaner in den 1960er-Jahren.
Und so, wie sich damals Rechtsbegriffe änderten (die Rassentrennung ist heute aufgehoben), so ändern sie sich auch heute noch. Inzwischen gibt es zum Beispiel Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, die im Auftrag von Mandanten und Mandantinnen versuchen, den Klimaschutz einzuklagen, weil die bislang bestehenden gesetzlichen Vorgaben nicht ausreichen. Grundlagen dafür sind bestimmte Paragrafen des Grundgesetzes oder der Europäischen Grundrechtecharta. Diese Rechtsauffassung wird nicht von allen Juristen und Juristinnen geteilt, aber sie ist doch gut begründbar. Und setzt sich vielleicht und hoffentlich auch irgendwann durch.
Am 10. Dezember 1948 wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen in Paris die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verkündet. 30 Artikel, der erste lautet: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen.“ Der zweite beschreibt ihre universelle Gültigkeit, dass jeder Mensch Anspruch auf diese Rechte habe, unabhängig von „Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand“.
Liest man die 30 Artikel (man findet sie problemlos im Internet), wird schnell deutlich, dass sie eine prima Richtschnur für das eigene Handeln, das Sich-Einmischen in Politik, das Verbessern unserer Gesellschaft sind. Mit ihnen als Grundlage kann man wenig falsch machen.
Man muss bloß wollen. Sich einmischen, die Welt verändern wollen. Auch wenn es unbequem ist und nicht immer gern gesehen wird. Der Sozialwissenschaftler Harald Welzer sagt in einem Interview mit dem Magazin Galore im Frühjahr 2019, dass „Weltverbesserer“ heute eher ein Schimpfwort ist, ähnlich wie „Gutmensch“. Und weiter:
„Leute, die guten Willens und bereit sind, etwas zu tun, müssen sich ständig dafür rechtfertigen. Wenn Sie jetzt also verkünden würden: ‚Hey, ich will die Welt verbessern, wer macht mit?‘ Dann entgegnet jeder: ‚Du hast doch nicht alle Tassen im Schrank.‘ Die Welt zu verbessern oder ein guter Mensch zu sein – das hat beides einen schlechten Ruf.“
Das ist doch eigentlich ziemlich furchtbar. Es wäre doch besser, wenn wir alle die Gesellschaft verbessern wollten, oder? Wenn wir nicht so frustriert wären, nicht so zynisch oder abgeklärt. Wenn wir den Mut hätten, die Welt zu verändern, eigene Vorstellungen wahr werden zu lassen, statt Witze über die zu machen, die genau diese Energie besitzen. Alles scheint oft so beliebig oder egal. Vielleicht, weil wir zu oft glauben, dass sowieso nichts veränder- und verbesserbar ist, weil wir zu oft gehört haben, dass es keine Alternativen gibt. Vielleicht auch, weil wir uns nicht als verantwortlich für unsere Gesellschaft sehen, weil wir keine Idee haben, wohin sie sich entwickeln soll. Aber:
Noch weniger: Man muss es sich bloß vorstellen können.
Und dann beginnen. Und spüren, dass man Wirkung erzielt.
„Geh mal wieder auf die Straße, geh mal wieder demonstrieren – denn wer nicht mehr versucht zu kämpfen, kann nur verlieren.“
(Die Ärzte)