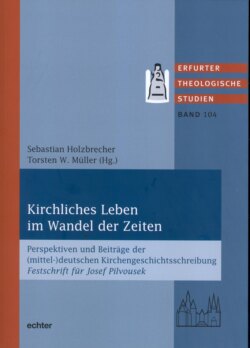Читать книгу Kirchliches Leben im Wandel der Zeiten - Группа авторов - Страница 35
Die strengkirchliche Mobilisierung der Diözese Rottenburg im Spiegel der Statusrelationen von Bischof Paul Wilhelm von Keppler Claus Arnold
ОглавлениеDer Rottenburger Bischof Paul Wilhelm (von) Keppler (1852-1926) ist der Forschung vor allem als prominenter Antimodernist bekannt,1 der sich in seinem Bistum2 durch die Ausmerzung „modernistischer“ Neigungen bei Seminaristen und Professoren hervortat.3 Auch Kepplers episkopaler Stil hob ihn von seinen Vorgängern ab: Er umkleidete sein Amt, das zuvor eher mit der Jovialität schwäbischen Honoratiorentums versehen worden war, mit byzantinisierender Weihe.4 Von sich selbst sprach er in seinen Hirtenbriefen als „der Bischof“. Dennoch dürfen auch die Momente der Kontinuität nicht übersehen werden, die Kepplers Episkopat prägten. So hat Dominik Burkard betont, dass Keppler bei seinen antimodernistischen Eingriffen in die Priesterbildung durchaus an frühere Mahnungen des Rottenburger Ordinariats in Richtung Tübingen anknüpfen konnte („keine Geistesbildung ohne Herzensbildung“), dabei aber nie so weit ging, „die Strukturen der württembergischen Bildungstradition anzutasten“, also die Bedeutung von Wilhelmsstift und Tübinger Fakultät grundsätzlich in Frage zu stellen.5 Die wissenschaftliche Tüchtigkeit des Rottenburger Klerus hatte Keppler schon in seinem Antrittshirtenbrief vom 18. Januar 1899 hervorgehoben.6 Auch in theologischer Hinsicht vermochte Keppler zuweilen durch eine „Tübinger“ Nüchternheit und Christozentrik zu überraschen. So betonte er etwa in seinem Hirtenbrief vom 15. August 1904 zum fünfzigjährigen Jubiläum der Dogmatisierung der unbefleckten Empfängnis Mariens: „Die wahre Marienverehrung muss von Herzen kommen, äußere Werke sind hier ohne Wert und Nutzen, wenn sie nicht vom inneren Geiste getragen werden. Die Andacht zu Maria muss zur treuen Beobachtung der Gebote ihres göttlichen Sohnes führen. Denn wenn wahre Liebe nur diejenige ist, welche die Herzen gleichförmig macht, dann müssen wir bestrebt sein, Christo zu dienen, in gleicher Weise, wie seine heiligste Mutter es getan. Was die weiseste Jungfrau bei der Hochzeit zu Kana zu den Dienern sagte, das sagt sie auch zu uns: ‚Was immer er euch befiehlt, das tuet [Joh 2,5].‘ “7 Und als sich nach dem Ende des württembergischen Staatskirchentums 1918 die Gelegenheit zu einer grundlegenden Revision der Gründungsvorgaben des Bistums, etwa durch eine Verlegung des Bischofssitzes, ergab, optierte Keppler für rottenburgisch-württembergische Kontinuität und begnügte sich damit, den zuvor schon begonnenen Kurs der ultramontanen Mobilisierung der Diözese zu forcieren8.
Vor diesem Hintergrund reizt ein näherer Blick auf Kepplers episkopales Wirken vor 1914, um dieser Mobilisierung weiter nachzuspüren. Das Bistum Rottenburg hatte im 19. Jahrhundert durch die Opposition des Bischofs Carl Joseph von Hefele (1809-1893) auf und nach dem I. Vaticanum,9 die Vermeidung eines Kulturkampfs zwischen Staat und Kirche,10 die durch Hefele gebremste politische Mobilisierung der Katholiken und die vergleichsweise große konfessionelle und religiöse Konzilianz eine gewisse Sonderrolle gespielt. Schon Rudolf Reinhardt und seine Schüler haben aber in ihren maßgeblichen Arbeiten11 betont, dass sich die Koordinaten in den letzten Regierungsjahren Hefeles, vielleicht schon beeinflusst von seinem Koadjutor und Nachfolger Wilhelm Reiser (1835-1898), und dann vollends unter Bischof Keppler, verschoben haben, nachdem durch den frühen Tod des erwählten Bischofs Franz Xaver von Linsenmann (1835-1898) ein konzilianter Amtsinhaber ausgefallen war. Diese langsame Veränderung der kirchlichen Pragmatik im Bistum kann als fortschreitende Ultramontanisierung und Episkopalisierung interpretiert werden. Sie markiert aber auf jeden Fall ein langsames Zurückschwenken des Bistums in den „mainstream“ des deutschen Katholizismus, in dem es am Ende von Kepplers Episkopat fast nahtlos aufgeht.12
Das Bemühen Bischof Kepplers um eine „Normalisierung“ der Diözese Rottenburg im römischen Sinne schlägt sich nicht zuletzt darin nieder, dass er 1902, wie er selbst meinte, erstmals eine ausführliche relatio status an die Kurie sandte. Tatsächlich lag in Rom aber wenigstens eine vorhergehende Relation vor, nämlich der kurze, nur vierseitige Bericht von Bischof Joseph von Lipp (1794-1869) aus dem Jahr 1852.13 Bei seiner Visitatio Liminum 1906 musste Keppler allerdings feststellen, dass sein umfassender Bericht über den Zustand der Diözese im römischen Geschäftsgang verloren gegangen war, weshalb er am 7. Juni 1907 ein „Update“ der Fassung von 1902 einreichte, das 27 maschinenschriftliche Seiten umfasste.14 Zusammen mit dem kurzen Bericht von 1909 und der weiteren ausführlichen Relation von 191315 verrät Kepplers Rechenschaft natürlich primär etwas über seine eigene Wahrnehmung der Diözese und die anliegenden pastoralen Aufgaben; sie kann aber auch in kritischer Betrachtung als Ausgangspunkt für unsere Frage nach der Mobilisierung der Diözese unter Keppler dienen.
Expansion des Bistums und Bautätigkeit
Im weltkirchlichen Vergleich hatte das Bistum bis 1913 beachtliche Ausmaße angenommen. Es umfasste 739.995 Katholiken (bei 1.671.183 Protestanten, 11.982 Juden und 14.414 Sonstigen in Württemberg), davon 1.227 Priester, 30 Alumnen im Rottenburger Priesterseminar und 150 im Wilhelmsstift. Im Reich lag es damit unter den 30 Sprengeln an 13. Stelle.16 Die 695 Pfarreien und 40 Quasipfarreien, die in der Größe zwischen 11.000 und 130 Seelen variierten, waren in 29 Dekanaten zusammengefasst und verfügten neben dem Dom über 783 Kirchen, 642 Filialkirchen und 415 Oratorien. Da viele Pfarreien, zumal in den Städten, groß waren, wies Rottenburg mit 166 Kaplänen und 145 Vikaren eine relativ hohe Zahl von Hilfsgeistlichen auf.
Keppler versäumte nicht, die Expansion des Bistums hervorzuheben: Seit 1850 seien nicht weniger als 80 Kirchen und Oratorien in den Diasporagebieten neu erbaut worden und seit 1870 50 neue Kirchen in Städten, die schon vorher eine Pfarrei besessen hatten. Vor allem sein Vorgänger Reiser habe Großes in der Sorge für die Diasporakatholiken geleistet, der Bonifatiusverein und die Freigebigkeit der Gläubigen des Bistums hatten das Ihre beigetragen. Im Geiste des Historismus favorisierten die Bischöfe von Hefele bis Keppler dabei die Neuromanik und Neugotik. Unter Keppler kamen aber auch Bauten und Gestaltungen im Geiste des Neubarock bzw. Neoklassizismus oder im „Beuroner Stil“ zur Ausführung. So ließ Keppler, der sich 1901 die Burg Straßberg zur Sommerresidenz erwählt hatte, dort 1906 eine Kapelle einbauen und sie 1908 – natürlich – im Beuroner Stil ausmalen.
Gottesdienst und Pastoral
Interessant sind Kepplers Aussagen im Hinblick auf das gottesdienstliche Leben der Diözese. Sie sind vor dem Hintergrund der „Reformen“ Papst Pius’ X. (1903-1914) zu sehen, der nicht nur erstmals den Gedanken der actuosa participatio der Gläubigen formulierte und den gregorianischen Choral zu liturgischen Norm erhob (1903), sondern auch den häufigeren Sakramentenempfang propagierte (1905) und die Frühkommunion ermöglichte (1910). Keppler schrieb deshalb ganz ad mentem des Papstes, wenn er in der Relation von 1913 vermerken konnte: „Die Häufigkeit des Sakramentenempfangs steigt von Jahr zu Jahr, zumal seit das neue Dekret über die Kommunion ergangen ist. Es werden nun alle Kinder, wenn sie 11 oder 12 Jahre alt sind [zuvor mit 13 Jahren], auf die Kommunion vorbereitet und treten, solange sie die Schule besuchen, sechs Mal jährlich alle gemeinsam an den Tisch des Herrn heran, einzelne von ihnen auch öfter, viele jeden Sonntag. Das weibliche Geschlecht frequentiert die Sakramente mit größerem Eifer; der Eifer der Männer wird nach und nach zu erwecken und zu vermehren sein.“17 Tatsächlich hatte Keppler das Thema des häufigeren Sakramentenempfanges für 1908 als Konferenzarbeitsthema ausgeschrieben und im „Generalbescheid auf die Conferenzarbeiten“ vom 7. September 1909 dem Klerus sehr ausführlich die Methoden zur Intensivierung des sakramentalen Lebens nahegebracht: Zykluspredigten, eucharistische Triduen, Volksmissionen, Exerzitien, die Ansprachen bei den Kasualien, die Katechese im Religionsunterricht, die Seelenführung im Beichtstuhl, Generalkommunionen der einzelnen Stände – all das sollte im Sinne Pius’ X. zusammenwirken.18 Zugleich drängte Keppler auch auf eine vorsichtige Vermeidung der Andachtsbeichte hin: Wer täglich kommuniziere, können alle Ablässe auch bei bloß vierzehntägiger Beichte gewinnen.19 Der Bischof betonte auch seine Bemühungen um den gregorianischen Choral in der Messfeier und die entsprechende Abdrängung der volkssprachlichen Lieder in die Andachten.20 Eine Ausnahme stellten nur die Rorate-Messen im Advent dar, „bei denen die Gläubigen religiöse Gesänge in der Volkssprache mit höchster Hingabe und Leidenschaft singen. Diese Gewohnheit könnte nur mit sehr großem Schaden eliminiert werden; es stünde nämlich zu befürchten, dass die Gläubigen in schwerer Empörung jenen bislang sehr gut besuchten Messen fortan fernbleiben würden“21. Noch in einem zweiten Punkt wich die Diözese von der römischen Norm ab: Bei der Firmung, die nur vom Bischof allein bei seinen Reisen im Fünfjahresturnus durch die Diözese gespendet wurde, war von Kepplers Vorgängern das Amt des Firmpaten abgeschafft worden. Die materialistischen Erwartungen der Kinder an die Paten hätten das Amt lästig gemacht, es sei früher zu großen Festmählern mit Skandalen gekommen. Außerdem sei bei der großen Zahl der Firmlinge für die Paten oft kein Platz mehr in der Kirche. Ohne die Paten laufe der Gottesdienst ohnehin würdiger ab und es gebe keinen Alkoholmissbrauch. (Nach dem Ersten Weltkrieg führte Keppler das Patenamt dann auf römisches Drängen hin wieder ein und konnte in der Relation von 1923 Vollzug melden.22)
Das Thema des Alkoholismus lag Keppler besonders am Herzen. Ihm widmete er 1907 einen speziellen Hirtenbrief, in dem er in scharfer Form vor allem den Schutz der Kinder vor Alkohol anmahnte und betonte, dass alle kirchlichen Vereine zugleich Mäßigkeitsvereine sein sollten.23 Kepplers kulturpessimistische Grundhaltung zeigte sich auch in seiner Einschätzung, dass auf dem Land die guten Sitten, das einfache, arbeitsame Leben, der feste Glaube und ein ehrlicher Eifer für die Religion herrschten, während in den Städten, vor allem den größeren, aufgrund der Ansteckung und dem Streben nach einem schickeren Leben, der Alkoholismus, die Genusssucht und von daher die Auflösung und Zersetzung des Familienlebens grassierten.24 In diesen Kontext gehörte auch die Frage der Mischehen.25 Keppler zählte von 1896 bis 1905 insgesamt 40.423 rein katholische Ehen und 8.696 Mischehen, von letzteren 4.525 mit kirchlicher Billigung (also mit katholischer Kindererziehung) und 4.170 ohne Einhaltung der kirchlichen Bedingungen. Hinzu kamen noch 915 rein standesamtliche Eheschließungen. Keppler beteuerte aber, dass der Kampf gegen die Mischehen geführt werde.26
Orden und Kongregationen
Insgesamt lobt der Bischof aber die außergewöhnliche Spendenbereitschaft und den religiösen Eifer der Diözesanen. Dieser zeige sich vor allem auch bei den Volksmissionen, die in großer Zahl von der Regierung erlaubt und von Benediktinern, Redemptoristen, Franziskanern, Kapuzinern und Jesuiten durchgeführt würden. Kepplers besondere Vorliebe für Beuron tritt hervor, wenn er betont, dass gerade die dortigen Benediktiner diesen Eifer bestätigten. Denn nach dem nahegelegenen Beuron pilgerten im Übrigen viele Tausend Diözesanen, und die Patres würden gerne als Beichtväter in die Pfarreien geholt. Insofern gab es, trotz der von Keppler ebenfalls ausführlich beklagten hysterischen Gegnerschaft der Protestanten zur Einführung von Männerorden (nescio quo furore correpti timore paene tabescant, quandocunque hujus rei mentio fit)27, eine nicht zu vernachlässigende Präsenz von Regularklerikern in der Diözese. Eine Frucht davon sei der große Ordensnachwuchs aus der Diözese, nicht nur bei den Frauenkongregationen im Bistum, sondern auch in vielen Ländern außerhalb – gerade letzteres Faktum bedürfte der weiteren Erhellung. Aufgrund der Forschungen von Klaus Schatz kann wenigstens für den Bereich des Jesuitenordens eine quantitative Angabe gemacht werden. Im Zeitraum von 1849 bis 1914 sind 122 Württemberger als Scholastikernovizen in die Gesellschaft Jesu eingetreten (einschließlich derer, die als Novizen wieder weggingen). Der Anteil der Württemberger war im ersten Zeitraum (von 1849 bis 1872) außergewöhnlich hoch: mit 63 Eintritten (9,4% aller Eintritte in den beiden Scholastikaten) lag Württemberg im süddeutschen Raum an der Spitze, vor Bayern und Baden. Dieser Anteil schwächt sich in den folgenden Perioden ab: 1873-95 sind es 34 (5,1%, bereits hinter Bayern), 1896-1914 25 (3,8%), was angesichts der Größe der Diözese aber immer noch eine Überrepräsentierung darstellt. Was die Brüdernovizen angeht, so erlaubt die lückenhafte Quellenlage keine exakte Angabe: Man kann nur sagen, dass 1852-72 mindestens 15 und 1873-95 27 eingetreten sind. Generell ist bei den Brüdernovizen der süddeutsche Raum noch schwächer repräsentiert als bei den Scholastikernovizen; aber innerhalb des süddeutschen Raumes scheint Württemberg auch hier stark überrepräsentiert zu sein.28 Mit dem aus Rottweil gebürtigen Kanonisten Franz Xaver Wernz (1842-1914), der 1906 zum General des Ordens gewählt wurde, und dem aus Isny stammenden Theologiehistoriker Franz Ehrle, der von 1895 bis 1914 Präfekt der Vatikanischen Bibliothek war und 1922 zum Kardinal erhoben wurde, hat die Diözese auch zwei prominente Jesuiten hervorgebracht.
Wesentlich breitenwirksamer waren hingegen die „barmherzigen Schwestern“, also die Frauen-Kongregationen im Bistum. Die neuere Forschung hat sich ausführlich mit ihrem „Catholicisme au féminin“ (Claude Langlois) beschäftigt;29 sie boten jungen Katholikinnen ein geistlich-berufliches Feld außerhalb von Ehe und Familie und können in ihrer Bedeutung für die Sozialfürsorge, Krankenpflege, Kinderpflege und -erziehung (in Krippen und Kindergärten) sowie für die Mädchenbildung kaum überschätzt werden. Insbesondere die Herausbildung des modernen Krankenhauswesens, wie es im Bistum exemplarisch durch das 1890 von den Untermarchtaler Vinzentinerinnen gegründete Stuttgarter Marienhospital verkörpert wird, wäre ohne die Hingabe und Professionalität der Schwestern nicht denkbar gewesen. Eine besondere Rolle spielten sie auch in den „Pfleg- und Bewahr-Anstalten“, also der Fürsorge für behinderte Menschen, wie sie ebenfalls von den Vinzentinerinnen in Rottenmünster (seit 1898) oder unter Mitwirkung der Reutener Franziskanerinnen in Liebenau verwirklicht wurde. Die Franziskanerinnen von Sießen widmeten sich dagegen besonders dem Bildungswesen mit Schulen in Stuttgart (1875), Mergentheim (1879), Friedrichshafen (1897), Rottenburg (1898) und Ellwangen (1895). Mit ihren zahlreichen Niederlassungen prägten die Schwestern die Diözese und ihre Pfarreien auch in der Breite. Im Jahr 1913 hatten die 1.085 Untermarchtaler Schwestern neben dem Mutterhaus 132 Niederlassungen, die 750 Reutener Franziskanerinnen 115, die 375 Sießener Franziskanerinnen 33. Hinzu kamen die Franziskanerinnen von Bonlanden (110 Schwestern) und Heiligenbronn (186 Schwestern) sowie die Notre-Dame-Schulschwestern in Ravensburg (74).30 Auch Bischof Keppler konnte mit großer Befriedigung auf die diözesanen Kongregationen blicken, die er auf seinen Firmreisen oft besuche: „Daher kann ich aus eigener Erfahrung bezeugen, dass für die in den Hospitälern und Einrichtungen der Sorge dieser Schwestern Anvertrauten in allen Dingen bestens gesorgt ist, die zum Heil des Körpers und der Seele notwendig sind.“31 Erfreut war Keppler auch über die Regeltreue in den Kongregationen, die jeweils ihren eigenen Superior und Beichtvater hatten.32
Priester und Priesterbildung
Mit einer gewissen Befriedigung konnte Keppler auch auf den Klerus des Bistums blicken. Nachwuchsmangel herrschte nicht: „Da in allen Teilen der Diözese der Zugang zu den höheren Studien leicht offensteht, steht immer die nötige Anzahl von gesitteten Knaben zur Verfügung, die zum Priestertum der heiligen Kirche hinstreben können.“33 Auffällig in seinem Bericht nach Rom ist, wie Keppler einerseits die Rottenburger Tradition der Priesterbildung bejaht, andererseits aber immer fest das römische Anforderungsprofil mit dem Ideal „Tridentinisches Seminar“ im Auge hat.34 Im Bereich der Knabenseminare konnte Keppler auf das Bischöfliche Knabenseminar (Martinushaus) in Rottenburg und das Seminar in Mergentheim verweisen. Daneben bestanden in Ehingen (Josephinum) und Ellwangen (Borromäum) private, von Priestern geleitete Gymnasialkonvikte. Hinzu kamen Lateinschulen in anderen Städten, welche die Schüler ebenfalls auf das sogenannte Landexamen vorbereiteten, das mit 14 Jahren als landesweiter Konkurs durchgeführt wurde und den Weg zu den niederen Konvikten in Ehingen und Rottweil ebnete. Jedes Konvikt hatte ca. 80 Alumnen im Alter von 14 bis 18 Jahren, die zwar am örtlichen öffentlichen Gymnasium studierten, wo aber auch geistliche Studienräte unterrichteten. Laudes und Vesper im Oratorium, tägliche Heilige Messe sowie gemeinsamer Sakramentenempfang gewährleisteten nach Kepplers Ansicht das „tridentinische“ Profil. Ähnliches galt für das Wilhelmsstift, in das man nach einem weiteren rigorosen Examen gelangen konnte. Auch dort gebe es täglich gemeinsames Stundengebet und Heilige Messe, jährliche Exerzitien, eine samstägliche Exhorte und die Teilnahme am sonntäglichen Gottesdienst in der Pfarrkirche (St. Johannes). Im Hinblick auf das römische Ideal der weltfernen Priesterbildung bat Keppler um Verständnis dafür, dass den Konviktoren Ausgang erlaubt werden müsse, denn das Haus sei eng. Auch die Vorlesungen könnten leider nicht alle im Haus stattfinden.
Mit hymnischen Worten pries Keppler sodann die Tübinger Fakultät: Diese habe von Anfang an die theologische Wissenschaft zur Spitze der Vollkommenheit bringen wollen. Überall auf der Welt würden noch die Namen von Möhler, Hefele und Kuhn gefeiert, die Theologische Quartalschrift werde von allen Theologen in hohen Ehren gehalten. Obwohl sie sich an einem schwierigen Ort befinde, habe sie doch immer die Rechte der Kirche verteidigt und sei auch dem Apostolischen Stuhl immer treu anhänglich gewesen, auch wenn es in der Vergangenheit bei manchen und bei manchen Aussagen an der klugen Zurückhaltung gemangelt habe. Keppler, der wie kein anderer Rottenburger Bischof seinem Stolz auf das Wilhelmsstift und die Fakultät Ausdruck zu verleihen vermochte,35 umschiffte also die Krise des I. Vaticanums und die nachfolgende Sterilisierung der Fakultät mit sehr großzügigen Worten. Dies war angesichts des Misstrauens, das auch noch um 1900 in Rom gegenüber den theologischen Universitätsfakultäten, und speziell gegenüber Tübingen, bestand, nicht erstaunlich.36 Eine differenzierte Wahrnehmung offenbart denn auch Kepplers Würdigung der jüngst verstorbenen Professoren der Fakultät: Dem Apologeten Paul von Schanz (1841-1905), der durchaus eine gewisse Offenheit für moderne Fragestellungen an den Tag legen konnte,37 bescheinigte Keppler ein sentire cum ecclesia. Auf Schanz’ Rat hatte er sich ganz gestützt, als 1899 und 1901 in Rom Denunziationen gegen Tübingen gelaufen waren.38 An dem Alttestamentler Paul Vetter (1850-1906) pries Keppler die Gelehrsamkeit, während der kritische Kirchenhistoriker Franz Xaver Funk (1840-1907), dessen Name noch heute eine Rolle in der Wissenschaft spielt,39 eine sehr nüchterne Würdigung erfuhr: Funk habe sich zwar durch die Integrität seines Charakters ausgezeichnet, habe aber durch seine freiere Denkungsart dem Bischof nicht wenig Sorge bereitet. In den letzten Jahren habe er sich aber zurückgehalten. In seinen Vorlesungen habe er den Hörern freilich weder geschadet noch genutzt. Er vermochte es nicht, sie zur Liebe zur Heiligen Kirche und zum Priestertum zu entflammen.40 – Tatsächlich war Funk am Ende seines Lebens verbittert über die Verdächtigungen, denen er von römischer Seite ausgesetzt gewesen war. Das Verbot der italienischen Übersetzung seines bekannten Lehrbuchs der Kirchengeschichte durch die Konsistorialkongregation (1912) musste er nicht mehr erleben. Seine Beurteilung durch Keppler zeigt, dass dem Bischof letztlich eine eng verstandene Kirchlichkeit vor Wissenschaftlichkeit ging. Mit der Fakultät, wie sie sich 1907 darstellte, war Keppler aber sehr zufrieden: Der Neutestamentler Johannes (von) Belser (1850-1916), der Kanonist Johannes Baptist Sägmüller (1860-1942)41, der Dogmatiker Wilhelm Koch (1874-1955), der patristische und scholastische Philosoph Ludwig Baur (1871-1943), den Keppler 1903 gegen den Funk-Schüler Hugo Koch (1869-1940)42 durchgesetzt hatte,43 und der Alttestamentler Paul Rießler (1865-1935) – sie alle seien kirchlich und gut sowie weit entfernt von jedem Verdacht auf Liberalismus und Neologismus; von den böswilligen Protestanten werden sie mit dem Prädikat des „Ulramontanismus“ geehrt und verachtet. Nur der Moraltheologe Anton Koch (1859-1915) – ein Schüler Linsenmanns, der mit Funk zusammen die „liberale Partei“ in der Fakultät gebildet hatte – habe einen gewissen Verdacht des Laxismus und Liberalismus auf sich gezogen, weniger wegen seiner Lehre als wegen seines Lebenswandels. Außerdem sei er früher mit den bayerischen Reformkatholiken verbunden gewesen; doch habe er sich in den letzten Jahren gebessert.44 Keppler konnte damit in Rom eine strengkirchlich durchsanierte Tübinger Fakultät präsentieren; die späteren Konflikte um Wilhelm Koch waren noch nicht abzusehen.45
Im Blick auf das Priesterseminar in Rottenburg, das unter Regens Benedikt Rieg (1858-1941), dem Schüler, Freund und Nachfolger Stiegeles, ohnehin ganz im strengkirchlichen Sinne geprägt war, brauchte Keppler nicht viel zu sagen. Die Seminarausbildung dauere aber leider nur ein Jahr (nicht zwei, wie von Rom vorgesehen), weil die Regierung nicht mehr bezahle. Bei diesem Punkt sowie in der Ordensfrage regte der römische Rezess dann auch an, Keppler solle vorsichtig versuchen, eine Änderung zu erreichen.46 Mit einer gewissen Befriedigung konnte Keppler vermerken, dass sich außerhalb von Tübingen mit seinen 150 Wilhelmsstiftlern und einigen zusätzlichen Stadtstudenten und Rottenburg mit den 30 Alumnen des Seminars keine Priesteramtskandidaten für den Dienst im Bistum vorbereiteten. Nicht im Blick hatte Keppler dabei die große Zahl von Rottenburgern, die in andere Diözesen, vor allem nach Augsburg, ausliefen – vielleicht weil sie die Entbehrungen und Anforderungen einer württembergischen Konviktslaufbahn scheuten. Zeitweise stammte ein Drittel des Augsburger Klerus aus Rottenburg.47
Mit seinem Klerus war Keppler auch sonst zufrieden. Außerhalb der Kirche, der kirchlichen Funktionen und Schule werde keine Soutane, sondern ein angemessener schwarzer Anzug getragen, wobei es keine Skandale oder Redereien gebe. Lobend hob Keppler auch die Fortbildung des Klerus bei den (aus der Zeit der Wessenberg’schen Pastoralreform herkommenden) Kapitelskonferenzen hervor, zu denen sich der Klerus des Dekanats zwei Mal im Jahr traf. Im Vorfeld stellten die Dekane Themen aus der Dogmatik, Moraltheologie, Liturgiewissenschaft, Pastoraltheologie, dem Kirchenrecht und der Exegese, die von den Pfarrern, Kaplänen und Vikaren schriftlich zu bearbeiten seien und auf der Konferenz dann diskutiert würden. Die Akten gingen dann an das Ordinariat, das die Autoren entsprechend lobe oder tadele. Daneben verwies Keppler auf die freien Kapitelskonferenzen, auf denen aktuelle pastorale Themen besprochen werden konnten. Eine richtige Synode sei seit Beginn der Diözese nie gehalten worden; aber Keppler habe stattdessen die zweijährlich stattfindende Dekanekonferenz eingeführt. Diese wurde 1909 noch erweitert, indem Keppler es jedem Kapitel erlaubte, einen zusätzlichen gewählten Delegierten zu der Konferenz zu entsenden.48
Bei der großen Zahl an Priestern hatte Keppler nur von relativ wenigen „schwarzen Schafen“ zu berichten. „Skandale gibt es sehr selten und wenn sie geschehen, werden sie streng bestraft.“49 Ausführlicher schreibt er 1913, dass er in den vergangenen Jahren gegen einen Priester wegen Trunkenheit und gegen vier weitere wegen Keuschheits-Delikten habe vorgehen müssen. Zwei von ihnen mussten die Diözese verlassen, zwei verloren ihr Benefizium und wurden nach einer Bußzeit mit einer weniger bedeutenden Stelle versehen. Gefallene Priester schickte Keppler zu Exerzitien in ein Kloster. Der Skandal in der Pfarrei werde durch sofortige Entfernung und die Sendung eines guten Nachfolgers repariert.50 Etwas bewegter war dann offenbar der Fünfjahreszeitraum von 1913 bis 1918, nicht zuletzt wegen des Krieges. Keppler berichtet, dass er, um einen Skandal zu vermeiden, einen Pfarrer wegen unsittlicher Gespräche und Berührung von Frauen sowie wegen Trunkenheit zur Resignation auf seine Stelle gedrängt habe. Er sei nach der Pensionierung dann bald gestorben. Ein anderer Pfarrer habe mit einer jungen Frau ein Kind gezeugt, habe die Stelle dann verlassen, sich im Krieg bewährt und erhalte nunmehr eine neue Stelle. Zwei Pfarrer hatten Verhältnisse mit Frauen, deren Männer im Krieg waren. Einer von ihnen sei suspendiert und zum Sanitätsdienst eingezogen worden, der andere habe seine Stelle aufgegeben und sich auf Dauer in ein Kloster zurückgezogen. Ein weiterer Pfarrer habe seinen guten Ruf verloren, sei aber, da die Regierung eine Pensionierung verweigert habe, nach Ablauf eines Jahres auf eine andere Stelle versetzt worden. Schließlich hätten zwei Priester schwer gegen das sechste Gebot gesündigt. Da ihr Verbrechen aber geheim geblieben sei, seien ihnen nach einer Bußzeit andere Stellen bzw. Aufgaben übertragen worden. Hier muss aufgrund der Ausdrucksweise von Keppler offenbleiben, wobei genau es sich bei dem sexuellen „crimen“ gehandelt hat.51 Die Relation von 1913 weist übrigens ausdrücklich – aber in einem anderen Kontext – darauf hin, dass der Bischof den geheimen Teil der Dokumente bei sich aufbewahrt; insofern sind die Statusrelationen der wohl einzige historische Anweg zu diesem Thema.52
Wenn die württembergische Regierung auch nicht alle seine Pensionierungswünsche erfüllte, so konnte Keppler 1913 immerhin nach Rom melden, dass sich die Besoldungssituation für die Geistlichen beträchtlich verbessert hätte: Seit 1911 sei eine altersabhängige Progression eingeführt worden, so dass Pfarrer neun Jahre nach der Ordination 2.500 Mark pro Jahr erhielten, nach 27 Jahren 3.800 Mark, Kapläne stiegen entsprechend von 2.000 auf 2.800 Mark. Für die Besetzung der Pfarrstellen wurde im Übrigen keine Einzelausschreibung vorgenommen, sondern zweimal jährlich ein allgemeiner Konkurs durchgeführt. Die Domkapitulare erhielten je nach Alter zwischen 5.400 und 6.200 Mark, der Domdekan 7.200 Mark, ein Domvikar 4.000 Mark. Damit lag das Kapitel deutlich über den Bezügen eines damaligen Universitätsprofessors, dem jährlich ca. 3.500 Mark sowie Zusatzleistungen von ca. 1.200 Mark zustanden. Da das Domkapitel zugleich das Bischöfliche Ordinariat bildete,53 war die Besoldung durchaus angemessen. Die hohe Arbeitsbelastung durch die Amtsgeschäfte halte das Kapitel auch davon ab, wie Keppler der Kurie ausführlich darlegte, seine Chorpflichten zu erfüllen. Nur an den Sonn- und Feiertagen versammele es sich zu Laudes, Messe und Vesper sowie im Triduum sacrum zu Matutin und Laudes. Hinzu kämen die marianischen Andachten im Mai und die Rosenkranzandachten im Oktober.
Das Verhältnis zu Regierung und Verwaltung, die politische Mobilisierung der Katholiken
Im 1907 erstellten „Update“ der Relation von 1902 zeichnet Keppler ein relativ idyllisches Bild von der staatskirchenrechtlichen Situation. Das Staatskirchenregiment sei gemildert; es gebe zum Beispiel kein Placetum regium mehr. Der Einfluss der Regierung sei aber groß bei der Verwaltung der kirchlichen Güter, die frommen Stiftungen und die Kongregationen würden ängstlich überwacht, keine Orden erlaubt; zudem bestehe für die Mehrzahl der Benefizien das königliche Patronat. Dies sei aber alles kein großes Problem, da der Katholische Kirchenrat als staatliche Mittelbehörde (bestehend aus zwei Priestern und vier Laien) dem Bischof ergeben sei und seinem Vorschlag folge. Hierbei hatte Keppler wohl vor allem seinen Freund Richard Wahl (*1854) vor Augen, der allerdings schon 1906 gestorben war, sowie den geistlichen Kirchenrat Eduard Vogt (1865-1923).54 Die optimistische Einschätzung Kepplers wurde allerdings bald Lügen gestraft, als der Kirchenrat 1908 nach der Publikation der Enzyklika „Pascendi“ durch Keppler auf das vorher eigentlich nötige Plazet zurückkam. Ähnliche Kontroversen gab es dann noch bei anderen Gelegenheiten bis 1918.55 Sehr enttäuscht war Keppler auch über die 1909 verabschiedete Schulnovelle, welche zwar am konfessionellen Charakter der Volksschule festhielt, aber die geistliche Orts- und Bezirksschulaufsicht abschaffte und in den Mittelschulen die Simultanschule zuließ.56 Für Keppler führte der Weg von der Simultanschule zuerst zur religionslosen und dann zur religionsfeindlichen Schule. Diese politische Niederlage stellte auch den wesentlichen Gehalt seiner kurzen Zwischenrelation von Ende 1909 nach Rom dar.57 1913 resümierte er dann sehr trocken: „Der württembergische König protestantischer Konfession [Wilhelm II.] ist gerecht und wohlwollend dem Bischof gegenüber. Es ist oft schwierig, gegen die Regierung und die Verwaltungsbeamten, die fast alle Akatholiken sind, die Rechte der Kirche und des Bischofs geltend zu machen. Wir sind den menschlichen Gewalten gegenüber frei von der Schuld knechtlicher Gesinnung.“58
Es ist wenig verwunderlich, wenn Bischof Keppler vor diesem Hintergrund die politische Mobilisierung der Katholiken in seinem Bistum als Mittel zur Durchsetzung kirchlicher Interessen und die Zentrumspartei als Transmissionsriemen dafür verstand. Auch die neuere Forschung tendiert dazu, die späte Gründung der Zentrumspartei in Württemberg weniger auf die wirtschaftliche Unzufriedenheit in den agrarisch geprägten katholischen Oberämtern zurückzuführen,59 sondern sie als Konfessionalisierung der württembergischen Landespolitik zu verstehen.60 „Meine Herren! Kutten und Kinder haben uns zusammengeführt, dass wir das württembergische Zentrum gebildet haben“61, so rief der Priester und Schriftleiter des „Deutschen Volksblattes“ Joseph Eckard (1865-1906) 1895 bei der ersten Landesversammlung des württembergischen Zentrums in Ravensburg aus. Kutten und Kinder, die Ordensfrage62 und das konfessionelle Schulwesen standen auch für Keppler im Mittelpunkt des Interesses. Scharfsinnig erkannte Keppler dabei die Vorfeldfunktion des katholischen Vereinswesens, das sich schon beim ersten Württembergischen Katholikentag in Ulm 1890 in der Ordensfrage deutlich zu Wort gemeldet hatte,63 und insbesondere des ebenfalls 1890 gegründeten Volksvereins für das Katholische Deutschland: „Es ist am meisten den männlichen Sodalitäten und insbesondere der großen, ,Volksverein‘ genannten Vereinigung zuzuschreiben, dass die katholischen Männer so in den politischen Dingen versiert und diszipliniert sind, dass wir ihnen bei den politischen und bürgerlichen Wahlen gänzlich vertrauen können; sie geben ihre Stimmen nämlich für die Kandidaten des ‚Zentrums‘ ab. Daher kommt es, dass obwohl die Katholiken im Königreich an Zahl unterlegen sind, dennoch das ,Katholische Zentrum‘ unter den politischen Parteien seiner Aufgabe mit großem Gewicht nachkommen kann.“64 Im Gegensatz zum Zentrum hatte der Volksverein im Bistum bereits unter Hefele mit starker Unterstützung des Bischofs eingeführt werden können, weil Hefele in ihm ein Mittel zur Bekämpfung der socialistischen Irrtümer der Gegenwart erblickte.65 Die so ermöglichte späte Mobilisierung war umso eindrucksvoller. „Der Eifer der schwäbischen Katholiken für den neuen Verein unter der Führung Adolf Gröbers [1854-1919]66 katapultierte ihn – mit Ende 1891 schon rund 13.000 Mitgliedern – an den Platz der drittgrößten Landessektion überhaupt; größer war der Erfolg nur im Rheinland und in Westfalen. Und wenige Jahre später (1897) war die württembergische Sektion mit über 21000 Mitgliedern fast exakt doppelt so groß wie die badische.“67 Mit dem Juristen Gröber hatte das württembergische Zentrum zugleich eine angesehene Führungspersönlichkeit, die 1917 sogar die Führung der Zentrumsfraktion im Reichstag übernehmen konnte. Neben Gröber brachte es vor allem auch der Zentrumspolitiker Matthias Erzberger zu reichsweiter Bekanntheit.
Nachdem die Verfassungsreform von 1906 die strukturelle adlig-katholische Mehrheit in der Ersten Kammer und die ständische kirchliche Vertretung in der Zweiten Kammer beseitigt hatte,68 war das Wirken des Zentrums in der Zweiten Kammer umso wichtiger geworden. In seinem Lob wurde Keppler hier 1907 geradezu lyrisch: „Und freilich tun sich die Führer dieser Fraktion nicht nur durch Weisheit, sondern auch durch ihre Tugenden vor den anderen hervor; mit solchem Mut und solchem Eifer verteidigen sie die katholische Sache, dass schon die Regierung selbst, die anfangs wenigstens ein genügend großes Misstrauen dem Zentrum gegenüber vor sich hertrug, nicht anders kann, als es zu achten. Es besteht kein Zweifel, dass durch die unermüdlichen Mühen dieser Männer die Rechte der Kirche viel mehr als zuvor gewahrt werden und in hohem Maße gehindert wird, dass gegen die Kirche ungerechte Gesetze verabschiedet werden. Sicherlich haben freilich aus diesem Grund die gehässigen Ausfälle der Protestanten gegen uns so zugenommen, dass sie in der Verleumdung, der ungerechten Behandlung und der feindlichen Verfolgung uns gegenüber schon mit den Sozialisten wetteifern.“69 Wenn Kepplers Vertrauen auf die Wirksamkeit des Zentrums sich auch vor 1918 nur sehr bedingt erfüllen sollte, so bleibt doch seine Identifikation mit dieser in Württemberg immerhin laikal geführten Partei bemerkenswert. Hier lag auch ein gewisser Unterschied zu dem von ihm sonst verehrten Papst Pius X., der die politisch-gesellschaftliche Aktivität von Laien immer unter geistlicher Aufsicht sehen wollte. Obwohl Keppler im Gewerkschaftsstreit um die interkonfessionellen christlichen Gewerkschaften zunächst äußerste Zurückhaltung geübt70 bzw. als Gegner derselben gegolten hatte – Fürstbischof Adolf Bertram von Breslau (1859-1945) schrieb vor seiner Verteidigung der christlichen Gewerkschaften auf der Fuldaer Bischofskonferenz 1912, er hoffe, dass mir, falls ich meinen Platz wieder neben Paul Wilhelm [Keppler] bekomme, der Humor nicht ausgeht71 –, so stellte sich der Rottenburger Bischof ab 1913 öffentlich hinter die christliche Gewerkschaftsbewegung.72 Schon 1902 hatte er eine relativ „demokratische“ Satzung für den Diözesanverband der Arbeitervereine genehmigt.73 Kurz gesagt: Keppler war sicher ein Antimodernist, aber nicht unbedingt ein Integralist. Entsprechend dankte Keppler in seiner Relation von 1913 dem Papst für die mühsam erreichte Duldung der christlichen Gewerkschaften in der Enzyklika Singulari quadam von 1912. Die Einbeziehung der Arbeitervereine in die gemischten Gewerkschaften sei nötig gewesen, damit auch ein Erfolg im Einsatz um mehr Lohn errungen und so den Sozialisten das Wasser abgegraben werden könne. Die katholischen Arbeiter könnten dort zugleich sittliches Vorbild sein. Die Arbeitervereine an sich entsprächen aber ganz den römischen Vorgaben.74
Die katholische Presse in Württemberg
„In keinem Land unternahmen die Katholiken halbherzigere Anstrengungen für das Wachstum ihrer Presse (zwischen 1865-1912 ‚nur‘ 87%).“75 Doch auch hier intensivierten sich ab den 1890er Jahren die Bemühungen. Bischof Keppler konnte dann 1913 insgesamt dreißig katholische Tageszeitungen nach Rom melden.76 Unter ihnen ragte das bereits 1848 gegründete „Deutsche Volksblatt“ in Stuttgart heraus, in dessen Verlag auch das „Katholische Sonntagsblatt“ erschien. Volksblatt und Sonntagsblatt konnten 1891 auf Landesebene eine Quasi-Monopolstellung erreichen, indem die AG Deutsches Volksblatt die ultramontanen „Donzdorfer“ Gegengründungen „[Anzeiger vom] Ipf“ und „Katholisches Wochenblatt“ aufkaufte.77 Auch bezüglich des Volksblattes wurde 1876 ein kurzer Richtungsstreit ausgefochten: Nachdem das Blatt in die Hand des katholischen Demokraten und späteren Zentrumsmannes Rudolf Probst (1817-1899) und seines Schwagers Karl von Streich (1826-1917) gekommen war, befürchtete Bischof Hefele eine zu große Annäherung an die demokratische Volkspartei, die damals in Württemberg von vielen Katholiken gewählt wurde.78 Ab 1877 lenkte der neue Schriftleiter Konrad Kümmel (1848-1936)79 das Blatt aber ganz im Sinne Hefeles wieder mehr in die Richtung der regierenden konservativen Landespartei. Nach Hefeles Tod konnte Kümmel dann durch das Volksblatt zur Gründung des Zentrums in Württemberg beitragen. Kümmel überließ dem schon oben genannten Joseph Eckard 1895 die Schriftleitung des Volksblattes, an der von 1896 bis 1903 auch Matthias Erzberger mitwirkte. Das Volksblatt war damit zum typischen Zentrumsblatt geworden. Kümmel widmete sich nun ganz dem Sonntagsblatt80, das zwar politisch auch eindeutig positioniert war, aber eher in mentalitätsgeschichtlicher Hinsicht interessant ist. Ähnlich wie die Haus- und Volkskalender81 wollte das Volksblatt durch erbauliche Erzählungen Unterhaltung und religiöse Bildung miteinander verbinden. Den Lesern wurde dabei indirekt oder direkt auch ein bestimmter Frömmigkeitsstil (gekennzeichnet durch Wallfahrten, Exerzitien, Herz-Jesu-Verehrung etc.) nahegebracht.82
Resümee
Insgesamt fällt auf, wie stark Keppler Rottenburg als Musterdiözese im Sinne des „konservativen Reformpapstes“ Pius X.83 darstellte; dieser verband theologische und kirchenpolitische Intransigenz mit einer formalen Modernisierung der Kirche im Sinne der pastoralen Intensivierung und Effizienzsteigerung. Unverkennbar bleiben aber auch die Reserven, die der Antimodernist Keppler dem römischen Integralismus gegenüber wahrte. Und auch insofern war das Bistum Rottenburg unter Keppler fest im mainstream des deutschen Katholizismus verankert worden.
1 K. Hausberger, Der Rottenburger Bischof Paul Wilhelm von Keppler (1898-1926) – ein Exponent des Antimodernismus im deutschen Episkopat, in: RJKG 21 (2002) 163-177; ders., Eine Denkschrift des Rottenburger Bischofs Paul Wilhelm von Keppler über den Reformkatholizismus aus dem Jahr 1903, in: RJKG 21 (2002) 321-340.
2 D. Burkard, / E. Gatz, / P. Kopf, Rottenburg, in: Gatz, E. (Hg.), Die Bistümer der deutschsprachigen Länder von der Säkularisation bis zur Gegenwart, Freiburg i. Br. 2005, 616-637; sowie noch immer A. Hagen, Geschichte der Diözese Rottenburg, 3 Bde., Stuttgart 1956-1960.
3 A. Hagen, Der Reformkatholizismus in der Diözese Rottenburg (1902-1920), Stuttgart 1962; M. Seckler, Theologie vor Gericht. Der Fall Wilhelm Koch – Ein Bericht (Contubernium 3), Tübingen 1972; J. Köhler, Heinrich Günters Legendenstudien. Ein Beitrag zur Erforschung historischer Methode, in: Schwaiger, G. (Hg.), Historische Kritik in der Theologie. Beiträge zu ihrer Geschichte (Studien zur Theologie und Geistesgeschichte des Neunzehnten Jahrhunderts 32), Göttingen 1980, 307-337 (mit Bibliographie); R. Engelhart, „Wir schlugen unter Kämpfen und Opfern dem Neuen Bresche.“ Philipp Funk (1884-1937). Leben und Werk (Europäische Hochschulschriften III, 695), Frankfurt a. M. 1996; ders., Zwischen Rebellion und Gehorsam. Zur Entlassung des Diakons Josef Heilig aus dem Priesterseminar Rottenburg, Frankfurt a. M. 1997; G. Klapczynski, „Ab initio sic non erat!“ „Modernismus“ am Beispiel Hugo Koch (1869-1940), in: Wolf, H. / Schepers, J. (Hg.), „In wilder, zügelloser Jagd nach Neuem“. 100 Jahre Modernismus und Antimodernismus in der katholischen Kirche (Römische Inquisition und Indexkongregation 12), Paderborn u.a. 2009, 271-288.
4 Vgl. E. Rentschler, Paul Wilhelm von Keppler (1852-1926). Der sechste Bischof von Rottenburg im Urteil seiner Zeitgenossen, in: RJKG 12 (1993) 247-255.
5 D. Burkard, Neues Jahrhundert – neuer Klerus? Priesterbildung und -erziehung in der Diözese Rottenburg an der Wende zum 20. Jahrhundert, in: RJKG 21 (2002) 179-217, hier 213.
6 Diözesanarchiv Rottenburg (DAR), Q 5.1.1.
7 DAR, Q 5.1.1.
8 C. Arnold, Zwischen Zentrum und Peripherie – die Rottenburger Diözesanidentität (1919-1978), in: RJKG 24 (2005) 35-50.
9 H. Wolf, (Hg.), Zwischen Wahrheit und Gehorsam. Carl Joseph von Hefele (1809-1893), Ostfildern 1994.
10 D. Burkard, Kein Kulturkampf in Württemberg? Zur Problematik eines Klischees, in: RJKG 15 (1996) 81-98; H. Wolf, Württemberg als Modell für die Beilegung des Kulturkampfes in Preußen? in: RJKG 15 (1996) 65-79.
11 Zusammenfassend R. Reinhardt, Art. Hefele, in: Gatz, E. (Hg.), Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder: 1785/1803 bis 1945, Berlin 1983, 295-297.
12 Eng verbunden mit diesem Prozess ist die Frage nach der Herausbildung eines „katholischen Milieus“ in bestimmten Städten und Regionen des Bistums, die hier nicht ausführlich erläutert werden kann. Auch die Milieu-Parameter scheinen aber auf eine „späte“ Milieubildung hinzuweisen, die erst in der Zeit des Nationalsozialismus abgeschlossen wird; Ch. Handschuh, Zwischen katholischer Lebenswelt und Milieu. Das Dekanat Rottweil 1905-1940, in: RJKG 29 (2010) 167-180.
13 Archivio Segreto Vaticano (ASV), S. Congr. Concilii Relationes 694: Rottenburgensis.
14 Ebd.
15 Beide in ASV, Congr. Concist. Relat. Dioec. 695: Rottenburg.
16 Vgl. die Statistik in H. A. Krose, Kirchliches Handbuch für das katholische Deutschland, Bd. 4: 1912/13, Freiburg i. Br. 1913, 213-215.
17 (Jeweils meine Übersetzung) Relatio vom 20. Februar 1913, 27; ASV, Congr. Concist. Relat. Dioec. 695: Frequentia sacramentorum crescit de anno in annum, praesertim ex quo novum de communione decretum emanavit. Pueri nunc omnes, cum undecim vel decimum annum agunt, ad communionem praeparantur atque dum scholae frequentunt sexies per annum omnes simul ad sacram mensam accedunt, singuli saepius, multi omnibus diebus Dominicis. Sexus femineus majori studio sacramenta frequentat; virorum studium paulatim excitandum et augendum erit. Dies war im Vergleich zu 1907 ein deutlicher Fortschritt: Relatio 1907, 15; ASV, Congr. Concilii Relationes 694: Ad communionem quotidianam prater personas religiosas paucos tantum laicos usque modo accedere advertitur; sed crescit celeriter numerus eorum, qui bis ter quater in hebdomada sacra synaxi reficiuntur.
18 Weitere Forschungen müssen ergeben, inwiefern sich hieraus ein statistischer Effekt ergibt, der bei der Handhabung der Milieu-Parameter in Bezug auf das Bistum Rottenburg zu berücksichtigen wäre; vgl. C. Handschuh, Lebenswelt.
19 DAR, Q 5.1.8.
20 Einen Einblick in die religiös-emotionale Bedeutung der Andachten, vor allem auch der später durch die Liturgiereform Pius’ XII. verdrängten Auferstehungsfeier, bieten die Erinnerungen von Maria Müller-Gögler (1900-1987) (Sigmaringen 1980, 334f und passim).
21 Relatio 1913, 4; ASV, Congr. Concist. Relat. Dioec. 695: [...] inter quas fideles cantica religiosa in lingua vernacula maximo cum amore et ardore canunt. Quae consuetudo maximo tantum cum damno eliminari posset; esset enim pertimescendum, ne fideles graviter indignati missas illas usque adhuc valde frequentatas porro negligerent.
22 Relatio 1923, 3; ASV, Congr. Concist. Relat. Dioec. 695.
23 DAR, Q 5.1.1.
24 Relatio 1913, 26; ASV, Congr. Concist. Relat. Dioec. 695: De populo generatim: Ruri adhuc, generaliter dicendo, probi valent mores, vita simplex et laboriosa, fides firma, sincerum religionis studium. In urbibus vero, praesertim maioribus, perniciosa contagionis vi grassantur vitae lautioris studia, alcoholismus, luxuria et exinde vitae familiaris dissolutio et dissipatio.
25 Zur Mischehenproblematik im Bistum Rottenburg vgl. exemplarisch M. E. Gründig, Verwickelte Verhältnisse. Folgen der Bikonfessionalität im Biberach des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, Epfendorf 2002, 142-201.
26 Relatio 1907, 26; ASV, Congr. Concilii Relationes 694.
27 Relatio 1907, 13; ASV, Congr. Concilii Relationes 694.
28 Freundliche Mitteilung von Prof. Dr. Klaus Schatz SJ, Frankfurt-Sankt Georgen. Seine mehrbändige Geschichte der deutschen Jesuiten im 19. und 20. Jahrhundert erscheint demnächst.
29 E. Gatz, (Hg.), Geschichte des kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, Bd. 7: Klöster und Ordensgemeinschaften, Freiburg 2006; R. Meiwes, „Arbeiterinnen des Herrn“. Katholische Frauenkongregationen im 19. Jahrhundert (Geschichte und Geschlechter 30), Frankfurt-New York 2000; W. Zimmermann / N. Priesching (Hg.), Württembergisches Klosterbuch. Klöster, Stifte und Ordensgemeinschaften von den Anfängen bis in die Gegenwart, Ostfildern 2003.
30 H. A. Krose, Kirchliches Handbuch 1913, 483.
31 Relatio 1913, 16; ASV, Congr. Concist. Relat. Dioec. 695: Ideo usu edoctus testari potest, in hospitalibus et institutis harum sororum curae subjectis omnibus rebus optime provisum esse, quae ad corporum et animarum salutem necessariae sunt.
32 Ebd. 15.
33 Relatio 1913, 16; ASV, Congr. Concist. Relat. Dioec. 695: Quum ergo in omnibus dioecesis partibus aditus ad literarum studia facile pateat, semper necessarius numerus puerorum bene moratorum suppetit qui ad sanctae ecclesiae sacerdotium adspirare possint.
34 Dies entspricht dem Befund von D. Burkard, Neues Jahrhundert – neuer Klerus? Priesterbildung und - erziehung in der Diözese Rottenburg an der Wende zum 20. Jahrhundert, in: RJKG 21 (2002) 179-217.
35 Ebd. 198f.
36 Vgl. R. Reinhardt, Zu den Auseinandersetzungen um den „Modernismus“ an der Universität Tübingen, in: ders. (Hg.), Tübinger Theologen und ihre Theologie. Quellen und Forschungen zur Geschichte der Katholisch-Theologischen Fakultät Tübingen (Contubernium 16), Tübingen 1977, 271-352 hier 278.
37 Ebd. 282f.
38 Ebd. 279.
39 Über ihn W. Gross, Franz Xaver von Funk – ein Kirchenhistoriker von Weltruf, in: RJKG 10 (1991) 121-132 sowie R. Reinhardt, Auseinandersetzungen, passim.
40 Relatio 1907, 20; ASV, Congr. Concilii Relationes 694: Ac primum quidem dicendum est, eam jam ab initio summo studio id egisse, ut scientiam catholicam cum docendo tum scribendo ad summum perfectionis fastigium eveheret et theologiae studiosos solida eruditione theologica imbueret. Celebrantur etiam nunc ubique terrarum nomina Moehler, Hefele, Kuhn. Inde ab anno 1819 edit ephemeridem catholicam quae inscribitur theologica ephemeris trimestria/Theologische Quartalschrift/, quae ab omnibus theologis permagni aestimatur. Ea utique laus ei debetur, quod quamquam in difficili ac scrupuloso loco versatur, tamen ecclesiae catholicae jura semper diligenter obtinuit ac defendit. Eadem etiam semper ecclesiae catholicae et Sedi Apostolicae fideliter addicta erat, quamquam id quoque concedendum est, temporibus jam praeteritis a nonnullis nonnulla minus prudenter scripta esse ac dicta. – Intra biennium tres notissimi et clarissimi professores facultatis theologicae mortui sunt: professor Schanz, qui theologiam dogmaticam et apologeticam tradebat, homo immensae doctrinae, qui idem semper pie cum ecclesiae catholica sentiebat; Paulus Vetter, veteris testamenti interpres, homo multarum linguarum gnarus et acutissimus hujus scientiae magister; denique professor Funk, historiae ecclesiasticae magister, homo doctissimus ac multorum librorum scriptor. Is quamquam morum integritate conspicuus erat, tamen propter liberiorem sentiendi rationem haud exiguam [21] sollicitudinem Episcopo parabat. Ceterum his proximis annis magis cavisse videtur, ne qua re offenderet. Sane quidem praelectionibus suis auditoribus neque nocuit neque profuit; non is erat, qui eos ad amorem s. ecclesiae et sacerdotii incendere et inflammare posset.
41 Über ihn D. Burkard, in: BBKL 17 (2000) 1177-1186.
42 Über ihn zuletzt G. Klapczynski, „Ab initio sic non erat!“.
43 Dazu zusammenfassend R. Reinhardt, Auseinandersetzungen, 284-287.
44 Relatio 1907, 20; ASV, Congr. Concilii Relationes 694: [...] ab omni liberalismi et neologismi suspicione longe absunt; a malevolis protestantibus „ultramontanismi“ nota honorantur et odio habentur. Professor Antonius Koch in quandam laxismi et liberalismi suspicionem incidit non tam propter docendi quam propter vivendi rationem. Accedit quod etiam cum reformatoribus Bavariae aliquamdiu consentiebat et amicitia cum eis conjunctus erat. Sed sublata his proximis annis hac consuetudine nihil jam in mutatis ejus moribus invenitur, quod reprehensione sit dignum.
45 M. Seckler, Theologie vor Gericht. Der Fall Wilhelm Koch – Ein Bericht (Contubernium, Bd. 3), Tübingen 1972; H. Wolf, „Hätte ich doch Stenogramme lesen können“. Keppler-Briefe zum Fall Wilhelm Koch, in: Bausteine zur Tübinger Universitätsgeschichte 6, Tübingen 1992, 91-108.
46 Rezess vom 5. Juli 1908 (Entwurf); ASV, Congr. Concilii Relationes 694.
47 Dazu C. Arnold, Zentrum.
48 Relatio vom 24. Dezember 1909; ASV, Congr. Concist. Relat. Dioec. 695: Hoc anno primum permisimus, ut unumquodque capitulum deputatum eligeret et ad conventum decanorum cum canonicis et episcopo mitteret, quo factum est, ut additis 29 electis deputatis numerus 75 sacerdotum compleretur. In hac synodo agebatur de quibusdam difficultatibus ac scandalis, quae diocesim turbaverant, de clero doctrina ac virtute melius excolendo, de edendo catechismo dioecesano. Haec omnia tractabantur in spiritu pacis et concordiae, ut non sit dubium, quin ex his actis et dioecesis et clerus uberrimum fructum ceperit.
49 Relatio 1907, 13; ASV, Congr. Concilii Relationes 694: Scandala perraro dantur ac si quae data sunt, severe puniuntur.
50 Relatio 1913, 11; ASV, Congr. Concist. Relat. Dioec. 695.
51 Relatio 1918, 4; ASV, Congr. Concist. Relat. Dioec. 695: Alii duo sacerdotes, quorum alter beneficio auctus, alter sine beneficio erat, graviter contra praeceptum sectum deliquerunt. Sed cum eorum crimen occultum mansisset, beneficiarius ab ordinario suspensione per exiguum tempus multatus exercitiis interesse et aliud officium suscipere iussus est, alteri beneficium nondum consecuto exercitia spiritualia et transitus ad aliud officium imposita sunt, insuper beneficium quod competierat negatum est.
52 Relatio 1913, 8; ASV, Congr. Concist. Relat. Dioec. 695: Partem secretam documentorum episcopus apud se custodit. Archivum est bene ordinatum.
53 Dazu H. Wolf, Das Domkapitel als Bischöfliches Ordinariat? Monarchische (Generalvikar) oder kollegiale (Domdekan) Diözesanleitung im Bistum Rottenburg, in: RJGK 15 (1996) 173-197.
54 Über ihn A. Hagen, Gestalten I, 354-387.
55 Ders., Geschichte III, 22-27.
56 Ebd. 289-295.
57 Relatio vom 24. Dezember 1909; ASV, Congr. Concist. Relat. Dioec. 695: In parlamento acerrima certamina orta sunt de constituenda nova lege scholastica. Qua lege cum intima illa concordia, quae ad id tempus inter scholam et ecclesiam intercesserat haud mediocriter laxari videtur, nos, ubi primum de hac lege ferenda certiores facti sumus, non dubitavimus, uberiorem commentarium cum ad gubernium tum in vulgus edere, in quo quid nobis odiosum et perniciosum esse videretur et quid metueremus accurate exposuimus. Deputati autem catholici ejus partis, quae centrum vocatur, item deputati a canonicis et clero in primum parlamentum electi fortissime et gravissime pro tuendis ecclesiae juribus contenderunt, sed frustra: a majore enim Protestantium numero lex perlata est et id solum effici potuit, ut quaedam legis capita quae minus noxia videbantur, integra servarentur nec pernicisioribus condicionibus vitiarentur. – De nova autem hac lege res sic se habet: Scholae elementares / de his enim solis res est / sunt etiam nunc per confessiones distinctae i.e. sive acatholicae sive catholicae; nam rogatio de erigendis scholis simultaneis repudiata est. In his scholis confessionalibus, quas vocant, inter omnes disciplinas religio primum locum obtinet, quam sacerdotes a ludimagistribus adjuti certis horis tradunt. In minoribus vicis parochus est etiam inspector scholae, sed facultatibus satis minutis; in majoribus autem oppidis est in numero consiliariorum scholasticorum illius loci. Scholarum autem totius pagi inspectionem, quam usque ad haec tempora ordo clericalis obtinuerat, paene totam amisit: nam quamquam etiam nunc fieri potest, ut univel alteri sacerdoti hoc munus extra ordinem tribuatur, plerumque tamen a magistris exercebitur. Summi vero de rebus scholasticis administrandis magistratus ipsi quoque per confessiones distincti sunt, quo factum est, ut quamvis acri certamine tamen summam hanc catholicam inspectionem scholarum catholicarum servaremus. Multa perdidimus, cum priorem bonum ordinem scholarum perdimus; sed magno opere metuendum est, ne in futuro multo plura perdamus. Nam adversarii scholae christianae ne nunc quidem satis habebunt, sed iteratis conatibus primum scholam simultaneam, deinde scholam sine religione, postremo autem scholam religioni inimicam appetent.
58 Relatio 1913, 8; ASV, Congr. Concist. Relat. Dioec. 695: Protestanticae confessionis Rex Württembergiae justus est et benevolus erga episcopum. Contra gubernium et magistratus qui omnes pene acatholici sunt, jura ecclesiae et episcopi persequi saepe est difficillimum. Servilitatis erga humanas potestates culpa vacamus.
59 So D. Blackbourn, Class, religion and local politics in Wilhelmine Germany. The Centre Party in Württemberg before 1914 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abteilung Universalgeschichte, Beiheft 9), Wiesbaden 1980.
60 A. Gawatz, Wahlkämpfe in Württemberg. Landtags-und Reichstagswahlen beim Übergang zum politischen Massenmarkt (1889-1912), Düsseldorf 2001, 99-107; 249-258.
61 Zit. nach ebd. 102.
62 Dazu zusammenfassend W. Zimmermann, Braucht Württemberg Mönche? Die „Klosterfrage“ im Königreich Württemberg, in: Gründig, M. E. (Red.), Kirche im Königreich Württemberg 1806-1918, Stuttgart 2008, 82-101.
63 Relatio 1907, 13; ASV, Congr. Concilii Relationes 694: Inprimis Carolus Josephus de Hefele sub finem vitae suae Gubernium instantissimis precibus oravit et obsecravit, ne sibi, homini senio confecto et proxime morituro hanc gratiam et consolationem denegaret: sed id quoque frustra fuit. Deinde in conventu catholicorum anno 1890 Ulmae celebrato de hac quoque re inprimis actum est et quid populus catholicus fieri vellet summa ingenuitate palam et aperte declaratum. Accedit, quod canonicus de Linsenmann, idem qui postea episcopus electus ante consecrationem diem obiit supremum, libello praeclarissimo scripto eandem rem tractavit ac jus populi catholici egregis defendit. Vgl. F. X. Linsenmann, Franz Xaver Linsenmann. Sein Leben, hg. von R. Reinhardt, Sigmaringen 1987, 307-309.
64 Relatio 1913, 28; ASV, Congr. Concist. Relat. Dioec. 695: Maxime ad virorum sodalitates ac pracipue ad magnam associationem „Volksverein“ dictam referendam est, quod viri catholici ita in politicis rebus versati et disciplinati sunt, ut eis in electionibus politicis et civilibus plane confidere possimus; scilicet in „Centri“ candidatos sua conferunt suffragia. Inde fit, ut quamvis catholici in Regno numero minores sint, tamen „Centrum catholicum“ in parlamento inter partes politicas suo munere praevaleat.
65 Zit. nach W. Halder, Katholische Vereine in Baden und Württemberg 1848-1914. Ein Beitrag zur Organisationsgeschichte des südwestdeutschen Katholizismus im Rahmen der Entstehung der modernen Industriegesellschaft (VKZG.F 64), Paderborn 1995, 257.
66 Über ihn A. Gawatz, Adolf Gröber (1854-1919), in: Weber, R. / Mayer, I., Politische Köpfe aus Südwestdeutschland, Stuttgart 2005, 32-41.
67 So W. Halder, Vereine, 260.
68 A. Hagen, Geschichte III, 18-22.
69 Relatio 1907, 26f; ASV, Congr. Concilii Relationes 694: Et sane hujus fractionis duces non solum sapientia sed etiam virtutibus praeter ceteros florent; tanto autem animo ac tanto studio rem catholicam defendunt, ut jam ipsum Gubernium, quod initio quidem satis magnam diffidentiam in centrum prae se tulerat, non possit eos non vereri. Neque est dubium, quin indefessis horum virorum laboribus jura ecclesiae multo magis quam antea serventur et magnopere impediatur, quominus injustae in ecclesiam leges perferantur. Certe quidem ob eam ipsam causam protestantium in nos odia ita creverunt, ut et calumniando et injurias inferendo et inimice nos sectando jam cum socialistis certent.
70 W. Halder, Vereine, 316.
71 Zit. nach R. Brack, Deutscher Episkopat und Gewerkschaftsstreit 1900-1914 (Bonner Beiträge zur Kirchengeschichte 9), Köln 1976, 224.
72 Ebd. 329.
73 W. Halder, Vereine, 325.
74 Relatio 1913, 32; ASV, Congr. Concist. Relat. Dioec. 695: In id praesertim omnibus viribus enisi sumus, ut operarios nostros in societates catholicae colligeremus, quae a sacerdotibus a nobis deputatis diriguntur et in vita privata et publica necnon in quaestionibus socialibus regulas a Sancta Sede et episcopis statutas sequuntur.
75 So O. Blaschke, Katholizismus und Antisemitismus im Deutschen Kaiserreich (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 122), Göttingen 1997, 135.
76 Relatio 1913, 34; ASV, Congr. Concist. Relat. Dioec. 695.
77 A. Hagen, Geschichte II, 130.
78 H. Wolf, Korrespondenz, 203-206.
79 Über ihn A. Hagen, Gestalten II, 412-472. Danach auch im Folgenden, wenn nicht anders vermerkt, die Mitteilungen zu Kümmel. Zu Kümmels besonderer Rolle für den Aufbau der Diaspora-Pfarrei Böblingen siehe E. Kläger, 100 Jahre St. Bonifatius-Kirche in Böblingen 1900 – 2000, Böblingen 2000.
80 Dazu umfassend H. Wolf / J. Seiler (Hg.), Das Katholische Sonntagsblatt (1850-2000). Württembergischer Katholizismus im Spiegel der Bistumspresse, Ostfildern 2001.
81 Dazu u.a. A. Holzem, Das katholische Milieu und das Problem der Integration: Kaiserreich, Kultur und Konfession um 1900, in: RJKG 21 (2002) 13-39.
82 Vgl. C. Arnold, „Sie vergehen und Du bleibst ...“ Das Katholische Sonntagsblatt und der württembergische Katholizismus an der Jahrhundertwende 1900, in: Wolf, H. / Seiler, J. (Hg.), Sonntagsblatt, 266-273.
83 Über ihn zusammenfassend R. Aubert, in: LThK 8, Freiburg 31999, 333-335.