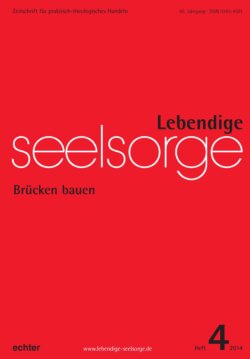Читать книгу Lebendige Seelsorge 4/2014 - Группа авторов - Страница 4
„Über sieben Brücken gehen“
ОглавлениеSpirituelle Inszenierungen zum Leitwort des Katholikentags 2014
Dieser Beitrag war begleitet von einer Tanzperformance – so sollte den Zuhörern, die hier direkt angesprochen werden, das Spielerische der Gedanken nahe gebracht werden. Sie sollten nicht nur zum gedanklichen Brückenbauen ermuntert werden, sondern zum leibhaftigen. Der Impuls stammt jeweils von Hans-Joachim Sander, der geistliche Gedanke von Susanne Sandherr.
Erster Impuls: Die Steinerne Brücke. Wir bauen mit Christus Brücken – seit gestern hier in Regensburg. Und auch noch die kommenden Tage. Vielleicht haben Sie schon ein paar der Brücken gesehen, die gebaut worden sind. Und vielleicht werden Sie die nächsten Stunden und Tage selbst ein paar bauen. Sie bauen jedenfalls daran mit, weil Sie hier in Regensburg sind. Ich muss Ihnen also gar nicht viel dazu sagen, und der Tanz, der hier die spirituelle Inszenierung trägt, ist sowieso nicht mit Worten zu überbieten. Denn getanzte Brücken halten ewig, weil Tänze schwerelos ins Weltall hinein überbrücken, was uns irdische Wesen beschwert. Damit die Tänzerinnen unsere Sehnsucht zum Ort der Fülle hin überbrücken und sie mit jedem Schritt vergrößern, deshalb hier nur zwei Gedanken: wir bauen mit Christus Brücken, also nicht einfach für ihn. Er ist am Bau beteiligt – als Baumeister, der Pläne hat, und ebenso als Material, mit dem gebaut wird. Deshalb bauen wir nicht irgendwelche Brücken, sondern solche, die halten können, was gebaut wird, wenn wir „Christus“ sagen, und die ein Material umsetzen, an dessen Haltbarkeit wir glauben. Und zweitens: je danach, welchen Raum wir mit Christus überbrücken, brauchen wir eine spezielle Art von Brücke.
Eine, die das kann und vormacht, ist die Steinerne Brücke hier in Regensburg. Ehrwürdig, seit Jahrhunderten über die Donau genutzt, ein Wahrzeichen der Stadt. Eine solche Brücke war sehr kostspielig, als die Stadt sie baute. Sie ist eine echte Investition, auf Dauer angelegt, um vielen den Weg in die Stadt möglich zu machen. Das ist genau eine Art von Brücke, wie wir Katholiken sie benötigen – weil sie den Weg in die Stadt weist, auf deren Markt hin, wo buntes, ständig wechselndes Treiben herrscht und so viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen, auch wenn sie sich nicht kennen. Das brauchen wir gerade jetzt, weil mittlerweile auf diesem Planeten mehr Menschen in Städten als auf dem Land leben und weil der gute alte Katholizismus (hier bei uns und anderswo) dagegen eher ländlich geprägt ist. Gegen das Land ist nichts zu sagen, natürlich nicht, aber es ist weltweit in den Sog der Städte geraten und der Prozess scheint nicht mehr umkehrbar zu sein. Massiv steigt die Verstädterung an und die Städte werden immer größer. Weltweit wachsen Mega-Städte mit mehr als 15 Millionen Einwohnern, immer unübersichtlich, hoch mobil; so eine Stadt schläft nie und überall auf der Welt werden diese Städte von einer Schere zwischen arm und reich geprägt, die ständig weiter aufgeht. Und doch wandern fortwährend mehr Menschen in die Städte, weil sie Hoffnung haben, und weil sie dort, wenn eine Hoffnung zerstört wird – was fast die Regel ist –, sehr bald eine neue finden können. Christus ist Hoffnung, sagt der Glaube. Weil wir mit ihm bauen, müssen wir in die Städte; denn dort wachsen die Verzweiflung und die Hoffnung. Wir können das nicht meiden, auch wenn die Verstädterung prekär ist. Und die steinerne Brücke weist den Weg.
Geistlicher Gedanke: Städte. Sichere, teure Städte. Menschen, die sich drängen. Menschen, die hineindrängen. Die steinerne Brücke wird schwarz vor Menschen. Menschenmassen. Menschen.
Stadt. Meine sichere, meine teure Stadt. Ich: mitten darin. Von Anfang an. Weil ich das Privileg habe, in dieser Stadt geboren worden zu sein. Hineingeboren in diese Stadt. Eingeboren in dieser Stadt, die Europa heißt. Steinerne Stadt. Ich bin schon da. Bin immer schon angekommen dort, wo die Menschen auf der steinernen Brücke hingelangen wollen.
„Denn hier haben wir keine bleibende Stadt, sondern die künftige ersehnen wir“ (Hebr 13,14). Bibel, Buch der Freiheit, Buch der Liebe.
Keine bleibende Stadt: Romantische Resignation städtischer Nomaden in der Spätmoderne? Keine bleibende Stadt: Lippenbekenntnis satter Stadtbürger? Oder biblische Weisung: Anweisung zum christusförmigen Leben, zum Leben als Brückenschlag? Steinerne Brücke schwarz vor Menschen. Stadt aus Stein. „Mein Herz so weiß“ (Shakespeare, Macbeth) - mein Herz aus Stein? (Ez 36).
Zweiter Impuls: Die Golden-Gate-Brücke. Wer kennt ihren Charme nicht, den der vielleicht bekanntesten Brücke weltweit – die Golden-Gate-Brücke bei San Francisco. Oft kopiert, selten erreicht, von Hollywood häufig zerstört, aber dann immer nur mit großem Bedauern im filmischen Pathos. Baut Christus Golden-Gate-Brücken? Ja, ganz sicher, denn die Brücke ist ein gate, also ein Tor, und das prägt ihre Schönheit ganz erheblich. Mit ihr öffnen sich neue Welten; wer sie quert, bringt Hoffnungen mit. Die Brücke gibt beidem Raum. Es beginnt schon damit, dass eine Meerenge überbrückt und so viel Umweg für die Realisierung der Hoffnungen eingespart wird. Man kommt besser dorthin, wohin man gehören will. Und die Brücke lässt anderem genügend Raum. Sie ist so hoch, dass schon zu ihrer Bauzeit die Schiffe voll mit den Hoffnungen der Einwanderer gut passieren konnten und dass heute die riesigen Containerschiffe das Siegel der unbegrenzten Möglichkeiten leicht in alle Welt mitnehmen können. Weniger als das darf man nicht mit Christus bauen. Wenn die Bauleute dann auch noch die Schönheit hinbekommen wie bei der Golden Gate, dann entsteht ein Übergang zur anderen Welt der neuen Schöpfung. Mit einer solchen Brücke muss niemand die Nebel fürchten, die so oft in der Bay Area das andere Ende der Brücke kaum erahnen lassen.
Geistlicher Gedanke: Golden-Gate-Bridge, gebaute Schönheit. Hochgebaut. Weitgespannt. Gerade so lässt sie Raum für andere und für anderes. So öffnet sie neue Welten und überbrückt Abgrund. Führt nicht nirgendwo hin, sondern von hier nach dort. Golden-Gate-Brücke, beflügelnder, befreiender Anblick. Golden Gate, Goldenes Tor. Einladend. Offen. Zeichen setzend, schönes Hoffnungszeichen. Beschwingt, beschwingend. Am anderen Ende der Skala: die Gated Community, das überwachte und für Fremde unzugängliche Wohnterritorium. Wer sich hier nicht eingekauft hat, wer nicht hierher gehört, wem hier nichts gehört – Bettler, Vagabunden und andere Eindringlinge – kommt auch nicht hinein. Überwachungskameras und bewaffnete Sicherheitskräfte sorgen dafür. Wer sind wir? Wir Europäer und Europäerinnen? Eine Gemeinschaft, die sich nicht mehr über ihre Gemeinsamkeit, sondern über die scharfe Bewachung ihrer Grenzen definiert? Wer sind wir, wir Katholiken? Einen Kreis kann man über seine Linie definieren oder über seinen Mittelpunkt. Wir sind Kirche: die, die zum Herrn gehören. So bauen wir eine Brücke: Kirche für andere. Wir sind Kirche, kyriake, kyriakoi, die zum Herrn gehören. Werden wir es.
Dritter Impuls: Der Pont-du-Gare. Wenn wir mit Christus bauen, also der Glaube an ihn das Material ist, mit dem gebaut wird, dann brauchen wir dringend eine Brücke wie den Pont-du-Gare. Ein Aquädukt, also eine Brücke, die Wasser von den Bergen in die Stadt leitet. Die Lebensressource fließt von außen nach innen. Gefälle wird benötigt – nicht zu viel und nicht zu wenig. Wasser gibt dem Leben Raum. Es ist ein Lebens-Mittel, man muss es dort hineinlassen, wo Menschen leben. Wir haben nun einmal nicht alles aus uns selbst heraus zur Verfügung, was wir zum Leben brauchen. Die wichtigsten Dinge kommen von außen: Wind und Wasser, Liebe und Lob, Wissen und Weisheit, Menschenrechte und Gott. Sie fließen zu und verhelfen dabei zum Leben. Die Stadt Gottes, die wir mit Christus bauen können, ist offen von außen her für das, was ihr Leben belebt. Bauen wir mit Christus einen Pont-du-Gare und die Wasser des Lebens werden fließen.
Geistlicher Gedanke: Ich öffne den Wasserhahn und klares, erfrischendes Nass sprudelt. Unerschöpflich. Ich kann trinken, solange ich will, soviel ich mag. So groß kann mein Durst kann gar nicht sein, dass er durch die Erfrischung aus der Leitung nicht gestillt werden könnte. Wir Europäer trinken zudem zumeist vor dem Durst. Doch wer außer uns kann sich das leisten? Wer außer uns kann das?
„Die Elenden und Armen suchen Wasser, / doch es ist keines da; / ihre Zunge vertrocknet vor Durst,“ heißt es eindringlich beim Propheten Jesaja (41,17). Simone Weil, die unbestechliche politische Denkerin und Christus-Mystikerin, notiert in ihren Cahiers: „Jesaja. Gott allein kann einem Unglücklichen Wasser geben.“ Und Gott – tut es: „Ich, der Herr, will sie erhören,/ ich, der Gott Israels, verlasse sie nicht“ (Jes 41,17). Gott allein kann einem Unglücklichen Wasser geben. Der Eine und Einzige, der aus Totem Leben schafft. Jubel aller Geschöpfe über des Schöpfers rettende Wasser-Wege, über Gottes Aquädukt: „Ja, ich lege einen Weg an durch die Steppe / und Straßen durch die Wüste. / Die wilden Tiere werden mich preisen, / die Schakale und Strauße, / denn ich lasse in der Steppe Wasser fließen, / um mein Volk, mein erwähltes, zu tränken“ (Jes 43,20). Die wilden Tiere werden mich preisen. Und sogar unsere Versteppungen und Verwüstungen sind im Blick. Wir haben es nur noch nicht gemerkt. „Seht her, nun mache ich etwas Neues. / Schon kommt es zum Vorschein, merkt ihr es nicht?“
Vierter Impuls: Die Zugbrücke. Für eine ziemlich lange Zeit war der bevorzugte Brückenbau in der Kirche die Zugbrücke. Die lässt sich hochziehen, wenn Leute kommen, die man nicht haben will, oder wenn man für sich bleiben und andere einschüchtern will mit der Macht der Burg, zu der die Zugbrücken oft gehören. Zugbrücken suggerieren aber nur Macht – und wiegen Burgherren in die gefährliche Sicherheit, alles kontrollieren zu können, was dem Glauben geschieht, und nichts einräumen zu müssen, was nicht passt. Im Evangelium finden sich aber keine Zugbrücken, weil seine Botschaft allen gehört und nicht nur denen, die die Macht haben, andere draußen zu halten und abzuschrecken. Wer noch in der Burg hinter der Zugbrücke lebt in der katholischen Kirche, sollten wir auf Hängebrücken locken, also schwankende Brücken, die leicht anzubringen sind und ohne großen Aufwand den Abgrund des Burggrabens überbrücken. Wer solche Brücken betritt, will schnell an die andere Seite gelangen, weil sie so schwankend sind. Hängebrücken sind wie geschaffen für die, die immer noch in der Kirche hinter Zugbrücken existieren, weil sie sich lieber belagern lassen. Für so manchen in der Hierarchie ist die Hängebrücke angesagt und sie fürchten sich davor. Der Papst schickt gerade jene Bischofskollegen, die sich noch hinter den Mauern verschanzt haben, von der Burgseite her auf diese Brückenart, weil – aus welchen Gründen auch immer –der Ablassmechanismus der Zugbrücke offenbar klemmt. Wir sollten sie im Rüberlaufen nicht allein lassen, sondern ihnen von der anderen Seite her zurufen, dass sie es schon schaffen und dann ganz erleichtert sein werden. Bringen wir keine Sturmleitern, sondern Hängebrücken neben der Zugbrücke an und reden wir den zweifelnden Mitchristen gut zu, dass schon längst keine Belagerung mehr stattfindet.
Geistlicher Gedanke: Endlich. Ich bin zu Hause. Die Türe schließt sich hinter mir. Meine Räume empfangen mich. Farben, Formen, die mich begrüßen, die mir gut tun. Der Blick in den Garten. Sanftes, sattes Grün. Blühende, bunte Tupfen. Wunderbar. Erleichterung. Angekommen. Es war ein langer Tag. Da höre ich die Türglocke. Nein, ich will jetzt nicht mehr. Einfach überhören? Dabei bräuchte ich keine Sorge zu haben, dass draußen vor der Tür ein pöbelnder Nachbar oder gar ein Gangster mit vorgehaltener Waffe steht. Alles in Ordnung hier. Ich lebe an einem der ruhigsten und sichersten Orte der Welt. Und doch – gerade mal keine Lust auf Welt. Aber das geht vorüber. In unserer Kirche ging es nicht so schnell vorbei. Es war ihr, es war uns zur Gewohnheit geworden, das Schifflein Petri nach allen Regeln der Kunst wasserdicht zu machen, das Schiff, das sich Gemeinde nennt, zu kalfatern, als sei es die Arche Noach und die Welt die große Flut. Zieht die Brücke hoch. Aber sicher!
Von wem haben wir das nur? Von Gott können wir es nicht gelernt haben. Schöpfung ist Öffnung, ist Raumgeben, ist Strömen, ist Lieben. Schöpfung ist Wagnis, der Schöpfer setzt sich selbst aufs Spiel. Damit wir gewinnen. Gott öffnet die Türe: zum Heil der Welt.
Fünfter Impuls: Die Donnersbergerbrücke. Für die Stammkundschaft, die ständig die Kirche frequentiert, braucht man eine Christusbrücke, die etwas aushält und die breit genug ist für die täglichen Pendlerströme. Eine Brücke wie die Donnersbergerbrücke in München. Der größte Pendlerstrom in die Kirche ist weiblich; Frauen halten die Kirche am Laufen, alltäglich, bei Wind und Wetter. Sie kümmern sich, obwohl sie es nicht leicht haben mit der Kirche. Es besteht also – wie so oft beim Spannbeton der Donnersbergerbrücke auf dem Mittleren Ring – großer Sanierungsbedarf. Die Kirche lebt da schon längst von der Bausubstanz. Sie muss sanieren – eine Alternative hat sie nicht wirklich. Wenn sie das endlich angeht, dann wird der Pendlerstrom auch wieder zunehmen. Da bin ich sicher. Jetzt wird so manche Frau, wird auch so mancher Mann davon abgehalten, über die alltägliche Kirchenbrücke zu Gott zu pendeln, weil man ja auf der Donnersbergerbrücke zu Genüge die Stellen kennt, an denen die Schilder mit dem „Achtung!“ stehen, die den Sanierungsbedarf nur anzeigen. Die kritischen Stellen, die behoben werden müssen, sind nur zu bekannt, es fehlt aber nach wie vor der Bautrupp. Das lässt so manche(n) über andere Brücken gehen, weil man wegen der nötigen, aber noch nicht durchgeführten Baumaßnahmen immer den eigenen Ärger fürchten muss. Schönheitsmaßnahmen reichen an der Alltagsbrücke zur Kirche nicht mehr. Wird ihre Donnersbergerbrücke aber gründlich saniert, dann haben alle etwas davon – und der Pendlerstrom wird steigen.
Geistlicher Gedanke: Manchmal habe ich Angst. Wie geht es weiter mit uns – mit Kirche? So viele Sanierungsarbeiten verschleppt, verschlafen, verlogen verleugnet.
Steht es mit uns, wie es mit manchen unpassierbaren öffentlichen Straßen, mit immer mehr für den Verkehr gesperrten oder teilgesperrten Betonbrücken steht?
Da sind die schrillen, die aggressiven Töne, die lauten, aufgeregten Stimmen derer, die allergisch reagieren auf Ökumene und für die Dialog mit-wem-auch-immer Teufelszeug ist, Abfall vom wahren Glauben. Abfall.
Und da ist der stille Kahlschlag, der Traditionsabbruch, und der radikale Schwund von Glaubenswissen. Die Bibel hat zwei Teile, das wissen manche noch. Kahlschlag, trotz gefühlter 1.000 Stunden Religionsunterricht. Da ist der Schwund an kirchlicher Glaubwürdigkeit. Die helfen doch nur sich selbst. Was hilft? Wer hilft? Christus hilft, wer sonst. Er, das Mensch gewordene Gotteswort. Das WORT, das in der Todesnot ohne Antwort blieb und ganz gewiss ohne Zauberwort. „Eli, Eli…“.
Worum geht es? Ich denke, es wird darum gehen, uns selbst zu missionieren, uns selbst zu christianisieren. Nicht allein, sondern getragen von dem, der „in allem uns gleich [wurde], außer der Sünde“ (Hebr 4,15). Getragen von ihm, dem vertrauensvollen Brückenbauer. Dem vertrauensseligen Brückenmenschen. Dem Mittler zwischen Gott und Mensch, Jesus Christus. „Denn einer ist Gott, und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus“ (1 Tim 2,5). Werden auch wir vertrauensselig! Das wird noch Folgen haben. Auf der Donnersberger Brücke.
Sechster Impuls: Die Europabrücke. Die hier einheimischen AutofahrerInnen kennen das. Man überquert Richtung Italien die erste Grenze Richtung Süden. Dort steht ein Schild, das auf das Hoheitsgebiet Österreichs hinweist und darunter steht: Hier herrscht Vignettenpflicht! Das ärgert die Bayern so sehr, dass sie gerne mit der Ausländermaut zurückschlagen würden. Ich bin da, obwohl Deutscher, Partei; immerhin wird ein Salzburger Professor von der Republik Österreich bezahlt. Also es sei gesagt: In Österreich sind die Berge doch deutlich höher, so dass die Infrastruktur wirklich sehr kompliziert und teuer ist und deshalb… – Sie wissen schon! Auch die Kirche weiß Brückenbauten wie die Europabrücke am Brenner zu schätzen. Bei ihr heißt die Mautbrücke Kirchensteuer. Die ist deutlich weniger eindrucksvoll als diese sehr schöne Tiroler Brücke, für die die Vignette allein nicht reicht. Das ist so eine Sache, ob bei der Mautbrücke Kirchensteuer wirklich mit Christus gebaut wird, oder nur vorgeblich für ihn, jedoch eigentlich mit anderen verschwiegenen Interessen. Immerhin haben wir ja nun einen Papst namens Franziskus und der lässt es Bischöfen nicht mehr durchgehen, wenn sie oberhalb der Mautbrücke für sich einen Palast errichten, selbst wenn der womöglich nicht von den aktuellen Mauteinnahmen, sondern von früheren, katholisch-gläubig überantworteten Spenden bezahlt wird. Der Fall des Limburger Bischofs ist weltweit bekannt geworden; in Atlanta musste der dortige Bischof wegen des Limburger Falls sein sog. „Diözesanes Zentrum“ verkaufen, das nichts anderes als seine persönliche Residenz war. Deshalb ein Rat aus der Alpenrepublik: Wenn man schon Mautbrücken für die Kirche braucht, dann müssen sie zu allererst einmal allen zugute kommen wie die leichtere Überfahrt über den Brenner durch die Europabrücke. Und besonders Menschen, für die Grenzen schwer zu überquerende Hindernisse sind oder die über hohe Pässe hinwegkommen müssen, also die Armen, die Ausgeschlossenen, die Verfemten, die Verlorenen sind der Gradmesser, ob Mautbrücken sich nicht bloß rechnen, sondern sich rechtfertigen lassen.
Geistlicher Gedanke: Lieber gar keine Maut, aber wenn schon Maut, dann lieber einnehmen als einzahlen, versteht sich. Doch Jesus, der sich erst einmal einen Denar leihen muss – er hat keinen –, um die Frage nach der kaiserlichen Maut beantworten zu können, versteht es anders, und die großen Gottsucher aller Zeiten haben auch etwas anderes verstanden. Sie wussten um den Sinn der Freigiebigkeit. Und dass wir sie einüben müssen. Sinn und Ziel der geistlichen Übungen des Ignatius von Loyola ist es, frei zu werden, frei von allen blinden Abhängigkeiten, frei von fremden Zwängen und eingefleischten Hierarchien: frei für den Willen Gottes, eines Gottes, der mir näher ist, so heißt es, als mein eigenes Herz. Eine solche Haltung gleichschwebender Freiheit gegenüber allen angesagten Gütern nennt Ignatius „indiferencia“. Indifferenz, das ist ignatianisch nicht kalte, tote Gleichgültigkeit und auch kein postmodern resigniertes Anything-goes, sondern, im Gegenteil, letzte Entschiedenheit: zur Freiheit von magischen Idolisierungen und mächtigen Idolen. Wenn man dann auch noch weiß und zuinnerst spürt, dass solche entschiedene Freiheit nicht sportlich-asketische Höchstleistung, sondern befreite Freiheit ist, dann ist man auf dem Weg zum Leben. Und zum Geben. Aber – ist das nicht verrückt? Reichtum nicht mehr zu begehren als Armut, Ehre nicht mehr als Nicht-Ehre, Gesundheit nicht mehr als Krankheit – sind solche Sätze nicht Spreng-Sätze, zu jeder Zeit, und gerade für unsere Zeit? Doch sie wollen uns nicht ins Nirwana befördern, sondern ins Leben. Diese Sätze wollen unsere festgefahrenen und fetischisierten Maßstäbe ver-rücken und uns gerade so zum Leben und zum Geben befreien! Und sie wollen heilsam unterscheiden lehren: Das des Kaisers gebt dem Kaiser und das Gottes – Gott (Mk 12,17). Maut ist nicht gleich Maut!
Siebter Impuls: Die Wild- oder Grünbrücke. Für die besonderen Fälle: die mit den nicht alltäglichen Interessen an Gott, die mit der kritischen Distanz am Glauben, die von den Sakramenten eigentlich Ausgeschlossenen, die nicht in die Gemeinden Passenden, die moralisch offiziell Verworfenen – für die baut Christus keine Standardbrücke nach katholischer DIN-Norm. Für sie muss man schon die besondere Brücke bauen. Denn Christi Herz ist weit, er lugt nicht hinter Zugbrücken ängstlich hervor, schickt die besonderen Fälle auch nicht in den Alltagsstrom der PendlerInnen über die Donnersbergerbrücke. Er rettet vielmehr die Sünderin im Tempel vor der Moralgier der Bigotten. Er lässt das verlorene Schaf nicht weiterlaufen, weil es nicht ordentlich die Mautstation passiert. Für die besonderen Fälle mit Christus wird so etwas wie eine Wildbrücke benötigt, die man oft auch Grünbrücke nennt. Das sind Brücken, die quer zu den großen, sehr frequentierten Autobahnen und Zugtrassen verlaufen. Hier gilt, dass der heimliche Wildwechsel Vorrang vor allem anderen hat. Hier herrscht daher absolutes Jagdverbot und verschwiegene Diskretion. Auch von versteckten Kameras sollte man besser lassen. Wer Wildbrücken baut und mit Christus anbietet, muss die Waffen der moralischen Empörung einsammeln, damit sie noch nicht einmal zum Zielen kommen, muss die Glut der Exkommunikation streng hüten, damit sie die Grasnarbe nicht versengt, muss verschwiegen und sanft auftreten, damit die anormalen, ungewohnten Lebensformen nicht verschreckt werden. Damit das äsende Wild, die hüpfende Runzelkröte, die züngelnde Kreuzotter, der lichtscheue Dachs, die nervösen Ameisen, auch das überscheue Wolfsrudel, meinetwegen auch der röhrende Hirsch und der einsame Bär so oft hin und hergehen können, wie sie wollen. Also nicht nur heimlich hinein, sondern auch bei Gelegenheit mal wieder heraus. Und manche von den Unpassenden hätten gern nach einer gewissen Zeit, in der sie in den Normalritualen der Kirche vorsichtig präsent sind, sich dabei aber ständig verschämt über die Schulter sehen, weil sie die zweite Ehe leben, weil sie die nicht akzeptierte Partnerschaft wagen, weil sie die streng bewachten Religionsgrenzen einfach grüne Grenze sein lassen – manchmal hätten die dann gern einen festen Platz auf den Normalbahnen der Kirche. Es muss ja nicht gleich die Überholspur zum Sakrament sein, die Kriechspur tut es ja auch, aber die brauchen sie dann schon. Für die hätten die Wildbrücken Christi dann sogar ein gutes kirchliches Werk getan.
Geistlicher Gedanke: Neulich mit dem PKW durch Bonn. Noch bevor ich etwas erkennen konnte, rief eine meiner Nichten in einer bemerkenswert hohen Tonart: „Wie süß!“ Und in der Tat, es war spektakulär. Eine Entenfamilie – Elterntier bzw. Elterntiere, vor allem aber ein Kindergarten Junge – querte seelenruhig die Straße, die kein Highway war, aber auch keine stille Nebenstraße. Links und rechts dieser informellen Wildbrücke hielten die Autofahrer an. Offenbar war das intuitiv konsensfähig: „Ich bremse auch für Tiere.“
Keine Sternstunde, eine Sternschnuppe bloß, gewiss. Und doch setzte sie Fragen frei: Wie können wir Menschen, wie können wir Christen nur so gehässig, so oft gnadenlos sein, entre nous? Angesichts von Menschen, die fragen? Die Fragen wagen? Angesichts von Menschen, die scheitern? Angesichts von Menschen, die anders sind? Werden wir Christus so gerecht - oder sind wir so nur selbstgerecht? Den Gastmählern Jesu, seinen prophetischen Zeichenhandlungen, was stellen wir ihnen an die Seite? Jesus, dem Freigiebigen, und gar seiner angekündigten Hingabe für die Anderen, die Vielen, beim Letzten Abendmahl? Eine kalte Schulter? Zähe Verhandlungen? Christus baut Brücken, ohne zu zögern. Kommen wir mit?