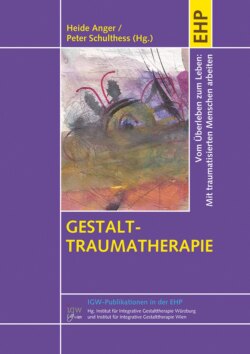Читать книгу Gestalt-Traumatherapie - Группа авторов - Страница 7
ОглавлениеWolfgang Wirth
Traumatherapie aus gestalttherapeutischer Perspektive
»Was die Wunde schlug, wird sie heilen«
Orakel von Delphi
In diesem Beitrag wird vor dem Hintergrund der Lebensgeschichte von Fritz Perls die Entwicklung der Gestalttherapie als traumaorientiertes Verfahren reflektiert. Eine kurze Skizze wichtiger traumadiagnostischer Kategorien und der Neurobiologie traumatischer Prozesse bilden die Grundlage für die Überprüfung gestalttherapeutischer Traumakonzepte. Diese werden aus dem Grundlagenwerk Gestalttherapie herausgearbeitet. Einige Modellskizzen veranschaulichen mein aktuelles und weitgehend gestalttherapeutisches Verständnis traumatischer Prozesse. Die Sichtung eines Großteils der Arbeiten zu verschiedenen gestalttherapeutischen Traumaschwerpunkten bildet neben eigenen Fallvignetten den praxisorientierten Abschluss.
Geschichte der Traumatherapie und Traumatheorien
Die Beschäftigung mit den lang anhaltenden und auch seelischen Folgen von Gewalt und Verletzungen lassen sich bis in die Antike zurückverfolgen. Den delphischen Orakelspruch für die unheilbare Wunde des durch Achilles Speer verwundeten Telephos interpretierte dieser damit, neun Jahre nach der Verletzung Rost von Achilles Speerspitze abzukratzen und auf die Wunde zu streuen. Erst dadurch wurde sie geheilt. In dieser kurzen Geschichte offenbart sich ein sechsgliedriges Wissen um Heilprozesse:
1. Sicherheit, der Speer wird nicht mehr gebraucht, (denn sonst würde er nicht rosten),
2. eine Konfrontation zwischen Täter/Tatwaffe und Opfer findet statt,
3. die nicht mehr gebrauchte Waffe muss als eine Art Täter/Opfer-Ausgleich dem Opfer zur Verfügung gestellt werden, damit es diesen Rost erhalten kann,
4. Das ursprünglich Verletzende führt in abgeschwächter, »assimilierbarer« Form zur Heilung,
5. die verstreichende Zeit wird eingerechnet, die es dauert, bis die Speerklinge rostet und
6. die Einschätzung der Tat ist durch einen Transformationsprozess verändert. Die Realität dieses Transformationsprozesses wird erlebt und stößt die Heilung an.
In unserer Kultursphäre und Zeit wurde das Traumathema bereits zum Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich anhand gerichtsmedizinischer Befunde über massive Kindesmisshandlungen durch Charcot aufgegriffen und von Janet (1889, zit. nach van der Kolk 2000, 223) sehr genau zu den Themenfeldern Dissoziation, Gedächtnisstörung und Organisation der seelischen Prozesse ausgearbeitet (Streeck-Fischer, Sachsse & Özkan 2001, 12). In England wurde die Thematik durch Ängste bei der Einführung der Eisenbahn als railway spin bewusst. Im 1. Weltkrieg wurde das Phänomen der Traumatisierung als »Kriegszittern« beobachtet und in England rasch mit dem Begriff shell shock (Granatenschock) belegt (Radkau 1998, 430). In den Anfängen hatte vor allem das Militär (Butollo 2003, 4) Interesse an der Behandlung und Entschärfung posttraumatischer Ausfälle von Soldaten, im russisch-japanischen Krieg 1904/5 wurden hierfür erstmals Militärpsychiater eingesetzt (Watson 1982, 206f). Durch die Sensibilisierung gegenüber den Symptomen wurden aber auch bei anderen Opfern von schlimmen Ereignissen wie Verkehrsunfällen, Schiffsunglücken oder Naturkatastrophen ähnliche Symptome festgestellt.
Das Interesse von Psychotherapeuten für die Behandlung der Folgen traumatischer Erlebnisse hat in den letzten 25 Jahren in hohem Maße zugenommen, sodass ein regelrechter Boom der Traumaforschung beobachtet werden konnte. Die Diagnose Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) wurde erst 1980 in das DSM III aufgenommen (van der Kolk et al. 2000, 86).
Einflussreiche Gründe dafür waren die lang andauernden psychischen Folgen bei Betroffenen. Zu diesen zählten unter anderem die Opfer des Holocausts, Vietnamveteranen sowie sexuell missbrauchte Frauen und Mädchen. Für diese letzte Gruppe schärfte sich das Bewusstsein im Gefolge der Diskussionen der Frauenrechtsbewegung um sexuelle Selbstbestimmung und sexuellen Missbrauch. In Europa wurden die psychischen Folgen der Bürgerkriege im ehemaligen Jugoslawien von verschiedenen Forschern genauer untersucht (z.B. Butollo, Krüsmann & Hagl 1998, Butollo, Hagl & Krüsmann 2003). Der 11. September 2001 mit der Zerstörung der Zwillingstürme in New York führte auch bei Gestalttherapeuten zu einer Fokussierung auf das Traumathema, was sich in einem Themenheft (2004) der elektronischen Zeitschrift Gestalt! zeigte. Die Diskussion um die Diagnose PTBS ist gegenwärtig weiter im Fluss und wird weitere Differenzierungen erfahren. (Butollo, Hagl, Krüsmann 2003, 189)
Eigene Traumatisierungen als lebensgeschichtlicher Hintergrund bei Fritz Perls
Perls charakterisiert seine Kindheit und sein junges Erwachsenenalter selbst als traumatisch. Dabei können mindestens fünf traumatische Einflüsse unterschieden werden.
1. Gewalt, Ablehnung, heftigste Prügeleien und der Versuch den Willen des Kindes Fritz auszulöschen,
2. sozialer Ausschluss und Repression an der Schule als Jude,
3. Kriegstraumatisierungen im 1. Weltkrieg mit Verlust seines besten Freundes, mit möglicher Retraumatisierung durch seine Psychoanalyse bei Harnack
4. Trauma der erzwungenen Emigration
5. Ermordung des Großteils seiner gesamten Familie, Verwandtschaft, vieler Freunde, Lehrer und Kollegen.
1) »Meine Mutter schlug mich mit Teppichklopfern. Sie konnte mich nicht brechen, ich zerbrach die Teppichklopfer.« (Perls 1981, 313). Bocian (2002, 39) vermutet, dass die folgende Passage aus Perls 1981 (290) zumindest mit eigenem Erleben vermischt ist: »Nie vergaß er, dass sein Vater ihn des öfteren »ein Stück Scheiße« nannte. Die Reaktionen der Eltern (…) erlebte er als existentiell vernichtend. »Ich will dich auslöschen, du sollst nicht leben. An deiner Stelle soll ›nichts‹ sein. (…) Wir erziehen dich. Bis du so wirst wie Wir, Wir, Wir, Wir dich haben wollen.« Bocian führt über Perls weiter aus: »Eine traumatische Neurose definiert er an einer Stelle als Verteidigungsstrategie, um sich gegen die »Überfälle der Gesellschaft« (Perls 1979, 49, zit. nach Bocian 2002) zu schützen. »Das zweijährige Kind z.B., das von seinen Eltern in einer dunklen Kammer eingeschlossen wurde, ist fast einer unerträglichen Anspannung unterworfen. Es wird durch ihr Verhalten auf ein Nichts reduziert – ja auf weniger als ein Nichts; es wird zu einem Objekt ihrer Manipulation ohne eigenes Recht und eigene Macht. Es gibt kein ›Ich‹ mehr, es gibt nur ›sie‹ und was ›sie‹ tun können« (ebd.). Bei der Durchsicht der Kurzvariante seiner Autobiographie (Perls 1993) fällt die schwierige Kindheitssituation und die fehlende soziale Unterstützung auf. Das Kind kann nicht verstehen, was geschieht. Verstehbarkeit ist aber nach Antonovsky (1997) eine wichtige Ressource, um ein Ereignis als weniger beschädigend und traumatisierend zu erfahren, ihr Fehlen erhöht die Gefahr traumatischer Verarbeitung.
2) »Diese Schule war ein Albtraum für mich« (Perls 1981, 193). »Selten haben so wenige Lehrer so viele Schüler gequält. Das Grundprinzip war Disziplin und Antisemitismus« (ebd., 280).
3) Perls berichtet über Erlebnisse aus dem 1. Weltkrieg im Jahr 1916: Perls hat eine Grippe mit hohem Fieber entwickelt, wird in einem Feldlazarett untergebracht. Er träumt: »meine Familie, im Vordergrund Grete, die Schwester, die ich liebe, steht um mein Grab herum und bittet mich ins Leben zurückzukehren. Ich bemühe mich, strenge mich an, biete alle meine Kräfte auf und schaffe es. Langsam, ganz langsam kehre ich zurück ins Leben, bereit, wenn auch nicht allzu bereit den Tod loszulassen, den Tod, der so viel erträglicher war als die Schrecken des Krieges.« Perls verbrachte neun Monate in den Schützengräben des Stellungskrieges in Flandern, wo der Gaskrieg erstmals erprobt und auf das heftigste geführt wurde. »Ich hatte bereits einen gewissen Grad an Härte und Gefühllosigkeit erreicht, aber es gab zwei Formen des Todes, die ich kaum ertragen konnte. Das eine waren die Kommandos nach den Angriffen. Nachdem die Gas-Wolke über die feindlichen Linien gezogen war, kletterten sie aus ihren Gräben. Sie waren mit einem langen biegsamen Hammer ausgerüstet, mit dem sie jeden der noch ein Lebenszeichen von sich gab, erschlugen. (…) Das andere passierte nur einmal. (…) In dieser Nacht machten wir einen weiteren Gas-Angriff. Öffnet die Ventile. Die gelbe Wolke kriecht in Richtung auf die (feindlichen) Gräben. Dann ein plötzlicher Wirbel. Der Wind ändert seine Richtung. Die Gräben verlaufen in Zick-Zack-Linien. Das Gas kann in unsere eigenen Gräben ziehen… und bei vielen funktionieren die Gasmasken nicht. Und viele, viele erleiden leichte und schwere Vergiftungen und ich bin der einzige Arzt und habe nur vier kleine Sauerstoff-Flaschen und jeder verlangt verzweifelt nach etwas Sauerstoff, klammert sich an mich und ich muss ihm die Flasche entreißen, um einem anderen Soldaten etwas Linderung zu verschaffen. Mehr als einmal war ich versucht, die Gasmaske von meinem schweißgebadeten Gesicht zu reißen.« (Perls 1981, 164f) Nachdem er diese Kriegsberichte aufgeschrieben hat, beschreibt sich Perls am nächsten Tag wieder so: »Heute morgen fühlte ich mich dem Wahnsinn nahe. Worte krochen wie Termiten über meinen ganzen Körper.« (ebd., 169)
Bocian (2002, 88f) geht mit Faiss (zit. in Bocian 2002) von einem starken Kriegstrauma bei Perls aus, das ihn für den Rest seines Lebens verbitterte (Zeff, zit. nach Bocian 2002) und zum Zyniker werden ließ (Perls 2003, 49f).
Perls (1993) selbst spricht von desensitization, einer Desensibilisierung, was in der Traumaliteratur als Abstumpfung oder numbing bezeichnet wird. Diese innere Panzerung aufzulösen und die Lebendigkeit und Lebensfreude wiederzugewinnen ist ein vermutlich daraus erwachsenes dringendes Anliegen. Bocian (2002, 90) sieht diese biographisch bestimmten Themen als zentral für die Entwicklung der Gestalttherapie. Bocian (2002, 112) nennt die in dieser Zeit und der nachfolgenden Weimarer Republik erfahrene »tief greifende Erfahrung der Verunsicherung, ja Dissoziation des Ich« (Vietta, zit. nach Bocian 2002) den Gegenpol zur Sehnsucht nach einer persönlich erlebten guten Gestalt von Perls. Die als Heilungshoffnung aufgesuchte zweite Lehranalyse bei dem extrem abstinenten Analytiker Harnak empfand er als Qual (Bocian 2002, 178). Der Analytiker Venzlaff (2001, 148) schreibt über die Abstinenzhaltung des Analytikers gegenüber Traumatisierten, besonders bei KZ-Überlebenden: »Die von der Psychoanalyse vorgeschriebene Abstinenzhaltung des Analytikers ließ den Patienten diesen in der Übertragungssituation als neuerlichen Aggressor erleben, wirkte oft in hohem Maße angstauslösend und somit antitherapeutisch.«
4) In seinem Interview mit Jim Simkin 1966 schildert Fritz Perls (1992, 23): »In Deutschland, nun dort haben wir einigermaßen komfortabel gelebt. Ich hatte mein Einkommen und Lore bekam etwas Geld von zu Hause. Dann gingen wir nach Holland, wo wir dann in größter Armut lebten. Als ich nach Holland floh, hatte ich eine Summe von umgerechnet 25 Dollar in meinem Feuerzeug versteckt. Und nun durften wir überhaupt kein Geld verdienen. Wir lebten von der Wohlfahrt, im tiefsten Winter auf einem Dachboden. Und Lore musste putzen gehen, das hatte sie vorher noch nie gemacht, und kalt war es, wir froren uns halb tot.«
Lore berichtet, dass sie sehr gefährdet waren »als Mitglieder der antifaschistischen Liga. Sie kamen immer nachts zwischen zwei und vier. Die letzten Nächte schliefen wir jede Nacht woanders.« (DVG-Film 2005)
5) Beim Schreiben seiner Autobiographie und beim Nachdenken darüber, ob er eine jüdische Identität habe, und wie diese sei, berichtet Perls Folgendes: »Ich erwache heute morgen benommen und schwer. Saß auf meinem Bett, dumpf und in einer Trance wie ich sie bei Insassen von psychiatrischen Kliniken gesehen habe, die sich in ihre Grübeleien zurückgezogen hatten. Geister, die Opfer Hitlers, meist Verwandte von mir und Lore besuchen mich, zeigen mit dem Finger auf mich: »Du hättest mich retten können«. Sie wollen, dass ich mich schuldig und für sie verantwortlich fühle.« (Perls 1981, 135f)
Perls kann daher als kindheitstraumatisiert sowie als kriegstraumatisiert angesehen werden. Auf seine Traumatisierung deutet auch seine doch erst sehr späte »Heilung« durch Ida Rolf hin, da aus der Therapie von Traumapatienten inzwischen bekannt ist, dass vor allem der Einbezug und die Fokussierung auf körperlich-emotionales Erleben eine Traumaauflösung möglich macht. Perls schreibt dazu: »… ich hatte Kontakt zu einer Schicht von zersplitterten und zerstreuten Bruchstücken von winzigen Introjektionen und fremdem Material. Viele bestanden aus körperlichen Empfindungen und Bildern jedoch ohne Zusammenhang. (…) Ich habe nicht die geringste Ahnung wie, aber offensichtlich bewirkte dieser Kontakt eine Veränderung. Meine zwanghafte Lüsternheit ließ wirklich nach. (…) Vor etwa drei Monaten gab ich mein zwanghaftes Masturbieren auf und es ist praktisch nichts mehr davon da. (…) ich weiß, dass eines Tages etwas ähnliches mit meinem Rauchen passieren wird« (Perls 1981, 267). Seine Sex- und Nikotinsucht können als weitere traumainduzierte Spannungszustände angesehen werden. Levine schreibt: »Zwanghaftes, perverses, promiskuitives und gehemmtes Verhalten in der Sexualität sind oft Anzeichen für das Bestehen eines Traumas und müssen nicht unbedingt durch sexuellen Missbrauch hervorgerufen worden sein (Levine 1998, 41).
Sein Verhältnis zu seinen Kindern, seine Prügelorgien gegenüber seiner Tochter (»he wanted to beat the hell out of me«: Renate Perls im biographischen Laura-Perls-Film ›Leben an der Grenze‹, 2005) sind weitere Hinweise auf seine traumageprägte Persönlichkeit im Sinne einer Wiederholung als hilfloser Versuch einer Täter-Opfer-Umkehr.
PTSD-Diagnostik
Innerhalb der Gestalttherapie ist die Entwicklung einer theorie- und therapieangemessenen Diagnostik insbesondere während der Anfangsjahre nicht mit großer Entschiedenheit vorangetrieben worden bzw. wurde immer wieder durch das Bestehen auf einer reinen Prozessdiagnostik erschwert. Einen der neueren Ansätze diagnostischen Herangehens legte Dreitzel (2004) mit einer prozessorientierten Gestaltdiagnostik vor. Für Traumabetroffene erscheint vor Therapiebeginn eine Abklärung der Symptome mit Hilfe diagnostischer Manuale bzw. Tests als sinnvoll, da das Übersehen einer traumabedingten Störung und eine unvorsichtige therapeutische Praxis unter Umständen eine Reinszenierung oder Reaktivierung bislang kompensierbarer Erlebnisse nach sich ziehen kann, die zu einer erneuten Verschlechterung der psychischen Situation mit sehr leidvollen Folgen für Betroffene führen kann. Eine sehr gute Übersicht über Traumadiagnostik geben Butollo, Krüsmann & Hagl (1998, 207f). Ein gestalttherapeutischer Diagnostikbogen, der auch für den Traumabereich helfen kann, die zentralen Konfliktfelder genauer einzugrenzen, findet sich bei Hartmann-Kottek (2004, 200). Auch Kepner (1995, 293f) legt ein eigenes zweiteiliges gestalttherapeutisches Testinstrument zur Einschätzung des Trauma- und Verarbeitungsniveaus vor, mit direkten Ableitungen für sein Traumastufenmodell healing tasks.
Das DSM-IV (1996, 491f) nennt folgende Kriterien für das Vorliegen einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS):
A Die Person wurde mit einem traumatischen Ereignis konfrontiert, bei dem die beiden folgenden Kriterien vorhanden waren:
1. Die Person erlebte, beobachtete oder war mit einem oder mehreren Ereignissen konfrontiert, die tatsächlichen oder drohenden Tod oder ernsthafte Verletzung oder Gefahr für die körperliche Unversehrtheit der eigenen Person oder anderer Personen beinhaltet.
2. Die Reaktion der Person umfasste intensive Furcht, Hilflosigkeit oder Entsetzen. Beachte: Bei Kindern kann sich dies auch durch aufgelöstes oder agitiertes Verhalten äußern.
B Das traumatische Ereignis wird beharrlich auf mindestens eine der folgenden Weisen wiedererlebt:
1. Wiederkehrende und eindringliche belastende Erinnerungen an das Ereignis, die Bilder, Gedanken oder Wahrnehmungen umfassen können. Beachte: Bei kleinen Kindern können Spiele auftreten, in denen wiederholt Themen oder Aspekte des Traumas ausgedrückt werden.
2. Wiederkehrende, belastende Träume von dem Ereignis. Beachte: Bei Kindern können stark beängstigende Träume ohne wiedererkennbaren Inhalt auftreten.
3. Handeln oder Fühlen, als ob das traumatische Ereignis wiederkehrt (beinhaltet das Gefühl, das Ereignis wiederzuerleben, Illusionen, Halluzinationen und dissoziative Flashback-Episoden, einschließlich solcher, die beim Aufwachen oder bei Intoxikationen auftreten). Beachte: Bei kleinen Kindern kann eine traumaspezifische Neuinszenierung auftreten.
4. Intensive psychische Belastung bei der Konfrontation mit internalen oder externalen Hinweisreizen, die einen Aspekt des traumatischen Ereignisses symbolisieren oder an Aspekte desselben erinnern.
5. Körperliche Reaktionen bei der Konfrontation mit internalen oder externalen Hinweisreizen, die einen Aspekt des traumatischen Ereignisses symbolisieren oder an Aspekte desselben erinnern.
C Anhaltende Vermeidung von Reizen, die mit dem Trauma verbunden sind oder eine Abflachung der allgemeinen Reagibilität (vor dem Trauma nicht vorhanden). Mindestens drei der folgenden Symptome liegen vor:
1. Bewusstes Vermeiden von Gedanken, Gefühlen oder Gesprächen, die mit dem Trauma in Verbindung stehen.
2. Bewusstes Vermeiden von Aktivitäten, Orten oder Menschen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen.
3. Unfähigkeit einen wichtigen Aspekt des Traumas zu erinnern.
4. Deutlich vermindertes Interesse oder verminderte Teilnahme an wichtigen Aktivitäten.
5. Gefühl der Losgelöstheit oder Entfremdung von Anderen.
6. Eingeschränkte Bandbreite des Affektes (z.B. Unfähigkeit, zärtliche Gefühle zu empfinden),
7. Gefühl eine eingeschränkte Zukunft zu haben (z.B. erwartet nicht Karriere, Ehe, Kinder oder ein normal langes Leben zu haben).
D Anhaltende Symptome erhöhten Arousals (vor dem Trauma nicht vorhanden). Mindestens zwei der folgenden Symptome liegen vor:
1. Schwierigkeiten ein- und durchzuschlafen,
2. Reizbarkeit oder Wutausbrüche
3. Konzentrationsschwierigkeiten
4. übermäßige Wachsamkeit (Hypervigilanz),
5. übertriebene Schreckreaktion.
E Das Störungsbild (Symptome unter Kriterium B, C und D) dauert länger als einen Monat.
F Das Störungsbild verursacht in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigung in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen.
Zeitlich lässt sich die PTSD in drei Typen klassifizieren:
Akut: Wenn die Symptome weniger als 3 Monate andauern.
Chronisch: Wenn die Symptome mehr als 3 Monate andauern
Mit verzögertem Beginn: Wenn der Beginn der Symptome mindestens sechs Monate nach dem Belastungsfaktor liegt.
Meichenbaum 1994 (zit. nach Butollo 2003, 9) unterscheidet Trauma vom Typ I und Typ II.
Typ I : Unerwarteter traumatischer Stressor: Dies ist ein plötzliches, überwältigendes Ereignis von begrenzter Dauer, das sich tief ins Gedächtnis eingräbt, im Detail erinnert wird und zu typischen PTSD-Symptomen wie Intrusionen führt, mit einer wahrscheinlich schnellen Restabilisierung, z.B. Vergewaltigungen, Unfälle, Naturkatastrophen.
Typ II: Anhaltende und wiederholte schwere Stressoren, zuerst wie Typ I, dann wiederholt, das Opfer ist machtlos es zu vermeiden, meist durch Menschen verursacht, mit unvollständigen Erinnerungen, vermehrten Dissoziationen (als Copingmöglichkeit), führt eher zu verändertem Selbstkonzept und Gefühlen der Scham und Wertlosigkeit, sowie lang anhaltenden Persönlichkeitsveränderungen mit emotionalen und sozialen Problemen. Auslösende Situationen sind z.B. physischer und/oder sexueller Missbrauch, Kriegseinsatz, Gefangenschaft, Folter.
Je nach Art und Kontext der Traumaentstehung können verschiedene Bereiche unterschieden werden, die auch noch weiter unterteilt werden können: Durch Menschen verursachte Traumata (man-made), Naturkatastrophen und Unfälle, Krankheiten. Angesichts der noch nicht abgeschlossenen Diskussion um die Diagnostik traumatischer Störungen werden sich weitere Differenzierungen wahrscheinlich in zukünftigen Diagnosemanualen niederschlagen.
Dissoziation
Dissoziation ist die Aufspaltung des Erlebten. Es werden drei Formen unterschieden (nach van der Kolk 2000, 245).
1. Primäre Dissoziation: Dabei wird das, was erlebt wird, nicht vollständig bewusst, sondern sensorisch oder emotional aufgespalten, ohne Integration in eine persönlich verbale Schilderung.
2. Sekundäre Dissoziation: Trennung zwischen einem beobachtenden und einem erlebenden Ich. Im Moment des Traumas wird der Körper verlassen und das Ganze von einer entfernteren Position aus betrachtet.
3. Tertiäre Dissoziation: Deutlich von einander unterscheidbare und z.T. nicht mit einander in Kontakt stehende Ich-Zustände mit jeweils eigenen kognitiven affektiven und Handlungsmustern. Manche dieser Ich-Zustände enthalten die traumatischen Erfahrungen, andere nicht. Dies tritt z.B. bei dissoziativen Identitätsstörungen auf.
Janet (1889, zit. nach van der Kolk 2000, 321) nannte die Dissoziation das Hauptproblem bei Traumata. Die Erinnerung an das, was geschehen ist, kann nicht in die eigenen Schemata integriert werden. Sie wird von den anderen Erfahrungen abgespalten. »Unfähig, die traumatischen Erinnerungen zu integrieren, haben sie anscheinend auch die Fähigkeit verloren, neue Erfahrungen zu assimilieren. Es ist, (…) als wäre ihre Persönlichkeit endgültig an einem bestimmten Punkt stehen geblieben und könnte sich nicht mehr durch Hinzufügung oder Assimilation neuer Bestandteile erweitern. (Janet 1919, zit nach van der Kolk 2000, 322). Auch van der Kolk et al. (2000, 199) nehmen an, dass Dissoziationen zum Zeitpunkt des Traumageschehens ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung einer PTBS sind.
Ausagieren (acting out)
Traumatische Erlebnisse werden häufig wiederholt mit dem impliziten Wunsch, sie nun zu einem guten Abschluss zu bringen. Dabei ist teilweise nur die Handlung der traumatischen Situation durch ihre Wiederholung zugänglich. »Die Wiederholungen sollen dazu dienen eine Gestalt zu schließen« (Perls 1981, 69). Die offen gebliebene Gestalt des traumatischen Erlebnisses führt dabei ähnliche Situationen herbei bzw. greift diese auf, um eine erfolgreiche Lösung zu versuchen. Diese Lösung misslingt in vielen Fällen, da kein Entwicklungsschritt die in der damaligen traumatischen Situation fehlende Sequenz hinzufügen konnte. Durch diese Wiederholungen kann sich die traumatische Verarbeitung des Ereignisses verfestigen, bzw. es kann zu weiteren erneuten Traumatisierungen kommen, den akkumulierten Traumata, die leider häufig zu beobachten sind. Aufgrund der Primärtraumatisierung fehlen zum einen Schutzmechanismen, zum anderen werden Situationen mit viel Aufregung und Wiederholungsmöglichkeiten zur Umkehr, zum Abschluss und zur Heilung dieser Gestalt gesucht. Die Auflösung des Traumas beinhaltet die sinnliche Zugänglichkeit der auslösenden Situation. Durch das bewusste Wiedererleben des Traumas und das damit verbundene innere Zusammenfügen, kann es verwandelt werden, transformiert werden und abgeschlossen werden. Dies ist nicht zu verwechseln mit dem Wieder-Erinnern oder -Erleben einzelner abgespaltener Aspekte. Ein Beispiel für diese Wiederholung ist Perls‹ Erleben der Ablehnung von Freud als Wiederholung der Ablehnung durch seinen Vater und in der Folge als eigene Ablehnung seines Sohnes Steve. Perls hatte das Konzept des oralen Widerstandes ausgearbeitet, um von Freud endlich die ersehnte Anerkennung zu erhalten, und hatte die 4000 km weite Reise aus Südafrika, wo er ein psychoanalytisches Institut aufgebaut hatte, auf sich genommen, um zur Präsentation seiner Hypothesen zu kommen. Perls (1981, 58f) beschreibt dies so: »Ich vereinbarte einen Termin, wurde von einer ältlichen Frau empfangen (ich nehme an, seiner Schwester) und wartete. Dann öffnete sich die Tür etwa einen Meter breit und da war er, vor meinen Augen. Es wirkte seltsam, dass er die Tür nicht verließ, aber damals wusste ich noch nichts von seinen Phobien. »Ich bin aus Südafrika gekommen, um einen Vortrag zu halten und um Sie zu sehen.« »Und wann fahren Sie zurück?« sagte er. Ich erinnere mich nicht an den Rest der (etwa vierminütigen) Unterredung. Ich war schockiert und enttäuscht. Einer seiner Söhne war beauftragt mit mir essen zu gehen. Ich hatte eine schnelle Schockreaktion erwartet, aber ich war lediglich wie betäubt.«
Komorbidität:
Die Folgen traumatischer Erlebnisse können eine Vielzahl psychiatrischer Störungsbilder wie Depressionen, Borderlinestörungen, Dissoziative Identitätsstörungen, Phobien, Panikstörungen, generalisierte Angststörungen, oder süchtiges Verhalten in unterschiedlichen Ausprägungen sein (Butollo, Hagl, Krüsmann 2003, 59f; Butollo & Hagl 2003, 13). Auch van der Kolk (2000) zählt als mögliche Folgen traumatischer Belastungen folgende Störungsbilder auf: Borderlinestörungen, Somatisierungsstörungen, Dissoziative Störungen, Selbstverstümmelung, Essstörungen. Für die Behandlung hat es entscheidende Auswirkungen, ob ein bestimmtes Verhalten als erklärbar und aus bestimmten Einwirkungen heraus entstanden gesehen wird oder ob es lediglich als verrückt angesehen wird.
Protektiv- und Vulnerabilitätsfaktoren
Aus der Entwicklungsforschung ist bekannt, dass die traumatische Verarbeitung bestimmter Erlebnisse von erlebtem Schutz oder erworbener und erlebter Verletzlichkeit beeinflusst wird. Diese Gegenspieler werden Protektiv- und Vulnerabilitätsfaktoren genannt. Wichtige Protektivfaktoren sind das Bestehen zumindest einer sicheren Bindung zu einem anderen Menschen, feinfühlige Erziehungspersonen, ruhiges Temperament, den vitalen Bedürfnissen entsprechende Lebensbedingungen, soziale Zugewandtheit, Wohlstand, Intelligenz, Kommunikationsfähigkeit, Kreativität, Erfahrungen von Bewältigung schwieriger Ereignisse. Über den Zusammenhang zwischen Bindung und Trauma gibt Maragkos (2003) Aufschluss. Vulnerabilitätsfaktoren sind Geburtskomplikationen, besonders mit kurzfristigem Sauerstoffmangel des Gehirns, schwieriges Temperament, frühe unsichere und unzuverlässige Bindungs- und Beziehungserfahrungen, Armut, fehlendes Verständnis der Welt, Verlust wichtiger Bezugspersonen, Trennung der Eltern, Schulwechsel, Umzug/Migration, Krankheit, Behinderung, Arbeitslosigkeit. Als potenziell gefährdende Einflüsse können alle Formen kritischer Lebensereignisse angesehen werden.
Neurobiologische Grundlagen der PTSD
Traumatische Erfahrungen beeinflussen das Gedächtnis. Dies kann überdeutliches Erinnern oder aber auch das völlige Vergessen bestimmter Ereignisse zur Folge haben. Oft werden vor allem die sensorischen oder emotionalen Anteile der Ereignisse erinnert. Rauch (1996; in: van der Kolk et al. 2000, 215f) zeigte in einer Positronen-Emmissions-Tomographie, dass bei Traumaüberlebenden, die an das Trauma erinnernde Reize dargeboten bekamen, die Gehirnareale, welche für emotionale Zustände und vegetative Erregung zuständig sind, ganz besonders die Amygdala, stärker durchblutet waren. Gleichzeitig sank der Sauerstoffverbrauch im Broca-Areal, wo Worte für innere Zustände erzeugt werden. Dies kann als ein physiologischer Beleg der Sprachlosigkeit traumatischer Erfahrungen gelten. Weitere Untersuchungen zu Somatisierungsstörungen (van der Kolk et al., 181) und Substanzmißbrauch (ebd., 178) zeigten einen engen Zusammenhang zu Traumatisierungen in der Vorgeschichte. Saxe (1994, in: van der Kolk et al. 2000, 180) fand heraus, dass bei Abwesenheit schwerer Traumata in der Vorgeschichte Somatisierungsstörungen nur selten sind. Das deklarative oder explizite Gedächtnis ist für die Speicherung von Tatsachen und Ereignissen die der Betreffende erlebt hat, zuständig. Das prozedurale oder implizite Gedächtnis speichert Fähigkeiten; Gewohnheiten, emotionale Reaktionsweisen, Reflexhandlungen. Die Forschungsergebnisse aus dem Bereich der Gedächtnisforschung weisen darauf hin, dass bei starken Emotionen und bei traumatischer Stresseinwirkung die Speicherung von Ereignissen und Tatsachen nicht stattfindet und das explizite Gedächtnis gestört wird. Dies erfolgt vermutlich durch eine Schädigung des für das explizite Gedächtnis verantwortlichen Hippokampus. Er wird durch die für ihn toxisch wirkenden Stresshormone geschrumpft und steht nicht mehr ausreichend zur Verfügung. Dadurch wird das Erlebte zersplittert in sensorischen, emotionalen Bruchstücken gespeichert, oder in Handlungserfahrungen, die dann im enacting wieder nachgespielt werden. Die Betroffenen sind also in einen Schrecken ohne Sprache eingeschlossen, der in vollem Ausmaß wiedererlebt wird, zu dem aber kein Kontakt herstellbar ist. Dies hat für das psychotherapeutische Handeln größte Bedeutung, da es hier wichtig ist, einen Verständnisrahmen für das zu finden, was vorgefallen ist. Die Amygdala gilt als Schaltstelle für Gefühle im Gehirn zu anderen Verarbeitungsstrukturen und auch für die Weiterverarbeitung im Neokortex. Van der Kolk et al. (2000, 217) nehmen an, dass die Amygdala sich bei besonders starker Aktivierung durch bestimmte Reize von der subjektiven Wahrnehmung abkoppeln kann und sich daher intensive emotionale Reizung hinderlich auf eine angemessene Verarbeitung der Erfahrungen auswirken kann. Solange sich eine Person durch ihre eigenen Kräfte oder fremde Mächte beschützt und sicher fühlt, wird sie keine seelische Beschädigung erfahren. Sobald allerdings die Ohnmachtserfahrung eintritt, ist eine traumatische Verarbeitung der Ereignisse möglich. Diese besteht unter anderem in einer erhöhten Erregbarkeit und Suche nach möglichen Hinweisreizen für eine Wiederholung des Traumas. Diese vermeintlichen Auslöser werden dann im Zuge einer phobischen Abwehr (Butollo 1999, 96) vermieden. Eine weitere Schwierigkeit für traumatisierte Menschen ist, sich emotional neutralen, aber bedeutsamen Dingen zuzuwenden. McFarlane, Weber & Clark (1993, zit. nach van der Kolk 2000, 203) zeigten, dass es für Traumabetroffene schwerer ist, wesentliche, aber emotional nicht erregende Ereignisse von unwesentlichen, aber emotional erregenden zu unterscheiden, bzw. die unwichtigen Stimuli zu neutralisieren. Die Reaktion auf normale Ereignisse ist für traumatisierte Menschen offensichtlich schwieriger. Diese Schwierigkeiten der Emotionsregulation führen zu Problemen im Alltagsleben und zu einer verminderten Teilnahme am normalen Alltagsleben. Die dauerhaften Veränderungen neurophysiologischer Prozesse mit Übererregung, Überreaktionen auf Stimuli, Ängsten, Phobien, sozialem Rückzug mit Veränderungen der kognitiven und emotionalen Schemata sind Auswirkungen, die sich leicht verselbstständigen können. Van der Kolk et al. (2000) nennen die PTBS deshalb auch eine »biopsychosoziale Falle«. Damit ist gemeint, dass die neurophysiologische Beeinträchtigung bezüglich des Herunterregelns von Erregung die spontane Löschung der erworbenen Konditionierungen verhindert oder dass die Vermeidung innerpsychischer Auslöser die mit dem Trauma in Verbindung stehen wirksame Trauerarbeit verhindert. Die sozialen Beeinträchtigungen verhindern auch schützendes und heilendes Interaktionsverhalten mit anderen Menschen.
Verknüpfungen und Querbeziehungen zur Gestalttherapie – Wegbereiter und Wegbegleiter gestalttherapeutischer Traumatherapie
Goldstein: Angst als Katastrophenerwartung
Goldsteins Forschung an Kriegsverletzten des 1. Weltkrieges kann als eine erste klinische Anwendung gestaltpsychologischen Denkens auf konkrete klinische Probleme gesehen werden (vgl. Votsmeier 1995). Die Rehabilitation insbesondere Schädel-Hirn-Verletzter, aber auch die psychologische Begleitung und Aspekte PTSD-bezogener Symptome stand dabei im Vordergrund. Wichtig für hier ist die Angsttheorie von Goldstein. Angst wird hier als eine Erschütterung des Eingewoben-Seins des Organismus in das Umweltfeld gesehen. Goldstein schreibt über die innere Selbstverwirklichungstendenz des Menschen im Organismus-Umweltfeld, dass (1934, 58) »ein Organismus nur sein kann, wenn es ihm gelingt, in der Welt eine adäquate Umwelt zu finden, sie herauszuarbeiten, wozu natürlich die Welt die Möglichkeit geben muss. Und weiter … »beim kranken Menschen … besteht die Grundvoraussetzung der Existenz darin, dass er wieder eine adäquate Umwelt aus der Welt herauszuschälen vermag.« (ebd.). Goldstein (1934, 24) unterscheidet zwei Grundverhaltensweisen: … »geordnetes Verhalten mit dem Gefühl der Leichtigkeit, des Behagens, der Entspannung, Angepasstheit an die Welt, der Freude« im Gegensatz zu »katastrophalen Reaktionen, die sich als ungeordnet, wechselnd, widerspruchsvoll, eingebettet in Erscheinungen körperlicher und seelischer Erschütterung« (erweisen. … Der Kranke … befindet sich (dabei) in einem Zustand, der gewöhnlich als Angst bezeichnet wird. Goldstein (1934, 187f) definiert Angst in Anlehnung an Kierkegard und Heidegger als zusammenhängend mit dem »Nichts«. Goldstein formuliert: »Der Kranke erlebt eine Erschütterung im Bestande der Welt wie des eigenen Ich … Diese Erschütterung ist erlebnismäßig das, was wir Angst nennen.« Der Kranke hat nach Goldstein nicht Angst, »der Kranke ›ist‹ Angst. Die Angst tritt also dann auf, wenn die Verwirklichung der der Wesenheit eines Organismus entsprechenden Aufgaben unmöglich geworden ist. Das ist die Gefährdung bei Angst.« (ebd.) Furcht definiert Goldstein (1934, 191) als Angst vor der Angst und auf Objekte gerichtet, welche Angst eintreten lassen können. Goldstein unterscheidet: »Die Furcht stärkt die Sinne, die Angst macht sie unbenutzbar, die Furcht treibt zum Handeln, die Angst lähmt. Der Angst können wir nur entgehen, indem wir Furchtsituationen vermeiden.« (ebd.)
EMDR
Das EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) wurde von Francis Shapiro in der Arbeit mit Vietnamveteranen entwickelt. Auf die gestalttherapeutischen Wurzeln der Begründerin der EMDR-Therapie Francis Shapiro weist Hartmann-Kottek (2004, 38) hin, sowie auf die inhaltliche Ähnlichkeit zwischen dem EMDR-Ansatz und der Gestalttherapie. Bei der EMDR-Technik wird zuerst imaginativ ein Sicherheitszustand erzeugt, z.B. als sicherer Ort. Dann wird ein bewegter Reiz, meist die Hand des Therapeuten vor den Augen des Klienten, regelmäßig hin- und herbewegt, oder als Berührreiz rhythmisch dargeboten. Gleichzeitig soll in kleinen Zeiteinheiten das Trauma erinnert und in kleinen anschließenden Pausen stichwortartig darüber berichtet werden. Durch dieses erneute, kontrollierte und abgesicherte Durchlaufen des Traumas wird es laut EMDR-Theorie richtig verarbeitet und abgeschwächt. Insbesondere der supportive Anteil der EMDR-Therapie, die Stabilisierungstechniken, wie die innere Helfer-Technik sowie die Distanzierungstechniken, nennt Hartmann-Kottek »genuine Gestalttherapie«. Hartmann-Kottek schlägt für Gestalttherapeuten als Ergänzung das Erlernen der EMDR-Technik vor, sowie die Kenntnis von Indikation und Gegenindikation für die Traumaexposition, verbunden mit einem Gesamtverständnis der Traumaschutzmechanismen.
Reich / Levine
Wilhelm Reich mit seiner genauen Beschreibung und Fokussierung auf Körperprozesse bildet für aktuelle traumatherapeutische Ansätze eine noch immer relevante Basis. Der Körper oder Leib wird als Speicherort traumatischer Erfahrungen begriffen, aber auch als Medium des Zugangs zu versprengten und verschütteten Bruchstücken traumatischer Erlebnisse, sowie als Ort eines Teils einer möglicher Heilung und Integration der Erlebnisse. Fuckert (2002) stellt für den deutschsprachigen Raum eine traumazentrierte Psychotherapie in der Nachfolge Reichs vor, die gerade auch durch Levine inspiriert wurde. Einen der Gestalttherapie verwandten Ansatz legt der in Reichianischer Tradition stehende Traumaforscher Peter Levine (1998, 2005) vor. Bocian (2002, 91, 227f) stellt die interessante Hypothese auf, dass Reich auch bei der Entwicklung seines Ansatzes zur Auflösung von Muskelpanzern vom Motiv der Auflösung seiner eigenen, durch Kriegstrauma bedingten inneren Panzerung geleitet worden sein könnte. Auch Levine betont die wichtige Rolle des Körpers bei der Traumaentstehung. Er betrachtet posttraumatische Symptome als durch Angst unterbrochene physiologische Reaktionen (43), die zu einer Erstarrung oder Immobilität führen. Levine postuliert hier auch das Prinzip der offenen Gestalt, die nach Abschluss drängt. Dazu ist es nötig die Energie, die in der Erstarrung gebunden ist, zu transformieren (ebd., 44). Dazu bedarf es eines unterstützenden Umfeldes: »Wir brauchen die Unterstützung unserer Freunde und Verwandten sowie der Natur.« (ebd., 45) Zentraler Prozess ist bei Levine das Abschütteln des Traumas durch Zittern und Schütteln in Analogie zum Abschütteln der Schockstarre bei Tieren. Levine bezieht bei seiner Traumatherapie die Natur als eine wichtige, uns unterstützende Matrix ein. Dabei benennt er schamanistische Heilungsansätze, die die Wechselwirkung zwischen Natur, der sozialen Gemeinschaft und den Symptomen und Reaktionen des Betroffenen beachteten und nutzen, als eine der Quellen seiner Therapie (ebd., 66, 69). Eine ähnliche Herangehensweise der Integration von schamanistischem, gemeinschaftsorientiertem und naturbasiertem Herangehen liegt auch von St. Just (2005) vor, mit einer stärkeren Betonung feministischer und weiblicher Heilungsperspektiven. Diese Ansätze können als Ausarbeitung ursprünglich gestalttherapeutischer Ansätze genutzt werden. Die Projekte des Gestaltkibuzz bzw. der therapeutischen Gemeinschaften von Fritz Perls an Orten unzerstörter Naturschönheit weisen in eine ähnliche Richtung.
Levine nennt seinen Ansatz »Somatic Experiencing«. Dabei sollen die verloren gegangenen und zersplitterten Teile der Existenz reintegriert werden, ausgelöst durch den starken Wunsch, die Ganzheit wieder zu erreichen. Darin wird durch körperliche Gewahrseinsübungen wie z.B. bewusst sich sanft berühren, duschen oder abklopfen versucht, wieder ein ganzheitliches Körpergefühl herzustellen. Dies hilft, das innere Empfinden als ganzheitliches inneres Gewahrsein zu entwickeln. Wenn dies einigermaßen eingeübt ist, werden klassische Wahrnehmungsübungen wie aus dem Praxisteil von Gestalttherapie eingesetzt (PHG, 1951; das Grundlagenwerk von F. Perls, R. Hefferline, P. Goodman, (1951/2006) als auch die drei Autoren werden mit PHG wiedergegeben. Wenn nicht ausdrücklich vermerkt, ist damit die Neuübersetzung von 2006 gemeint). In aufeinander folgenden Übungsschritten werden nun einzelne traumatypische Reaktionen identifiziert. Levine betont, dass auf kathartische Lösung ausgerichtete Therapien weniger wirkungsvoll seien und oft Retraumatisierungen auslösen können (ebd., 19). Mittels des gelernten inneren Erlebens wird das traumatische Ereignis in der therapeutischen Situation wieder erlebt und kann danach abgeschüttelt werden.
Traumakompetente Konzepte und Modelle der Gestalttherapie
Traumatherapeutisches Verständnis in PHG
Nicht nur die persönlichen Biographien der Gründer der Gestalttherapie sondern auch die inhaltliche Formulierung des Gründungsbuches »Gestalttherapie« sind geprägt durch die Auseinandersetzung mit der Thematik traumatischer Verarbeitung. Dies ist unter anderem der wenn auch abgrenzenden Orientierung an der Freudschen Neurosenlehre und Ätiologie geschuldet, aus der heraus sich die Gestalttherapie gerade entwickelte. Innerhalb der Psychoanalyse war bekanntermaßen die Entstehung von Neurosen ursprünglich auf ein traumatisches Erlebnis zurückgeführt worden, eine Position, die Freud von Janet und Charcot übernommen hatte, später aber abschwächte und revidierte (Streeck-Fischer, Sachsse & Ökzan 2001, 12). Im Folgenden werden nun die für eine Traumatherapie entscheidenden Begriffe herausgearbeitet. Diese Beschreibungen wurden von PHG nicht explizit für Traumatherapie entwickelt, sondern eher für eine »normale« Neurosentherapie. Und doch ist Gestalttherapie mit Beschreibungen traumatischer Konstellationen reich ausgestaltet und voll tiefen Verstehens traumatheoretischer Prozesse. Gerade die Zeit der Entstehung von Gestalttherapie ist eine zutiefst von den Traumata zweier Weltkriege geprägt Epoche gewesen.
Schöpferische Anpassung
Wir glauben, dass die Konzentration auf eine gegenwärtige Angelegenheit, … zu einer Gestalt führt, die ein tatsächliches Problem löst. (PHG 2006, 47) Diese schöpferische Anpassung wird durch die organismische Selbstregulation vorangetrieben, bzw. ist Ausdruck dieser. PHG schreiben dazu: Wenn man die Dinge sich selbst überlässt, regulieren sie sich auf spontane Weise selbst, und … tendieren …dazu, sich wieder zu korrigieren«. (PHG, 48) Sie können »zu etwas Wertvollem führen«. In diesem Sinne kann beispielsweise die künstlerische Ausdrucksgebung einer Niki de SaintPhalle angesehen werden, oder das hohe soziale Engagement von Menschen, die traumatische Erlebnisse überstanden haben, wie Nelson Mandela. Dort bildete sich zum Teil aus den traumatischen Erfahrungen heraus die Triebfeder ihres wertvollen sozialen Engagements, bzw. dieses soziale Engagement ermöglichte das Weiterleben nach den traumatischen Ereignissen. Menschen, die diese Art der Transformation traumatischer Erfahrungen vollziehen konnten, sind jedem bekannt und üben eine ermutigende Leuchtkraft aus. Die Perls’ selbst, deren Familien teilweise in Konzentrationslagern verschwanden, sind ein Beispiel dafür. In diesem Sinne kann die Gestalttherapie auch als Transformationsleistung traumatisierter Analytiker angesehen werden. Schöpferische Anpassung wird als wesentliche Funktion des Selbst angesehen. »Aber wenn man einmal die schöpferischen Funktionen der Selbstregulation, die für das Neue, für die Zerstörung und Neuintegration der Erfahrung offen sind – wenn man diese einmal ausgelöscht hat, dann bleibt nicht mehr viel übrig, was als Grundlage einer Theorie des Selbst dienen könnte« (PHG, 49). Bedeutsam für die Traumatherapie ist auch der Umgang des Klienten mit Widerstand. Hier versuchen PHG »… den Horizont der Bewusstheit und des Risikos zu vergrößern und es dem Selbst zu erlauben, seine eigene kreative Synthese zu finden …« (PHG, 53).
Wiederaneignung und Identifizierung
Der Klient muss sich die abgesprengten Teile seiner Selbst und seines Lebens wieder aneignen, und die in ihnen liegende Kraft sich wieder zu eigen machen. »Wenn die Vergangenheit des Patienten während der Behandlung wiederentdeckt wurde, muss er sie schließlich als seine eigene Vergangenheit annehmen. Wenn er sich in seinem zwischenmenschlichen Verhalten anpasst, muss er in der sozialen Situation selbst zum Handelnden werden. Wenn sein Körper dazu animiert wurde, lebendig zu reagieren, muss der Patient spüren, dass er es ist, nicht sein Körper, der dies vollzieht.« (PHG, 53)
Kontakt und Unterbrechung
»… im Kontaktgeschehen gibt es nur die Einheit einer die Perzeption anregenden Bewegung, die emotional eingefärbt ist« (PHG, 63). Bei traumatischen Erlebnissen wird dieses Kontaktgeschehen als sehr unangenehm erlebt, der Mensch möchte am liebsten aus der Situation verschwinden, aus dem Felde gehen, nicht dasein, sich nicht spüren. Genau dies wird dann psychologisch z.T. auch gemacht als Dissoziation, während die Person leibhaftig aber in der Situation bleiben muss. Die Dissoziation ist in gestalttherapeutischem Sinne die völlige Unterbrechung des Kontaktes, das Rausgehen aus dem Kontakt, bzw. die Abspaltung des Erlebten als nicht zu sich gehörig. Ein kleines Beispiel für alltägliche Dissoziationen ist das Warten in einer Schlange, wo sich viele Menschen gedanklich an einen völlig anderen Ort versetzen. In Notsituationen gibt es die Schutzfunktionen der sensiblen Oberfläche (65), die in subnormalen oder supernormalen Formen auftreten: »panische Flucht, Schock, Betäubung, Bewusstlosigkeit, Totstellen, partielles Blackout, Amnesie«. (65) »Diese Formen beschützen die Grenze, indem sie sie zeitweise desensibilisieren oder paralysieren und darauf warten, dass die Gefahr vorbei geht. Andererseits gibt es Mittel, die die Spannung abfangen, indem sie die Grenze selbst durch Anteile der Spannungsenergie in Bewegung setzen, beispielsweise durch Halluzination und Traum, lebhafte Imagination, Zwangsgedanken, Grübeln und damit einhergehende Rastlosigkeit. Die subaktiven Mittel scheinen geeignet zu sein, die Grenze vor Überflutungen aus der Umwelt zu schützen, indem sie die Gefahr ausschließen; die superaktiven Mittel haben eher mit propriozeptiver Überlastung, die die Energie abschöpft, zu tun – außer man fällt in Ohnmacht, wenn der Gefahrenpunkt bei Not und Krankheit erreicht ist« (PHG, 65).
»An der Kontaktgrenze gibt es diese beiden Prozesse zur Bewältigung von Notfallsituationen: Auslöschen und Halluzinieren. (Es handelt sich … um gesunde temporäre Reaktionen in einem komplizierten Organismus-Umweltfeld« (PHG, 67).
Trauma als unerledigte Situation
PHG führen als Beispiel das Erleben eines kindlichen Frustrationstraumas an: »Der Einfachheit halber denken wir an einen einzigen dramatischen Augenblick, ein ›Trauma‹. Der Wunsch wurde frustriert: Seine Befriedigung war gefährlich, und die durch die Frustration ausgelöste Spannung war unerträglich. Dann unterdrückte man den Wunsch und die Bewusstheit des Wunsches absichtlich, um nicht zu leiden und die Gefahr abzuwehren. Der ganze Komplex von Gefühl, Ausdruck, Geste und sinnlichem Eindruck, der besonders tief geht, weil er auf wesentliche Weise unerledigt bleibt, ist außer Funktion; beträchtliche Energie wird ständig darauf verwendet, ihn in der jeweiligen Gegenwart außer Funktion zu halten. Wie kommt es nun zur Wiedererinnerung? Nehmen wir an, die gegenwärtige absichtliche Unterdrückung wird gelockert, beispielsweise durch Übungen mit den Augenmuskeln und dem Umherschauen …« »Plötzlich kommen die immer gegenwärtigen, aber latenten Gefühle und Gesten zum Ausdruck, und mit ihnen taucht die alte Szene bildhaft wieder auf. Nicht das alte Bild hat also das Gefühl ausgelöst, sondern die Lockerung der gegenwärtigen Unterdrückung. Die alte Szene wird wiederbelebt, weil sie zufällig der letzte freie Ausdruck des Gefühls und der Geste in der Sinnenwelt war bei dem Versuch, die unerledigte Situation zu einem Abschluss zu bringen.« (PHG, 108, 109).
Sicherheitsventile
Die Reaktionsformen auf Traumata, das Halluzinieren, Träumen, Totstellen, Auslöschen, Verzerren, Isolieren, (zwanghafte) Wiederholen oder panikartige Flucht werden von PHG als gesunde »Sicherheitsventile zum Schutze der Kontaktgrenze bezeichnet« (PHG, 129f).
Identifikation mit dem Aggressor, Auslöschung des Selbst und Introjekte
Abb. 1: Trauma-Kontakt-Schema
Ein traumatischer Prozess kann gestalttherapeutisch als das Scheitern der Integrationsleistungen des Selbst gesehen werden, so wie der neurotische Prozess selbst auch. Der Zusammenhang zwischen einem traumatischen Erlebnis und einem posttraumatischen Folgeprozess wird klar dargelegt in der Beschreibung der Selbstunterdrückung. »Wenn weder Flucht noch Vernichten möglich sind, nimmt der Organismus zum Auslöschen der eigenen Bewusstheit Zuflucht« (PHG, 171). »Im Augenblick des Höhepunktes eines Konfliktes und der Verzweiflung reagiert der Organismus, indem er sich auslöscht – im spektakulären Fall, indem er bewusstlos wird, häufiger aber durch Taubheitsgefühle, Lähmung oder eine andere Form der zeitweisen Verdrängung« (PHG, 196). »Es gibt einen leeren Raum in der Figur, denn der allgemeine Kontext des Bedürfnisses, der Gelegenheit, der Schwierigkeit usw. bleibt gleich; die Selbstbehauptung, die den zentralen Platz im Konflikt einnahm, fehlt jetzt nämlich. Dieser leere Raum wird jetzt durch die Identifikation mit einer anderen Person gefüllt, nämlich der Person, die den Konflikt hat unerträglich werden lassen … jetzt wird diese Person zu einem selbst« (196f). »… die Introjekte müssen bewusst werden, damit sie zerstört werden können; der Kontakt zu den isolierten sexuellen, sozialen Interessen muss wieder aufgenommen werden« (PHG, 204)
Gestalttherapeutische Traumakompetenzen
Serok (1985) betont die Eignung der Gestalttherapie für traumatisierte Menschen und kennzeichnet ein Trauma als ein unfinished business, also eine offene, unabgeschlossene Gestalt. Wolf (1999) stellt eine integrative gestalttherapeutische Traumatherapie vor. Strümpfel (2006) nennt in seiner Metaanalyse die Studie von Paivio & Nieuwendhuis (2001, zit. nach Strümpfel 2006, 194) mit Emotionsfokussierter Therapie bei in ihrer Kindheit sexuell missbrauchten Erwachsenen sowie die Metaanalyse von Greenberg (2004, zit. nach Strümpfel 2006, 244) als Belege für die Wirksamkeit prozess-erfahrungsorientierter Therapie. Psychische Störungen im gestalttherapeutischen Sinne werden als eine Art eingefrorene und festgefahrene Notfallreaktion angesehen, bzw. als das, was von der Notfallreaktion in der Selbst-Struktur übrig geblieben ist. In diesem Sinn geht die gestalttherapeutische Traumatheorie von der Begegnung mit einem Ereignis aus, welches die aktuell verfügbare Selbst-Integrationsfähigkeit und Selbstunterstützung (self support im Sinn von Lore Perls) übersteigt. Die Notfallreaktion führte zum Zeitpunkt ihres Entstehens zu Unterbrechungen und Schutzreaktionen, die das Individuum in seinem Erleben des Schreckens, der Ohnmacht und Hilflosigkeit herunterfahren sollen. Diese Unterbrechungen der Kontaktfunktionen sind der zentrale Arbeitsfokus gestalttherapeutischer Therapie. Dabei wird versucht die alten, festgefahrenen Reaktionen auf bestimmte Ereignisse wieder aus ihrer Erstarrung zu befreien, sie aufzulösen und ihre Angemessenheit für die aktuelle Lebenslage zu prüfen. Hardie (2002) kommt in einem Übersichtsartikel zu Gestalttherapie und Sozialarbeit im Zusammenhang mit dem 11. September zu dem Schluss, dass Gestalttherapie für die Behandlung von PTSD geeignet ist. Sie ist der Meinung, dass es kaum Literaturbeiträge der Gestalttherapie zu den Themen Trauma und PTBS gibt (Hardie 2002, 7). Cohen (2002) beschreibt in der gleichen Ausgabe von Gestalt! (2002) Gestalttherapie als wirksames Verfahren für PTBS.
Phänomenologische Grundhaltung
Die Gestalttherapie ist von einer relativ strikt phänomenologisch orientierten Haltung geprägt, bei der das aktuell gezeigte Verhalten des Individuums genau untersucht wird. Durch die Unterstützung der explorierenden Phänomenwahrnehmung mit Aufmerksamkeit, Konzentration, sozialer Zeugenschaft und Beziehung wird ein unspezifisches supportives Feld geschaffen, das genau auf die aktuelle Befindlichkeit des Klienten ausgerichtet ist. Dadurch können die jeweiligen Erstarrungsmomente genau erfahrbar gemacht werden und gelangen wieder in den Erlebens- und Zugriffbereich des Individuums.
Körperbewusstheit
Eine weitere ideal an den heutigen Stand der Traumaforschung angepasste Herangehensweise ist der fortwährende Einschluss (Einbezug) des Körpers in die Bewusstseinsbildung über die Unterbrechungsreaktionen.
Gleichberechtigung als Ziel
Die dritte gestalttherapeutische Spezialität ist die permanente bewusste Gestaltung und Reflexion der Beziehung auf einer versuchsweise gleichberechtigten Ebene. Dies ist durch Machtgefälle aufgrund der Definitionsmacht des Therapeuten, sowie des Wissensgefälles innerhalb einer Psychotherapie nur bedingt möglich (Hutterer-Krisch 2001; Portele 1994), doch ist dieser Anspruch ausschlaggebend für eine therapeutische Grundhaltung, welche für traumatisierte Menschen mit massiven Ohnmachtserfahrungen sehr heilsam erscheint.
Feldeinflüsse
Die vierte gestalttherapeutische Traumakompetenz ist die Bewusstheit der Organismus-Umweltbedingtheit, d.h. der Feldabhängigkeit individuellen Erlebens. Das Feld beeinflusst das Erleben, Verarbeiten und die Bewältigung des Traumas in eminenter Weise mit. Dies drückt sich auch in Anleihen und der Verbindung mit noch deutlicher ganzheitlich orientierten Herangehensweisen wie schamanistischen Heilmethoden oder (naturbezogenen) Ritualen aus.
Integration
Die fünfte gestalttherapeutische Traumakonzeption ist die Arbeit an der Integration der verschiedenen Erlebensteilstücke zu einem Ganzen. Hartmann-Kottek (2004, 94f) definiert: »Für die Gestalttherapie, deren Ziel die Integration ist, gehört die Qualität von Kohärenz als eine mögliche Integrationsform sinngemäß zum zentralen Fokus des Interesses. (…) Die Kohärenz ist eine notwendige Bedingung für das Gestalt-Erleben sowie für die integrierende Organisationsform einer Gestalt. Damit sei sowohl der subjektive wie der subjekt-unabhängige Pol einer Gestalt-Wahrnehmung angesprochen.« Der Kohärenzbegriff wurde besonders von Antonovsky (1997) in seinem salutogenetischen Konzept am Beispiel von KZ-überlebenden Frauen entwickelt. Die »Wiederherstellung der Kohärenz der betroffenen Persönlichkeit« ist nach Hartmann-Kottek Fernziel einer Traumatherapie. »Auf der neurobiologischen Ebene wird die Integration der traumatisch versprengten Erlebnissplitter gefördert, nachdem sie emotional weitgehend neutralisiert worden sind; auf der vorgeschalteten und flankierenden psychotherapeutischen Ebene wird das Kohärenzgefühl über liebevolle Selbstannahme, Fremd- und Selbstwertschätzung und durch Förderung von angemessener Vertrauensfähigkeit in den Rest der Welt gestärkt.« (ebd., 96)
Therapie der Gefühle
Als eine der wichtigsten gestalttherapeutischen Spezialitäten kann schließlich die direkte Bearbeitung von Gefühlen angesehen werden (Strümpfel 2006, Greenberg 2003). Gerade der Umgang mit therapeutisch häufig schwierig zu erfassenden Gefühlen wie Scham, aber auch Angst oder Leere haben eine langjährige und sehr effiziente Tradition innerhalb der Gestalttherapie. Die hemmenden Gefühle Scham und Angst behindern den Ausdruck und die Kontaktaufnahme. Ihre Phänomenologie ist gestalttherapeutisch genau untersucht worden (Dreitzel 2007, 141; Chu 1994; Yontef 1999, 353; Staemmler 2003) Daraus wurden entsprechende therapeutische Schritte entwickelt. Victor Chu stellt fest: Scham stellt eine individualisierte Form tabuisierter gesellschaftlicher Konflikte dar (Chu 1994, 7). Die Funktion der Scham benennt Chu »gerade für Menschen, die in ihrer Kindheit tief verwundet worden sind. Ihre Scham schützt sie vor den Erinnerungen an früher erfahrene Verletzungen.« (Chu 1994, 8) Nach Chu ist eine Folge von Schamprozessen starke Einsamkeit. »Wer in tiefe Scham versinkt, ist in diesem Moment der einsamste Mensch auf der Welt. Wenn ich mich schäme, falle ich aus der Geborgenheit der Gemeinschaft. Selbst wenn ich von Menschen umgeben bin, die sich liebevoll um mich bemühen – die Scham umgibt mich wie eine Glaswand, und die persönliche Kommunikation nach draußen ist jäh unterbrochen. Unsere Scham bricht die Brücken hinter uns ab, gerade dann, wenn der menschliche Halt uns vor der inneren Katastrophe retten könnte.« (Chu 1994, 10). Scham wirkt insbesondere auch durch die Tabuisierung von Traumata (Chu 1994, 18). Scham ist die Reaktion auf das Gefühl der Entblößung (Chu 1994, 34).
Hier-und-jetzt-Fokus
Dieser Fokus bildet den Bildschirm, die Abbildfläche, den Erscheinungsraum, das Ausdrucksfeld und den Anker gegenüber dem Sog des Vergangenen. Er ist gleichzeitig das Mikroskop in den Körper, der den Hier-und-jetzt-Prozess ständig erlebt. Das dissoziierende Bewusstsein kann hiermit wieder zurück in den gegenwärtigen Körper finden.
Selbstprozesse
Abb. 2: Normative nichttraumatische Reaktion bei einer Auswahl
– unterstützender Selbstsubprozesse
– einer sozialen Schutzbeziehung
Der gestalttherapeutische Selbstbegriff ist geprägt von der Goldsteinschen und Lewinschen Vorstellung des sich ständig selbst aktualisierenden und verändernden Organismus im Kontakt mit seiner Umwelt, mit der er ein gemeinsames Feld bildet. Das heißt »das Selbst ist die Kontaktgrenze in Bewegung« (Dreitzel 2004, 40f), »das Selbst ist das Integrierende; die synthetische Einheit« (PHG, 32). Das Selbst kann nach Isadore From (zit. nach Dreitzel, 42) in die drei Subsysteme Ich-Funktionen, Es-Funktionen, Persönlichkeits-Funktionen unterteilt werden. Nach Dreitzel (2004, 38f) geht es in der therapeutischen Arbeit immer nur um die Wiederbelebung der Ich-Funktionen. Die Ich-Funktionen sind zum einen die Motivation, die beginnt mit der Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse. Dreitzel nennt hier das Brauchen, das Wünschen, und das Wollen. Es sind ferner die Hand-lungskompetenzen, um diese Bedürfnisse zu befriedigen, und schließlich die Aufnahme- und Verdauungsfähigkeiten, um die »herbei gehandelten« Bedürfnisinhalte zu assimilieren. Butollo, Krüsmann & Hagl (1998, 95f) systematisieren gestörte Selbstprozesse als Folge traumatischer Erfahrungen. Sie sehen die Selbstantworten, die Phantasien, und Narrationen, also Geschichten, die man sich selbst über das Trauma erzählt, in hohem Maße mitverantwortlich für die Auswirkungen des Traumas. Selbstprozesse beinhalten dabei das Repräsentationssystem über die Welt (Weltbild) und uns (Selbstbild) sowie unserer Interaktionen und Antworten auf sie, also die Ich/ Du/Es-Beziehung zur Welt. Diese Symbolisierungen des Selbst werden selektiv aktiviert und konfigurieren und konstituieren laufend das Selbst. Diese Botschaften an das Selbst werden vor dem Hintergrund früherer Beziehungs- und Bindungserfahrungen gewichtet, aber auch durch die Intensität der gegenwärtigen Erlebnisse. Gute Sprach- und Handlungskompetenzen verbessern diese Selbstprozesse und helfen erklärende Selbstantworten und verstehende Differenzierungen schützend zu entwickeln. Die Gewichtung der Selbstprozesse verändert sich je nach Intensität des Traumas. Durch Selbstabspaltungen kommt es zum Verlust des dialogischen Selbst und dadurch unter Umständen zu starken Reduzierungen der Beziehungsfähigkeit. Die Anforderungen an eine Traumatherapie sind nach Butollo, Krüsmann & Hagl (1998, 100) daher erstens die Wiederherstellung einer Antwortbereitschaft, die möglichst viele Selbstanteile integriert, und zweitens die Mobilisierung von Ressourcen zum Eintreten in dialogische Beziehungen. Die Integration der dissoziierten, abgespaltenen Selbstteile ist dabei das eigentliche Ziel.
Abb. 3: Dysfunktionale Selbstprozesse bei fehlender Schutzbeziehung
Abb. 4: Beschädigtes Selbst
Greenberg, Rice & Elliot (2003) nehmen als Selbstprozess einen Syntheseprozess an. Anstelle des Organismus treten in Modulen organisierte kognitiv-affektive Schemaprozessoren, wodurch eine differenziertere und genauere Beschreibung der bei Dysfunktionen ablaufenden Vorgänge möglich wird. Nach Greenberg, Rice & Elliot (2003, 135, 139) tritt bei erlebtem Missbrauch in der Kindheit durch den erlebten Widerspruch von Fürsorge und Missbrauch bei ein und derselben Bezugsperson eine emotionale Spaltung auf, bei der zwei separate Schemata für jede der beiden Arten der Beziehung gebildet werden. Das Selbst wird somit in Beziehung zu dieser Person in zwei unterschiedliche Selbstorganisationen gespaltet. Durch diese Organisation in verschiedene »Teilselbste« entsteht eine dissoziative Störung. Durch unterschiedliche Hinweisreize können dann unterschiedliche Selbstorganisationen aktiviert werden. Dabei werden Gut und Böse strikt voneinander getrennt. Es können auch komplementäre Rollen wie die des Opfers und des Täters oder des Verführers und des Verführten entstehen und völlig unabhängig voneinander aktiviert werden, oder die Betreffenden dissoziieren ihre emotionale Erfahrung völlig. Greenberg, Rice & Elliott beschreiben sechs Verarbeitungsprobleme, wobei für Traumabetroffene insbesondere folgendes Schema relevant ist: »(…) die automatische Aktivierung von Schemata, die bei unaufgelösten und traumatischen Erfahrungen mit anderen Menschen eine Rolle gespielt haben, wodurch die betroffenen Klienten ständig von einem negativen Gefühl gegenüber einer wichtigen Bezugsperson begleitet werden« (ebd., 140).
Kontakt – Dialog
Die durch Bubers Einfluss geprägte dialogische Ausrichtung der Gestalttherapie ist eine essentielle traumatherapeutische Qualität. Erfahrungen werden in innere Dialoge, Beziehungs- und Kontaktfiguren geformt. Entstellte und deformierte Kontaktgestaltung und Kontakterfahrung sind die Folge von Traumata (Butollo, Krüsmann & Hagl, 117). Therapeutische Methoden der Stuhlarbeit und des Dialoges können helfen, die massiv geschädigte Kontaktgrenze und damit auch Selbstgrenze wieder zu flexibilisieren und den aktuellen Motiven und Handlungsmöglichkeiten der Person anzupassen.
Support
Das stete Bewusstsein der Notwendigkeit von support ist eine gestalttherapeutische Grundkomponente. Diese ressourcenorientierte Haltung begreift support in erster Linie als Selbstunterstützung, aber auch Fremdunterstützung. Lore Perls formulierte es so: »Unter ›Stützung‹ (support) verstehe ich nur zum geringsten Anteil die Fürsorge und Ermutigung, die durch meine Gegenwart und mein Interesse gewährleistet ist, sondern die Stützen, auf die der Patient (oder auch Therapeut!) sich in sich selbst verlassen kann oder die ihm fehlen. Stütze beginnt mit der primären Physiologie wie Atmung Blutkreislauf und Verdauung, schreitet fort mit der Entwicklung der Hirnrinde, dem Einschließen der Zähne, mit Sensitivität und Beweglichkeit, aufrechter Haltung, Sprache und Sprachgebrauch, Gewohnheiten und Sitten und sogar ganz besonders den Hemmungen und Blocks, die ursprünglich als Stützfunktion gebildet wurden.« (Perls 1989, 110)
Offene Gestalt, Figur/Hintergrund
Für viele traumatherapeutisch tätige Gestalttherapeuten bleibt bei traumatischen Erfahrungen eine offene Gestalt. Der Begriff der offenen Gestalt wurde durch die Lewinschülerin Zeigarnik im Rahmen willenspsychologischer Untersuchungen Lewins entwickelt. Er charakterisiert das Bestreben eine unterbrochene Handlungssequenz abzuschließen. Fritz Perls prägte diesen Begriff um als unfinished business für im aktuellen Geschehen wirksame Einflüsse unverarbeiteter vergangener Beziehungserfahrungen. Nach einem Trauma kann die Erfahrung, d.h. die Figurbildung nicht abgeschlossen werden. Die unabgeschlossene Figur resultiert aus dem (bislang) unzureichenden Grund, der die hinreichenden Prozesse, Strukturen und Erfahrungen zur Verarbeitung dieses Ereignisses im Moment seines Erlebens nicht zur Verfügung stellen konnte. Die Bereitstellung ausreichender äußerer und innerer Stützung ermöglicht es den Figurbildungsprozess abzuschließen.
Modell gestalttherapeutischer Traumaarbeit
Der gestalttherapeutische Umgang mit Konflikten ist aktiv und offensiv. Ziel ist, es den Konflikt so bewusst und offen durchleben zu können, dass er für das Selbst eine Wachstumsmöglichkeit bietet. Als pathologisch wird die Verdrängung, das Erstarren, die Unterdrückung des Konfliktes gesehen. Dies wurde für neurotische Konflikte am Beispiel der Ohnmacht eines Kindes gegenüber dem übermächtigen Erwachsenen beschrieben. Kann nun dieses Modell auch zur Bewältigung von posttraumatischen Belastungsstörungen herangezogen werden? Hier erscheint es ja gerade sinnvoll zu verdrängen, zu vergessen, nicht zu spüren. Hat hier das gestalttherapeutische Modell seine Grenzen gefunden? Es lässt sich dagegen einwenden, dass die klassische beschriebene Ohnmachtssituation auch die zu Grunde liegende Erfahrung einer traumatisierenden, PTSD auslösenden Situation ist. Der Unterschied ist nicht auszumachen; es ist letztlich die subjektive Erfahrung von überwältigender Ohnmacht oder Bewältigung, die darüber entscheidet, welche Erfahrung ein Trauma auslöst und welche nicht. Gewiss, es gibt eine Reihe von Erfahrungen, die bei den meisten Menschen PTSD-Reaktionen auslösen. Dazu gehört das Miterleben von Mord bei Angehörigen oder das Nicht-helfen-Können bei tödlichen Unglücken. Die Dauer von PTSD-Reaktionen ist wiederum sehr unterschiedlich. Sie kann als eine Folge und Kombination aus so genannten Vulnerabilitätsfaktoren, Risikofaktoren und Belastungsbedingungen einerseits und Protektivfaktoren und Ressourcen und Supportfaktoren anderseits gesehen werden. Dies zeigen beispielsweise die Untersuchungen von Antonovsky (1997), der daraus ein Bewältigungsmodell entwirft. Es ist also bei jeder Art von Traumaarbeit und gerade auch bei der gestalttherapeutischen Annäherung an traumatische Erfahrungen darauf zu achten, dass ein ausreichend supportives Feld geschaffen wird, in dem der Heilungsprozess sich entfalten kann. Das Wiedereröffnen des Konfliktes darf also nur in dem Maße geschehen, in dem ausreichende Kräfte zur Verfügung stehen, um dieses Mal den psychologischen und inneren Kampf zu gewinnen bzw. zu ertragen ohne zu zersplittern. Hartmann-Kottek (2004, 209) betont, dass bei Traumapatienten ähnlich wie bei Psychosepatienten zunächst eher mit potenzialentfaltenden Gestalttherapieformen und nicht mit konfliktlösendem Schwerpunkt gearbeitet werden soll, da sonst die Gefahr emotionaler Überflutung gegeben ist. Auch van Vugt (1990), Crump, (1984), Wolf (1999, 833) und Hille (2002, 132) warnen vor kathartischen Techniken bei Traumapatienten. Daraus ergibt sich ein behutsames, dem Tempo des Klienten folgendes Vorgehen. Die Annäherung an die traumatischen Themen voll achtsamen Spürens, voller Aufmerksamkeit und Bewusstheit kann jetzt mit der Freiheit erfolgen, selbst zu entscheiden, wie weit es gehen soll! Die genaue Exploration und langsame, klientenbestimmte Beschreibung des traumatischen Ereignisses beinhaltet also ein Vorgehen, das in der Expositionsmethodik der Verhaltenstherapie bzw. in der imaginativen Konfrontation der EMDR-Methode wieder aufgegriffen wurde: Das erneute innerliche Sich-Stellen und Aussetzen. Dabei geht es in erster Linie um die kreative Erschaffung von inneren Antworten, Möglichkeiten und Methoden, mit dem Entsetzen umzugehen. Das »Löschen« der Wucht der traumatischen Erinnerungen ist bei diesen Verfahren der äußerlich beschreibbare Vorgang. Die kreative innere Antwort ist nicht vorhersehbar, nicht plan- oder machbar – es ist eine höchst individuelle Leistung des integrativen Selbst, die sich aus ihm heraus vollzieht. Die Fokussierung auf Wachstum und Entwicklung stellt den Rahmen zur Überwindung der traumatischen Verletzung dar.
Ist nun die PTSD-Reaktion gleichartig, sodass eine spezifische, aber vergleichbare Behandlung notwendig würde? Einerseits erscheint die PTSD-Reaktion besonders in ihren Symptomen vergleichbar. Einerseits wird innerhalb der Traumaforschung darüber diskutiert, ob Traumata z.B. anhand ihrer Auslöser typisiert werden können, oder ob es eine allgemeine menschliche Reaktion auf Traumata gibt. Andererseits scheinen traumatische Erlebnisse eine Vielzahl von Reaktionsmöglichkeiten und Folgen nach sich ziehen zu können, z.B. Borderline-Erleben, Ängste, Sucht, Scham, Zwangsverhalten, Täterverhalten. Diese Reaktionsmöglichkeiten sind vermutlich sowohl auf die prämorbide Struktur der jeweiligen Person zurückzuführen, auf deren Umgangsmöglichkeiten mit Belastungen, bzw. deren Schwächen und Schwierigkeiten, als auch auf die Massivität der Traumatisierung. In gestalttherapeutischem Sinne sind der Umgang mit dem Trauma und die psychologischen Reaktionen darauf eine schöpferische Anpassungsleistungen im Moment der traumatischen Erfahrung. Darin fließen alle dem Individuum zur Verfügung stehenden und mit dem Ereignis in Bedeutungszusammenhang stehenden Stärken und Schwächen ein. Dieser Moment ist vergangen, doch für den betroffenen Menschen ist dies noch nicht Realität geworden. In seiner psychologischen Wirklichkeit besteht diese Situation weiter fort, bzw. kann jeden Moment wieder eintreten. Es ist also eine Fixierung, ein Verhaftet-Sein in einem vergangenen Augenblick, in einer vergangenen Zeitspanne. PHG (311f) benannten als Ziel für den allgemeinen therapeutischen Prozess: »… die erneute Aktivierung von Fixierungen zu Erlebniseinheiten. (…) Gegenwärtig ist das Verhalten des Patienten in der Therapie und anderswo eine schöpferische Anpassung, die weiterhin ein Problem mit chronischer Furcht und Frustration zu lösen versucht. Die Aufgabe besteht darin, ihm ein Problem anzubieten unter Bedingungen, in denen seine gewohnten (unabgeschlossenen) Lösungen nicht mehr die angemessensten Lösungen darstellen. Wenn er seine Augen benutzen muss und dies nicht tut, weil es nicht interessant und sicher für ihn ist, dann wird er jetzt seine Blindheit aufgeben und sich mit seinem Sehvermögen identifizieren; wenn er zugreifen muss, wird er sich jetzt seiner muskulären Aggression gegen das Zugreifen bewusst und kann sie loslassen usw.; dies geschieht nicht, weil Blindheit und Lähmung an sich »neurotisch« sind, sondern weil sie zu nichts mehr taugen: Deren Bedeutung hat sich von einer Technik zu einem Hindernis gewandelt.« (ebd., 312) Angewandte Gestalttherapie ist daher die Unterstützung für eine Person, sich in einer für sie aktuell erforderlichen Weise zu entwickeln, also eine Art Weiterentwicklung zu vollziehen. In diesem Sinne ist Gestalttherapie Entwicklungstherapie, und zwar insbesondere das Zur-Verfügung-Stellen eines geeigneten supportiven Feldes für einen Abschnitt einer lebenslangen Weiterentwicklung. Diese Entwicklung geht dabei einerseits von der Person selbst aus, von ihren Bedürfnissen, ihren Es-Funktionen (also ihrem Körper und seinen Impulsen), ihren Bewertungen (also ihren Ich-Funktionen), und ihrer Erfahrung (also ihren Persönlichkeitsfunktionen), und des Feldes in das sie eingewoben ist (vgl. Dreitzel 2004). Das Feld umfasst auch die Verbindung mit dem Umfeld, z.B. mit der Natur oder mit einem engen Raum und kann umgekehrt wieder Rückwirkungen auf den Organismus haben, die gerade bei Heilritualen wichtig werden, die das Naturfeld einbeziehen. Zum Feld zählen unter anderem die aktuellen Beziehungen zu anderen Menschen, die hier ergänzend als die Beziehungsfunktionen eingefügt werden können. Die Beziehungsfunktionen lassen das Verhalten einer Person immer als Antwort auf den Anruf und die Erschütterung durch den Anderen im Sinne Levinas’ (1995, 1999, 2005) bzw. als Wahl eines Beziehungsmodus im Sinne von Bubers Du vs. Es erscheinen. Das traumatische Erlebnis ist in seiner existenziellen Erschütterung daher eine »Selbsterfahrung« im Sinne einer Antwort auf die eigene Existenz und greift damit zutiefst in die Selbstprozesse der Person ein. Dies geschieht möglicherweise auf eine ähnliche Art wie bei Kindern, die in Abhängigkeit zu ihren Bezugspersonen deren Antworten und Reaktionen in den Aufbau ihrer Persönlichkeitsstruktur integrieren. Das heißt gegenüber dem Anruf durch das traumatisierende Gegenüber – sei es Mensch, Natur oder Gegenstand, (siehe Butollo 1998. 95f) – hat die Person keine Wahl und antwortet »zu schnell«, blitzartig, amygdaloid (van der Kolk 2000) und körperspeichernd. Ein therapeutisches Ziel ist daher die Wiederherstellung von Wahlmöglichkeiten der Reaktion (Butollo 1998). Eine Fülle methodisch-technischer Herangehensweisen der Gestalttherapie findet sich bei Hartmann-Kottek (2004).
Integrität und Polarität
Traumatische Erlebnisse bedrohen die erlebte Integrität auf verschiedenen Ebenen:
1. Auf der Ebene der Kontrolle, der Handhabbarkeit, können Ohnmacht und Überwältigung entstehen.
2. Auf der physiologischen Ebene geschieht eine Erstarrungsreaktion.
3. Auf der Ebene des erlebten Zusammenhanges, der Kontinuität und Kohärenz kommt es zu Abspaltungen des Erlebens, der Gefühle, Empfindungen und möglicherweise auch der Handlungen.
4. Auf der Ebene der Sicherheit kommt es zu Angst und Vermeidung.
5. Auf der Ebene der Bewertungen kann es zu massiven Selbstabwertungen kommen.
6. Auf der Ebene des Verstehens dessen, was vor sich geht, entsteht Verwirrung.
7. Auf der sozialen Ebene des Vertrauens zu anderen entstehen Gefühle der Scham.
Diese Ebenen können auch als gegensätzliche Polaritäten oder als ineinander verschränkte Reaktionen und Gegenreaktionen gesehen werden.
Tab. 1: Polaritäten bei Integritätsverlust durch Traumata
Mögliche und wichtige Kontaktstörungen traumatischer Erfahrungen werden in Tabelle 2 dargestellt. Dabei wurde die Dissoziation hinzugefügt.
So wie ein Kind die soziale Unterstützung und Zeugenschaft durch ein Elternteil braucht, so benötigt auch der durch ein psychisches Trauma Verletzte wieder das Gesehen-Werden von andern Menschen. Damit ist es ihm möglich, sich in seiner nun anderen Realität als wirklich erleben zu können, um diese Realität glauben zu können. Dadurch kann es gelingen, aus dem Bann der damaligen traumatisierenden Beziehung nun in eine neue Beziehung zu treten, von der aus gesehen das damalige traumatisierende Ereignis Vergangenheit ist. Es wird eine sehr schmerzliche Narbe bleiben, doch eben vergangen. Gleichfalls ist ein effektives und gelingendes Erleben von Unterstützung, sowie Kontrollierbarkeit des Lebens wichtig. Die Transformation und Abstraktion des Geschehenen kann gelingen, wenn es verstanden wird und wenn sich der Betroffene als Überlebender und Zeuge seines eigenen Lebens begreifen kann. Sichere und wertschätzende Beziehungen zu anderen Menschen sind die stärksten Schutzfaktoren gegenüber Traumata, und gleichzeitig auch die wichtigsten Heilungsfaktoren Traumatisierter.
Tab. 2: Kontaktstörungen, Therapieschritte, Polaritäten der Kontaktstörungen.
Gestalttherapie bei verschiedenen Traumaformen und Traumafolgen:
Butollo – Integrative Traumatherapie und Dialogische Exposition
Butollo und Mitarbeiter (1998, 2003) praktizieren und untersuchen die fruchtbare Integration von gestalttherapeutischen und verhaltenstherapeutischen Therapieelementen besonders in der Integrativen Traumatherapie mit Dialogischer Exposition (Butollo & Hagl 2003, 163f). Die verhaltenstherapeutischen Methoden werden dabei besonders in Behandlung der phobischen Anteile einer PTBS zur Überwindung dysfunktionalen Vermeidungsverhaltens herangezogen. Auch für den Aufbau fehlender Fähigkeiten und Fertigkeit werden Methoden der Verhaltenstherapie eingesetzt. Gestalttherapeutische Elemente werden in allen Behandlungsphasen eingesetzt. Die Integrative Traumatherapie entfaltet sich in vier aufeinander aufbauenden Phasen:
1. Sicherheit: Sicherheit wahrnehmen und verfestigen über Therapeutische Beziehung und therapeutisches Setting. Zur Ruhe kommen, die Wahrnehmung bestätigen, bekräftigen und stützen sind wichtige Elemente. Der Umgang mit den Symptomen und sozialen Ressourcen steht im Vordergrund.
2. Innere Stabilität: Unsicherheit erkennen und bewältigen über Selbstwahrnehmung und Beziehung, Ich-Grenzen aktivieren, Verbesserung von Selbstwahrnehmung und Selbstausdruck, Selbsterleben als kompetent, aktiv und konfliktfähig. Trauer und Dissoziation sind wichtige Themen
3. Konfrontation: Kontakt mit Trauma und Täter über Aktivierung früherer Erlebnisinhalte, kognitive und emotionale Arbeit an der Wirkung des Traumas. Grenzen aufrechterhalten durch Aggression
4. Integration: Trauma und Dialogfähigkeit über Reifung, entfremdete Selbstanteile und inneren Täter explorieren. Annehmen der Veränderung ist das Ziel.
Missbrauch
Gestalttherapeutische Ansätze zur Behandlung bei sexuellem Missbrauch sind in reicher Zahl vorgelegt worden, so Laschinsky (1996), Rust & Wolber (1996), Faria & Belohlavek (1984, zit. nach Butollo 2003). Schön (2008) beschreibt Gestalttherapie bei missbrauchten Kindern und Jugendlichen und untersucht dabei besonders auch die Gefahr der Sekundärtraumatisierung der Helfer. Anger (2008) schildert ihr gestalttherapeutisches Vorgehen bei einer dissoziativen Fugue nach sexuellem Missbrauch. Amendt-Lyon (2005, 244) stellt in einer Fallbeschreibung die Wirkung von Wahrheit und Beziehung in einer Therapie nach Missbrauchserfahrungen vor. Hille (2002) beschreibt ihre überwiegend in der gestalttherapeutischen Arbeit mit Missbrauchsopfern gewonnen Erfahrungen und entwickelt daraus in Anlehnung an Besems & van Vugt (1990) ein gestalttherapeutisches Modell, das auch Parallelen zu dem Modell von Kepner aufweist, ohne dieses aber anscheinend zu kennen. Hille (2002) diskutiert das für und wider der Rollen-/Stuhlarbeit am Täterintrojekt mit der Gefahr einer Verstärkung des Introjekts anhand der Positionen von Bungart (1991, zit nach Hille 2002, 121) und Staemmler (1992/1993, zit. nach Hille 2002, 122). Auch Wolf (1998) berichtet über das gestalttherapeutische Vorgehen im stationären Setting bei einer Missbrauchspatientin erweitert durch EMDR-Techniken.
Kepner
Kepner (1995) bringt Ergebnisse der Traumaforschung über die Bedeutung des Körpers für die Traumareaktion und Gestalttherapie in Verbindung. Er präsentiert einen körperbewussten Ansatz in der Arbeit mit erwachsenen Mißbrauchsüberlebenden und Inzestopfern. Im deutschsprachigen Raum kann für den bewusst erlebten und subjektiv erfahrenen Körper der ältere und phänomenologisch aufgeladenere Begriff Leib wieder herangezogen werden. Die Wiederaneignung des Leibes durch eine sehr achtsame, genaue, supportive und versprachlichend-bewusstmachende Aufmerksamkeit mit dem Erspüren dessen, was der Leib ausdrücken will, was er sagen will, was er in sich eingeschlossen hat und was demnach das Subjekt in sich eingeschlossen hat, ist das Ziel des Kepnerschen Ansatzes. Er ist gegenwärtig die theoretisch am besten ausgearbeitete Anwendung der Gestalttherapie für die Therapie erwachsener Mißbrauchsopfer.
Kepner nennt seinen Ansatz »Healing Tasks« was wörtlich mit »Hei-lungs-Aufgaben« übersetzt werden kann, worin allerdings der Wachstumsgedanke stark mitschwingt. Kepner erläutert die Entwicklungsunterbrechungen, die durch ein Kindheitstrauma ausgelöst werden. Er versteht Heilung als Wachstum und Fortführung der gestörten Entwicklung. Dieser Prozess kann in vier wichtige Phasen unterteilt werden. Für die jeweiligen Phasen werden verschiedene therapeutische Aufgaben beschrieben:
1. Entwicklung von Unterstützung (Developing Support):
Unterstützung ist der entscheidende Bezugsgrund für alle Entwicklungs- und Wachstumsprozesse.
2. Entwicklung der Selbstfunktionen (Development of the Self Functions):
Selbstfunktionen helfen Erregung zu modulieren. Missbrauchsopfer haben aufgrund der missbräuchlichen Entwicklungsumgebung häufig nur eingeschränkt entwickelte Selbstfunktionen. Kinder können in diesem Zusammenhang von Gefühlen überschwemmt werde. Als Folge kann es zu Fühllosigkeit, Dissoziationen und zum der Verlust der Unterscheidungsfähigkeit oder zum Erstarren kommen. Eine Entwicklungsumgebung, die dem Kind nicht hilft die intensiven Gefühle und Erlebnisse zu verarbeiten, trägt nicht zur Entwicklung der Selbstfunktionen bei. Bei nicht ausreichenden Selbstfunktionen kann das kathartische Abreagieren der traumatischen Erinnerungen retraumatisierend sein, da keine andere Erfahrung als in der Vergangenheit gemacht werden kann. Kepner sieht hierin den größten Mangel der kathartischen Methode.
3. Rückgängig machen, wiederholen, Trauer (undoing, redoing and mourning):
Da das Opfer zum Zeitpunkt des Missbrauchs ein Kind war, und wenig Macht und Fähigkeiten hatte, die Grenzen seiner Integrität aufrecht zu erhalten, wurde ein Großteil des Geschehens verinnerlicht und wird nun als eigene Erfahrung anstatt als Beziehungserfahrung erlebt. Da es nicht möglich war wegzulaufen, zurückzustoßen oder das Geschehen anders zu beenden, mussten solche gegen die Umgebung gerichteten Impulse nach innen gegen sich selbst gewendet werden. Als Retroflexionen führt dies zu einem »Einfrieren« der Betroffenen und einer Haltung voller Selbstbestrafung, Selbstbeherrschung und Vorsicht. Als Introjektionen werden diese Geschehnisse verinnerlicht, und führen zu einem falschen Selbst voller Scham, Glaubenssätzen und Überzeugungen der eigenen Wertlosigkeit, oder falschen Darstellungen und Präsentationen der eigenen Person, jenseits der wahren Bedürfnisse. Das beschämte Kind sagt nicht: »Hör auf, mir so schlechte Gefühle machen«, sondern zwingt sich zu einem unauffälligen Verhalten, spannt seine Muskeln an und verfällt in eine eingezogene Haltung. Im alltäglichen Verhalten einer Person lässt sich die Wiederholung und Reinszenierung der traumatischen Geschehnisse beobachten. Beim Rückgängigmachen wird die gesamte Beziehung des Organismus zu seiner Umgebung mittels Ausdrucksarbeit wieder hergestellt. Hierfür werden therapeutische Reinszenierungen, Dialoge und verschiedene Alltagshandlungen eingesetzt, die nur bei ausreichendem Support und ausreichenden Selbstfunktionen gelingen. Eine weitere Folge dieses Umkehrprozesses ist der Verlust eines idealisierten Elternbildes, der Verlust der Kindheit. Diese Verluste müssen betrauert werden.
4. Wiederherstellung (reconsolidation)
Die Person bzw. der Organismus und das gesamte Umweltfeld organisieren sich bei diesem Prozess neu, wodurch Wachstum ermöglicht wird. Für den Überlebenden beinhaltet dies möglicherweise eine grundlegende Neuorientierung seines Lebens. Er lernt nicht nur neue Fähigkeiten, sondern wird wirklich ein anderer Mensch.
Heilung ist nach Kepner (1995) kein linearer Prozess. Er benutzt ein schematisches Modell (ebd., 8), um die einzelnen therapeutischen Phasen zu verdeutlichen. Dabei bedingen sich die oben beschriebenen Phasen in sukzessivem Aufbau mit dem Support zu Beginn und der Wiederherstellung gegen Ende der Therapie. Im therapeutischen Prozess können unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. Kepner unterscheidet als Schwerpunkte die Arbeit mit Gefühlen, mit dem Gedächtnis oder mit dem therapeutischen Selbst. Gerade für die Traumatherapie scheint die Konzentration auf körperlich-sensorisch-emotionale Antworten des Klienten unverzichtbarer als für andere Störungsbilder zu sein. Nach Kepner (1995, 31f) wird traumatisches Material auch infolge der Wirkung des Feldes vergessen, oder wieder erinnert. Bei geänderten Feldbedingungen ändern sich auch die Zugangsbedingungen zu den Erinnerungen. Besonders wertvoll erscheint Kepners (38) detaillierte Beachtung verschiedener Aspekte der Scham bei Mißbrauchsopfern. Scham wird dabei als Zurückweisung, Unterbrechung der Verbindung zu anderen und als eigene Wertlosigkeit und Schlechtheit erlebt. Diese Aspekte zeigen sich in Introjekten (Bezeichnungen des Aggressors werden übernommen z.B. »Ich bin eine Hure, ich bin schlecht«), in Retroflexionen (der Wunsch den Aggressor zu bestrafen, wird in Selbstbestrafung zurück gewendet), im Bedürfnis nach Unterstützung (Äußerungen dieses Bedürfnisses verbunden mit dem Glauben, aufgrund der eigenen Wertlosigkeit keine Unterstützung zu verdienen), in der Selbstführung (Self Management, Kontakte mit anderen werden abgebrochen, da sie als zu überwältigend erlebt werden) in Gefühlen mit unstimmiger Kontextzuordnung (Statt »ich fühle mich schlecht durch das, was mir angetan wurde« »ich bin schlecht«) in fixierten Gestalten (aus der Kindperspektive ergeben sich Konstruktionen wie »Ich erhalte keine Hilfe, also bin ich es auch nicht wert, Hilfe zu erhalten«). Als eine weitere wichtige Selbststützung wird die Stärkung des Kontaktgeschehens über die Aneignung oder Wiederaneignung des Leibes durch gezielte Körperaktivitäten wie Yoga, Laufen, Tanzen, Kampfsport etc. (Kepner ebd., 254) gefördert.
Besems & van Vugt
Für den deutschsprachigen Raum legten Besems und van Vugt bereits 1990 eine an Fallbeispielen reiche Darstellung ihrer Arbeit mit Inzestbetroffenen vor. Zur Frage des Settings schätzen die Autoren eine 50-Minuten-Therapieeinheit als meist zu kurz ein, häufig werden längere Sitzungen benötigt. In Stunden, in denen es besonders um Körperexploration geht, sind auch zwei Therapeuten anwesend. Der zweite Therapeut ist Zeuge und bietet Schutz vor möglichen Ängsten, Übergriffen und Wiederholungen des Missbrauchs. Besems & van Vugt (1990) sprechen explizit nicht von Missbrauch, sondern von Inzest (15f), um Betroffene dabei nicht zu stigmatisieren und dabei erlebte mögliche positive Gefühle nicht zu verdammen. Die Wahrnehmung und der Ausdruck blockierter Gefühle (23f), angefangen bei Trauergefühlen, aber besonders durch die (Wieder-) Aneignung der aggressiven Selbstfunktionen (29f), hat einen grundlegenden Stellenwert. Besems und van Vugt betonen eine forderungsfreie und gleichzeitig versorgend-direktive Haltung zu Beginn der Therapie. Die (Um-) Feldabhängigkeit der Klientin besonders unter dem Sicherheitsaspekt ist eine wichtige Besonderheit. Die Selbstaktualisierung und Selbstdarstellung im Hier und Jetzt jenseits von Sprache ist gerade aufgrund des Verbotes der Täter darüber zu sprechen eine entscheidende therapeutische Technik. Die Wiederaneignung des erstarrten, abgetöteten Körpergefühls geht einher mit dem Ausdruck der Geschichte der Traumatisierung. Für diese empfindliche Ausdrucksarbeit setzten Besems und van Vugt zur Erleichterung des Ausdrucks des Unsagbaren sprachfreie kreative Medien ein, wie z.B. Ton (Besems & van Vugt 1990, 78f) oder Kinderbücher. Dies hilft gleichzeitig an die abgebrochene emotionale Kindheitsentwicklung anzuknüpfen. Eine wichtige Etappe ist schließlich, langsam die Worte für das zu finden, was geschehen ist und den Missbrauch zu erzählen. Die Aufgabe der inneren Beziehung zum Täter, die als Verrat empfunden wird, ist eine lange und schmerzhafte Wegstrecke. Für die Wiederherstellung von Selbstwert und Würde wird besonders Gruppentherapie als geeignet angesehen. Das Bewusstsein, Opfer gewesen zu sein, aber diese Rolle überlebt zu haben, muss als Realität der eigenen Biographie bestehen bleiben. Seine innere Gewichtung im Rahmen einer Polaritäten-Arbeit als Teil einer z.B. Ohnmacht/Opfer- und Macht/Prinzessin-Polarität zu verschieben ist ein weiterer bedeutungsvoller Schritt. Die Autoren skizzieren auch die Problematik des Inzestgeschehens bei Jungen durch Väter und Mütter. Nach Hille (2002) haben Besems & van Vugt (1997, zit. nach Hille 2002, 132) den Akzent in ihrer Traumatherapie verschoben, hin zu einem stärker ressourcenorientierten Vorgehen, eine »Arbeit am Trauma ohne das Trauma selbst zu bearbeiten« (ebd.), sondern in die »erwachsene Erinnerung« (ebd.) zu integrieren.
Krieg und Gewalt
Fritz Perls selbst berichtete von einer Therapie eines traumatisierten KZ-Überlebenden in Südafrika: »Ein Soldat litt am ganzen Körper an blauen Flecken. Als letzter Ausweg wurde er zu mir geschickt. Dieser Soldat hatte einen Ausdruck tiefster Verzweiflung in seinen Augen und war leicht benommen. In der Armee hatten wir natürlich keine Zeit, mit Psychoanalyse oder ähnlichen Formen weitgreifender Psychotherapie herumzuspielen. Ich setzte ihn unter Pentothal und erfuhr, dass er in einem Konzentrationslager gewesen war. Ich sprach Deutsch mit ihm und führte ihn zurück zu den Momenten seiner Verzweiflung und löste den Block, der ihn hinderte zu weinen. Er weinte sich wirklich die Augen aus, oder sollen wir sagen, er weinte sich die Haut ab. Er erwachte in einem Zustand der Verwirrung und dann erwachte er wirklich und hatte die typische Satorieerfahrung, vollkommen und frei in der Welt zu sein. Schließlich ließ er das Konzentrationslager hinter sich und war bei uns. Die blauen Flecken verschwanden« (Perls 1981, 95). Leider ist über die weitere Entwicklung dieses Patienten nichts bekannt. Nach heutigem Kenntnisstand ist zu vermuten, dass diese einmalige Möglichkeit, seine Gefühle auszudrücken und sich innerlich zu lösen, sicher ein entscheidender Heilungsschritt war, der aber vielleicht doch ausreichte.
Crump (1984) berichtet über Gestalttherapie bei Vietnamveteranen, wobei die PTBS vor allem als unfinished business gesehen wird. Der Autor fand besonders die gestalttherapeutische Methode der Arbeit mit Sätzen, verbalen Wiederholungen, Abklärung der Bewusstheit und dem Geschehen eine Stimme zu verleihen geeignet. Crump führt aus, dass es für Vietnamveteranen z.T. unmöglich ist, emotional wahrzunehmen was sie sagen. Crump betont, dass die Arbeit mit Vietnamveteranen mit Vorsicht und nur auf der Grundlage einer sehr guten Ausbildung in Psychopathologie und Gestalttherapie durchzuführen ist. Speziell das Timing der Interventionen erfordere ausreichende Erfahrung, da Gestaltinterventionen intensive Gefühle und Konflikte rasch an die Oberfläche bringen könnten. Deshalb ist es wichtig zu wissen, wann der Klient dazu bereit und in der Lage ist. Crump geht dabei wiederholt auf die tragende Funktion einer empathischen Beziehung und eines verlangsamten Tempos des therapeutischen Prozesses ein. Serok (1985) beschreibt die Gestalttherapie einer Holocaust-Überlebenden, sowie mit einem traumatisierten Soldaten des Yom-Kippur-Krieges. In Anlehnung an Polster (Polster & Polster 1975, zit. nach Serok 1985) war es dabei notwendig, Parallelen zur alten Situation in der Gegenwart herzustellen. Im Erinnerungsprozess wird auch die Geschwindigkeit der Erinnerung variiert, verlangsamt und der Verarbeitungsfähigkeit der Klientin angepasst, sowie ausreichend Support aufgebaut. Butollo (1998) schildert ausführliche und bewegende Fallbeispiele des Bosnienkrieges und liefert eine Vielfalt gestalttherapeutischer Interventionen. Jossen (2003) gibt ein anrührendes Beispiel für die Gestalttherapie bei einer multipel kriegs- und gewalttraumatisierten jungen Frau. Rothkegel (1996) berichtet über Gestalttherapie mit Folteropfern. Hoffmann-Widhalm (1999) beschreibt die Anwendung gestalttherapeutischer Prinzipien und auftretende Schwierigkeiten bei bosnischen Kriegsflüchtlingen in einem Flüchtlingslager. Kosijer (1998) schildert die Gestalttherapie mit einer Jugendlichen aus Bosnien. Heimannsberg & Schmidt (1992) legten eine Sammlung von Beiträgen vor, in denen sich eine Reihe von Therapeuten mit der deutschen Vergangenheit und ihrer eigenen Verwobenheit in die Geschichte des Nationalsozialismus auseinandersetzen.
Krankheit, Behinderung, Unfall
Strümpfel (1992) beschreibt Gestalttherapie bei Aids. Micknat (2002) analysiert traumatische Prozesse bei geistiger Behinderung aus einer gestalttherapeutischen Perspektive. Wirth (2003) untersucht Traumatisierungen bei Hörbehinderten, bzw. beschreibt Ressourcenarbeit bei Hörbehinderten aus gestalttherapeutischer Sicht (Wirth 2008b), bei der besonders Gruppentherapie für Hörgeschädigte (Wirth 2008a) eine große Rolle spielt. Pröpper (2007) legt eine Arbeit über die traumatisierenden Auswirkungen von Krebserkrankungen vor. Wolf (1998) und Butollo (2003, 3) beschreiben die Gestalttherapie bei U-Bahnfahrern, die Suizidanten überfahren hatten. Besonders strukturelle Störungen können als »Behinderungen« begriffen werden (Dreitzel 2004, Kommentar zu Schaubild 17). Dadurch ist eine Annahme des »So-Seins« im Sinne der paradoxen Theorie der Veränderung möglich. Gestalttherapeutische Aspekte von (Hör-) Behinderung werden in Wirth (2006) genauer ausgeführt.
Gruppentherapie
Soziale Bindungen gelten als der grundlegendste Schutz gegen Traumatisierungen (van der Kolk et al. 2000, 324). Van der Kolk et al. sprechen von einer »Trauma-Schutzschicht« (trauma membrane) die von Familien, Kollegen und Freunden geschaffen wird. »In Anerkennung dieses Bedürfnisses nach Zugehörigkeit als Traumaschutz herrscht jetzt weitgehende Übereinstimmung, dass der zentrale Punkt bei der akuten Krisenintervention die Bereitstellung und Wiederherstellung der sozialen Unterstützung ist (ebd.). Eine Form der Gruppentherapie wird oft als Behandlung der Wahl für sowohl akut als auch chronisch traumatisierte Individuen angenommen. Die gemeinsame Geschichte kann ein Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühl erzeugen. (…) In einer Gruppe mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, sind die meisten traumatisierten Personen schließlich in der Lage, die passenden Worte zu finden, um zum Ausdruck zu bringen, was mit ihnen geschah (ebd., 325).
Die Gruppenmitglieder stellen dabei gleichrangige Peers dar, die spezifisches Verständnis, Support, aber auch Kontrolle ermöglichen. Die therapeutische Zweierbeziehung kann in ihrem Machtgefälle als zu riskant erlebt werden. Auch innerhalb einer gestalttherapeutischen Beziehung hat der Therapeut die Definitions- und Auswahlmacht, (Portele 1994, 96f, Hutterer-Krisch 2001), wenngleich er immer wieder versucht, die Vision des »Heilens aus der Begegnung« (Trüb 1964 zit. nach Portele 1994, 104) Realität werden zu lassen. Die Gefahr der von Trüb »Begegnungsflucht« genannten Neurose des Therapeuten, bei der er die Ich-Du-Beziehung in eine handhabbare Ich-Es-Beziehung zu verwandeln sucht, erscheint angesichts der Schwere und der möglichen Angst des Therapeuten vor seinen eigenen durch Traumaberichte ausgelösten Gefühlen bei der Therapie für Traumabetroffene besonders hoch. Sie können auch Folge einer Macht-Ohnmacht-Reinszenierung oder mehr noch einer Macht-Gehorsam-Konstruktion sein (Portele & Roessler 1994, 143f). Bowman (2002) berichtet von den Wirkungen informeller gestaltorientierter Gruppenprozesse als Unterstützung der natürlichen Verarbeitungsprozesse nach dem 11. September.
Dissoziationen
Dissoziative Phänomene werden nach Butollo (1999) zunehmend als wichtige Faktoren der Entstehung oder Aufrechterhaltung einer PTBS erkannt. Votsmeier (1999, 716f) stellt das Konzept der Dissoziation innerhalb der Gestalttherapie bei strukturellen Störungen vor. Mit Yalom (1980, zit. nach Votsmeier 1999) bezeichnet er Dissoziationen als »intrapersonale Isolation«, als Prozess, bei dem Teile von sich selbst abgespalten werden. Das Ziel der Therapie ist es, den Klienten zu helfen, diese abgespaltenen Teile wieder zu integrieren (Votsmeier 1999, 716). Dabei hebt Votsmeier das Goldsteinsche Stressmodell (Goldstein 1965, zit. nach Votsmeier 1999) hervor. Dabei werden Teilbereiche der inneren Prozesse vom Rest des Systems entfremdet, abgespalten und isoliert (ebd., 717).
Abb. 5: Dissoziation
Deistler & Vogler – Dissoziative Identitätsstörung
Für die Therapie extrem und komplex traumatisierter und missbrauchter Klientinnen mit Dissoziativen Identitätsstörungen (Multiplen Persönlichkeitsstörungen) legten Deistler & Vogel 2002 eine bereits in 2. Auflage (2005) erschienene bemerkenswerte Einführung in ihre Arbeit vor. Dabei wird auf Modelle der Gestalttherapie und der Integrativen Therapie zurückgegriffen. Dissoziation wird innerhalb des Kontaktprozesses in Anlehnung an Zinker (1982, zit. nach Deistler und Vogler 2005) entweder als Kontaktunterbrechung zwischen Rückzugs- und Empfindungsphase angesehen, oder mit Teschke (1999 zit. nach Deistler & Vogler 2005) als Unterbrechung zwischen Empfindung und Gewahrsein verortet. Vor allem ist daher die Kontaktphase der Empfindung des Eigenen gestört und unterbrochen, die Person ist so auf die Abwehr von Gefahren konzentriert, dass die Wahrnehmung der Empfindungen nicht mehr gelingen kann.
Dissoziationsprozesse werden von den Autorinnen als wertzuschätzende kreative Prozesse angesehen, ohne die ein Überleben in einem unerträglichen, hoch traumatisierenden Umfeld nicht möglich gewesen wäre (ebenda, 14).
Im therapeutischen Prozess werden neben der Wahrnehmung der Klientin besonders Resonanzprozesse der Therapeutin beachtet und mit genutzt. (ebenda, 116f). Dabei können Veränderungen des körperlichen Ausdrucksverhaltens oder Brüche im Kontakterleben als Hinweise für mögliche Wechsel (switch) zu einer anderen inneren Person /Alter (von alternierender Persönlichkeitsanteil; ebenda, 14) dienen. Bei vielen verschiedenen Wechseln wird versucht eine gemeinsame Ausdruckslinie zu erfassen, als Hilfs-Integrationsleistung für die Klientin.
Die Autorinnen nutzen das Modell der acht blockierten Kontaktzyklen von Hartmann-Kottek-Schröder (1983, zit. nach Deistler & Vogler; ebenda, 120) zur Beschreibung der Kontaktunterbrechungen ihrer Klientinnen. Dabei können unterschiedliche innere Personen verschiedene Kontaktunterbrechungen aufweisen. Als Grundprinzipien gestalttherapeutischer Arbeit mit traumatisierten Menschen nennen die Autorinnen in Anlehnung an Butollo, Krüsmann und Hagl (1998) die übergeordnete Relevanz der Beziehung, das Arbeiten in der Gegenwart, und das Schließen unvollendeter Gestalten.
Durch die ständige Einbeziehung von Körper, Gefühl und Kognitionen wird eine integrierende Verbindung zwischen den dissoziierten Anteilen der Klientinnen gefördert. Diese Integration sollte dabei immer an dem Wohlbefinden und der Lebensqualität der Klientin orientiert werden und nicht zum Selbstzweck geraten. Die Verbesserung der Beziehungsfähigkeit auf der Grundlage erlebter Beziehung zwischen Klientin und Therapeutin stellt ein Lernmodell für andere neue Beziehungserfahrungen außerhalb des therapeutischen Settings dar (ebenda, 141).
Die Bedeutung einer möglichst gleichberechtigten Haltung wird unterstrichen, die sich jenseits des Gefälles von Definitionsmacht und Wissensmacht in der gleichberechtigten personalen Begegnung nach Gremmler-Fuhr (1999 zit. nach Deistler und Vogler; ebenda, 143) vollziehen kann. Dabei ist es wichtig, dass jede der Alters mit der Therapeutin in Beziehung tritt und auf ihre spezifische Weise auf die Therapeutin reagiert, antwortet und response-ability beweist (S. 161). Die Dissoziative Identitätsstörung wird als Beziehungsstörung angesehen. Zentrale Bedürfnisse der Klientin wurden dissoziert, und müssen erst wieder langsam wahrgenommen, benannt, verstanden und integriert werden, und zwar meist für verschiedene Alters. Dabei können Schwierigkeiten und Reinszenierungen auftreten. Deistler und Vogler beschreiben eine Reihe von Möglichkeiten, die Beziehung zwischen Klientin und Therapeutin zu regeln und die Klientinnen weiter zu stabilisieren, wie Verträge z.B. zum Gewaltverzicht, die Erstellung innerer Landkarten, Groundingübungen, Sicherheitsmaßnahmen, Sicherer-Ort-Übungen, und andere imaginative Übungen nach Reddemann (2001, zit. nach Deistler und Vogler). Die Arbeit an Täterintrojekten wird ebenfalls dargestellt. Die therapeutische Begleitung im Rahmen des betreuten Wohnens wird detailliert ausgeführt und ihre Möglichkeiten und Grenzen ausgelotet. Die Gefahren einer sekundären Traumatisierung von TherapeutInnen werden von den AutorInnen abschließend untersucht und mögliche Gegenmaßnahmen aufgeführt.
Trauer
Perls (1981) »Die Trauerarbeit (ist) ein ungeheuer wichtiger Prozess um (…) zu überleben.« Perls hat in dem oben zitierten Beispiel einer Therapie eines KZ-Überlebenden dessen Möglichkeit und wiedererlangte Fähigkeit zu trauern und seiner Trauer Ausdruck zu verleihen als entscheidenden Heilungsfaktor verstanden. Kepner (1995) betont die Trauer um den Verlust der Kindheit als einen wichtigen Entwicklungsschritt des erwachsenen Missbrauchsopfers. Auch Besem & van der Vugt (1990) halten die Trauer für eine bedeutsame Phase des Heilungsprozesses. Canacakis (2002) schildert vor einem gestalttherapeutischen Hintergrund essentielle Abläufe von Trauerprozessen. Butollo (1998, 269) betont die Notwendigkeit des Trauerns im Genesungsprozess einer Traumatherapie.
Angst, Strukturelle Störungen, Sucht,
»Der Mangel an wesentlicher Stützung wird als Angst erlebt«, schreibt Lore Perls (1989, 111). »Allgemein wird Angst einer Einengung der Atmung gleichgesetzt; aber die Reduktion oder gar Suspendierung der Atmung und damit auch die Reduktion der Erregung und des Interesses ist manchmal schon eine Reaktionsbildung auf eine möglicherweise gefährliche Situation (Totstellreflex)«. (ebd.) Die Folgerung aus dieser Definition ist eine supportive Therapie. Einen Ansatz der Integration gestalt- und verhaltenstherapeutischer Herangehensweisen legte Butollo (1996) vor. Die Therapie von Persönlichkeitsstörungen wie der Borderlinestörung sowie von Suchterkrankungen, die beide ebenfalls als Folgen und Bewältigungsversuche traumatischer Erfahrungen angesehen werden können, sind von Gestalttherapeuten als spezifische Therapiefelder entwickelt worden. Zur Borderlinestörung legten Votsmeier (1988), Yontef (1999), Janssen (1999), Greenberg, Rice & Elliot (2003), Klampfl (2003) Beiträge vor. Votsmeier (1999) formulierte Grundsätze der Gestalttherapie mit besonderem Augenmerk der traumatischen Genese sowie des Konzepts der Dissoziation. Lang (2007) diskutierte mit entwicklungstheoretischem Blick frühe Störungen, die er frühe Entwicklungshemnisse nennt, als Traumafolgestörungen. Lang fordert bei frühen Störungen vor allem supportive therapeutische Schritte unter Einbezug des Körpergedächtnisses, sowie gegenwärtige Augenblicke genießen zu lernen. Gestalttherapeutische Suchtbehandlung beschrieben Röser (1994), Röser & Votsmeier (1999), Wardetzki (1999) und Clemmens (1997, 2006).
Eigene Beispiele gestalttherapeutischer Traumaarbeit
In meinen beiden Fallbeispielen werden die Kraft und der Schutz einer wichtigen sozialen Beziehung sichtbar, aber auch die Schwächung durch deren Verlust.
Wo ist mein Platz?
Eine 23-jährige gehörlose Patientin war mit ihrer besten Freundin vor einem halben Jahr in eine Lawine geraten. Dabei wurde sie selbst fast erdrückt, die beste Freundin starb noch in der Lawine vor ihren Augen. Die Klientin zeigte Hyperarousal, Flashbacks, Intrusionen, Suizidphantasien, sozialen Rückzug besonders auch von der Herkunftsfamilie, die vermieden wird. Die Therapie erfolgt in Gebärdensprache. Nach zwei Sitzungen will sie auch die Therapie abbrechen, das bringe alles nichts. Nach einer EMDR-Intervention zum traumatischen Erlebnis verändert sich der Focus. Nun wird klar, dass die beste gehörlose Freundin, mit der die Patientin zum ersten Mal außerhalb der Familie zusammen lebte und die sie bereits aus der frühen Schulzeit gut kannte, eine wichtige Funktion beim Ablösungsprozess von der Herkunftsfamilie hatte, der jäh unterbrochen wurde. Es besteht jedoch eine ungeheure Sprachlosigkeit der Klientin ihrer Familie gegenüber. Durch Stuhlarbeit kann sie langsam ihre Gefühle und Bedürfnisse ausdrücken. Trauer, Wut und Ärger auf die Mutter und die Herkunftsfamilie dominieren nun als vorherrschende Gefühle. Die Patientin zeigte große Angst und scheint unfähig, dies der Mutter im Zweiergespräch zu zeigen. Wir vereinbaren eine Dreiersitzung mit moderiertem Dialog zwischen Mutter und Tochter und mir mit Ermutigung der Tochter. Die Tochter äußerte ihrer Mutter gegenüber vorsichtig ihre Wünsche nach einer besser auf sie abgestimmten Kommunikation im familiären Rahmen. Die Mutter beschwichtigt eher, die Patientin gibt enttäuscht auf. Weitere Stuhlarbeit mit noch prägnanterer Formulierung ihrer Bedürfnisse, danach erneuter moderierter Dialog mit Mutter und Tochter. Die Tochter kann ihrer Mutter jetzt sagen, dass sie sich in der Familie oft kommunikativ ausgeschlossen fühlt, und dass sie sich wünscht, dass in ihre Familie mehr gebärdet, mehr visuelle Kommunikation benützt wird. Die Mutter erklärt sich dazu bereit. Nun hat die Tochter endlich das Gefühl, von der Mutter wahrgenommen zu werden und potentiell in die Familie zurückkehren zu können. Dabei verschwinden die PTSD-Symptome, und die Isolationserfahrungen völlig. Bei einem Nachtreffen zwei Jahre später berichtet die Patientin, dass sie danach mit ihrem Freund zusammen gezogen sei, dass sie aber das Gefühl hatte, dass ihre Familie auch für sie da gewesen sei.
Darf ich wie ich will?
Eine ca. 50-jährige prälingual gehörlose Frau berichtet mir in Gebärdensprache über ihre Kindheit in einem strengen christlichen Gehörlosenschulheim, in das sie gegen ihren Willen mit sechs Jahren gebracht worden war. Dies war der Zeitpunkt ihrer Einschulung in die Gehörlosenschule und dies war die für sie zuständige. Sie hatte überhaupt nicht verstanden, weshalb sie dorthin musste. In ihrer Familie hatte ihr keiner erklärt was geschehen würde. Die Kommunikationsmittel waren begrenzt, und den Eltern war von der Heimleitung gesagt worden, dass sie so verfahren sollten. Sie fuhr also mit ihren Eltern in das Heim, diese sprachen mit den Schulschwestern, dann wurde sie plötzlich von den Schwestern gepackt und in einen Raum gesperrt. Sie sah durch einen Türspalt noch kurz, wie ihre Mutter mit Tränen in den Augen zu ihr hersah und von einer anderen Schwester mit ihrem Vater nach draußen geleitet wurde. Als sie schließlich aus dem Zimmer durfte, waren ihre Eltern nicht mehr da. Sie weinte und tobte und wurde als Strafe dafür gleich nochmals eingesperrt. Das Essen dort schmeckte ihr überhaupt nicht, sie verweigerte es oft, doch es herrschte Essenszwang. Alles musste aufgegessen werden, auch wenn es nicht schmeckte. Wiederholt musste sie das Gegessene erbrechen. Danach wurde sie gezwungen, das Erbrochene wieder aufzuessen, woraufhin sie es wieder erbrach und wieder gezwungen wurde – so ging das immer wieder. In den nächsten Ferien, als ihre Eltern sie abholten, erzählte sie ihnen alles. Diese beschwerten sich bei der Heimleitung. Doch sie wurden beschwichtigt, dass dies alles nur Erfindungen ihrer Tochter seien, da diese nicht im Heim bleiben wolle. Dies sei auch von anderen Kindern bekannt. Die Eltern glaubten den »Expertinnen«. Sie erzählte es zu Hause auch ihrer Großmutter, die sie über alles liebte. Diese glaubte ihr. Bei ihrer Rückkehr nach den Ferien wurde sie von ihrer Schulschwester halb totgeschlagen, mit dem Kopf wieder und wieder an der Wand geknallt, bis sie blutete. Ihr wurde erzählt, dass die Schwestern, wenn sie ihren Eltern noch einmal solche Lügen über das Heim erzählen würde, dafür sorgen würden, dass sie für immer im Heim bleiben müsse und nie mehr nach Hause dürfe. Sie glaubte das, als sechsjähriges gehörloses Mädchen. Sie erzählt, dass sie darüber fast verrückt geworden sei. Das einzige, was sie aufrecht gehalten hatte, war der Gedanke an die Großmutter, die ihr geglaubt hatte. Die Großmutter glaubte ihr auch bei den nächsten Besuchen und nur ihr erzählte sie davon. Sie bat sie, doch zu versuchen es in dem Heim trotzdem auszuhalten, da es die einzige Möglichkeit für Bildung für sie sei. Heute noch könne sie viele der Speisen nicht essen oder riechen, die es damals im Heim gegeben habe. In der Folgezeit gelang es ihr trotzdem eine Berufsausbildung abzuschließen und sich gut in die Gehörlosengemeinschaft zu integrieren.
Als 45-Jährige erlebte sie Arbeitsplatzkonflikte mit einer unsicheren neuen Chefin, die keine Erfahrung mit Gehörlosen hatte und die sie anschrie, sie solle schneller arbeiten. Zeitgleich verstarb auch ihre hochbetagte Großmutter. Dies löste eine Reaktivierung des Traumas mit massiven Intrusionen, Hyperarousal, Vermeidungen, Arbeitsunfähigkeit für vier Jahre aus. Die Klientin hatte die strengen Schwestern als Überlebensstrategie introjiziert. Selbsthass, massive Selbstabwertung, permanente Selbstkritik. Diese Introjekte verbündeten sich nun mit der Chefin, woraufhin es zum völligen psychischen Zusammenbruch der Klientin kam, mit massiven Ängsten, Selbstvernichtungsphantasien und der völligen Arbeitsunfähigkeit.
Die Entwicklung von Gegenstrategien, über die erstmalige Wahrnehmung und Differenzierung ihres Körpergefühls, einer Körper-Awareness und einer achtsamen Haltung für sich und die eigenen Bedürfnisse waren der primäre Fokus im Rahmen einer vierjährigen Langzeittherapie.
Nach einer EMDR-Intervention zur Auflösung der Intrusionen der Schulschwestern nach dem ersten Jahr glitt die Klientin aufgrund eines unbemerkten dissoziativen Prozesses in eine deutliche Verschlimmerung. Durch den visuellen Doppelmodus von Gebärdensprache und visueller Verarbeitung/Mimik bei der Intervention war der dissoziative Prozess nicht deutlich zu erkennen. Es folgte ein dreiwöchiger Psychiatrieaufenthalt mit Einverständnis der Klientin. Danach ging es ein Jahr nur über supportive Gestalttherapie weiter, danach zwei Jahre mit innerer Dialogarbeit und der Einnahme der Perspektive der Überlebenden. Das Aufspüren und die Identifizierung der Täterintrojekte, die als Top-dog-Attacken verstanden werden können, über die Wahrnehmung eigener Körpergefühle, stereotyper Denkinhalte und Stuhlarbeit brachte die Wende. Es schien, als sei in dem Moment, in dem sie ihr wahres, auf angenehmen Körpergefühlen beruhendes Selbst wieder gefunden hatte, die Macht des Bösen schneller gewichen, als alter Schnee in der Frühlingssonne schmilzt. Es erfolgte eine Arbeitserprobung am alten Arbeitsplatz auf lange entwickelten Wunsch der Klientin. Seit einem Jahr arbeitet die Klientin wieder erfolgreich und weitgehend angstfrei in ihrem alten Beruf.
Literatur
Amendt-Lyon, N. (2006): Denkwürdige Augenblicke der therapeutischen Beziehung. In: S. Lobb, N. Amendt-Lyon (Hrsg): Die Kunst der Gestalttherapie. Wien: Springer, 241-255
Anger, H. (2008): »The Gestalt wants to be completed«. Im vorliegenden Band, 185
Antonovsky, A. (1997): Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit. Tübingen: DGVT-Verlag
APA (American Psychiatric Association) (1996): Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-IV. (4. Aufl. ) (Dt. Bearb. V. H. Saß, H.-U. Wittchen & M. Zaudig) Göttingen: Hogrefe
Bocian, B. (2002): Lebenserfahrung und Theorieproduktion – Fritz Perls in Berlin 1893-1933. Ein Beitrag zur deutschen Vorgeschichte und zugleich zur Aktualität von Gestalttherapie und Gestaltpädagogik. Dissertation. www.edocs.tu-berlin.de/diss/2002/bocian_bernd.pdf (28.2.2007)
Butollo, W. (1996): Konfrontation und Kontakt: Integration von Gestalttherapie- und Verhaltenstherapie bei Angststörungen. Gestalttherapie, 1, 60-70
Butollo, W. (1998): Trauma und Selbstantwort. Gestalttherapie, 1, 54-68
Butollo, W., Krüsmann, M., Hagl, M. (1998): Leben nach dem Trauma. Über den therapeutischen Umgang mit dem Entsetzen. München: Pfeiffer
Butollo, W., Hagl, M., Krüsmann, M. (20032): Kreativität und Destruktion posttraumatischer Bewältigung. Forschungsergebnisse und Thesen zum Leben nach dem Trauma. München: Pfeiffer
Butollo, W. (2003): Die Klassifikation Posttraumatischer Belastungsstörungen. (PTBS) Vortrag. In: W. Wirth (Hrsg.): Trauma und Hörbehinderung. Hamburg: Signum, 3-22
Butollo, W., Hagl, M. (2003): Trauma, Selbst und Therapie. Konzepte und Kontroversen in der Psychotraumatologie. Bern: Huber
Bowman, C. (2002): To Ground Zero an Back. Gestalt!, 6, 1. www.g-gej.org/6-1/gzeroandback.html (28.2.2007)
Canacakis, J. (2002): Ich begleite Dich durch Deine Trauer. Stuttgart: Kreuz-Verlag
Chu, V. (1994): Scham und Leidenschaft. Zürich: Kreuz
Clemmens, M.C. (1993): Chemical dependency as a developed contact style. Gestalt Review 41, 1, 1-6
Clemmens, M.C. (1997): Getting beyond sobriety: Clinical approaches to long-term recovery. San Francisco: Jossey-Bass
Clemmens, M.C. (2005): Gestalt approaches to Substance use /abuse / dependency: theory and practice. In: A. L. Woldt, S. M. Toman: Gestalttherapy. History, theory and practice. Thousand Oaks: Sage, 279-300
Cohen, A. (2002): Gestalt Therapy and Post-traumatic Stress Disorder: The potential and its (lack of) Fulfilment. Gestalt!, 6, 1. www.g-gej.org/6-1/gestaltptsd.html (28.2.2007)
Crump, L. D. (1984): Gestalttherapy in the treatment of Vietnam veterans experiencing ptsd symptomatology. Journal of Contemporary Psychotherapy, 14, 1, 90-98
Deistler, I., Vogler, A. (2005): Einführung in die Dissoziative Identitätsstörung. Multiple Persönlichkeit. Therapeutische Begleitung schwer traumatisierter Menschen. Paderborn: Junfermann
Dreitzel, H.P. (2004): Gestalt und Prozess. Eine psychotherapeutische Diagnostik oder: Der gesunde Mensch hat wenig Charakter. Bergisch Gladbach: EHP
Dreitzel, H.P. (2007): Reflexive Sinnlichkeit I.: Emotionales Gewahrsein. Die Mensch-Umwelt-Beziehung aus gestalttherapeutischer Sicht. Neue, korr. Ausg. Bergisch Gladbach: EHP; zuerst: 1992
DVG – Deutsche Vereinigung für Gestalttherapie e.V. (2005): An der Grenze – Lore Perls und die Gestalttherapie. Ein Dokumentarfilm von Christof Weber und Wolf Lindner
Fuckert, D. (2002): Traumazentrierte Psychotherapie in der Nachfolge Wilhelm Reichs. Ein integratives körpertherapeutisches Modell. In: U. Sachsse, I. Özkan, A. Streeck-Fischer (Hrsg.): Traumatherapie – was ist erfolgreich? Göttingen: Vandenhoeck & Rupprecht, 83-112
Gestalt! (2004): Vol. 6, 1. www.g-gej.org
Greenberg, L.S., Rice, L.N. & Elliot, R. (2003): Emotionale Veränderung fördern. Grundlagen einer prozeß- und erlebensorientierten Therapie. Paderborn: Junfermann
Hardie, S. (2004): Gestalt! Vol. 8, 1. www.g-gej.org
Hartmann-Kottek, L. (2004): Gestalttherapie. Berlin: Springer
Heimansberg, B., Schmidt, C.J. (1992): Das kollektive Schweigen. Nationalsozialistische Vergangenheit und gebrochene Identität in der Psychotherapie. Köln: Edition humanistische Psychologie
Hille, K. (2002): Gestalttherapie und Trauma. In: U. Sachsse, I. Özkan, A. StreeckFischer (Hrsg.): Traumatherapie – was ist erfolgreich? Göttingen: Vandenhoeck & Rupprecht, 113-139
Hoffmann-Widhalm, H. (1999): Anwendung gestalttherapeutischer Grundprinzipien und Techniken in der Behandlung des posttraumatischen Syndroms am Beispiel der Arbeit mit bosnischen Flüchtlingen. In: R. Hutterer-Krisch, I. Luif, G. Baumgartner (Hrsg.): Neue Entwicklungen in der Integrativen Gestalttherapie. Wien: Facultas, 195-214
Horowitz, M.J. (2003): Persönlichkeitsstile und Belastungsfolgen. Integrative psychodynamisch-kognitive Psychotherapie. In: A. Maercker (Hrsg.): Therapie der posttraumatischen Belastungsstörungen. Berlin: Springer
Hutterer-Krisch (2001): Zum Verhältnis von Ethik und Psychotherapie. In: R. Hutterer-Krisch: Fragen der Ethik in der Psychotherapie. Wien: Springer
Janssen, N. (1999): Therapie von Borderline-Störungen. In: R. Fuhr, M. Sreckovic & M. Gremmler-Fuhr (Hrsg.), Handbuch der Gestalttherapie. Göttingen: Hogrefe, 789-811
Jossen, A. (2003): Vlora – Vom Überleben zum Leben. Gestalttherapie, 2, 69-90
Kepner, J. (1995): Healing Tasks. Psychotherapy with Adult Survivors of Childhood Abuse. San Francisco: Jossey-Bass
Klampfl, P. (2003): Was ist selbstfürsorglich an der Selbstzerstörung von Borderline-Patientinnen? Gestalttherapie, 2, 69-90
Kosijer, S. (1998): Kriegstraumatisierung und ihre Therapie. Gestalttherapie 1, 80-87
Lang, K. (2007): Arbeit mit »Frühen Entwicklungshemmnissen« in der Gestalttherapie. Gestalttherapie 1, 43-60
Laschinsky, D. (1996): Therapie mit sexuell missbrauchten Menschen: Gedanken zur Aufdeckung und Behandlung. Gestalttherapie, 2, 46-53
Layne, T. (1990) Therapie mit Inzestfamilie und Überlebenden. Gestalttherapie, 2, 67-72
Levinas, E. (1995): Zwischen uns. Versuche über das Denken des Anderen. München: Hanser
Levinas, E. (19994): Die Spur des Anderen. Untersuchungen zur Phänomenologie und Sozialphilosophie. Freiburg: Alber
Levinas, E. (2005): Humanismus des anderen Menschen. Hamburg: Meiner
Levine, P.A. (1998): Trauma-Heilung. Das Erwachen des Tigers. Essen: Synthesis
Levine, P.A., Kline, M. (2005): Verwundete Kinderseelen heilen. Wie Kinder und Jugendliche traumatische Erlebnisse überwinden können. München: Kösel
Maragkos, M. (2003): Bindung und Posttraumatische Belastungsstörungen. In: W. Butollo, M. Hagl (Hrsg.): Trauma, Selbst und Therapie. Bern: Huber, 91-108
Mayo, E. (1972): The Psychology of Pierre Janet. Westport: Greenwood Press
Micknat, J. (2002): Gestaltheilpädagogik. Umgang mit dem Trauma der geistigen Behinderung. Bergisch Gladbach: EHP
Perls, F. (1981): Gestalt-Wahrnehmung. Verworfenes und Wiedergefundenes aus meiner Mülltonne. Frankfurt: Verlag für humanistische Psychologie
Perls, F. (1993): A Life Chronology. Gestalt Journal 2, 5-9
Perls, F., Hefferline, R., Goodman, P. (1951): Gestalt Therapy. Excitement and Growth in the Human Personality
Perls, F., Hefferline, R., Goodman, P. (20067): Gestalttherapie. Grundlagen der Lebensfreude und Persönlichkeitsentfaltung. Stuttgart: Klett-Cotta
Perls, L. (1989): Leben der Grenze. Köln: EHP
Perls, L. (2003): Der Weg zur Gestalttherapie. Laura Perls im Gespräch mit Daniel Rosenblatt. In: Erzählte Geschichte der Gestalttherapie. Wuppertal: Peter Hammer
Polster, E. & Polster, M. (1975): Gestalttherapie. Theorie und Praxis der integrativen Gestalttherapie. München: Kindler
Portele, G. H., Rössler, K. (1994): Macht und Psychotherapie. Köln: EHP
Pröpper, M. (2007): Gestalttherapie mit Krebspatienten. Eine Praxishilfe zur Traumabewältigung. Wuppertal: Peter Hammer
Radkau, J. (1998): Das Zeitalter der Nervosität. Deutschland zwischen Bismarck und Hitler. München: Carl Hanser
Rothkegel, S. (1996): Der gefrorene See. Gestalttherapeutische Traumabearbeitung mit Folteropfern. In: S. Graessner, N. Gurris, C. Pross: Folter. An der Seite der Überlebenden. Unterstützung und Therapien. München: Beck, 129-149
Rust, G., Wolber, G. (1996): Ich hab ein ganz schmutziges Herz. Therapeutische Gruppenarbeit mit von sexuellem Missbrauch betroffenen Mädchen. Gestalttherapie, 2, 73-86
Schön, T. (2008): Über den Umgang mit dem Entsetzen. Aspekte gestalttherapeutischer Traumabehandlung bei Kindern und Jugendlichen. Im vorliegenden Band, S. 199
Serok, S. (1985): Implications of Gestalt Therapy with Post Traumatic Patients. Gestalt Journal, 1, 8, 78-89
Staemmler, F.-M., Merten, R. (2003): Angst als Ressource und Störung. Paderborn: Junfermann
Streeck-Fischer, Sachsse & Özkan (2001): Perspektiven der Traumaforschung. In: A. Streeck-Fischer, U. Sachsse, I. Özkan (Hg.): Körper, Seele, Trauma. Biologie, Klinik und Praxis. Göttingen: Vandenhoeck & Rupprecht, 12-22
Strümpfel, U. (2006): Therapie der Gefühle. Forschungsbefunde zur Gestalttherapie. Bergisch Gladbach: EHP
Van der Kolk, B.A. (2000): Trauma und Gedächtnis. In: B.A. van der Kolk, A.C. McFarlane & L. Weisaeth (Hrsg.): Traumatic Stress. Grundlagen und Behandlungsansätze. Paderborn: Junfermann, 221-240
Van der Kolk, B.A., McFarlane, A.C. & Weisaeth, L. (2000): Traumatic Stress. Grundlagen und Behandlungsansätze. Paderborn: Junfermann
Votsmeier, A. (1988): Gestalttherapie mit Borderline-Patienten. Gestalttherapie, 2, 5-15
Votsmeier, A. (1995): Gestalttherapie und die »Organismische Theorie«. Der Einfluss Kurt Goldsteins. Gestalttherapie, 1, 2-16
Votsmeier, A. (1999): Grundsätze der Gestalttherapie bei strukturellen Störungen. In: R. Fuhr, M. Sreckovic & M. Gremmler-Fuhr (Hrsg.): Handbuch der Gestalttherapie. Göttingen: Hogrefe, 715-732
Wardetzki, B. (1999): Gestalttherapie mit suchtkranken Menschen – Bulimie als Beziehungskrankheit. In: R. Fuhr, M. Sreckovic & M. Gremmler-Fuhr (Hrsg.): Handbuch der Gestalttherapie. Göttingen: Hogrefe, 813-826
Watson, P. (1982): Psychokrieg. Möglichkeiten, Macht und Missbrauch der Militärpsychologie. Düsseldorf: Econ
Wirth, W. (2003): Psychisches Trauma und Hörbehinderung. In: W. Wirth (Hrsg.): Trauma und Hörbehinderung. Hamburg: Signum, 111-139
Wirth, W. (2006): Hilfe, Selbsthilfe, Vielfalt: Rette sich wer kann? Ethische Aspekte der Rehabilitation und Psychotherapie bei erwachsenen Hörgeschädigten. In: M. Hintermair (Hrsg.): Ethik und Hörschädigung. Heidelberg: Median, 349-268
Wirth, W. (2008a in Druck): Gruppentherapie für hörgeschädigte Menschen. In: Hofstätter, A. (Hrsg.): Tagungsbericht zur 23. Internationalen Fachtagung für Psychologinnen und Psychologen an Einrichtungen für Hör- und Sprachgeschädigte: Psychologie im Netzwerk, Möglichkeiten der Interdisziplinarität in der Arbeit für und mit schwerhörigen und gehörlosen Menschen. Linz: Barmherzige Brüder
Wirth, W. (2008b in Druck): Gestalttherapie als ressourcenfokussiertes Verfahren für Hörgeschädigte: Support – die Basis für Entwicklung. In: Hintermaier, M. & Tsirigotis, C. (Hrsg.): Empowerment und Ressourcenarbeit mit hörgeschädigten Menschen in Theorie und Praxis. Heidelberg: Median
Wolf, U. (1998): Gestalttherapeutische Arbeit mit traumatisch geschädigten Patienten. Gestalttherapie, 1, 69-79
Wolf, U. (1999): Psychotherapeutische Unterstützung bei Trauma und Gewalt. In: R. Fuhr, M. Sreckovic & M. Gremmler-Fuhr (Hrsg.): Handbuch der Gestalttherapie. Göttingen: Hogrefe, 827-837
Yontef, G.M. (1999): Awareness, Dialog, Prozess. Wege zu einer relationalen Gestalttherapie. Köln: EHP
Verwendete Internetseiten:
www.edocs.tu-berlin.de/diss/2002/bocian_bernd.pdf (28.2.2007)
www.g-gej.org (26.2.2007)
www.g-gej.org/6-1/gzeroandback.html (28.2.2007)
www.g-gej.org/6-1/gestaltptsd.html (28.2.2007)