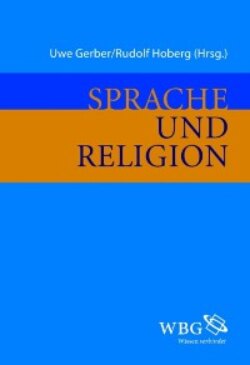Читать книгу Sprache und Religion - Группа авторов - Страница 15
PaRDeS: Die Lehre vom vierfachen Schriftsinn im Judentum und Christentum
Оглавление1. Gott, Esther, Bach
Was meint eigentlich die Lehre vom vierfachen Schriftsinn in der christlichen und jüdischen Hermeneutik? Die anspruchsvollste Lesart dieser Lehre wollen wir an einem Beispiel aus der Musik illustrieren. Helga Thoene versucht in ihrer „analytischen“ Studie zu J. S. Bachs „Sonaten und Partiten für Violine solo“ (BWV 1001 - 1006, Köthen 1720) nachzuweisen, dass der Zyklus insgesamt und die A-Moll Sonate insbesondere eine numerologisch verschlüsselte Botschaft enthält (Thoene 2005). Der Künstler habe mittels des lateinischen Zahlenalphabets aus der „Cabbala Paragrammatica“ (Leipzig 1683), die Johannes Henningius in seiner „Cabbalalogia“ mitteilt, programmatische Texte in seine Musik hineinkomponiert, und zwar nicht etwa nur seinen Namen, sondern eine ganze Liturgie – wie z. B. im Schlusstakt der Fuga der G-Moll Sonate, dessen Tonbuchstabenwert dem Zahlenwert seines vollen Namens entspricht (= 158). So entspreche z. B. auch die Addition der Taktzahlen der drei Fugenthemen und der Schlusstakte in den drei Sonaten für Violine solo (97 + 295 + 364 = 756) dem Zahlenwert der lateinischen Trinitätsdevise: „Ex Deo nascimur“ (143), „In Christo morimur“ (211), „Per spiritum sanctum reviviscimus“ (402) - „Aus Gott werden wir geboren, in Christus werden wir sterben und durch den heiligen Geist werden wir wiederbelebt“ (Thoene 2005, S. 39). Um diese frohe Botschaft zu vernehmen, müsste der Hörer freilich über ein Computerhirn verfügen. Es würde nämlich nicht reichen, beim Hören mitzuzählen, er müsste darüber hinaus Summen weit auseinander liegender Sätze (Nr. 2, Nr. 14 und Nr. 23) addieren und mit dem keineswegs eindeutigen Zahlenwert des besagten Spruchs vergleichen. Gesetzt, J. S. Bach hätte sich solcher Verschlüsselungsmethoden bedient, wofür die Verfasserin übrigens jeglichen außermusikalischen Beweis schuldig bleibt1 , so können die Fugen absolut ohne Kenntnis dieses Programms gehört werden – und sind auch 300 Jahre so gehört worden. Fände sich aber doch ein echter „Bach Code“, dann könnte mit seiner Hilfe in der wortlosen Musik erstmals eine bislang verborgene Schicht mit zu Gehör gebracht werden und das ganze Werk in einem neuen Licht erscheinen. Es ist keine große Kunst, einen Geheimtext zu produzieren, der wie ein Zeichensalat aussieht und sich schon dadurch verdächtig macht; aber so formvollendete Stücke wie die „Sonaten für Violine Solo“ als Geheimtext eines ebenso formvollendeten liturgischen und theologischen Klartextes zu komponieren, das übersteigt beinahe menschliche Schöpferkraft. Diese virtuose Codierung wäre allerdings nur eine Fingerübung im Vergleich zum „Bibel Code“, den der Schöpfer nach der Lehre vom vierfachen Schriftsinn komponiert haben soll.2 Dieser Lehre zufolge werden im einfachen Wortsinn der Schrift gleichzeitig drei andere Stimmen artikuliert; nicht etwa drei Nebenstimmen, die im homophonen Akkordsatz die Oberstimme begleiten, so dass man nur alle Register ziehen muss, um den ganzen Ton- und Sinnumfang des Werkes zu hören. Es handelt sich um echte Vierstimmigkeit, wobei die Polyphonie in der Polysemie der biblischen Sprache bereits mitschwingt und andeutungsweise anklingt. Aber die einzelnen Stimmen sind erst nach und nach kunstvoll aus dem Cantus firmus des Wortsinns entwickelt und eigens besetzt worden und haben dann ganz neue Sinnhorizonte des Werkes erschlossen. Nun aber, liegen sie, wie angeblich jene Liturgie in den Sonaten von J. S. Bach, Zeichen in Zeichen, Wörter in Wörter, Texte in Texte wie die ineinandergesetzten Figuren einer russischen Puppe oder, nach einem alten kabbalistischen Bild, wie die Hüllen einer Nuss in der harten Schale des Wortsinns. Um eine solche Nuss zu knacken und alle verborgenen Botschaften zu extrahieren, sind freilich noch andere, geheimere Operationen auszuführen als die Anwendung des gemeinen Zahlenalphabets.3
Obwohl die Lehre vom vierfachen Schriftsinn keine zwingende Sinnannahme ist, entbehrt sie nicht einer inneren Logik. Nach dem einfachen Buchstaben (Pschat) erzählt die Bibel von Anfang bis Ende die Geschichte des Volkes Israel und zählt seine Gesetze, seine Gebete, seine Gesichte, seine Gedichte auf. Nichts weist auf den ersten Blick darauf hin, dass es sich um Geheimtexte handeln könnte. Doch ein überflüssiges Wort hier4 , ein doppeldeutiges Wort da5 , ein verschlüsseltes Wort dort6 machen die Aufmerksamkeit der Zeichendeuter rege, sie werden von ihnen als Andeutung (Remes) eines verborgenen Sinnes aufgefasst. Mit verschiedenen Mitteln hat die rabbinische Exegese, die patristische Allegorese und die philosophische oder kabbalistische Kryptoanalyse unter der einfachen narrativen Schicht des Textes systematisch eine andere, zeitlos allgemeine Bedeutung (Allegorie) gesucht, etwa die rabbinische Kasuistik, die kirchliche Dogmatik oder irgendeine neuplatonische Metaphysik. Der Klartext der naiven biblischen Geschichten enthielte und enthüllte demnach Gedankengänge, wie sie verwinkelter und verwickelter niemals gedacht worden sind. Dazu schöpfen die Allegoresen den Text ohne Rücksicht auf die historische Wahrscheinlichkeit bis an die äußerste Grenze der hermeneutischen Belastbarkeit aus. Dieser Art von Exegese traut man heutzutage nichts oder vielmehr alles zu und fällt schnell das Urteil: Willkür! Das vermeintlich Ausgelegte sei wie das hineingeschwindelte Zylinderkaninchen bloß Eingelegtes, das im ursprünglichen Text nie und nimmer gemeint gewesen sein kann. Dagegen kann man immerhin einwenden, dass auch der biblische Text mit solchen Mitteln arbeitet und die Andeutung (Remes) ein „Formgeheimnis der biblischen Erzählung“ (Franz Rosenzweig) bildet. Formeln, Wörter, Wurzeln, Buchstaben, Zahlen, Akzente wiederholen sich wie Leitmotive innerhalb eines biblischen Textes und kehren in anderen Kontexten wieder. Die zeitlich gegliederte Erzählebene und die räumlich aufgefächerte Wiederholungsebene verhalten sich zueinander wie die Melodiestimme zur Bassstimme im alten Generalbass und eröffnen einen weiten Spielraum für Akkorde und Variationen. Die Bibel muss nach dem zweiten Schriftsinn Partitur gelesen werden!7
Aber die Allegorese kann noch nicht den ganzen Sinn der Schrift erschöpfen, weil diese mehr sein will als zeitlose Weisheit, sie will darüber hinaus jederzeit auch instruktive Weisung, Tora, sein. Damit ist nicht das allgemeinverbindliche Gesetz gemeint, das schwarz auf weiß im Text oder leicht erkennbar zwischen den Zeilen steht. Die Paränese sucht vielmehr nach einem Fingerzeig (Remes), der wie ein ausgestreckter Zeigefinger (Tora von Jara, werfen im Sinne von Fingerwerfen, Spr 6, 18) über den Seitenrand hinaus auf den Leser gerichtet ist, ihn persönlich anspricht. Keine Schriftstelle, die nach diesem Schriftsinn nicht riefe: „Mensch, wo bist Du?“ (Ajeka, 1 3, 9). Umgekehrt kann auch jeder Leser oder Hörer der Schrift erwarten, dass seine Sinnsuche (Derascha) in Erfüllung geht, dass die Schrift ihm etwas ganz Persönliches zu sagen hat, dass in sonst unentzifferbaren Lettern eine unverwechselbare Botschaft auf ihn wartet. So haben die Kabbalisten den Wunsch im Gebet: „Gib uns unseren Anteil in Deiner Tora“ (Ten Chelkenu BeToratecha) verstanden.9 „Es gibt 600.000 (vierfache) Erklärungen in der Tora“, so begründet ein mystischer Traktat über die Seelenwanderung diese eigene Sinngebung, „entsprechend jeder einzelnen dieser Arten, die Tora zu erklären, existiert eine Seele in Israel“. Ihre Wanderung endet erst dann, wenn sie ihren vierfachen Eigensinn in der Tora entdeckt hat. In diesem Text steht schließlich noch, dass jede dieser 600.000 Seelen Israels aus der Tora gebildet, wörtlich, „gemeißelt“ wurde – ein schönes Bild dafür, dass wir unsere Seelen tatsächlich aus Büchern auflesen, wo sie längst vorgesehen oder besser vorgeschrieben sind (R. Chajim Vital 1981, S. 48f.). Hier liegt der Willkürvorwurf noch näher als vorhin. Doch auch die Derascha gehört zu den Genera, die die Bibel selber pflegt. Das Deuteronomium, das alle Charakteristika eines Midraschs hat und mehr als alle anderen biblischen Bücher die unvergängliche Heutigkeit (HaJom) der Botschaft betont (vgl. De Vries 1975, S. 164 ff.), spricht ausdrücklich „neben dem, der heute hier bei uns vor dem Herren, unserem Gott steht, auch den [an], der heute nicht bei uns ist“ (5 29, 14). Welche dramatische Wirkung diese gewaltige Predigt des Propheten der inneren Zeitrechnung der Bibel zufolge nach mehr als ein halbes Jahrtausend noch zu entfalten vermochte, erzählt das 2. Buch der Könige (IIKön 22, 11).10 Josia, dem man das aufgefundene Deuteronomium vorlas, war über die Missachtung des verlorenen Gesetzes so bestürzt, dass er umgehend eine „Kulturrevolution“ ausrief (Assmann 2004, S. 86ff; 2005, S. 225f.). Wie in den Chorälen von Bach (etwa dem berühmten Eingangschoral zur Matthäuspassion: „Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen!“) wird der jeweils „heutige“ Hörer angesprochen und die Predigtintention bleibt, ihn zur Umkehr zu bewegen (Neh 8, 9). Vielleicht heißt der dritte moralische Sinn (sensus moralis) auf lateinisch deshalb tropologischer Sinn, weil er auf eine Wendung (gr. tropos), eine Umkehr (hebr. tschuwa) des Hörers berechnet ist. Die Tora ruft jedenfalls dem Leser: „Darscheni!“ zu11 und will als Derascha gehört und gelesen werden.
Was wir bisher über den zweiten und dritten Sinn der Schrift gesagt haben, lässt sich aber ohne weiteres von der Rezeption jedes Werkes behaupten (Partiturlesen, Leserpartizipation; vgl. z.B. Gadamer 1975, S. 313ff.). Damit haben wir den besonderen Sinn, den die Bibel als „Gottesschrift“ für sich in Anspruch nimmt, noch gar nicht berührt. Diesen vierten Schriftsinn charakterisieren die Kabbalisten als den eigentümlichen Gottessinn, indem sie die ganze Schrift buchstäblich als Gottesnamen lesen.12 So wie der Komponist sein Werk mit dem vertonten Tetragrammaton B-A-C-H (b-a-c-h) versiegelte13 , so der göttliche Autor das seine mit dem Tetragrammaton J-H-W-H. Ist diese Signatur einmal unleserlich, so kann sie mit Hilfe der Dechiffrierkunst (Chochmat HeZeruf), z. B. durch Buchstabenrücken wieder sichtbar gemacht werden14 , denn in ihrer magmatischen Urschicht war die Ur-Tora (Tora Keduma) nach einem berühmten Midrasch mit schwarzem Feuer auf weißem Feuer geschrieben und noch nicht zur bekannten Textgestalt erstarrt.15 Der Gottesname als Unterschrift bildet die stets mitzulesende unterschwellige Grundschicht des Textes, ihre innerste Botschaft, ihr äußerstes Geheimnis (Sod). Der kabbalistische Onomatologe R. Josef Gikatilla zeigt mit recht komplizierten Berechnungen, wie das Tetragrammaton als Grundmuster in allen seinen Derivaten, den übrigen Namen und Beinamen Gottes und letztendlich in der gesamten Textur des biblischen Textes eingeschrieben ist und schließt: „Somit erscheint die ganze Tora nach dem Namen JHWH gewoben (Arag), demgemäß heißt sie ‚Torat JHWH‘ (Ps 19, 8), was eigentlich „Lehre des Herrn“ bedeutet, hier aber mit „Lehre des Gottesnamens“ wiedergegeben werden muss.“16 Im Grunde genommen besagt diese Lehre, dass die Tora in allen ihren Teilen Nennung, Vorstellung, Selbstmitteilung, Ausbuchstabierung Gottes ist.17 Hier spätestens scheint der Gipfel der Willkür erreicht. Doch auch hier greifen die Kabbalisten nur das traditionelle Schriftverständnis auf und radikalisieren es. Dass die Schrift „Gottesschrift“ sei (Michtaw Elohim, 2 32, 16), gilt nach der traditionellen Auffassung nicht nur an jenen Stellen, wo Gott sich selber zu Wort meldet oder über Ihn gesprochen wird, sondern auch an jenen, wo von Ihm gar nicht die Rede ist. Ausgerechnet das so menschlich-allzumenschlich anmutende Hohelied, wo Gott secundum litteram eigentlich überhaupt nicht vorkommt, gilt gemäß der traditionellen Auffassung als „heiligstes“ Buch der biblischen Bücher (Kodesch Kodaschim, mJad III, 5). Zum Buch Esther, wo der Name Gottes ebenfalls durch Abwesenheit glänzt, hat man gesagt, er sei in der höfischen Intrige um die Judenvernichtung umso mehr verstrickt, je weniger er als eine bestimmte, handelnde Person auftritt, dafür aber mit unsichtbarer Hand das Geschick seines Volkes durch lauter wunderbare Wendungen zu einem glücklichen Ausgang lenkt. In der gewundenen Lebenslinie Israels, wie sie der Buchstabe darstellt, zeichnet sich überall die Unterschrift Gottes ab. Was aber macht die Auslegung im Namen Gottes für einen Sinn? Hier kommt dem Ausleger des vierten Schriftsinns zustatten, dass dieser Name schon in der Bibel kein dunkler Eigenname mehr ist, sondern am brennenden Dornbusch als Seinsbegriff durchleuchtet wurde (Schem Hawaja, 2 3, 14). Gikatilla erläutert, „dass der spezielle Name (Schem HaM‘juchad) JHWH, eben jener Name ist, welcher Ihm besonders ist und einer wichtigen Aussage über sein Sein (Hawaja) und die Ewigkeit seiner Existenz dient [...]. Wenn du willst, sage ‚HaHowe Haja WeJihje‘ (Der da ist, war und sein wird).“18 Auslegung sub specie aeternitatis hieße demnach, die äußere Geschichte Israels als innere Gottes- oder Seinsgeschichte zu durchschauen und so die faits divers von Hirten und Schäfern ins Absolute zu erheben. Der spanische Kabbalist R. Moses der Leon, der am Ende des 13. Jahrhunderts die kanonische Formel für die jüdische Lehre vom vierfachen Schriftsinn prägte, schrieb über die menschlich-göttliche Doppelnatur des Textes in einem Responsum: „Alle jene Geschichten sind in Wahrheit alle das Mysterium der Gottheit, und sie sind auf der Stufe seines Denkens im Mysterium seines Namens, Er sei gesegnet, enthalten“. Er verweist auf sein heute verlorenes Buch über den vierfachen Schriftsinn, wo er „hinsichtlich des Mysteriums (Sod) dieser Geschichten und Vorfälle auslegte, die in der Tora berichtet werden, um zu lehren, dass alles das ewige Leben bedeutet [...]. Es gibt kein Wort in der Tora, das nicht im Mysterium seines Namens, er sei erhoben, enthalten ist, damit der Mensch, der sich mit diesen Dingen befasst, das ewige Leben erringt [...]. Denn diese Welt ist ein Abbild der oberen Welt, und alles Leben und alles Geschehen geschieht in dieser Welt, damit es als Abbild der oberen Welt dient.“(Zitiert und übersetzt bei Grözinger 2007, S. 207f.)
Jetzt haben wir alle Sinne beisammen: den einfachen historischen Sinn (Pschat), den angedeuteten zeitlosen Sinn (Remes), den immer neu zu erforschenden Eigensinn (Drasch), und den verborgenen Tiefsinn (Sod) der Schrift. Zwischen den verschiedenen Auslegungsweisen soll es wenigstens gemäß den Absichtserklärungen der Vertreter der Lehre vom vierfachen Schriftsinn keinen Streit der Interpretationen geben, sie bilden nur auf verschiedenen kategorialen Ebenen (der narrativen, der normativen, der instruktiven und der generativen) denselben Inhalt ab und verweisen so auf die Einheit des Sinnes in der Vielstimmigkeit der Auslegungen: Aus der Historiographie des Alten Israel wird die Hodographie des ewigen Israel, die Biographie des Israeliten und die Autobiographie Gottes herausgelesen. Diese Rekonstruktion des vierstimmigen Werkes ist allerdings zu schön, um wahr zu sein. Denn die vier hermeneutischen Begriffe: Pschat (P), Remes (R), Drasch (D), Sod (S) gehören nicht der gleichen Ordnung an. Die beiden eingeführten hermeneutischen Begriffe Pschat und Drasch bezeichnen wohl zwei Bedeutungsebenen, den buchstäblichen und den übertragenen Sinn, während aber das Wort Remes ganz allgemein einen Hinweis auf eine andere Bedeutung meint und Sod diesen verborgenen Bedeutungsinhalt umschreibt. So gesehen stehen die Kürzel: P, R, D, S nicht für eine Stratigraphie der Sinnschichten, sondern für eine planvolle Transformation des buchstäblichen Sinns (P) mittels Hinweisen (R) in irgendeinen gesuchten (D) verborgenen Sinn (S), eine Transformation, die man mit Moshe Idel als „Arkanisierung des Archaischen“ bezeichnen kann. Der gesuchte Geheimsinn des Buchstabens kann dabei ein halachischer oder aggadischer, ein philosophischer oder mystischer Midrasch sein. Dass der rabbinische Midrasch bevorzugt als „moralischer Sinn“ angesprochen werden kann, weil in ihm die legalistischen und ethischen Rücksichten vorherrschen, ändert nichts daran, dass sich auch die kosmologischen Spekulationen der jüdischen Philosophie oder die theogonischen Spekulationen der jüdischen Mystik nicht weniger als Drasch präsentieren. Überdies verstehen sich alle drei Geheimsinne als textunmittelbar, ja, ihre Ausweise sind umso literalistischer, je weiter sie sich vom trivialen Textsinn entfernen. Aber die ersten mittelalterlichen Vertreter der Lehre vom vierfachen Schriftsinn haben sie durchaus als Leiter (Sulam) vom Sinnlichen zum Geistigen, vom Vergänglichen zum Ewigen, vom Menschlichen zum Göttlichen verstanden und die Hermeneutik als Aufstieg (Anagogie) ins Paradies beschrieben.
Nehmen wir als erstes Beispiel für diese Viel- bzw. Vierschichtigkeit der Schrift gleich ihr erstes Wort, Bereschit. Die „Bibel in gerechter Sprache“ gibt nicht weniger als sieben mögliche Übersetzungen an: bei Beginn, als Anfang, zu Anfang, durch einen Anfang, im Anfang, zu Beginn, am Anfang an. Dass keine dieser Übersetzungen für sich und auch alle zusammen genommen dem Original vollauf „gerecht“ werden, liegt an der notorischen Vieldeutigkeit der hebräischen Präposition Be, dem ersten Buchstaben der Schrift. Sie kann nach den Begriffen der deutschen Grammatik mindestens in vierfacher Weise verstanden werden, wie üblich temporal (am, hebr. Be’et), aber auch kausal-final (wegen, hebr. Biglal), lokal-direktional (im, hebr. Betoch), oder modal-instrumental (mit, hebr. Al Jede). Die temporale Auffassung der Präposition antwortet auf die Frage Wann?, die kausal-finale auf Wozu?, die lokal-direktionale auf Woher? und die modal-instrumentale auf Womit?. Es leuchtet ein, dass alle diese vier Fragen nach Anfang, Sinn, Ursprung und Ursachen der Welt angebracht sind, und sie entsprechen in etwa den Fragen, die man nach dem vierfachen Ursachenbegriff des Aristoteles (Metap V, 2; Phys II, 3) überhaupt stellen kann. Die vier Arten der jüdischen Schriftauslegung antworten nun der Reihe nach auf diese vier Fragen, wie sich aus dem Kommentar des R. Bachja ben Ascher aus Saragossa (Rabbenu Bechaje, ca. 1255 - 1340) ergibt, der die Schrift als erster systematisch nach dem vierfachen Schriftsinn auslegte (vgl. Übersetzung und Erläuterung der einschlägigen Stellen bei Grözinger 1994). In der Einleitung zu seinem Kommentar unterscheidet er diese vier Auslegungswege (Arba‘a Derachim) wie folgt: Der „Derech HaPschat“ ist die Auslegung nach dem Buchstaben im Anschluss an Rabbi Schlomo ben Izchak (Raschi, 1040 - 1105), der „Derech HaMidrasch“ folgt der Exegese der Rabbinen in Talmud und Midrasch, der „Derech HaSechel“ setzt die philosophische Allegorese des Rabbi Mosche ben Maimon (Rambam, 1138 - 1204 n.) fort und der „Derech HaKabbala“ betreibt mystische Kryptoanalyse nach dem Vorbild des Rabbi Mosche ben Nachmann (Ramban 1194 - 1270 n.).19 Die Paschtanim, die Meister des Buchstabens, haben nach Rabbenu Bechaje das Wort Bereschit vor allem danach untersucht, was „zuerst“ (BaRischona) kam: Himmel und Erde, das Licht, das All?20 Die Darschanim, wenigstens diejenigen, die Rabbenu Bechaje anführt, interessieren sich hingegen weniger für den Anfang (Bereschit) als für das Ende (Acharit) der ganzen Sache, also für den Sinn und Zweck der Welt. Durch eine Reihe von Hinweisen (Remasim), etwa die Homophonie des ersten Wortes Bereschit mit verschiedenen Sorten von zu opfernden Erstlingen (Reschit), die Auflösung des Wortes Bereschit in signifikanten Silben und Zahlen (etwa Bet-Rosch-JT -der Buchstabennamen Bet bedeutet Haus, Bet-Rosch verweise auf den ersten Tempel (Bajit Rischon), der 410 = JT Jahre stand) legen durchgehend folgende Parallele nahe: Das große Gotteshaus der Welt kündigt schon das kleine in Jerusalem an, die große Gottesgabe die vielen kleinen Gegengaben, der Gottesdienst ist m. a. W. Sinn und Zweck der Welt.21 Überhaupt wird durch weitere Buchstabenversetzungen und Querverweise die gesamte Unheils- und Heilgeschichte Israels von den Vätern über Moses bis zum Messias in das erste Wort der Tora eingetragen. Die philosophischen Maskilim suchen in den ersten Worten der Schrift, aus welchem Prinzip die Welt en arché, in principio hervorgeht, und verstehen nach Rabbenu Bechajje Bereschit als Subjekt des Verses: Bereschit Bara Elohim - Bereschit schuf Elohim, wobei Reschit für die causa prima und das Pluraliatantum Elohim für den mundus intelligibilis stehen. Die Mekubalim finden schließlich im ersten Vers der Schrift die Emanation der zehn göttlichen Attribute (Sephirot) aus Gott verschlüsselt. Das Wort Bereschit schildere insbesondere die Vermittlung der Schöpfung durch die Weisheit, von der schon die Bibel verschiedentlich spricht (Spr 3, 19; Ps 104, 24; Hi 28, 20; Joh 1, 1). Die 1. Potenz, der übervernünftige und darum auch nur durch die Spitze des Buchstabens Bet angedeutete göttliche Wille (Krone, Keter) habe zunächst mit (Be-) der 2(= Bet). Potenz der göttlichen Weisheit (Chochma) den göttlichen Verstand (Bina = Elohim, d. i. in etwa der Ideenhimmel) hervorgebracht. Schließlich stehe zwischen den Intervallen der beiden ersten Bet des biblischen Textes (Bereschit, Bohu) der zweiundvierzigbuchstabige geheime Gottesname verschlüsselt, den schon der Talmud als gut gehütetes Geheimnis erwähnt (bQid 71a). Dieses erste Beispiel zeigt bei aller Phantastik, dass der vierfache Schriftsinn nicht bloße Willkür ist, sondern von den mannigfachen Dimensionen des Buchstabens der Schrift selber gefordert wird.
Unser zweites Beispiel haben wir selber zusammengestellt. Wir nehmen den durch Erwählung, Berufung, Bestimmung und Prüfung höchst individuierten Menschen Abraham, der geradezu als Illustration der Ecce-homo-Haecceitas herhalten könnte, und sehen zu, was der vierfache Schriftsinn aus ihm macht, indem er ihn typisiert, idealisiert, hypostasiert. Abraham ist nach dem buchstäblichen Sinn der Vorläufer Israels (112), im allegorischen eine Vorwegnahme seines Glaubens (1 15, 6) und Gesetzes (1 26, 5), im moralischen – etwa im Gegensatz zu den Leuten von Sodom – ein Vorbild der Gastfreundschaft (1 18; mAV V, 10; bSan 109a-b), im mystischen Sinn ein Gefäß Seines Segens (1 12, 2 - 3), eine Hypostase Seiner Güte (Chessed).22 Wenn man will, kann man alle diese Bedeutungen kodiert im Namen Abrahams wiederfinden. ABRaM, der Entdecker des „hohen Vaters“ (AB RaM, 1 11, 26) wird durch seinen Namenswechsel als Apostel der Völker charakterisiert: ABRaHaM soll nach der biblischen Erklärung eine Abkürzung für „Vater einer Menge von Völkern“ (AB-HaMon Gojim, 1 17, 5) heißen, was umständehalber gewiss keine biologische Vaterschaft meint. Durch den Wert dieses neuen Namens im hebräischen Zahlenalphabet (= 248) wird er sodann buchstäblich zur Verkörperung der 248 Gebote der Tora, die nach einem berühmten Midrasch der Anzahl der Glieder des menschlichen Körpers entsprechen.23 Die Vorbildfunktion kann wiederum aus der biblischen Namenserklärung gewonnen werden, die streng genommen den Namen ABHaM ergeben müsste, der Spruch zur Erklärung von ABRaHaM hätte dagegen ABaR HaMoN Gojim lauten müssen (Ibn Esra z. St.). Das Nomen aus der Wurzel ABR bedeutet Flügel, Schwinge, was die homiletische Auslegung stützt: „Er (Abraham) ist der Hebel, der sie (die Völker) zur geistigen und sittlichen Höhe bringt“ (S. R. Hirsch z. St.). Schon in der rabbinischen Literatur hat Abraham eine beinahe übermenschliche Statur, was anhand des seinem Namen hinzugefügten H-Lautes dargetan wird. Das hebräische Wort BeHibaram in der Unterschrift zum Schöpfungsbericht: „Dies ist die Entstehung von Himmel und der Erde, da sie erschaffen wurden“ (BeHiBaRAM, in der masoretischen Schreibweise mit hervorgehoben diminuierten H‘, 1 2, 4) haben die Rabbinen einerseits in die beiden Wörter BeH‘ (= mit dem Buchstaben He) und BeRa’AM (= erschuf er sie) zerlegt und als „Er erschuf sie (Himmel und Erde) mit dem Buchstaben H“ gelesen (GenR 12, 10 u. Raschi z. St.) und andererseits durch die Permutation des A- und H-Lauts als Anagramm von Abraham identifiziert (Be-HeBRAM = Be-ABRaHaM, GenR 12, 9). Daraus folgt, dass der Schöpfer die Welt Abraham „zuliebe“ (die Präposition Be kann wie Bischwil, wegen, zuliebe, auch final aufgefasst werden) erschuf. Für die Kabbalisten ist der zusätzliche Hauchlaut im Namen Abrahams allerdings eine Erkennungsmarke Gottes, dessen Namen tatsächlich in vielen biblischen Personennamen wiederkehrt und in dem eben auch zweimal der H-Laut vorkommt. Und zwar sei das hinzugesetzte H der letzte Buchstabe des Namens JHWH, der in der kabbalistischen Emanationslehre der letzten der zehn Hypostasen entspricht, dem Reich (Malchut) bzw. seiner Einwohnung (Schechina). Nach dem Sohar I, 93 ist es kein Widerspruch, dass Abraham zugleich Hypostase der göttlichen Güte (Chessed) und des Reiches Gottes (Malchut) ist, denn Gott regiert sein Reich eben mit Güte. Die buchstäblichen und die mystischen Bedeutungen der Chiffre Abraham konvergieren: Der Mission für das Gottesreich auf Erden korrespondiert die Emanation des Gottesreiches im Himmel. Der vierfache Schriftsinn typisiert, idealisiert und divinisiert so den real existierenden Patriarchen.
2. Omnisignifikanz
Wir haben es gar nicht nötig, die Lehre vom vierfachen Schriftsinn an speziell jüdische oder christliche Voraussetzungen zu binden, weil wir jeden narrativen Text ganz spontan nach dem vierfachen Schriftsinn lesen. Im äußeren Gewand des narrativen Textes suchen wir stets nach der typischen Gestalt, dem idealen Gehalt und den geheimen Gedanken seines Schöpfers. Wir können in den vier Sinnen auch leicht die Blickwinkel wiedererkennen, die sich in jeder Textinterpretation verschränken: vom Text her (intentio operis), vom Leser her (intentio lectoris) und vom Autor her (intentio auctoris). Ich höre aber schon die Historiker schreien: „Er erklärt seine Lieblingsschichttorte zur Schichttorte schlechthin!“24 – ein durchaus nachvollziehbarer Einwand, wenn man bedenkt, wie langsam und unsicher die hermeneutische Formation namens „Vierfacher Schriftsinn“ historisch gewachsen ist (vgl. Lubac 1959 - 1964). Aber die Durchschlagkraft des hermeneutischen Modells über Religionsgrenzen hinweg sagt vielleicht doch etwas über seine innere Wahrheit aus. Es ist freilich nicht zu bestreiten, dass die spezifisch jüdische Ausprägung dieser Lehre eng mit dem jüdischen Schriftverständnis verknüpft ist, speziell mit offenbarungstheologischen Voraussetzungen, wonach die Bibel eine göttliche Schrift in der Sprache der Menschen ist.25 Nur weil die Offenbarung als Verhüllung des aktual Unendlichen in endlichen Schriftzeichen gedacht wird, kann die Auslegung umgekehrt als potentiell unendliche Enthüllung des Unendlichen in jeder Einzelheit der Schrift betrieben werden. Der Omniszienz und Omnipotenz des Verfassers entspricht die Omnisignifikanz seines Werkes. James J. Kugel hat in seiner Untersuchung zum Parallelismus membrorum den Begriff der Omnisignifikanz wie folgt definiert: „The basic assumption underlying all of rabbinic exegesis is that the slightest details of biblical text have a meaning that is both comprehensible and significant. Nothing in the Bible, in other words, ought to be explained as the product of chance, or, for that matter, as an empathic or rhetorical form, or anything similar, nor ought its reasons to be assigned to the realm of Divine unknowables. Every Detail is put there to teach something new and important, and it is capable of being discovered by carefully analysis.” (Kugel 1981, S. 104; vgl. dazu auch Kugel 1999)
Das heißt, dass alle sprachlichen Wendungen im biblischen Text, die rhetorischen Figuren und der poetische Schmuck kein nutzloses Beiwerk wären. Jedes Synonym im biblischen Gedankenreim etwa müsste sich nach dem Nullredundanz-Kriterium der rabbinischen Exegese unter irgendeiner Rücksicht als Antonym erweisen lassen. Es ist aber durchaus möglich, dass sich die Lehre vom vierfachen Schriftsinn auch aus einem profanen Textverständnis heraus entwickeln lässt.
Gerade eine bestimmte Art von Dichtung liefert eine literarische Illustration zu diesem Schriftverständnis. Jorge Luis Borges, ein gutes Beispiel für einen Dichter dieser Art, hat in „Una vindicación de la cábala“ (1931) die Poesie und die Prosa einmal folgendermaßen unterschieden: Bei einer Zeitungsmeldung zähle vor allem der Informationsgehalt, während die Form der Mitteilung, etwa die Zahl der Wörter, Silben, Buchstaben und dgl. mehr dem Zufall überlassen bleibt. Beim Gedicht sei es gerade umgekehrt, hier herrschen die Gesetze des Wohlklanges auf Kosten des Sinns, der in einer poésie pure oft sogar vollkommen gleichgültig ist. Gewisse Dichter erheben allerdings den Anspruch, in ihren Werken sowohl hinsichtlich der Form wie des Inhalts nichts dem Zufall überlassen zu haben. Ihre Werke genügten der biblischen Kanonformel, es ist „nichts hinzuzufügen, nichts wegzunehmen“ (Bal Tossif, Bal Tigra, 5 4, 2) und ihre Autorschaft stünde Gott nur um ein Geringes nach.26
„Stellen wir uns nun diese sternhafte Intelligenz vor [so extrapoliert Borges auf die Heilige Schrift], wenn sie sich daran begibt, sich offenbar zu machen [...] in geschriebenen Worten. Stellen wir uns dergleichen vor, in Übereinstimmung mit der [...] Theorie von der wörtlichen Inspiration, dass Gott Wort für Wort diktiert, was er zu sagen beabsichtigt. Diese Prämisse (und sie war es, die die Kabbalisten übernahmen) macht aus der Schrift einen absoluten Text, bei dem die Mitwirkung des Zufalls mit Null zu beziffern ist. Allein die Vorstellung dieses Dokuments ist ein größeres Wunderwerk als alle, die auf seinen Seiten verzeichnet sind. Ein Buch, das für die Kontingenz undurchdringlich ist, ein Mechanismus unendlicher Absichten, unfehlbarer Variationen, lauernder Offenbarungen, Überlagerungen von Licht – wie sollte man es nicht bis zur Absurdität, bis zur Unzahl befragen, wie es die Kabbala tut.“(Borges 2003, S. 66 f.)
Omnisignifikanz und Nullkontingenz des Textes bedeuten zugleich vollkommene Transparenz von Form und Inhalt, totale Koinzidenz von Semiotik und Semantik, nicht nur bei den bedeutsamen Sprach- und Schriftzeichen, sondern auch noch bei kalligraphischen Verzierungen, an denen nach einem rabbinischen Diktum auch Berge von Lehren aufhängt werden können.27 Die Heilige Schrift wäre also nur der Ideal- und Grenzfall einer vollkommenen Schrift, der sich profane poetische Texte beliebig annähern können! Die Omnisignifikanz ist die Grundlage für mannigfache Überschneidungen zwischen der rabbinischen Hermeneutik und der modernen Literaturtheorie.
Wie verhält sich das Prinzip der Omnisignifikanz zur Lehre vom vierfachen Schriftsinn? Zunächst muss bemerkt werden, dass die Omnisignifikanz des biblischen Textes keineswegs ein jüdisches Dogma ist und nicht von allen jüdischen Schrifterklärern im gleichen Maß vertreten wird (vgl. Steiner 1992). Wie weit der Deuter das Schriftwort auf der Skala zwischen der Null- und der Omnisignifikanz mit Sinn füllt, bleibt vielmehr ihm überlassen. Der Vers: „Denn das ist kein leeres Wort für euch (Dawar Rek), sondern daran hängt euer Leben“ (5 32, 47) besagt nach dem Talmud – „wenn es leer für euch ist, dann, weil ihr euch nicht darum bemüht; wann ist es euer Leben, wenn ihr euch darum bemüht“ (jKet 8, 11, 32c).28 Die Erwartung des Talmuds ist aber, dass wir dem Gotteswort so viel Sinn wie möglich geben. Der Begriff Omnisignifikanz bekommt wenigstens in der Tradition des vierfachen Schriftsinns einen immer weiteren Umfang. Schon die Synagogenväter verstehen ihn dahingehend, dass nicht nur alles an und in der Schrift bedeutsam ist, sondern auch, dass die Schrift alles bedeutet: „Forsche in ihr (Tora)”, sagen sie „und forsche immer wieder in ihr, denn in ihr ist alles enthalten” (Hafach Ba WaHafach Ba, Dechola Ba, mA V 5, 25). Wir sollen, so könnte man diese Maxime auch übersetzen, die Schrift so lange auf den Kopf stellen, bis sie alles preisgibt, auch anachronistische Aussagen, die sie nach dem historisch-kritischen Verstand niemals hätte machen können. Denn jede noch so verdrehte, noch so fernliegende Deutung, die in Zukunft im Lehrhaus zur Sprache kommen wird, muss nach einem bekannten rabbinischen Paradox seit jeher in der Schrift bereits enthalten gewesen sein: „was ein kundiger Schüler dereinst vor seinem Lehrer lehren wird, war auch schon dem Mose am Sinai gesagt worden“ (Afilu Ma ScheTalmid Watik Atid LeHorot Lifnei Rabbo Kwar Nemar LeMosche BeSinai, jPea 17a). Damit ist eine weitere Ausdehnung des Begriffs der Omnisignifikanz gegeben. Denn alle möglichen Deutungen und Deutungsansätze erweisen sich als von vornherein textimmanente Möglichkeiten. Eine solche Textzentrik liegt z. B. auch der reformatorischen Hermeneutik zugrunde, die die sola scriptura als norma normans und sui interpres auffasst. Der vierfache Schriftsinn bringt, wenn das überhaupt noch möglich ist, eine weitere Steigerung der Omnisignifikanz. Denn nach dem vierten Schriftsinn (Sod) hat Gott sich, um noch einmal den entschiedenen Gegner des vierfachen Schriftsinns und der Kabbala, Luther, zu zitieren, in der Schrift herabgelassen und „gebuchstabet“. Oder, um es besser mit den Worten eines italienischen Kabbalisten des 13. Jahrhunderts zu sagen: „Gott ist also nicht irgendetwas jenseits der Tora, die Tora ist nicht außerhalb von ihm und er nicht außerhalb von ihr, und daher durften die Weisen der Kabbala sagen, dass der Heilige, gelobt sei Er, selber die Tora ist“.29 Zwischen Gott und Text gibt es keinen Unterschied mehr, er ist wie der Leser hoffnungslos im Gewebe des Textes verstrickt. Der Monotheismus wird zum Textmonismus oder Pantextismus: Es gibt nur einen Text und nichts außer ihm! Alle Gotteseigenschaften, alle Gottesworte, alle Gottestaten sind eben berichtete Eigenschaften, Worte und Taten; dem Text entgeht nichts mehr! Die Omnipräsenz Gottes im Text gibt dem Prinzip der Omnisignifikanz seine letzte und höchste Rechtfertigung. Gott steckt buchstäblich in jedem Detail, welches daher auch mit unendlichem Sinn schwanger geht und zu unendlicher Sinngeburt fähig ist. Somit erklärt sich das Geheimnis des Mehr des sensus plenior im Weniger des sensus litteralis, der unendlichen Fülle in der endlichen Hülle. In diesen vier verschiedenen Bedeutungen des Omnisignifikanzprinzips, wonach alles im Text bedeutsam ist, der Text auch wirklich alles bedeutet, der Text alle Deutungen einschließt und allen Textstellen unendliche Bedeutung zukommt, erkennen wir den vierfachen Schriftsinn wieder. Wenn wir den theologisch-mystischen Überbau weglassen, dann klingen diese kühnen Formeln der unendlichen Sinnanreicherung von Texten reichlich postmodern.30 Wir wollen deshalb abschließend noch einmal auf den traditionellen christlichen und jüdischen Sinn der Lehre vom vierfachen Schriftsinn zurückkommen und beide miteinander vergleichen.
3. Christlich-jüdische Lehre?31
Die Lehre geht auf die Patristik zurück (v. Dobschütz 1921, S.1 - 13). Vollständig tritt sie erstmals bei dem gallischen Mönch Johann Cassianus (360 - 435) auf.32 In seinen Mönchsgesprächen will er sie aus der Schrift selber ableiten (Collationes 14, 8). Im goldenen Alphabet der tüchtigen Frau am Ende des Buchs der Sprüche Salomons steht: „Ihr ganzes Haus ist gekleidet in Karmesin“ (Spr 31, 21). Sowohl die LXX wie die Vulgata lesen Sche najim (doppelt) statt Schanim und übersetzen „Ihr ganzes Haus ist doppelt gekleidet“ (vestiti sunt duplicibus) – was eigentlich auch besser zum vorigen Vers passt, demzufolge niemand im Hause der tüchtigen Frau den Winter zu fürchten bräuchte. Dieses doppelte Gewand nun ist für Cassian ein unzweideutiger Hinweis auf die Doppelsinnigkeit der Heiligen Schrift, die nach dem historischen und dem geistigen Sinn verstanden werden kann (historica interpretatio, intelligentia spiritualis). Die Dreiteilung des geistigen Sinns folgert er ferner aus einem anderen Spruch: „Habe ich Dir nicht geschrieben Herrliches (Schalischim) an Ratschlägen und Lehren“. Die LXX wie die Vulgata geben Schalischim im Sinne von Schalisch mit „dreifach“ wieder (griech. trissos, lat. tripliciter). Quod erat demonstrandum! Die drei geistigen Sinne tragen bei ihm schon ihre üblichen Namen tropologia (griech. Trópos; Wendung, Wechsel), allegoria (griech. allegoréin von alleon und lat. alienus; etwas anders sagen) und anagogia (griech. anagogein; hinaufführen). Der Beleg dafür aus dem Neuen Testament ist die Allegorie im Galater-Brief 4, 21 - 31. Dort stehen die beiden Abrahamsfrauen, die Magd Hagar und die Herrin Sara, für die beiden Testamente. Die Geschichte der beiden Frauen (22f.) ist der historische Sinn; die Auslegung auf die beiden Testamente (V. 24f.) der allegorische, und der damit angedeutete Aufstieg vom Sinai bzw. Zion zur Ierosolyma coelestis, von der Natur zur Erwählung, vom Fleisch zum Geist, von der Knechtschaft des Gesetzes zur Freiheit des Christenmenschen (V. 26f.) der anogogische. Cassians fortan klassisches Paradigma für den vierfachen Schriftsinn ist denn auch Jerusalem, das sich vierfach (quadrifariam) verstehen lässt: „secundum historiam civitas Judaeorum, secundum allegoriam ecclesia Christi, secundum anagogen civitas dei illa caelestis, quae est mater omnium nostrum, secundum tropologiam anima hominis“ (nach dem historischen Sinn als Stadt der Juden, nach dem allegorischen als Kirche Christi, nach dem anagogischen als himmlische Stadt und nach dem tropologischen als menschliche Seele). Einen weiteren neutestamentlichen Hinweis auf die Lehre vom vierfachen Schriftsinn entnimmt Cassian dem Vers IKor 14, 6: „Was nützt euch Brüder, wenn ich komme und in Zungen vor euch rede, euch aber keine Offenbarung (apokalypsis), keine Erkenntnis (gnosis), keine Weissagung (propheteia) und keine Lehre (didaskalia) bringe.“ Die Lehre vom vierfachen Schriftsinn wird aber in der Regel in den Kommentaren zu Gal 4, 24 ausgeführt, z. B. im scholastischen Standardkommentar von Nikolaus von Lyra (1270 - 1349), der vom wichtigsten jüdischen Literalisten Raschi beeinflusst war und in dieser Hinsicht wiederum Luther beeinflusst hat: „Habet enim sacra scriptura quadruplicem sensum, scil. historicum, qui per voces significatur, et mysticum, qui per rem significatam intelligitur: et hic est triplex: moralis quando intelligitur quid agendum est, allegoricus quando designatur quid credendum, anagogicus quando signatur quid in patria sperandum”
Sodann führt er das obligate Beispiel Jerusalem an und den Merkvers
„Littera gesta docet,
quid credas allegoria,
Moralis quid agas,
quod tendas anagogia“
„Der Buchstabe lehrt das Geschehene,
was zu glauben ist, die Allegorie
was zu tun der moralische Sinn,
wohin zu streben die Anagogie.“
(vgl. Lubac 1948)
Cassian hat den vierfachen hermeneutischen Kanon nicht frei erfunden. Er geht letztendlich auf die Homer-Exegese zurück, wonach der Text einen verborgenen Untersinn (hyponoia) besitzt (Plato, Rep 378D, Xenophon, Symp 3, 6) und folglich anders gelesen (allegoria) werden muss. Eben diesen Doppelsinn des kanonischen Textes haben die alexandrinischen Toragelehrten auf die Heilige Schrift übertragen und der bekannteste von ihnen, Philon, nennt ihn wechselweise hyponoia oder allegoria („De fuga et inventione“ 174ff.). Der spirituelle Überbau (superaedificatum) wird von den Kirchenvätern weiter in ein, zwei oder drei Sinne aufgefächert33 , wobei sich neben dem anthropomorphen trichotomischen Schema des Origenes (sóma, psyché, lógos), das sich bis ins Hochmittelalter hält (z. B. bei den Viktorinern), allmählich die tetradische Formel durchsetzt (Beda, Hrabanus Maurus, Honorius von Autun, Johannes von Salesbury). Bei Thomas von Aquin finden wir die klassische Formulierung der Lehre vom vierfachen Schriftsinn („quadruplex sensus scripture habetur in usu“) in seiner Summa Theologica: „Die erste Bedeutung, nach der die Worte die Dinge bedeuten, wird wiedergegeben durch den ersten ‚Sinn‘, nämlich den geschichtlichen oder Wortsinn (sensus historicus vel litteralis). Die andere Bedeutung aber, wonach die mit den Worten bezeichneten Dinge selbst wieder andere Dinge bezeichnen, wird wiedergegeben durch den sensus spiritualis, den geistigen ‚Sinn‘, der im Wortsinn gründet und diesen voraussetzt. Dieser geistige Sinn wird dreifach eingeteilt [...]. Soweit die Geschehnisse des Alten Testaments die des Neuen vorbilden, haben wir den allegorischen Sinn (sensus allegoricus); soweit das, was in Christus selbst oder an seinen Vorbildern geschah, zum Vorbild und Zeichen für unser eigenes Handeln wird, haben wir den moralischen Sinn (sensus moralis); soweit aber das vorbildet, was in der ewigen Herrlichkeit sein wird, haben wir den anagogischen Sinn (sensus anagogicus).“ (STheol I, 1, 10).
Der vierfache Schriftsinn meint nach Thomas also keine Vierdeutigkeit der Wörter, sondern eine Vierstufigkeit ihres Sinns, die aus der Vorzeit des Alten Testaments in die Zukunft des Neuen Testaments weist. Diese Vierstadien-Lehre vertritt ganz offensichtlich christliche gegen jüdische Interessen, denn der höhere, geistige Sinn des Alten Testaments erschließt sich ihr zufolge nur im Neuen Testament. Zur Bestätigung dieses Verdachts brauchen wir uns nur noch einmal ihre gewöhnliche neutestamentliche Belegstelle Gal 4, 24 anzusehen. Sie besagt ganz offensichtlich, dass die Reihe Natur - Knechtschaft - Diesseits - Buchstabe (Gramma) durch die Reihe Erwählung - Freiheit - Jenseits - Geist (Pneuma) ersetzt werden soll. Nachdem Paulus im Sinne einer „tropologischen“ Auslegung daran erinnert hat, wie der natürliche Sohn Ismael den verheißenen Sohn Isaak verspottet und verfolgt (29, 1 21, 9) – ganz, so die durchsichtige Chiffrierung, wie die zeitgenössischen gesetzestreuen Juden die Christen – und wie Abraham, der „Vater des Glaubens“, die rebellische Magd und ihren Sohn verstoßen hat (30, 1 21, 10 - 12), schließt er mit der folgenden Adresse an seine Gemeinde: „So sind wir nun, liebe Brüder, nicht der Magd Kinder, sondern der Freien“ (ebd. 31). Die Lehre des vierfachen Schriftsinns hebt in diesem Sinn systematisch den Buchstaben des Alten Testaments im Sinne des Neuen auf. Jerusalem ist nach dem Literalsinn als Abbild der historischen Stadt, nach dem allegorischen als Sinnbild der Kirche, nach dem tropologischen als Vorbild für den Christen, nach dem anagogischen als Inbild des Gottesreiches zu lesen. Nicht erst Luther, schon Thomas fordert: „Das Wort sie sollen lassen stahn!“ – „cum omnes sensus fundentur super unum, scilicet litteralem“, aber das meint trotz der Kreuzzüge, dass das irdische Jerusalem lediglich als historische Grabstätten stehen bleibt, nicht als gegenwärtige und zukünftige Heilstätte. Wenn Christen im Psalm Jerusalem aussprechen, dann haben sie Höheres im Sinn. Das gleiche gilt für alle Figuren und Erzählungen des Alten Testaments, sie sind Sinnbilder der Ereignisse des Neuen Testaments und Vorbilder und Wunschbilder für die Gegenwart und Zukunft (STheol I, 1, 10). Dante, der die Lehre vom vierfachen Schriftsinn in den Mittelpunkt seiner Hermeneutik und Poetik rückt, bringt öfter das Beispiel von Psalm 114, der gewöhnlich vom Leichenzug angestimmt wurde. Der erste Vers „Da Israel aus Ägypten zog“ bezieht sich zwar auf die historische Befreiung Israels aus der ägyptischen Knechtschaft, aber er ist gewiss nicht nur historischer Bericht, sondern Urbild der Erlösung überhaupt. Im buchstäblichen Sinn bedeute er den Auszug Israels aus Ägypten in der Zeit des Mose, im allegorischen die Erlösung durch das Werk Christi, im moralischen die Bekehrung der Seele aus der Sünde zur Gnade, im anagogischen den Aufstieg der Seele aus der Gefangenschaft dieser Welt zur Freiheit der ewigen Herrlichkeit. Nur weil der Exodus die Erlösung von den Sünden, die innere Bekehrung und die Rettung der Seele meinen kann, passt er auch zum christlichen Leichenzug (Conv II, 1; Ep XIII, 7; Purg II, 46). Der spezifisch christliche Sinn des AT ergibt sich erst aus seiner allegorischen Überhöhung „im Geist und in der Wahrheit“ (Joh 4, 23), wie sie die Lehre vom vierfachen Schriftsinn vollzieht. Die Juden sind aus christlicher Sicht deshalb mit Blindheit geschlagen, weil sie auf dem fleischlichen Sinn des Buchstabens der Schrift, weil sie z. B. auf die Wiederherstellung des irdischen Jerusalems bestünden. Der vierfache Schriftsinn erweist sich daher als polemische Substitutionsformel im Verdrängungswettbewerb zwischen Christentum und Judentum.34
Umso erstaunlicher ist, dass in der spanischen Kabbala im 13. Jh. im Umkreis der Sohar-Literatur ebenfalls eine Lehre vom vierfachen Schriftsinn auftaucht (van der Heide 1982). Das Merkwort für die vier Sinne, PaRDeS, das ursprünglich auf persisch (pairi daeza, d. h. rundherum Mauer = hortus conclusus) und später auf hebräisch (Koh 2, 5) und auf griechisch (paradéisos) den geschlossenen Lustgarten des Königs bzw. Gottes bezeichnet, ist inzwischen zum allgemeinen Kennwort der jüdischen Hermeneutik überhaupt geworden. Wobei die vier Konsonanten des Merkwortes PaRDeS für die Initialen der weiter oben erläuterten Bezeichnungen für die vier Sinne der Schrift stehen: Pschat = „einfacher“ Sinn, Remes = „angedeuteter“ Sinn, Drasch = „belehrender“ Sinn, Sod = „geheimer“ Sinn. Wegen der zeitlichen und formalen Koinzidenz der beiden Lehren vom vierfachen Schriftsinn haben christliche wie jüdische Forscher wie E. v. Dobschütz und Gershom Scholem auf einen christlichen Einfluss geschlossen. Scholem begründet diesen Verdacht damit, dass zeitnah und unabhängig voneinander mehrere Varianten dieser Formel unter jüdischen Exegeten auftauchen, aber alle wie auf Verabredung immer auf vier Sinnen bestehen. Aus dem obstinaten Vierklang alleine kann aber kein fremder Einfluss abgeleitet werden, denn in der biblischen wie rabbinischen Literatur wimmelt es nur so von Quaternionen – man denke nur an das Tetragrammaton, an die vier Paradiesflüsse (Gen 2), an die Tetramorphenquadriga der Merkawa (Ez 1), an die vier Besucher des esoterischen Paradieses im Talmud usw. (vgl. Krochmalnik 2006, S. 7 - 26). Die Kabbalisten haben mit der PaRDeS-Formel und dem vierteiligen Schriftsinn Saiten angeschlagen, die in der jüdischen Tradition viele Echos auslösen. Die Formel vom vierfachen Schriftsinn ließe sich ohne jeden Bezug auf die christliche Lehre mühelos aus den Quellen dieser Tradition entwickeln. Aber wenn schon ein christlicher Einfluss angenommen wird, dann nicht im Sinne einer gedankenlosen Kopie, sondern einer bewussten und selbstbewussten Replik. Den christlichen Exegeten, die sich mit dieser Formel vom vierfachen Schriftsinn systematisch das AT aneignen, wollte man womöglich entgegenhalten, dass die Juden keineswegs nur Buchstabenknechte seien (II Kor 3, 6) als welche sie die christlichen Herren allenfalls anzuerkennen bereit waren („Librarii nostri“ sagt Augustin ad Ps 56,9), sondern ebensoviel geistigen Tiefsinn aus ihrer Heiligen Schrift heben können, ohne die Grenzen des vergangenen, gegenwärtigen, zukünftigen und ewigen Judentums aufzuheben. Die jüdische Lehre vom vierfachen Schriftsinn war in der Tat ganz anders ausgerichtet als die christliche. Beiden Lehren ist gemeinsam, dass der sensus litteralis an Raum- und Zeitbedingungen geknüpft ist, während der allegorische oder „kabbalistische“ Sinn, wie der christliche Kabbalist Johannes Reuchlin sagt, ewig sei.35 Doch während die christliche Tetralogie einen Fortschritt durch die Zeit zur Ewigkeit beschreibt (anagogé, ascensus), geht es bei der jüdischen Tetralogie um eine Einführung und Initiation (eisagogé) in die Offenbarung der Ewigkeit mitten in der Zeit. Im Zeitlichen des Buchstabens (Pschat) deutet sich das Ewige an (Remes), im Es-war-einmal das Immergleiche und wird zum ewigen Vorbild (De rascha) und Urbild (Sod) erhoben. Wenn man die von der PaRDeS-Formel geleistete Transformation des Bedeutungsgehaltes des Textes insgesamt berücksichtigt, dann kann man sagen, dass sie aus dem Einzel- und Sonderfall einen Regel- und Allgemeinfall, dann einen Präzedenz- und Idealfall und schließlich einen göttlichen Einfall macht. Die Buchstaben P, R, D, S stehen für einen Sinn, der immer weitere Kreise zieht, so dass aus Abraham nicht Jesus, aus Saulus nicht Paulus, aus Judentum nicht Christentum, sondern nur ein höherer Abraham, ein höheres Judentum wird. Moses der Leon, der die PaRDeS-Formel geprägt hat, schreibt: „Unter dem Titel Pardes habe ich ein Buch über das Mysterium der vier Wege geschrieben, worauf schon sein genauer Name hinweist, der auf jene vier Bezug nimmt, die das Pardes betreten haben, das nichts ist als eben Peschat, Remes, Derascha, Sod. In diesem Buch habe ich mich hierüber ausführlich im Zusammenhang mit dem Geheimnis der Erzählung und Fakten verbreitet, die in der Tora berichtet werden, um zu zeigen, dass sie alle sich mystisch auf das ewige Leben beziehen und dass es dort nichts gibt, was nicht im Mysterium Seines Namens enthalten ist.“ (zit. bei Scholem 1995, S. 61f.)
Man kann sagen, dass die christliche Lehre vom vierfachen Schriftsinn eine eschatologische Überhöhung des Alten durch das Neue Testament betreibt, während die jüdische Lehre vom vierfachen Schriftsinn eine protologische Vertiefung der Tora in der „Ur-Tora“ (Tora Keduma) sucht. Die Bevorzugungen des futurischen Endsinns oder des präsentischen Ursinns ergeben sich ganz einfach aus dem christlichen Interesse, die Ablösung der Testamente zu rechtfertigen oder aus dem jüdischen Interesse, die Gleichursprünglichkeit der schriftlichen und mündlichen Torot darzutun. Aber auch dort, wo die jüdische Interpretation ganz entschieden von eschatologischen und messianologischen Motiven getrieben wird – ausgerechnet die Schichten der Sohar-Literatur, die die PaRDeS-Formel aufgreifen, sind von einer geradezu antinomistischen Endzeitlaune geprägt –, bleibt der PaRDeS ein jüdisches Unternehmen. Die Lehre vom vierfachen Schriftsinn könnte man geradezu als Unterscheidungslehre zwischen Judentum und Christentum profilieren. Gewiss, beide Anagogien führen ins Paradies. Die christliche Lehre aber bricht das Siegel des Geheimnisses (Sod) und führt zur Offenbarung (apokalypsis) des himmlischen Jerusalem, wo ein „Strom lebendigen Wassers (fließt), klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes […]. Auf beiden Seiten des Stromes mitten auf der Gasse ein Baum des Lebens“ (Off 22, 1 - 3). In der jüdischen Lehre bleibt das Geheimnis dagegen ungebrochen. Die vier Rabbinen, die nach einer Erzählung das Paradies (Pardes) betraten, will sagen, in die Geheimnisse der Tora eindrangen (mChag II, 1), wurden a limine gewarnt: „Wenn ihr zu den reinen Marmorsteinen kommt, dann sagt nicht: Wasser, Wasser!“ (bChag 14b) – und nur einer von Vieren besaß das Unterscheidungsvermögen, der Ambiguität des Prüfzeichens, das vielleicht für die Unterscheidung von kristallklarem und flüssigem Sinn steht, nicht zum Opfer zu fallen. In seiner modernen oder besser gesagt postmodernen Interpretation der Lehre vom vierfachen Schriftsinn hat Jean-Francois Lyotard gerade an diesem Drehpunkt die Verkehrung des Bindestrichs zwischen Jüdischem und Christlichem in einem Trennungsstrich festgemacht.36 Im Christentum, so lassen sich die komplexen Ausführungen von Lyotard vielleicht zusammenfassen, wird die lautlose, körperlose, vieldeutige, geheimnisvolle Stimme der Offenbarung verlautet, verkörpert, verdeutlicht, veröffentlicht – und als Transfiguration des „toten Buchstabens“ ausgegeben (IIKor 3, 5). In Wahrheit aber wird dadurch die jüdische Lerngemeinschaft (Lomde Tora), die endlos die geheimnisvollen Spuren einer Absenz verfolgt, durch eine Kirche verdrängt, die auf Dogmen schwört und die Präsenz feiert. Und es ist ja wahr, dass jüdische Auslegung auch dort Probleme (Kuschijot) sieht, wo es für das ungeübte Auge gar keine gibt. Vierfacher Schriftsinn bedeutet hier nicht Lösung und Erlösung, sondern Vervierfachung der Schwierigkeitsgrade der Deutung.
Man wird uns vielleicht sagen, dass wir mit der Rationalisierung der Lehre vom vierfachen Schriftsinn auf verlorenem Posten stünden. Das mag sein, aber wir stehen nicht allein. Wir sind nicht die ersten und die einzigen, die dieser Theorie wieder Geltung zu verschaffen suchen. Dante war der erste, der die Lehre vom vierfachen Schriftsinn auch auf die profane Literatur und speziell auf seine eigenen Werke angewandt wissen wollte. In seinem berühmten lateinischen Brief an seinen Gönner Cangrande Della Scala (ca. 1315 - 17), dem er die ersten Gesänge seines Paradieses widmete, macht er geltend, dass sein Text nicht einfach, sondern „polysemisch“ sei, d. h. die Zeichen bedeuten Dinge, die wiederum Zeichen sind, die Dinge bedeuten. Und er fordert den Leser auf, seine göttliche Komödie als doppelbödigen Text zu lesen: litteral und allegorisch. Sein buchstäblicher Sinn sei allerdings das, was gewöhnlich der anagogische Sinn ist, „der Zustand der Seelen nach dem Tod“, der allegorische hingegen: „der Mensch, der sich durch seine Verdienste oder Unterlassungen Ansprüche auf göttliche Züchtigungen und Belohnungen“ erwirbt. Die Kommentatoren Dantes, sein Sohn Iacopo di Dante, Iacopo della Lana, Francesco da Butti, haben diesen Hinweis beherzigt. Der jüdische Aufklärer Moses Mendelssohn (1729 - 1786) hat den PaRDeS als natürliche Hermeneutik gerechtfertigt und aus den drei oder vier kommunikativen Funktionen des Sprechens abgeleitet. Der „einfache“ Sinn (Pschat) ist, so könnte man Mendelssohns Ansatz fortführen, die Notation oder Information, der „angedeutete“ Sinn (Remes) die Konnotation „zwischen den Zeilen“ und Evokation zwischen den Texten, der „belehrende“ Sinn (Drasch) die Instruktion und der „geheime“ Sinn (Sod) die Intention des Autors (Mendelssohn 2004, S. 184 - 192). Henri Atlan hat im Anschluss an die jüdische Lehre vom vierfachen Schriftsinn (Atlan 1982) und Horst-Jürgen Gerigk im Anschluss an die christliche nachzuweisen versucht, „warum alle literarischen Texte nach dem vierfachen Schriftsinn zu lesen sind“ (Gerigk 2002, S. 119 - 139). Hans Sedlmayr hat das Konzept des vierfachen Schriftsinns auf die Malerei übertragen und den „mehrfachen Bildsinn“ am Beispiel der „Allegorie der Malerei“ von Jan Vermeer durchgeführt (Sedlmayr 1958, S. 160 - 172). Und Walter Meinrad hat in seiner theologisch-musikologischen Dissertation schließlich eine Art vierfachen Musiksinn bei J. S. Bach nachgewiesen, mit dem wir unsere Überlegungen begonnen haben.37
Literatur
Assmann, Jan 2004: Religion und kulturelles Gedächtnis. München (C.H. Beck).
Assmann, Jan 2005: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. München (C.H. Beck).
Atlan, Henri 1982: Niveaux de signification et athéisme de l’Ecriture. In: Halperin, Jean/
Levitte, Georges (Hrsg.): La bible au présent, actes du XXIIe Colloque des intellectuels juifs de langue francaise. Paris (Gallimard), S. 55 - 88.
Barc, Bernard 1978: Le Texte de la Torah a-t-il été récrit? In: Tardieu, Michel: Les règles de l’ interpretation. Paris (Publications du Centre d’Etudes des Religions du Livre), S. 69 - 88.
Borges, Jorge Luis 2003: Eine neue Widerlegung der Zeit und 66 andere Essays. Frankfurt am Main (Eichborn).
Brumlik, Micha 2004: Die Welt der Schrift und die Schrift der Welt. In: Tyradellis, Daniel/ Friedlander, Michael S. (Hrsg.), 10+5 = Gott. Die Macht der Zeichen. Katalog zur Ausstellung des Jüdischen Museums Berlin. Leipzig, S. 103 - 118.
De Vries, Simon J. 1975: Yesterday, Today and Tomorrow. Time and History in the Old Testament. London (Eerdmans, William B. Publishing Company).
Dobschütz, Ernst von 1921: Vom vierfachen Schriftsinn. Die Geschichte einer Theorie. In: Festschrift für A. v. Harnack. Leipzig (J. C. Hinrichs Verlag), S. 1 - 13.
Dohmen, Christoph 1992: Vom vielfachen Schriftsinn – Möglichkeiten und Grenzen neuerer Zugänge zu biblischen Texten. In: Sternberg, T. (Hrsg.): Neue Formen der
Schriftauslegung? Freiburg (Herder), S. 13 - 74. Dohmen, Christian/ Stemberger, Günter 1996: Hermeneutik der Jüdischen Bibel und des Alten Testaments. Stuttgart u. a. (Kohlhammer), S. 159 - 209.
Gadamer, Hans-Georg 1975: Wahrheit und Methode. Tübingen (Mohr Siebeck).
Gerigk, Horst-Jürgen 2002: Lesen und interpretieren. Göttingen (Vandenhoeck und Ruprecht).
Goldberg, Arnold 1987: Die Schrift der rabbinischen Schriftausleger. In: Goldberg, Arnold 1987: Rabbinische Texte als Gegenstand der Auslegung. Gesammelte Studien II. Tübingen (Mohr Siebeck), S. 230 - 241.
Grözinger, Karl-Erich 1993: Handling of Holy Tradition as a Path to Mystical Unity in the Kitve Ha`Iyyun. In: Sed-Rajna, G. (Hrsg.): Rashi 1040 - 1990. Paris (Les Editions du Cerf), S. 251 - 258.
Grözinger, Karl-Erich 1994: Jüdische Schriftauslegung, In: Chiarini, Paolo/ Zimmermann, H. D. (Hrsg.): Schrift Sinne. Exegese, Interpretation, Dekonstruktion. Berlin (Guardini-Stiftung), S. 19 - 25.
Grözinger, Karl-Erich 2000: Die hermeneutischen Paradigmata hasidischer Tora-Deutung. Prinzipien der Innovation. In: Stegmaier, Werner (Hrsg.): Die Philosophische Aktualität der Jüdischen Tradition. Frankfurt am Main (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft).
Grözinger, Karl-Erich 2005: Jüdisches Denken., Jüdisches Denken. Theologie. Philosophie. Mystik, Band 2: Von der mittelalterlichen Kabbala zum Hasidismus. Frankfurt am Main/ New York (Campus Verlag), S. 303 - 333.
Hofstadter, Douglas R. 1985: Gödel, Escher, Bach. Ein Endloses Geflochtenes Band. Stuttgart (Deutscher Taschenbuchverlag).
Horn, Hans-Jürgen 2005: Origenes, Cassian, der vierfache Schriftsinn und seine Beziehung zu ontologischen Vorstellungen des Platonismus. In: Khoury, Raif Georges/ Halfwassen, Jens (Hrsg.): Platonismus im Orient und Okzident. Neuplatonische Denkstrukturen im Judentum, Christentum und Islam. Heidelberg (Universitätsverlag Winter), S. 49 - 60.
Hübner, Hans 1994: Eine moderne Variante der mittelalterlichen Lehre vom vierfachen Schriftsinn: Vetus Testamentum und Vetus Testamentum in Novo receptum. In: Chiarini, Paolo/ Zimmermann, H. D. (Hrsg.): Schrift Sinne. Exegese, Interpretation, Dekonstruktion. Berlin (Guardini-Stiftung), S. 54 - 64.
Idel, Moshé 2003: Jacques Derrida et les sources kabbalistiques, in: Cohen, Joseph/ Zagury-Orly, Raphael. Judéités. Questions pour Jacques Derrida. Paris (Galilee), S. 133 - 156.
Krochmalnik, Daniel 2000: Schriftauslegung - Das Buch Exodus im Judentum. Stuttgart (Katholisches Bibelwerk).
Krochmalnik, Daniel 2006: Im Garten der Schrift. Wie Juden die Bibel lesen. Regensburg (Sankt Ulrich Verlag).
Krochmalnik, Daniel 2007a: Regenesis. In der Raschiwerkstatt. In: Krochmalnik, Daniel/ Liss, Hanna/ Reichman, Ronen (Hrsg.): Raschi und sein Erbe. Internationale Tagung der Hochschule für Jüdische Studien und der Stadt Worms. Heidelberg (Universitätsverlag Winter), S. 227 - 239. Krochmalnik, Daniel 2007b: Variationen zum Anfang in der Jüdischen Tradition. In: Zeitschrift für Ideengeschichte I/2, S. 45 - 61.
Kugel, James 1981: The Idea of Biblical Poetry. Parallelism and its History. New Haven/ London (Yale University Press).
Lyotard, Jean-Francois 1995: Ein Bindestrich – Zwischen „Jüdischem“ und „Christlichem“. Düsseldorf i. a. (Parerga).
Lubac, Henri de 1948: Sur un vieux distique. In: Mellanges Cavallera, Tolouse, S. 347 - 66.
Lubac, Henri de 1952: Der geistige Sinn der Schrift. Einsiedeln (Johannes Verlag).
Lubac, Henri de 1959 – 1964: Exégèse médiévale. Les quatres sens de l’écriture. Paris (Editions du Cerf).
Maier, Johann 1995: Die Kabbalah, Einführungen – Klassische Texte –Erläuterungen. München (C.H.Beck), S. 58 - 59.
Meinard, Walter 1994: Musik-Sprache des Glaubens. Zum geistlichen Vokalwerk Johann Sebastian Bachs. Frankfurt am Main (Verlag Knecht).
Mendelssohn, Moses 2004: Gesammelte Schriften. Jubiläumsausgabe, Bd. 20.1: Hebräische Schriften I. Deutsche Übertragung, bearbeitet v. M. Brocke, D. Krochmalnik, A. Schatz, R. Wenzel. Stuttgart-Bad Cannstatt (Frommann-Holzboog), S.184 - 192.
Meyer, Ulrich 1981: Zahlenalphabet bei J. S. Bach – Zur antikabbalistischen Tradition im Luthertum. In: Musik und Kirche, S. 15 - 19.
Rad, Gerhard von 1947: Deuteronomium-Studien. Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht).
Reichert, Klaus 1994: Rabbenu Joyce – Annäherungen an Finnegans Wake. Chiarini, Paolo/ Zimmermann, H. D. (Hrsg.): Schrift Sinne. Exegese, Interpretation, Dekonstruktion. Berlin (Guardini-Stiftung), S. 108 - 120.
Scholem, Gershom 1960: Zur Kabbala und ihrer Symbolik. Zürich (Rhein Verlag).
Scholem, Gershom 1973: Studien zur jüdischen Mystik. Frankfurt am Main (Suhrkamp), S. 7 - 70.
Scholem, Gershom 1998: Die Kabbala und ihre Symbolik. Frankfurt am Main (Suhrkamp).
Sedlmayr, Hans 1958: Kunst und Wahrheit. Zur Theorie und Methode der Kunstgeschichte. Hamburg (Rowohlts Deutsche Enzyklopädie), S. 160 - 172.
Singh, Simon 2006: Geheime Botschaften. Die Kunst der Verschlüsselung von der Antike bis in die Zeiten des Internet. München (Deutscher Taschenbuchverlag).
Steiner, Richard C. 1992: Meaninglessness, Meaningfulness and Super-Meaningfulness in Scripture. An Analysis of the Controversy surrounding Dan 2:12 in the Middle Ages. JQR 82, 3 - 4, S. 431 - 449.
Thoene, Helga 2005: Johann Sebastian Bach. Sonata A-Moll (BWV 1003). Eine wortlose Passion. Analytische Studie. Oschersleben (Dr. Ziethen Verlag).
Van der Heide, Albert 1982: PARDES. Over de theorie van de viervoudige schriftzin in de middeleeuws joodse exgese. In: Deurloo, K.A. e.a. (red.), Amsterdamse Cahiers voor Exegese en Bijbelse Theologie 3. Kampen Kok. S. 117 - 165.
Wohlmuth, Josef 1997: Jüdische Hermeneutik. In: Jahrbuch für Biblische Theologie 12, S. 194 - 200.