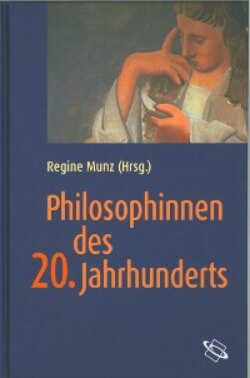Читать книгу Philosophinnen des 20. Jahrhunderts - Группа авторов - Страница 7
EINLEITUNG Von nicht-notwendigen Wirklichkeiten: Denkerinnen der Kontingenz
ОглавлениеVon REGINE MUNZ
O tauch deine Hände ins Wasser,
Tauch sie ein bis zum Handgelenk;
Blicke nur in das Becken
Und frag dich, was dir fehlt.
Der Gletscher rumpelt im Schranke,
Die Wüste seufzt im Bett,
Und der Sprung in der Teetasse öffnet
Einen Weg ins Land der Toten …
W. H. Auden1
1. Denkende Frauen und andere Wirklichkeiten
Angesichts der „Männerlastigkeit“ vieler philosophiegeschichtlich angelegten Darstellungen, einschließlich derjenigen des 20. Jahrhunderts, erscheint es vorderhand notwendig, der Unzulänglichkeit jener dergestalt unvollständigen Philosophiegeschichten und Lexika dadurch entgegenzuwirken, dass die Philosophinnen des 20. Jahrhunderts in einer entsprechenden Publikation eigens gewürdigt werden. Die im Sinne dieses verdienstvollen Projektes bislang erschienenen Sammelbände zu Philosophinnen leiden dabei unter der Beliebigkeit der Auswahl der zusammengeführten Denkerinnen. Denn die Tatsache, dass einige Philosophinnen zufällig weiblichen Geschlechts waren und zu einem bestimmten Zeitpunkt gelebt haben, ist heute kein hinreichender Grund mehr dafür, sie in einem entsprechenden Sammelband zusammenzuführen. Diese Arbeit wurde bereits erfolgreich geleistet.2 Fraglich bleibt aber, wie in einer losen Zusammenstellung des Denkens von mehr oder weniger berühmten Frauen deren gegenseitigen Beeinflussungen, Absetzungen und gedanklichen Anschlüsse zur Darstellung gebracht werden können, um im Anschluss daran den spezifischen Beitrag der Frauen zur Philosophiegeschichte eigens würdigen zu können. Deswegen lag es für mich nahe, diesem Sammelband einen spezifischen Leitgedanken zugrunde zu legen. Der Ausgangs- und Bezugspunkt des hier dokumentierten Nachdenkens von Frauen ist einfach und grundlegend: So ist nachgerade das Faktum der Kontingenz des Geschlechtes der jeweiligen Philosophin, welches sie als möglichen Gegenstand eines Textbandes wie „Denkerinnen des 20. Jahrhunderts“ prädisponiert, ein Hinweis auf den gemeinsamen Zielpunkt des Denkens von Frauen und des philosophischen Denkens der Moderne insgesamt. Bekanntlich machte sich die Moderne auf, Kontingenzen von scheinbar festgefügten, vorgegebenen, allumfassenden, theoretischen, kirchlichen und sozialen Ordnungssystemen zu entlarven und sie als eine von vielen möglichen Ordnungen zu begreifen. Selbst das postcartesianische Projekt, welches das erkennende Subjekt als einzig sicheren Punkt zum Ausgangspunkt der Wissensorganisation bestimmt, gerät unter den Verdacht, historisch zufällige Fakten fälschlicherweise zu notwendigen Wirklichkeiten hochstilisiert zu haben. Die Denker und Denkerinnen des 20. Jahrhunderts haben diesen Ansatz radikal weitergedacht und im Hinblick auf die Ordnung der Sprache, auf das erkennende Subjekt und auf scheinbar abgesicherte Erkenntnisse kritisch weitergeführt. So kann eine bestimmte Form des Nachdenkens über Kontingenz als Signum der Moderne gelten, weil sie nicht allein die Zufälligkeit von Mensch, Welt und deren Ordnung, sondern gerade die Zufälligkeit der sprachlichen und symbolischen Ordnung, die Zufälligkeit des historischen (Erkenntnis-) Subjektes und des Gemeinwesens sowie die Zufälligkeit jeglicher spezifischer Form von Wissensorganisation und Kontingenzbewältigungsstrategie in den Blick nimmt. „Kontingent“ ist demnach das, was anders möglich ist, und weist auf die Möglichkeit und Vielfalt anderer Möglichkeiten hin. Über die Pluralität der denkerischen, existentiellen und politischen Wirklichkeiten und der sie erfassenden Erkenntniswege und Symbolsysteme haben in besonderer Weise sowohl „traditionelle Philosophinnen“ wie Susanne Langer, Edith Stein und Hannah Arendt als auch feministische Theoretikerinnen wie Simone de Beauvoir, Luce Irigaray und Judith Butler auf prominente und eigenständige Weise nachgedacht. Zentrale Momente des hier vorgestellten Kontingenzdenkens sind daher, wie ich meine, Denken von Pluralität, Denken als Rationalitätskritik und Denken aus der Situation der Kontingenz.
Über die Pluralität der möglichen Denk- und Sprachordnungen, die Vielschichtigkeit menschlicher Symbolsysteme hinaus beleuchten Philosophinnen wie Susanne K. Langer, Edith Stein, Hannah Arendt und feministische Theoretikerinnen die existential verhaftete und politische Bedingtheit von Freiheit und kritisieren all jene Ordnungen, die sich als notwendig, ahistorisch und allumfassend verstehen: Die amerikanische Logikerin und Symboltheoretikerin Susanne K. Langer hat in ihren logischen und anthropologischen Studien eine nonsubstantielle Ontologie entwickelt und damit auf die Konstruiertheit der Wirklichkeit hingewiesen. Dieser Kontingenzgedanke Langers greift über auf die Auffassung von der naturhaften Kontingenz des Menschen, auf die Darstellung des kontingenten, d. i. konstruktiven Elementes der menschlichen Erkenntniswege und auf die Behauptung der Pluralität und Kontingenz menschlicher Symbolsysteme. Es gibt für Langer eine Fülle von Zeichenprozessen, wie alltagssprachliche und metaphorische Formulierungen, Rituale, magische Praktiken, Zeremonien, Mythen und Künste. Zudem kann aus Langers theoretischer Perspektive der Konnex zwischen Zeichen und Bezeichnetem nur als ein kontingenter, d. i. konventioneller begriffen werden. Mehr noch: Für Langer ist der Symbolisierungsvorgang nicht nur anders vorstellbar, sondern er ist auch umkehrbar zu denken, da Symbol und symbolisierter Gegenstand ontologisch indifferent sind. Auf den Spuren der phänomenologischen Forschung hat die Theoretikerin Edith Stein am Grenzbereich von Phänomenologie und Ontologie versucht, eine phänomenologische Beschreibung des Kontingenten zu entwickeln. Sie bricht den aristotelischthomistischen Ansatz existentiell und versucht, mit dem Existenzdenken und der Personenlehre die Kontingenz des Ich und der Wirklichkeit der Welt zu beschreiben. Hannah Arendt hat in ihren politischen Studien konsequent die Verbindung zwischen Kontingenz und Freiheit behauptet und auch deren Kehrseite, die Willkür, untersucht, um so die prägenden Kontingenzerfahrungen der Moderne – die Revolutionen, die beiden Weltkriege und die Shoa – theoretisch nachvollziehen zu können.
Mit dem Stichwort „Kontingenz“ ist darüber hinaus ein wichtiger Ansatz feministischer Kritik an traditionellen Formen von Wissensorganisation, an der soziopolitischen Situation von Frauen sowie an einer sprachlichen und symbolischen Ordnung, welche sich historisch kontingent an einer bestimmten Form von zumeist männlicher Perspektive orientiert, bezeichnet. Simone de Beauvoir hat den Zweifel an der Generalisierung perspektivisch begrenzter Wirklichkeitskonstrukte Ende der vierziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts als Angriff auf die Mythen über die Weiblichkeit formuliert. Die „trügerischen Erzählungen“ über das, was das Weibliche sei, verkünden das Vorhandensein ewiger, unwandelbarer, nicht-zufälliger Ideen. Im Widerspruch zu den verstreuten, kontingenten, vielfältigen Existenzweisen von Frauen beharre das mythische Denken auf das einmalige und starre Ewigweibliche. Gerade die konkrete, kontingente Situation der Frauen werde vom Mythos beharrlich ausgeblendet. Wenn der Mythos „durch das Verhalten der Frauen aus Fleisch und Blut widerlegt wird, sind sie es, die unrecht haben: man erklärt nicht, dass das Weibliche eine Entität ist, sondern dass die Frauen nicht weiblich sind“3. Die konkrete Situation der Frau ist demnach radikal kontingent, sie wird von der Gesellschaft formiert und gestaltet oder aber – und besser noch – sie ist Effekt der freien Wahl einer Frau, die sich und ihre Möglichkeiten selbst wählt. Anders als Beauvoir nimmt Judith Butler den Einbruch des Kontingenten nicht als Ausgangpunkt freier Wahl und transzendierenden Selbstentwurfs von Frauen, sondern als privilegierten Ort der Kritik. Sie setzt sich mit den Bedingungen der Subjektivierung von Individuen auseinander und initiiert das Projekt einer innerfeministischen, permanenten Kritik, welches nach den Grenzen der Prämissen des feministischen Diskurses fragt. Feministische Wissenschaftstheoretikerinnen beziehen ihr kritisches Potenzial aus dem Verdacht, dass die Behauptung der Nicht-Kontingenz von Forschungsergebnissen – d. h. die Auffassung, dass wissenschaftliche Theorien inhaltlich nicht kontingent sind – mit dem historisch kontingenten Ausschluss von Frauen aus der Position des Forschungssubjektes unvereinbar sind. So geht Lynn Hankinson Nelsons interner wissenschaftstheoretischer Ansatz davon aus, dass „Geschlecht“ eine relevante Variable des Theoriebildungsprozesses ist. Darüber hinaus weist Hankinson Nelson die Kontingenz von Theorien nach, die sie als unabgeschlossen, instabil und anders, d. i. alternativ denkbar versteht. Sandra Hardings wissenssoziologischer Ansatz wiederum beschäftigt sich weniger mit den verschiedenen Theoriegebäuden selbst, sondern mehr mit dem Umfeld, in dem sich diese Theorien entwickeln. Harding begreift Wissenschaften als kontingente soziale Phänomene. Die bewusste und kritische Berücksichtigung des gesellschaftlichen Standpunktes der Forschungssubjekte in Wechselwirkung mit den Forschungsobjekten sowie den Forschungsresultaten kommt zum Ergebnis, dass wissenschaftliche Theorien kontingent sind. Hardings kritischer Blick macht jedoch nicht Halt vor dem eigenen feministischen Standpunkt, der selbst als historisch kontingent reflektiert wird.
Endlich benennt die Vokabel „Kontingenz“ nicht allein einen impliziten oder expliziten Zielpunkt des Denkens von Frauen des 20. Jahrhunderts, sondern kennzeichnet als existentielle Kategorie die von Abbrüchen, Abhängigkeiten, Zufällen und lebenspraktischen Hindernissen geprägte Lebenssituation, in der Frauen lange Zeit schreibend nachgedacht, philosophisch gearbeitet und gelehrt haben; sie weist hin auf die Brüchigkeit ihres jeweiligen Lebensentwurfes: Die Inkommensurabilität der denkerischen Existenz der vorgestellten Philosophinnen war vielmals geprägt von existentiellen Augenblicken, in denen ihnen überraschend, einbrechend, bestürzend das Kontingente begegnete und ihr weiteres Denken bestimmte. Denn Kontingenz ist, wie Hans-Christoph Askani im Anschluss an das Denken Franz Rosenzweigs formuliert, nicht nur in Bezug auf das Denken, sondern auch in Bezug auf die Lebensgeschichte „[d]as Ganze aus den Angeln gehoben […], das Einzelne, das sich sperrt, das sich sträubt, das hereinplatzt“4. Die Denkerinnen mussten sich zu vielfältigen und lebensbestimmenden, beglückenden, verstörenden, überraschenden, kurz: kontingenten Gegebenheiten in ein Verhältnis setzen. Aus der freudigen Akzeptanz, den radikalen Verwerfungen oder der konsequenten Ignorierung der vielfältigen Verstrickungen und den unkontrollierbaren Zufällen in der Lebenszeit heraus artikuliert sich das Denken der Philosophinnen des 20. Jahrhunderts. Oder anders, im Hinblick auf die kontingente Existenz formuliert: Kontingent ist die (Nicht-)Übereinstimmung zwischen emotionalen und intellektuellen Teilen in der Identität, den existentiellen Gegebenheiten und den intellektuellen Setzungen und Ausstoßbewegungen, wie es Maja Wicki-Vogts Beitrag zu Simone Weil auf eindrückliche Weise vorführt.5
Die Philosophinnen des 20. Jahrhunderts haben sich oftmals selbst als Grenzgängerinnen erlebt. Wenige der denkenden Frauen, die zu Beginn des letzten Jahrhunderts lebten und forschten, haben sich als Philosophinnen verstanden und selbst so bezeichnet. Iris Murdoch und Simone de Beauvoir bewegten sich auf der Schnittstelle zwischen Schriftstellerin und Philosophin, Künstlerin und Intellektuelle. Hannah Arendt und Simone Weil arbeiteten auf der Grenze zwischen politischem Engagement und philosophischer Existenz. Die fehlende Gradlinigkeit im Absolvieren des akademischen Werdegangs der Philosophinnen geschah meines Erachtens nicht ganz freiwillig und auch nicht ganz zufällig: Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein reichten die institutionellen Schranken, welche die traditionelle wissenschaftliche Laufbahn für Frauen erschwerten, wenn nicht gar unmöglich machten. Auf die hartnäckigen Versuche der Philosophin Edith Stein sich zu habilitieren und ihre Beschwerde beim Preußischen Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung ist es zurückzuführen, dass 1920 die Habilitation für Frauen in Deutschland zugelassen wurde.6 Danach war es die sehr kurze Zeitspanne von dreizehn Jahren, in der Wissenschaftlerinnen in Deutschland unabhängig von ihrer Herkunft die Möglichkeit hatten, akademische Positionen zu erlangen. Edith Stein selbst konnte keine Laufbahn als Wissenschaftlerin ergreifen. Philosophinnen wie Susanne Langer wurde trotz ausreichender wissenschaftlicher Qualifikation der Zugang zu Lehrstühlen erschwert. Nach vielen Jahren akademischer Lehr- und Forschungstätigkeit und zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen erhielt sie erst im Alter von 59 Jahren eine Professur. Im Zuge der neuen Frauenbewegung sind aber besonders in der angelsächsischen Welt Lehrstühle für Frauen keine Seltenheit mehr: Seyla Benhabib, Agnes Heller, Judith Butler und Luce Irigaray lehren in Harvard, New York, Berkeley und Rotterdam. Andere wichtige Vordenkerinnen feministischer Theoriebildung wie etwa Sandra Harding sind lediglich als Gastprofessorinnen angestellt. Doch nicht nur die Situation an den Universitäten erwies sich als bestimmend für die denkerische Existenz der Philosophinnen des 20. Jahrhunderts. Es waren die beiden Weltkriege, deren katastrophale Wucht sich in Europa entlud, sowie die Shoa, der Einbruch der absoluten Kontingenz und des organisierten Verbrechens, der das Leben der älteren Generation der hier vorgestellten Philosophinnen direkt und das der jüngeren indirekt beeinflusste: Edith Stein wurde aufgrund ihrer jüdischen Herkunft eine Lehrtätigkeit untersagt, aus einem holländischen Karmelitinnenkloster wurde sie von der Gestapo verschleppt und im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau ermordet. Obschon sie in einem gespaltenen Verhältnis zu ihren jüdischen Wurzeln stand, kehrte Simone Weil trotz erfolgreicher Emigration in die USA nach Europa zurück und hungerte sich aus Solidarität mit den Opfern des nationalsozialistischen Regimes und des Krieges zu Tode. Hannah Arendts Leben war von der Emigration und der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Totalitarismus geprägt. Simone de Beauvoirs Selbstverständnis als politische Intellektuelle, die sich für gesellschaftliche Belange einsetzte, war eine Konsequenz ihres Widerstandes gegen die Vichy-Regierung und gegen Nazi-Deutschland. Agnes Hellers Vater fiel 1944 in Auschwitz dem Nazi-Terror zum Opfer. Iris Murdoch wurde mit dem Krieg bei ihrer Arbeit mit Flüchtlingen und durch ihre Freundschaft mit Überlebenden des Terrors konfrontiert.
Die Denkerinnen integrierten und reflektierten die Widersprüche und Antagonismen, die produktiven und zerstörerischen Momente, und die extreme Vielfältigkeit der politischen und kulturellen Ausgangspunkte, die sie und ihre Epoche geprägt haben. Denn die Erkenntnis, dass nicht alle Frauen die gleiche Geschichte und denkerischen Voraussetzungen haben, spitzt sich für das „Zeitalter der Extreme“7 noch einmal radikal zu. „Das 20. Jahrhundert erweist sich […] als ein Zeitalter, für das die Frage nach Kontinuität, Wandel und Brüchen, nach Innovation und Tradition nicht auf einfache Weise beantwortet werden kann. Vielmehr ist es ein Jahrhundert dramatischer Widersprüche: zwischen Tradition und Innovation, zwischen zukunftsträchtigen Innovationen […] und der Novität bisher ungekannter Katastrophen, zwischen Krieg und Frieden, Diktatur und Demokratie, zwischen Selbstbestimmung, Morden und Ermordet-Werden.“8
2. Kontingenz: Von der Lesart eines Begriffs zu anderen Möglichkeiten
Heute ist „Kontingenz“ ein in Mode gekommener Begriff. Er dient als Signalwort für ein sich postmodern, nachaufklärerisch und religionskritisch oder einfach nur melancholisch modern verstehendes Denken9. Aufgrund seiner Bedeutungsfassung zwischen Notwendigkeit und Unmöglichkeit entzieht sich der Begriff einer präzisen Fassung. Als Ermöglichungshorizont wie auch als Unsicherheitshorizont in der Moderne verstanden, dient „Kontingenz“ zur Markierung von Veränderungspotenzial – was kontingent ist, könnte auch anders sein, anders verstanden, anders gemacht werden –, wie auch zur Angabe eines Verlustes bzw. einer Bedrohung – was kontingent ist, versteht sich nicht mehr von selbst, es ist nicht mehr unangreifbar, es kann auch nicht sein bzw. überhaupt nicht gewesen sein. Darüber hinaus kann mit „Kontingenz“ die Wandelbarkeit und Bedingtheit von Wahrnehmungs-, Handlungs-, Ordnungs- und Vernunftkonzepten festgestellt werden. Schließlich wird mit Kontingenz die Bedingtheit der menschlichen Existenz, ihrer Lebenswelten und ihrer Entwicklungsmöglichkeiten beschrieben. Und endlich dient die ambivalente Begriffsfassung von „Kontingenz“ bestens zur Markierung von Ausschlüssen, welche an den Grenzen der theoretischen Vernunft selbst angesiedelt sind. Mit dem Kontingenzbegriff wird also eine diffuse und spannungsgeladene Grenze markiert, auf der Begriffliches und Unbegriffliches sich berühren, darüber hinaus wird ein Problem berührt, welches „systemstörend systemimmanent“10 das Denken in Frage stellt und die Grenzen der Vernunft bedeutet.
Kontingenz ist neben Notwendigkeit, Möglichkeit und Unmöglichkeit eine der vier Möglichkeiten des logischen Urteils und bedeutet die Dimension des Nicht-Bestimmbaren, des Schwer-Bestimmbaren oder zumindest des Nicht-Präzise-Bestimmbaren und wird üblicherweise mit Begriffen wie „Ordnung“, „Wirklichkeit“, „Ursächlichkeit“ und „Freiheit“ konturiert. Als spätantike Latinisierung – „contingere“, dt.: „zusammenfallen, sich berühren und anrühren“ (transitiv) wie auch „zuteil werden, sich ereignen und glücken“ (intransitiv) – des griechischen „endechomenon“ bzw. „endechestai“ geht der Begriff auf Aristoteles zurück. Aristoteles verwendet einen weiten und einen engen Möglichkeitsbegriff: Der weite, einseitige Möglichkeitsbegriff der „Hermeneutik“ bestimmt „endechestai“ als das, was nicht unmöglich ist. Damit umfasst „endechestai“ das Mögliche und das Notwendige. Der enge, zweiseitige Möglichkeitsbegriff der Ersten Analytik bestimmt das als möglich, was nicht unmöglich und nicht notwendig ist. Im ersten Fall ist in „endechestai“ die Notwendigkeit als Möglichkeit des Möglichen enthalten, im zweiten ausgeschlossen. Allerdings sagt Aristoteles in beiden Fällen nichts über die Wirklichkeit des Möglichen aus: „endechestai“ ist nicht notwendig wirklich und kann der Fall sein oder nicht. Viele Jahrhunderte später wird „endechestai“ von Boethius ins Lateinische übersetzt. Hier findet „contingens“ Eingang in die mittelalterliche Theologie und Philosophie und wird im christlichen Kontext sowohl hinsichtlich seiner Wirklichkeit als auch als spezifischer Begriff näher bestimmt. Als „einer der wenigen Begriffe spezifisch christlicher Herkunft in der Geschichte der Metaphysik“ bringt der Kontingenzbegriff „die ontische Verfassung einer aus dem Nichts geschaffenen und zum Vergehen bestimmten, nur durch den göttlichen Willen im Sein gehaltenen Welt zum Ausdruck“.11 Im weiteren Verlauf der Philosophiegeschichte wird „contingens“ in sehr unterschiedlichen Bedeutungen gebraucht. Das weit reichende Bedeutungs- und Verwendungsfeld des Kontingenzbegriffes kann so an eine vielschichtige Entstehungsgeschichte anknüpfen.12
In der neueren Geschichte der Begriffsgeschichte von Kontingenz hingegen setzt sich die scheinbar eindeutige Erzählung der Herausgeber von Poetik und Hermeneutik durch: Ihrem Ansatz zufolge hat sich im Laufe der Geschichte ein zunehmendes Kontingenzbewusstsein gebildet, bei parallel dazu verlaufender Schwächung Gottes und des transzendentalen Subjektes: „erst – in der Antike – war alles notwendig und (fast) nichts kontingent; dann – in der christlichen Welt – war Gott notwendig und alles, was nicht Gott ist (die geschaffene Welt), kontingent; schließlich – in der modernen Welt: nach der Schwächung Gottes und der Schwächung des transzendentalen Subjekts – ist nichts mehr notwendig und alles kontingent.“13 Am Ende dieser Entwicklung steht, wie die Theologen Philipp Stoellger und Ingolf U. Dalferth eindrücklich vorgeführt haben, eine Überlastung des Begriffs: Denn wenn alles kontingent und nichts mehr notwendig ist, dann sind die Steigerungsmöglichkeiten des Begriffs ausgeschöpft und der Sinn der Kontingenz ist zugleich mitverspielt.14 Doch nicht nur theologische Gründe, die einen „geschichtsphilosophischen Ausfall der Theologie“ monieren, sprechen gegen diese eminente Horizontverengung. Es gibt immer wieder Gegenbeispiele zu dieser Begriffsgeschichte, die daran erinnern, dass „Kontingenz“ mit sich als gleichsam theologische Restbestände Bestimmtheiten im Gepäck führt, die das Unbestimmte immer wieder neu bestimmen und formieren. Es zeigt sich, dass schon am Anfang seiner Verwendung das Kontingente das Notwendige entweder als das Andere, Ausgeschlossene oder aber als Teil seiner Bestimmung bei sich trägt. So bezieht das unzureichend bestimmte Vielfältige (das rein denkbare Unwirkliche, oder das wirklich Mögliche) seine unbestimmten Möglichkeiten und Wirklichkeiten vom notwendig bestimmenden Einzelnen und umgekehrt. Jede weitere Anknüpfung an die verschiedenen Kontingenzerzählungen der Moderne tut gut daran, das Bestimmende des lediglich unzureichend Bestimmten nicht unbesehen als vermeintlichen Ballast von sich zu werfen. Philosophinnen des 20. Jahrhunderts haben zu einem nicht unwesentlichen Teil an diesen Gegenerzählungen geschrieben. Sie haben sich dabei dem angenähert, was das Andere bzw. der bestimmende Teil der Kontingenz sein könnte.
3. Vom Denken der Kontingenz
Vom Bestimmenden des Unbestimmten
Wie aus der kurzen Skizze zur Begriffsgeschichte der Kontingenz deutlich wurde, sind Bestimmtheit und Unbestimmtheit die beiden komplementären Pole, um die das Denken der Kontingenz kreist, die es ausschließt oder die es aufzunehmen vermag. Ein kurzer Rückblick auf die theologischen Beiträge zum Kontingenzdenken erinnert an das Bestimmende des unzureichend Bestimmten. Von einer theologischen Warte aus kann die Frage, ob das Kontingente in den Gottesgedanken integriert werden kann oder nicht, auf zwei Arten beantwortet werden. Gilt das Kontingente einzig als ontologischer Mangel, so wird dem theologisch dadurch Rechnung getragen, dass Gott als davon frei gedacht wird. Da sein Wesen die Existenz von Notwendigkeit einschließt und Gott nicht als abgeleitet und bedingt betrachtet wird, ist die Schöpfung, die Welt, die Gott im kontingenten Akt erschafft, aus dieser Sicht bedingt und abgeleitet. Das Notwendig-Göttliche wird zum Bestimmenden, das Nicht-Notwendige, Weltliche zum Bestimmten. Anders sieht dies allerdings aus, wenn das Kontingente nicht als Mangel, sondern als Teil von Gott gedacht wird. Dies ist der Fall, wenn die Freiheit der kontingenten Welt ins Spiel kommt. Wird ihr Spiel mit den Möglichkeiten von Gott gewusst? Nimmt Gott teil an dieser Welt und ihren Kontingenzen? Je nachdem ob Kontingenz als Teil von Notwendigkeit gedacht ist, bleibt sie in das göttliche Wesen integriert oder erscheint als das ihm fremde, andere Element.15
Die Philosophie Edith Steins und ihr Denken, das sich im Spannungsfeld von Ontologie und Phänomenologie bewegt, kommt der theologischen Fassung des Bestimmenden am nächsten, dadurch dass das wahre, ewige Sein in die Nähe zum biblischen Gottesgedanken rückt. Das Kontingente wird bei ihr nicht in den Gottesgedanken integriert. Im Gegenteil: Das ewige Sein, das Wahre, Gute, Eine steht bei Stein in Differenz zur wirklichen Welt, zu jenem Bereich, der durch Endlichkeit und Geschöpflichkeit gekennzeichnet ist. Doch Steins Denkweg geht nicht aus vom Notwendigen, Ewigen, sondern es setzt ein beim kontingenten, endlichen und vergänglichen Ich und führt zum bestimmenden, schöpferischen Grund. Steins eingehende phänomenologische Analyse des kontingenten Ich ergibt, dass für seinen Stand der Reflexion ein nicht-kontingenter, transzendenter Ichgrund anzunehmen ist. Das Notwendig-Göttliche erscheint als das Andere des kontingenten Menschen, der sich gerade in der Gerichtetheit auf sein komplementäres Anderes hin profiliert. Kontingenz dient so als Verweisungsbegriff: Nicht aus sich selbst zu sein und sich selbst zu genügen verweist auf etwas anderes seiner selbst.
Simone Weils religionsphilosophisches Denken kreist um zwei komplementäre Pole, den der Kontingenz und den der Notwendigkeit. Gerade spiegelbildlich verkehrt zum traditionellen Gottesgedanken denkt Weil nicht das Notwendige, sondern das Kontingente als das Religiöse schlechthin, während das Weltliche sich als das Notwendige zeigt. Diese Konstellation macht Weil mit der Metapher der Schwerkraft und dem Begriff der Gnade deutlich: Während die Welt durch Notwendigkeit und durch das Prinzip Schwerkraft ausgezeichnet ist, ist die religiöse Dimension im kontingenten Phänomen der Gnade enthalten. Im Schwerkraftbegriff Weils lässt sich die unwillkürliche, notwendige Mechanik allen Denkens und Handelns heraushören, deren Wirkung darin besteht, dass Menschen die Individualität der anderen nicht anerkennen können: „Schwerkraft. Ganz allgemein wird das, was man von den anderen erwartet, durch die Wirkung der Schwerkraft in uns bestimmt; was man von ihnen empfängt, wird durch die Wirkung der Schwerkraft in ihnen bestimmt.“16 Die Notwendigkeit der Schwerkraft ist dadurch gekennzeichnet, dass sie willentlich nicht aufzuheben ist. Die Wirkung des Schwerkraftmechanismus, so lautet die mystische Formulierung Weils, kann als Leere erfahren werden.17 Das Phänomen Gnade demgegenüber widerspricht dem Gesetz der Schwerkraft. Gnade macht gerade das geltend, was die Schwerkraft zwar bewirken, aber nicht halten kann: die Leere, indem sie sie erzeugt und dort auftritt, wo sich Leere befindet. In ihr schneiden sich Schwerkraft und Gnade.18
Wie kaum eine andere Philosophin betont Iris Murdoch die kontingente Verfasstheit menschlicher Existenz. Das Leben der Menschen ist bestimmt von Zufällen, jedoch vermeiden es die meisten Menschen, dies zu erkennen. In einer Umformulierung der christlichen Doktrin von der Erbsünde begründet Murdoch dies damit, dass Menschen ichbezogen und egoistisch sind. Deswegen können sie die Erkenntnis, dass ihr eigenes Leben nicht plan- und kontrollierbar ist, nicht ertragen. Dennoch hält Murdoch im Anschluss an die Philosophie Simone Weils und die Lektüre Platons am Bestimmenden fest. Sie erkennt die Idee des Guten in Rückgriff auf das metaphysische Konzept Platons und auf die Gottesbeweise als das bestimmende Andere zum Kontingenten. Während das Kontingente all das bezeichnet, was Menschen nicht kontrollieren und verstehen können und was sich dem menschlichen Wunsch entzieht, die Geschichte in einer bestimmten Form aufgelöst zu sehen, ist das Gute genau die Kraft, welche die Tugend, sich für das Kontingente zu öffnen, ermöglicht. In dieser Zweiheit von „gut“ und „kontingent“ zeigt sich eine eigentümliche Passivität bzw. Aufmerksamkeit, welche das Kontingente nicht bewältigen oder zu gestalten sucht, sondern eine Haltung, welche dem Kontingenten in der aufmerksamen Begegnung gerecht wird.
Hannah Arendts Denken der Kontingenz, ihre Bejahung der Welt als vielfältiger Kosmos und ihre Zustimmung zur Pluralität der Individualitätsformen, findet seinen bestimmenden Gegenpart in der Figur der Rechtfertigung der Welt und des Menschen aus dem Anfang – theologisch gesprochen aus der Schöpfung des Menschen – anthropologisch bzw. ontogenetisch gewendet aus der Natalität. „Weil jeder Mensch aufgrund des Geborenseins ein initium, ein Anfang und Neuankömmling in der Welt ist, können Menschen Initiative ergreifen, Anfänger werden und Neues in Bewegung setzen. […] Mit der Erschaffung des Menschen erschien das Prinzip des Anfangs, das bei der Schöpfung der Welt noch gleichsam in der Hand Gottes und damit außerhalb der Welt verblieb, in der Welt selbst und wird ihr immanent bleiben, solange es Menschen gibt.“19 Im Rückgriff auf die Denkfiguren Augustins gründet Arendt das unzureichend bestimmte Vielfältige im notwendig bestimmenden einzelnen Anfang. Zugleich ist dieser notwendige Anfang das Kontingente, d. i. das Unerwartete und Unberechenbare schlechthin.
Anders als bei Stein, Weil, Arendt und Murdoch wird das Bestimmende bei den übrigen Denkerinnen nicht mehr unter Rückbezug auf den Gottesgedanken bzw. unter Rückgriff auf theologisches Denken überhaupt formuliert. So bleibt die praktische Dimension der Notwendigkeit einer individuell verantworteten Wahl die Konstante, vor der sich Agnes Hellers politisches Denken profiliert. Auch in der Zeit, als sie den realexistierenden Sozialismus in Ungarn von innen heraus theoretisch begleitet, begreift Heller die Kontingenz des Politischen in ihrer kritischen Dimension, die sich sowohl gegen eine total verwaltete, total bestimmte Gesellschaft richtet als auch gegen eine reduktive empirische Theorie, die nur dazu da ist, die totalitäre Gesellschaft zu stützen. Demgegenüber betont sie die Kontingenz des Alltäglichen. Ebenso kontingent zeichnet Heller später den Status der Moderne. Mit der Metapher des Neugeborenen fasst Heller die Kontingenz und Neuartigkeit des Experimentes Moderne. Dem Individuum ist die Paradoxie der Freiheit auferlegt, die darin besteht, dass es im Bewusstsein seiner Kontingenz Verantwortung für sein Leben übernehmen muss, ohne dabei Rekurs auf absolutistische Notwendigkeiten nehmen zu können. Simone de Beauvoir hat weniger die Möglichkeiten einer paradoxen Freiheit als das Verdammtsein zur Freiheit, im Sinne Sartres, im Blick. Die Freiheit des einzelnen Menschen angesichts der Erwartung der Anderen ist das bestimmende Moment in Simone de Beauvoirs Kontingenzdenken. Für Beauvoir besteht die Notwendigkeit, die Freiheit zu wählen, und dies gerade auch dann, wenn die Anderen die Freiheit, die eigene Existenz zu wählen, einschränken, verzerren und unmöglich machen. Damit ist die Freiheit das notwendig Bestimmende, die individuelle Existenz und die Existenz der Anderen das kontingente, teilweise bedrohliche andere Moment. Zugleich erkennt Beauvoir in der Kontingenz eine befreiende Kategorie. Dadurch, dass in Le deuxième sexe die Situation der Frauen als radikal kontingent beschrieben ist, entwickelt sich die Situation zur emanzipatorischen Größe. Denn die Überwindung und Bemächtigung der bedingten und nicht notwendigen Situation der Frauen ist ein Akt der Frauen in Richtung Freiheit. Während Beauvoir das Verhältnis zwischen Notwendigkeit und Kontingenz als situativ bestimmt, lokalisiert Judith Butler dieses Verhältnis als genealogisch strategisch im politischen Bereich. Denn dort, wo die Prämissen des Denkens als das Unhinterfragte einer Theorie auftreten, sind sie doch für Butler immer schon historische, kontextuelle und damit kontingente Setzungen. Das Gegengewicht zur strategisch verschleierten Kontingenz alles Politischen ist die Notwendigkeit einer permanenten Kritik. Obwohl Kritik selbst schon ihrem kritischen Verfahren unterzogen ist, bleibt sie das Bestimmende, das allerdings schon in der Kontingenz eingezogen ist. Butlers Anerkennung einer unaufhebbaren Kontingenz im Bereich des Politischen entlarvt diese zugleich als die Grenze der Theorie des Politischen. Bei Seyla Benhabib stehen sich Vernunft und die Reflexion über die kontingenten Bedingungen eines konkreten, vernünftigen Subjektes gegenüber. In der Tradition der kritischen Sozialtheorie betont Benhabib die Notwendigkeit der ständigen Selbstreflexion der Vernunft über ihre Bedingungen und meint, dies sei im gemeinsamen Diskurs möglich. Sie erinnert zugleich an die Kontingenz des jeweiligen Diskurses, eingebettet in die kontingenten Lebenszusammenhänge, und warnt davor, das ethisch-kommunikative Ideal eines Diskurses in Form eines verallgemeinerten Anderen, unabhängig von diesen Kontingenzen, d. i. den konkreten Anderen, zu entwerfen.
Auf der Ebene der Kategorie Geschlecht geht Luce Irigaray von einer notwendigen Zwei-Geschlechter-Theorie aus. Die Notwendigkeit, die Differenz der Geschlechter zu denken und dem Weiblichen den verloren gegangenen Ort im Symbolischen wiederzufinden, führt dazu, dass Luce Irigaray den Platz des Weiblichen in einer doppelten Weise ausmisst: Zum einen ist das Weibliche in der Ordnung des Gleichen der Spiegel, der als Anderes des Gleichen eine zentrale Rolle in der Kontingenzbewältigung übernimmt, zum anderen gibt es ein nicht subsumierbares Anderswo, das für das Kontingente schlechthin steht.
Das Bestimmende in Susanne Langers Denken ist die menschliche Symbolisierungsfähigkeit. Sie geht davon aus, dass diese ein angeborenes Bedürfnis der Menschen ist. Darin sieht sie die notwendige und fundamentale Tätigkeit des menschlichen Geistes. Ständig werden Sinneswahrnehmungen zu Symbolen verarbeitet. Demgegenüber erscheinen die Symbolsysteme selbst als radikal kontingent. Langers Theorie fußt auf einer Ontologie ohne Substanzen und Eigenschaften, die Wirklichkeit als interpretierte und formalisierte, d. i. konstruierte Wirklichkeit begreift und „Tatsachen“ als logisch konstruierte Ereignisperspektiven, relationale Gefüge, die durch „permanente Veränderlichkeit und einen multiplen Charakter als kontingent und reichhaltig gekennzeichnet sind“, erkennt.
Gefühle und Körperlichkeit
Wie kein anderer Ausdruck des Selbst- und Weltverhältnisses des Menschen sind Gefühle Kennzeichen einer spezifischen Individualität und damit bei verschiedenen Individuen kontingent gleich oder kontingent anders. Die Denkerinnen der Kontingenz weisen den Gefühlen eine Rolle zu, die ihnen nicht bloß das Außervernünftige, Andere zuspielt, sondern ihre jeweils spezifische Rationalität zu fassen versucht. Die eigentümliche Form von Vernünftigkeit kann im kontingenten Moment der Gefühle dingfest gemacht werden. Susanne Langer hat eine eingehende und umfassende Analyse der Gefühle geliefert, indem sie unter „feelings“ den gesamtheitlichen Weltbezug des Menschen versteht. Der Bereich subjektiver Erfahrung umfasst so die biologisch vitalen Bezüge, den Bereich der sinnlichen Wahrnehmung, die sensitiven Qualitätsempfindungen, hochdifferenzierte Gefühle und begrifflich-rationales Denken. Mit dieser Ausdehnung der Reichweite von Gefühlen auf emotive, kognitive und willensbestimmte Momente ganzheitlichen Selbst- und Weltverhältnisses des Menschen macht Langer auf die Gefühlskomponente der Kognition aufmerksam. Langer fragt weiter danach, wie sich Gefühle im Unterschied zu Gedanken und Wahrnehmungen charakterisieren lassen. Diese Frage berührt die Symbolisierungsweisen der Gefühle. Den Ausdruck der Gefühle erkennt Langer etwa in der Musik als symbolischer Form, die es durch ihre logische Verwandtschaft mit den menschlichen Formen des Gefühlslebens vermag, den Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Musik ist allerdings keine Sprache im engen Sinn, sondern sie ist eine nichtdiskursive symbolische Form, weil es keine willkürlich zu bestimmende Referenz ihrer Elemente gibt. Musik wie auch bildende Kunst als symbolische Form vermitteln Wissen um die Komplexität von Gefühlen. Kunstwerke gestatten, dem menschlichen Gefühlsleben Ausdruck zu geben, das sonst namenlos bleibt.20 Ebenso wie Langer geht Iris Murdoch von der Vielschichtigkeit der Gefühle aus. Gefühle sind nicht allein oberflächlicher, bewusster Natur, sondern umfassend und subtil.21 Murdochs Interesse an der Zufälligkeit, welche im menschlichen Leben, vom Bereich der Emotionen bis hin zum Bewusstsein spielt, erkennt in den Gefühlen eine positive kreative Kraft, die bei moralischen Urteilen deutlich weniger bewusst gesteuert ist, als es im Sinne eines objektiven Urteils von Vorteil wäre. Bei Iris Murdoch gerät vorzugsweise die Bedeutung der Gefühle für die moralische Urteilskraft in den Blick. Sie sind ihrer Ansicht nach verwoben mit moralischem Urteilen, Handeln und Verhalten. Damit sind Gefühle nicht länger eine immer gleiche Urkraft, die zu beherrschen wäre; sie sind vielmehr abhängig davon, wie Menschen die Welt wahrnehmen, beurteilen, bewerten; so wird ihre je andere Ausprägung in verschiedenen Kulturen und zu unterschiedlichen Zeiten sichtbar.
Doch der Aufweis der Gefühlskomponente von Rationalität und das Festhalten an der Rationalität von Gefühlen ist Denkerinnen wie Luce Irigaray noch zu wenig radikal: Sie verbindet die Entdeckung, dass Gefühle eine eigene Form von Vernünftigkeit haben, mit der Betonung der Materialität des sexuellen Körpers. Die Körperlichkeit des Denkens und der Sprache auf weibliches Sprechen angewandt hat zur Folge, dass das Reden als Berühren der weiblichen Lippen vorgestellt wird. Mit dieser Theoriemetapher ist weibliches Sprechen im wahrsten, buchstäblichsten Sinne des Wortes als kontingent ausgezeichnet, insofern „contingere“ mit „sich berühren“ übersetzt werden kann. Lässt sich ein größerer Gegensatz zu dieser Position als das Denken Simone Weils denken? Im Gegensatz zu Irigaray lehnt Simone Weil die Kontingenz, d. i. die Zeitlichkeit – zumindest des eigenen Körpers –, ab. Sie wehrt sich gegen die eigene Körperlichkeit, d. i. Weiblichkeit und Bedürftigkeit. So hat es auf den ersten Blick den Anschein, als würde Weil Körperlichkeit radikal ignorieren bzw. negieren. Bei genauerem Hinschauen und der Lektüre der „Fabriktagebücher“22 Weils zeigt sich, dass sie den Körper, der mannigfaltigen Zufällen ausgesetzt ist, aus einer anderen Perspektive betrachtet. Im Unterschied zu der positiven Besetzung des (weiblichen) Körpers als Einfallstor für neue sprachliche Möglichkeiten ist Weil Meisterin darin, den Körper unter dem Aspekt der körperlichen Empfindung des Schmerzes zu thematisieren, die für sie körperliche Schmerzen, psychisches Leiden und soziale Erniedrigung umfasst. Schmerz ist aus dieser Perspektive ausgezeichneter Zugangsort zur Passivität des Körpers im Leiden und im Unglück. Und gerade hier liegt die „spirituelle“ Bedeutung des Leidens in der Philosophie Weils, da es Ausgangspunkt der Gottesliebe ist und zur Begegnung mit Gott im Schweigen führen kann. Statt einer Sprache sich berührender Lippen spricht Weil eindrücklich die Sprache des Schmerzes. Mit Irigarays Schreiben verbindet sich der Ort dieser Sprache: Beide bewegen sich am Rande des Darstellbaren.
Kontingenz und die Grenze des Denkens, der Sprache
An den Grenzen von Erklärbarkeit und Verfügbarkeit entwickeln die Denkerinnen ein neues Verständnis für kontingente Phänomene, für Zufälliges, Unberechenbares, Grundloses, aber auch für das, was sich den traditionellen Erklärungsmustern zu entziehen scheint. Oder anders ausgedrückt: Das Denken des Kontingenten macht auch vor den Kontingenzen des eigenen Denkens nicht Halt und wird als Struktur und Form des eigenen Denkens begriffen. Nicht zufällig weicht die Form für das Nachdenken des Kontingenten, welche sich die Philosophinnen gewählt haben, oftmals von der traditionellen Form des argumentativen, begründenden philosophischen Systemdenkens ab. Die Texte der Philosophinnen sind vielmals essayistisch, aphoristisch, machen vor der Form des Gedichtes oder des Romans nicht Halt, teilen sich im Brief, im Fragment, in der Form der denkerischen Existenz mit – sie wollen weniger begründen, als vielmehr mitteilen, plausibilisieren, einführen, in Kontakt bringen und erzählen. Denn treten die Grenzen der eigenen bzw. der anderen Erklärungsmuster hervor, kommt auch die Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer sprachlichen Beschreibung dieser vorderhand nichtrationalen (bzw. transrationalen) Randphänomene in den Blick. Sie hinterlassen Spuren im geschriebenen Text. In den Briefen Simone de Beauvoirs an ihren Geliebten Nelson Algren ist Kontingenz auf eine außerordentliche Art als Figur der Mitteilung eingeholt. Die Briefe sind flüchtig, unvollständig, folgen keinem Plan und keinem Gesetz der Ganzheit, sie sind offen für das Kontingente. Hier wird eine andere Sprache entwickelt, gesprochen, eine Sprache, welche die körperliche Dimension des Schreibens einholt.23 Mit der Form des Denkens der Kontingenz, in der sich Spuren der Kontingenz des eigenen Denkens eingezeichnet haben, ist die gedankliche Reflexion auf die Kontingenz des eigenen Standpunktes bzw. der Position des kontingenten Subjektes verbunden. Für Edith Stein bleibt die Grenze der gedanklichen Bewegung, die vom endlichen bedingten Ich ausgehend das notwendige Sein zu erreichen sucht, der Denkfähigkeit selbst eingeschrieben und bleibt als sinnvolle Herausforderung bestehen: Die Andersheit Gottes kann Stein zufolge nur berührt, nicht gesehen werden. Schließlich zeigt Stein, dass die Begrenztheit des Kontingenzdenkens in ihrer Erkenntnisbewegung auf eine Begegnung mit Welt, Gott, Person zielt und so die Grundlage des menschlichen Welt- und Wirklichkeitsverhältnisses bildet. Iris Murdoch versucht denkerisch die Balance zu halten zwischen der Vereinheitlichungstendenz des denkerischen Zugriffs, der einen artifiziellen Schein auf das an sich unvollständige, fragmentarische Leben wirft und dem partikularisierenden Denken, das dem Impuls der Ordnung und Klassifikation widersteht und stattdessen die einzelnen kontingenten Phänomene mit einer Art Laserstrahlform von Aufmerksamkeit herausgreift und individuiert. Murdoch beschreibt die dazu parallele Spannung von Form und Kontingenz im Roman. Der ideale Roman hält die Spannung von Form und Kontingenz, die Spannung zwischen der Notwendigkeit, ein einheitliches Ganzes zu schaffen, und der Notwendigkeit, individuelle Charaktere dazustellen, welche die kontingente Wirklichkeit menschlichen Lebens widerspiegeln.
Plädiert Murdoch für Kontingenz als ästhetische Kategorie, welche als Gegengewicht zur notwendigen Form im Roman eingeholt werden muss, so reflektiert Hannah Arendt auf die eigene theoretische Tätigkeit als „Geschichtenerzählerin“24 sowie auf die narrative Verfasstheit menschlichen Handelns und menschlicher Existenz überhaupt. Da Handlungen nur in der Erzählung leben (derer, die sie ausüben, und derer, die sie miterleben und sich an sie erinnern), ist das Geschichten-Erzählen eine elementare menschliche Tätigkeit. Dem entspricht auf der theoretischen Ebene eine perspektivische Darstellung, welche die Pluralität der verschiedenen Handlungsperspektiven in narrativer Form zur Darstellung bringt. Voraussetzung hierfür ist für Arendt eine Urteilskraft, die es vermag, die Welt in der erzählten Geschichte so neu zu erschaffen, wie sie in den Augen anderer erscheint. Agnes Heller führt dieses Projekt weiter, indem sie eine erzählende Moralphilosophie entwirft, in der eine kontingente Person zu einer anderen kontingenten Person spricht. Demgegenüber setzt Judith Butler die souveräne Position des Subjektes, das Geschichten erzählt und sich in anderen Geschichten vorfindet, einer permanenten Kritik aus, die auch vor den Grundlagen des historischen Daseins nicht Halt macht. So setzt Butler alle Versuche des theoretischen Zugriffs auf die Geschichten der Kritik aus, eine Machtstrategie zu sein, die fälschlicherweise unabschließbar Kontingentes in theoretisch auf Dauer Gestelltes, Notwendiges überführt.
4. Die Denkerinnern
Die Zusammenstellung der hier vorgestellten Philosophinnen ist deswegen kontingent, weil die räumliche Begrenzung zu einer Auswahl nötigte. Es konnten nur zwölf mögliche Vertreterinnen der denkerischen Zunft vorgestellt werden. Es wurden in diesem Sammelband lediglich nordamerikanische und europäische Intellektuelle berücksichtigt. Den Schwerpunkt der Auswahl habe ich auf existentialistische, phänomenologische Denkerinnen (Simone Weil, Edith Stein, Simone de Beauvoir), politische und moralphilosophische Denkerinnen (Hannah Arendt, Agnes Heller, Iris Murdoch), Denkerinnen, die sich im Grenzbereich Literatur-Theorie bewegen, sowie feministische Denkerinnen (Judith Butler, Lynn Hankinson Nelson, Sandra Harding) gelegt. Diese Eingrenzung ist u. a. dem kontingenten Denkhorizont der Herausgeberin geschuldet. Zugleich aber ist jede Auswahl auch immer eine notwendige Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten. Es fehlen etwa wichtige Vertreterinnen der analytischen Philosophie wie Elizabeth Anscombe und Philippa Foot, es fehlen radikale Feministinnen wie die Theologin und Philosophin Mary Daly, es fehlen die italienische Philosophinnengruppe Diotima und Luisa Muraro, es fehlen wichtige französische Theoretikerinnen wie Sarah Kofman, Julia Kristeva, Hélène Cixous; es fehlen zudem Autorinnen aus dem asiatischen, indischen, südamerikanischen und afrikanischen Raum.
Die theoretische Ausgangslage der einzelnen Artikel ist sehr verschiedenartig. Wo noch wenig überblickshafte Darstellungen der Philosophin vorhanden sind, handelt es sich in erster Linie um Einführungen in unbekannte Denkwelten. Bei anderen Artikeln kann auf eine breite Diskussionsbasis und einen umfangreichen Forschungsstand zurückgegriffen werden, wie etwa bei Hannah Arendt und Judith Butler. Hier handelt es sich bei den Texten um Diskussionsbeiträge. Schließlich gibt es Beiträge, die in erster Linie biographisch angelegt sind (Simone Weil), und Beiträge, die eine genaue Re-Lektüre eines bestimmten philosophischen Textes unter dem Aspekt der Kontingenzthematik vornehmen (Edith Stein). Die Unterschiedlichkeit der einzelnen Zugänge ist Stärke und Merkmal des Denkens von Kontingenz, welches sich selbst auch im Denken über das Denken der Kontingenz als ein plurales, vielschichtiges präsentiert.
Die Leistung des Kontingenzdenkens von Frauen, wie es in diesem Sammelband dargestellt wird, dürfte in einem Zweifachen liegen. Einmal darin, dass in besonderer Weise sichtbar wird, auf welche Weise und an welchen inhaltlichen Punkten das Denken von Frauen durch ihre philosophischen Vorgängerinnen geprägt ist, gerade dann, wenn dieses Denken von Unterbrüchen und Abbrüchen gekennzeichnet ist. Diese Überlegung knüpft an Hannah Arendts Projekt einer „alternative[n] Archäologie der Moderne“25 an. Wer, wie Arendt, davon ausgeht, dass der Faden der Tradition gerissen ist, „die Kontinuität der Vergangenheit, wie sie von einer Generation auf die andere überzugehen und dabei eine Eigenständigkeit zu entwickeln schien“26, unwiederbringlich gebrochen und verloren ist, der oder die kann Geschichte nur in einer demontierten Gestalt aufgehoben denken: als eine spezifischen Form von historischer Erinnerung, welche die Spuren ihrer Destruktion in sich trägt.27 Diesen bewertungsfreien Umgang mit Vergangenheit charakterisiert Arendt als eine besondere Weise der Tätigkeit des Geschichtenerzählens. Philosophische Denkübungen bestehen unter anderem darin, in den Trümmern der Geschichte zu graben, um die Perlen vergangener Erfahrung mit ihren sedimentierten und verborgenen Bedeutungen wiederzufinden, aus denen sich eine Geschichte herauslesen lässt, die dem Geist hilft, sich auf die Zukunft zu orientieren. So enthält auch die von Abbrüchen gekennzeichnete Geschichte des Denkens von Frauen Perlen, welche die Spuren einer Genealogie weiblichen Denkens legen können, eine Form von Erinnerung als kreatives Neudurchdenken, das Potenziale der Vergangenheit aufdeckt und weiterführt. Zum anderen erkenne ich die Leistung des Kontingenzdenkens von Frauen darin, dass sie kleinere und größere Bausteine zu einer Gegenerzählung zur bestimmenden Kontingenzerzählung bereitstellen: Die Beiträge der denkenden Frauen zur Kontingenzproblematik machen deutlich, dass Aporien und Grenzen des Kontingenzdenkens im Rückgriff auf die Anfänge zwar nicht zu lösen sind, doch sie weisen darauf hin, dass Denkwege, die einmal eingeschlagen wurden, neu reflektiert, noch einmal und noch einmal anders gegangen werden können. Es ist das Verdienst der vorgestellten Denkerinnen, die Frage nach dem Anderen der Kontingenz, nach der Bedingtheit des nicht unbedingt Notwendigen offen gehalten und philosophische Antworten darauf gesucht zu haben. So möchte dieses Buch ein Beitrag zu Denkerinnen der Kontingenz sein und zugleich mit an einer Geschichte des Kontingenzdenkens schreiben.
Dass die Idee zum Buch wurde, ist nicht allein und nicht notwendigerweise einzig den Autorinnen anzurechnen. Doch gerade ihnen und ihrer Bereitschaft, mein Konzept weiterzudenken, anders zu denken, schreibend zu Papier bzw. auf den Computerbildschirm zu bringen, und sich dabei auf das „formale Korsett“ eines derartigen Projektes einzulassen, bin ich zu großem Dank verpflichtet. Für wertvolle Hinweise und Anregungen im Vorfeld des Buches danke ich besonders Brigitte Hilmer, Rahel Jaeggi, Ruth Ewertowski und Louise Röska-Hardy. Die Basler Wissenschaftlerinnengruppe HBK (Natalie Amstutz, Ariane Bürgin, Elsbeth Dangel-Pelloquin, Franziska Frei Gerlach, Silvia Henke, Brigitte Hilmer, Kathrin Hönig, Anne Krauter, Katrin Meyer, Fabienne Peter, Barbara Schmitz und Barbara von Reibnitz) hat dieses Projekt in vertraut kontrovers-konstruktiver Manier begleitet, diskutiert und entscheidend geprägt. Den Studierenden der Theologischen Fakultät der Universität Basel, mit denen ich in einem ersten Durchgang drei Philosophinnen auf ihr Kontingenzdenken hin befragt habe, verdanke ich klarere Konturen dieses Projektes. Die Öffentliche Bibliothek der Universität Basel bot mir klimatisierte, kühle Arbeitsräume, die ich besonders bei den heißen Temperaturen des Sommers 2003 geschätzt habe. Zu danken habe ich dem Schweizerischen Nationalfonds, der meine Arbeit an diesem Buch überhaupt erst ermöglicht und finanziell unterstützt hat. Zu danken ist auch der Theologischen Fakultät der Universität Basel, die mir den Arbeitsplatz und das elektronische Know-how zur Verfügung gestellt hat. Zu danken ist überdies Bruno Kern, dem Lektor der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, der die Arbeit zu diesem Buch angeregt und mit Christian Geinitz freundlich betreut hat.