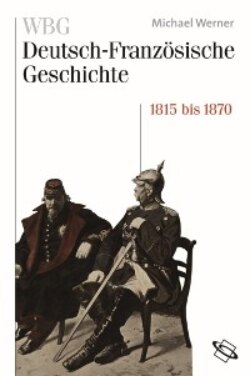Читать книгу WBG Deutsch-Französische Geschichte Bd. IV - Guido Braun - Страница 11
2. Im Zeichen der bourbonischen „Universalmonarchie“. Die französisch-deutschen Beziehungen im Zeitalter der Vorherrschaft LudwigsXIV. in Europa zwischen Tradition und Expansion (1648–1715) Kontinuität und Wandel in den französisch-deutschen Beziehungen
ОглавлениеIm Zeitalter Ludwigs XIV. (1648/61–1715) verschoben sich die Parameter der französischen Reichspolitik zunächst nicht wesentlich. Zu den Grundkonstanten des französischen Verhältnisses zum Reich und der europäischen Politik im Allgemeinen gehörte seit dem 16. Jahrhundert der dynastische Antagonismus zu den Habsburg-Lothringern, die bis 1700 in Madrid regierten und bis 1742 und dann wieder von 1745 bis zum Ende des Alten Reiches die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation stellten. Sie residierten nach dem Tode Rudolfs II. gemeinhin in Wien. Das nordalpine Reich und Reichsitalien gehörten in diesem europäischen dynastischen Konflikt im 16. und 17. Jahrhundert zu den wichtigsten geographischen Zentren der kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Valois- und Bourbonen-Königen auf der einen und den Habsburger-Kaisern und spanischen Königen auf der anderen Seite.
Die Leitung der französischen Politik oblag nach dem Westfälischen Frieden bis 1661 weiterhin dem französischen Prinzipalminister Kardinal Mazarin, der die Nachfolge des 1642 verstorbenen Kardinals Richelieu angetreten hatte. Seit 1643 war Ludwig XIV. französischer König; er erreichte 1651 die Volljährigkeit29, trat jedoch erst 1661 seine persönliche Regierung an, die eine Abkehr vom Regierungssystem der Prinzipalminister markierte. Auch im Reich regierte bis 1657 FerdinandIII., der Kaiser, der (nach seinem Regierungsantritt 1637) 1648 den Westfälischen Frieden abgeschlossen hatte. Ihm und seinem Nachfolger Leopold I. wurden von reichsständischer Seite einschließlich der traditionell kaisertreuen katholischen Fürstbischöfe bis in die 1670er Jahre hinein jedoch Absichten zur Revision der Westfälischen Friedens- und Verfassungsordnung unterstellt, was der französischen Diplomatie gerade im entscheidenden letzten Jahrzehnt des Krieges gegen Spanien wichtige Anknüpfungspunkte zur Eindämmung des habsburgischen Einflusses im Reich durch eine erfolgreiche eigene Bündnispolitik mit den Reichsständen bot.
Trotz personeller Kontinuitäten beim politischen Führungspersonal markierte 1648 zwar in völkerrechtlicher Hinsicht nicht den Beginn eines „Westfälischen Zeitalters“ oder eines „Westfälischen Systems“, das Interpreten des 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts in diesem Friedenswerk angelegt sehen wollten30, aber durchaus eine deutliche Zäsur in den deutsch-französischen Beziehungen: Seit einem Jahrhundert hatten der Kaiser und der französische König aufgrund des von 1552 an bestehenden völkerrechtlichen Kriegszustandes keine ordentlichen diplomatischen Beziehungen mehr zueinander unterhalten. Der Friedensvertrag bewirkte zwar keine dauerhafte Trennung der beiden Linien des Hauses Habsburg, zumal in Wien zwei Wochen nach Friedensschluss, am 8. November 1648, durch die Hochzeit zwischen Philipp IV. und der seinerzeit einzigen Kaisertochter Maria Anna ihre dynastischen Bande noch enger geknüpft wurden. Mazarin hatte jedoch erstmals einen Keil zwischen sie treiben können. 1659 gelang es den Franzosen dann im Pyrenäenfrieden, die französische Süd- und Ostgrenze auf Kosten des isolierten Spanien zu arrondieren31.
1648 wurde Frankreich neben Schweden darüber hinaus als Garantiemacht des Friedenswerkes von Münster und Osnabrück eingesetzt32. Die Durchsetzung der darin verbrieften reichsständischen Rechte war ein französisches Kriegsziel gewesen, doch die französische Diplomatie in Münster hatte das Feld der Verhandlungen über die gravamina politica et ecclesiastica weitgehend dem Kaiser, den Ständen selbst und Schweden überlassen. Frankreich legte seinen Garantiemachtstatus nach 1648 aber bis ins 18. Jahrhundert sehr extensiv als Wächteramt über die gesamte Reichsverfassung aus. Mit der Friedensgarantie erhielt die französische Politik ein Instrument an die Hand, mit dem sie Interventionen in die deutschen Verhältnisse legitimieren konnte, auch wenn dabei offenkundig genuin französische Interessen im Vordergrund standen. Diese Anwendung des Garantierechts diskreditierte es im Reich zunehmend. 1648 war für die Zeitgenossen jedoch noch nicht genau abzusehen, welche Möglichkeiten das Garantierecht bot33.
Seit dem Tode Mazarins 1661 betrachtete der Sonnenkönig die Außenpolitik als seine persönliche Domäne und als zentrales königliches Amtsgeschäft. Anders als die im Verlaufe seiner 54-jährigen Regierungszeit wechselnden politischen Konstellationen, Ziele und Minister, von denen nur wenige eine für die auswärtigen Beziehungen herausragende Rolle einnahmen, wie der Kriegsminister Louvois, war dieses königliche Reservat die eigentliche außenpolitische Grundkonstante zwischen 1661 und 1715. Seine Außenpolitik ließ durchaus nicht jede Kontinuität zur Politik Richelieus und seines Erziehers, des außenpolitischen Pragmatikers Mazarin, vermissen. Jedoch setzte der Sonnenkönig zweifellos eigene Akzente, die seiner Herrschaft trotz einer im Wesentlichen unveränderten politischen Grundkonstellation auch außenpolitisch ein unverwechselbares Gepräge gaben34. Charakterisiert wurden diese außenpolitischen Rahmenbedingungen durch den bourbonisch-habsburgischen Gegensatz, der seit der Erwerbung eines Großteils des burgundischen Erbes und der spanischen Königswürde durch die Habsburger den beherrschenden Faktor in der europäischen Politik bildete, sowie durch die drohende Personalunion zwischen dem spanischen Königs- und dem Kaiserthron, die bis zu den Friedensschlüssen von Utrecht, Rastatt und Baden nicht ausgeschlossen war. Die Außenpolitik genoss gegenüber ökonomischen und sozialen Erwägungen Priorität35. Die merkantilistische Wirtschafts- und Handelspolitik Colbert’scher Prägung hatte dafür die finanziellen Mittel bereitzustellen36. Die jüngere Forschung hat dennoch zu Recht betont, dass Ludwig XIV. die finanziellen, wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen seit dem Ende des Pfälzischen Krieges zunehmend in den außenpolitischen Erwägungen berücksichtigte und dass sie entscheidend zu seiner zunehmenden Friedensbereitschaft beitrugen37.
Unter Mazarin und Ludwig XIV. erfolgte zunächst keine grundsätzliche Abkehr von den klassischen französischen Methoden einer Bündnispolitik mit den Reichsständen, die auf einem konzilianten Grundton im beiderseitigen Einvernehmen beruhte. Richelieus Ansinnen, den wahlmonarchischen Charakter des Reiches verfassungsrechtlich durch ein Verbot der Wahl vivente Imperatore auszubauen, war Ausdruck einer Überschätzung des kaiserlich-reichsständischen Dualismus gewesen. Letztere blieb auch für die Deutschlandpolitik Mazarins und Ludwigs XIV. charakteristisch. Über den Interessen- und Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Reichsoberhaupt und seinen Ständen drohte die französische Politik nicht selten die innerständischen Konflikte, im Umfeld von 1648 insbesondere die Divergenzen zwischen den Kurfürsten und den übrigen Ständen, aus dem Blick zu verlieren. Obwohl die französischen Kenntnisse über das politische System des Reiches und sein Verfassungsrecht sehr viel genauer waren, als es die Forschung bis in die 1980er Jahre annahm38, lag in der Überzeichnung des deutschen Dualismus zwischen Kaiser und Reichsständen sicherlich ein Grundproblem der französischen Perzeption des Reiches. Weder Richelieu noch die nachfolgenden französischen Staatsmänner und Könige planten jedoch bis zur Französischen Revolution eine Vernichtung des Kaisertums an sich. Überlegungen, die Kaiserwürde abzuschaffen, tauchten im 18. Jahrhundert im Umkreis der französischen Regierung nur punktuell auf und wurden niemals nachdrücklich verfolgt.