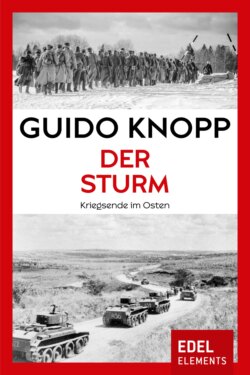Читать книгу Der Sturm - Guido Knopp - Страница 3
ОглавлениеAutor
Prof. Dr. Guido Knopp, Jahrgang 1948, arbeitete nach dem Studium als Redakteur der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ und als Auslandschef der „Welt am Sonntag“. Von 1984 bis 2013 war er Leiter der ZDF-Redaktion Zeitgeschichte. Seitdem moderiert er die Sendung History Live auf Phoenix. Als Autor publizierte er zahlreiche Sachbuch-Bestseller. Zu seinen Auszeichnungen zählen der Jakob-Kaiser-Preis, der Europäische Fernsehpreis, der Telestar, der Goldene Löwe, der Bayerische und der Deutsche Fernsehpreis, das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse und der Internationale Emmy.
Vorwort
Wir haben noch immer Funkverkehr mit Berlin, wo sich der Feind den Weg ins Stadtinnere erkämpft hat. Das Herz blutet bei diesen Gesprächen. Es ist wie der Kampf der Westgoten am Vesuv.« Ende April 1945 sandte Hitlers Helfer Alfred Jodl diese verzweifelte Botschaft an seine Frau. Vergeblich hatte er von außen die letzten Kräfte der ausgebluteten Wehrmacht zu mobilisieren versucht, um den Tyrannen aus der von der Roten Armee eingeschlossenen Hauptstadt zu befreien. Die Niederlage des Reiches vor Augen, verfiel er wie so viele andere in die schicksalstönende Untergangsromantik, mit der Hitler seine Paladine bis zuletzt in Bann hielt – wider jede Vernunft und ohne Rücksicht auf die Opfer, die der aussichtslos gewordene Kampf kostete. Bedenkenlos verknüpfte der Diktator das Los Deutschlands mit seinem eigenen: alles oder nichts. Wenn schon kein Sieg, dann der totale Untergang.
Gut sechs Jahrzehnte sind vergangen, seit der Krieg sein Ende fand und das Nazireich in einem Meer von Blut und Tränen versank. Viele Städte waren nur noch schwelende Ruinenfelder, landauf, landab bot sich den Siegern ein gespenstisches Bild. Millionen Soldaten waren an den vielen Fronten gestorben; Millionen Zivilisten in den Bombennächten, auf der Flucht und durch Vertreibung umgekommen; Millionen in Gaskammern ermordet worden.
Seinen Höhepunkt erreichte dieser Krieg im Osten. »Ostfront« – schon das Wort klang nach Tod. Mit dem Überfall am 22. Juni 1941 hatte Hitlers Vernichtungsfeldzug gegen die Sowjetunion begonnen. Hier wollte er seine beiden Hauptziele verwirklichen: die Eroberung von »Lebensraum im Osten« und die Ermordung der Juden Europas. Beides war für ihn die Vorstufe zum Endziel, dem wahnwitzigen Traum eines großgermanischen Reiches vom Atlantik bis zum Ural. Doch spätestens seit Stalingrad stand fest, dass der Krieg nicht mehr gewonnen werden konnte. Nach drei Jahren und Millionen Toten war die Wehrmacht in die alten Reichsgrenzen zurückgedrängt worden.
Im Oktober 1944 erreichte die Rote Armee im Osten deutschen Boden. Nun wurden die Ostpreußen Opfer eines Hasses, den die Deutschen selbst gesät hatten. Nemmersdorf bildete den Anfang: Stalins Truppen rächten sich mit einem Blutbad unter der Zivilbevölkerung für jene Grausamkeiten, die in deutschem Namen auf dem Boden der Sowjetunion begangen worden waren. Goebbels’ Propaganda schlachtete die Massaker nach Kräften aus: Das würde dem gesamten deutschen Osten drohen, wenn die Russen kämen! Der Kampfeswille wurde neu entfacht, und noch einmal gelang es der Wehrmacht, die Front im Osten zu stabilisieren. Von Oktober 1944 bis zum Januar 1945 verharrte die Rote Armee im Grenzland von Ostpreußen. Das war nur die Ruhe vor dem »Sturm«. 2,2 Millionen Soldaten, 33 500 Geschütze und 7000 Panzer standen Anfang Januar 1945 bereit für den entscheidenden Vorstoß nach Berlin.
Vieles wäre der Zivilbevölkerung erspart geblieben, hätte man sie rechtzeitig evakuiert. Doch die Menschen durften ihre Dörfer und Städte nicht verlassen. »Jede Räumung wird die Moral der Truppe und der Zivilbevölkerung schwächen«, verfügte Ostpreußens Gauleiter Erich Koch. Ein Bauernhof voller Kinder werde hartnäckiger verteidigt als ein leeres Gehöft – so das menschenverachtende Kalkül der obersten Führung. Als die Rote Armee schließlich am 12. Januar 1945 ihre Großoffensive startete, durchstieß sie binnen weniger Tage die dünnen deutschen Verteidigungslinien und drang bei Elbing bis zur Ostseeküste vor: 2,5 Millionen Menschen saßen in der Falle. So sammelten sich überall in aller Eile Trecks, die zu den Häfen strebten. Zu Fuß, mit Schlitten oder Pferdewagen versuchten die angstvollen Menschen, ein rettendes Schiff zu erreichen. Doch vor den vermeintlich sicheren Häfen lag das Haff, eine bis zu zwanzig Kilometer breite, siebzig Kilometer lange Ostseebucht, die durch eine fünfzig Kilometer lange Landzunge, die Nehrung, von der offenen See getrennt ist. Schon die Überquerung des zugefrorenen Haffs war für viele ein Wettlauf mit dem Tod. In der dunklen Eiswüste kamen sie vom festen Weg ab, verirrten sich und brachen ein.
Während Millionen auf der Flucht nach Westen waren, vollzog sich im Osten Deutschlands eine Tragödie anderer Art. Um den Vormarsch der Roten Armee Richtung Berlin zu verzögern, wurden Städte wie Königsberg, Breslau und Kolberg zu »Festungen« erklärt. Sie sollten bis zum letzten Mann gehalten werden und damit starke russische Kräfte binden. Für die Eingeschlossenen begannen qualvolle Monate zwischen Bangen und Hoffen. Hinter hastig aufgebauten Panzersperren, eilig ausgehobenen Gräben und Einmannbunkern hausten Hunderttausende Zivilisten, verteidigt von zusammengewürfelten Einheiten aus Wehrmacht, Volkssturm und Hitlerjungen. Wer nicht weiterkämpfen wollte, wurde zur Abschreckung als »Verräter« aufgehängt. Aus allen Rohren feuerte die sowjetische Armee auf die Eingekesselten, Straße um Straße wurde von den Rotarmisten eingenommen. Am 18. März fiel Kolberg, am 9. April Königsberg, am 6. Mai schließlich auch Breslau. Die Rache der Sieger traf vor allem die Frauen: Vergewaltigungen, Plünderungen und Morde waren an der Tagesordnung. Der dramatische Kampf ums Überleben unter der Besatzung begann. Erst Jahre später wurden die letzten Überlebenden aus ihrer Heimat ausgewiesen, die ihnen zu einem Ort des Schreckens geworden war.
Mitte April begann der Großangriff auf Berlin. Mit über einer Million Soldaten setzte Marschall Schukow an der Oder zum entscheiden den Stoß an. Das Ringen um die Schlüsselstellung auf den Seelower Höhen wurde zum Fanal. Hier sollte nach Hitlers Willen das letzte Aufgebot der Wehrmacht wie ein »Wellenbrecher« die Flut der heranströmenden Roten Armee aufhalten. Nach vier Tagen war der idyllische Landstrich, den der Dichter Theodor Fontane einst als »fernes Wunderland« gepriesen hatte (»alles Friede, Farbe, Duft«), in eine gesichtslose Kraterlandschaft verwandelt. Zehntausende Tote hatte der erbitterte Kampf beide Seiten noch einmal gekostet. Nun lag der Weg in die Hauptstadt offen. Am 21. April standen Schukows Soldaten am Stadtrand von Berlin. Als die ersten sowjetischen Granaten in der Innenstadt explodierten, war auch bei Hitler endlich die Fassade aus Unnachgiebigkeit und falscher Siegeszuversicht zerstört. »Der Krieg ist verloren«, rief der »Führer« unter Tränen in einer dramatischen Lagebesprechung im Bunker. Doch aufgeben, um Leben zu schonen, kam für ihn nicht infrage. Er werde in Berlin bleiben, und wenn es denn sein müsste, auf den Stufen der Reichskanzlei fallen. Am 25. April hatte die Rote Armee die Reichshauptstadt eingeschlossen. Der Endkampf um das Herz der Stadt begann.
Was folgte, war der jämmerliche Untergang eines Reiches, das tausend Jahre bestehen sollte und nach zwölf zusammenbrach. Während Berlin im Straßenkampf versank und Zigtausende Menschen dieses letzte Aufbegehren mit ihrem Leben bezahlten, entzog sich der Verantwortliche »fünf nach zwölf« durch Selbstmord. Und mit einem Schlag versank das Nazireich. Sein mörderisches Dasein hatte allein von Hitler abgehangen. Ohne ihn war es ein Totenschiff. »Hitlers Tod«, sagte seine Sekretärin Traudl Junge, die bis zum bitteren Ende bei ihm ausgeharrt hatte, »war für uns wie das Ende eines Zustands der Massenhypnose. Plötzlich entdeckten wir in uns wieder eine unbezwingbare Lust zu leben, wir selbst zu werden, menschliche Wesen zu sein.«
Die Bilanz des Krieges im Osten? Für den Kriegsherrn Hitler war der Krieg nicht nur eigentliches Staatsziel, er war auch Selbstzweck, und der Überlebenskampf das Gesetz jeder Existenz: der Wahn des Usurpators, für den es nur ein Entweder/Oder gab – Siegen oder Untergehen. Er fand genügend Generäle, die ihm folgten. Millionen von Soldaten wurden nicht gefragt, ebenso wenig die Zivilbevölkerung. Vier Millionen Deutsche hatten als Soldaten für ein mörderisches Vaterland ihr Leben gelassen. 2,5 Millionen Zivilisten kamen in den Bombennächten um, auf der Flucht, durch die Vertreibung.
Diejenigen, die das schreckliche Geschehen überstanden hatten, fanden keine Zeit für Tränen. Nichts als überleben wollten sie. Noch Hunderttausende verhungerten in jenem Jahr – gefangene Soldaten, Greise und Kranke. Konrad Adenauer sah das deutsche Volk »zugrunde gehen – langsam, aber sicher«. Der alte Herr aus Rhöndorf hatte seine Deutschen jedoch ziemlich unterschätzt. Sie streckten Leberwurst mit Holz, sie bückten sich nach Ami-Kippen, fälschten Fragebögen und tauschten Silber gegen Butter. Mitunter war die neue Zeit schon da, bevor die alte endete: Noch vor der Kapitulation hatte sich bereits der erste Ortsverein der SPD formiert; am Tag von Hitlers Selbstmord war in der Nähe von Küstrin die »Gruppe Ulbricht« gelandet, Schlangenei des späteren DDR-Regimes.
Das Jahr war Ende und Anfang: Schlussstrich unter eine Zeit der Weltkriege, die künftige Historiker als einen großen Orlog sehen werden – 1914 bis 1945, der Dreißigjährige Krieg des zwanzigsten Jahrhunderts. Und der Anfang einer neuen Ära: einer Friedenszeit, die allerdings nicht durch menschliche Vernunft gesichert wurde, sondern durch die Angst vor der Atombombe.