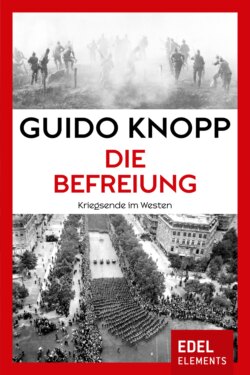Читать книгу Die Befreiung - Guido Knopp - Страница 4
Vorwort
ОглавлениеEs war eine Befreiung
Und dennoch, die Stunde ist groß – nicht nur für die Siegerwelt, auch für Deutschland – die Stunde, wo der Drache zur Strecke gebracht wird, das wüste und krankhafte Ungeheuer, Nationalsozialismus genannt, verröchelt und Deutschland von dem Fluch wenigstens befreit, Hitlers Land zu heißen«, mit diesen Worten begrüßte der in die USA emigrierte Schriftsteller Thomas Mann die deutsche Kapitulation. Nur wenige seiner Landsleute, die in »Hitlers Land« verblieben waren, mögen damals ähnlich empfunden haben. Für die große Mehrheit der Deutschen allerdings war der 8. Mai 1945 wohl zunächst die Stunde des Zusammenbruchs und nicht die Stunde der Befreiung, wie sich auch die Sieger damals nicht als Befreier der Deutschen, sondern als Befreier von den Deutschen gefühlt haben. Nur eine positive Erfahrung verband Sieger und Besiegte am Ende dieses schrecklichen Krieges: Es war die Erleichterung, überlebt zu haben – einen Krieg, der mehr als 50 Millionen Opfer gefordert und zugleich deutlich gemacht hatte, wozu Menschen fähig sind und was sie ihresgleichen antun können.
Heute, fast 60 Jahre nach Ende des Krieges, hat sich die Sicht auf die Ereignisse von damals sehr gewandelt. Die Besiegten von einst und die Nachgeborenen haben sich lange schon von Hitlers mörderischem Reich losgesagt. Sie sind heute in ihrer großen Mehrheit bereit, die schweren Leiden, die die militärische Niederlage den Deutschen aufbürdete, nicht mehr den alliierten Siegern, sondern vor allem der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft anzulasten, die diesen Krieg im deutschen Namen und von deutschem Boden aus entfesselte. Und die Sieger von einst haben das Nachkriegsdeutschland als eine friedliche Demokratie kennen gelernt – und ihm allmählich vertraut. Sie sind heute zunehmend bereit, die Deutschen nicht nur als Vollstrecker, sondern auch als Opfer von Hitlers Wahn zu begreifen – nicht nur als Besiegte, sondern auch als Befreite.
Das vorliegende Buch beruht auf den Recherchen für ein Filmprojekt, das die Endphase des Krieges im Westen darstellt. Bislang wurde dieser Krieg in der Regel nur aus nationaler Sicht geschildert. Heute, da die Zeitgenossen hoch betagt sind, ist es an der Zeit, dass einst verfeindete Nationen gemeinsam aufzeigen, was den Zweiten Weltkrieg ausmacht. Noch sind die Menschen, die den Krieg erlebt haben, am Leben und können erzählen, »wie es war«. Und noch haben wir die Chance, ihnen zuzuhören, wenn sie von der Grenzerfahrung ihres Lebens berichten: Deutsche und Amerikaner, Briten und Kanadier, Franzosen und Italiener, Niederländer und Belgier.
Der Befreiung im Westen ging ein jahrelanges diplomatisches Tauziehen unter den Alliierten voraus. Seit Ende 1941 forderte Stalin eine »Zweite Front« im Westen Europas, die die Rote Armee im Osten entlasten sollte. Doch erst bei der Konferenz von Teheran Ende November 1943 sagten Churchill und Roosevelt Stalin eine Invasion für das nächste Frühjahr zu. Das Unternehmen »Overlord«, die alliierte Landung in der Normandie, begann am 6. Juni 1944. Im Morgengrauen erschien die bis zu diesem Augenblick gewaltigste Armada der Weltgeschichte vor der französischen Küste: Rund 200 000 Mann Sturmtruppen, auf viertausend Schiffen verteilt, eroberten die Strände der Normandie, unterstützt durch eine Feuerwalze alliierter Bomber und Kriegsschiffe. An manchen Stränden gelang der Durchbruch ohne größere Verluste, an anderen blieben hunderte von Angreifern im vernichtenden Abwehrfeuer der deutschen Stellungen liegen. Am Ende des »längsten Tages« siegte die alliierte Überlegenheit an Menschen und Material. Die »Zweite Front« war eröffnet, die Befreiung Westeuropas jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Hitlers populärster General, Feldmarschall Erwin Rommel, mahnte seinen Kriegsherrn, angesichts des aussichtslosen Kampfes »Folgerungen« zu ziehen, das heißt, den Krieg zu beenden. Doch Hitler blieb bei seiner sturen Durchhalteparole, die er bereits am Abend des 6. Juni ausgegeben hatte: »Hier gibt es kein Ausweichen und Operieren, hier gilt es zu stehen, zu halten oder zu sterben.«
Anfang August brach die deutsche Front in Nordfrankreich zusammen. Der Weg ins Innere Frankreichs, der Weg nach Paris war frei. Für die französische Bevölkerung war es die Stunde der Befreiung. Viele, die unter der deutschen Besatzung gelitten hatten, wollten nun aktiv daran mitwirken, ihre Ketten zu zersprengen. Für das befreite Frankreich unter Führung von General Charles de Gaulle war es zudem eine Frage der nationalen Ehre, die Hauptstadt aus eigener Kraft zu befreien. Am 19. August 1944 – fünf Tage, bevor alliierte Truppen Paris erreichten – griffen dort 20 000 französische Untergrundkämpfer zu den Waffen. Für den deutschen Stadtkommandanten General Dietrich von Choltitz spitzte sich die Situation dramatisch zu. Bis zuletzt hatte er gehofft, die Stadt ohne Kampf räumen zu dürfen. Doch nun befahl ihm Hitler, Paris dürfe »nur als Trümmerfeld in die Hand des Feindes fallen«. Von Choltitz aber zögerte die Ausführung des Befehls immer weiter hinaus – bis es zu spät war. Am 24. August 1944 marschierten reguläre französische Truppen in die Stadt ein, tags darauf ging der Kommandant mit 12 000 deutschen Soldaten in die Gefangenschaft. Während die Pariser ihre Freiheit bejubelten, schäumte Hitler im fernen Rastenburg vor Wut. Sein Befehl, die Stadt zu zerstören, war zum Glück ignoriert worden.
Wie wenig der Krieg ansonsten auf Kulturschätze Rücksicht nahm, zeigte sich an der zweiten großen Invasionsfront des Westen in Italien. Im September 1943 waren alliierte Truppen von Sizilien auf das italienische Festland übergesetzt. Als die neue italienische Regierung, die auf den Sturz Mussolinis gefolgt war, mit den Alliierten einen Waffenstillstand schloss, ließ Hitler die italienische Armee entwaffnen und Italien besetzen. Aus den Soldaten der einst verbündeten Wehrmacht wurden in den Augen der meisten Italiener nun »Besatzer«, aus den Alliierten »Befreier«. 140 Kilometer südlich von Rom errichtete die Wehrmacht eine Verteidigungslinie, um den alliierten Vormarsch aufzuhalten. Die deutsche Schlüsselstellung lag auf dem Berg Monte Cassino, in unmittelbarer Nähe des gleichnamigen Klosters, das als Wiege des abendländischen Mönchtums weltberühmt war. Seit Januar 1944 bestürmten die alliierten Truppen vergeblich die deutschen Stellungen auf dem Klosterberg. Schließlich griff auch die US-Luftwaffe an. Am 15. Februar 1944 wurde das alte Kloster Monte Cassino durch einen amerikanischen Bombenangriff völlig zerstört. Das Kloster sei eine »deutsche Festung«, war den Piloten vor ihrem Einsatz gesagt worden. Ein Irrtum: Tatsächlich befanden sich keine deutschen Soldaten im Kloster, dafür aber etwa 800 Flüchtlinge, alte Männer, Frauen, Kinder – bis zu 300 von ihnen starben. Die deutsche Propaganda sprach von alliierter Kulturlosigkeit und Zerstörungswut, die Alliierten verwiesen auf die unmittelbare Nähe von Kloster und deutschen Stellungen. Doch auch nach der Zerstörung des Klosters dauerte es noch Monate, bis die Schlacht von Monte Cassino entschieden war. Erst am 18. Mai 1944 zogen sich die letzten deutschen Einheiten vom »heiligen Berg« zurück. Der Durchbruch der Alliierten nach Norden war geglückt. Am 4. Juni befreiten die Amerikaner unter dem großen Jubel der Bevölkerung Rom.
Im Unterschied zur Normandie und zum Monte Cassino glich der alliierte Vorstoß über die belgische Grenze bis nach Brüssel hinein mehr einem Triumphzug als einer kriegerischen Unternehmung. In den Städten und Dörfern entlang des Weges stand die belgische Bevölkerung jubelnd Spalier und begrüßte die Befreier mit einem Meer aus Fahnen. Viele britische und amerikanische Soldaten waren nahezu berauscht von ihrem Vormarsch. Das Ende des Krieges schien unmittelbar bevorzustehen. »Weihnachten zu Hause«, hieß die Parole. Doch noch einmal gelang es der deutschen Wehrmacht, den alliierten Vormarsch aufzuhalten. Ein alliierter Großangriff auf den Rhein im September scheiterte spektakulär. 10 000 britische Fallschirmjäger wurden bei dem Versuch, die Brücke von Arnheim zu erobern, eingekesselt. Nur 2000 konnten fliehen, der Rest fiel oder wurde gefangen genommen. Dann, am 16. Dezember 1944, folgte völlig unerwartet der deutsche Gegenangriff: Heimlich hatte Hitler kampfstarke Divisionen von der Ostfront abgezogen und in den Westen verlegt. Die deutsche Ardennenoffensive stürzte die Alliierten in ihre schwerste Krise seit der Landung in der Normandie. Doch als die US-Luftwaffe, nachdem tagelang schlechtes Wetter herrschte, wieder Angriffe flog, wendete sich das Blatt ganz schnell. Die letzte große Schlacht vor der deutschen Grenze ging verloren, widerstrebend musste Hitler den Rückzug befehlen. Die Zeit für den alliierten Angriff auf Deutschland selbst war gekommen.
Anfang März 1945 begann der letzte Akt des Krieges im Westen. Alliierte Truppen erreichten auf breiter Front den Rhein. Der Wehrmacht blieb nur noch ein Ausweg: Alle Brücken sprengen und auf dem Ostufer eine neue Front aufbauen. Doch das Glück kam den Alliierten zu Hilfe. Am 7. März 1945 nahm eine amerikanische Vorhut die intakte Rheinbrücke bei Remagen im Handstreich. Hitler tobte, ließ einige Offiziere hinrichten und setzte alle verfügbaren Kräfte gegen die Brücke in Marsch. Aber der Schaden war irreversibel. Die Amerikaner hatten eine erste Bresche in die Rheinfront geschlagen. Zwei Wochen später fiel diese ganz. Mit über einer Million Soldaten setzten die Alliierten bei Wesel über den Niederrhein. »Die Deutschen sind geschlagen. Jetzt haben wir sie. Jetzt sind sie fertig«, jubelte der britische Premierminister Churchill. Was folgte, war der jämmerliche Abgesang von einem Reich, das tausend Jahre währen sollte und nach zwölf zusammenbrach. Nazideutschland versank in einem Meer von Blut und Tränen. Sein monströses Dasein hing allein von jenem ab, der es geschaffen hatte. Ohne ihn, den Kristallisationspunkt böser Emotionen, war es nur ein Geisterschiff. Mit Hitlers Selbstmord am 30. April 1945 endete der Spuk. Seine Nachfolger ergaben sich bedingungslos – auf Gnade oder Ungnade. Die meisten Deutschen erlebten die Kapitulation am 8. Mai mit zwiespältigen Gefühlen. Sie waren erleichtert, dass die Bombenangriffe auf die Städte und Dörfer, die Kämpfe und das Töten an der Front ein Ende hatten. Zugleich aber fühlten sie sich als Zeugen und Opfer eines einzigartigen Zusammenbruchs. Die Stunde der bitteren Wahrheit war gekommen – bitter auch deswegen, weil sich nun das ganze Ausmaß der Verbrechen offenbarte, die von Deutschen begangen worden waren. Befreit hingegen fühlten sich die Opfer und Verfolgten des Naziregimes, vor allem die Menschen, die von den Alliierten in den Wochen zuvor aus den Konzentrationslagern befreit worden waren. Für sie wie für elf Millionen Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter war Deutschland bis zuletzt das Land gewesen, das Gefangenschaft, Versklavung und Tod bedeutet hatte.
Was bleibt nun als Bilanz des letzten Kriegsjahres im Westen? Für den Kriegsherrn Hitler war der Krieg nicht nur sein eigentliches Staatsziel, er war auch Selbstzweck, und der Überlebenskampf das Gesetz jeder Existenz: der Wahn des Usurpators, für den es nur ein Entweder-oder gab – Siegen oder Untergehen. Er fand genügend Generäle, die ihm folgten. Millionen von Soldaten wurden nicht gefragt, ebenso wenig die Zivilbevölkerung. Gleichwohl erscheinen die Deutschen im Rückblick allenfalls als »Befreite wider Willen«. Sie haben sich nicht selbst von Hitler trennen können (und viele auch nicht trennen wollen) und überließen es den Alliierten, Europa und auch die Deutschen vom braunen Terror zu befreien. In Deutschland hat es nach dem Krieg einige Zeit gedauert, bis sich diese Erkenntnis durchsetzte. Zu sehr hatten viele Deutsche zunächst mit ihrem eigenen Schicksal zu kämpfen; für viele war der 8. Mai zudem nicht End- oder Wendepunkt ihrer persönlichen Leidensgeschichte, sondern erst ihr Beginn. Von den über elf Millionen deutschen Soldaten, die sich bei Kriegsende in Lagern der Anti-Hitler-Koalition befanden, geriet die Mehrheit erst nach der Kapitulation in Gefangenschaft. Die letzten von ihnen kehrten 1956 aus sibirischen Lagern heim. Mehr als 14 Millionen Deutsche verloren durch Flucht und Vertreibung ihre Heimat, zwei Millionen von ihnen das Leben.
Noch heute fühlen viele Deutsche beim Gedenken an das Kriegsende einen inneren Zweifel und Zwiespalt. War der 8. Mai ein Tag der Befreiung oder der Niederlage? In seiner Rede zum 40. Jahrestag der Kapitulation hat Bundespräsident Richard von Weizsäcker diese Frage in einer weithin akzeptierten Formel beantwortet: »Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem Menschen verachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Niemand wird um dieser Befreiung willen vergessen, welche schweren Leiden für viele Menschen mit dem 8. Mai erst begannen und danach folgten. Aber wir dürfen nicht im Ende des Krieges die Ursache für Flucht, Vertreibung und Unfreiheit sehen. Sie liegt vielmehr in seinem Anfang und im Beginn jener Gewaltherrschaft, die zum Krieg führte.« Der lange Weg zum 8. Mai 1945 begann am 30. Januar 1933.