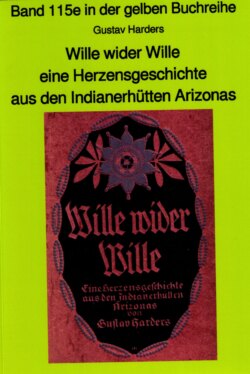Читать книгу Wille wider Wille - aus den Indianerhütten Arizonas - Band 115 in der gelben Buchreihe bei Jürgen Ruszkowski - Gustav Haders - Страница 6
Ein Zeitungsausschnitt
ОглавлениеSchon vor Tagesgrauen hatte Sims die sämtlichen großen Jungen aus den Betten geholt, und als er um acht Uhr zum Frühstück erschien, wo wir uns zuerst sahen, denn ich hatte lange geschlafen, konnte er mir berichten, dass die Fenster bereits wieder eingesetzt seien und dass in seinem Zimmer alles in alter Ordnung sei.
„Hast du keine Spur von den Tätern entdeckt?“ fragte ich.
„Nein“, sagte Sims, „du kannst gern laut reden, die Herren und Damen wissen bereits alle, was vorgefallen ist. Wir werden die Täter auch nicht entdecken können. Von uns Weißen hat niemand etwas gesehen, und von den Indianern würde niemand etwas sagen.“
Hiermit war die Sache erledigt.
Nur einer der anwesenden Herren, der „Disciplinarian“ der großen Knaben, sprach noch die Meinung aus, je weniger man aus der Sache mache, desto besser sei es. Man müsse bei den Jungen den Gedanken wecken, dass sie mit so etwas niemanden ärgern könnten, dann würden sie es weniger leicht wiederholen.
Am Abend, als Sims und ich wieder in meinem Zimmer zusammen waren, kam unser Gespräch auf Dohaschtida zurück. Die Art, in der ich über ihn redete, mochte wohl etwas übertrieben sein, und die Hoffnungen, die ich in Beziehung auf sein künftiges Verhalten laut werden ließ, etwas weitgehend erscheinen. In meiner schwärmerischen Schilderung verstieg ich mich dazu, zu behaupten, dass in Dohaschtida etwas von der Stärke des Mars und der Schönheit Apollos sei, dass er mich in seinem Wesen an die Härte eines Achilles und die Weichheit Hektors erinnere, und dass ich die feste Hoffnung habe, dass er, herausgerissen aus den Banden des Heidentums, eines Tages unter seinem Volke wirken würde wie der große Täufer in der Wüste, und die der andere Johannes, der an des Herrn Brust lag, den der Herr lieb hatte, und – und der den Herrn und die Menschen liebte.
Sims hörte mir beständig lächelnd zu. Schließlich sagte er, seine letzten Worte vom vorigen Abend fast wörtlich wiederholend: „Mensch, glaubst du wirklich, es sei möglich, mit einem Menschen, wie dieser Dohaschtida einer ist, etwas anzufangen? Niemals wird etwas aus ihm werden. Niemand, und auch du nicht, könnte den Willen dieses Mannes brechen. Aber so, wie er ist, so sind sie mehr oder weniger alle. Sie haben ihren Kopf darauf gesetzt, dem Weißen nicht zu Willen zu sein. Darum muss man sie zwingen.“
„Damit ist der Wille nicht gebrochen. Kennst du übrigens diesen Dohaschtida?“
„Nein, persönlich nicht. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, habe nur von ihm gehört. Wie du weißt, war ich Sonntag verhindert, der Andacht beizuwohnen, und war also nicht Zeuge seines auffallenden Benehmens in der Halle. Ich bin aber überzeugt, dass dein Bekannter ein junger Indianer mit Namen Percy Sottan ist. Percy Sottan ist der Name, den er in der Schule erhalten hat. Du siehst schon seine Feindschaft wider alles, was von uns kommt, aus dem Umstande, dass er dir nicht diesen, sondern seinen Indianernamen Dohaschtida nannte. Percy ist vor etlichen Monaten von einer höheren Indianerschule in Neu Mexiko hierher zurückgekehrt. Er ist 500 Meilen zu Fuß gegangen, obwohl der Schulsuperintendent ihm eine Eisenbahnfahrkarte gekauft und eingehändigt hatte. Ich muss dir das vorlesen. Es stand etwas darüber in einer Zeitung. Ich habe den Artikel ausgeschnitten.“
Sims stand auf und holte ein Buch, in das er Zeitungsausschnitte eingeklebt hatte. Nach kurzem Suchen und Blättern sagte er: „Hier habe ich es schon.“ Und er las: Albuquerque, Neu Mexiko. Januar 19.. Passagiere eines der hier durchlaufenden Züge erzählten in der Vorhalle des Bahnhofshotels während der einstündigen Wartezeit, die sie daselbst verbrachten, folgende interessante Begebenheit, die ein grelles Licht auf den noch immer ungebrochenen Stolz und Dünkel unserer heutigen Indianer wirft. Ein junger hochgewachsener Indianer trat in den Zug und setzte sich. Der Kondukteur kam zu ihm und bat ihn um seine Fahrkarte, Der Indianer reichte ihm dieselbe. Der Kondukteur machte mit seiner Zange die ordnungsmäßigen Löcher in die Fahrkarte und gab sie dem Indianer zurück. Die Karte musste noch durch die Hände anderer Kondukteure gehen, bevor der Indianer an sein Reiseziel kam, und musste erst in der Hand des letzten Kondukteurs bleiben. Hierauf wollte der Kondukteur dem Indianer einen kleinen farbigen Pappstreifen unter das Band seines Hutes schieben. Jeder Reisende weiß, dass dies allgemeine Sitte ist. Der Kondukteur weiß an der Farbe dieses Streifens, wie weit der Reisende fährt, und kann ihn aufmerksam machen, wenn sein Aussteige-Platz naht. Außerdem weiß er, wenn immer neue Reisende in den Wagen einsteigen, wen er bereits nach seiner Fahrkarte gefragt hat, und braucht niemanden zum zweiten Male belästigen. Diese kleine Karte hat alle ihre guten Eigenschaften. Sie hat dieselben für den Kondukteur sowohl wie für den Reisenden. Als nun der Kondukteur dem Indianer diese Karte an den Hut stecken wollte, sprang der Indianer auf und schrie den Kondukteur an: ‚Wer gibt dir ein Recht, mich anzufassen! Ich bin der alleinige Herr meines Körpers und alles dessen, was an demselben ist!‘
In aller Ruhe setzte der Kondukteur dem Indianer auseinander, um was es sich handele und bat ihn dann, sich die Karte selber an den Hut zu stecken. ‚Ich bin ein Mensch‘, sagte der Indianer. Ich bin keine Kuh. Ich bin kein Pferd. Kühe werden gebrandmarkt. Menschen werden nicht gebrandmarkt. Ich werde die Karte nicht an meinen Hut stecken.‘ Er sprach nicht ohne Erregung.
In beschwichtigendem Tone entgegnete der Kondukteur, der Indianer solle sich doch in die allgemeine Sitte fügen. Es sei Anordnung der Bahngesellschaft, dass solche Karten gegeben würden, und dann setzte er hinzu: ‚Sieh doch, alle Leute hier in diesem Wagen tragen solche Karten.“
‚Bah,‘ sagte der Indianer, ‚lauter Bleichgesichter und Mexikaner. Was gehen die mich an. Ich will den Papierfetzen nicht an meinem Leibe.‘ Er riss dem Kondukteur das kleine rote Stück Pappe aus der Hand, zerriss es und warf dem Manne die Stücke vor die Füße. Dann zog er seine Fahrkarte aus der Tasche, zerriss auch die und warf die Fetzen dahin, wo die anderen lagen.
‚Ich werde nicht fahren‘, sagte er, ich werde zu Fuß nach Hause gehen. Lass den Zug halten. Ich habe keine Fahrkarte!‘ kommandierte er.
‚Wie du willst!‘ sagte der Kondukteur, der verärgert war. Er zog die Notleine. Von der Lokomotive her kam mit dreimaligem Pfeifen die Antwort. Die Fahrgeschwindigkeit des Zuges ließ nach. Bald hielt der Zug, und der Indianer verließ den Wagen, ohne irgendeinen der Insassen eines Blickes zu würdigen. Es war mitten in der Wüste von Neu Mexiko. Der Konduteur erzählte, dass das Reiseziel des Indianers, wie seine Fahrkarte gezeigt habe, im äußersten Westen Arizonas liege. Der Mann habe an 400 Meilen zurückzulegen, wenn er zu Fuß gehen wolle.“
Soweit der Zeitungsbericht.
Der Artikel schloss mit der Bemerkung der Redaktion, dass die Indianer sehr gute Fußgänger seien, und dass der Weg dem jungen Manne nicht zu weit und nicht zu lästig geworden sein werde. Das Bewusstsein, den verhassten Weißen mitsamt der Eisenbahngesellschaft einen Hieb versetzt zu haben, den sie in gewisser Hinsicht verdiene, habe ihn über alle Beschwerden des langen Wanderns hinweggeholfen. Dieses Dekorieren der Reisenden mit den bunten Pappstreifen, was der Indianer brandmarken nannte, sei etwas Unschickliches, und man müsse sich über das reisende Publikum wundern, dass es sich geduldig so etwas gefallen lasse.
Sims klappte sein Buch zu und sah mich fragend an.
„Sicherlich hast du recht“, entgegnete ich, „das war Dohaschtida, oder wie er mit seinem Schulnamen heißt, Percy Sottan. So etwas! Eine Fahrkarte haben und zu Fuß gehen! Und Geld muss er auch haben. Du hättest die eleganten Kleider sehen sollen, die er am Sonntagvormittag trug.“
„Wird er nicht lange tragen“, meinte Sims, „noch ein paar Monate weiter, und er wird sich von den übrigen Indianern wenig in seinem Äußeren unterscheiden. Er wird genau werden wie die anderen. So geht es mit allen, die aus den hohen Schulen zurückkehren.“
„Das glaube ich auch“, sagte ich, „der Zwang ändert nichts. Seine Wirkung hält nur so lange an, wie er da ist. Fällt der Zwang hin, so fällt alles mit ihm, was ein Resultat seines Waltens war.“
„Aber was willst du denn machen?“ fragte Sims geärgert.
„Man muss warten, man muss ihnen Zeit lassen. Man muss sie nicht zwingen. Es hat eine Zeit gegeben, da unsere Väter in demselben Zustande sich befanden wie die heutigen Indianer. Es ist nicht über Nacht gekommen, dass wir ein Leben wie unser heutiges dem von damals vorziehen.“
„Das ist richtig“, sagte Sims, „aber wo in aller Weltgeschichte hat man sich so viele Mühe gegeben, so viele ungezählte Millionen geopfert, solche wohldurchdachte, systematische Arbeit getan, um ein Volk zu zivilisieren, wie unsere Regierung das seit Jahren mit den Indianern tut? Es liegt am Indianer, dass alles vergeblich zu sein scheint. Er will nicht und muss gezwungen werden.“
Ich erlaubte mir zu widersprechen. „So etwas ist freilich noch nicht dagewesen!“ sagte ich. „Es wäre besser,, die Herren in Washington hätten ein wenig Weltgeschichte und Kirchengeschichte im Besonderen studiert, ehe sie den Plan fassten, mit einer organisierten Armee von dressierten Damen und Herren, ohne Religion, ein Volk, wie die Indianer, zu zivilisierten Amerikanern zu machen. Zivilisation lässt sich nicht erzwingen, die kommt und entwickelt sich von selbst, langsam und durch Beispiel und Gewöhnung. Will man zwingen, so bäumen sich mit Recht die gestern Abend von dir genannten menschlichen Eigenschaften: Selbstgefühl, Selbstsucht, und ich setze hinzu Selbstachtung, gegen solches Zwangsverfahren auf.“
„Du bist ein Idealist!“ sagte Sims.
„Erlaube mir, dass ich widerspreche. Der Idealismus läge auf deiner Seite, vorausgesetzt, dass du, was mir aber nicht der Fall zu sein scheint, die Hoffnungen Washingtons auf einen Erfolg solcher Arbeit teilen würdest.“
„Worauf gründest du deine Ansicht?“
„Auf einige deiner gestrigen Auslassungen.“
„Die darfst du jetzt nicht in Betracht ziehen. Ich rede jetzt vom Zivilisieren und nicht vom Christianisieren.“
„Hier liegt eben der ganze Fehler. Man muss erst christianisieren, und dann kommt die sogenannte Zivilisation ganz von selbst. Dies lehrt die Geschichte aller Völker.“
„Unsere Regierung hat aber nicht ohne Erfolg gearbeitet. Wir haben eine Reihe von zivilisierten Indianerstämmen.“
„Durch die Arbeit der Regierung?“
„Ja.“
„Da bist du im Irrtum. Wo immer ein zivilisierter Indianerstamm ist, da hat die Kirche Mission getrieben. Die Missionsarbeit hat Christen gemacht. Das Christentum hat solche hat solche Indianer zu zivilisierten Menschen umgewandelt. Die Regierung schreibt sich Erfolge zu, die gar nicht auf ihre Rechnung kommen. Jene Indianer wären heute wahrscheinlich genau so weit, wenn die Regierung gar nicht und die Kirche allein gearbeitet hätte; und sie wären sicherlich heute genauso weit zurück, noch ebenso unzivilisiert wie diese deine Indianer hier, wenn die Regierung allein gearbeitet hätte.“
„Du hältst also unsere Arbeit für zwecklos?“
„In gewissem Sinne ja. Ich meine auch, ein Mann wie du sollte mir beistimmen. Du solltest die Nutzlosigkeit der Regierungsarbeit ohne Missionshilfe zugeben.“
„Dazu bin ich denn doch nicht ohne weiteres bereit!“ sagte Sims. „Warum meist du denn, dass ich arbeite?“
„Weil du einen guten Verdienst hast.“
„Du redest sehr offen.“
„Willst du, dass ich anders rede?“
„Nein. Aber um auf die Sache zurückzukommen. Nimm z. B. deinen Dohaschtida. An diesem haben ohne Zweifel während seines Aufenthalts auf der höheren Schule Dutzende von Pastoren ihr Heil versucht. Alle ohne Erfolg. Dohaschtida ist mit ungebrochenem Willen in das Land seiner Väter zurückgekehrt.“
„Ich habe mich vorhin nicht ganz richtig ausgedrückt. Ich sprach von Missionshilfe. Ich hätte sagen sollen: Predigt des Evangeliums. Diese Predigt ist hier in unserem Lande, wie überhaupt in der Welt, sehr rar. Die rechte Predigt des Evangeliums gibt dem Menschen etwas, hat weiter nichts im Sinn, als das Menschenherz geschickt zum Nehmen zu machen. Viele Prediger aber machen, wenn es hoch kommt, das Evangelium zur Grundlage für gesetzliche Forderungen; andere aber, was schlimmer ist, benutzen es zu fadem, leidigem Moralisieren. Beides, das letztere noch mehr als das erstere, ist absolut kraftlos, den inneren Menschen, wie du dich zuvor ausdrücktest, zu erneuern. Das wahre Evangelium ist eine Kraft Gottes, aber nur das wahre, und als solches allmächtig.“
„Könntest du mir mit wenigen Worten den Inhalt des wahren Evangeliums nennen?“
„Gewiss.“
„Und der wäre?“
„Dir sind deine Sünden vergeben.“
„Sind vergeben? Sind?“ fragte Sims sinnend.
„Ja. Sind vergeben. Nicht: werden vergeben. Sie sind vergeben. Sobald du den Akt der göttlichen Sündenvergebung für die Gesamtheit der Menschen sowohl, wie für jedes einzelne Individuum, von irgendwelchem menschlichen Tun oder Verhalten abhängig machst, oder aus der Vergangenheit, wo er liegt, in die Gegenwärt oder Zukunft versetzest, so hast du die Herrlichkeit des Evangeliums zerstört und seine Kraft und Gnade vernichtet,“
„Ich muss gestehen“, sagte Sims, was du da aussprichst, ist mir neu; aber ich muss sagen, es heimelt mich an, obwohl ich dich nicht voll verstehe. Ich will dich weiter hören.“
„Aber heute nicht mehr“, sagte ich, „es ist spät geworden. Wir wollen uns zur Ruhe begeben.“
Wir schüttelten uns herzlich die Hände, und ich verließ das Haus des Herrn Superintendenten, um nach meinem ganz am entgegengesetzten Ende des Schuleigentums gelegenen Wohnplatzes hinüberzugehen.
Es war heller Mondschein und alles öde uns still. Es war um Mitternacht herum. Als ich mich dem Schlafgebäude der Mädchen näherte, an dem mein Weg mich vorbeiführte, näherte, sah ich eine hohe Mädchengestalt in der Kleidung der Schülerinnen, ein Indianermädchen, leichtfüßig über die breite Veranda des Hauses laufen. Das Mädchen eilte die Treppe hinab und lief geradeswegs über den weiten Rasen dem Zaune zu. Behände kletterte es an dem mit Stacheln versehenen Gitterwerk in die Höhe, schwang sich über den, den etwa zehn Fuß hohen Zaun oben abschließenden Querbalken, sprang auf den Erdboden und lief in größter Eile in die Wüste hinein, wo sie bald meinen Augen zwischen Kaktusstauden und dem Wüstengestrüpp verschwunden war.
Eine Ausreißerin!
Sollte ich zurückgehen und Sims benachrichtigen?
Nein, ich war hier kein Polizist.
* * *